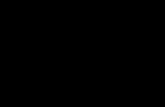Stieber Freiheit Markt
-
Upload
noel-coria -
Category
Documents
-
view
5 -
download
2
description
Transcript of Stieber Freiheit Markt
-
www.zeitschrift-humanwirtschaft.de - 05/20088
Im Mai 2008 haben sich in St. Gallen Fachleute aus Wirt-schaft, Politik und Gesellschaft mit 200 ausgewhlten Studenten aus ber dreiig Lndern zu einem Dialog der Generationen getroffen. Das Thema: Globaler Kapitalismus lokale Werte. Der Gewinner eines studentischen Aufsatz-wettbewerbs, Christoph Paret, ein 22-jhriger Student der Philosophie, Psychologie und Geschichte in Tbingen kommt nach seinem mit groem Beifall bedachten Vortrag seiner Thesen zu folgendem Schluss: Das bleibende Problem des freien Marktes besteht darin, dass er der Moral bedarf, die er aber gleichzeitig unablssig untergrbt. ( ... ) Die Zukunft des Kapitalismus wird sich daran entscheiden, wie klug man mit diesem Widerspruch umzugehen weiss.
Dem lsst sich wenig entgegenhalten. Aber, was ist hier klug? Es findet sich rascher eine Antwort auf die Frage, wel-che Manahmen, diesen Widerspruch aufzulsen, nicht klug wren. Das ist in erster Linie eine fundamentale Globalisie-rungs- und Systemkritik. Unklug und wirkungslos sind sicher auch Moralpredigten. Auch der allgemeine Appell an die Vernunft hilft heute (fast) so wenig, wie vor der Aufklrung. Und mit jeder Forderung nach Umverteilung und nach ein-seitigen staatlichen Eingriffen findet man sich rasch in der belchelten Ecke der Neiddebattierer. Auch das von der Poli-tik in schwierigen Situationen gerne praktizierte geschftige Nichtstun wird keinen Erfolg haben. Und die Hoffnung, der Markt knnte die Fehlentwicklungen selbst bereinigen, ist unbegrndet.
Einige Gedanken zu den Entwicklungen insbesondere auf den Finanzmrkten
Sind die Erscheinungen und Vorgnge auf den weltweiten Mrkten Ausdruck quasi naturgesetzlich wirkender Krfte, vergleichbar der Thermodynamik? Oder ist der Markt in Wirklichkeit The God that failed? Der Schutz von Freiheit und Eigentum werden vom Grundgesetz garantiert. Anscheinend gibt es Ausnahmen.
Wie frei drfen Mrkte sein?
Von Anselm Stieber
WIE FREI DRFEN MRKTE SEIN?
-
www.zeitschrift-humanwirtschaft.de - 05/2008 9
Dass offensichtlich Handlungsbedarf besteht, beweist ein kurzer Bericht in der NZZ vom 31. Mai/1. Juni. Die fr die berwachung der Rohwaren-Futuresmrkte in den USA zustndige Commodity Futures Trading Commission (CFTC) habe erklrt, heit es dort, dass seit Dezember (!) eine mehrspurige detaillierte Untersuchung der Handelsaktivi-tten im Erdlsektor im Gange sei. Die Bekanntgabe solcher Vorgnge ist unblich. Sie erfolgen sonst diskret. Die Situa-tion muss ein kritisches Stadium erreicht haben, da die CFTC mit der britischen Financial Services Authority (FSA) und mit dem in London aktiven Brsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE), wieder nach der NZZ zitiert, ein Abkommen ber intensivierten Datenaustausch getroffen habe; zudem soll auch der dortige Handel strker auf allfllige Missbru-che und Unregelmigkeiten berprft werden. Was ber-prft wird und mit welchen Konsequenzen, wird nicht ver-lautbart. Der Eindruck drfte nicht ganz falsch sein, dass hier der Bock den Grtner spielt. Auch das war noch nie eine kluge Aufgabenverteilung.
Was ist kluges Umgehen mit diesem Problem? Der Hin-weis auf allgemeinverbindliche Rechtsnormen und auf demokratisch legitimierte, anerkannte Prfinstanzen knnte ein Weg sein. Die rechtsprechende Gewalt und die sie aus-benden Institutionen bilden ein sowohl politisch als auch wirtschaftlich unabhngiges Ordnungssystem. Es hat dafr Sorge zu tragen, dass Verste gegen geltendes Recht geahndet werden und Rechtsverletzungen unterbleiben.
In diesem Zusammenhang spielt eine zentrale Rolle, dass der Staat mit dem Schutz der Freiheit des Individuums gegen-ber seinen Brgern eine fundamentale Rechtspflicht wahrzu-nehmen hat. Dieses Menschenrecht ist ein sog. Abwehrrecht. Es garantiert nicht nur Schutz vor Gewalt gegen die Person, sondern ebenso Schutz vor bergriffen auf deren Eigentum, nicht zuletzt auch vor Eingriffen des Staates selbst.
Ausgehend von John Locke und der amerikanischen Bill of Rights bis zum Nobelpreistrger Friedrich August von Hayek gehren Freiheitsrechte und Eigentumsrechte zusam-men. Sie bilden das Fundament unserer Grundrechte. In Art. 14 unseres Grundgesetzes steht ausdrcklich, dass Eigen-tum gewhrleistet wird. In Abs. 2 heit es: Eigentum ver-pflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen. Und in Abs. 3.: Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulssig. .... Dieser Gedanke findet sich auch in Artikel 17, Abs. 2 der Allgemeinen Erkl-rung der Menschenrechte, also in einem nahezu weltweit anerkannten System von Rechtsnormen: Niemand darf will-krlich seines Eigentums beraubt werden.
Niemand darf willkrlich seines Eigentums beraubt wer-den!? Willkrlich heit, ohne gesetzliche Grundlage. Werden wir beraubt? Werden die Eigentumsrechte geschtzt? Wird Eigentum zum Wohle der Allgemeinheit verwendet? Wohl-gemerkt, das Eigentum geniet hchsten grundgesetzlichen Schutz, nicht seine Verwendung. Dazu drei Beispiele:
. Willkrliche Enteignung durch Konditionen der Kreditvergabe
Hier ist vorauszuschicken, dass jeder heute in seinen Rech-ten durch Besteuerung seiner Einknfte beeintrchtigt wird. Das ist allerdings im Hinblick auf die sog. Anspruchsrechte des Individuums gegenber dem Staat Infrastruktur, medi-zinische Versorgung, Bildung, Kultur etc. positiv zu disku-tieren. Menschenrechtsverletzend ist ein ganz anderer Vor-gang. Wir haben generell ein fr nachhaltiges Wirtschaften ungesundes, falsche Anreize setzendes Kreditwesen. Dazu drngen exponentiell wachsende Kapitalvermgen mit den Banken auf die Finanzmrkte. Deren Arbeit besteht in der Suche nach lukrativen Geldanlagen, Krediten und Beteili-gungen mit hohen Renditen. Aus verlsslicher Quelle kann man erfahren, dass generell in allen Konsumgterpreisen die Zinsen fr Fremdkapital heute schon mit bis zu 40% des Endpreises zu Buche schlagen.
Gravierend werden die Brger in ihren Rechten dadurch verletzt, dass sie einen um 40% berhhten Preis fr alle Gter bezahlen mssen, nur um den Forderungen des Kapi-tals auf leistungsloses und nahezu unbegrenztes Einkom-men zu entsprechen. Das ist willkrliche Enteignung und damit ein Versto gegen das Grundrecht auf Eigentum. Nie-mand darf willkrlich seines Eigentums beraubt werden: versumt die Judikative ihre Pflicht zur Prfung, ob Eigen-tum tatschlich gewhrleistet ist? Eine auf Rechtsgrundst-zen aufgebaute Gesellschaft msste diese Frage ohne Vor-behalte klren. >
WIE FREI DRFEN MRKTE SEIN?
-
www.zeitschrift-humanwirtschaft.de - 05/20080
schenwrdige Standards fr die abhngige Beschftigung von Menschen weitgehend unbestritten gltig sind.
Die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre hat aller-dings die Durchsetzbarkeit des Arbeitsrechts immer weiter eingeschrnkt. Und zu Beginn des 21. Jahrhunderts ms-sen wir erkennen, dass hufig nicht mehr der Arbeitgeber in seiner klassischen Ausprgung als langfristig planender, seiner Verantwortung bewusster Unternehmer entschei-det. Der moderne Arbeitgeber tritt im Gewand des an kurz-fristigen Gewinnen interessierten Geldgebers auf und er dik-tiert, ob Stellen abgebaut, Arbeitspltze verlagert oder Fir-men geschlossen werden (s. Nokia).
Sharehoulders Value, das heit oft bizarre Gewinnerwar-tungen in der Hhe zweistelliger Prozentstze, bestimmt die Entscheidungen des Managements. Diesen Effekt verstrken meist unbekannte Finanzinvestoren, wie z.B. Private Equity Gesellschaften, die Aktienmehrheiten lukrativer Unterneh-men erwerben (s. Permira Hugo Boss), hufig wieder mit Hilfe von Finanzkrediten. Sie ziehen das Eigenkapital aus dem Unternehmen ab und zwingen es, sich bis an die Gren-zen zu verschulden. Die Zinslast steigt drastisch. Am Markt behaupten wird sich das Unternehmen nur, wenn es z.B. Per-sonalkosten einspart. Die dafr geeigneten Mechanismen sind bekannt. Das sind dann jedoch sog. betriebsbedingte Fakten, gegen die das Arbeitsrecht wirkungslos ist.
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Mit dem Verkauf von Fir-menanteilen oder ganzen Firmen, der weder den Kunden, noch den Mitarbeitern, noch der gesunden, langfristigen Ent-wicklung des betroffenen Unternehmens selbst dient, son-dern einseitig nur den Interessen von Finanzinvestoren ent-spricht, wird mglicherweise ebenfalls geltendes Recht ver-letzt. Die Lsung wre eine zeitgeme Weiterentwicklung der Idee des Arbeitsrechts in der Form, dass eine rechtlich klare Einbindung von Boden und Kapital in die Mitverant-wortung fr Arbeitnehmer erfolgt. Das wre ein wesentlicher Beitrag zur Strkung einer Unternehmenspolitik im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens am Standort. Manahmen zur Anpassung an wirtschaftliche Entwicklungen, die betriebs-wirtschaftlich notwendig sind, wrden dadurch keineswegs verhindert.
Groe Teile der Weltwirtschaft haben sich von den Men-schen und ihren konkreten Bedrfnissen emanzipiert. Diese Bereiche haben und verfolgen ihre eigenen Ziele. Das wird Konsequenzen haben: die Begnstigung von Wenigen auf Kosten von Vielen wird das Vertrauen in die Marktwirtschaft erschttern. Das gefhrdet den gesellschaftlichen Konsens ber unsere Wirtschaftsform und damit unseren Staat unmit-telbar. Fragt man sich, was denn die Ursache sein knnte,
. Willkrliche Enteignung durch Missbrauch freier Mrkte
Einen zweiten, offensichtlichen Versto gegen geltendes Recht haben Vorgnge zur Folge, die uns alle tglich in Mit-leidenschaft ziehen. Finanzinvestoren und Groanleger wie Hedge Fonds, Versicherungen, Staatsfonds spekulieren in groem Umfang z.B. mit lmengen, die erst in der Zukunft gefrdert werden.
Zur Zeit umfasst das spekulative Handelsvolumen ca. das 15-fache des realen Bedarfs. Das Gleiche geschieht mit Agrar-produkten wie Reis, Mais und Sojabohnen. Diese Wertpa-piere (futures), an Terminbrsen gehandelt, bewirken nichts anderes, als eine knstlich berhhte Nachfrage mit der Folge, dass die Preise steigen. Die Umstze dieser Luftnum-mern sind exorbitant. Das an Terminbrsen angelegte Geld ist entweder bereits durch hnliche Spekulationsgewinne entstanden, oder es wird ber Kredite bereitgestellt. Knst-liche Verknappung, knstliche Preissteigerungen, knstlich aufgeblhte Geldmengen lassen die Kapitalblase am Finanz-markt kontinuierlich anschwellen, erhhen Kreditrisiken und bringen das gesamte internationale Finanzsystem und damit die wirtschaftliche Entwicklung in Gefahr. Das kann man nicht als finanzmarkttechnisches Problem abtun.
Dass wir bei der Deckung unseres Bedarfs an l oder Agrarprodukten fr knftige Gewinne skrupelloser Speku-lanten bezahlen, denen die ausreichende und preiswerte Ver-sorgung der Menschen mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln gleichgltig ist, das ist nicht nur ein Versto gegen die Forde-rung der sozialvertrglichen Verwendung des Eigentums. Hier wird diese humane Forderung am Beispiel der rmsten Men-schen in ihr Gegenteil verkehrt. Wem Grundrechte und Markt-wirtschaft etwas bedeuten, muss ein unmittelbares Interesse daran haben, dass dieser Missbrauch der Freiheit liberaler Mrkte weltweit in rechtliche Schranken gewiesen wird. Die Marktwirtschaft braucht zur Versorgung der Menschen mit Gtern und Dienstleistungen weder Terminbrsen noch Kre-dite, die spekulativ und mit Hebelwirkung (Leverage) ein-gesetzt werden auch nicht die globale. Bei einer objek-tiven Abwgung der Rechtsgter ist das Recht auf Schutz des Eigentums hher zu bewerten, als das Recht auf Spekulati-onsgewinne. Ein Grundsatzurteil hierzu ist berfllig.
. Willkrliche Enteignung durch falsche Ziele bei Firmenbernahmen
Von den drei Produktionsfaktoren Boden / Kapital / Arbeit ist der dritte auf demokratischem Wege durch ein weit entwi-ckeltes und detailliertes Arbeitsrecht gezhmt worden. Die Wirkung der Menschenrechte und ihre Ausstrahlung haben in der Form des Arbeitsrechts dafr gesorgt, dass heute men-
WIE FREI DRFEN MRKTE SEIN?
-
www.zeitschrift-humanwirtschaft.de - 05/2008
die den Trend zu extrem kurzfristiger Gewinnmaximierung, zu ebenso extremen Renditeerwartungen, oder zu unge-niertem Spekulantentum ausgelst hat, ist man ratlos. Sollte es ein Angstsyndrom sein? Angst vor einer selbst verschul-deten dsteren Zukunft? Oder nur das hemmungslose Aus-nutzen der Schwche der Politik?
Wie gesagt, es wre unklug, partielle Eingriffe und Regu-lierungen von Staatsseite vorzunehmen. Klger wre es, wenn juristische Experten einschlgiger Einrichtungen objek-tiv nach den Kriterien des geltendes Rechts prfen, ob das System der Kreditvergabe und der Verzinsung
generell, ob die Spekulation auf knftige Preisentwicklung von Roh-
stoffen und Grundnahrungsmitteln, ob die Vergabe von Krediten fr Spekulationsgeschfte, ob Unternehmensbergnge und Beteiligungen ohne
Rcksicht auf die Produktionsfaktoren Arbeit, Boden undKapital,
als rechtskonform gelten knnen und nicht in letzter Kon-sequenz den Tatbestand der willkrlichen Enteignung erfl-len. Sollte es so sein, dann wre eine Besttigung durch hchstrichterliche Urteile die notwendige Folge. Wie beim Diebstahl ist das Gesetz dazu geschaffen, den Geschdigten zu schtzen, nicht den Dieb.
Unter diesem Gesichtspunkt ist das Pldoyer fr die verbindliche juristische Prfung der oben genannten Tat-bestnde auf Verletzung von Grundrechten wohl begrn-det. Es geht letztlich darum, den Missbrauch groer Kapi-talvermgen durch ihre Eigentmer zu verhindern. Eine heilsame Folge wre die Wiedereinsetzung des Geldes in seine ursprngliche Funktion als Wertquivalent zur realen Welt der Gter und Dienstleistungen. Hierfr die Vorausset-zungen zu schaffen, knnte fr Juristen und fr Wirtschafts-wissenschaftler eine hoch verdienstvolle Aufgabe sein. Und eine Bekrftigung der Lebensfhigkeit der Demokratie. Wie frei drfen unsere Mrkte sein? Wir wissen es lngst. So frei, wie es die Rechtsordnung der Gesellschaft erlaubt, in der wir leben. Wilhelm Rpke (1899-1966), der groe National-konom hat das Problem folgendermaen beschrieben: Es war ein katastrophaler Fehler, die Marktwirtschaft als etwas Autonomes, ( ...) wahrzunehmen, und ( ... ) die entschei-dende Bedeutung eines den Prinzipien der Marktwirtschaft angemessenen ethisch-rechtlichinstitutionellen Rahmens zu bersehen. Vor Jahren ein alter Professor und heute ein jun-ger Hoffnungstrger kommen bei der Beurteilung der Frage, wie frei Mrkte sein drfen, praktisch zum gleichen Ergebnis. Wann fangen wir an, mit dem marktinhrenten Widerspruch klug umzugehen? Den ethisch-rechtlich-institutionellen Rah-men haben wir: Unser Grundgesetz.
Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus/Kommunismus herrscht in weiten Kreisen die Meinung vor, zum bestehen-den System des Kapitalismus gebe es keine Alternative und man msse die Schnheitsfehler, die da sind: Arbeitslo-sigkeit, Inflation, Verschuldung, Krieg, Umweltschden und der Hunger in der sogenannten Dritten Welt, hinnehmen wenn auch hufig zhneknirschend.
Diese verstndliche Resignation verfliegt sehr schnell, wenn man mit der Natrlichen Wirtschaftsordnung, wie sie in der Zeitschrift HUMANWIRTSCHAFT dargestellt wird, in Berhrung kommt. Endlich erscheint hier ein Lichtblick, der Aussicht auf eine bessere Welt verheit. Keine paradie-sischen Zustnde werden vorgegaukelt, sondern es wird eine Leistungsgesellschaft vorgestellt, die das Prinzip der Gegenseitigkeit zur Grundlage hat. Die Marktwirtschaft verdient endlich ihren Namen und soziale Gerechtigkeit ist kein Schlagwort mehr. Der Abbau der Brokratie wird ein-geleitet und die Grundlage fr eine Friedensordnung gelegt.
All das basiert auf zwei grundlegenden Reformen des Geld- und Bodenrechts; ein Geld, das befreit wird vom Verzinsungszwang und ein Bodenrecht, das keine Spekula-tionsmglichkeiten kennt.
Diese Idee der Natrlichen Wirtschaftsordnung erfhrt zur Zeit eine Renaissance. Wirtschaftszeitschriften nehmen sich des Themas an, und religis orientierte Menschen entdecken die bereinstimmung mit ihren Glaubensstzen. Umweltschtzer und Friedensfreunde erweitern ihre Arbeit durch die Kenntnisse um die Natrliche Wirtschaftsord-nung. Gedanken der Hoffnung berall.
Wenn Sie das vorliegende Heft durchgelesen haben glauben wir, wird auch bei Ihnen der Wunsch aufkeimen, die Freiwirtschaftstheorie, die Natrliche Wirtschafts-ordnung, nher kennenzulernen. Unser umfangreiches Bcherangebot bietet dazu viele Gelegenheiten.
W. Schmlling
Gedanken der Hoffnung