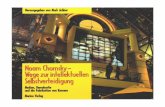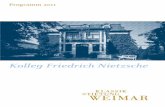Suhrkamp Verlag - bilder.buecher.de · In den späten sechziger Jahren nahm Giorgio Agamben an...
Transcript of Suhrkamp Verlag - bilder.buecher.de · In den späten sechziger Jahren nahm Giorgio Agamben an...
Leseprobe
Agamben, Giorgio
Der Mensch ohne Inhalt
Aus dem Italienischen von Anton Schütz
© Suhrkamp Verlag
edition suhrkamp 2625
978-3-518-12625-7
Suhrkamp Verlag
In den späten sechziger Jahren nahm Giorgio Agamben an Martin Hei-deggers Seminaren im südfranzösischen Le Thor teil. Damals entstandauch sein erstes Buch L’uomo senza contenuto, das 1970 erschien. Selbst-bewußt und radikal stürzt er sich auf klassische Positionen der Ästhetik,er konfrontiert Platon, Kant und Hegel mit Künstlern und Autoren derKlassischen Moderne. In einer Zeit, in der die Kunst nicht länger dieFunktion hat, das Wesen der Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen,wird sie zu einer selbstzerstörerischen Kraft, der Künstler, so Agamben,zu einem »Menschen ohne Inhalt«. Agambens erstes Buch liegt nun end-lich auch auf deutsch vor.
Giorgio Agamben, geboren 1942, lehrt Philosophie an der UniversitätVenedig. In der edition suhrkamp liegen vor: Homo sacer. Die souveräneMacht und das nackte Leben (Homo sacer I, es 2068), Was von Auschwitzbleibt. Das Archiv und der Zeuge (Homo sacer III, es 2300), Ausnahme-zustand (Homo sacer II.1, es 2366), Das Offene. Der Mensch und das Tier(es 2441), Profanierungen (es 2407), Die Zeit, die bleibt. Ein Kommentarzum Römerbrief (es 2453), Die Sprache und der Tod (es 2468), Signaturarerum. Über die Methode (es 2585), Herrschaft und Herrlichkeit. Zurtheologischen Genealogie von Ökonomie und Regierung (Homo sacerII.2, es 2520). Das Sakrament der Sprache. Eine Archäologie des Eides(Homo sacer II.3, es 2606).
Die italienische Originalausgabe erschien 1970 unter dem TitelL’uomo senza contenuto im Verlag Rizzoli (Mailand).
edition suhrkamp 2625Erste Auflage 2012© Giorgio Agamben 1970© der deutschen AusgabeSuhrkamp Verlag BerlinDeutsche ErstausgabeAlle Rechte vorbehalten, insbesondere das desöffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durchRundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,vervielfältigt oder verbreitet werden.Satz: TypoForum GmbH, SeelbachDruck: Druckhaus Nomos, SinzheimUmschlag gestaltet nach einem Konzeptvon Willy Fleckhaus: Rolf StaudtPrinted in GermanyISBN 978-3-518-12625-7
1 2 3 4 5 6 – 17 16 15 14 13 12
Inhalt
§ 1 Was das Unheimlichste ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 2 Frenhofer und sein Doppelgänger . . . . . . . . . . . . . . . 16
§ 3 Der Mensch von Geschmack und die Dialektikder Zerrissenheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§ 4 Die Wunderkammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
§ 5 »Die Urteile über die Dichtkunst sind wertvollerals die Dichtkunst selbst« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
§ 6 Ein sich selbst vernichtendes Nichts . . . . . . . . . . . . . 70
§ 7 Die Entbehrung ist wie ein Gesicht . . . . . . . . . . . . . . 79
§ 8 Poiesis und Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
§ 9 Die ursprüngliche Struktur des Kunstwerks . . . . . . . 125
§ 10 Der Engel der Melancholie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
§ 1 Was das Unheimlichste ist
In seiner dritten Abhandlung Zur Genealogie der Moral unter-zieht Nietzsche Kants Definition des Schönen als interesse-loses Wohlgefallen einer radikalen Kritik. Kant, schreibt er,
»gedachte der Kunst eine Ehre zu erweisen, als er unter den Prädikatendes Schönen diejenigen bevorzugte und in den Vordergrund stellte, wel-che die Ehre der Erkenntnis ausmachen: Unpersönlichkeit und Allge-meingültigkeit. Ob dies nicht in der Hauptsache ein Fehlgriff war, isthier nicht am Orte zu verhandeln; was ich allein unterstreichen will, ist,dass Kant, gleich allen Philosophen, statt von den Erfahrungen desKünstlers (des Schaffenden) aus das ästhetische Problem zu visiren,allein vom ›Zuschauer‹ aus über die Kunst und das Schöne nachgedachtund dabei unvermerkt den ›Zuschauer‹ selber in den Begriff ›schön‹ hin-ein bekommen hat. Wäre aber wenigstens nur dieser ›Zuschauer‹ denPhilosophen des Schönen ausreichend bekannt gewesen! – nämlich alseine grosse p e r s ö n l i c h e Thatsache und Erfahrung, als eine Fülleeigenster starker Erlebnisse, Begierden, Überraschungen, Entzückungenauf dem Gebiete des Schönen! Aber das Gegentheil war, wie ich fürchte,immer der Fall: und so bekommen wir denn von ihnen gleich von Anfangan Definitionen, in denen, wie in jener berühmten Definition, die Kantvom Schönen giebt, der Mangel an feinerer Selbst-Erfahrung in Gestalteines dicken Wurms von Grundirrthum sitzt. ›Schön ist, hat Kant gesagt,was o h n e I n t e r e s s e gefällt.‹ Ohne Interesse! Man vergleiche mitdieser Definition jene andre, die ein wirklicher ›Zuschauer‹ und Artistgemacht hat – Stendhal, der das Schöne einmal une promesse de bon-heur nennt. Hier ist jedenfalls gerade Das a b g e l e h n t und ausgestri-chen, was Kant allein am ästhetischen Zustand hervorhebt: le desinte-ressement. Wer hat Recht, Kant oder Stendhal? – Wenn freilich unsereAesthetiker nicht müde werden, zu Gunsten Kant’s in die Wagschale zuwerfen, dass man unter dem Zauber der Schönheit s o g a r gewandloseweibliche Statuen ›ohne Interesse‹ anschauen könne, so darf man wohlein wenig auf ihre Unkosten lachen: – die Erfahrungen der K ü n s t l e rsind in Bezug auf diesen heiklen Punkt ›interessanter‹, und Pygmalionwar jedenfalls n i c h t nothwendig ein ›unästhetischer Mensch‹.«1
7
Die Erfahrung der Kunst, wie Nietzsche sie in diesen Wortenbeschreibt, hat nichts gemeinsam mit einer Ästhetik. Es gehtin ihr vielmehr darum, den Begriff der »Schönheit« von deraisthesis, der Sinnlichkeit des Betrachters, zu reinigen, um dieKunst aus dem Blickwinkel ihres Schöpfers zu betrachten.Diese Reinigung resultiert aus der Umkehrung dessen, was dasKunstwerk in der Perspektive der Tradition ist: An die Stelleder Dimension des Ästhetischen – der sinnlichen Aneignungdes schönen Objekts durch den Betrachter – tritt die schöpferi-sche Erfahrung des Künstlers, der im eigenen Werk une pro-messe de bonheur erkennt. Am äußersten Punkt ihres Schick-sals – in der »Stunde des kürzesten Schattens« – verläßt dieKunst den neutralen Horizont der Ästhetik, um sich in der»goldenen Scheibe« des Willens zur Macht wiederzuerkennen.Pygmalion, jener Bildhauer, der der Liebe zu seiner eigenenSchöpfung derart verfallen ist, daß er wünscht, sie möge nichtmehr zur Sphäre der Kunst gehören, sondern zum Leben, istdas Symbol dieser Wendung im Bereich des Nenners der Kunst,des Übergangs von der Idee einer interesselosen Schönheit zuder des Glücks, der Idee einer unbeschränkten Ausdehnungund Steigerung der Werte des Lebens. Zugleich verlagert sichder Schwerpunkt der Reflexion über die Kunst fort vom inter-esselosen Betrachter hin zum – interessierten – Künstler.
Daß er diesen Wandel vorausgesehen hat, ist ein Zeugnismehr für die Richtigkeit von Nietzsches Vorhersagen. Ver-gleicht man diese Stelle der dritten Abhandlung über die Ge-nealogie der Moral mit den Ausdrücken, derer sich AntoninArtaud im Vorwort zu Das Theater und sein Double zur Be-schreibung des Todeskampfs der westlichen Kultur bedient,fällt gerade in diesem Punkt eine überraschende Übereinstim-mung auf. »Unsre abendländische Vorstellung von Kunst undder Gewinn, den wir aus ihr ziehen, sind schuld am Verlust uns-rer Kultur«, schreibt Artaud: »Unsrer trägen, unbeteiligten Vor-stellung von Kunst setzt eine authentische Kultur eine magi-
8
sche und ungestüm egoistische, das heißt beteiligte Vorstellungentgegen.«2 Die Ansicht, daß die Kunst keineswegs eine des-interessierte Erfahrung ist, war in anderen Zeiten offenbar all-gemein geteiltes Wissen. Wenn Artaud in »Das Theater und diePest« auf den Beschluß des Pontifex Maximus Scipio Nasicahinweist, alle Theater Roms dem Erdboden gleichzumachen,sowie auf die Attacken, in denen der heilige Augustinus seinerWut gegen das Theater, das den Tod der Seele verursacht, freienLauf läßt, so spricht sich in Artauds Worten die ganze Sehn-sucht aus, die ein Geist, für den das Theater nur »in einer ma-gischen, furchtbaren Verbindung mit der Wirklichkeit und mitder Gefahr«3 Bedeutung besaß, für eine Epoche empfindenmußte, die eine derart konkrete und interessierte Idee vomTheater besaß, daß sie es zum Heil der Seele und der Stadt fürerforderlich hielt, die Bühnen zu zerstören. Daß man heutenach derartigen Ansichten vergeblich suchen würde – selbst beiBefürwortern der Zensur –, muß nicht erst eigens erläutert wer-den; daß dagegen da, wo es zum ersten Mal zu einer autono-men Betrachtung des ästhetischen Phänomens als solchemkommt – in der Gesellschaft des europäischen Mittelalters –,dies in Form einer Haßkampagne gegen die Kunst geschieht,liegt weniger auf der Hand. Und doch ist dies nachzulesen inbischöflichen Sendschreiben, welche die musikalischen Inno-vationen der ars nova, die Modulation des Gesangs und denGebrauch der fractio vocis, aus der Messe verbannten, da sie mitihrer Faszination die Gläubigen ablenkten. Im übrigen hätteNietzsche unter den Zeugnissen, die für interessierte KunstStellung nehmen, auch einen Passus aus Platons Politeia zitie-ren können – einen Passus, der oft wiederholt wird, wenn vonder Kunst die Rede ist, ohne daß die Haltung, die sich in ihmausspricht, einem modernen Ohr deshalb weniger anstößigklänge. Platon sieht ja bekanntlich im Dichter eine Bedrohungdes Gemeinwesens und eine mögliche Ursache seines Unter-gangs. »Einem Mann also«, schreibt er,
9
»[…] wenn uns der selbst in die Stadt käme und auch seine Dichtungenuns darstellen wollte, würden wir Verehrung bezeigen als einem heiligenund wunderbaren und anmutigen Mann, würden ihm aber sagen, daß einsolcher bei uns in der Stadt nicht sei und auch nicht hineinkommendürfe, und würden ihn, das Haupt mit vieler Salbe begossen und mitWolle bekränzt, in eine andere Stadt begleiten.«4
Und mit einer Wendung, die unsere Sensibilität nur in Schau-dern versetzen kann, ergänzt Platon später, dies müsse gesche-hen, weil »in den Staat nur der Teil von der Dichtkunst auf-zunehmen« sei, »der Gesänge an die Götter und Loblieder auftreffliche Männer hervorbringt«.5
Doch schon vor Platon stoßen wir im Zusammenhang mitder Kunst auf eine solche Verdammung oder wenigstens aufeinen solchen Verdacht, und zwar in einem Dichterwort. AmEnde des ersten Stasimon der Antigone läßt Sophokles denChor den Menschen, soweit er techne besitzt (in dem weitenSinn, den die Griechen diesem Wort beilegten, bezeichnete esdie Fähigkeit, ein Ding hervorzubringen, es vom Nichtseinzum Sein zu bringen), als »das Beängstigendste« charakterisie-ren. Diese Macht, erklärt der Chor weiter, könne zum Heil,doch ebenso auch zum Untergang führen, bevor er seine Sichtin einer Weissagung zusammenfaßt, die Platons Bann über dieDichter vorwegnimmt:
»Nie sei Gast meines Herdes,Nie mein Gesinnungsfreund,Wer solches beginnt.«6
Edgar Wind hat bemerkt, daß das für uns so erstaunliche Ver-dammungsurteil Platons damit zu tun hat, daß die Kunst aufuns nicht mehr den Einfluß ausübt, den sie auf Platon hatte.7
Die Kunst findet bei uns also nur deshalb eine so gnädige Auf-nahme, weil sie aus der Sphäre des Interesses herausgetretenund in die des bloßen »Interessantseins« eingetreten ist. In ei-ner Skizze zum Mann ohne Eigenschaften, die Musil zu einem
10
Zeitpunkt verfaßte, als ihm die endgültige Zentralgestalt seinesRomans noch nicht klar vor Augen stand, wird Ulrich (hier nochunter dem Namen Anders) beim Eintreten in das Zimmer derklavierspielenden Agathe von einem dunklen und unwidersteh-lichen Verlangen erfaßt, das ihn dazu treibt, auf das Instrument,welches das ganze Haus mit solch trostloser Schönheit erfüllt,mehrere Revolverschüsse abzufeuern. Und wahrscheinlich wür-den wir – ließen wir es darauf ankommen, die friedfertige Auf-merksamkeit, die unseren gewohnten Umgang mit dem Kunst-werk kennzeichnet, zum Gegenstand einer schonungslosenAnalyse zu machen – uns am Ende mit Nietzsche in Überein-stimmung finden, nach dessen Ansicht seine Zeit absolut keinAnrecht darauf hatte, eine Antwort auf Platons Frage nach demmoralischen Einfluß der Kunst zu geben, und zwar aus diesemGrunde: »Hätten wir selbst die Kunst – wo haben wir den Ein-fluss, i r g e n d e i n e n Einfluss der Kunst?«8
Platon hatte, wie die klassisch-griechische Welt im ganzen,von der Kunst eine Erfahrung anderer Art – eine Erfahrung, diemit Interesse und ästhetischem Genuß nur wenig Gemeinsam-keiten aufwies. Die Macht, die die Kunst über die Seele ausübt,erschien ihm ausreichend, um die Grundlagen seiner Stadt zuzerstören; doch er verbannte sie nur widerstrebend und nurgezwungenermaßen, »da wir es uns bewußt sind, wie auch wirvon ihr angezogen werden [hos xynismen ge hemin autois ke-loumenois hyp’autes]«.9 Um die Effekte der Kunst auf die Vor-stellungskraft zu bestimmen, bedient sich Platon der Formulie-rung »göttliche Angst« (theios phobos) – eines Ausdrucks, deruns heute gewiß kaum geeignet scheint, die Formen zu definie-ren, in denen wir uns als aufmerksam-bereitwillige Betrachterder Kunst zuwenden. Und doch finden wir uns genau damitkonfrontiert, von einem bestimmten Zeitpunkt ab sogar immerhäufiger: Wir müssen uns nur die Aufzeichnungen ansehen,in welchen Künstler der Moderne ihre Erfahrungen mit derKunst niedergelegt haben.
11
Parallel zu dem Prozeß, im Zuge dessen sich der Betrachtereingeschlichen hat in den Begriff der Kunst (mit dem Ergebnis,daß dieser der Stellenwert eines topos ouranios des Ästheti-schen zufiel), dürfte in der Sphäre der Künstler somit eine ge-nau entgegengesetzte Entwicklung stattgefunden haben. Fürden, der sie hervorbringt, wird die Kunst eine immer beängsti-gendere Erfahrung, und im Hinblick auf diese kann der Begriffeiner interessierten Kunstbetrachtung bestenfalls als Euphe-mismus gelten. Denn was hier auf dem Spiel steht, ist keines-wegs die Erzeugung eines schönen Werks; für denjenigen, deres hervorbringt, ist das Kunstwerk vielmehr eine Angelegen-heit, in der es um Leben und Tod seines Urhebers geht, oderdoch eine, in der seine geistige Integrität auf dem Spiel steht.Die zunehmende Ungefährlichkeit, welche die Begegnung desKunstbetrachters mit dem Werk charakterisiert, geht in derErfahrung des Künstlers, für den das Glücksversprechen, lapromesse de bonheur, der Kunst die Rolle eines Gifts einnimmt,das seine Existenz verseucht und zerstört, Hand in Hand mitwachsender Gefährlichkeit. Das Handeln des Künstlers er-weist sich als mit einem extremen und stets zunehmendenRisiko verknüpft, gleichsam als handele es sich um ein Duell,bei dem der Künstler – wie Baudelaire es ausdrückt – »vor Ent-setzen aufschreit, ehe er besiegt wird«.10 Wie wenig es sich beidieser Formulierung um eine Metapher handelt – eine der vie-len Metaphern, die zu den »Requisiten des literarischen Histrio-nen«11 gehören –, ist in den Worten ausgesprochen, in denen dervon »Apollo geschlagen[e]«12 Hölderlin an der Schwelle desWahnsinns sagt: »[Ich] fürcht’ […], daß es mir nicht geh’ amEnde, wie dem alten Tantalus, dem mehr von Göttern ward, alser verdauen konnte.«13 Diese Erfahrung spricht auch aus demZettelchen, das man nach Vincent van Goghs Tod in seinerTasche fand und auf das der Maler gekritzelt hatte: »Und meineeigene Arbeit, nun, ich setzte mein Leben dabei aufs Spiel, undmein Verstand ist zur Hälfte dabei drauf gegangen.«14 Ähnlich
12
erklärte auch Rilke in einem Brief an Clara: »Die Kunstwerkesind stets das Ergebnis eines eingegangenen Risikos, einer bisan ihr Extrem, an den Punkt, an dem der Mensch nicht mehrweitermachen kann, getriebenen Erfahrung.«
Eine weitere Vorstellung, der wir bei Künstlern immer häu-figer begegnen, ist die, daß die Kunst grundlegend gefährlich ist– nicht nur für den Künstler, sondern auch für die Gesellschaft.So stößt Hölderlin in den Notizen, in denen er den Sinn seinerunvollendet gebliebenen Tragödie Der Tod des Empedokles aufden Punkt zu bringen versucht, auf eine enge Verbindung, jaauf ein einheitliches Prinzip, das der anarchischen Unbelehr-barkeit der Agrigenter ebenso zugrunde liegt wie der titani-schen Poesie des Empedokles; in einem unausgeführten Ent-wurf zu einer Hymnendichtung erkennt er in der Kunst sogardie wesentliche Ursache von Griechenlands Untergang:
»Nämlich sie wollten stiftenEin Reich der Kunst. Dabei ward aberDas Vaterländische von ihnenVersäumet und erbärmlich gingDas Griechenland, das schönste, zu Grunde.«15
Man kann dies zurückweisen, muß dann aber auch in Kauf neh-men, daß es so in der modernen Literatur keinen MonsieurTeste geben würde, keinen Werf Rönne, keinen Adrian Lever-kühn – allenfalls noch den Jean-Christophe Romain Rollands,eine hoffnungslos abgschmackte Romanfigur.
Alles scheint somit darauf hinzudeuten, daß sich die Künst-ler selbst, würde es ihnen überlassen sein zu beurteilen, ob derKunst Zutritt zur Stadt zu gewähren sei, mit Platon in Überein-stimmung finden und für die Notwendigkeit optieren würden,die Kunst zu verbannen.
Wenn es sich aber so verhält, dann handelt es sich beim Ein-tritt der Kunst in die ästhetische Dimension und bei der schein-baren Möglichkeit, sie nach Maßgabe der aisthesis des Betrach-
13
ters zu verstehen, nicht um die unschuldigen und natürlichenPhänomene, die wir in ihnen zu sehen gewohnt sind. Und dar-um gibt es – falls es uns im Ernst darum zu tun ist, die Frage derKunst in unserer Zeit zu stellen – wohl nichts Dringlicheres alseine Destruktion der Ästhetik, die das gewohnheitsmäßig alsEvidenz Erlebte entthronen und sich bereit finden würde, dieZuständigkeit der Ästhetik als Wissenschaft vom Kunstwerkanzufechten. Es ist jedoch fraglich, ob die Zeit für eine derar-tige Destruktion reif ist und ob sie nicht eher den schlichtenVerlust eines möglichen Horizonts, vor dem das Kunstwerkverstanden werden könnte, nach sich ziehen würde – und damitdas Aufreißen eines Abgrunds, der sich dann nur durch einenradikalen Sprung bewältigen ließe. Aber vielleicht sind ein sol-cher Verlust und ein solcher Abgrund eben das, was uns ammeisten not tut, wenn wir wollen, daß das Kunstwerk seineursprüngliche Rolle wieder einnimmt. Und wenn es wahr ist,daß der grundlegende architektonische Mangel eines Hauseserst in dem Moment sichtbar wird, in welchem es in Flammensteht, so könnten wir uns heute in einer besonders günstigenLage befinden, den authentischen Sinn des ästhetischen Pro-jekts des Westens zu begreifen.
Vierzehn Jahre bevor Nietzsche die dritte Abhandlung zurGenealogie der Moral publizierte, hat ein Dichter, dessen Wortwie ein Gorgonenhaupt über dem Schicksal der westlichenKunst steht, von der Dichtung nicht verlangt, daß sie schöneWerke hervorbringe oder einem desinteressierten ästhetischenIdeal genüge, sondern daß sie das Leben ändere und dem Men-schen die Pforten Edens wieder öffne. Rimbauds Begegnungmit dem Terror findet in dieser Erfahrung statt, in der la ma-gique etude du bonheur, die magische Erforschung des Glücks,alle sonstigen Zwecke verdunkelt, um sich selbst als einzigeFatalität von Dichtung und Leben zu setzen.
Die Einschiffung nach Kythera – ins Kythera der modernenKunst – soll den Künstler somit nicht dem versprochenen
14
Glück zuführen; sie soll ihm vielmehr Zugang zum Unheim-lichsten verschaffen, nämlich zu jenem göttlichen Terror, dereinst Platon dazu bewog, die Dichter aus seiner Stadt zu ver-bannen. Nietzsches Appell aus dem Vorwort zur FröhlichenWissenschaft – »Nein, wenn wir […] überhaupt eine Kunstnoch brauchen, s o i s t e s e i n e a n d r e K u n s t ! […] Vo rA l l e m : e i n e K u n s t f ü r K ü n s t l e r, n u r f ü r K ü n s t -l e r !«16 – gewinnt seinen rätselhaften Sinn wieder, wenn er alsder letzte Moment in jenem Prozeß erkannt wird, in dem dieKunst sich von ihrem Betrachter reinigt, um sich unversehens,in wiedererrungener Integrität, mit ihrer eigenen absoluten Be-drohlichkeit konfrontiert zu sehen.
15
§ 2 Frenhofer und sein Doppelgänger
Wie ist es möglich, daß die Kunst, diese unschuldigste allerTätigkeiten, den Maßstab des Menschen im Terror findet? JeanPaulhan, der sich in den Blumen von Tarbes mit der grund-legenden Zweideutigkeit der Sprache auseinandersetzt, unter-scheidet Zeichen, die sich aus den Sinnesdaten ergeben, undIdeen, die mit jenen Zeichen so assoziiert sind, daß sie unmit-telbar von ihnen evoziert werden. Paulhan kennt Rhetoren-Schriftsteller und Terroristen-Schriftsteller: Während die einendas Bedeutete zur Gänze in der Form auflösen und aus dieserForm das einzige Gesetz der Literatur machen, verweigern sichdie anderen diesem Gesetz und sind dem entgegengesetztenTraum verfallen – dem Traum von einer Sprache, die nichts istals ihr Sinn selbst, einem Denken also, in dessen Flamme sichdas Zeichen restlos verzehrt, indem es den Schreiber mit demAbsoluten konfrontiert. Der Terrorist hat nichts für Worteübrig; er ist nicht fähig, das Meer, in das er sich unablässigstürzt, noch in dem Wassertröpfchen auf seiner Fingerkuppezu erkennen. Der Redner dagegen hält sich an Worte; demDenken scheint er mit Mißtrauen zu begegnen.
Daß das Kunstwerk nicht dasselbe ist wie die Sache, um diees in ihm geht, liegt auf der Hand; die Griechen drückten diesim Begriff der Allegorie aus, die anderes kommuniziert, alloagoreuei, als die Materie, aus der sie besteht.1 Und doch gibtes Objekte, bei denen die Form bestimmt und bedingt istvon der Materie – ein Felsblock, ein Wassertropfen, alle natür-lichen Dinge –, wie es andererseits Objekte gibt – eine Vase,eine Schaufel, jedes vom Menschen hergestellte Objekt –, beidenen umgekehrt die Form die Materie zu bestimmen scheint.Der Terror träumt davon, Werke hervorzubringen, die in derWeise in der Welt sind, in der ein Felsblock oder ein Wasser-
16
tropfen in der Welt sind, also etwas zu produzieren, das seinemStatus nach eine Sache ist. »Die Meisterwerke sind dumm«,schrieb Flaubert, »sie tragen dieselbe gelassene Miene zurSchau wie die Produktionen der Natur, die großen Tiere unddie Berge.«2 Und bei Degas findet man die Wendung: »Das hatdie Glätte sauberer Malerei.«3
Der Maler Frenhofer in Balzacs Unbekanntem Meisterwerkist der vollkommene Typus des Terroristen. Zehn Jahre langversuchte er, auf der Leinwand etwas zu schaffen, das mehr istals noch das genialste Kunstwerk; wie Pygmalion hat er dieKunst durch die Kunst ausgemerzt mit dem Ziel, aus seinemWerk, der »Belle Noiseuse«, etwas zu machen, das mehr ist alsnur eine Totalität aus Zeichen und Farben: die lebende Realitätseines Denkens und Vorstellens. »Mein Bild ist kein Bild«, er-klärt er seinen beiden Besuchern,
»es ist eine Empfindung, eine Leidenschaft. Sie ist in meinem Ateliergeboren und muß in ihm jungfräulich bleiben; sie kann es nur bekleidetverlassen. […] Ihr steht vor einer Frau, und ihr suchtet ein Bild. Die Lein-wand hat so viel Tiefe, die Luft ist so wahr, daß ihr sie von der Luft, dieeuch umgibt, nicht mehr unterscheiden könnt. Wo ist die Kunst? Verlo-ren, verschwunden!«4
Doch seine Suche nach einem absoluten Sinn hat Frenhofer nurden Blick auf seine Idee verdunkelt. Sie hat ihn veranlaßt, jedemenschliche Form aus seinem Werk zu verbannen, ja es in einChaos aus Farben, Schattierungen und unbestimmten Über-gängen zu verwandeln, in »eine Art von formlosem Nebel«. DieWorte des jungen Besuchers Poussin – »Aber früher oder späterwird er merken, daß gar nichts auf seiner Leinwand ist« – neh-men sich angesichts dieser absurden »Mauer aus Malerei« wieein Alarmsignal aus, das sich gegen die Bedrohung richtet, dieder Terror für die Kunst des Okzidents darzustellen beginnt.5
Betrachten wir Frenhofers Malerei aus der Nähe. Was dieLeinwand zeigt, sind verworrene Farbmassen, strukturiert nur
17
durch ein Geflecht unentzifferbarer Linien. Jeder Inhalt ist ver-schwunden und nichts Bedeutungshaltiges zu erkennen – mitAusnahme einer Fußspitze, die sich vom Rest des Gemäldesabhebt wie der »Torso irgendeiner Venus aus parischem Mar-mor, der sich mitten aus den Trümmern einer eingeäschertenStadt erhebt«.6 Die Suche nach dem absoluten Sinn hat jedenSinn verschlungen; was überlebt, sind sinnentleerte Zeichenund Formen. Ist dann aber das unbekannte Meisterwerk nichteher ein Meisterwerk der Rhetorik? Ist es dann wirklich derSinn, der das bedeutungshaltige, auf anderes verweisende Zei-chen ausgelöscht hat – und nicht umgekehrt das Zeichen, dasden Sinn zerstört hat? Wir sehen hier den Terroristen, wie ermit dem Paradoxon des Terrors ringt. Um aus der flüchtigenWelt der Formen herauszutreten, findet er kein anderes Mittelals die Form selbst; je mehr er von ihr zu tilgen versucht, destostärker muß er sich zugleich auf sie konzentrieren, um sie demUnsagbaren gefügig zu machen, das er ausdrücken will. Unddoch bleibt ihm am Ende nichts anderes als Zeichen – Zeichen,die dem Sinn, den er mit ihnen verfolgt hat, um nichts wenigerfremd bleiben, auch nachdem sie durch das Zwischenreich desSinnlosen hindurchgegangen sind. Die Flucht vor der Rhetorikließ ihn bei ihrem Gegenteil, dem Terror, Asyl suchen; der Ter-ror jedoch führt ihn wieder zur Rhetorik zurück. Haß auf dasWort, Misologie, verwandelt sich so in Philologie, Liebe zumWort; Zeichen und Sinn liegen nacheinander auf der Jagd, ver-wickelt in einen endlosen circulus vitiosus.
Der Bezug von Zeichen und Bezeichnetem erweist sich hierals so unauflöslich mit der Sprache selbst verbunden – denktman sie metaphysisch als eine phone semantike, als Laut plusBedeutung –, daß jeder Versuch, ihn zu überwinden, ohne zu-gleich auf das Gebiet der Metaphysik hinüberzuwechseln, hin-ter seinem Gegenstand zurückbleiben muß.
Die moderne Literatur kennt nur zu viele Beispiele für die-ses paradoxe Geschick, auf das der Terror zugeht. Derselbe
18
ganze Mensch, der seine Ganzheit dem Terror verdankt, ist zu-gleich auch ein homme-plume, ein menschgewordener Feder-halter, und wir sollten uns an die Gestalt erinnern, in der Mal-larme, einer der reinsten literarischen Interpreten des Terrors,zuletzt seine Vorstellung von der vollendetsten Gestalt desUniversums verwirklicht sah – die Gestalt des Buchs. AntoninArtaud verfaßte in den letzten Jahren seines Lebens die Suppotset supplications, Texte, in denen er sich anschickte, die Literaturgänzlich in etwas aufzulösen, das er sonst als Theater bezeich-nete – »Theater« in jenem Sinn, den die Alchemisten in derBeschreibung ihrer spirituellen Reise dem Theatrum Chemi-cum unterlegten, einem Sinn, dem wir um keine Handbreitnäher kommen, solange wir dem Wort die Bedeutung geben,die es in der westlichen Kultur gewöhnlich besitzt. Was aberhat diese Reise außerhalb der Literatur zutage gefördert, wennnicht Zeichen, über deren Un-Sinn wir uns Fragen stellen, weilwir fühlen, daß in ihnen das Schicksal der Literatur bis auf denGrund ausgelotet wird? Dem Terror, dem es wirklich allein umseine Kohärenz geht, bleibt nur eine Geste, diejenige Rim-bauds, mit dem der Dichter sich – wie Mallarme sagte – leben-den Leibes selbst von der eigenen Dichtung aboperiert hat.Und doch bleibt das Paradoxon des Terrors auch in diesemextremen Zug noch präsent. Wo hat le mystere Rimbaud dennseinen Ort, wenn nicht gerade dort, wo die Literatur sich ihrGegenteil, das Schweigen, einverleibt? Zerfällt RimbaudsRuhm nicht, wie Blanchot beobachtet hat, in die Poesie, die ergeschrieben, und in diejenige, die zu schreiben er sich geweigerthat?7 Und liegt nicht gerade darin das Meisterwerk der Rheto-rik? Wir müssen uns hier fragen, ob diese Opposition von Ter-ror und Rhetorik nicht doch mehr verbirgt als so etwas wie einedefinitiv unlösbare Denksportaufgabe, und ob die Insistenz,mit der die moderne Kunst sich immer tiefer in sie verfahrenhat, uns nicht die Sicht auf ein Phänomen nimmt, das zu einervöllig anderen Dimension gehört.
19
Kehren wir zu Frenhofer zurück. Was ist hier geschehen?Solange kein fremdes Auge sein Meisterwerk betrachtet hatte,zweifelte er nicht eine Sekunde an seinem Gelingen. Der bloßeUmstand, daß das Gemälde den Blicken der Besucher Porbusund Poussin ausgesetzt war, ist ihm nun Grund genug, sichdem Verdikt seiner Betrachter anzuschließen: »Nichts, nichts!Und zehn Jahre Arbeit!«8
Frenhofer hat sich verdoppelt, seine Perspektive hat sichverschoben – von der des Künstlers zu der des Betrachters,von der interessierten promesse de bonheur zur interesselo-sen Ästhetik. In diesem Übergang hat sich die Integrität seinesKunstwerks in Nichts aufgelöst. Darum hat sich, streng ge-nommen, nicht nur Frenhofer, sondern auch sein Werk verdop-pelt. Wie bei Kippbildern – jenen geometrischen Figuren, die,wenn sie lange genug betrachtet werden, eine andere Gestaltannehmen, von der aus dann kein Weg, abgesehen von derMöglichkeit, die Augen zu schließen, zur ersten Gestalt zu-rückführt – präsentiert Frenhofers Bild eines von zwei Gesich-tern, die nicht in eine Einheit gebracht werden können: Dasdem Künstler zugewandte Gesicht des Werkes ist die lebendeRealität, und in ihm erkennt er sein Glücksversprechen; dasandere Gesicht, dem Betrachter zugewandt, erweist sich alseine Summe von Elementen ohne eigenes Leben und spiegeltsich wider in dem Bild, das das ästhetische Urteil ihm zurück-wirft.
Diese Verdoppelung in eine Kunst, die vom Betrachter, undeine Kunst, die vom Künstler erlebt wird, ist aber der Terrorselbst; die Unterscheidung zwischen Terror und Rhetorik führtuns so zurück zur Unterscheidung von Künstler und Betrach-ter, von der wir ausgegangen waren. Die Ästhetik, das wäredann nicht einfach die Bestimmung eines Kunstwerks im Aus-gang von der aisthesis, der sinnlichen Auffassung des Betrach-ters: Vielmehr ist das, was sich in ihr Geltung verschafft, vonAnfang an eine Ansicht des Kunstwerks als des Resultats eines
20