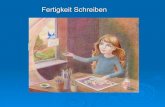Survivalguide Schreiben ||
Transcript of Survivalguide Schreiben ||
-
Survivalguide Schreiben
-
Gabriele Bensberg
Survivalguide SchreibenEin Schreibcoaching frs Studium Bachelor-, Master- und andere Abschlussarbeiten Vom Schreibmuffel zum Schreibfan!
Mit 61 Abbildungen
1C
-
Ergnzendes Material finden Sie unter http://extras.springer.com/978-3-642-29875-2
ISBN 978-3-642-29875-2 ISBN 978-3-642-29876-9 (eBook)DOI 10.1007/978-3-642-29876-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet ber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
SpringerMedizin Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013Dieses Werk ist urheberrechtlich geschtzt. Die dadurch begrndeten Rechte, insbesondere die der ber-setzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfltigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungs-anlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulssig. Sie ist grundstzlich vergtungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestim-mungen des Urheberrechtsgesetzes.
Produkthaftung: Fr Angaben ber Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewhr bernommen werden. Derartige Angaben mssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit berprft werden.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne be-sondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Marken-schutzgesetzgebung als frei zu betrachten wren und daher von jedermann benutzt werden drfen.
Planung: Joachim Coch, HeidelbergProjektmanagement: Kerstin Kindler, HeidelbergLektorat: Karin Dembowsky, MnchenCartoons: Claudia Styrsky, MnchenProjektkoordination: Heidemarie Wolter, HeidelbergUmschlaggestaltung: deblik BerlinFotonachweis Umschlag: Benicce - Fotolia.comHerstellung: Crest Premedia Solutions (P) Ltd., Pune, India
Gedruckt auf surefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Medizin ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Mediawww.springer.com
Gabriele BensbergPsychologische Beratungsstelle (PBS)Studentenwerk Mannheim
-
VVorwort
Zu Beginn des Herbstsemesters 2010 erschien das Buch Survivalguide Bachelor. Die Auto-ren waren ber den Erfolg des Ratgebers ein wenig erstaunt. Dass unser Werk derart nach-gefragt war und weiterhin ist, zeigt, mit welch hohen Anforderungen und Stresspotenzialen ein Studium heute einhergeht. Auch bei guter Begabung und berdurchschnittlicher Moti-vation fllt es immer mehr Studierenden schwer, ihr Studium ohne zustzliche Unterstt-zung zu managen.
Und so entschloss sich der Verlag, einen weiteren Survivalguide zu publizieren, der eine zentrale Herausforderung am Ende des Studiums zum Thema hat: die Abschlussarbeit. Da ich selbst gerne schreibe und ganz unterschiedliche Texte verfasse, hat mir diese Aufgabe sehr viel Spa gemacht, und ich hoffe, den Leserinnen und Lesern etwas von der Faszina-tion, die das Schreiben haben kann, vermitteln zu knnen.
Wenn es um das Abfassen wissenschaftlicher Texte geht, scheiden sich die Geister. Den einen geht es leicht von der Hand, und sie haben sogar Freude daran. Fr andere ist es eher eine Qual, die sich verstiegene Professorenhirne ausgedacht haben, um junge Studierende zu piesacken. Manch ein Student wrde doppelt so gerne studieren, wenn es keine schrift-lichen Arbeiten gbe. Auch kommt es immer wieder vor, dass Absolventinnen und Absol-venten an dem Projekt Abschlussarbeit scheitern und ihr Studium aus diesem Grund nie beenden.
Das Buch wendet sich vor allem an Studentinnen und Studenten, die sich mit dem Schrei-ben schwer tun und sich den Zugang zu ihrem Schreibprojekt erleichtern mchten! Es will dabei aber mehr sein als eine praktische Handlungsanleitung, indem es auch weiterfhren-de Informationen und Anreize zum Schreiben selbst gibt.
Wer ein Kochbuch fr die Anfertigung seiner Bachelor- oder Master-Thesis bzw. Zulas-sungsarbeit sucht, sollte zunchst die7Kap. 411 lesen. Wer meint, er msse erst einmal seine generelle Schreibunlust bekmpfen, findet den Einstieg am ehesten ber7Kap. 23 sowie7Kap. 1415. Wissbegierige junge Menschen, die etwas ber die Hintergrnde von Schreibproblemen erfahren mchten, sollten mit7Kap.1 starten. Zur Untersttzung bei der praktischen Umsetzung der vielen Tipps beim Schreiben stehen die wichtigsten bungs-materialien zum Download auf 7 http://extras.springer.com bereit (mit der ISBN 978-3-642-29875-2 gelangst du zum entsprechenden Material).
Engagierte Feministinnen und Feministen unter den Leserinnen und Lesern bitte ich um Nachsicht, dass den maskulinen Formen meist nicht die dazugehrigen femininen zur Sei-te gestellt wurden. Es geschah einzig und allein aus sprachsthetischen Grnden, d.h. um stndige Doppelungen und Wortungetme zu vermeiden, die den Sprachfluss betrchtlich stren. Auch wenn die weibliche Form nicht explizit genannt ist, sind die Leserinnen selbst-verstndlich immer angesprochen.
Es ist mir ein Anliegen, mich sehr herzlich bei all jenen zu bedanken, die mich in irgend-einer Weise bei der Entstehung des Werks untersttzt haben.
-
VI
5 Herrn Joachim Coch und Frau Kerstin Kindler vom Springer-Verlag Heidelberg danke ich dafr, dass sie das Buch mit Sachverstand, Geduld und klugem Rat fortlaufend be-gleitet haben.
5 Ich danke dem Geschftsfhrer des Studentenwerks Mannheim, Dr. Jens Schrder, der mir ermglichte, das Werk im Rahmen einer Nebenttigkeit zu schreiben und diesem Projekt mit sehr viel Offenheit und Wertschtzung begegnete.
5 Ein Dankeschn geht auch an meine Mitarbeiter Diplompsychologe Vitali Scheibler, Diplompsychologin Angelika Supp und Diplompsychologe Markus Dewald, die fortlau-fend Korrektur lasen und wertvolle Kritikpunkte einflieen lieen.
5 Bedanken mchte ich mich auerdem bei Frau Karin Dembowsky, die das Buch uerst grndlich und mit einem beeindruckenden Ma an Hintergrundwissen lektorierte, und bei Frau Claudia Styrsky, deren Talent und Ideenreichtum das Werk seine gelungenen Cartoons verdankt.
5 Und zum Schluss danke ich allen ehemaligen Klientinnen und Klienten, die mich wegen ihrer Schreibprobleme um Rat fragten und deren Probleme den Fallbeispielen zugrunde liegen, die aus Grnden der Schweigepflicht allerdings verfremdet wurden.
Allen, die das Buch als Ratgeber fr die Abfassung eines umfangreichen wissenschaftlichen Textes nutzen, wnsche ich gutes Gelingen.
Und nun macht euch bereit fr das Abenteuer Schreiben!
Gabriele BensbergIm Frhjahr 2013
Vorwort
-
VII
Inhaltsverzeichnis
I Schreibprobleme hausgemacht?
1 Textformen und Schreibprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1 Private Texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.1 Notiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.2 Elektronische Kurzmitteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.3 Brief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.4 Tagebuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Amtliche Texte oder Von der Wiege bis zur Bahre Formulare, Formulare! . . . . . . . . . . . . 61.2.1 Behrdenkorrespondenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.2.2 Antrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2.3 Erklrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Studienrelevante Textformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3.1 Vorlesungsmitschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3.2 Exzerpt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3.3 Protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.4 Prfungsrelevante Textformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.4.1 Handout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.4.2 Essay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.4.3 Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.4.4 Seminararbeit und Referat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.4.5 Prsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.4.6 Abschlussarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.5 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 Persnlichkeit und Schreibprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.1 Schreiben ist persnlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.1.1 Eine positive Haltung ist wichtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.1.2 Die Identifikation mit der Thematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.1.3 Manche packt es fr immer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.2 Schreiben heit Entscheidungen treffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.2.1 Entscheidung ber Thema und Betreuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.2.2 Entscheidung ber die Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.2.3 Entscheidung ber die Inhalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.3 Schreiben erfordert Durchhaltevermgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.3.1 Schreiben ist langwierig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.3.2 Hhen und Tiefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.3.3 Alte Tugenden sind gefragt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.4 Beim Schreiben ist man allein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.4.1 Schreiben ist keine Gruppenaufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.4.2 Nur wenige knnen dir raten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.4.3 Allein sein heit nicht, einsam sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
-
VIII
3 Schreiben unter der Flagge des Self-Handicappings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253.1 Was versteht man unter Self-Handicapping? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.2 Motive fr Self-Handicapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.3 Studentische Self-Handicapping-Strategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.3.1 Aufschieberitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.3.2 Konzentrationsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.3.3 Krperliche Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.4 Auswirkungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.5 Einschtzung des Schweregrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.6 Was tun? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
II Anforderungen, Probleme, Lsungen
4 Bachelor- und Masterarbeiten: Grundstzliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.1 Anforderungen an das Thema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.1.1 Wahlfreiheit oder Vorgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.1.2 Wissenschaftlichkeit der Fragestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.1.3 Eingrenzung der Fragestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.2 Formale und stilistische Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.2.1 Styleguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.2.2 Allgemein gltige Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.2.3 Sprache und Stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.2.4 Schne neue Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.3 Aufbau und Gliederung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.3.1 Unverzichtbare Elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.3.2 Erluterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.4 Beurteilungskriterien fr wissenschaftliche Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.4.1 Allgemeine Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.4.2 Kriterienkatalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5 Der Wissenschaftswald das Schreibumfeld optimieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475.1 Anforderung: Rahmenbedingungen klren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.1.1 Stellenwert der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.1.2 Arbeitsplan erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.1.3 Planungsbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.1.4 Arbeitszeiten festlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.1.5 Arbeitsort festlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.1.6 Gestaltung des Arbeitsplatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.1.7 Allein oder Tandem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565.1.8 Belohnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.2 Probleme und Lsungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.2.1 Unvorhergesehene Lebensereignisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.2.2 Flexibilitt und Gelassenheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.2.3 Unrealisierbare Planungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635.2.4 Aktive Problemlsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Inhaltsverzeichnis
-
IX
6 Brich einen Zweig ab Thema und Betreuung abklren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696.1 Anforderung: Thema und Betreuer finden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706.1.1 Anforderung: Thema finden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706.1.2 Anforderung: Betreuer finden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736.2 Probleme und Lsungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756.2.1 Entscheidungsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756.2.2 Entscheidungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766.2.3 berforderung und hhere Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776.2.4 Thema abndern oder zurckgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786.2.5 Der Betreuer hat andere Vorstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786.2.6 Die hohe Kunst der Diplomatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796.2.7 Der Betreuer fllt aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796.2.8 Neuen Betreuer finden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796.3 Belohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7 Lass den Zweig Wurzeln treiben Literatur suchen und auswerten . . . . . . . . . . 837.1 Anforderung: Die vier groen S Sondieren, Suchen, Sortieren, Skribieren . . . . . . . . . . . 847.1.1 Literatursondierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847.1.2 Literatursuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847.1.3 Literaturbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867.1.4 Literatureinfgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887.2 Probleme und Lsungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917.2.1 Sekundrliteratur fehlt bzw. berfordert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917.2.2 Springen oder aufgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917.2.3 Lesen ohne Ende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917.2.4 Begrenzung von Werk- und Seitenzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927.2.5 Was ist wichtig, was ist unwichtig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937.2.6 Beurteilungskriterien finden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937.2.7 Ausufernde Zusamme nfassungen schreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937.2.8 Effiziente Bearbeitungsstrategien einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947.2.9 Wer sagt was? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957.2.10 Mein ist mein, und dein ist dein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967.2.11 Belohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
8 Lass den Zweig wachsen Inhalte strukturieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998.1 Anforderung: Map entwerfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008.1.1 Inhaltsverzeichnis erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008.1.2 Zentrale Versatzstcke umreien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018.1.3 Den Roten Faden spinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078.2 Probleme und Lsungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088.2.1 Was wie gewichten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088.2.2 Gewichtungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088.2.3 Was ist zentral? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108.2.4 Herzstcke der Arbeit definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108.2.5 Chaos statt Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128.2.6 Strukturierungshilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Inhaltsverzeichnis
-
X
8.2.7 Belohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
9 Lass den Zweig grnen Rohfassung erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159.1 Anforderung: Mutation zum Schriftsteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179.1.1 Erster Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179.1.2 Zweiter Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179.1.3 Dritter Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179.1.4 Vierter Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179.1.5 Fnfter Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179.1.6 Belege nicht vergessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189.1.7 Wissenschaftssprache verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189.1.8 Fachtermini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189.1.9 Beispiel: Wissenschaftssprache Veterinrmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199.1.10 Objektivitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199.1.11 Przision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199.1.12 Sachlicher Stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199.2 Probleme und Lsungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199.2.1 Mangelndes Know-how . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199.2.2 Zum Wissenden werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209.2.3 Erster Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209.2.4 Zweiter Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209.2.5 Dritter Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209.2.6 Sprachliche Defizite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209.2.7 Expertenhilfe und Nachteilsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219.2.8 Schreibblockaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219.2.9 Der Kardinalfehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219.2.10 Five-step- und Worst-text-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229.2.11 Angst vor dem leeren Blatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239.2.12 Clustering und linkshndiges Schreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239.2.13 Schreiben und Gefhl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249.2.14 Mit heier Nadel schreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259.2.15 Die heilige Zahl Sieben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259.2.16 Aufschieberitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269.2.17 Planung und Kerkerhaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279.3 Psychische Blockaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299.3.1 Angst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299.3.2 Die Angst an die Kette legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309.3.3 Einsamkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319.3.4 Austausch und Geselligkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319.4 Hilfsangebot Schreibwerkstatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319.4.1 Kreative Schreibwerkstatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329.4.2 Wissenschaftliche Schreibwerkstatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329.4.3 Belohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
10 Lass den Zweig blhen kreativ schreiben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13510.1 Anforderung: Ineinandergreifende Zahnrder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13610.1.1 Lernforschung: Abwechslung tut not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Inhaltsverzeichnis
-
XI
10.1.2 Kreativittsforschung: Vielfalt ist wichtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13610.1.3 Der Humus wechselnder Arbeitsschritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13710.1.4 Lebe mit der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13910.1.5 Stelle die Weichen fr die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14010.2 Probleme und Lsungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14210.2.1 Mangelnde Flexibilitt des Verhaltens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14210.2.2 Abwechslungsreiche Tagesplne erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14210.2.3 Mangelnde Flexibilitt des Denkens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14210.2.4 Kreativittsbungen einfgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14310.2.5 Angst und Unsicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14410.2.6 Angstbewltigungsstrategien einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14410.2.7 Belohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
11 Gib den Zweig aus der Hand Endfassung erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14711.1 Anforderung: Puppenspielertalente entwickeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14811.1.1 Rote Fden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14811.1.2 Sprachliche Korrektheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14811.1.3 Sprache klingt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14911.1.4 Die Augen essen mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14911.1.5 Das Sahnehubchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15011.1.6 Die Arbeit im Sonntagskleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15111.2 Probleme und Lsungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15311.2.1 Selbstzweifel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15311.2.2 Sei streng mit dir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15311.2.3 Das innere Loslassen der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15411.2.4 Knpfe ein Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15411.2.5 Alles geht schief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15511.2.6 Puffer einplanen und Helfer sichern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15511.3 Der Vorhang fllt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15711.3.1 Deine Thesis ist wichtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15711.3.2 Lass die Thesis Kreise ziehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15711.3.3 Pflanze deinen Zweig im Wissenschaftswald ein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15911.3.4 Belohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
III Die Zeit danach
12 Der Tag nach der Abgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16312.1 Wie siehts im Inneren aus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16412.1.1 Hochstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16412.1.2 Kreise ziehen lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16412.1.3 Herunterspielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16512.1.4 Ein Fest nur fr dich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16612.1.5 Beispieltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16612.1.6 Leere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16712.1.7 Aktive Zukunftsplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16712.2 Risse im Beziehungsnetz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Inhaltsverzeichnis
-
XII
12.2.1 Abschiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16912.2.2 Balanceprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16912.2.3 Neid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17112.3 Einstieg in das Erwachsenenleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17212.3.1 Jugend ade mit Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17212.3.2 Setze eine Zsur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17312.3.3 Lerne dich kennen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17412.3.4 Werte-Fragebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
13 Alles war umsonst: was nun? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17713.1 Das Scheitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17813.1.1 Tiefes Loch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17813.1.2 Trauerarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17813.1.3 Umgang mit elterlichen Vorwrfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17913.1.4 Der Neuanfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17913.1.5 Expertenrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18013.1.6 Was ist ein Hrtefallantrag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18013.1.7 Was ist Prozesskostenhilfe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18013.1.8 Abstand gewinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18113.1.9 Fach oder Studiengang wechseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18213.1.10 Ausbildung anvisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18213.1.11 Aussteigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18213.2 Wer wei, wozu es gut war? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18313.2.1 Die Weisheit des Unbewussten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18313.2.2 Gewissensfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18413.2.3 Erfolgsgeschichten ohne Uni-Abschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
IV Vom Schreibmuffel zum Schreibfan
14 Schrift und Schreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19314.1 Der weite Weg zur Schrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19414.1.1 Mal- und Handwerkskunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19414.1.2 Die ersten Schriftzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19414.1.3 Das Vermchtnis der Gene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19614.1.4 Die Weltgemeinschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19814.2 Schreiben schtzt vor Vergessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19914.2.1 Unser Gedchtnis ist begrenzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19914.2.2 Reale Zeit und gefhlte Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20014.3 Fhre Tagebuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20114.3.1 Du bist nie allein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20114.3.2 Du kannst Dampf ablassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20114.3.3 Du nimmst dich wichtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20214.3.4 Du lebst bewusster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20214.3.5 Du wirst aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20214.4 Manuell oder virtuell? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Inhaltsverzeichnis
-
XIII
14.4.1 Manuelle Medien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20314.4.2 Virtuelle Medien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20314.4.3 bung macht den Meister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
15 Die Macht des geschriebenen Wortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20715.1 Bcher verndern die Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20815.1.1 Harriet Beecher Stowe: Onkel Toms Htte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20815.1.2 Charles Darwin: Vom Ursprung der Arten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20915.1.3 Das Kommunistische Manifest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20915.2 Tagebcher verndern die Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21015.2.1 Schreiben gegen die Einsamkeit: Anne Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21115.2.2 Schreiben als Befreiung: Anas Nin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21215.2.3 Schreiben zur Vernderung: Freedom Writers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21315.3 Die verndernde Kraft des Schreibens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21515.3.1 Die Bibliotherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21515.3.2 Die Poesietherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21615.3.3 Lnger leben durch Schreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Nachwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Inhaltsverzeichnis
-
1 I
Schreibprobleme hausgemacht?
Kapitel 1 Textformen und Schreibprobleme 3
Kapitel 2 Persnlichkeit und Schreibprobleme 15
Kapitel 3 Schreiben unter der Flagge des Self-Handicappings 25
-
3Textformen und Schreibprobleme
1.1 Private Texte 41.1.1 Notiz 41.1.2 Elektronische Kurzmitteilung 41.1.3 Brief 41.1.4 Tagebuch 5
1.2 Amtliche Texte oder Von der Wiege bis zur Bahre Formulare, Formulare! 6
1.2.1 Behrdenkorrespondenz 61.2.2 Antrag 71.2.3 Erklrung 8
1.3 Studienrelevante Textformen 81.3.1 Vorlesungsmitschrift 81.3.2 Exzerpt 81.3.3 Protokoll 9
1.4 Prfungsrelevante Textformen 91.4.1 Handout 91.4.2 Essay 91.4.3 Interpretation 101.4.4 Seminararbeit und Referat 101.4.5 Prsentation 101.4.6 Abschlussarbeit 12
1.5 Fazit 13
Literatur 13
1
G. Bensberg, Survivalguide Schreiben, DOI 10.1007/978-3-642-29876-9_1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
-
4
Hol der Teufel das Briefeschreiben! Wenn wir nur beisammen wren! (Katherine Mansfield)
1.1 Private Texte
Wenn jemand sagt, er knne nicht schreiben, ist ihm meist nicht klar, dass diese Einschtzung zu einem hohen Prozentsatz von der Art des zu ver-fassenden Textes abhngt. Zwar gibt es Analpha-beten bzw. Menschen, die ein derart gebrochenes Verhltnis zu Schriftzeichen haben, dass sie sich nur in der allergrten Not einige Buchstaben ab-qulen, beispielsweise um eine lebensnotwendige Unterschrift zu leisten, typisch fr Studierende ist dieses Phnomen aber nicht. Gerade bei studen-tischen Schreibproblemen spielt die Textart eine wesentliche Rolle.
Grundstzlich kann man zwischen privaten Texten und solchen, die eher formell sind oder im Hinblick auf den Inhalt und Ausdruck bewer-tet werden, unterscheiden. Auch der erforderliche Umfang eines Textes ist mit mglicherweise auftre-tenden Problemen beim Schreiben verquickt.
1.1.1 Notiz
Die meisten von euch geben problemlos Telefon-nummern ihr Handy ein, notieren in der Vorlesung eine wichtige Literaturangabe oder schreiben m-helos auf, was beim Einkauf an Lebensmitteln fr die nchste WG-Fete besorgt werden soll.
1.1.2 Elektronische Kurzmitteilung
Fr elektronische Kurzmitteilungen ist typisch, dass es kurze Botschaften sind, die man in der Mehrzahl nicht gro berdenkt und meist an Be-kannte und/oder Freunde versendet. Das Simsen, Chatten, Mailen, Twittern sowie die Kontaktpflege per Facebook geht fast allen Studentinnen und Stu-denten flott von der Hand, und sie fhlen sich dabei nicht im Geringsten blockiert. Im Gegenteil, man-che verbringen ganze Stunden mit Beschftigungen dieser Art. In fast jeder Lebenslage wird das Han-dy gezckt, um kleinere Botschaften auszusenden
oder zu empfangen. Selbst Mails, die formellerer Natur sind, indem sie sich beispielsweise an den Seminarleiter mit einer inhaltlichen Frage richten, bereiten selten Schwierigkeiten.
Groer Beliebtheit erfreuen sich mittlerwei-le auch die zahlreichen, im Internet angebotenen Flirtlines. Hier erfolgen Eintrge anscheinend ebenfalls ganz zwanglos, ohne dass sich ihre Verfas-ser um so lstige Dinge wie Rechtschreibung oder Zeichensetzung kmmern.
Kontaktanzeige einer Flirtline
Weiblich, Single, wSternzeichen: Jungfrau Deutschland Ich suche: Ich suche einen Mann der weis was er will und mit eigenen beinen im Leben steht!!!!Auch Foren, die dazu dienen, sich ber Lehrer und Dozenten auszutauschen, knnen sich ber man-gelnde Kommentare nicht beklagen.
Bewertung einer Marketing-Vorlesung durch einen Studenten
Positiv: interessante Themen und zum Teil sehr unterhaltsamer Vorlesungsstil. Der Prof fgt viele praktische Beispiele ein und stellt den Stoff schon verstndlich dar.Negativ: die Klausur ist krass schwer, es wird viel Auswendiglernen verlangt, Definitionen und Fach-ausdrcke sind stupide zu pauken, weil sie wort-wrtlich abgefragt werden. Auerdem finde ich Massenveranstaltungen von mehr als 600 Studie-renden nicht so prickelnd.
1.1.3 Brief
Persnliche Briefe hingegen werden zunehmend seltener geschrieben. Ein gelungener Brief (frher auch wohlklingend Epistel genannt) setzt voraus, dass man sich mit der Person des anderen beschf-tigt und sich Gedanken ber Inhalt und Aufbau des Schreibens macht. Im Unterschied zu berwiegend kurzen Mails, die frher oder spter gelscht wer-
Kapitel 1Textformen und Schreibprobleme
1
-
5den, sind Briefe meist lnger und zeitlich bestn-diger. Einige haben Jahrzehnte, Jahrhunderte und sogar Jahrtausende berdauert (7Beispiel). Diese beiden Bedingungen, die Lnge bzw. Lebensdau-er des Mediums einerseits und der gewisse Zwang zu vertieftem Nachdenken andererseits, wirken anscheinend auf immer mehr Menschen abschre-ckend. Obwohl Briefe daher in der Gegenwart zu einem etwas exotischen Phnomen mutiert sind, ist es andererseits so, dass sich die meisten Menschen freuen, wenn sie einen solchen erhalten. Ein Brief vermittelt nmlich, dass der Empfnger dem Ab-sender etwas wert ist, da dieser einen weit hheren Aufwand betrieben hat, als es fr eine Mail oder SMS erforderlich gewesen wre. Er oder sie hat vielleicht schnes Papier gekauft, den Inhalt hand-schriftlich verfasst und noch eine besondere Brief-marke ausgewhlt.
Heloise und Ablard: Verbotene Liebe vor 900Jahren
Was mich betrifft, so waren mir die Entzckun-gen der Liebe, denen wir uns gemeinsam hinga-ben, so s, da ich sie nicht verabscheuen oder aus meinen Gedanken entfernen knnte. Wohin ich mich auch wende, sie stehen mir vor Augen und erwecken meine Begehrlichkeit; ihre Gaukel-bilder verschonen nicht einmal meinen Schlaf. Mitten in den Feierlichkeiten der Messe, wenn das Gebet am reinsten sein sollte, bemchtigen sich meines elenden Herzens die obsznen Trugbilder jener Wollust, und ich bin mehr mit ihrer Schimpf-lichkeit als mit dem Gebet beschftigt. Wenn ich sthnen sollte ber die Snden, die ich begangen habe, schluchze ich ber jene, die ich nicht mehr begehen kann (aus einem Brief der Heloise an ihren ehemaligen Geliebten; Beck, 1995, S. 209)Heloise lebte im 12.Jahrhundert und war die Sch-lerin des berhmten Theologen und Gelehrten Ablard. Beide gingen eine verbotene Liebesbe-ziehung ein, die mit der Entmannung Ablards und der Unterbringung der jungen Heloise in einem Kloster endete, nachdem sie einen Sohn zur Welt gebracht hatte. Auch Ablard zog sich in ein Klos-
ter zurck. Die beiden sollten einander nicht mehr wiedersehen, unterhielten aber ber viele Jahre hinweg einen intensiven Briefwechsel.
1.1.4 Tagebuch
Auf wenig Gegenliebe stt zurzeit meist auch das Fhren eines Tagebuchs. Tagebcher sind leider vllig zu Unrecht aus der Mode gekommen und waren schon in frheren Zeiten eher eine Dom-ne des weiblichen Geschlechts. Tagebucheintra-gungen sind in der Regel sehr privater Natur. Sie handeln von Ereignissen im Leben oder auch im gesellschaftlichen Umfeld des Schreibenden und beschftigen sich berwiegend mit seinen persn-lichen Wnschen, Bedrfnissen, Enttuschungen, Kmmernissen usw. Aber auch heute gibt es sie noch, die leidenschaftlichen Tagebuchschreiber/innen.
Die meisten Menschen aber wissen mit dieser Art Selbstanalyse und chronikhaften Berichterstat-tung ber das eigene Leben nichts (mehr) anzufan-gen, wofr mehrere Grnde verantwortlich sind: Zum einen handelt es sich um eine unmoderne Ausdrucksform, und man gert leicht in den Ver-dacht, uncool zu sein, wenn man sich zu ihr be-kennt. Auerdem setzen regelmige Eintrge in ein Tagebuch voraus, dass man in einen Dialog mit sich selbst eintritt und das eigene Fhlen, Denken und Handeln reflektiert. Das ist eigentlich auch der tiefere Sinn von Tagebuchnotizen, aber genau davor schrecken viele zurck, da diese Beschfti-gung mit der eigenen Person auch unangenehme Tatsachen zu Tage frdern kann. Andererseits hat-ten Tagebcher schon frher eine auerordentlich sttzende Funktion und ersetzten manchmal nicht vorhandene Freunde. So richtete Anne Frank ihre Tagebucheintragungen in Form von Briefen an eine erfundene Freundin namens Kitty (7Abschn.15.2).
Heute sind virtuelle soziale Netzwerke Ver-bndete im Kampf gegen Einsamkeit und Lange-weile, und man kann sich bei ihrer Nutzung mit Freunden aus aller Welt verlinken. Aber es gibt Unterschiede. Whrend nichtexistente Freunde, an die sich klassische Tagebucheintragungen richten, der eigenen Phantasie entspringen, und man die Beziehung daher in der Vorstellung sehr intensiv
1.1 Private Texte1
-
6
gestalten kann, sind die Kontakte innerhalb eines Social Networks zwar real, aber in der Regel uerst oberflchlich.
Auch ein Web-Log, selbst wenn man regel-mig Eintragungen vornimmt, ist mit dem her-kmmlichen Tagebuch, das ein Zwiegesprch mit der eigenen Person einleitet, nicht zu vergleichen, da hier ein ffentlicher Raum hergestellt wird und die Leser die eigenen Gedanken meist kommentie-ren drfen oder sogar sollen.
Aus einem Online-Tagebuch
Wahrscheinlich bin ich nur ungeduldig. D. mel-det sich nicht. Im Prinzip ist es so gut, da genau das immer mein Interesse weckt. Als er sich letzte Woche stndig meldete, zog ich mich etwas zu-rck. Vielleicht hat er das bemerkt. Vielleicht sind wirs aber auch einfach zu strmisch angegangen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Er hat sich bis jetzt jedes Mal DIREKT danach gemeldet. Nicht diese nervige 3-Tage-Wartezeit, keine Spielchen, kein garnix. Einfach nur eine nette Nachricht. Der Kerl ist Gold wert. Nach unserem letzten, ersten richtigen Date, nachdem ich allerdings auch bei ihm geschlafen hatte, hat er sich auch kurz nach-dem ich zur Haustr raus war per SMS gemeldet. Gentlemanlike. Am Freitag schrieb er mir, wir knnten das mit dem Date gerne bald wieder-holen. Bald Seitdem habe ich nichts von ihm gehrt, Doch irgendwie traue ich mich nicht, einfach zu fragen, ob wir uns diese Woche sehen. Da hilft selbst stundenlanges im FB on sein nichts, wenn der Kerl sich nicht an seinen Laptop be-wegt.Wenn du selbst auch eine ablehnende Haltung gegen-ber Tagebchern hast, solltest du jetzt zu7Kap.15 springen und erst einmal in7Abschn.15.2 weiter-lesen!
1.2 Amtliche Texte oder Von der Wiege bis zur Bahre Formulare, Formulare!
Offizielle Schriftstcke unterscheiden sich von privaten Texten dahingehend, dass sie mit einem
Muss verbunden sind: Ich muss bestimmte For-mulare ausfllen, um in den Genuss bestimmter Leistungen zu kommen oder bestimmte negative Konsequenzen abzuwenden. Amtliche Texte haben daher immer einen gewissen Zwangscharakter. Der Zeitpunkt, zu dem diese Schriftstcke abgegeben werden sollen, sowie weitere formale Kriterien sind vorgegeben. Die Abfassungssprache ist meist wenig eingngig, wofr es den schnen Ausdruck Amtsdeutsch (7Beispiel) gibt. Mittlerweile ist es bei vielen offiziellen Schriftstcken mglich, zwi-schen manueller und elektronischer Bearbeitung zu whlen.
Der Anfang des Rotkppchen-Mrchens auf Amtsdeutsch
Im Kinderanfall unserer Stadtgemeinde ist eine hierorts wohnhafte, noch unbeschuhte Minder-jhrige aktenkundig, welche durch ihre unbliche Kopfbedeckung gewohnheitsmig Rotkppchen genannt zu werden pflegt. Der Mutter besagter R. wurde seitens ihrer Mutter ein Schreiben zu-stellig gemacht, in welchem diese Mitteilung ihrer Krankheit und Pflegebedrftigkeit machte, worauf die Mutter der R. dieser die Auflage machte, der Gromutter eine Sendung von Nahrungs- und Genussmitteln zu Genesungszwecken zuzustel-len (Auszug aus: Thaddus Troll: Rotkppchen, in amtlichem Sprachgut beinhaltet. In: Das groe Thaddus Troll-Lesebuch, Hamburg 1981. Silber-burg-Verlag, Tbingen, mit freundlicher Genehmi-gung).
1.2.1 Behrdenkorrespondenz
Jeder Mensch erhlt irgendwann zum ersten Mal in seinem Leben ein amtliches Schreiben, und mit absoluter Sicherheit wird es nicht bei diesem einen bleiben. Bei solchen Schreiben handelt es sich u.a. um Bescheide, z.B. den Lohnsteuerbescheid, Rechnungen, Mahnungen, Strafzettel usw. Bei den meisten Menschen erzeugt Post dieser Art ein mehr oder weniger ausgeprgtes Unbehagen, das von einer gewissen Anspannung bis hin zur Angst reicht. Einige entscheiden sich daher, derartige Briefe einfach zu ignorieren. Sie werfen sie in den
Kapitel 1Textformen und Schreibprobleme
1
-
7Mll, lassen sie von ihrem Hund zerfetzen oder be-feuern im Winter damit den Kamin. Das solltest du aber nur nachahmen, wenn du auch bereit bist, die Konsequenzen dieses Tuns mit stoischer Gelassen-heit zu ertragen. Sei gewiss, der Arm des Gesetzes reicht weit, und daher umfassen die Folgen einer Nichtbeachtung amtlicher Korrespondenz Mahn-gebhren, am Ende sogar Besuche von Herren mit Kuckuck sowie Vorladungen und vielleicht sogar das zweifelhafte Vergngen, einmal einen Knast von innen zu erleben.
Wenn dir danach nicht unbedingt der Sinn steht, solltest du dir eine bestimmte Vorgehens-weise beim Umgang mit amtlichen Schreiben zu eigen machen. Zunchst sind diese Briefe so aufzu-bewahren, dass sie nicht verloren gehen knnen. Es empfiehlt sich also, einen besonderen Ordner an-zulegen. Auerdem sollte man sie sofort ffnen, um zu berprfen, ob berhaupt und ggf. in welchem Zeitraum reagiert werden muss. Es kann sinnvoll sein, vor der Beantwortung eine persnliche Be-ratung, etwa durch einen Rechtsanwalt oder eine amtliche Stelle, in Anspruch zu nehmen, auf die man sich entsprechend vorbereiten sollte. Wenn diese Fragen geklrt sind, setzt man das Antwort-schreiben auf. Wer sich ber Stil und formale Kri-terien unsicher ist, kann sog. Briefsteller zu Rate ziehen, die anhand praktischer Beispiele demonst-rieren, wie derartige Schreiben abzufassen sind.
1.2.2 Antrag
Antragsformulare sind meist uerst umfangreich und mit unverstndlichen Passagen und Begrif-fen gespickt. Daher werden sie manchmal durch ebenso umfangreiche Anlagen ergnzt, in denen erklrt wird, wie die einzelnen Abschnitte zu ver-stehen und zu bearbeiten sind. Nette Gesten, die aber leider nicht in jedem Fall die Verstndlichkeit des Formulars erhhen!
Wer fllt schon solche Antragsformulare gerne und/oder mit leichter Hand aus, ohne ber irgend-welche Paragrafen zu stolpern. Das Ausfllen wird daher gerne aufgeschoben oder sogar vllig ver-gessen, was auch damit zu tun hat, dass falsche Angaben, und seien sie auch nur versehentlich
zu Papier gebracht, uerst unangenehme Folgen nach sich ziehen knnen.
Fr Studierende stellt vor allem das Ausfllen von BAfG-Antrgen eine echte Herausforderung dar. Whrend man als naiver Brger davon ausgeht, dass diese Antrge berwiegend von bedrftigen Schlern und Studenten gestellt werden, sehen das die offiziellen Verantwortlichen offensichtlich an-ders, denn es finden sich viele Spalten, in denen man Angaben zu seinem Einkommen oder Ver-mgen bzw. sonstigen wiederkehrenden Leistun-gen machen muss. Sollte also BAfG eigentlich etwas fr Reiche sein, oder sind diese Pflichtfelder aus einer gewissen Paranoia heraus entstanden, die hinter jedem Schler oder Studenten den gebore-nen Betrger wittert?
Auch fr BAfG-Antrge ist die ungewhnli-che Begrifflichkeit typisch (7Beispiel), oder kannst du auf Anhieb erklren, was unter dem Wortun-getm Aufstiegsfortbildungsfrderungsgesetz (AFBG; umgangssprachlich: Meister-BAfG) zu verstehen ist?
Beispiel BAfG-Erstantrag, Formblatt1
Dein Einkommen und dein Vermgen mssen Zeile fr Zeile jeweils in Euro offengelegt werden.
Zitat aus dem Antragsformular:
Angaben zu meinem Vermgen im Zeitpunkt der Antragstellung (bitte Belege beifgen)
4 Land- und forstwirtschaftliche Grundstcke (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert)
4 Sonstige unbebaute Grundstcke (auch Mit-eigentumsanteile, Zeitwert)
4 Sonstige bebaute Grundstcke (auch Mit-eigentumswert, Zeitwert)
4 Betriebsvermgen (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert)
4 Wertpapiere, insbesondere Aktien, Pfandbrie-fe, Schatzanweisungen, Wechsel
4 Lebensversicherungen (Rckkaufwert) 4 Forderungen und sonstige Rechte 4 Sonstige Vermgensgegenstnde, z.B. Perso-nenkraftfahrzeuge (Zeitwert)
1.2 Amtliche Texte oder Von der Wiege bis zur Bahre Formulare, Formulare!1
-
8
Ist dir klar, was sonstige unbebaute Grundst-cke sind? Darunter versteht man z. B. die Wiese, die nicht als Bauplatz freigegeben wird, weil der unter strengem Naturschutz stehende Gemeine Feldhamster dort seine Heimat gefunden und ein unterirdisches Hhlensystem angelegt hat.
Was Schatzanweisungen sind, weit du nicht? Damit sind Schuldverschreibungen mit entweder kurzer, mittlerer oder langer Laufzeit gemeint und nicht etwa Anweisungen deines Schatzes wie Du sollst nicht immer anderen Frauen nachstarren!
Und Forderungen? Nein, hier ist nicht an ein Duell zwischen zwei Spielern in World of Warcraft gedacht, sondern an finanzielle Vermgenswerte.
Und Sonstige Vermgensgegenstnde? Du musst nicht, wie du vielleicht befrchtest, erst die von deiner Gromutter ererbten Rubinohrringe zum Pfandleiher bringen, bevor Du BAfG erhlst. Bei einem Auto sieht die Sachlage schon anders aus. Solltest du beispielsweise stolzer Besitzer eines Rolls Royce mit einer schnen Emily auf der Khler-haube sein oder auch einen nicht ganz so exklu-siven Edelschlitten fahren, fragst du am besten bei dem fr dich zustndigen BAfG-Amt nach.
1.2.3 Erklrung
Zu den amtlichen Texten, die sich unter dem Ober-begriff Erklrung subsumieren lassen, gehren u.a. die Lohn- oder Einkommenssteuererklrung. Letztere muss man, wenn man eine bestimmte Ver-dienstgrenze berschreitet, zwingend erstellen. Auch fr diese Formulare trifft zu, dass sie um-stndlich formuliert und schwer verstndlich sind, weswegen die Finanzmter eine umfangreiche Bro-schre erstellt haben, in der mit Beispielen veran-schaulicht wird, was unter den einzelnen Punkten wie einzutragen ist. Diese Anleitung ist 19 Seiten lang und wird ergnzt durch ein Merkblatt, auf dem noch zustzlich die Art des Kugelschreibers und das Muster der Blockschrift fr die handschriftli-che Ausstellung des Antrags abgebildet sind. Diese Vorgaben sind notwendig, weil die Antrge mitt-lerweile maschinell ausgewertet werden. Natrlich gibt es auch lngst eine elektronische Lohnsteuer-karte mit Namen ELStAM, auf die aber nicht jeder
zurckgreifen mchte, z.B. aus Scheu, trotz aller Sicherungen sensible Daten ins Netz zu stellen.
1.3 Studienrelevante Textformen
Hier handelt es sich um Texte, die fast alle Stu-dierenden whrend ihres Studiums verfassen. Sie unterliegen keiner Bewertung, sondern sind nur fr den Eigengebrauch bestimmt.
1.3.1 Vorlesungsmitschrift
Vorlesungsmitschriften werden zwar in absehbarer Zeit wahrscheinlich der Vergangenheit angeh-ren, weil PowerPoint-Folien meist vollstndig ins Netz gestellt werden. Dies gilt zunehmend auch fr komplette Lehrveranstaltungen, ist allerdings noch nicht allgemein gngige Praxis. Es gibt auch Dozenten, die sich weigern, ihre Vorlesungen on-line zu prsentieren, weil sie der Auffassung sind, dass Studierende mehr lernen, wenn sie whrend der Veranstaltung entscheiden mssen, was wichtig oder unwichtig ist.
Bei Vorlesungsmitschriften sind normalerweise keine Schreibblockaden beobachtbar, wenngleich ihre Qualitt sehr unterschiedlich ist. Manche er-scheinen wirr und ungeordnet, andere sind sehr gut strukturiert und deutlich gegliedert, sodass sie sich als Lernvorlage eignen. Wer nicht in der Lage ist, in einer Vorlesung gleichzeitig zuzuhren und brauchbare Notizen zu verfassen, sollte seine Aufzeichnungen anschlieend noch einmal ber-arbeiten oder auf den Smart-Pen zurckgreifen. Der Smart-Pen ist ein digitaler Stift, mit dem man gleichzeitig schreiben und Audiodateien aufneh-men kann, die sich auf den PC bertragen lassen. Tippt man mit dem Stift auf ein notiertes Stichwort, wird sogleich der zugehrige Audiomitschnitt ab-gespielt (Bensberg u. Messer, 2010, Survivalguide Bachelor, Abschnitt 23.11).
1.3.2 Exzerpt
Exzerpt kommt vom lateinischen excerptus (Her-ausgepflcktes), und demzufolge heit exzerpieren
Kapitel 1Textformen und Schreibprobleme
1
-
9wrtlich bersetzt: etwas herausziehen. Exzerpte fertigt man gewhnlich von wissenschaftlicher Li-teratur an, die man der eigenen Arbeit zugrundele-gen will. Man filtert das fr seine Arbeit Wichtige heraus, fasst die Ergebnisse, Argumente usw. zu-sammen und fgt ggf. eigene Gedanken hinzu.
Exzerpte kann man in ein Heft eintragen oder auf groen Karteikarten notieren, man kann sie aber auch direkt im PC als Flietext erstellen. Die letzte Variante ist auf jeden Fall die konomischste, denn sie ermglicht es, Textabschnitte aus den Ex-zerpten herauszukopieren und in die eigene Arbeit einzufgen.
In manchen Ratgebern wird vermittelt, Ex-zerpte seien sozusagen der Weisheit letzter Schluss, will heien, dass sie es dir angeblich ersparen, dich noch einmal mit den Originalschriften auseinan-derzusetzen. Hier ist Vorsicht geboten. Es emp-fiehlt sich in jedem Fall, die wichtigsten Texte zu kopieren bzw. auszuleihen oder auch zu kaufen, um sie wiederholt lesen und auf diese Weise eventuell relevantes Randwissen speichern zu knnen. Oft macht man dabei neue Entdeckungen im Textkor-pus und stt z.B. auf eine Stelle, die sich als Zitat eignet, was man zum Zeitpunkt des Exzerpierens nicht wissen konnte, da man sich noch in der Pla-nungsphase der Thesis befand. Verlasse dich daher nie allein auf deine Exzerpte! Denn sie dienen aus-schlielich dazu, die Struktur eines Textes zu er-fassen und die wichtigsten Aussagen festzuhalten.
1.3.3 Protokoll
Protokolle beschreiben Sachverhalte, Ereignisse usw., die sich in einem bestimmten Zeitraum zu-getragen haben. Bei einem Protokoll kommt es vor allem auf Genauigkeit an, es muss alle wichtigen Fakten nicht nur enthalten, sondern auch korrekt beschreiben. Die sthetik der Sprache spielt bei der Abfassung von Protokollen nur eine unterge-ordnete Rolle. Protokolle sind in der Regel keine prfungsrelevanten Leistungen, begegnen Studie-renden aber, wenn sie Praktika ablegen oder sich einer studentischen Gruppierung anschlieen. In solchen Kontexten ist es oft erforderlich, Inhalte zu protokollieren.
1.4 Prfungsrelevante Textformen
Prfungsrelevante Texte sind schriftliche Ab-fassungen, die man erstellen und abliefern muss, um Credits nach dem European Credit Transfer Accumulation System (ECTS) zu erhalten, wobei ein Kreditpunkt einen Arbeitsaufwand von 2530Stunden voraussetzt. Bei diesen Texten mssen Vorgaben beachtet werden, was die Abfassungszeit, die Form, die Seitenzahl usw. betrifft. Sie sind also nicht fr den Eigengebrauch bestimmt, sondern werden in einem Seminar zur Diskussion gestellt und/oder Dozenten zur Bewertung ausgehndigt.
1.4.1 Handout
Ein Handout (Thesenpapier) fasst die wichtigsten Aussagen und Thesen eines Referats kurz und pr-gnant zusammen. Es sollte nicht mehr als eine Seite umfassen und wird an die Mitstudenten und Do-zenten ausgeteilt bzw. ins Netz gestellt.
Handouts kommen auch bei mndlichen Ab-schlussprfungen zum Einsatz, indem der Prfling zu jedem Spezialgebiet seine eigenen Ideen und Erkenntnisse in einem Paper, das er den Prfern zur Verfgung stellt, schriftlich zusammenfasst. Oft orientieren sich die Prfer bei ihren Fragen an den Punkten des Thesenpapiers, einen Anspruch dar-auf hast du aber nicht.
1.4.2 Essay
Ein Essay stellt eine mehr oder minder geistvolle Errterung eines Themas dar, das den Bereichen Gesellschaft, Kunst oder Wissenschaft angehrt. Hier geht es nicht um wissenschaftlich eindeutige Nachweise und Begrndungen, sondern um eine intellektuell anspruchsvolle persnliche Ausein-andersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand. Art und Stil der Abhandlung werden bei der Bewertung bercksichtigt. Daher sind Essays eher mit journa-listischen Schreibformen als mit wissenschaftlichen Beitrgen verwandt.
Essays sollen subjektiv sein, allerdings ohne (wie dies z. B. bei Gedichten oder Romanen kei-ne Seltenheit ist) die Gesetze der Logik und das
1.4 Prfungsrelevante Textformen1
-
10
vorhandene Basiswissen auer Acht zu lassen. Sie werden in geisteswissenschaftlichen Disziplinen gerne als Prfungsleistung eingesetzt. Der Bewer-tungsmastab ist nicht eindeutig, da es kein abso-lutes Richtig oder Falsch gibt. Dozenten set-zen je nach persnlichem Gusto unterschiedliche Schwerpunkte, die im Einzelnen nicht unbedingt offen gelegt werden oder nachvollziehbar sind.
z Guter und schlechter Stil
Wer nachlssig schreibt, legt dadurch zunchst das Bekenntnis ab, da er selbst seinen Gedanken keinen groen Wert beilegt. Denn nur aus der berzeugung von der Wahrheit und Wichtigkeit unserer Gedanken entspringt die Begeisterung, welche erfordert ist, um mit unermdlicher Aus-dauer berall auf den deutlichsten, schnsten und krftigsten Ausdruck derselben bedacht zu sein; wie man sie nur an Heiligtmer oder unschtzbare Kunstwerke, silberne oder goldene Behltnisse wendet. Daher haben die Alten, deren Gedanken, in ihren eigenen Worten, schon Jahrtausende fort-leben und die deswegen den Ehrentitel Klassiker tragen, mit durchgngiger Sorgfalt geschrieben; soll doch Platon den Eingang seiner Republik sie-ben Mal, verschieden modifiziert, abgefat haben (Schopenhauer, 2003, S. 84, 285).
1.4.3 Interpretation
Interpretieren heit, die sich nicht unmittelbar whrend des Lesens erschlieende tiefere Bedeu-tung eines Textes z. B. Gedicht oder Roman herauszuarbeiten, welche sich subjektiv sehr unter-schiedlich darstellen kann. Daher existieren auch keine objektiven Bewertungskriterien fr derartige Arbeiten, sondern die Stringenz und berzeu-gungskraft der Argumentation sowie die verbale Kompetenz sind fr die Qualitt und nachfolgende Benotung ausschlaggebend.
Vor allem in geisteswissenschaftlichen Fchern wie etwa Germanistik, Romanistik und Anglistik sind Interpretationen literarischer Texte als Pr-fungsleistungen verbreitet. Interpretiert werden aber auch Rechts- und Bibeltexte bzw. geistliche Schriften. In der Theologie werden entsprechende Interpreta-tionen unter dem Begriff Exegese subsumiert.
Das bei Interpretationen hufig angewandte wissenschaftliche Verfahren ist die Hermeneutik, ein auf Nachfhlung und Verstehen basierender Interpretationsansatz (7 Abschn.8.1.2, hermeneu-tisches Vorgehen).
Beim Interpretieren geht es im engeren Sinne darum, die Aussage (Wirkung, Bedeutung, Sinn, Struktur usw.) eines Werkes zu verstehen. Damit kann das Nachvollziehen oder Ergrnden dessen gemeint sein, was die Schpferin oder der Schpfer mit einem Werk (einer Dichtung, einem philoso-phischen Text, einem Bild, einem Musikstck, einer Skulptur usw. aussagen wollte (Kruse, 1994, S. 98).
1.4.4 Seminararbeit und Referat
Seminar- oder Hausarbeiten sind schriftliche wis-senschaftliche Arbeiten begrenzten Umfangs im Durchschnitt umfassen sie zwischen 10 und 30Sei-ten , die in jedem Studiengang erbracht werden mssen. Der Student soll im Rahmen einer Semi-nararbeit demonstrieren, dass er das methodische Instrumentarium und die Anforderungen seines Fachs beherrscht. Fr Seminararbeiten existieren Richtlinien, was die uere Gestaltung und den In-halt anbelangt, die je nach Fach sehr unterschied-lich sein knnen.
Referate stellen meist verkrzte Seminararbei-ten dar, die im Seminar (d.h. vor Kommilitonen und Dozenten) vorgetragen werden, meist mit an-schlieender Diskussion. Um einen Schein zu er-werben, muss man sein Referat oft noch zu einer Seminar- bzw. Hausarbeit erweitern, die spter in der Regel zu Semesterende abgegeben wird.
1.4.5 Prsentation
Prsentationen dienen dazu, die Inhalte eines Vor-trags zu verdeutlichen und das Gesagte visuell zu untersttzen. Ein Referat oder einen Vortrag mit-tels einer PC-Prsentation zu halten, ist mittlerwei-le fast schon ein Muss. Es soll Kindergrten geben, in denen sogar schon die Kids darin unterrichtet werden, wie man eine Prsentation erstellt. Pr-sentationen sind vor allem im Berufsleben und an
Kapitel 1Textformen und Schreibprobleme
1
-
11
chen. Das gilt auch fr den Aufbau jeder einzelnen Folie.
5 Gestaltung der Folien: Gestalte Folien nicht zu bunt, und berfrachte sie nicht mit Bildern. Hier gilt das Prinzip der Abs-tinenz, d.h., so wenig wie mglich, so viel wie ntig! Verwende die Farbe Rot uerst sparsam.
5 Sprache: Bilde kurze Stze und beschrn-ke dich, wenn mglich, auf Stichwrter. Beschrifte insgesamt hchstens 68Zeilen pro Seite.
5 Schrift: Die Schriftgre sollte mindestens 14pt betragen. Die Verwendung von mehr als drei unterschiedlichen Schriftgren innerhalb einer Prsentation ist verpnt.
5 Animationen und sonstige Effekte: Auch hier ist das Gesetz der Sparsamkeit zu be-achten, da die Seriositt eines Vortrags bei bertreibungen leicht Schaden nehmen kann.
Bei einer Prsentation empfiehlt es sich, ein In-haltsverzeichnis voranzustellen und Zwischen-berschriften einzufgen, um den Zuhrern den berblick zu erleichtern (wo befinden wir uns gerade?), der durch die Vielzahl gestalteri-scher Elemente ansonsten leicht verloren geht.
Die .Abb.1.1, .Abb.1.2, .Abb.1.3 und .Abb.1.4 zeigen Beispiele fr Prsentationsfolien.
Hochschulen ein gngiges Medium; kaum ein Stu-dent wird sein Studium absolvieren knnen, ohne je eine Prsentation gemacht zu haben.
Am verbreitetsten sind Prsentationen mit dem Programm PowerPoint von Microsoft, das jedem von euch bekannt sein drfte, sodass sich detail-liertere Hinweise zu der technischen Handhabung des Programms an dieser Stelle erbrigen sollten. Die Rechenzentren der meisten Hochschulen bie-ten Einfhrungen in PowerPoint bzw. Kurse zum Erstellen und zur optimalen Gestaltung von Pr-sentationen an. Solltest du diesbezglich noch eini-ge Unsicherheiten aufweisen, ist die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung empfehlenswert.
Die Tatsache, dass es gute und schlechte Pr-sentationen gibt und fr erstere bestimmte Krite-rien anzulegen sind, hat sich allerdings noch nicht bis zu jedem Studierenden durchgesprochen.
Zentrale Kriterien einer guten Prsentation 5 Eyecatcher am Anfang: Stelle eine Frage, ein Bild oder einen Sinnspruch vorweg, um das Interesse zu wecken und/oder den Blick zu fesseln.
5 Fazit am Ende: Fasse die Ergebnisse kurz zusammen und fge eventuell einen Aus-blick auf noch ungelste Probleme oder nicht beantwortete Fragen an.
5 Klare Gliederung: Der Aufbau des Vortrags muss nachvollziehbar sein und die Abfolge der Folien den Gesetzen der Logik gehor-
.Abb. 1.1 Folie Gefhrdungspotenziale
Gefhrdungspotentiale in derBeratung von Studierenden
1.4 Prfungsrelevante Textformen1
.Abb. 1.2 Folie Inhalt
Inhalt
Suizidalitt Aggressives Verhalten Stalking Amok
-
12
der Regel nur 2040 Seiten. Das macht ihre Ab-fassung aber nicht unbedingt leichter, denn man muss wichtige Aussagen auf relativ wenigen Seiten zusammendrngen und sehr gut berlegen, was in den Text aufzunehmen ist und worauf verzichtet werden kann. Abschlussarbeiten bilden meist die letzte oder vorletzte Prfungsleistung. Nur Staats-examensarbeiten mssen schon vor der Anmel-dung zu den Examina eingereicht werden, weswe-gen sie auch unter der Bezeichnung Zulassungs-arbeit (kurz Zula) bekannt sind.
Allgemeine Regelungen fr alle Studien-bereicheA 1. Studienstruktur und Studiendauer1.4 Zur Qualittssicherung sehen Bachelor- ebenso wie Masterstudiengnge obligatorisch eine Abschlussarbeit (Bachelor-/Masterarbeit) vor, mit der die Fhigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Prob-lem aus dem jeweiligen Fach selbstndig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Der Bearbeitungsumfang fr die Bachelor-arbeit betrgt mindestens 6 ECTS-Punkte und darf 12 ECTS-Punkte nicht berschreiten; fr die Masterarbeit ist ein Bearbeitungsumfang von 1530 ECTS-Punkten vorzusehen (Ln-dergemeinsame Strukturvorgaben fr die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-diengngen. Beschluss der Kultusministerkon-ferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010).
Nicht jedem fllt das Prsentieren leicht. Daher suchen nicht nur Studierende mit Schreibproble-men, sondern auch solche, die ber Sprechngste klagen, die studentischen Beratungsstellen auf. Mit dem Sprechen ist es hnlich bestellt wie mit dem Schreiben: Auch Redehemmungen sind in den meisten Fllen situationsabhngig. Oft ist es so, dass sich dieselbe Person stundenlang mit vertrau-ten Personen austauschen kann, ohne ins Stocken zu geraten, aber im Seminar keine Worte findet, wenn der Professor eine Frage stellt (.Abb. 1.5). Auch hier ist das eigentliche Problem nicht das Sprechen, sondern die Angst vor negativer Kritik und mglicher Abwertung.
1.4.6 Abschlussarbeit
Bei der Studienabschlussarbeit kann es sich derzeit noch um eine Magister-, Diplom- oder Staatsexa-mensarbeit handeln, in der Mehrzahl der Flle aber besteht sie mittlerweile in einer Bachelor-, Master- bzw. Doktorarbeit.
Abschlussarbeiten mssen bestimmten wissen-schaftlichen Standards gengen, die bei Bachelor-arbeiten etwas reduziert sind. Eine Thesis kann prinzipiell theoretisch oder empirisch ausgerichtet sein und je nach Fach in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen geschrieben werden.
Was den Umfang betrifft, so sind Bachelor- im Vergleich zu Diplom- und Magisterarbeiten deut-lich entschlackt und kaum breiter angelegt als eine Seminar- bzw. Hausarbeit, denn sie umfassen in
.Abb. 1.4 Folie Vier erhhte Alarmsignale
Vier erhhte Alarmsignalekonkrete Angaben ber die Durchfhrung, Auswahl und Bechaung der Suizidmittel, Zeit und Ortvorangegangene Suizidversucheunzureichende Distanzierung von vorangegangenen SelbstmordversuchenSuizide bei Familienangehrigenpsychische Strungen oder Erkrankungen
.Abb. 1.3 Folie Suizidalitt
Suizidalitt
Kapitel 1Textformen und Schreibprobleme
1
-
13
1.5 Fazit
Warum also gibt es so viele Blockaden und Vermei-dungstaktiken, wenn es um das wissenschaftliche Schreiben geht? Hier sind an erster Stelle die Be-wertung eines Textes durch eine hhere, mchtige Instanz und die damit verbundenen Folgen fr die eigene Person zu nennen. Beides kann mit einer ge-danklichen Vorwegnahme von Misserfolg und De-mtigung und damit einer Gefhrdung des Selbst-werts einhergehen.
Das Kriterium der Bewertung steigert sich in seiner Bedeutsamkeit und Bedrohlichkeit noch, wenn das Erreichen einer wichtigen Lebensstation, also z.B. der Abschluss des Studiums, mit der Ab-fassung eines Textes verbunden ist. Eine weitere Rolle bei der Herausbildung von Schreibproblemen spielen Umfang und inhaltlicher Anspruch eines Textes. Je mehr Seiten das zu erstellende Schrift-stck umfasst, je weiter seine Sprache vom Um-gangsdeutsch entfernt und je abstrakter der Gehalt sein soll, desto intensiver ist meist auch der beim Schreiben erlebte Stress.
Merke! 5 Jeder Studierende beherrscht die Grundprinzi-pien des Schreibens!
5 Wissenschaftliches Schreiben ist nur eine Ab-art des Schreibens an sich, eine Art gehobenes Handwerk, sozusagen die Kr nach der Pflicht!
5 Wissenschaftliches Schreiben ist erlernbar!
Literatur
Beck R (Hrsg) (1995) Streifzge durch das Mittelalter. Ein historisches Lesebuch. Beck, Mnchen
Bensberg G, Messer J (2010) Survivalguide Bachelor. Sprin-ger, Berlin Heidelberg New York
Kruse O (1994) Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreib-blockaden durchs Studium, 3.Aufl. Campus, Frankfurt
Lhrssen H (2010) Raumbergreifendes Grogrn: Der kleine bersetzungshelfer fr Beamtendeutsch. rororo, Reinbek
Moesslang M (2008) Besser prsentieren mehr erreichen: 52 Tipps fr wirkungsvolle Prsentationen. Books on demand, Norderstedt
Mller P, Wieland R (Hrsg) (2010) Liebesbriefe berhmter Frauen, 2.Aufl. Piper, Mnchen
Schopenhauer A (2003) ber Schriftstellerei und Stil (Hrsg. v. L. Ltkehaus). Alexander Verlag, Berlin
Troll T (1981) Das groe Thaddus Troll-Lesebuch. Hoffmann und Campe, Hamburg
.Abb. 1.5 Zwei Seelen wohnen ach in einer Brust!
1
Literatur
-
1515
Persnlichkeit und Schreibprobleme
2.1 Schreiben ist persnlich 162.1.1 Eine positive Haltung ist wichtig 162.1.2 Die Identifikation mit der Thematik 172.1.3 Manche packt es fr immer 17
2.2 Schreiben heit Entscheidungen treffen 192.2.1 Entscheidung ber Thema und Betreuer 192.2.2 Entscheidung ber die Literatur 192.2.3 Entscheidung ber die Inhalte 20
2.3 Schreiben erfordert Durchhaltevermgen 202.3.1 Schreiben ist langwierig 202.3.2 Hhen und Tiefen 212.3.3 Alte Tugenden sind gefragt 21
2.4 Beim Schreiben ist man allein 222.4.1 Schreiben ist keine Gruppenaufgabe 222.4.2 Nur wenige knnen dir raten 222.4.3 Allein sein heit nicht, einsam sein 22
Literatur 23
2
G. Bensberg, Survivalguide Schreiben, DOI 10.1007/978-3-642-29876-9_2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
-
16
Allein sein zu mssen ist das Schwerste, allein sein zu knnen das Schnste. (Hans Krailshei-mer)
2.