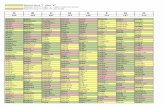Titel-VM5 2004 01.10.2004 11:58 Uhr Seite 1 »Eine geniale ... · Dr. Hedda von Wedel, Mitglied des...
Transcript of Titel-VM5 2004 01.10.2004 11:58 Uhr Seite 1 »Eine geniale ... · Dr. Hedda von Wedel, Mitglied des...

VERWALTUNG &MANAGEMENT
NOMOS VerlagsgesellschaftBaden-Baden
September/Oktober 2004 · ISSN 0947-9856 E 21241
Zeitschrift für allgemeine Verwaltung
Aus dem Inhalt
Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit AdamReformen des öffentlichen Haushalts- und
Rechnungswesens in Deutschland
Steve Du Mont und Willi KaczorowskiNetworked Virtual Organisation
Bernhard Blanke und Henning SchriddeWissensmanagement an den Schnittstellen
öffentlicher Leistungsprozesse
Thomas F. GordonDie Bedeutung von eGovernance für die
Öffentliche Verwaltung
Antje und Mathias ErnstInnovative Leitbilder für Städte
»Eine geniale Idee«Prof. Dr. Michael Quaas, Fachanwalt
für Verwaltungsrecht, Stuttgart
Der Kommentar erläutert die Vorschriften des VwVfGsowie der VwGO in einem Band. Das Werk verzahnt beideBereiche, vermeidet unnötige Doppelungen und nutztdamit die entsprechenden Synergieeffekte in Über-sichtlichkeit, Handlichkeit und Preis.
Zusätzlich bietet der neue Handkommentar:
■ Verwandte Normen aus der Abgabenordnung (AO), dem Sozialverwaltungsverfahren (SGB X), der Finanz-gerichtsordnung (FGO) und dem Sozialgerichtsgesetz(SGG) werden immer dort berücksichtigt, wo dieseinhaltlich abweichen.
■ Fragen der Verwaltungszustellung (VwZG), der Verwaltungsvollstreckung (VwVG) und desKostenrechts werden mit kommentiert.
■ Landesrechtliche Besonderheiten – z. B. bei den zuständigen Widerspruchsbehörden – sind durch-gängig berücksichtigt.
■ Einzelfallbezogene Anwendungsfragen im Beson-deren Verwaltungsrecht werden mit kommentiert.
■ Speziell für den Praktiker: Formulierungshinweiseund Praxistipps für den richtigen Antrag bzw. dierichtige Tenorierung.
VerwaltungsrechtVwVfG ■ VwGOHandkommentar
Herausgegeben von Prof. Dr. Michael Fehling, BuceriusLaw School Hamburg, RegRat Dr. Bertold Kastner,Innenministerium Baden-Württemberg und VRiVG Prof.Dr. Volker Wahrendorf, Gelsenkirchen
2004, ca. 2.000 S., geb., ca. 89,– €, ISBN 3-8329-0973-7Erscheint November 2004
Nomoswww.nomos.de
Titel-VM5_2004 01.10.2004 11:58 Uhr Seite 1

»Auf ein Wort …«
VM 5/2004 225
Verwaltungen müssen größer werden! Eine ungewöhnlicheForderung in Zeiten, in denen die Finanzlage allen öffentlichenEinrichtungen Schlankheitskuren aufzwingt. Aber es ist jaauch nicht das ungehemmte Wachstum der Population öffent-lich Bediensteter gemeint. Es sei allerdings die These gewagt,dass auch für Verwaltungen die Gesetzmäßigkeit der Kosten-degression durch Wachstum gilt. Was Daimler-Chrysler undviele andere uns international vormachen, gilt grundsätzlichauch für die Kommunalverwaltungen eines Flächenlandes.
Die Erkenntnis, dass stetige Verschlankung auch zur Aus-zehrung führen kann, ist nicht neu. Dass Wachstum ein Poten-zial zur Kostensenkung bietet, zeigen die Erfahrungen derWirtschaft. Heißt das Zauberwort also Fusion? Die Bildunggrößerer Verwaltungen durch den Zusammenschluss vonKommunen? Nach dem Muster von Daimler und Chryslervielleicht eine neue Großstadt Köln-Düsseldorf? Wer dieseStädte kennt, ahnt Folgen, die über Kosteneinsparungen weithinausgehen. Während Dänemark auf die Gebietsreform setztund 275 Gemeinden durch Zusammenlegung auf 120 reduzie-ren will, scheint dieser Weg in Deutschland nicht populär zusein. Eine Gebietsreform mag zwar auch hier im Einzelfallhilfreich sein, zum Beispiel gibt es auf Fehmarn durchaus guteErfahrungen damit, aber die generelle Lösung ist es nicht.
Kommunen müssen über sechshundert primäre Geschäfts-prozesse bewältigen – deutlich mehr, als in der Privatwirt-schaft üblich. Dabei ist die Anzahl der Fälle, die pro Prozessanfallen, sehr unterschiedlich, häufig außerordentlich niedrig.Mehrheitlich so gering, dass eine effiziente Bearbeitung nichtmöglich ist. Und das ist der Kern des Problems im Pudel derUnwirtschaftlichkeit. Die Kunden- respektive Bürgernähe solldurch dezentrale Verwaltungen gewahrt bleiben, gleichzeitigsollen Skaleneffekte durch die Bearbeitung möglichst vielergleichartiger Fälle erreicht werden. Die Lösung liegt in dervertikalen Teilung der Prozesse: dezentrale, ortsnahe Bürger-büros als Front Office und die Konzentration von Middle undBack Office-Prozessen über mehrere Verwaltungen hinweg.
Vermutlich ist die Anwendung der Begriffe Front Officeund Back Office auf Verwaltungsprozesse für die meistennoch etwas ungewohnt. Die Idee, gleichartige Prozesse überVerwaltungsgrenzen hinweg zu bündeln, ist hingegen Gedan-kengut aus den sechziger Jahren. Damals hat die revolutionäreEntwicklung der Computertechnik dazu geführt, gleichartigeBearbeitungsschritte zusammenzufassen, um den Rechen-knecht mit ausreichend Futter versorgen zu können. In dieserZeit wurden zum Beispiel Kreisbesoldungsstellen und Zweck-verbände zum Betrieb von Datenzentralen gegründet. Die wei-tere Entwicklung und Dezentralisierung der Rechnertechnikwurde dann als Befreiung von den technischen Zwängen emp-
funden: Jeder konnte wieder alles selber machen. In den Jahrendes wirtschaftlichen Wachstums trat die Frage nach der Wirt-schaftlichkeit dabei in den Hintergrund.
Durch die Internettechnologie wird es möglich, das FrontOffice bis in das Wohnzimmer des Bürgers zu bringen – de-zentraler geht's kaum noch. Aber wer will dem Bürger jetztnoch zumuten, dass er seine Lebenslagen noch nach den Zu-ständigkeiten unterschiedlicher Verwaltungen und Verwal-tungsebenen sortiert? Das HamburgGateway, regelmäßig mitPreisen und Auszeichnungen bedacht, macht den zeitgemäßenLösungsansatz deutlich: ein Portal als generischer Verwal-tungszugang – für alle Themen, die bearbeitet werden müssen.Egal ob Umzug, Kfz-Zulassung, Hundesteuer oder Aufgrabe-schein, egal ob Baugenehmigung oder Meldeauskunft, der Zu-gang zu den Verwaltungen erfolgt künftig über ein einheitli-ches Portal.
Dem stark dezentralisierten Front Office steht die wirt-schaftliche Notwendigkeit einer zentralen Fall-Bearbeitung ge-genüber. Die 24-stündige Verfügbarkeit von Internetverfahren,die Softwarepflege oder die Aktualisierung von Verwaltungs-verfahren nach Gesetzesänderungen sind auf dezentral aufge-stellten Rechnern ungleich aufwändiger als bei Rechenzen-trumslösungen. Alleine der Sicherheitsgewinn durch stabileNotstromversorgung, kontrollierten Zugang zum Beispieldurch Vereinzelungsschleusen oder eine technisch komplizier-te Feuerlöschanlage spricht eindeutig für zentral betreuteRechner. Aber auch Verfügbarkeit, Back-up-Möglichkeiten,routinierte Datensicherung und eine umfassende Verfahrens-überwachung im Rechenzentrum lassen dezentrale Rechner alszweitbeste Lösung erscheinen.
Auch Rechenzentren unterliegen Skaleneffekten. Als Bei-spiel mag die Zusammenlegung der MVS-Rechenzentren desLandesamtes für Informationstechnik in Hamburg und der Da-tenzentrale Schleswig-Holstein dienen. Dabei konnten durchAufgabenteilung und -bündelung Ersparnisse in der Höhe von3,5 Millionen Euro jährlich erzielt werden. Die Erfahrungen ausdieser Kooperation haben letztlich mit dazu beigetragen, dieEinrichtungen dieser beiden Länder zu einem gemeinsamenUnternehmen Dataport zu fusionieren. Die Träger rechnen mitweiteren Synergieeffekten von zehn bis fünfzehn Prozent. Da-mit ist Dataport gut aufgestellt für die Anforderungen größererVerwaltungen und komplexerer Prozesse. Es ist zu erwarten,dass andere Einrichtungen diesem Beispiel folgen werden.
Mit den besten Wünschen
Verehrte Leserinnen und Leser!
Dr. Sebastian Saxe, Vorstand Technik der Dataport Anstalt desöffentlichen Rechts, Altenholz

Impressum
226
VERWALTUNG UND MANAGEMENTZeitschrift für allgemeine Verwaltung
10. Jahrgang, Heft 5/2004, Seiten 225-280
Schriftleiter und Herausgeber:em. Univ.-Prof. Dr. Heinrich Reinermann, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
Beirat:Prof. Dr. Hinrich E.G. Bonin, Fachhochschule Nordostniedersachsen, LüneburgJochen Dieckmann, Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Eichhorn, Universität MannheimAxel Endlein, Landrat, MdL, Präsident des Deutschen Landkreistages, Bonn
Prof. Dr. Klaus-Eckart Gebauer, Direktor beim Landtag Rheinland-Pfalz, MainzPeter Heesen, Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes, Bonn
Dr. Jürgen Hensen, Präsident des Bundesverwaltungsamtes und des Bundesausgleichsamtes, KölnDr. oec. HSG Albert Hofmeister, Chef des Inspektoriat des Eidgenössischen Departements für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, BernDr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Berlin
Univ.-Prof. Dr. Klaus Lenk, Universität OldenburgProf. Dr. Marga Pröhl, Bundesministerium des Innern, Berlin
Univ.-Prof. Dr. Christoph Reichard, Universität PotsdamDr. Thilo Sarrazin, Senator für Finanzen des Landes Berlin
Dr. Sebastian Saxe, Vorstand Technik der Dataport Anstalt des öffentlichen Rechts, AltenholzUniv.-Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Siedentopf, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
Dr. Hedda von Wedel, Mitglied des Europäischen Rechnungshofes, LuxemburgDr. Arthur Winter, Sektionschef im Bundesministerium für Finanzen, Wien
Christian Zahn, Mitglied des Bundesvorstands der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Berlin
Redaktionsanschrift: Verwaltung und ManagementPostfach 1409D-67324 SpeyerTel. (06232) 654-323, Fax (06232) 654-407E-Mail: [email protected]: http://www.dhv-speyer.de/rei/vm
Verwaltung und Management erscheint in der
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden
Druck und Verlag:
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Waldseestraße 3-5, 76530 Baden-Baden, Tel. (07221) 2104-0, Fax (07221) 210427
Anzeigenverwaltung und Anzeigenannahme:
sales friendly, Bettina Roos, Reichstr. 45-47, 53125 Bonn,Tel. (0228) 9268835, Fax (0228) 9268836,E-Mail: [email protected]
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträgeund Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-
tung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassenist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Dies giltinsbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzun-gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbei-tung in elektronischem System.
Namentlich gezeichnete Artikel müssen nicht die Meinung derHerausgeber/Schriftleitung wiedergeben. Unverlangt eingesandteManuskripte – für die keine Haftung übernommen wird – geltenals Veröffentlichungsvorschlag zu den Bedingungen des Verla-ges. Es werden nur unveröffentlichte Originalarbeiten angenom-men. Die Verfasser erklären sich mit einer nicht sinnentstel-lenden redaktionellen Bearbeitung einverstanden.
Erscheinungsweise: Zweimonatlich.
Bezugsbedingungen: Abonnementspreis jährlich 105,– Euro,(inkl. MwSt.), zuzüglich Porto und Versandkosten (zuzüglichMwSt. 7%); Bestellungen nehmen entgegen: Der Buchhandelund der Verlag; Abbestellungen vierteljährlich zum Jahresende.
Zahlungen jeweils im voraus an: Nomos-Verlagsgesellschaft,Postsbank Karlsruhe, Konto 73 636-751 (BLZ 660 100 75) undStadtsparkasse Baden-Baden, Konto 5-002266 (BLZ 662 500 30).
ISSN 0947-9856

Inhalt
VM 5/2004 227
Auf ein Wort ... 225
Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland 228Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam
Ausgehend von fünf maßgeblichen Treibern der Re-form des Haushalts- und Rechnungswesens schildernund bewerten die Autoren die Ansätze bei Bund,Ländern und Kommunen in Deutschland und ordnensie in einen internationalen Vergleich ein.
New Public Management und eGovernment 234Christian Bock
Während sich die Reformbewegung des New PublicManagement merklich verlangsamt hat und auchstärker in den Fokus der öffentlichen Kritik geriet, istElectronic Government – wenn auch nicht mehr mitdem gleichen Elan wie während des .com-Hypes –noch immer ein positiv belegtes Thema. Ziel des Bei-trags ist es, die gegenseitigen Beeinflussungen vonNew Public Management und eGovernment zu zei-gen. Dabei soll schwergewichtig gezeigt werden, wodas eine Programm dem anderen helfen kann, aberauch, wo seine Bremswirkungen zu beachten sind.
Networked Virtual Organisation 241Steve Du Mont und Willi Kaczorowski
Nicht nur in der Privatwirtschaft haben sich als Ant-wort auf die Globalisierung neue Strukturen vernetz-ter virtueller Organsiationen herausgebildet. Die Au-toren zeigen an vier konkreten Beispielen auf, dassdieses Organistionsmodell auch im öffentlichen Sek-tor trägt, und erkären die Ursachen diese Trends.
Wissensmanagement an den Schnittstellen öffentlicher Leistungsprozesse 246Bernhard Blanke und Henning Schridde
Die Qualität öffentlicher Leistungen von Verwaltun-gen wird zunehmend davon bestimmt, wie sie inner-organisatorisch und organisationsübergreifend Infor-mationen und Wissen zu nutzen verstehen. Um dieHandlungs- und Innovationsfähigkeit des Staates zubewahren, wenn nicht gar zu erhöhen, ist es erforder-lich, an den verschiedenen Schnittstellen öffentlicherLeistungsprozesse vorhandenes oder neues Wissenzu erschließen, zu verbreiten und anzuwenden, kurz,ein Wissensmanagement für öffentliche Leistungs-prozesse aufzubauen.
Gender Controlling in der Kommunalverwaltung 252Anke Rösener und Wulf Damkowski
Gender Mainstreaming ist als Begriff in aller Munde,häufig fehlt es aber an nachhaltigen Umsetzungen inder Praxis. Wer das Ziel der Geschlechtergerechtig-keit ernsthaft verfolgen will, ist darauf angewiesen,ein umfassendes Gender Controlling-System zu eta-blieren. Dabei ist Gender Controlling als Ansatz zurPlanung, Organisation, Umsetzung und Kontrolle ei-
ner verbindlichen Gleichstellungspolitik in Organisa-tionen zu verstehen. Gender Controlling stellt dabeikein isoliertes Bereichscontrolling dar, sondern sollteBestandteil eines Gesamt-Controlling-Systems sein.
Die Bedeutung von eGovernance für die Öffentliche Verwaltung 258
Thomas F. Gordon
Im öffentlichen Kontext bedeutet »Governance« dasSteuern und Führen der Gesellschaft im Interesse undzum Wohle der Allgemeinheit. Die dazu notwendigenGesetze und Regelungen unterliegen einem spezifi-schen Lebenszyklus. Unter eGovernance verstehenwir die Anwendung wissensbasierter Rechtsbera-tungssysteme (»Legal Knowledge-Based Systems«)für die Durchführung von Aufgaben innerhalb diesesLebenszyklus zur Verbesserung der Korrektheit,Transparenz und Effizienz von Verwaltungstätigkei-ten.
Innovative Leitbilder für Städte 264
Antje und Mathias Ernst
Wie können Leitbilder dazu beitragen, nachhaltigeZukunftsperspektiven für Städte zu erschließen? DerBeitrag geht dieser Frage nach, indem er generelleÜberlegungen mit einem aktuellen Werkstattberichtkombiniert.
Disziplinierung der Justiz zwischen Gerechtigkeit und Effektivität – Zur Justizreform in Bosnien und Herzegowina 270
Axel Schwarz und René El Saman
Wie sichert man die Rechtsstaatlichkeit in den Nach-folgestaaten des ehemaligen Jugoslawien? Wie misstman bei der Neubesetzung der Richter- und Staatsan-waltstellen Gesetzestreue und moralische Integritätder Bewerber? Wie ist die Disziplinargewalt in derJustiz auszuüben? Die Autoren berichten am BeispielBosnien und Herzegowina über diese Aufgaben.
Die Selbstbewertung nach dem EFQM-Modell (Teil 3 und Schluss) 274
Michael Trick
Die Berufsfeuerwehr Bochum hat sich zum Ziel ge-setzt, die Qualität ihrer Leistungserbringung nachhal-tig zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurdeals Grundlage für die Einführung eines Qualitätsma-nagement-Systems eine Selbstbewertung nach demEFQM-Modell in Form eines Pilotprojektes für denBereich des Rettungsdienstes vorgenommen.
Nachrichten 279
Vorschau 280

Grundlage der Studie
Das öffentliche Haushalts- und Rech-nungswesen befindet sich in Deutschlandund in den EU-Mitgliedsländern, aberauch bei der EU-Kommission selbst, in ei-nem fundamentalen Umbruch. Die aus-schließlich auf die finanzielle Sphäre aus-gerichteten Ansätze für die Steuerung öf-fentlicher Verwaltungen sind nicht mehrhinreichend leistungsfähig. Des Weiterenbringt die allgemeine Internationalisierungdes europäischen Einigungsprozesses ei-nen wachsenden Harmonisierungsbedarfmit sich. Einheitliche Mindeststandardswerden mittelfristig auch im öffentlichenSektor unabdingbar. Vor dem Hintergrunddieser Entwicklung war und ist das öffent-liche Haushalts- und Rechnungswesen mitseinen unterschiedlichen nationalen Aus-prägungen und Facetten seit Jahren Gegen-
stand des Forschungsinteresses der Mit-glieder des »Comparative InternationalGovernmental Accounting Research (CIGAR)«-Netzwerks. Diese Gruppe vonWissenschaftlern startete 2001 – initiiertvon Klaus Lüder und unter dessen Leitunggemeinsam mit Rowan Jones – eine empi-rische internationale Vergleichsstudie vonneun europäischen Ländern über den Standund die Entwicklungstendenzen der Re-form des öffentlichen Haushalts- undRechnungswesens.1 Differenziert wurdedabei zwischen der staatlichen und derkommunalen Ebene. Im Rahmen dieserStudie haben der Verfasser und die Verfas-serinnen des vorliegenden Beitrags die Si-tuation in Deutschland aufgearbeitet. Fürden Erkenntnisprozess und aktuellen Re-formstand, der im Folgenden aufgezeigtwird, waren nicht nur die Literaturstudien,empirischen Erhebungen und die Analyseneinzelner Konzepte vor Ort von Bedeu-tung, sondern ganz besonders auch die aufden vier Workshops während der Projekt-laufzeit (2001 bis 2003) sowie auch bilate-ral geführten Fachdiskussionen und Ein-schätzungen durch die europäischen Kolle-gen.2 Die Ergebnisse dieses Projektsmachen deutlich, dass die deutsche Refor-mentwicklung im europäischen Vergleicheinen starken Nachholbedarf hat und dies,
obwohl in den vergangenen zehn Jahrenganz erhebliche Ressourcen in die Ent-wicklung von Reformkonzepten und derenUmsetzung investiert worden sind.
Zur aktuellen Reformsituation
Reformtreiber
Das traditionelle öffentliche Haushalts-und Rechnungswesen in den deutschenGebietskörperschaften basiert auf der Ka-meralistik.3 Es ist eine reine Geldver-brauchsrechnung, in der nur Einnahmenund Ausgaben erfasst werden. Sie liefertkeine Informationen über Kosten und Lei-stungen, über das Vermögen, über reineGeldschulden hinausgehende Verbindlich-keiten und Rückstellungen und deren Ver-änderung.4 In Wissenschaft und Praxis be-steht inzwischen Konsens, dass dieses System zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept reformiert werden muss, sodassauch nicht zahlungswirksame Ressourcen-verbräuche erfasst werden.5 Zudem herrscht Einigkeit darüber, dass die input-orientierte Haushaltsplanung zu einer out-putorientierten Budgetierung zu transfor-mieren ist, um eine stärkere Leistungsori-entierung zu erreichen.6
Reformen des öffentlichen Haushalts- undRechnungswesens in Deutschland
Stand, Konzepte, Entwicklungsperspektiven
von Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam
Ausgehend von fünf maßgeblichen Treibern der Reform des Haus-halts- und Rechnungswesens schildern und bewerten die Autorendie Ansätze bei Bund, Ländern und Kommunen in Deutschlandund ordnen sie in einen internationalen Vergleich ein.
Dr. Christiane Behm istals wissenschaftliche
Beraterin in einer Reihevon Reformprojekten
zum öffentlichen Haus-halts- und Rechnungs-
wesen tätig.
Univ.-Professor Dr.Dietrich Budäus ist Leiter des LehrstuhlsPublic Management ander Hamburger Univer-sität für Wirtschaft undPolitik.
Dr. Berit Adam ist als wissenschaftli-che Beraterin in einerReihe von Reformpro-
jekten zum öffentlichenHaushalts- und Rech-
nungswesen tätig.
Ursachen und Konzepte der Reform des öffentlichen Finanzwesens im Überblick
228 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 228-233
1 Lüder/Jones (2003).2 Besonders profitiert haben wir dabei von der
Diskussion und von den Anregungen der Pro-jektleiter Klaus Lüder und Rowan Jones, de-nen hier noch einmal ausdrücklich gedanktsei.
3 Vgl. hierzu und zum Folgenden Lüder (1997);(1998); (1999); (2001); (2004); Budäus/Srocke(2004).
4 Vgl. Merschbächer (1987), S. 10 ff.5 Vgl. Lüder (1999), S. 1 ff. Zum derzeitigen
Stand der Reform des öffentlichen Haushalts-und Rechnungswesens in Europa vgl. die um-fassenden empirischen Studien in dem jüngstvon Lüder und Jones (2003) herausgegebenenSammelband Lüder/Jones (2003), S. 13 ff.;speziell zur aktuellen Situation in Deutschlandvgl. Budäus/Behm/Adam (2003), S. 273 ff.
6 Vgl. Budäus (2000), S. 305 ff.

Die Diskussion und die derzeitigenpraktischen Ansätze einer Reform des öf-fentlichen Haushalts- und Rechnungswe-sens in Deutschland lassen sich im We-sentlichen auf fünf Einflussgrößen bzw.Reformtreiber zurückführen.
Generelle Reformbewegung vom bürokratischen Verwaltungsmodell zumNew Public Management
Die Reform des öffentlichen Haushalts-und Rechnungswesens ist Teil der welt-weiten Bewegung eines generellen Wan-dels von der bürokratischen Verwaltungs-steuerung hin zu einer stärkeren Manage-mentorientierung.7 In Deutschland istdiese Entwicklung seit Anfang der 1990erJahre durch das neue Steuerungsmodellder Kommunalen Gemeinschaftsstelle fürVerwaltungsvereinfachungen (KGSt) auf-gegriffen worden. Generelle Merkmaledieser Reformbewegung sind:� die allgemeine Forderung nach weniger
Staat und einer schlanken Verwaltung� der Wandel vom produzierenden Staat
zum Gewährleistungsstaat� eine zunehmende Privatisierung und
wachsende Marktorientierung� Wettbewerb bzw. Quasi-Wettbewerb
sowohl zwischen öffentlichen als auchzwischen öffentlichen und privaten Or-ganisationen (Benchmarking; zwische-norganisatorische Vergleiche; Aus-schreibungswettbewerb)
� Anwendung von Managementkonzep-ten des privatwirtschaftlichen Sektors inöffentlichen Verwaltungen
� Trennung von politischer und admini-strativer Zuständigkeit
� dezentrale teilautonome Organisationennicht nur im peripheren öffentlichenSektor, sondern auch innerhalb derKernverwaltung.
Eine Reihe dieser neuen Strukturmerkmaleund Steuerungsprinzipien sind unmittelbarmit einem neuen Haushalts- und Rech-nungswesen verbunden.
Die anhaltende Finanzkrise der Gebietskörperschaften
Verwaltungsreformen und die Reform desöffentlichen Haushalts- und Rechnungswe-sens werden insbesondere seitens der Poli-tik als geeignete Maßnahmen angesehen,langfristig die öffentliche Verschuldungabzubauen und durch fundiertere Informa-tionen als Entscheidungsgrundlage not-wendige Handlungs- und Gestaltungsspiel-räume zurück zu gewinnen.8 Dabei sindRechnungs- und Haushaltswesen zwei Sei-ten einer Medaille. Die Reformkonzeptebeider Seiten müssen sich methodisch und
konzeptionell entsprechen. Das reformierteRechnungswesen soll ein realistisches, ausden Verwaltungsentscheidungen resultie-rendes, den tatsächlichen Verhältnissenentsprechendes Bild über die Vermögens-,Aufwands-/Kosten-, Ertrags-/Leistungs- undFinanzsituation einer Gebietskörperschaftgeben. Das reformierte Haushaltswesensoll die Entscheidungen über die Leistun-gen und den damit verbundenen Ressour-cenverbrauch steuern.
Eine isolierte Betrachtung einer Seiteist weder sinnvoll, noch konzeptionell insich stimmig – Rechnungswesen und Bud-getierung bzw. Haushaltswesen gehörenzusammen. Eine sukzessive Umsetzunglässt sich weniger unter konzeptionellen,
sondern vielmehr nur unter Implementie-rungsgesichtspunkten rechtfertigen. ZurVermeidung der Verselbstständigung undeiner isolierten, konzeptionslosen Ent-wicklung und Implementierung eines ein-zelnen Reformelements, insbesondere derKostenrechnung, ist von vornherein dieFestlegung des iterativ angestrebten Ge-samtkonzepts eines zukunftsorientiertenreformierten Haushalts- und Rechnungs-wesens mit den einzelnen Reformelemen-ten und deren Integration unabdingbar.
Die Bestrebungen um eine stärkere Flexibilisierung und wirtschaftlichereVerwendung von Haushaltsmitteln
Die Überlegungen zur Wirtschaftlichkeitund Flexibilisierung sind nicht neu. Siespielen schon seit je her in der Fachdiskus-sion in vielschichtiger Weise und in den unterschiedlichsten Empfehlungen eineRolle.9 Auch in der Praxis wurde dem Be-darf an Flexibilisierung inzwischen durchdie Ausdehnung der Deckungsfähigkeit undÜbertragbarkeit entsprochen. Allerdings ge-hen die heutigen Bestrebungen und Refor-mansätze weit darüber hinaus. Im Grundegeht es um eine umfassende Flexibilisie-rung durch eine vollständige Deckungs-fähigkeit in Form globaler Budgets. Ergän-zend hierzu wird in der Einführung einerKostenrechnung ein Ansatz gesehen, stär-ker der Forderung nach wirtschaftlichemVerhalten Rechnung zu tragen.
Die Forderung nach einer stärkerenBerücksichtigung der intergenerativenGerechtigkeit
Auf Grund der Verschuldung der öffent-lichen Gebietskörperschaften in einer aufDauer nicht mehr vertretbaren Größenord-nung sowie einer Vernachlässigung der systematischen und vollständigen Erfas-sung von über die Geldschulden hinaus ge-henden Verbindlichkeiten und Rückstel-lungen wird zunehmend deutlich, dass dienachfolgenden Generationen mit diesenFolgewirkungen belastet werden.10
Die tatsächlichen Lastenverschiebungenin die Zukunft werden im derzeitigen öf-fentlichen Haushalts- und Rechnungswesen
nicht erkennbar.11 Dieses Problem versuchtdie Finanzwissenschaft durch Generatio-nenbilanzen transparent zu machen. Hier-bei sind aber erhebliche Abgrenzungspro-bleme zu lösen und es muss mit stark ver-einfachenden Prämissen gearbeitet werden,etwa hinsichtlich der Zahlungsbewegungenbei den Generationenkonten. Von daherliegt es nahe, das öffentliche Haushalts-und Rechnungswesen grundlegend so zureformieren, dass die notwendigen Infor-mationen systemimmanent ohne Sonder-
Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam, Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland
VM 5/2004 229
»Das öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen befindet sich in Deutsch-land, in den EU-Mitgliedsländern und derEU-Kommission in einem fundamentalenUmbruch.«
7 Vgl. zum Beispiel Hood (1995), S. 104 ff.;Reichard (1994); (2001); Budäus (1994); Bu-däus/Conrad Schreyögg (1998); Schedler/Pröller (2000); Jann/ u. a. (2004).
8 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (1999),S. 16 f.; Bretschneider (1999), S. 4 f.; Finger(2001), S. 103. Zu den Funktionen und der Lei-stungsfähigkeit der einzelnen Instrumente vonVerwaltungsreform vgl. insbesondere Finger(2001), S. 201, S. 95 ff.; Buchholtz (2001).
9 Vgl. zum Beispiel Budäus/Lüder (1976), S.67ff.
10 Während die Geldschulden der öffentlichenGebietskörperschaften in einer Größenord-nung von 1,3 Billionen Euro für die Gebiets-körperschaften in Deutschland anzusetzensind, werden die von der nächsten Generationzu tragenden tatsächlichen Verpflichtungen inrecht unterschiedlichen Größenordnungen an-gegeben. Einzelne Autoren beziffern die»wahre Staatsverschuldung« bezogen auf dasJahr 1997 mit mehr als 270% des Sozialpro-dukts; vgl. Raffelhüschen/Feist (2000), S. 19.
11 Vgl. Raffelhüschen/Feist (2000), S. 9.

rechnungen bereitgestellt werden. Mit demneuen öffentlichen Rechnungswesen exi-stiert ein Ansatz, der die notwendige peri-odengerechte Erfassung des Ressourcen-verbrauchs systemimmanent gewährleistet.
Die internationale Entwicklung und daraus resultierende Anpassungs- undHarmonisierungsbedarfe
Schließlich erfordert die internationale Re-formentwicklung12 im öffentlichen Haus-halts- und Rechnungswesen ganz wesentli-che Anpassungsmaßnahmen und Umstruk-turierungen in Deutschland sowohl aufkommunaler Ebene als auch auf Staatsebe-ne. Es gibt einen zunehmenden Bedarf fürvergleichbare Informationen von Regionenund Staaten auf internationaler Ebene, ins-besondere auf EU-Ebene.13
Reformelemente
Die nationale und internationale Reform-bewegung bezieht sich mit unterschiedli-
chen Intensitäten auf unterschiedliche Ele-mente des öffentlichen Haushalts- undRechnungswesens.
Reformelement »Rechnungssystem«
Das Rechnungssystem steht für die kon-zeptionelle Grundlage des Haushalts- undRechnungswesens. Es vollzieht sich zur-zeit der Wandel von der klassischen Ka-meralistik über die erweiterte Kameralistikhin zu einem am Ressourcenverbrauch ori-entierten Haushalts- und Rechnungswesenin Form einer integrierten Verbundrech-nung auf Basis der Doppik.15
Die klassische Kameralistik ist ein rei-nes Geldverbrauchskonzept. Bei der erwei-terten Kameralistik bleibt das kameraleSystem grundsätzlich erhalten. Das Geld-verbrauchskonzept wird lediglich um eineKostenrechnung additiv erweitert und umInformationen über Leistungen in Formvon Produktkatalogen. Die integrierte Ver-bundrechnung zeichnet sich dadurch aus,dass sie das Geldverbrauchskonzept alsführendes Rechnungssystem zugunsten desRessourcenverbrauchskonzepts ablöst. Da
in diesem grundlegenden Reformkonzeptauch jener Ressourcenverbrauch auszuwei-sen ist, der in der entsprechenden Haus-haltsperiode nicht mit Zahlungen verbun-den ist, wie etwa Abschreibungen oderPensionsverpflichtungen, ändert sich auchdie auszuweisende Verschuldung von denGeldschulden zu den gesamten Schulden16
als Fremdkapital.Neben den aus dem kaufmännischen
Rechnungswesen bekannten Elementender Ergebnisrechnung (im privatwirt-schaftlichen Rechnungswesen »Gewinn-und Verlustrechnung«) und der Vermö-gensrechnung (im privatwirtschaftlichenRechnungswesen »Bilanz«) besteht kon-zeptionell Einigkeit, dass im öffentlichenBereich auf eine Abbildung von Zahlun-gen im Rahmen einer Finanzrechnungnicht verzichtet werden kann. Im Unter-schied zum kaufmännischen Rechnungs-wesen wird daher konzeptionell für den öf-fentlichen Bereich ein Drei-Komponenten-Rechnungswesen mit einer Ergebnis-,Vermögens- und Finanzrechnung gefor-
dert. Der zu diesem Rechnungswesen spie-gelbildlich geführte doppische Haushaltgliedert sich in einen Ergebnis- und Fi-nanzhaushalt. Eine Plan-Vermögensrech-nung wird in keinem Konzept diskutiert,da künftige Änderungen der Vermögens-rechnung durch die Aufstellung eines Er-gebnis- und Finanzhaushalts vollständigerklärt werden.
Im Mittelpunkt der integrierten Verbund-rechnung (Drei-Komponenten-Modell) stehtdie Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnis-haushalt, mit deren Saldo gemessen wird,ob die Erträge (Ressourcenaufkommen)und Aufwendungen (Ressourcenverzehr)sich mittelfristig entsprechen (Haushalts-ausgleich). Hinter der Forderung nach mit-telfristigem Ausgleich von Ressourcenauf-kommen und -verzehr steht die »Philoso-phie«, dass jede Generation ihren Konsumselbst zu erwirtschaften hat (intergenerativeGerechtigkeit).
Reformelement »Rechnungslegung«14
Bei der Reform der Rechnungslegung gehtes um für den öffentlichen Bereich sinn-
volle Vorschriften für Ansatz, Ausweis,Bewertung und Konsolidierung. Für diedeutschen Gebietskörperschaften wird inden bisherigen Reformansätzen für dieRechnungslegung überwiegend auf dasHGB zurückgegriffen.
Unter Einbeziehung der internationalenEntwicklung existieren aber inzwischen fürden öffentlichen Bereich praktisch drei un-terschiedliche Referenzmodelle: das HGB(Handelsgesetzbuch), die IAS/IFRS (Inter-national Accounting Standards/Internatio-nal Financial Reporting Standards) und die IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), die sich stark andie IAS/IFRS anlehnen. Das HGB wird al-lerdings mittelfristig nicht mehr das domi-nante Referenzmodell sein. Es entsprichtmit seinem Vorsichts- und Imparitätsprin-zip nicht den Anforderungen an eine dietatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-,Finanz- und Ergebnislage abbildendenRechnungslegung. Damit wird auch der ausdem Vorsichts- und Imparitätsprinzip re-sultierende hohe Stellenwert der Kosten-rechnung zur Ermittlung des tatsächlichenRessourcenverbrauchs an Bedeutung ver-lieren. Der Bedarf eines zusätzlichen Rech-nungskreises für ein das externe Rech-nungswesen ergänzendes internes Rech-nungswesen wird zurückgehen, sodass sichdie Komplexität des Rechnungswesens ins-gesamt verringert.
Ursachen und Konzepte der Reform des öffentlichen Finanzwesens im Überblick
230
12 Vgl. hierzu Jones/Lüder (2003).13 Dabei ist zu beobachten, dass die staatliche
Ebene der kommunalen Ebene mit einer ge-wissen Zeitverzögerung folgt; vgl. Lüder(2003), S. 19.
14 Teilweise wird in der Literatur die Rechnungs-legung (Ansatz und Bewertung) mit dem Rech-nungssystem/Rechnungskonzept zusammenge-fasst; vgl. etwa Lüder/Kampmann (1995), S.17ff.
15 Hier wird bewusst der Begriff »integrierteVerbundrechnung« gewählt, statt des vor al-lem in der kommunalen Praxis verwendetenBegriffs »Doppik«. Damit soll besonders aufdie Integration der Finanzrechnung (Verbund-rechnung bezieht sich im kaufmännischenRechnungswesen nur auf den Verbund vonVermögens- und Erfolgsrechnung) abgestelltwerden, aber auch auf die Integration derdurch das Rechnungssystem geprägten kon-zeptionellen Verknüpfung von Haushaltswe-sen und Rechnungswesen. Im Rahmen desSpeyerer Verfahrens wird dieses Rechnungs-system auch als Drei-Komponenten-Rechnung– bestehend aus einer Vermögensrechnung(Bilanz), Ergebnisrechnung (Gewinn- undVerlustrechnung) und Finanzrechnung (Kapi-talflussrechnung) – bezeichnet. Vgl. Lüder(2001), S. 37.
16 Vgl. Lüder (2001), S. 48 f.
»Die fünf Reformtreiber sind:mehr Management, Wirtschaftlichkeit und
intergenerative Gerechtigkeit sowie die Finanzkrise und die internationale
Harmonisierung im Rechnungswesen.«

Reformelement »Konsolidierung«
Die Vielzahl und Heterogenität der Rechts-und Organisationsformen mit unterschied-lichen Rechnungssystemen in den einzel-nen Gebietskörperschaften macht es zur-zeit unmöglich, einen Gesamtüberblicküber die Vermögens-, Finanz- und Ergeb-nislage einer Gebietskörperschaft alsGanzes zu erhalten. So werden nicht seltenverselbstständigte öffentliche Einheitenganz bewusst als Schattenhaushalte ge-schaffen oder genutzt, um die Vermögens-und Finanzlage einer Gebietskörperschaftzu verschleiern. Intergenerative Gerechtig-keit kann somit nicht kontrolliert werden.
Um die Konsolidierung zu erleichtern,werden in einem reformierten öffentlichenRechnungswesen für die Einzelabschlüsseöffentlicher Einheiten, die zum Rechtskreis»Kernverwaltung« zählen (Kernverwaltungund organisatorisch verselbstständigte, aberrechtlich unselbstständige Organisationsein-heiten) ein einheitliches Rechnungssystemgefordert. In einem weiteren Schritt sind dieEinzelabschlüsse der Kernverwaltung undder zur wirtschaftlichen Einheit »Kernver-waltung« zählenden verselbstständigtenEinheiten unabhängig von ihrer Rechtsformzu einem Konzernabschluss zu konsolidie-ren. Erst der Konzernabschluss ermöglichteinen Überblick über die finanzielle Ge-samtsituation der Gebietskörperschaft. Aufkommunaler Ebene wird diesem Aspekt inersten Ansätzen Rechnung getragen, zumBeispiel in den Städten Stuttgart, Solingensowie Wiesloch und Uelzen.
Reformelement »Budgetierung«
Der Budgetierung wird im aktuellen Re-formprozess ein hoher Stellenwert beige-messen.17 Dies ist rein pragmatisch be-gründet. Die globale Budgetierung istzunächst einmal eine intelligente Sparstra-tegie. »Intelligent« ist diese Strategie des-halb, weil die Einsparentscheidungen nichtmehr auf politischer Ebene in einem – inder Regel konfliktären – Prozess herbeige-führt werden müssen, sondern in die de-zentralen Verwaltungseinheiten »vor Ort«verlagert werden, verbunden mit gewissenAnreizmechanismen für die einzelnen Or-ganisationseinheiten.18 Die Budgetierungselbst bleibt dabei bisher weitgehend inpu-torientiert und beschränkt sich auf die Ab-kehr von der klassischen Zweckbindungder Mittel zugunsten einer umfassendenDeckungsfähigkeit.19 Mit der Verlagerungvon Einsparentscheidungen und damit inder Regel auch Leistungsprogramment-scheidungen in die einzelnen Verwaltun-gen geht eine Entpolitisierung bisher poli-tischer Entscheidungen einher.
Reformelement »Kosten- und Leistungs-rechnung«
Die Grundlage für effizientes Verwal-tungshandeln ist die Bereitstellung von In-formationen über Aufwendungen/Kostenund Erträge/Leistungen.20 Deshalb ist dieNotwendigkeit von Kosten- und Leistungs-rechnungen in öffentlichen Verwaltungenauch nicht mehr umstritten. Unterschiedli-che Auffassungen gibt es allerdings dar-über, ob Kosten- und Leistungsrechnungenflächendeckend oder – wie § 6 Absatz 3HGrG (Haushaltsgrundsätzegesetz) formu-liert – nur in »geeigneten Bereichen« ein-geführt werden sollen. Diese Formulierungerweckt den Eindruck, es gäbe geeigneteund nicht geeignete Bereiche für die Ein-führung einer Kosten- und Leistungsrech-nung. Die flächendeckende Einführung derKosten- und Leistungsrechnung in öffent-lichen Verwaltungen wird damit qua defi-nitione generell ausgeschlossen, i.d.R. einewenig sinnvolle Vorgehensweise. Zweck-mäßig erscheint es, zwischen Bereichen zu
unterscheiden, die sich von vornherein gutfür die Einführung und Praktizierung einerKostenrechnung eignen und solchen, diesich zunächst weniger gut eignen. Im er-sten Fall lassen sich auf Grund der vorge-gebenen Organisationsstruktur und der Artdes Leistungsprogramms Kosten und Lei-stungen gut erfassen, abgrenzen und zu-rechnen. Im zweiten Fall ist dies aus denunterschiedlichsten Gründen schwieriger.Generell gilt jedoch, dass überall dort, woRessourcen verbraucht werden, diese sichauch organisations- und leistungsbezogen,wenn auch nicht immer ganz einfach, er-fassen lassen müssen.
Die Kosten- und Leistungsrechnungstellt bei einem ressourcen- und outputori-entierten Haushaltswesen die Schnittstellezwischen Rechnungs- und Haushaltswesendar. Die sich in der Praxis nur in Einzelas-pekten unterscheidenden Ansätze konzen-trieren sich dabei überwiegend auf eineKostenrechnung. Das Problem der Lei-stungsrechnung ist bisher für den öffentli-chen Sektor noch nicht hinreichend gelöst.Zwar werden in zunehmendem Maße – re-lativ isoliert – Produktkataloge aufgestellt;die daraus abgeleiteten Produkte sind je-
doch häufig nicht identisch mit den Ko-stenträgern in der Kostenträgerrechnung.
Die Position Deutschlands im europäischen Vergleich
Auf internationaler Ebene ist der Reform-trend weltweit, besonders aber auch in Eu-ropa »eindeutig und einheitlich«.21 Dernotwendige Ersatz oder zumindest aber dieErgänzung des zahlungsorientierten öffent-lichen Haushalts- und Rechnungswesensdurch ein ressourcen- und outputorientier-tes Haushalts- und Rechnungswesen ist unstrittig. Es setzt sich zunehmend die inte-grierte Verbundrechnung mit Vermögens-rechnung, Ergebnisrechnung und Finanz-rechnung durch. »Ausgangspunkt und er-ster Schritt einer Gesamtreform desHaushalts- und Rechnungswesens ist in derRegel die Umgestaltung des finanziellenRechnungssystems und der Rechnungsle-gung«.22 Eine erste umfassende empirischfundierte Analyse des Entwicklungsstandsdes öffentlichen Haushalts- und Rech-
nungswesens in Europa23 zeigt sehr deut-lich den Reformrückstand Deutschlands.
Neben Italien und den Niederlandenbildet Deutschland auf staatlicher Ebenedas Schlusslicht der internationalen Re-formbewegung. Als Ausnahme ist aller-dings ausdrücklich auf den Reformansatzim Land Hessen zu verweisen. Hier wirdversucht, flächendeckend für die Staats-ebene eines Bundeslandes die integrierteVerbundrechnung einzuführen. Weitere er-ste Ansätze in diese Richtung finden sichinzwischen in den Stadtstaaten Hamburgund Bremen und jüngst auch in Nordrhein-Westfalen. Auf kommunaler Ebene stelltsich die Situation vergleichsweise positivdar. Es zeichnet sich ab, dass die überwie-gende Mehrheit der Bundesländer dieDoppik verbindlich vorschreiben wird.Dies ergibt sich allein aus statistischen
Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam, Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland
VM 5/2004 231
»Die fünf Reformelemente finden sich inRechnungssystem, Rechnungslegung, Budgetierung, Kosten- und Leistungs-rechnung sowie Konsolidierung.«
17 Vgl. Frischmuth (1999), S.139 ff.18 Vgl. Schwarting (1999), S. 135 ff.19 Vgl. hierzu bereits Budäus/Lüder (1972).20 Vgl. hierzu und zum Folgenden Lüder (2001).21 Lüder (2004), S. 2.22 Lüder (2004), S. 2.23 Vgl. Lüder/Jones (2003).

Harmonisierungserfordernissen und ausrein praktischen Erwägungen seitens derSoftwareanbieter, die auf Dauer nicht zweiSysteme vorhalten werden.
Reformen auf Bundesebene
Reformaktivitäten im Überblick
Die Reformaktivitäten auf Bundesebenekonzentrieren sich auf die Budgetierungund die Kosten- und Leistungsrechnung.Über die Reformaktivitäten zur Budgetie-rung ist relativ schnell berichtet. Die Re-form des Haushaltsgrundsätzegesetzes(HGrG) aus dem Jahre 1998 mit der Ziel-setzung der Flexibilisierung der Mittelbe-wirtschaftung ist auf Bundesebene zumin-dest in der Kernverwaltung weitgehendohne Folgen geblieben. Die Bundeshaus-
haltsordnung (BHO) wurde bisher nichtangepasst. Deckungsfähigkeit und Über-tragbarkeit bleiben im Rahmen des bisheri-gen (beschränkten) Nutzungspotenzials,und auch der mögliche Wandel von einerinputorientierten zur outputorientiertenBudgetierung spielt in der Kernverwaltungdes Bundes bisher keine besondere Rolle.
Zwar sind durchaus einige Versuche zubeobachten, outputorientierte Budgets undProduktkataloge zu entwickeln.24 DieseBemühungen stehen im Zusammenhangmit der Einführung von Kosten- und Lei-stungsrechnungen, bei denen im Grundegenommen die Kostenträgerrechnung eineFestlegung der den Ressourcenverbrauchverursachenden Produkte als Kostenträgervoraussetzt. Jedoch scheint ein Hauptpro-blem offensichtlich darin zu liegen, Pro-dukte als Output zu definieren. So findensich auch anschauliche Beispiele, in denen
weniger die Leistung selbst, sondern eherallgemeine klassische Funktionen undAufgaben zu Produkten umdefiniert wer-den.25 Dies gilt etwa dann, wenn »Beam-ten- und Laufbahnrecht«, »Versorgungs-recht« und »Besoldungsrecht« als Produk-te bezeichnet werden.
Die Reformaktivitäten zum Rechnungs-wesen konzentrieren sich auf die Kosten-und Leistungsrechnung und erwecken denEindruck einer umfassenden Ausrichtungder Bundesverwaltung auf wirtschaftlichesHandeln. Grundlage ist das von einer Un-ternehmensberatung 1997 erarbeitete Kon-zept einer standardisierten Kosten- undLeistungsrechnung. Inzwischen gilt diesesKonzept generell als Orientierung für dieEinführung von Kosten- und Leistungs-rechnungen in den einzelnen Bundesres-sorts.26 Es dient auch als Grundlage derAusbildungskonzeption auf diesem Gebietfür alle öffentlichen Einheiten auf Bundes-ebene. Wie bereits angedeutet, liegt dasProblem darin, dass die Einführung vonKosten- und Leistungsrechnungen seitensdes Gesetzgebers nur für »geeignete Berei-che«27 gefordert wird und nicht flächen-deckend für die gesamte Verwaltung. Des-halb kann jeder einzelne Minister entschei-den, welche Einheiten als geeignetanzusehen sind und damit, in welchemUmfang überhaupt eine Kostenrechnungzur Anwendung kommt.28
Durch die standardisierte Kosten- undLeistungsrechnung soll das klassische (ka-merale) Geldverbrauchskonzept durch In-formationen über den Output und dentatsächlichen Ressourcenverbrauch ergänztwerden. Dieses beinhaltet� die Definition von Produkten und Pro-
duktgruppen als Grundlage für eine out-putorientierte Budgetierung
� die Kostenermittlung für den Output/dieProdukte
� eine systematische Definition von Ko-stenarten und Leistungsarten
� interne Leistungsverrechnungen.Entsprechend werden als konkrete Zielset-zungen der standardisierten Kosten- undLeistungsrechnung genannt29
� Transparenz von Kosten und Leistun-gen
� Planung, Steuerung und Kontrolle vonKosten und Leistungen
Ursachen und Konzepte der Reform des öffentlichen Finanzwesens im Überblick
232
24 Vgl. hierzu zum Beispiel Bundesministeriumder Finanzen (1997), S. 64 ff.; Bundesministe-rium des Innern (1999), S. 8 ff.
25 Vgl. Bundesministerium des Innern (2001), S.11; Bundesministerium des Innern (2002), S.12 ff.; Bundesministerium des Innern (1999a), S. 2 ff.
26 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (1997).27 § 6 Absatz 3 HGrG.28 Vgl. hierzu auch Lüder (2001), S. 58 ff.29 Vgl. Bundesfinanzministerium (1997), S. 24.
Bild 1: Stand der Reform des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Europa (Quelle: Lüder/Jones (2003a), S. 21; eigene Übersetzung)
Bild 2: Phasen der Reform des öffentlichen Rechnungswesens im europäischen Vergleich(Quelle: Lüder/Jones (2003a), S. 20 eigene Übersetzung) Legende: vgl. Bild 1.

� Unterstützung der Haushaltsplanungund Mittelbewirtschaftung
� Kalkulation kostendeckender Gebührenund Entgelte
� innerbetriebliche Leistungsverrechnung� Unterstützung von Privatisierungsent-
scheidungen� Ergänzung der bestehenden Instrumente
und Verfahren des Haushalts- undRechnungswesens.
Die standardisierte Kosten- und Leistungs-rechnung kommt bisher überwiegend innachgeordneten Bundesbehörden zur An-wendung30 wie� Kraftfahrtbundesamt� Fachhochschule des Bundes� Eisenbahnbundesamt� Umweltbundesamt� Zollverwaltung� Bundesamt für Sicherheit und Informa-
tion� Presse- und Informationsamt der Bun-
desregierung� Deutscher Wetterdienst.Neben der standardisierten Kosten- undLeistungsrechnung existiert ein Vorschlagdes Bundesrechnungshofs zur Reform derVermögensrechnung des Bundes.31 Anlasshierfür ist die Tatsache, dass die nach §§73, 86 BHO geforderte Vermögensrech-nung nur unzureichende Informationen lie-fert über das Vermögen des Bundes unddie tatsächlichen Schulden. Ausgewiesenwerden nur die langfristigen Geldschulden.Der Reformvorschlag lehnt sich an dieVermögensrechnung im Rahmen der inte-grierten Verbundrechnung an. Auf derVermögensseite wird unterschieden zwi-schen Verwaltungsvermögen, realisierba-rem Vermögen, Vermögen im Gemeinge-brauch und Finanzvermögen. Auf der Ka-pitalseite werden auch Rückstellungen indas Fremdkapital einbezogen. Dieser hiervorliegende Vorschlag einer Vermögens-rechnung des Bundes hat bisher allerdingskeine praktischen Konsequenzen nach sichgezogen.
Konzeptionelle Merkmale der Reformprojekte
Die bisher auf Bundesebene vor allem beiden nachgeordneten Bundesbehörden durch-geführten Pilotprojekte orientieren sichkonzeptionell am Rechnungssystem der er-weiterten Kameralistik. Das führende Sy-stem der Geldverbrauchsrechnung wird er-gänzt um Informationen über Leistungenund Kosten. Diese Informationen stehenallerdings isoliert neben dem klassischenkameralen Haushalt. Die erweiterte Kame-ralistik ermöglicht dabei keine systemati-sche Ableitung des Haushalts aus der Ko-stenrechnung. Sie eignet sich nur für die
einseitige Ermittlung der Kosten aus derkameralen Haushaltsrechnung, soweit essich um zahlungsorientierte Kosten han-delt und zusätzlich eine Vermögensrech-nung für die nicht zahlungswirksamen Ko-sten (Abschreibungen, Zuführungen zuRückstellungen) durchgeführt wird. Ko-sten und Leistungen sind lediglich ergän-zende ex ante über eine (meist fehlerhaft
geführte) Nebenrechnung bereitgestellteInformationen, ohne dass diese für dieBudgeterstellung der Folgeperiode eine sy-stematisch steuernde Wirkung haben. Dasleitende System für Verwaltungshandelnbleibt faktisch der klassische, am Geldver-brauch inputorientierte Haushalt und nichtumgekehrt. Die Kosten können zwardurchaus für fallweise Wirtschaftlichkeits-vergleiche oder Entscheidungen, etwa überAusgliederung/Fremdbezug, herangezogenwerden, eine systematische, flächen-deckende und auf Dauer angelegte Steue-rung des Budgets im Sinne eines ressour-cen- und outputorientierten Ergebnisbud-gets ist nicht möglich.32
Das vom Bundesrechnungshof vorge-legte Konzept einer Vermögensrechnungorientiert sich an der Erstellung einer Bi-lanz im privatwirtschaftlichen Bereich. Einderartiger Ansatz wäre, wenn er dennpraktisch umgesetzt würde, durchaus ge-eignet, die tatsächliche Vermögens- undSchuldensituation wiederzugeben.33
Stand und Probleme der Umsetzung
Im Vergleich zur Reform des Haushalts-und Rechnungswesens in Europa, in letzterZeit insbesondere auch bezogen auf jenesder EU-Kommission, sind die Reformakti-vitäten auf der deutschen Bundesebeneeher als sehr zurückhaltend einzustufen.Ein systematisches Konzept einer ressour-cen- und outputorientierten Budgetierungist ebenso wenig zu erkennen wie ein res-sourcenorientiertes Rechnungswesen. Eingrundlegender Wandel vom Geldver-brauchskonzept zu einem Ressourcenver-brauchskonzept ist nicht erkennbar.
Die notwendigen Reformen werden sei-tens des Gesetzgebers wenig bis gar nicht
unterstützt. Obwohl das HGrG geändertwurde, brachten die Modifikationen keinefundamentale Erneuerung des Haushalts-und Rechnungswesens. Durch die neu ein-geführten §§ 6a und 33a im HGrG kanneine outputorientierte Budgetierung undein Ressourcenverbrauchskonzept auf Ba-sis der Doppik nur eingeführt werden,wenn die traditionelle Budgetierung und
das kamerale Rechnungswesen parallelweiter geführt werden. Als Konsequenz er-gibt sich hieraus, dass die Verwaltungensich weiterhin an dem alten System orien-tieren werden. Auch stellt sich die Frage,ob seitens der Politik und Verwaltung diemit einem reformierten öffentlichen Haus-halts- und Rechnungswesen angestrebteTransparenz tatsächlich gewollt ist.
Fortsetzung in Heft 6/2004
Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam, Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland
VM 5/2004 233
30 Vgl. Bundesregierung (2002), S. 18 ff.31 Vgl. Bundesrechnungshof (2001).32 Die derzeitig zu beobachtenden Versuche, ein
outputorientiertes Budget auf der Grundlagevon Kosten- und Leistungsrechnungen unterBeibehaltung des kameralen Haushalts aufzu-stellen, sind zu vergleichen mit den Bemühun-gen, Anfang der 1930er Jahre die Betriebska-meralistik einzuführen. Unter Beibehaltungder kameralen Rechnung sollte damals dengewandelten Anforderungen an das Rech-nungswesen öffentlicher Betriebe Rechnunggetragen werden. Dabei zeigt sich, dass dieszwar theoretisch mit einem sehr komplexenund intransparenten System der Betriebska-meralistik durchaus möglich war. Die Praxishat sich jedoch sehr bald dafür entschieden,für öffentliche Betriebe das gleiche Rech-nungswesen wie für private einzuführen. Des-halb ist auf Dauer auch für die erweiterte Ka-meralistik zu erwarten, dass sie von demdoppischen ressourcenorientierten Haushalts-und Rechnungswesen abgelöst wird.
33 Insofern ist einerseits den öffentlichen Äuße-rungen des Bundesrechnungshof-Präsidenten,Prof. Dr. Dieter Engels (vgl. Interview im»Spiegel« Nr. 1/29.12.2003, S. 32 ff.) zuzu-stimmen, dass der Bund nicht weiß, welchesVermögen er im Einzelnen besitzt. Problema-tisch hingegen erscheint die Äußerung, dass»wir wissen, wie viele Schulden der Bundhat«. Bekannt und ausgewiesen sind faktischnur die Geldschulden.
»Eine erste fundierte Analyse des Entwicklungsstands des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Europa zeigt sehr deutlich den Reformrückstand Deutschlands.«

Einleitung
In der Lehre ist derzeit keine klare Haltungüber das gegenseitige Verhältnis von eGo-vernment und New Public Management(NPM) festzustellen. Es finden sich diver-gierende Aussagen:1� Es handle sich um zueinander neutrale
und isolierte Entwicklungen.� Die beiden seien zueinander komple-
mentär.� eGovernment sei das Umsetzungsin-
strument von NPM.� eGovernment werde durch NPM eher
beeinträchtigt.� eGovernment sei die elektronische Va-
riante des NPM.� eGovernment sei der Nachfolger von
NPM.� NPM und eGovernment seien sich er-
gänzende Ansätze mit aber unterschied-lichen Auslösern.2
� eGovernment sei die gemeinsame Ver-bindung der drei Entwicklungsstränge»Informationstechnologie«, »Manage-mentinnovation« und NPM.3
� eGovernment könne als Ergänzung, alsErweiterung oder als Zusatz zu NPMverstanden werden.4
� Zwischen NPM und eGovernment be-stünde faktisch keine direkte Verbin-dung. Eine Einführung von NPM in einer Verwaltung bedinge nicht gleich-zeitig eine Einführung von eGovern-ment und umgekehrt. Trotzdem stündenbeide Begriffe für eine Zukunftsorien-tierung und Modernisierung der Verwal-tung und können sich unter Umständengegenseitig positiv beeinflussen.5
� Bei eGovernment und bei NPM handlees sich um zwei Reformtypen – Reformaus Sachzwang und Reform aus Ein-sicht –, die sich unterscheiden, aberauch ergänzen.6 Man brauche die Zieledes NPM nicht aufzugeben, denn aufdem langen Weg dahin komme man anModernisierungen wie eGovernmentvorbei.
� eGovernment schliesse den Kreis vonVerwaltungsmodernisierung und Infor-mations- und Kommunikationstechnik(IuK), die beide in einem wechselseiti-gen Bedingungsgefüge zueinander stün-den.7
Ziel dieses Beitrags ist es, dieses gegensei-tige Verhältnis der beiden Konzepte näherzu beleuchten und namentlich auch darzu-legen, dass es auch eine gegenseitige nega-tive Beeinflussung gibt.
Definitionen
New Public Management
NPM verfügt nicht über eine scharfe, mög-licherweise gar in einem Rechtsakt nieder-gelegte Definition. Schedler/Proeller defi-nieren NPM als »die Anwendung von mo-dernen Management-Methoden auf die
öffentliche Hand mit dem Ziel, den Staatdurch eine stärkere Ausrichtung an denBedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgerzu stärken.«8 Je nach Land wird für NPMgar eine unterschiedliche Terminologieverwendet.9 Vor dem Hintergrund diesesThemas ist es nicht nötig, auf die histori-schen, theoretischen und faktischen Unter-schiede resp. Gemeinsamkeiten näher ein-zugehen. Es sei einzig schon hier erwähnt,dass der Zusatz »new« teilweise übertrie-bene Erwartungen resp. zu negative Asso-ziationen weckt. Die mitteleuropäischenVerwaltungen waren und sind (grössten-teils) Hochleistungsverwaltungen.10 Einigefür den Bürger wichtige Anliegen desNPM lassen sich bereits auf der Basis desklassischen Verwaltungsrechts verwirkli-chen. Dieses »aber« soll nicht als Kritikam NPM verstanden werden; wir werdensehen, dass der schon hohe Qualitätsstan-dard der Verwaltungsleistungen ein Hin-dernis für eGovernment im NPM darstel-len kann.
eGovernment
Nachdem das Journal of E-Governmentder Definition von eGovernment11 eineganze Ausgabe hat widmen können,12 soll
New Public Management und eGovernmentvon Christian Bock
Während sich die Reformbewegung des New Public Managementmerklich verlangsamt hat und auch stärker in den Fokus der öf-fentlichen Kritik geriet, ist Electronic Government – wenn auchnicht mehr mit dem gleichen Elan wie während des .com-Hypes –noch immer ein positiv belegtes Thema. Ziel des vorliegenden Bei-trags ist es, die gegenseitigen Beeinflussungen von New Public Ma-nagement und eGovernment zu zeigen. Dabei soll schwergewichtiggezeigt werden, wo das eine Programm dem anderen helfen kann,aber auch, wo seine Bremswirkungen zu beachten sind.
Dr. Christian Bock,M.B.L., M.B.A. ist Mit-glied der Direktion desEidgenössischen Insti-tuts für Geistiges Eigen-tum, Bern.
eGovernment und New Public Management: gegenseitige Hinderer oder Helfer?
234 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 234-240
1 Mehlich 2002, S. 19 f. m.w.N.2 Summermatter 2003, S. 12 f.; Schedler
2003a, S. 107 ff.3 Booz 2002, S. 22 f.4 Luginbühl 1998, S. 7.5 eGovernment Glossar des Kompetenzzen-
trums eGovernment der Berner Fachhoch-schule: http://glossar.iwv.ch.
6 Reinermann 2003, S. 404.7 Fischer 2002, S. 45.8 Schedler 2003b.9 »Neues Steuerungsmodell« in Deutschland;
»Wirkungsorientierte Verwaltungsführung«,»Wirkungsorientierte Führung der Verwal-tung« und »Neue Verwaltungsführung« in derSchweiz.
10 Begriff nach Kurt Eichenberger, Hochlei-stungsverwaltung des entfalteten Sozialstaa-tes, in: Walter Haller, Georg Müller, AlfredKölz und Daniel Thürer, FS für Ulrich Häfelinzum 65. Geburtstag, Schulthess Polygraphi-scher Verlag, Zürich 1989, S. 443 ff.
11 Zur Kritik am Terminus eGovernment vgl.Urs Albrecht, E wie electronic, in: LeGes –Gesetzgebung & Evaluation, Heft 2001/1, S.85 ff.
12 Journal of E-Government, Heft 1/2004.

hier nicht der (sicherlich untaugliche) Ver-such unternommen werden, dies in nur we-nigen Zeilen zu tun; ich folge daher der»offiziellen« Schweizer Definition: eGo-vernment umfasst die Unterstützung derBeziehungen, Prozesse und der politischenPartizipation innerhalb der staatlichenStellen aller Ebenen (Bund/Kantone/Ge-meinden) sowie zwischen den staatlichenStellen und all ihren Anspruchsgruppen(zum Beispiel Bürger/Unternehmen/Insti-tutionen) durch die Bereitstellung entspre-chender Interaktionsmöglichkeiten mittelselektronischer Medien.13
Der Begriff eGovernment besteht auszwei Dimensionen: dem regulierendeneGovernment, das heisst der Gestaltung derRahmenbedingungen für die Informations-gesellschaft (eGovernance, ePolicy) sowiedem partizipierenden eGovernment, beiwelchem die öffentliche Hand als Anwen-derin der IuK im Dienste effizienterer Ver-waltungs- und Geschäftsprozesse auftritt.Schwerpunkt dieses Beitrags bildet daspartizipierende eGovernment, denn es ver-wirklicht – wie auch NPM – die Schnitt-stelle zum Kunden resp. Bürger.14
Erwartungen ans eGovernment
Die Kunden resp. Bürger (in der Folgewerden beide Begriffe synonym verwen-det) stellen an eGovernment verschiedeneexplizite und implizite Anforderungen.Zunächst soll der Frage nachgegangenwerden, welche allgemeinen Vorteile eGo-vernment ihnen bringt. Alsdann ist derFrage nachzugehen, was für Erwartungenüberhaupt an eGovernment-Transaktionenangelegt werden. Hierbei darf nicht ver-gessen werden, dass der Kunde (jedenfallsnoch heute) immer eine Wahlmöglichkeithat, das heisst, er kann sich von Fall zuFall entscheiden, ob er traditionell (dasheisst persönlich, per Telefon oder auf Pa-pier) mit der Verwaltung kommuniziertresp. eine Verwaltungsleistung in An-spruch nimmt oder ob er dies mittels mo-derner eTransaktionen macht. Mit anderenWorten: Sieht der Kunde keinen Nutzenim eGovernment, so wird er es auch nichtnutzen, wenn er nicht hierzu gezwungenwird resp. ist.
Value Proposition des eGovernment
eGovernment vermag dem Kunden ver-schiedene allgemeine materielle und im-materielle Vorteile zu bieten:� eGovernment ist modern, es liegt im
Trend, es ist neu und es ähnelt demeBusiness resp. eCommerce der Privat-industrie.15
� Es ist schneller (und bietet damit einenindirekten monetären Vorteil), weil– die Verwaltung in die Lage versetzt
wird, die begehrte Leistung schnellerzu erbringen
– ein IT-basiertes System in der Lageist, eine fast fehlerfrei Eingabe zuverlangen und somit Rück- undNachfragen nicht mehr notwendigsind
– in einigen Fällen das System selberdie Leistung bereits erbringen resp.zurückmelden kann.
� Es bietet tiefere oder aber nicht höhereGebühren
� Ein in den (veränderten) Prozess derVerwaltung eingebettetes und ange-passtes eGovernment führt auf Seite derVerwaltung zu einer Kosteneinsparung.In Anwendung des Kostendeckungs-prinzips ist diese Einsparung an denGebührenzahler weiterzugeben.
� Oftmals kann eGovernment dem Kun-den faktische Zusatzleistungen bieten,die er nicht hat, wenn er sich traditio-neller Verfahren bedient.
Erwartungen der Bürger
Die wenigsten Verwaltungen kommen inden Genuss, eGovernment im Rahmenvöllig neuer Verwaltungsprozesse einzu-führen. Bestenfalls ist dies im Rahmen vontotal- oder partialrevidierten Normen mög-lich, doch in der Regel nur in Ausführungvon bestehenden und in ihren Kernprozes-sen unveränderten Erlassen. Ein Grossteilder Erwartungen, die der Kunde an dieneuen Möglichkeiten des eGovernmentstellt, ergibt sich somit aus den bereits be-kannten Leistungen:� Im Normalfall wird der Kunde verlan-
gen, dass alte und neue Kommunikati-onswege parallel zueinander weiterbe-stehen. Diese Anforderung ergibt sichbereits aus der Forderung nach chan-cengleichem Zugang zu den IuK. Eben-so ist es vor dem Hintergrund dieserAnforderung sehr schwierig, bei tradi-tionellen Wegen einen Leistungsabbauvorzunehmen.
� Wie bereits eingangs erwähnt, darf mannicht vergessen, dass die Verwaltungauch ohne NPM und eGovernment eine
nicht zu vernachlässigende Dienstlei-stungsqualität bietet:– Wird eine Eingabe versehentlich bei
einer unzuständigen Behörde ge-macht, so ist diese gehalten, die Sa-che unverzüglich und von Amtes we-gen an die zuständige Behördeweiterzuleiten. Wenn im eGovern-ment strukturierte Daten übermitteltwerden, so wird der Betroffene raschmerken, ob er es mit der zuständigenBehörde zu tun hat. Auf der anderenSeite wird ihm dadurch die Möglich-
keit genommen, die Kommunikationauf diesem Weg überhaupt aufzuneh-men.
– Aus dem Verbot der formellenRechtsverweigerung leitet in derSchweiz das Bundesgericht auch dasVerbot des überspitzten Formalis-mus ab. Dieses Verbot besagt, dassForm- und Verfahrensbestimmungennicht zu formalistisch und mit über-
Christian Bock, New Public Management und eGovernment
VM 5/2004 235
»Der schon hohe Qualitätsstandard der mitteleuropäischen Verwaltungen kann einHindernis für eGovernment im NPMdarstellen.«
13 Regieren in der Informationsgesellschaft – DieeGovernment-Strategie des Bundes, Anhang1: Begrifflichkeiten und Definitionen, Bern2002, S. 2, entspricht dem weitgehend(http://www.admin.ch/ch/d/ egov/egov/strate-gie/strategie.html). Die Speyrer Definition(»Unter Electronic Government verstehen wirdie Abwicklung geschäftlicher Prozesse imZusammenhang mit Regieren und Verwalten(Government) mit Hilfe von Informations- undKommunikationstechniken über elektronischeMedien. Auf Grund der technischen Entwick-lung nehmen wir an, dass diese Prozesse künf-tig sogar vollständig elektronisch durchgeführtwerden können. Diese Definition umfasst so-wohl die lokale oder kommunale Ebene, dieregionale oder Landesebene, die nationaleoder Bundesebene sowie die supranationaleund globale Ebene. Eingeschlossen ist somitder gesamte öffentliche Sektor, bestehend ausLegislative, Exekutive und Jurisdiktion sowieöffentlichen Unternehmen«).
14 Der Begriff »Bürger« resp. »Kunde« ist natür-lich zu eng. Im Sinne des Zugangs ist zwi-schen Privaten (C2G), Unternehmen (B2G),anderen Verwaltungsstellen (A2G resp. G2G)sowie Non-Profit und Non-Government Orga-nisationen (O2G) zu unterscheiden. Bezogenauf die Art und Weise der Interaktion ist zwi-schen Information, Kommunikation undTransaktion zu unterscheiden (Fischer 2002,S. 47).
15 Lalive d’Epinay 2002, S. 211 fasst dies tref-fend mit dem Satz »Was der Wirtschaft rechtist, soll dem Staat billig sein« zusammen. ImFazit ebenfalls Booz 2002, S. 13 ff.

triebener Strenge interpretiert undangewendet werden dürfen. Würdeeine Behörde für Papiereingaben diegleichen Anforderungen stellen, dieein technisches System verlangt, sowürde sie dieses Verbot regelmässigverletzen. Es ist zur Kenntnis zunehmen, dass das Papier weitausmehr Freiheiten und Komfort bietet,als es ein Computersystem kann.
– Die Verwaltung ist gehalten, denBürger auf offensichtliche Fehleraufmerksam zu machen und diese womöglich zu korrigieren. Sofern Fri-sten bestehen, soll die Möglichkeitgegeben werden, die Korrektur nochinnert Frist vorzunehmen. Im eGo-vernment besteht die Möglichkeit,durch Hilfesysteme oder Agentenden Kunden durch eine Eingabe zuführen und ihm eine (fast) fehlerfreieEingabe zu garantieren. Der Nutzendieser Fehlerfreiheit wächst aberprimär der Verwaltung und nichtdem Bürger an, denn er kann sich im
traditionellen Verfahren auf die Kor-rektur von Amtes wegen verlassen.Hiermit verwandt ist die Frage, wiemit der Ausübung von Optionen undWahlrechten umzugehen ist. Na-mentlich im Abgaberecht gehen immer mehr Behörden dazu über,Pauschalabzüge von Amtes wegenabzuziehen, auch wenn diese Mög-lichkeit nicht in Anspruch genom-men wurde – die Verwaltung handelthier also im mutmasslichen Interessedes Bürgers. Die Verwendung eineselektronischen Systems, das diesauch so macht, drängt sich für denBürger dann nicht auf, da kein spezi-fischer Vorteil weitergegeben wird.Mit anderen Worten: Die elektroni-sche Steuererklärung erreicht danndie grösste Wirkung, wenn sie Ele-mente des »eSteuerberaters« enthält.
– Schliesslich wird von eGovernmenterwartet, dass es wenigstens gleichschnell und möglichst schneller istals das traditionelle Verfahren. Diesist natürlich nur möglich, wenn miteGovernment die zeitlich anspruchs-
vollen Teile abgebildet werden kön-nen. Dort, wo eine intellektuelle Lei-stung oder ein Ressourcenengpass zuVerzögerungen führt, wird eGovern-ment nicht die gewünschten Resulta-te bringen. Entscheidende Vorteileentstehen natürlich dort, wo eine Lebenssituation (zum Beispiel Un-ternehmsgründung, Todesfall) vonverschiedenen rechtlichen und admi-nistrativen Regelungen überlagertwird. Hier kann eGovernment ent-scheidende Erleichterungen bringen.
� Rechtstaatlichkeit steht mit NPM16, aberauch mit eGovernment, in einem (natür-lichen) Spannungsfeld. Soweit hiervonNPM und damit nur das verwaltungsin-terne Verhältnis betroffen ist, wird derBürger mit den entstehenden Unsicher-heiten nicht belastet. Im Bereich deseGovernment können aber Zweifel ander Gültigkeit von Handlungen und Ak-ten entstehen. Diese Unsicherheit kanndazu führen, dass auf die Benutzung voneGovernment verzichtet wird.
� Der Kontakt mit der Verwaltung solleinfach und verständlich sein. Dies be-trifft nicht nur den Inhalt der Informati-on, sondern auch dessen Darstellungund Anwendbarkeit. Auf der einen Sei-te bietet eGovernment eine Chance, be-stehende Defizite aufzuholen. Auf deranderen Seite muss kritisch hinterfragtwerden, ob die Verwaltung, die diesesPrinzip häufig schon beim Papier nichtbeherzigt, dies plötzlich im eGovern-ment vermag.
� eCommerce und eBusiness schaffenbeim Kunden eine bestimmte Erwar-tungshaltung. Dies betrifft die Formund den Inhalt der Darstellung sowieServiceangebote. An diesen Verglei-chen mit der Privatwirtschaft muss sichdie Verwaltung messen lassen.
� Der Kunde und Bürger nimmt »die Ver-waltung« einheitlich wahr und ver-gleicht sie miteinander. Dies bedeutet,dass positive Initiativen einer Verwal-tungseinheit auch von anderen erwartetwerden. Entsprechend erzeugen negati-ve Erfahrungen Vorbehalte und Unsi-cherheiten.
� An Datenschutz und Vertraulichkeitwerden hohe Anforderungen gestellt.Auch wenn es dem technischen Fach-mann klar ist, dass Papier und Telefaxdiese Sicherheit auch nicht immer bie-ten können, so sind die Anforderungendes Kunden trotzdem zu beachten. Die-se Anforderung richtet sich zudem nichtnur an die Verwaltung, sondern auch anDritte, welche als Hilfspersonen odergar Störer Einblick in Transaktionenhaben.
NPM und Geld
Jede Verwaltungshandlung kostet. Entwe-der werden die Kosten vom direkten Aus-löser getragen oder es findet eine Querfi-nanzierung zwischen verschiedenen An-tragstellern statt oder eine andere(allgemeine oder spezifische) staatliche Fi-nanzquelle kommt für die Finanzierungauf. Dabei sind selbstverständlich die Prin-zipien der Äquivalenz und der Kosten-deckung einzuhalten.
Ein privates Unternehmen, das – wiedie NPM organisierte Verwaltung auch –moderne Managementgrundsätze anwen-det, ist immer bestrebt, sich nach einheitli-chen Prozessen zu organisieren resp. sichdas strategische Ziel zu geben, dies zu er-reichen. Entsprechend ist es Usus, dasszum Beispiel Banken unterschiedliche Ko-sten für Geldbezüge ab Automaten oderSchalter und für Zahlungsaufträge übereBanking oder Papierauftrag erheben.
Mit Blick auf bestehende eGovernment-Prozesse muss man feststellen, dass bis-lang vor allem die Frage gestellt wird, wasder Kunde will resp. was ihm auch nutzt.Es wird weniger die Frage danach gestellt,auf was er zu verzichten und zu zahlen be-reit ist. Der Vergleich der Verwaltung mitder Privatwirtschaft ist daher mit einer ge-wissen Vorsicht zu ziehen:� Amazon.com hätte wohl nie den glei-
chen Erfolg gehabt, wenn es sowohltraditionelle als auch Cyberbuchlädenhätte betreiben müssen.
� Hätten die Banken die Auflage gehabt,ihr bestehendes Filialnetz parallel zumeBanking aufrechtzuerhalten und nurwenig Änderungen in der Preisstrukturvorzunehmen, so würde eBanking heuteganz anders aussehen.
Beispiele aus der Privatwirtschaft zeigen,dass sich erfolgreiche Unternehmen ko-härent organisieren und fokussieren: Ea-syjet und Ryanair bieten nur Billigflüge an
eGovernment und New Public Management: gegenseitige Hinderer oder Helfer?
236
16 Thom 2000, S. 27 ff.
»Aus dem Verbot der formellen Rechtsverweigerung folgt das Verbot des
überspitzten Formalismus; technische Systeme dürfen den Bürgern vom Papier
gewohnte Vorteile nicht nehmen.«

und verzichten konsequent auf Verwässe-rungen dieser Strategie; Dell vertreibt sei-ne Produkte nur über Internet und Telefon– auf ein Filialnetz und persönliche Bera-tung wird verzichtet. Im Gegensatz dazuist die Verwaltung – negativ ausgedrückt –dazu verpflichtet, »auf verschiedenenHochzeiten zu tanzen.«
Es soll hier nicht gesagt werden, dasssie dies a priori nicht kann. Es muss aberauf die entsprechenden Schwierigkeitenund die Lehren der Privatwirtschaft hinge-wiesen werden.
Vom »Was« und vom »Wie«
Entscheidendes Charakteristikum desNPM ist, dass von einer Input- zu einerOutput-steuerung übergegangen wird.17
Die zu erbringende Leistung (»Was«) istin ihren Grundzügen in einem Rechtserlassumschrieben und wird durch eine Lei-stungsvereinbarung konkretisiert. Das»Wie« der Leistungserbringung ist dabeivon untergeordneter (aber nicht völlig ver-nachlässigbarer) Bedeutung. Dabei zeigtsich, dass die ergebnisorientierte Steue-rung ein technologiegeeigneter Ansatzist.18
Im Bereich des eGovernment mussman feststellen, dass das »Wie« teilweisesehr genau geregelt ist und nur noch we-nig Spielraum verbleibt. Gründe hierfürsind:� Der überwiegende Teil unserer Rechts-
normen baut auf älteren Erlassen auf,die aus einer Zeit stammen, wo nochniemand an eGovernment und NPM ge-dacht hat. Entsprechend sind solche Er-lasse weder medien-19 noch organisati-ons- resp. prozessneutral formuliert.Folge hiervon ist, dass eGovernmentnicht sinnvoll eingeführt werden kann,ohne bestehende Normen zu verletztenoder bis an den Rand des Möglichen zuinterpretieren, und dass Gesetzesrevi-sionen teilweise so verlaufen, dass dertraditionelle Papierprozess beibehaltenund ihm zur Seite ein angeglichenereGovernment-Prozess gestellt wird.
� Verschiedene Prozesse müssen parallelzueinander betrieben werden. Der »Zu-gang für Alle« und die Vermeidung der»Digital Divide« sind sehr wichtige An-liegen, aber sie haben ihre Konsequen-zen.
Ich denke, dass es möglich ist, das Kon-zept der Outputorientierung zu einem grossen Teil auch auf eGovernment anzu-wenden. Voraussetzung ist, dass Erlasseentsprechend formuliert werden. Dies be-dingt natürlich, dass gegenüber der aus-führenden Verwaltung Vertrauen besteht.
Das Verhältnis von eGovernmentund NPM
In den folgenden vier Abschnitten soll dasgegenseitige Verhältnis von eGovernmentund NPM näher untersucht werden. Fokusist dabei jeweils, wie sie einander fördern,aber auch einander behindern.
eGovernment dank NPM
Kundensicht
Sowohl NPM als auch eGovernment habengemeinsam, dass der Kunde und seineWünsche und Bedürfnisse im Zentrum ste-hen. Während eine traditionelle Sicht das»Produkt« der Verwaltung aus einer reinenVerwaltungssicht ansieht, macht sich dieVerwaltung unter NPM/eGovernment dieSichtweise des Kunden zu eigen (Bild 1).
Während in vielen Bereichen der klassi-schen Verwaltung keine private Substituti-on oder Konkurrenz existiert, wird dies vorallem. im Bereich der Informationstätig-keit durch eBusiness und eGovernmenterst möglich.20 Diese Sichtweise ist aller-dings nicht unproblematisch: Indem dieVerwaltung eine Lebenssituation auch ausder Sichtweise ihrer Konkurrenz betrach-tet, wird sie deren zukünftige Schritte anti-zipieren und eigene Massnahmen ergrei-fen. Sie wird sich in diesem Fall der Kritikaussetzen, dass sie ausserhalb ihres ange-stammten und wettbewerbsrechtlich zuläs-sigen Aufgabenbereichs tätig wird.
Die Verwaltung konkurrenziert sichaber auch selber. Indem noch immer dertraditionelle Weg angeboten wird (werdenmuss), hat der Kunde eine Wahlmöglich-keit und wird das neue eGovernment-An-gebot kritisch vergleichen.
Managementeinstellung
NPM setzt eine mentale Einstellung desManagements (sowie der politisch und
hierarchisch vorgesetzten Stellen) voraus,die gegenüber Änderungen, Unsicherhei-ten und teilweise neuen Sichtweisen offenist.21 Dies ist die genau gleiche Einstel-lung, die auch eGovernment erfordert. Vonverschiedenen Autoren ist zu Recht ange-führt worden, dass die blosse Existenz ei-ner Präsenz auf dem Internet noch langekein eGovernment bedeutet. Viele so ge-nannte eGovernment-Initiativen sind aberin diesem Stadium stecken geblieben, dader Wille für weitgehende Änderungenfehlte.
Eine positive Einstellung des Verwal-tungsmanagements genügt aber noch nicht,um eGovernment erfolgreich einzuführen.Wenn das ausführende und betroffene Ver-waltungspersonal nicht einbezogen undseine Befürchtungen und Ängste ernst ge-nommen werden, so wird es eGovernmentsehr schwer haben. NPM ist hier von Vor-teil, da bei dessen Einführung genau diegleichen Probleme auftreten. Zudem er-laubt NPM durch Anreizsysteme und eineInnovationsorientierung ein positives Um-feld für moderne Verwaltungsmechanis-men zu schaffen.
Flexibler Mitteleinsatz
Aus rechtlichen, organisatorischen und po-litischen Gründen ist die Verwaltung nichtimmer in der Lage, bei eGovernment-Pro-jekten auf Erfahrungen und Technologiender Privatwirtschaft zurückzugreifen. Siemuss daher teilweise neue Wege beschrei-ten und Technologien und Methoden ein-setzen, welche noch unerprobt sind.
Christian Bock, New Public Management und eGovernment
VM 5/2004 237
17 Schedler 2003b, S. 60.18 Fischer 2002, S. 45 f.19 Bock 2001, S. 172.20 Zu denken ist hier etwa an die Publikation
von Rechtsdaten (vgl. David Rosenthal, Inter-net-Schöne neue Welt?, Orell Füssli, Zürich1999, S. 118).
21 Schedler 2001a, S. 42 ff.; Schedler 2001b, S.781 f.
Bild 1: Kundensicht im NPM und eGovernment

Wenn dem Staat beim Einsatz der IKTeine besondere Rolle zukommen und ernamentlich ein verlässlicher Partner für dieWirtschaft sein soll, so ist die ausführendeVerwaltung auf eine gewisse Flexibilitätbeim Mitteleinsatz angewiesen.
NPM verschafft diese Freiheiten. Mit-tels Globalbudget kann die Verwaltung diePrioritäten setzten, um den Leistungsauf-trag zu erfüllen.22 Wenn bezüglich Lei-stungen die Verwaltung mit der Privatwirt-schaft verglichen wird, so muss sie auchentsprechende Mittel erhalten. Ebensomuss man aber auch politisch bereit sein,Fehlschläge in Kauf zu nehmen.
Kostenreduktion
eGovernment ist zwar im Unterschied zumNPM nicht primär finanziell motiviert,23
doch wird von ihm schlussendlich auch einquantitatives Ziel erwartet: entweder inForm von tieferen Kosten oder in einembesseren Preis-/Leistungsverhältnis.
Public Private Partnerships
Als Public Private Partnership (PPP) wirdein Kooperationsmodell zwischen der öf-fentlichen Verwaltung und Privaten be-zeichnet, in dem nicht nur eine operatio-nelle (wie zum Beispiel bei Privatisierun-gen, Contracting Out oder Outsourcing),sondern auch eine strategische Allianz ein-gegangen wird. Dies zeigt sich darin, dassChancen und Risiken geteilt werden, diePartner gleichberechtigt sind und eine ge-meinsame Entscheidungs- und Verantwor-tungsgemeinschaft entsteht.
PPPs drängen sich im eGovernmentdort auf, wo die öffentliche Verwaltung anihre technischen, finanziellen und organi-satorischen Grenzen stösst, um tatsächlicheGovernment anbieten zu können. WeitereAnwendungsfälle sind etwa:� koordinierende Tätigkeiten für ver-
schiedene Verwaltungsstellen oder Ge-meinwesen mit parallelen Kompetenzen
� die Integration von eGovernment-An-geboten in kommerzielle Softwarepro-dukte, welche den direkten Datenaus-
tausch zwischen Verwaltung und Bür-ger erlauben
� der gemeinsame Aufbau von Portalen,in denen sowohl der Staat als auch pri-vate Anbieter ihr spezifisches Know-how einbringen.
PPPs stellen ein Instrument des NPMdar,24 denn der Staat beschränkt sich hierauf seine Rolle als Gewährleister undüberträgt die konkrete Ausführung einemDritten. Dieses Modell kann natürlich nurBestand haben, wenn der private PPP-Part-ner das Projekt auch ökonomisch erfolg-reich betreiben kann und will. Ansonstenist die öffentliche Hand gezwungen, denBetrieb selber zu übernehmen.
eGovernment trotz NPM
Übersteigerung der Kundensicht
»Der Kunde ist König« ist ein an sich rich-tiger Grundsatz, der sowohl in der privatenals auch öffentlichen LeistungserbringungGeltung hat. In der Privatwirtschaft ist die-ser Grundsatz allerdings wesentlich einfa-cher anzuwenden, denn der Leistungser-bringer ist frei, wie er sein Angebot gestal-ten will. Entsprechend kann und muss erauf Reaktionen seiner Kundschaft und derKonkurrenz reagieren. Gemäss der ge-wählten Kundengruppe wird er die einzel-nen Attribute des Angebotes resp. der Lei-stungserbringung verändern. Ebenso musser nicht alle möglichen Kundengruppenbefriedigen.
Der Verwaltung ist es dagegen ver-wehrt, sich ihre Kunden auszusuchen. Siemuss alle Anliegen gesetzeskonform erfül-len und kann Unterscheidungen nur in sehrengen Grenzen vornehmen.
Explosion der Kommunikationswege
Je nach technischer Affinität, Lebenslage,Ausbildung, Problemsituation, Fähigkeitund Dringlichkeit wird sich der Kunde imUmgang mit der Verwaltung eines be-stimmten Kommunikationswegs bedienen.Die Verwaltung, die diesen Bedürfnissenentsprechen will, ist gehalten, nebeneinan-
der die Kommunikation per Brief, Fax, E-Mail, Telefon und persönlicher Kommuni-kation zuzulassen.25 Diese Situation istnicht neu: Jedes private Unternehmen mitdirektem Kundenkontakt muss sich dieserHerausforderung stellen. Der entscheiden-de Unterschied ist aber, dass es der Ver-waltung fast unmöglich ist, den Kundenzur Verwendung bestimmter Kommunika-tionswege zu motivieren oder unterschied-liche Qualitätsstufen anzubieten.
Zeit- und Erfolgsdruck
NPM-Projekte werden von der Öffentlich-keit und den politisch verantwortlichenKreisen zu Recht einer engen Erfolgskon-trolle unterzogen und kritisch beobachtet.Die Verantwortlichen sind rasch gehalten,nach aussen wahrnehmbare Erfolge vorzu-weisen. Was würde sich besser eignen alsein graphisch ansprechendes, innovatives,modernes und mit der Privatwirtschaft ver-gleichbares eGovernment-Projekt? Damitkann der (notwendige und sehr motivie-rend wirkende) externe Erfolg rasch erzieltwerden. Solche early birds sind wichtig.Häufig ist es auch richtig, dass mehrSchein als Sein vorhanden ist. Dies darfaber nicht dazu verleiten, die weiter not-wendigen Arbeiten nun einzustellen undAnpassungen in der internen Organisationund den Prozessen zu unterlassen.
Kundenbegriff
In den seltensten Fällen ist die Verwaltungnur mit einem Typus von Kunden konfron-tiert. Die Beispiele in Tabelle 1 mögen diesetwas illustrieren.
Eine eGovernment-Lösung, welche alleKundengruppen befriedigen soll, wird essehr schwer haben. Analog dem Erfolg desB2B (business-to-business) des eCommer-ce sind transaktionale eGovernment-Pro-jekte dort erfolgreich, wo man sich aufeine Kundengruppe fokussieren kann, wel-che zudem über ein technisches Know-how verfügt und von den Vorteilen deseGovernment unmittelbar profitieren kann.
eGovernment und New Public Management: gegenseitige Hinderer oder Helfer?
238
22 Diese Aussage macht auch deutlich, dass einschlecht formulierter Leistungsauftrag aucheGovernment verhindern kann.
23 Schedler 2001b, S. 777; Günter 2001, S. 18 f.,wobei nebst finanziellen Motiven auch nochandere im Vordergrund stehen können, so etwaadministrative und/oder politische Krisen oderUnzufriedenheiten mit Amtsträgern.
24 Schedler 2003b, S. 208 ff.; Thom 2000, S.48, 217.
25 Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Zuerwähnen sind etwa noch Chat, Videoconfe-rencing oder SMS.
Tabelle 1: Kundentypen und ihre Verteilung

Gleichbehandlung
Anschliessend an den vorangehenden Ab-schnitt ist das Problem der Gleichbehand-lung zu erwähnen. Wenn man sich auf einebestimmte Kundengruppe beschränkt unddieser gewisse Vorteile gegenüber anderenKundengruppen verschafft, so stellt sich so-fort das Problem der Gleichbehandlung.26
Stellt man bei der Definition von NPM dasElement der »Anwendung von modernenManagement-Methoden« in den Vorder-grund, so ist die Nicht-Gleichbehandlungdurch Segmentierung an sich kein Problem.Da NPM aber in einem staatlichen und vorallem rechtsstaatlichen Umfeld eingebettetist, werden der möglichen Nicht-Gleichbe-handlung zahlreiche Grenzen gesetzt.
Gleichbehandlung ist ein Hindernis, aufdas eGovernment sowohl in einem NPMals auch in einem traditionellen Verwal-tungsumfeld trifft. Da sich aber NPM be-wusst die Kundensicht auf die Fahnen ge-schrieben hat, wird das Problem derGleichbehandlung in diesem Kontext nochverstärkt.
NPM dank eGovernment27
New = modern = eGovernment
Sowohl NPM als auch eGovernment sindmodern und neu. Der an eCommerce ge-wöhnte Bürger wird einen entsprechendenService bald auch von der Verwaltung ver-langen.28 Während eGovernment in derLage ist, ein Interface zwischen Bürger undVerwaltung zu schaffen, ist NPM weitausschwieriger zu vermitteln. Solange die staat-liche Leistung in der gewünschten Qualitätund den akzeptierten Kosten erbracht wird,ist es grundsätzlich egal, ob dies »traditio-nell« oder »in Anwendung von modernenManagement-Methoden« erfolgt.
Der Kunde kann die Verwaltung mittelseGovernment anders wahrnehmen. Dieskann – häufig ausgehend von der Verwal-tung – Motor für weitergehende Anstren-gungen (eben NPM) sein.
Modernes Management bedient sich derIT
IT ist heute ein fester und nicht mehr weg-denkbarer Bestandteil moderner Manage-mentmethoden. Richtig und umfassend angewendetes eGovernment wird den Ver-antwortlichen neue Möglichkeiten der Ver-waltungsführung und -optimierung ermögli-chen. Oft gelangt die traditionelle Verwal-tungsorganisation an eine Grenze, die dannmittels NPM verschoben werden kann.
Es ist in diesem Zusammenhang nochein weiterer Punkt zu betonen: NPM setzt
motiviertes und gut ausgebildetes Personalvoraus. Die Modernität der Verwaltungs-abläufe und der Infrastruktur trägt mass-geblich zur Arbeitsplatzattraktivität bei.
Messbarkeit des Erfolgs
Messbarkeit und Benchmarking sind we-sentliche Elemente, um den Erfolg einesProjekts beurteilen zu können und um dieLeistungen konstant zu verbessern. eGo-vernment ermöglicht es, die vom Kundenwahrgenommenen Leistungen der Verwal-tung genau zu messen:� Dauer des Verfahrens vom Start bis
zum Abschluss� Zufriedenheit des Kunden durch auto-
matisierte und strukturierte Rückmelde-Systeme
� Verfügbarkeit der Leistungen� Umfang der Benutzung.
Ebenso wird ermöglicht, allgemeingültigeServicestandards festzulegen und Proble-me sichtbar zu machen.
Virtuelles Schliessen realer Gräben
Eine föderalistische Staatsstruktur oder nurhistorisch erklärbare Kompetenzaufteilun-gen zwischen Gebietskörperschaften ver-hindern häufig, dass die Verwaltung ihreLeistungen in der erwünschten Art undWeise erbringt. Mittels eGovernment-Initiativen können die für den Kunden ne-gativen Folgen verringert werden.
An dieser Stelle ist aber sofort ein Caveat anzubringen: Wenn es eGovern-ment braucht, um für den Kunden existie-rende Nachteile auszugleichen, so ist dieFrage zu stellen, warum die Grundproble-me nicht angegangen werden. Es ist heuteallgemein bekannt, dass IT-Projekte, wel-che bestehende organisatorische Mängelzementieren, selten von Erfolg gekröntsind.
Politik der kleinen Schritte
Durch das technologische eGovernmentkann mit kleinen Reform- und Modernisie-rungsschritten häufig mehr in RichtungNPM erreicht werden, als man zu Beginnbewilligt erhalten hätte.29 Zudem können
durch eine »Politik der kleinen Schritte«manche Risiken reduziert werden.
NPM trotz eGovernment
Digital Divide
Die Digital Divide ist derzeit und auchnoch in absehbarer Zukunft eine – ausSicht des eGovernment – unangenehmeRealität. Das davon negativ betroffeneKundensegment stellt für eGovernment einHindernis dar. Wenn nun eGovernmentund NPM (zu) eng miteinander verbundenwerden (oder gar zu einer Identität ver-schmelzen), so riskiert man, dass ein Seg-ment der Bevölkerung ausgeschlossenwird. Dabei ist der Begriff der Digital Di-vide meines Erachtens sehr breit zu fassen:Nicht nur die Bürger, die den Zugang zumInternet nicht haben können sondern auch
nicht wollen, sind darunter zu subsumie-ren.
Die Lösung muss darin bestehen, dasseGovernment und NPM zwar miteinanderverbunden werden, dass aber NPM breiterangelegt wird.
eGovernment als technokratische Antwort
Erfolgreiches NPM bedingt zu einem ho-hen Mass, dass die Betroffenen davonüberzeugt sind. Wenn NPM nur alsPflichtübung oder Modetrend aufgefasstwird, so besteht die Gefahr, dass kurzfristi-ge Erfolge gesucht werden, um anschlies-send wieder zu alten Handlungsmusterzurückzukehren. Einer dieser Erfolge kanneGovernment sein. In diesen Fällen wer-den technische Antworten gegeben, wo or-ganisatorische Änderungen erforderlichsind.
Christian Bock, New Public Management und eGovernment
VM 5/2004 239
»eGovernment droht, bestehende Normen zuverletzen, die aus einer Zeit stammen, alsnoch niemand an eGovernment und NPMgedacht hat.«
26 Hierzu Bock 2001, S. 166 f.27 Beachte etwa, dass Konrad Graber, Die Er-
folgsfaktoren des New Public Management,in: Der Schweizer Treuhänder 2002, S. 333ff. eGovernment (zu Recht) nicht zu den Er-folgsfaktoren des NPM zählt. A.A. noch Bock2001, S. 176.
28 Hanna Muralt Müller, eGovernment als neueHerausforderung, in: Gisler 2001, S. 4 f.; La-live d’Epinay 2002, S. 210.
29 Reinermann 2003, S. 405.

Sparsamer Mitteleinsatz
NPM wird häufig mit dem Ziel eingesetzt,die direkten und indirekten Kosten für denBürger zu senken. Kostensenkung ist da-gegen kein Definitionselement von eGo-vernment.30 Im Gegenteil: eGovernmentund damit verbundenes Business ProcessReengineering führt zu hohen Initialko-sten, von denen man hofft, dass sie in Zu-kunft zu einer finanziell positiven Projekt-beurteilung führen. In vielen Fällen wirdes aber bei der blossen Hoffnung bleiben,denn die Zeiträume, bis vollständiges eGo-vernment eingeführt werden kann, sinddermassen lang, dass eine zuverlässigeRentabilitätsrechnung nicht machbar ist.
Weiter ist zu beachten, dass eGovern-ment heute zu vielen Restriktionen ausge-setzt ist, so dass viele Vorteile nicht reali-sierbar sind.
Unterschiedliche Motivation
Schedler/Scharf31 bezeichnen eGovernmentzu recht als technologiegetrieben. Wenn fürNPM der Satz »structure follows strategy«stimmt, so ist er für eGovernment zu »struc-ture follows strategy follows potential« zuerweitern. Bei eGovernment steht oftmalsdas Machbare und nicht das Verlangte imVordergrund. Damit entsteht das Risiko,dass sich eGovernment genau in das Ge-genteil von NPM verwandelt: dass die Ver-waltung nämlich das entwickelt, was sieselber als benötigt erachtet.
Dieses Risiko lässt sich meines Erach-tens nicht aus der Welt schaffen und istquasi inhärent. Ein Blick auf das Scheiternvieler eBusiness-Initiativen zeigt, dass dieskein Problem ist, welches nur der Staathat. Es zeigt auch deutlich auf, dass derviel beschworene Vergleich mit der Privat-wirtschaft an seine Grenzen kommt. AuchKundenbefragungen helfen häufig nichtweiter, denn eGovernment ist teilweise soneu, dass sich der Kunde das Produkt garnicht abstrakt vorstellen kann. Zudem hatdie Verwaltung keine Handhabe, um dieBenutzung auch zu verlangen.
Fazit
� eGovernment wird dann ein Erfolg,wenn der Kunde darin eine Verbesse-rung sieht. Dort, wo die Verwaltung be-reits auf einem hohen Qualitätsniveauarbeitet, besteht keine Veranlassung füreGovernment.
� Es ist an der Zeit, dass die Verwaltungbezüglich ihrer Leistungserbringungnicht unbesehen mit der Privatwirt-schaft verglichen wird. Dort, wo Ge-
meinsamkeiten bestehen, sollen diesebetont und auch Forderungen gestelltwerden. Gleichzeitig ist aber anzuer-kennen, dass die Verwaltungen Leistun-gen zu erbringen hat, welche der Privat-wirtschaft nicht auferlegt werden.
� Die Verwaltung muss finanziell trans-parenter werden. Sie soll darlegen, mitwelchen (Mehr-)Kosten bestimmteKommunikationswege verbunden sind.Es ist dann an den politisch oder hierar-chisch kompetenten Behörden, einge-denk der Kosten die notwendigen Ent-scheidungen zu treffen.
� Dort wo die Verwaltung tatsächlichmittels eGovernment finanzielle Vortei-le realisieren kann, sind diese an dieBenutzer weiterzugeben.
� Die Einführung von eGovernment stelltin vieler Hinsicht ein Risiko dar. Hierzumüssen alle beteiligten Stellen den not-wendigen Mut aufbringen.
� Die Einführung von eGovernment kannals Infrastrukturarbeit betrachtet werden.Es ist somit gut möglich, dass viele derheutigen Investitionen niemals unmittel-bar rentieren werden und sich positiveEffekte erst in ferner Zukunft zeigenwerden resp. immaterieller Natur sind.
Literatur
(Bock 2001) Christian Bock, eGovernment undRecht, in: Gisler 2001; S. 155 ff.
(Booz 2002) Booz Allen Hamilton, E-Govern-ment und der moderne Staat, F.A.Z.-Institut,Frankfurt a.M. 2002.
(Fischer 2002) Ute Fischer, Verwaltungs-Infor-mationssysteme und Verwaltungsmodernisie-rung, in: Verwaltung und Management, Heft 1,S. 41 ff.
(Gisler 2001) Michael Gisler und Dieter Spah-ni, eGovernment, Verlag Paul Haupt, 2. Aufl.,Bern/Stuttgart/Wien 2001.
(Günter 2001) Matthias Günter, NPM und eGo-vernment in der Praxis, in: eGov Präsenz, Heft1/2001, S. 18 f.
(Luginbühl 1998) Marcel Luginbühl, ElectronicGovernment – Einsatz des Internets in der öf-fentlichen Verwaltung, http://www.youts.com/downloads/Lic-Arbeit_egov1998UniBern.pdf.
(Mehlich 2002) Harald Mehlich, Electronic Go-vernment – Die elektronische Verwaltungsre-form, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th.Gabler, Wiesbaden 2002.
(Reinermann 2003) Heinrich Reinermann, Ver-waltungsmodernisierung mit New Public Mana-gement und Electronic Government, in: Her-mann Knödler und Michael H. Stierle,Physica-Verlag, Heidelberg 2003, S. 381 ff.
(Schedler 2001a) Kuno Schedler, eGovernmentund neue Servicequalität der Verwaltung, in:Gisler 2001, S. 42 ff.
(Schedler 2001b), Kuno Schedler und MariaChristina Scharf, Exploring the Interrelationsbetween Electronic Government and the New
Public Management, in: Beat Schmid, KatarinaStanoevska-Slabeva und Volker Tschammer,Towards the E-Society, Kluwer, Boston/Dord-recht/London 2001, S. 781 f.
(Schedler 2003a) Kuno Schedler, Lukas Sum-mermatter und Bernhard Schmidt, ElectronicGovernment einführen und entwickeln, VerlagPaul Haupt, Bern/Stuttgart/Wien 2003.
(Schedler 2003b) Kuno Schedler und IsabellaProeller, New Public Management, Verlag PaulHaupt, 2. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien 2003.
(Summermatter 2003) Lukas Summermatter, IstE-Government New Public Management?, in:Heinrich Meyer, Netzguide E-Government, Netz-woche, Basel 2003, S. 12 f.
(Thom 2000) Norbert Thom und Adrian Ritz,Public Management, BetriebswirtschaftlicherVerlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden 2000.
(Lalive d’Epinay 2002) Maya Lalive d’Epinay,E-Government – eine Herausforderung für dieSchweiz, in: Der Schweizer Treuhänder 2002,S. 211.
eGovernment und New Public Management: gegenseitige Hinderer oder Helfer?
240
30 Schedler 2001b, S. 777.31 Ebenda.
7. Internationaler Speyerer Qualitätswettbewerb
Zum siebten Mal startet der InternationaleSpeyerer Qualitätswettbewerb für öffentli-che Verwaltungen. Bis zum 31. März2005 können sich Organisationen des öf-fentlichen Sektors aus Deutschland, Öster-reich und der Schweiz um einen Speyer-Preis bewerben:
Ziel des Wettbewerbs ist es, innovati-ve Weiterentwicklungen der öffentlichenVerwaltung sowie des Staats- und Ver-waltungshandelns nach Innen und Außenzu prämieren. In den vergangenen Jahrenhaben sich neben Bundes-, Landes- undKommunalverwaltungen, öffentlichenUnternehmen und Verbänden auch Schu-len und Universitätsverwaltungen, Mu-seumsverwaltungen, Gerichtsverwaltun-gen oder Versicherungsanstalten bewor-ben. Beteiligen können sich selbstständi-ge Verwaltungsorganisationen sowieTeilbereiche von Verwaltungen, mit ei-genständigem Entscheidungs- und Selbst-gestaltungsspielraum.
Die Preisverleihung findet im Rah-men eines Innovationskongresses imHerbst 2005 in Linz (Österreich) statt.
Nähere Informationen:
Internationaler Speyerer Qualitätswettbe-werb, Deutsche Hochschule für Verwal-tungswissenschaften Speyer, Freiherr-vom-Stein-Str. 2, D-67346 Speyer, Armin Liebig/Vera Silke Saatweber, Telefon: ++49 (0) 6232 654-266 oder654-288, E-Mail: [email protected] [email protected], Internet:www.dhv-speyer.de/qualitaetswettbewerb.

Einführung
Weltweit müssen Regierungen und Ver-waltungen drei wesentliche Aufgaben be-wältigen: � vertikale und horizontrale Integration
der Verwaltungsdienstleistungen unterdem Stichwort »one-shop-government«.Ziel ist es, mehr Schnelligkeit, Flexibi-lität und Effektivität bei der Aufgaben-erfüllung zu erreichen.
� Anpassung der Verwaltungsdienstlei-stungen in Qualität und Quantität an dieBedürfnisse der Nutzer bei gleichzeiti-ger fiskalischer Stabilität.
� Überwindung der Vertrauenskrise zwi-schen Politik, Verwaltung und den Nut-zern, die sich in einer oftmals skepti-schen und sogar zynischen Beurteilungder Leistung des öffentlichen Sektorswiderspiegelt.
Der britische Premierminister Tony Blairbeschrieb im Jahre 2002 den erforderli-chen Wandel, den das Staatsverständnisdabei vollziehen wird: »Twentieth Centurycollective power was exercised through theBig State. Their welfare was paternalistic,handed down from on high. That won’t dotoday. Just as mass production has depar-ted from industry, so the monolithic provi-sion of services has to depart from the pu-blic sector. People want an individual ser-vice for them. They want Governmentunder them, not over them. They want Go-vernment to empower them, not controlthem ... Out goes the Big State. In comesthe Enabling State«.1
Bei dieser Transformation wird die in-telligente Nutzung der Informations- undKommunikationstechnologie (IuK) einenentscheidenden Beitrag leisten müssen, sowie sie in den letzten Jahren Industrie- undDienstleistungsunternehmen radikal verän-dert hat. Insbesondere die Netzwerktechno-logie spielte hierbei eine besondere Rolle.
Networked Virtual Organisationsin der Wirtschaft
In den Industrie- und Dienstleistungsunter-nehmen hat sich in den letzten Jahren auf-grund der Anforderungen der globalisierttätigen und vernetzten Wirtschaft ein dra-matischer Wandel vollzogen. Dieser Wan-del betrifft die Art und Weise, wie Unter-nehmen produzieren, wie sie auf die Be-dürfnisse ihrer Kunden eingehen, wie siemit anderen Unternehmen im eigenen Eco-system agieren und wie sie ihre Mitarbei-ter zu Höchstleitungen befähigen. WelcheEntwicklungsstufen dieser Wandel voll-zieht, wird in Bild 1 dargestellt.
Von diesem Paradigmenwechsel vonisoliert arbeitenden Unternehmensfunktio-
nen wie Entwicklung, Produktion, Marke-ting und Verwaltung hin zu NetworkedVirtual Organisations (NVO) sind vieleglobal operierende Unternehmen in einerVielzahl von Branchen betroffen.
Am Beispiel des weltweit führendenNetzwerk- und Kommunikationsspeziali-sten Cisco Systems lässt sich gut herausar-beiten, welche Strategien Unternehmen imZeitalter der Wissensgesellschaft erarbeitetund umgesetzt haben, um mit konsequen-ter Umsetzung von internetbasierten Ge-schäftsprozessen eine höhere Wertschöp-fung zu erreichen.
Cisco Systems hat gegenwärtig cirka36.500 Beschäftigte, von denen siebenhun-dert in Deutschland arbeiten. Im Ge-schäftsjahr 2004 hat das Unternehmen ei-nen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollarerzielt. Der Geschäftsbericht weist aus,dass der Nettogewinn von Cisco Systemsim Jahre 2004 bei 4,4 Milliarden US-Dollar lag. Was ist das Geheimnis des Er-folgs? Cisco Systems stellt Unternehmenund Behörden nicht nur die Infrastrukturfür funktionierende netzwerkbasierte In-formations- und Kommunikationsprozessezur Verfügung, sondern nutzt das Internetkonsequent auch bei der Ausgestaltung dereigenen Geschäftsprozesse. Inzwischensind neunzig Prozent der Geschäftsprozes-se des Unternehmens webgestützt. Dabeiwird die gesamte Wertschöpfungskette desUnternehmens erfasst.
Alljährlich ermittelt Cisco Systems –unter den kritischen Augen der Wirt-schaftsprüfer – welche Ersparnisse dieserkonsequente Interneteinsatz erzielt hat. ImJahre 2004 konnte das Unternehmen Ge-samteinsparungen hinsichtlich Kosten undZeit von insgesamt 2,16 Milliarden US-Dollar aufweisen. 2003 lag der Wert nochbei 2,1 Milliarden US-Dollar. Mithin istfast die Hälfte des jährlichen Nettogewinnsauf den konsequenten Einsatz der Internet-technologie zurückzuführen.
Networked Virtual OrganisationEin neues Organisationskonzept für den öffentlichen Bereich
von Steve Du Mont und Willi Kaczorowski
Nicht nur in der Privatwirtschaft haben sich als Antwort auf dieGlobalisierung neue Strukturen vernetzter virtueller Organsiatio-nen herausgebildet. Die Autoren zeigen an vier konkreten Beispie-len auf, dass dieses Organistionsmodell auch im öffentlichen Sek-tor trägt, und erkären die Ursachen diese Trends.
Willi Kaczorowski Government Back Offices for Better Electronic Services-Group, Cisco Systems.
Steve Du Mont, Vice President und
Global Lead PublicSector, Internet
Business SolutionsGroup, Cisco Systems.
Vernetzte virtuelle Organisationen als dritte Stufe von eGovernment
Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 241-245
241
1 Tony Blair: Speech 1. 10. 2002 in: Cisco Systems: Connected Republic. Changing theway we govern, San Jose 2004.

Neben der konsequenten Ausrichtungaller Geschäftsprozesse auf das Internetgibt es noch einen zweiten Faktor, der denErfolg von Cisco Systems begründet. Or-ganisatorisch hat sich das Unternehmenhin zu einer »Networked Virtual Organisa-tion« entwickelt.
Eine »Networked Virtual Organisation«lässt sich definieren als »reinvention andorchestration of an industry function usingnetworking technology to virtually integra-te horizontal and vertical partners into ahighly customer oriented and process opti-mized entity capable of enhanced valuedelivery«.
Mit der Gründung einer NetworkedVirtual Organisation werden im Wesentli-chen drei Ziele verfolgt:� Für alle Mitglieder der NVO soll die
Anpassungsfähigkeit an stetig steigendeAnforderungen unter regelmäßig sichverändernden Umweltbedingungen er-höht werden, damit sie auf längereSicht auch wettbewerbsfähig bleiben.
� Unternehmen, die sich intern und externauf das NVO-Modell ausgerichtet ha-ben, sind eher in der Lage, umfassendauf Kundenbedürfnisse einzugehen unddiese in den Mittelpunkt ihrer Ge-schäftsausrichtung und unterstützenderProzesse zu stellen.
� Fähigkeiten und Fertigkeiten der Be-schäftigten, sich in der Wissensgesell-schaft weiterzuentwickeln, werden durchdas NVO-Modell besonders unterstützt.
Welche strategischen Überlegungen stehenhinter dem Konzept der »Networked Vir-tual Organisation«? Basierend auf demGrundgedanken, dass es in einer Wissens-gesellschaft darauf ankommt, Ressourcenund organisatorische Kapazitäten von vie-
len und vielfältig agierenden Organisatio-nen und Organisationseinheiten so zu nutzen, dass daraus Waren und Dienstlei-stungen entstehen, die eine einzige Organi-sation nicht produzieren oder nur mit wesentlich höheren Kosten produzierenkönnte, sind zahlreiche Unternehmentransformiert worden oder stehen mittenim Prozess der Transformation.
Dabei bleibt bei NVOs die Autonomieoder wenigstens eine Halbautononomie derUnternehmen vorhanden. Im Konzert derPartner konzentrieren sich die Mitgliederauf ihre Stärken, die sie systematisch ent-wickeln und ausbauen müssen. Da dieKernkompetenz des einen Partners dieKontextaktivität des anderen NVO-Mit-glieds darstellt, ergeben sich so auf NVO-Ebene Synergieeffekte. Nach dem Konzeptder NVO konzentrieren sich die einzelnenPartner nicht nur auf ihre Kernkompeten-zen, sondern sie bringen auch ihre eigenenWerte, Maßstäbe und Ziele mit ein. AllePartner behalten die alleinige Verantwor-tung für den Ressourceneinsatz, lediglichdie Informations- und Kommunikations-technologie spielt hierbei eine Sonderrolle.Information wird allen Partnern der Net-work Virtual Organisation zur Verfügunggestellt. Dies bedingt eine einheitlichetechnologische Plattform mit horizontalund vertikal integrierten Prozessen und ge-meinsamen Standards. Ebenso erfordert esdie Verwendung einheitlicher Definitionen.
Da alle Mitglieder der Network VirtualOrganisation ihre organisatorische Selbst-ständigkeit behalten, bedarf es eines Koor-dinators oder Orchestrators, der die Partnerzusammenhält und darauf hinwirkt, dassalle ein gemeinsames Ziel- und Strategie-verständnis haben. Insbesondere die Orien-
tierung an Kundenbedürfnissen und derenWerten ist von identitätsstiftender Bedeu-tung. Darüber hinaus muss der Koordina-tor einer NVO dafür Sorge tragen, dasseinheitliche Messgrößen für den Erfolg desUnternehmens oder ausreichende Aus- undFortbildung für die Beschäftigten angebo-ten wird.
Somit lässt sich zusammenfassend fest-stellen: Für eine erfolgreiche NVO in derWirtschaft gelten drei grundlegende Vor-aussetzungen: � ein konsequentes Streben nach Nutzen
und Mehrwert für die Kunden� die Fähigkeit, zwischen Aufgaben und
Funktionen zu unterscheiden, die fürdas Kerngeschäft jeder Organisationvon zentraler Bedeutung sind, und sol-chen, die für sie zum Umfeld gehörenund von einer Organisation ausgeführtwerden können, für die sie wiederumzum Kerngeschäft gehören
� die Verpflichtung, einfachere und stan-dardisiertere Geschäftsprozesse zu schaf-fen, die sowohl über funktionale Gren-zen innerhalb einer Organisation alsauch über verschiedene Organisations-grenzen außerhalb der Organisationhinweggehen.
NVO im öffentlichen Bereich –Beispiele
Im öffentlichen Bereich haben sich Net-work Virtual Organisations stufenweisemit der Einführung von eGovernment her-ausgebildet. Ging es in der ersten Stufe dereGovernment-Entwicklung noch darum,Informationen webbasiert zur Verfügungzu stellen und einfache Transaktionen zuermöglichen, so war die zweite Stufe da-durch charakterisiert, dass interaktive, in-tegrierte und am Kundennutzen ausgerich-tete Dienstleistungen hinzukamen. Erst inder dritten Stufe entschlossen sich ambitio-nierte Verwaltungen, sich zu NetworkedVirtual Organisations zu entwickeln.
Im Folgenden werden vier Beispielevorgestellt, in denen Verwaltungsbehördendie Transformation zu Networked VirtualOrganisations genutzt haben, um zusätzli-chen gesellschaftlichen Nutzen für Bürgerund Wirtschaft zu schaffen.
Centrelink – Australien
Das prominenteste Beispiel für eine NVOist das vielfach ausgezeichnete Modell derCentrelink-Organisation in Australien. Indiesem Flächenland haben die australi-schen Bürger Zugang zu Verwaltungs-dienstleistungen über eine staatliche Agen-tur namens Centrelink. Für den Zugang
Vernetzte virtuelle Organisationen als dritte Stufe von eGovernment
242
Bild 1

stehen sowohl ein Portal und ein australi-enweites Callcenter als auch die örtlichenCentrelink-Büros bereit, Dabei bündeltCentrelink ungefähr 140 Informations- undTransferdienstleistungen aus 23 BehördenAustraliens. Nicht nur die staatlichen, son-dern auch die regionalen und die kommu-nalen Behörden nehmen CenterlinksDienstleistungen in Anspruch.
In der Vergangenheit wurden dieseAufgaben von spezialisierten Behördenauf staatlicher, regionaler und kommunalerEbene wahrgenommen, die sie traditionellfachpolitikbezogen organisiert hatten. Da-bei war die Kommunikation dieser Behör-den untereinander unterentwickelt, eineganzheitliche Betrachtung der Bedürfnisseder Kunden fand nicht statt.
Deshalb stellt Centrelink ein erfolgrei-ches und effizientes Modell einer one-shop-Politik dar. Da die 27.000 MitarbeiterCentrelinks und die 300 Kundencenternicht sämtliche Facetten der Dienstlei-stungserstellung beherrschen können undmüssen, bedient sich Centrelink externerPartner. Diese können sowohl Verwal-tungsbehörden als auch gemeinnützige Or-ganisationen oder private Unternehmensein, die mit Centrelink durch Verträgeverbunden sind. In den letzten Jahren hatCentrelink eine Konsolidierung seiner In-formations- und Kommunikationstechno-logie vorgenommen und sie den Partnernauf der staatlichen, regionalen und kom-munalen Ebene zur Mitnutzung zur Verfü-gung gestellt. Beim Einsatz der IuK gehtCentrelink neue Wege. Gesteuert durch ei-nen Chief Information Officer (CIO) wur-de das Konzept einer integrierten Informa-tions- und Kommunikationstechnologieentwickelt, die Sprache, Daten und Vi-deoübertragung möglich macht. Centre-links Websites sind nicht nur in 42 Spra-chen vorhanden, sie integrieren auchSprachanwendungen wie Customer VoiceRecognition-Systeme.
Obwohl die staatlichen, regionalen undkommunalen Behörden Aufgaben an Cen-trelink durch Dienstleistungsvertrag abga-ben, blieb ihnen dennoch die Gewährlei-stungsaufgabe und mithin ein Teil ihrerHoheit.
Ontario – Kanada
Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreicheTransformation des öffentlichen Bereichsstellt Ontario dar.
Die Provinz ist die zweitgrößte des Lan-des Kanada und mit vierig Prozent der Ge-samtbevölkerung und zwölf Millionen Ein-wohnern die einwohnerstärkste Provinz.Flächenmäßig ist Ontario größer als Spani-en und Frankreich zusammen. Mitte der
neunziger Jahre hatte die neu gewählte Re-gierung der Provinz Ontarios vier Ziele ge-setzt. Sie umfassten die Reduzierung deröffentlichen Verwaltung, Verbesserung derKundenorientierung, Beseitigung der Fach-Silos und einen ausgeglichenen Haushalt.
Seit 1998 sind Regierung und Verwal-tung der Provinz wie ein Unternehmen or-ganisiert. Dies gilt besonders für die Artund Weise, wie Informations- und Kom-munikationstechnologie geplant, beschafft,gesteuert und über die gesamte Behörden-landschaft Ontarios eingesetzt wird. Er-folgsfaktor war hierbei, dass IuK nicht län-ger als Kostenblock, sondern als Hebel zurVeränderung betrachtet wurde. Nach An-sicht der IuK-Chefstrategin der Provinz,Joan McCalla, war es ein Durchbruch.»We successfully made the case that onlythrough the application of technologycould we increase the capacity of govern-ment while reducing size and costs. Andthrough an enterprise approach to techno-logy, we could improve client service undbreak down organization silos. It was the
genesis of an important cultural transfor-mation«.2
Nunmehr sind die Aufgaben der Infor-mations- und Kommunikationstechnologie,die in den 22 Ministerien wahrgenommenwerden, zu sieben IuK-Clustern zusam-mengefasst, die von einem Clusterverant-wortlichen gesteuert werden, der wiederumeinem Chief Information Officer auf derProvinzebene berichtet. Zugleich unterste-hen diese IuK-Verantwortlichen jedochauch dem Leiter des Fachministeriums.Ontario hat damit eine wesentliche Gover-nance-Voraussetzung erfüllt, die für dasFunktionieren von NVOs wichtig ist.
Ein gutes Beispiel für eine kundenorien-tierte integrierte Dienstleistung im Rahmendes NVO-Modells in Ontario ist das Pro-jekt »My lost wallet«. Ziel ist es, einen Ser-vice bereitzustellen, mit dem ein Bürger,der seine Brieftasche verloren hat, eine ein-zige Anfrage bei den Behörden stellenmuss. Diese Anfrage löst dann einen Vor-gang aus, während dessen alle beteiligtenBehörden wichtige Dokumente ausstellenwie zum Beispiel den Antrag für den neuenPersonalausweis oder den Führerschein,ohne dass der Bürger jede einzelne Behör-
de besuchen muss. Dies beschleunigt undvereinfacht es für den Bürger, offizielleDokumente zu ersetzen. Eine logische Er-weiterung dieses Services wäre, auch pri-vate Organisationen einzubeziehen.
Texas 2-1-1 – Vereinigte Staaten
Im US-Bundesstaat Texas hatte die Healthund Human Services Commission (HHSC)den gesetzlichen Auftrag, für mindestensachtzig Prozent der Bürger über eine zen-trale Nummer einen einfachen und ge-bührenfreien Telefonzugriff auf Gesund-heits- und Sozialservices bereitzustellen.HHCS entschied sich für einen nationalenAnsatz zur Bereitstellung dieser Dienstlei-stungen, in dem man »2-1-1 Call Center«implementierte. Ganz ähnlich wie dieberühmte 9-1-1 Nummer ist diese Telefon-nummer eine von der US Federal Commu-nications Commission für bestimmteZwecke reservierte Nummer. Heute kannjeder Bürger von einem beliebigen Ort inTexas aus die Nummer 2-1-1 wählen und
erhält überall Unterstützung durch zahlrei-che örtliche und private Anbieter von Ge-sundheits- und Sozialleistungen.
Texas ist einer der ersten Staaten, die 2-1-1 als landesweites »virtual govern-ment« eingeführt haben. Die Bürger dabeizu unterstützen, sich in dem wachsendenLabyrinth von Anbietern gesundheitsbezo-gener und sozialer Leistungen, Behördenund Service-Organisationen zurechtzufin-den, erforderte die Integration von Dienst-leistungen aus dem staatlichen, dem gemeinnützigen und dem privaten Sektor.Hätte sich die HHCS für einen individuel-len, lokalen Ansatz entschieden, so hättensie 25 lokale Area Information Center im-plementieren und bis zu einhundert neueMitarbeiter einstellen müssen, um dieseEinrichtungen rund um die Uhr kompetentzu besetzen. Aufgrund knapper finanziellerResourcen wandte sich die HHSC an gem-einnützige Organisationen. Diese stelltendem Staat die Mitarbeiter kostenlos zurVerfügung. Im Gegenzug erhalten die gem-einnützigen Organisationen kostenlose CallCenter- Software, Datenbanktechnologie
Steve Du Mont und Willi Kaczorowski, Networked Virtual Organisation
VM 5/2004 243
»Die Behörden müssen aus dem traditionellenOrganisationsmodell ausbrechen und Netzwerke schaffen, die Fachpolitiken undProgramme miteinander verbinden.«
2 Cisco Systems: The Connected republic, S. 26.

und Zugriff auf eine zusammengeführteSprach-, Video- und Dateninfrastrukur aufInternetbasis. Eingehende Anrufe werdenautomatisch an das Call Center weitergelei-tet, das die jeweilige Auskunft am bestengeben kann.
Kennisnet – Niederlande
In den Niederlanden wurde ein Projekt mitdem Namen »Kennisnet« entwickelt. Über-setzt heißt dies »Wissensnetzwerk«.»Kennnisnet« ist eine staatliche Behördedes Bildungsministeriums, die als Dirigenteines Bildungsnetzwerks wirkt. Dieses Bil-dungsnetzwerk wurde für Schüler, Elternund Lehrer sowie für öffentliche und priva-te Bildungsanbieter geschaffen. Ein privat-wirtschaftliches Konsortium von Kabel-an-bietern stellt dabei die Breitbandinfrastruk-tur für 12.000 Schulen zur Verfügung.Kennisnet hält ein Toolkit von Applikatio-nen bereit, welches Lehrern, Schülern, Stu-denten und anderen Lerngruppen ermög-licht, selbst Bildungsinhalte zu entwerfen,zu verbreiten und zu speichern. Darüberhinaus verwaltet »Kennisnet« alle Aktivitä-ten in Bezug auf Bildung und organisiertesLernen. Für die Schulen gibt es in den Nie-derlanden keine gesetzliche Verpflichtung,sich an diesem Bildungsnetzwerk zu betei-ligen. Vielmehr können Schulen oder Lern-gruppen eigenverantwortlich entscheiden,ob sie an »Kennisnet« teilhaben wollen
NVO im Öffentlichen Sektor – Gemeinsame konzeptionelleGrundlagen
Bei den im letzten Kapitel vorgestelltenBeispielen für Networked Virtual Organi-sations lassen sich trotz aller historischen,kulturellen und verwaltungsorganisatori-
schen Unterschiede drei wesentliche ge-meinsame Merkmale identifizieren, die inAnlehnung an die Transformation in derWirtschaft auch für den öffentlichen Be-reich relevant sind. Dazu gehören dreiLeitprinzipien:� Fokussierung auf Kundenorientierung� Kern/Kontext-Analyse� Standardisierung und robuste Infra-
struktur.
Fokussierung auf Kundenorientierung
Kundenorientierung stellt das verwaltungs-politische Mantra des Neuen Steuerungs-modells und der Überlegungen zu eGovern-ment dar. Allerdings wurde es bisher mehrpropagiert als umgesetzt. Um wirklich kun-denorientiert zu arbeiten, muss sich die öf-fentliche Verwaltung auf drei Dinge kon-zentrieren. Sie muss die Fähigkeit ent-wickeln, als eine Einheit zu agieren, sodass die Bürger das Gefühl haben, von ei-ner einzigen Organisation bedient zu wer-den anstatt von einer Vielzahl von Behör-den. Zweitens sollte die Verwaltung ihreAktivitäten um die Bedürfnisse der Bürgerherum organisieren und nicht um das, wasfür den Staat einfacher ist oder traditionellschon immer so gemacht wurde. Drittensbesteht für die öffentliche Verwaltung dieNotwendigkeit, flexibler zu werden, ummit den komplexen Problemen umgehen zukönnen, welche die veränderten wirtschaft-lichen, sozialen und kulturellen Erwartun-gen der Bürger mit sich bringen.
Wollen sie nach außen als eine einzigeOrganisation agieren, so müssen Regie-rungsbehörden aus dem traditionellen Mo-dell der Bereitstellung von Dienstleistun-gen (separate Fachbehörden oder derenEinrichtungen) ausbrechen, und Netzwerkeschaffen, die Ministerien/Behörden sowieFachpolitiken und damit verbundene Pro-
gramme und Initiativen miteinander ver-binden. Dazu ist eine vertikale und hori-zontale Integration der Verwaltungsleistun-gen erforderlich. Dies ist nur möglich,wenn neue Modelle des Regierens undVerwaltens erstellt und interaktive und ver-netzte Informations- und Kommunikations-technologie-Architekturen und Standardsüber alle Behörden und Aktivitäten hinwegvereinheitlicht werden. Sobald die Anfor-derungen der Bürger die Messlatte darstel-len, verändert sich das Design der Struktu-ren, Prozesse und Informationsflüsse derRegierung und der Verwaltungsbehörden.
Allerdings ist die Verpflichtung zur Zu-sammenarbeit und deren organisatorischeUmsetzung über gemeinsame Standardsund Netzwerkinfrastrukturen nur eine Sei-te der Medaille zur Kundenorientierung.Darüber hinaus ist es erforderlich, auch dieGeschäftsprozesse so zu organisieren, dassdie jeweiligen Kundenerwartungen imMittelpunkt stehen. Beispiele dafür enthältdie ausgezeichnete Studie »Reorganisationof Government Back Offices for Better Electronic Services«, die im Auftrag dereuropäischen Kommission erstellt wurde.In dieser Studie werden so genannte BestPractice-Fallbeispiele für über zwanzigVerwaltungsdienstleistungen aufgezeigt.Auch der bei der internationalen E-Gover-nment-Konferenz in Como im Juli 2003vorgelegte Bericht3 zeigt auf, welche Vor-teile für die Kunden der öffentlichen Ver-waltung entstehen, wenn bei eGovern-ment-Strategien die Geschäftsprozesse ho-rizontal und vertikal betrachtet radikal aufden Prüfstand gestellt werden.
Kern/Kontext-Analyse
Bildet die absolute Kundenorientierung denMaßstab für die vernetzte Organisation deröffentlichen Verwaltung, wird mit Hilfe ei-ner tief greifenden Aufgabenkritik zu analy-sieren sein, welches die Kernaufgabenkünftiger Verwaltungstätigkeiten und wel-ches Kontextaufgaben sind, die von anderenPartnern des Netzwerks aufgrund ihrer ei-genen, wesentlich über die der Verwaltunghinausgehenden fachlichen Kompetenz bes-ser wahrgenommen werden sollen.
Die Unterscheidung in Kern/Kontext-Aufgaben ist von elementarer Bedeutung fürdie Bildung von Network Virtual Organisa-tions. Dabei kann sich eine Behörde eineseinfachen Werkzeugs in Form einer Matrixbedienen. Sie wird im Bild 2 dargestellt.
Vernetzte virtuelle Organisationen als dritte Stufe von eGovernment
244
3 European Institute of Public Administration:E-Government in Europe: The State of Af-fairs, July 2003, S. 35.
Bild 2

Die Unterscheidung in Kern/Kontext-Aufgaben ist die für die öffentliche Ver-waltung keineswegs neu. Sie wird bei derherkömmlichen Aufgabenkritik oftmalsangewandt. Verwaltungsbehörden kom-men dann am Ende zunehmend zum Er-gebnis, öffentliche Aufgaben, für derenGewährleistung sie nur zuständig sein wol-len, an Dritte abzugeben (Outsourcing). InNetworked Virtual Organisations geht maneinen anderen Weg. Er ist mit dem Stich-wort »Outtasking« zu charakterisieren.
Beim Outtasking werden Kontextaufga-ben, die kritisch für die Erfüllung allge-mein- oder verwaltungspolitscher Zielesind, zwar durch Dritte operativ wahrge-nommen. Zugleich haben alle Partner desNVO-Modells jedoch über gemeinsameIuK-Plattformen jederzeit die Möglichkeit,wichtige Daten des Dienstleistungserstel-lungsprozesses einzusehen und gegebenen-falls auch gegenzusteuern. So wird durchOuttasking die Fähigkeit der öffentlichenVerwaltung erhöht, durch ein Frühwarnsy-stem schneller und effizienter auf potenzi-elle Probleme reagieren zu können. Dieskann insbesondere für die Kriterien Kun-denzufriedenheit, Qualität und Termin-treue von Bedeutung sein. Demgegenüberhat im herkömmlichen Outsourcing-Mo-dell die öffentliche Verwaltung lediglichbei den Verhandlungen über die Service-Level-Agreements (SLA) die Möglichkeit,Kriterien zu setzen und über einen Eskala-tionsprozess dann auf die vertragsgetreueDienstleistungserfüllung hinzuwirken.
Kontinuierliche Standardisierung undrobuste Infrastruktur
Neben der Konzentration auf Kundener-wartungen und der Unterscheidung inKern/Kontext-Aufgaben stellt die kontinu-ierliche Standardisierung das dritte grund-legende Merkmal der NVO-Konzeptiondar.
Will die öffentliche Verwaltung nachaußen als eine einheitliche Organisationerscheinen, die auf verschiedene Zugangs-kanäle (Vor-Ort-Büros, Portale, Call Cen-ter, Mobile Plattformen etc.) zu erreichenund die im Backoffice vertikal und hori-zontal integriert ist, dann wird sie vor allem auf Hardware und Software zurück-greifen, die webbasierte Information,Kommunikation und Transaktion fördern.Dazu gehören vor allem auf dem Internet-Protokol (IP) basierende Anwendungen. Inden Public Sector-Beispielen für VNO-Modelle spielt dabei die IP-Telefonie einegroße Rolle. Sowohl im Centrelink-Mo-dell, in Ontario oder der »2-1-1«-Lösungin Texas als auch bei Kennisnet hilft dieIntegration von Sprache, Daten, Video undSpeicherung öffentlichen Verwaltungen,kundenorientierter und effizienter zu arbei-ten. Darüber hinaus ist vor allem die Breit-bandtechnologie in der Lage, zwischenden NVO-Partnern Konnektivität und ge-meinsame Anwendungen sicherzustellen,die beispielsweise beim Outtasking einenahezu zeitgleiche Verarbeitung von Da-ten und Informationen ermöglicht.
Fazit
Das Konzept der Networked Virtual Orga-nisation hat sich nicht nur in der globali-sierten Wirtschaft durchgesetzt. Vielmehrlassen sich in internationaler Perspektivezahlreiche Beispiele finden, bei denen öf-fentliche Verwaltungen mit Non Profit-Or-ganisationen und dem privaten Sektor inNVO-Strukturen zusammenarbeiten. Inkonzeptioneller Hinsicht sind dabei für denAufbau von NVO-Strukturen drei Leit-prinzipien von grundlegender Bedeutung.Fokussierung auf den Kunden und Reorga-nisation der Organisation und Arbeitswei-se der öffentlichen Verwaltung, damit die-se Kundenerwartungen erfüllt werden,stellt das erste Leitprinzip der NVO-Kon-zeption dar. Das zweite Leitprinzip bestehtin der Anwendung des Kern/Kontext-Mo-dells mit dem erfolgreichen Konzept desOuttaskings. Schließlich stellt drittens diekontinuierliche Standardisierung vonHard- und Software und der grundlegen-den Geschäftsprozesse zwischen denNVO-Partnern sicher, dass gesellschaftli-cher Nutzen geschaffen wird, der weit überden hinausgeht, den jede einzelne Organi-sation mit Hilfe ihrer traditionellen Orga-nisation, Arbeitsweise und Werkzeuge fürBürger und Unternehmen schaffen würde.
Steve Du Mont und Willi Kaczorowski, Networked Virtual Organisation
VM 5/2004 245

Die zu Beginn der neunziger Jahre in Ganggesetzte Verwaltungsreform in der Bundes-republik Deutschland scheint nach dem Ur-teil vieler Beteiligter und Beobachter in einStadium der Reformmüdigkeit geraten zu
sein.1 Diese Reformmüdigkeit hat viele Ur-sachen, wie zum Beispiel die anhaltendeDominanz der Haushaltskonsolidierung,die managerielle Engführung betriebswirt-schaftlicher Konzepte oder die unterent-wickelte Prozessorientierung. Allzu oftwurden Reformen nach der Blaupause derKGSt oder der von Unternehmensberaternvollzogen, ohne eine entsprechende Tiefen-wirkung innerhalb der öffentlichen Verwal-tung zu entfalten. Tradierte Perspektivenund routinisierte Handlungen, die in den»alten« Verwaltungsstrukturen Stabilitätund Orientierung gewährleisteten, scheinensich unter der Oberfläche der neu imple-mentierten Instrumente und Strukturen zureproduzieren und problemlos weiterzule-ben.2 Eine wirksame Veränderung derDenk- und Handlungsmuster in der Ver-waltungsorganisation vom bürokratischenzum manageriellen Modell erfordert hinge-gen organisationales Lernen. Organisatio-nales Lernen kann definiert werden als Pro-zess der Schaffung und Weiterentwicklungder organisationalen Wissensbasis, auf de-ren Grundlage Anpassungs- und Entwick-lungsstrategien generiert werden können.3
Organisationales Lernen geht über indivi-duelles Lernen hinaus. »Hinzukommenmuss eine über Lernen gesteuerte Verände-rung der Regelsysteme des Systems«, indenen das organisationale bzw. institutio-nelle Wissen über die Steuerung organisa-tionaler Abläufe und Leistungsprozesseverankert ist.4 Aufgabe des Wissensmana-gements ist es, das Wissen über die Um-welt der Organisation und über ihre inter-nen Abläufe auf eine Art und Weise aufzu-bereiten, dass es zum Gegenstand organisa-torischer Entscheidung werden kann.
Auch in bürokratischen Organisationenwird fortlaufend auf unterschiedlichen Ebe-nen gelernt, doch erfolgt das Lernen in mo-nozentrischen bzw. regelgestützten For-men. Die Veränderung von Organisations-strukturen und -abläufen findet hierbei aufGrund klarer formaler Anweisungen durchVorgesetzte oder durch externe Beraterstatt. Die Lernfähigkeit der gesamten Orga-nisation hängt damit von wenigen zentralenFührungspersonen ab, während die Mitar-beiter dieses Wissen nur umzusetzen ha-ben.5 Nimmt die Komplexität der Organi-
Wissensmanagement an den Schnittstellenöffentlicher Leistungsprozesse
von Bernhard Blanke und Henning Schridde
Öffentliche Leistungen stellen das Bindeglied zwischen den im po-litischen Meinungs- und Machtkampf entschiedenen Zielen imHinblick auf erwünschte Wirkungen einerseits und den feststellba-ren oder durch die Adressaten bewerteten Wirkungen andererseitsdar. Die Anstrengungen zur Staats- und Verwaltungsmodernisie-rung versuchen, öffentliche Leistungsprozesse durch die klare Ab-grenzung von Verantwortlichkeiten zwischen Politik, Verwaltung,Leistungserbringern und Bürgern bzw. Kunden exakter zu unter-teilen und durch ein System von Ziel- und Leistungsvereinbarun-gen optimal aufeinander abzustimmen. Die Qualität öffentlicherLeistungen von Verwaltungen wird zunehmend davon bestimmt,wie sie innerorganisatorisch und organisationsübergreifend Infor-mationen und Wissen zu nutzen verstehen. Um die Handlungs-und Innovationsfähigkeit des Staates zu bewahren, wenn nicht garzu erhöhen, ist es erforderlich, an den verschiedenen Schnittstellenöffentlicher Leistungsprozesse vorhandenes oder neues Wissen zuerschließen, zu verbreiten und anzuwenden, kurz, ein Wissensma-nagement für öffentliche Leistungsprozesse aufzubauen.
Dr. Henning Schridde, Institut für PolitischeWissenschaft, AbteilungSozialpolitik und PublicPolicy, UniversitätHannover.
Univ.-Professor Dr.Bernhard Blanke,
Institut für PolitischeWissenschaft, AbteilungSozialpolitik und Public
Policy, UniversitätHannover.
Nachhaltige Staats- und Verwaltungsmodernisierung erfordert organisationales Lernen
246 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 246-251
1 Röber, Manfred: Wandel der Verwaltung zwi-schen Erneuerungselan und Reformmüdigkeit,in: Blanke, Bernhard/Nullmeier, Frank/ vonBandemer, Stefan/ Wewer, Göttrik (Hrsg.):Handbuch zur Verwaltungsreform. 2. Aufl.,Opladen. 2001, S. 49-57.
2 Nagel, Erik und Müller, Werner R. (1999):New Public Management: (k)ein Wandel ohneKulturentwicklung(!), Wirtschaftswissenschaft-liches Zentrum (WWZ) der Universität Basel.,Basel, S. 8; Blanke, Bernhard/ Schridde, Hen-ning: Wenn Mitarbeiter ihre Orientierung ver-lieren, in: Zeitschrift für Personalforschung 15.Jg., 3/2001, S. 336-356; Göbel, Markus/ Lauen,Guido: Personalentwicklung und organisationa-les Lernen im Prozess reflexiver Verwaltungs-modernisierung, in: Verwaltung und Manage-ment 8. Jg., 1/2002, S. 32-36.
3 Bea, Franz/Haas, Jürgen: Strategisches Mana-gement, 2. Aufl., Stuttgart 1997, S. 406.
4 Willke, Helmut: Systemisches Wissensmana-gement, Stuttgart 2001, S. 41.
5 Führungswissen erscheint demnach als legiti-mes Wissen, das verteilte implizite und auf Er-fahrungen basierende Wissen der Mitarbeiterhingegen als nichtlegitimiertes Wissen. Aufdiese Weise kann die Verwaltungsführung da-von abstrahieren, dass sie selbst ein Produktder Verwaltungsorganisation und von ihr ab-hängig ist und »daher auch gegen sich selbst

sation und die Dynamik und Unsicherheitin der Umwelt zu, so sehen sich Politik undVerwaltung gezwungen, immer mehr Ent-scheidungen in immer kürzerer Zeit zu tref-fen. Dies führt wiederum zur Informations-und Entscheidungsüberlastung der politi-schen und administrativen Führung. Damitjedoch bleibt zu wenig Zeit für Reflexionund zur Optimierung öffentlicher Lei-stungsprozesse.
Öffentliche Leistungsprozesseund wissensbasierte Politik – ein konzeptioneller Rahmen
Die Handlungsfähigkeit des »intelligentenStaates«6 wird jedoch in wachsendemMaße von seiner Fähigkeit bestimmt, dasverteilte Wissen über Problemlösungspo-tenziale, Politikadressaten und Märkte ent-lang der einzelnen Stufen öffentlicher Lei-stungsproduktion gezielt zu mobilisieren,zu verbessern und weiter zu entwickeln.Wissensmanagement verschärft die poli-tisch-administrativen Steuerungsproblemeund verschiebt die Grenzen der hierarchi-schen Steuerung weiter in Richtung Selbst-und Kontextsteuerung. Entsprechend for-mulierte es auch der Staatssekretär im Bun-deskanzleramt Frank Walter Steinmeier:»In der modernen, hoch komplexen Gesell-schaft verfügen Regierung und Parlamentnicht mehr a priori über das notwendigeWissen, geschweige denn einen Wissens-vorsprung, um sachadäquate Entscheidun-gen zu treffen. Sie müssen vielmehr dienotwendigen Lernprozesse selbst organi-sieren.«7 Dabei sieht sich das Wissensma-nagement für öffentliche Leistungsprozessejedoch mit einem Dilemma konfrontiert:Einerseits steigt nicht zuletzt durch die Re-duzierung der Leistungstiefe staatlichenHandelns und dadurch bewirkter Unsicher-heiten auf (Wohlfahrts-)Märkten der Be-darf an Wissen und an Infrastrukturen desWissenstransfers, andererseits machen esdie Merkmale organisierter Komplexitätnahezu unmöglich, das vorhandene und er-forderliche Wissen so zu aktivieren, dass esgemäß der Mission des Gesamtsystems anden Stellen verfügbar wird, wo die jeweilsnotwendigen Entscheidungen fallen.8 Ausdiesem Dilemma gibt es grundsätzlich zweiWege:� Zum einen kann der Staat Maßnahmen
ergreifen, durch die der Bedarf an In-formationsverarbeitung und Wissensinkt (zum Beispiel durch Reorganisati-on der politischen und administrativenStrukturen, verschiedene Formen derDezentralisierung, exaktere Untertei-lung der einzelnen Prozessstufen öffent-licher Leistungsprozesse).
� Zum anderen kann der Staat zusätzlichoder alternativ dazu lernfähigerereStrukturen und Prozesse entwickeln(zum Beispiel Wissensmanagement).
Beide Wege werden mit dem Wissensma-nagement an den Schnittstellen öffentli-cher Leistungsprozesse beschritten. Zumeinen geht es beim Management der öf-fentlichen Leistungskette nicht nur darum,die verwaltungs- bzw. organisationsinter-nen Leistungsprozesse, sondern den ge-samten, das heißt auch verwaltungsexter-
nen und organisationsübergreifenden Lei-stungszusammenhang, an dem in derRegel mehrere private und öffentliche Ak-teure beteiligt sind, zu analysieren und zugestalten.9 Notwendige Prozessoptimie-rungen können sich also nicht allein aufdie Verwaltung beschränken, sondern wer-den sich zunehmend auch auf die effizien-te Gestaltung der Schnittstellen zwischenden verschiedenen an der öffentlichen Lei-stungskette beteiligten Organisationen undAkteuren konzentrieren. In diesem Zusam-
menhang wird Governance als Sammelbe-griff für eine neue Generation von Staats-und Verwaltungsreformen diskutiert10, indenen gesellschaftliche und staatliche Akteure kompromisssuchend und regel-schaffend zusammenwirken, um Maßstä-be, Organisationsformen, Verfahren undHandlungsinstrumente einer kooperativenAufgabenerfüllung zu entwickeln.
Zum anderen leben diese Strategien da-von, dass sich staatliche und gesellschaftli-che Akteure in einen gemeinsamen Lern-
prozess begeben. Eine wissensbasierte Po-litik gelangt dann zu einer Generierunginnovativen Wissens, wenn sie die schwie-rigen und voraussetzungsreichen Übergän-ge zwischen explizitem und implizitem11
Wissen in »routinisierte« organisationaleProzesse fasst, die fördern, dass das Wis-sen der beteiligten Akteure und Organisa-tionen artikuliert und durch Zugänglichkeitverbreitet wird. Entsprechend lässt sich be-obachten, dass in wachsenden Maße Kom-missionen, Beiräte, Sachverständigenkom-
Bernhard Blanke und Henning Schridde, Wissensmanagement an den Schnittstellen öffentlicher Leistungsprozesse
VM 5/2004 247
»Die Handlungsfähigkeit des ›intelligentenStaates‹ wird von seiner Fähigkeit bestimmt,das verteilte Wissen gezielt zu mobilisierenund weiter zu entwickeln.«
schränkt. Die intelligente Organisation hinge-gen zeichnet sich dadurch aus, dass sie dieverteilte Intelligenz innerhalb der Organisati-on zu nutzen versteht und eine eigene Wis-sensbasis aufbaut, um ihre Strukturen und Ge-schäftsprozesse in kognitiv anspruchsvollenSituationen umbauen zu können. Eine intelli-gente Organisation muss daher lernen, unter-schiedliche Wissensbestände zu managen undzu koordinieren.
7 Steinmeier, Frank-Walter: Konsens undFührung, in: Müntefering, Franz/ Machnig,Matthias (Hrsg.): Sicherheit im Wandel. NeueSolidarität im 21. Jahrhundert, Berlin 2001, S.263-273.
8 Vgl. Willke, Helmut: Systemtheorie III: Steue-rungstheorie, 2. Aufl., Stuttgart 1998, S. 288.
9 Naschold, Frieder u.a.: Leistungstiefe im öf-fentlichen Sektor. Erfahrungen, Konzepte,Methoden, Modernisierung des öffentlichenSektors Sonderband 4, Berlin 1996, S. 39
10 Löffler, Elke: Governance die neue Generati-on von Staats- und Verwaltungsmodernisie-rung, in: Verwaltung und Management 7. Jg.,4/2001, S.212
11 Zu Recht weisen Schreyögg und Geiger dar-aufhin, dass sich implizites Wissen nicht inexplizites Wissen konvertieren lässt, weil die-ses nicht-verbalisierbar und nicht-formalisier-bar ist. Grundlage für ein Wissensmanage-ment könne allenfalls narratives Wissen sein,vgl. Schreyögg, Georg/Geiger, Daniel: Kanndie Wissensspirale Grundlage des Wissensm-anagements sein? Diskussionsbeiträge 20/03des Instituts für Management, FU Berlin, Ber-lin 2003.
gestalten, planen und arbeiten muss«, so Baecker, Dirk: Die »andere« Seite des Wis-sensmanagements, in: Götz, Klaus (Hrsg.):Wissensmanagement. Zwischen Wissen undNichtwissen, München und Mering 2002, S.97-108. Wissensmanagement erscheint als do-mestizierte Variante organisationalen Lernens,durch die das Führungs- und Managementwis-sen dethematisiert und Lernprozesse einer zen-tralen Kontrolle unterworfen werden, vgl.Fried, Andrea/Baitsch, Christof: Mutmaßun-gen zu einem überraschenden Erfolg ZumVerhältnis von Wissensmanagement und orga-nisationalem Lernen, in: Götz, Klaus (Hrsg.):Wissensmanagement. Zwischen Wissen undNichtwissen, München und Mering 2002, S.33-46. Die Logik asymmetrischer Machtvertei-lung zwischen Management und Mitarbeiternund die Logik organisationalen Lernens steheneinander diametral gegenüber. Wissensmana-gement scheint dann als Ausfluss der parado-xen Aufgabe des Managements, Stabilität undVeränderung, Exploitation und Explorationvon Wissen auszubalancieren. Dem Manage-ment fehlt häufig die Einsicht, dass es über-haupt keine Instrumente gibt, die die Ungewis-sheit (wirtschaftlichen) Handelns ausschaltenkönnen. Strategisches Denken zeichnet sichfolglich nicht dadurch aus, dass es uns Gewis-sheit verschafft, sondern dass es uns aufschwierige Situationen vorbereitet (von Oetin-ger, B., Plädoyer für die Ungewissheit, in DieZeit 09/2003).
6 Die Intelligenz innerhalb einer klassisch büro-kratischen Organisation ist auf die Informati-onsverarbeitungskapazität der Spitze be-

missionen, Expertenrunden, Arbeitskreise,Netzwerke, Runde Tische, Bürgerdialogeetc. an der Ausgestaltung öffentlicher Lei-tungsprozesse mitwirken. Dies wird aufder einen Seite als Aushöhlung »verfas-sungsgemäßer Verfahren staatlicher Wil-lensbildung« und Herrschaft durch »priva-te Interessenregierungen« kritisiert12, lässtsich auf der anderen Seite unter den Bedin-gungen einer dynamischen und komplexenUmwelt jedoch auch als lernfähige Formenpolitischer Willensbildung betrachten.
Zur Synthese von Wissenspolitologie und Wissensmanagement
Mit dem Wissensmanagement innerhalbvon und dem Wissenstransfer zwischenunterschiedlichen Organisationen beschäf-tigen sich verschiedene Wissenschaftsdis-ziplinen, von der Philosophie bis zur Ma-nagementforschung. Wir verfolgen denZugang einer praktischen Politikwissen-schaft, die im Kern der Möglichkeit einernachhaltigen Problemlösung durch kollek-tive öffentliche Entscheidungen und derenUm- und Durchsetzung sowie kritischerReflexion und Bewertung der Ergebnisseverpflichtet ist. Dieser Zugang ist, wieoben erwähnt, mittlerweile internationalunter dem Signum Governance entwickelt.
In diesem wissenschaftlichen Diskurswerden aus verschiedenen Disziplinen Ele-mente transferiert, dominant ist allerdingsunverkennbar der aus dem New PublicManagement entstammende Leitbegriffdes »Wissensmanagements«13.
Während die »Wissenspolitologie«14
sich wesentlich auf Wertprobleme und die»große Politik« konzentriert, beschäftigtsich das Wissensmanagement speziell mitKommunikation innerhalb von distinktenOrganisationen, auch Teilbereichen (agen-cies) des politisch-administrativen Lei-stungsprozesses. Beide Zugänge weisendeutliche Beschränkungen auf:� Die Wissenspolitologie in ihrer Weiter-
entwicklung im Kontext deliberativerPolitik hat bislang die Vermittlung zuden tatsächlich gefällten Entscheidun-gen im Politikprozess nicht zureichendreflektiert und erforscht.
� Die auf den Leistungsprozess bezogeneDebatte um Wissensmanagement (ein-schließlich des eGovernment) neigt
dazu, das Problem technokratisch zuverkürzen.
Beide Stränge müssen jedoch miteinanderverknüpft und unter der Perspektive desgesamten öffentlichen Leistungsprozessesbearbeitet werden. Der öffentliche Raumbeschränkt sich keineswegs auf die »großePolitik« und die überregionale medialeKommunikation von auf Handlung undEntscheidung bezogenem Wissen; viel-mehr dehnt er sich weit aus über den ge-samten öffentlichen Sektor, seine gestuften
Leistungsprozesse15 und seine vielfältigenInteraktionen mit der gesellschaftlichenUmwelt mit jeweils spezifischen Adressa-ten und Interesseneinflüssen.
Es ist in der internationalen Literatur16
üblich, diesen Prozess auch und vor allemals Transformationsprozess der öffentli-chen Willensbildung zu konzeptualisieren,wodurch der demokratietheoretische undpraktische in eher managerielle Zugängeendogenisiert wird.
Entscheidend wäre es nun für diesenTransformationsprozess zu erforschen,
welche Arenen für die Kommunikationvon Wissen an welchen Prozessphasenoder -stufen angelagert und ob und welcheTypen solcher Kommunikation identifi-zierbar sind. Dies ist unseres Erachtens dieVoraussetzung dafür, dass sowohl übervernünftige Regeln gesprochen werdenkann als auch Verbesserungsvorschlägefür die Wissenskommunikation im öffent-lichen Raum entwickelt werden können.
Formen und Stufung des Wissenstransfers im Politik-Zyklus
Eine explorative Übersicht und Systemati-sierung der in den letzten Jahrzehnten zubeobachtenden Öffnungsprozesse17 zwi-schen Organisation und Umwelt im Be-reich »politische Planung und Steuerung«führt zu vier unterscheidbaren Typen:� Sachverständigenmodell� Bündnis- oder Konsensmodell� Ausschussmodell� Beteiligungsmodell.Dabei scheinen sich diese vier Typen rela-tiv deutlich verschiedenen Phasen des poli-tisch-administrativen Leistungsprozesseszuordnen zu lassen, die hier heuristisch inAnlehnung an den Policy-Zyklus18 kon-zeptualisiert sind.
In der Phase der Problemformulierungund Programmentwicklung dominiert das
Nachhaltige Staats- und Verwaltungsmodernisierung erfordert organisationales Lernen
248
schung. Wissenspolitologie und rhetorisch-dia-lektisches Handlungsmodell, in: Heritier, Adri-enne (Hrsg.): Policy-Analyse. Kritik und Neu-orientierung, PVS 24, Opladen 1993, S.175-198; Sabatier, Paul A.: Advocacy-Koali-tionen, Policy-Wandel und Policy-Lernen:Eine Alternative zur Phasenheuristik, in: Heri-tier, Adrienne (Hrsg.): Policy-Analyse. Kritikund Neuorientierung, PVS 24, Opladen 1993,S. 116-148, Maier, Matthias L. u.a. (Hrsg.):Politik als Lernprozess?, Opladen 2003.
15 Vgl. Lamping, Wolfram/ Schridde, Henning:Der Aktivierende Staat ordnungs- und steue-rungstheoretische Aspekte, in: Lütz, Susanne/Czada, Roland (Hrsg.): Der Wohlfahrtsstaat -Transformation und Perspektiven. Opladen2004 (i.E.).
16 Zum Beispiel Nutley, Sandra/Webb, Jeff: Evi-dence and the policy process, in: Davies,Huw/ Nutley, Sandra/ Smith, Peter C. (Hrsg.):What works? Evidence-based policy and prac-tice in public services, Bristol 2000, S. 13-41.
17 Benz, Arthur: Politische Steuerung in lose ge-koppelten Mehrebenensystemen, in: Werke,Raymund/ Schimank, Uwe (Hrsg.): Gesell-schaftliche Komplexität und kollektive Hand-lungsfähigkeit, Frankfurt a.M./New York2000, S. 97-124.
18 Vgl. Windhoff-Heritier, Adrienne: Policy-Analyse. Eine Einführung, Frankfurt a.M.1987, Hill, Michael/ Hupe, Peter: Implemen-ting Public Policy. Governance in Theory andPractice, London/Thousand Oaks, New Delhi2002.
»Im Policy-Kreislauf lassen sich verschiedeneModelle für Wissenstransfer ausmachen.«
12 Papier, Hans-Jürgen: Steuerungs- und Re-formfähigkeit des Staates, in: Verwaltung undManagement, 9. Jg., 3/2003, S. 116-121.
13 Vgl. Götz, Klaus (Hrsg.): Wissensmanage-ment. Zwischen Wissen und Nichtwissen,München und Mering 2002; Schreyögg, Ge-org/ Conrad, Peter (Hrsg.): Managementfor-schung 6 Wissensmanagement, Berlin/NewYork 1996.
14 Ansätze der Wissenspolitologie und des Poli-tik-Lernens gehen davon aus, dass der politi-sche Entscheidungsprozess nicht nur von Inter-essenkonstellationen und von Machtressourcengeprägt wird, sondern als weitere Einflussfak-toren Ideen, Wissen und Lernprozesse im Um-gang mit Problemlösungen und die damit ver-bundene kognitive Dimension eine wichtigeRolle spielen. Der Wandel einer Politik beruhtdemzufolge auf Lernprozessen, die häufig imGefolge externer Schocks auftreten. Gerade inZeiten eines Umbruchs entsteht ein breiterRaum für Lernprozesse, die politischen Aus-handlungs- und Steuerungsprozessen zugäng-lich sind. Die aktuellen Krisenerscheinungenin Deutschland scheinen die Suche nach neuenProblemlösungen über unterschiedliche politi-sche Handlungsfelder und Ländergrenzen hin-weg beschleunigt zu haben. Auf diese Weiseentstehen neue Werteprioritäten, Kausalannah-men und »kognitive Landkarten«, die von»Befürworter-Koalitionen« getragen werdenund bei entsprechend günstigen Zeitfenstern zuVeränderungen in der Politikgestaltung führen.vgl. Nullmeier, Frank: Wissen und Policy-For-

Sachverständigenmodell, in unterschiedli-cher Ausprägung, je nach der seitens politi-scher Machtzentren bestimmten Rangfolgein der Bedeutung des Themas (Enquete-Kommissionen, institutionalisierte Sach-verständigenräte, kurzfristig angesetzteKommissionen auf »höchster Ebene«).
Im Übergang von Programmentwick-lung zur Implementation dominiert dasBündnis- oder Konsensmodell, in welchembereits organisierte Akteure zum Zweck derkooperativen Gemeinwohlkonkretisierung19
»konzertiert« werden. Im Unterschied zumSachverständigenmodell wird nicht nur ex-ternes, bereits produziertes Wissen »transfe-riert« (nicht ohne Modifikation im Exper-tendiskurs), sondern es wird im Prozess desTransfers neues Wissen mehr oder wenigergemeinsam produziert. Und zwar unter Ein-beziehung von »Wissen über mögliche Fol-gen« aus der Praxis.
Im Implementationsprozess im engerenSinne findet man das Ausschussmodell,häufig institutionalisiert im Gesetzesvollzug(Pflegeausschuss, Jugendhilfeausschuss, Ar-beitsgemeinschaften, Beiräte etc.). DessenAufgabe scheint es zu sein, in vorgefertigtepolitische Leistungsprogramme jenes »An-wendungswissen« zu internalisieren, überwelches die öffentlichen Organisationen(»Bürokratien«) strukturell nicht verfügenkönnen. Vor allem geht es hier auf einermikropolitischen Ebene um »Interessenver-mittlung« in einem Prozess der »Nachju-stierung« und Spezifizierung genereller Re-geln aus dem »Rechtsetzungsprozess«.
Und schließlich sind in den letzten Jahr-zehnten Beteiligungsmodelle in verschie-dener Form »wie Pilze aus dem Boden ge-schossen« (zum Beispiel Elternbeiräte,Bürgerdialoge, Bürgerbeteiligung im Städ-tebaurecht). Dies liegt offensichtlich dar-an, dass selbst bei Einbeziehung unter-schiedlichster organisierter Interessen imAusschussmodell es nicht gelingt, das»Bürgerwissen« in dem für die Treffsi-cherheit politisch-administrativer Lei-stungsprozesse notwendigen Maße zuberücksichtigen (responsiveness). Bei-spielsweise setzt das Modell der Planungs-zelle20 ganz dezidiert auf die eigenständigeProduktion von Handlungswissen aus demKreis der Bürger als Betroffene/Konsu-menten, für welche das interne Organisati-onswissen der »Verwaltung« nur noch alsSammlung von unbewerteten Daten gilt,die dann erst im koproduktiven Prozessder Bürgerplanung zu Handlungswissentransformiert werden.
Diese Stufung von Wissenstransfer zwi-schen den rechtlich und institutionell »ge-schlossenen« Kommunikationsprozesseninnerhalb des dem Gesetzesvollzug folgen-den politisch-administrativen Leistungs-
prozesses ist jedoch keineswegs so linearzu denken, wie es dem idealisierenden Po-licy-Kreislauf entsprechen würde. Undzwar aus folgenden Gründen:� Unter Bezug auf die Governance-For-
schung lässt sich behaupten, dass derVersuch, die vier Modelle auf die insti-tutionell geregelten Leistungsprozesse(Bild 1) passgenau zuzuschneidern, umsie in den geschlossenen administrati-ven Kommunikationsprozess zu »re-in-ternalisieren«21, dazu führt, dass die ge-sellschaftlichen Interessen und Akteureim Gegenzug versuchen, solche Model-le zu »verselbstständigen« und zu eige-nen Domänen zu machen.
� Daraus ergibt sich, dass der Wis-senstransfer keineswegs »sachgerecht«neutral und konfliktfrei vor sich gehenkann, wie es ein Modell der »Experto-kratie« vorgeben möchte. Hier prallenunterschiedliche Rationalitäten aufein-ander. Und jedes der o.g. Modelle ist insich ein Aushandlungsmodell.
� Grundsätzlich lassen sich dabei Routi-ne- und Innovationsspiele22 unterschei-den. Routinespiele bedienen die Status-Quo-Interessen und reproduzieren dasalltägliche Organisationswissen. Inno-vationsspiele hingegen ziehen Struktur-veränderungen nach sich. Organisatio-nales Lernen und Wissensgenerierunglassen sich dementsprechend als je ei-genständige (mikro-)politische Aus-handlungsprozesse auf den einzelnenStufen öffentlicher Leistungsproduktionauffassen.
� Im Verlaufe der Stufung verändert sichauf beiden Seiten des Transferprozessesdas jeweilige Wissen, insbesondere verliert die Wissenschaft als »provedknowledge« ihre Bedeutung. Umge-kehrt steigt die Bedeutung von Erfah-rungswissen. Beide hier polarisiertenWissensformen stehen nun ihrerseits inje spezifischen Aushandlungsbeziehun-gen. Die Regeln, nach denen ein solcherAushandlungsprozess zwischen Wis-sensarten »optimal«, der Aufgabe ent-sprechend, erfolgen soll und kann, sindnoch keinesfalls erforscht.
� Die Unklarheit über die Spielregelnführt damit »zwangsläufig« zu Missver-ständnissen, vor allem weil die von MaxWeber tradierte Unterscheidung von»Verantwortungsethik« und »Gesin-nungsethik« weder durchhaltbar nochdiesen Verhandlungsprozessen adäquatzu sein scheint. Solche Missverständnis-se, gar paradoxe Kommunikationen,werden umso mehr dort systemisch ge-neriert, wo Politik und Verwaltung ge-zielt versuchen, »Expertenwissen« fürsich zu funktionalisieren. Hier prallenkonträre »Allzuständigkeiten« aufeinan-der: der demokratisch legitimierte Anspruch der öffentlichen Instanzen,
letztlich für den ganzen Prozess verant-wortlich zu sein, einerseits, und der»fachlich« begründete Anspruch der»Wissenschaft« bzw. der jeweiligenProfessionen (Mediziner, Lehrer etc.),letztlich für die Richtigkeit der Inhaltegerade stehen zu müssen, andererseits.
Bernhard Blanke und Henning Schridde, Wissensmanagement an den Schnittstellen öffentlicher Leistungsprozesse
VM 5/2004 249
»Eine am Demokratiepostulat orientierte Konzeption des Wissensmanagements führtzu einer kooperativen Verteilung von Verantwortung zwischen den am öffentlichenLeistungsprozess beteiligten Akteuren.«
19 Schuppert, Gunnar Folke: Verwaltungswissen-schaft. Verwaltung, Verwaltungsrecht, Verwal-tungslehre, Baden-Baden 2000, S. 810 f.
20 Dienel, Peter C.: Planungszelle. Der Bürgerals Chance, Opladen 2002.
21 Prozesse der Wissensgenerierung und desWissenstransfers rufen vor allem wegen desProzesskontrollinteresses der »Bürokratie«Gegenbewegungen hervor. Das Prozesskon-trollinteresse entspringt dem Versuch, Lern-prozesse »bürokratisch« zu steuern. Da diesesnicht möglich ist, führt das Prozesskontrollin-teresse zu einer Ausweitung der Kontroll-bemühungen und im Endeffekt zum Abbruchvon Lernprozessen. Das Wissensmanagementerstarrt dann in einem technokratischen Infor-mationsmanagement.
22 Bogumil, Jörg/Kißler, Leo: Verwaltungsmo-dernisierung als Machtspiel. Zu den heimli-chen Logiken kommunaler Modernisierungs-prozesse, in: Budäus, Dietrich/Conrad, Peter/Schreyögg, Georg (Hrsg.): New Public Mana-gement, Managementforschung 8, Berlin/New York 1998, 123-149, Wilkesmann, Uwe:Kollektives Lernen in Organisationen am Bei-spiel von Projektgruppen, in: Clermont, Alois/Schmeisser, Wilhelm/Krimphove, Dieter(Hrsg.): Personalführung und Organisation.München 2000, S. 295-311.

Öffentliche Leistungsprozesse lassen sichdemnach nicht nach rationalistischen Ent-scheidungskalkülen durchstrukturieren, wiees Modelle der Geschäftsprozessoptimie-rung suggerierten, sondern sie müssen alsAusgangspunkt für kollektive Lern-, Erfah-rungs- und Vereinbarungsprozesse begrif-fen werden.23
Wissensmanagement in und füröffentliche Leistungsprozesse
Ein Ausweg aus diesen Dilemmata könnteder Ansatz sein, die Stufung öffentlicherLeistungsprozesse selbst systematischnach weitgehend genau bestimmbarenAufgaben neu zu denken und gleichzeitigdie Schnittstellen zwischen diesen Aufga-ben in der Leistungskette zu bestimmen.An diesen Schnittstellen wären dann mög-lichst genau Transformationsregeln zu ent-wickeln, und zwar� zum einen bezüglich der Aushandlungs-
prozesse verschiedener Wissensformen� zum anderen zwischen den verschiede-
nen Stufen (rekursive Wissenskreisläu-fe).
Parallel zum öffentlichen Leistungsprozessmüsste somit ein Informations- und Wis-sensprozess aufgebaut werden, bei dem derpotenzielle Input an Informationen undWissen auf den einzelnen Stufen des Lei-stungsprozesses abgebildet und durch diebeteiligten Akteure im Hinblick auf ihreRelevanz bewertet wird.24 Wissensmanage-
ment und öffentlicher Leistungsprozessmüssen so miteinander verzahnt werden,dass sich das Wissensmanagement nichtverselbstständigt oder aber zur Alibiveran-staltung verkommt. In beiden Fällen handeltes sich um Ressourcenverschwendung.Wissensgenerierung ist eine Leistung, wel-che der Rationalität des öffentlichen Lei-stungsprozesses untergeordnet ist.25 Ein sy-stematisches Wissensmanagement erfordertein prozessorientiertes Konzept entlang derWertschöpfungskette des Wissens (Phasen:Generierung und Beschaffung, Speicherungund Bereitstellung, Transfer und Lernen).Die Form des Wissensmanagements unddie zu nutzenden Instrumente hängen dabeinicht nur von der Art der Organisation ab,sondern auch davon, welches spezifischeWissensproblem auf welcher Wertschöp-fungsstufe gelöst werden soll. Wissensma-nagement funktioniert nur, wenn es die verschiedenen Phasen entlang der Lei-stungskette berücksichtigt. Die einzelnenProzessstufen werfen jeweils spezifischeProbleme auf. So geht es bei der Wissens-verteilung/-diffusion um die Frage, wie dasrelevante Wissen zur richtigen Zeit am rich-tigen Ort, in der richtigen Form dem richti-gen Nutzer zur Verfügung gestellt werdenkann. Die Allozierung von Wissen kannaber nicht durch eine zentrale Managemen-tinstanz vorgegeben werden, sondern nurderen Möglichkeit durch die Bereitstellungentsprechender lernförderlicher Kontexte.
Öffentliche Leistungen entstehen als po-litischer Ausgleich im permanenten Wech-
selspiel zwischen der Nachfrage nach (sozi-al-)staatlichen Leistungen und dem entspre-chenden Angebot (Bild 1). Hierbei treffender Staat (oder die von ihm beauftragtenStellen) und der (organisierte) Bürger in jeunterschiedlichen Rollen aufeinander. Derreale Prozess der Leistungserbringung os-zilliert dabei im Politik-Zyklus von der Pro-blemdefinition bis zur Einzelleistung in al-len Phasen mehrfach zwischen der »Nach-frage-« und »Angebotsseite«. Dabei sind esimmer wieder die Schnittstellen auf je spe-zifischen institutionell organisierten Stufendes Leistungserbringungsprozesses, bei de-nen Nachfrage und Angebot aufeinandertreffen und den Prozess entscheidend mit-gestalten. Ausgehend vom betriebswirt-schaftlichen Konzept der »Leistungskette«lässt sich der gesamte Produktionsprozessöffentlicher Leistungen in einzelne mitein-ander verknüpfte Teilprozesse zerlegen.
Dabei stellen sich die einzelnen Stufenals Transformationsstufen von öffentlichenAufträgen und bereitgestellten Finanzmit-teln in unterschiedliche politische Leistun-gen (Produkte) dar, die jeweils Vorausset-zungen für die nachgelagerten Stufen sind.26
Eine Konzeption öffentlicher Leistungs-prozesse muss, um es zusammenzufassen,auf der einen Seite das Verhältnis von Staatund Gesellschaft abbilden, andererseitsWirkungsbeziehungen zwischen Steue-rungsaktivitäten und -ergebnissen herstel-len und diese Dimensionen zueinander inBeziehung setzen.
Die Steuerung der Wissenskreisläufe27
auf den einzelnen Stufen öffentlicher Lei-stungsprozesse muss sich an den jeweili-gen Zielebenen bzw. Bewertungskriterienorientieren. Die einzelnen Wissenskreis-läufe lassen sich als Lernarenen28 begrei-
Nachhaltige Staats- und Verwaltungsmodernisierung erfordert organisationales Lernen
250
23 Naschold u.a., a.a.O., S. 16.24 Vgl. auch Abecker, Andreas/ Hinkelmann,
Knut/Maus, Heiko: Geschäftsprozessorientier-tes Wissensmanagement, Berlin 2002.
25 Willke a.a.O., S. 91.26 Vgl. weiterführend Blanke, Bernhard: Verant-
wortungsstufung und Aktivierung im Sozial-staat - Steuerungsfragen der Modernisierung,in: Burth, Hans-Peter/Görlitz, Axel (Hrsg.):Theorie politischer Steuerung, Baden-Baden2001, S. 147-166; Lamping, Wolfram/ Schrid-de, Henning,, a.a.O..
27 Vgl. Nonaka, Ikujiro/ Takeuchi, Hirotatka: Or-ganisation des Wissens, Frankfurt a.M. 1997.
28 Arena bezeichnet in der Policy-Forschung imGegensatz zum Policy-Netz, dass sich auf Ak-teure und den institutionalisierten Beziehun-gen zwischen diesen Akteuren bezieht, dieentsprechenden Konflikt- und Konsensbil-dungsprozesse (Windhoff-Heritier a.a.O.,S.43). Die Gestalt der Lernarena ergibt sichdabei aus dem Lernziel, den relevanten Lern-prozessen, den strukturellen, kulturellen undpersonellen Besonderheiten der Organisationund schließt Konflikt- und Konsensbildungs-prozesse über die Relevanz von Informationenund Wissen mit ein.
Bild 1: Wissenskreisläufe in gestuften öffentlichen Leistungsprozessen

fen, die lose miteinander entlang der öf-fentlichen Leistungskette gekoppelt sind.Damit wird der Tatsache Rechnung getra-gen, dass öffentliche Leistungsprozessehäufig einen mehrfach kurzgeschlossenzirkulären Charakter aufweisen. Zugleichlässt sich dadurch das Nacheinander derzeitaufwändigen Erfahrungsbildung in einNebeneinander kollektiver Lernprozessetransformieren und Politikprozesse be-schleunigen. Aufgabe des Staates ist dieOrganisation einer wissensbasierten Infra-struktur und damit eines Wissensmanage-ments für öffentliche Leistungsprozesse.Dies ermöglicht die Generierung, Erpro-bung und temporäre Integration unter-schiedlichster Wissensbestände in sehrspezifischen und sich schnell verändern-den Entscheidungssituationen.29
Auf Grund des im Wesentlichen an derAbteilung Sozialpolitik und Public Policy(in Koordination mit dem IAT Gelsenkir-chen) entwickelten Konzeptes des »Akti-vierenden Staates«30 lässt sich prima faciefür jede der vier Stufen eine klare Aufgabebestimmen, für deren Erfüllung nicht nurArenen zu unterscheiden und Typen vonWissenskommunikation zu identifizierensind, sondern eine aufgabenspezifischeForm derselben zu entwickeln wäre:� die Entwicklung von Prioritäten jenseits
des Wahlzyklus und der Parteipolitik,welche einerseits stets einen gesell-schaftlichen Grundkonsens reklamiert,andererseits aber diesen gewissermaßenin den Himmel des Sachverstandes hebt(Kommissionen), wo er wie letzte Bei-spiele zeigen gerade erst recht verspieltwird
� die Klärung und Operationalisierungvon Leistungszielen im Feld des Bünd-nis- und Konsensmodells, welches sichunter dem ungefilterten Druck wider-strebender Interessenlagen häufig nichtentfalten konnte
� die Kooperation bezüglich der effizien-ten und effektiven, vor allem aber aufQualitätssteigerung gerichteten Lei-stungsprozesse, bei denen allzu häufiginsbesondere professionelle Eigeninter-essen (Fachwissen) eine erheblicheblockierende Rolle spielen (BeispielGesundheitspolitik)
� die Einbeziehung des Bürgerwissens inder Koproduktion öffentlicher Leistun-gen, eine Schnittstelle, bei der immereine Diskrepanz zwischen dem Wunschnach politischer Partizipation und derÜbernahme von Verantwortung bei derErstellung von Leistungen zu konstatie-ren war (zum Beispiel Umweltpolitik).
In allen Bereichen ginge es darum, die ver-alltäglichte Unterscheidung zwischen »Ge-sinnung« und »Verantwortung« zu über-
winden, die sich weit über das ursprüng-lich einmal formulierte ethische Postulatder Distanz verschiedener Codes von Wis-senschaft und Politik hinaus überall in derGesellschaft verbreitet hat. Viele beklagte»Blockaden« lassen sich nämlich als Folgevon Verschiebungen von Zuständigkeiten,Zurückhaltung von wichtigen Informatio-nen, mangelnde Handlungs- und Risikobe-reitschaft und fehlende Kooperationsfähig-keit entschlüsseln.
Letztlich führt also eine am Demokratie-postulat orientierte Konzeption des Wis-sensmanagements zu einer kooperativenVerteilung von Verantwortung zwischenden am öffentlichen Leistungsprozess be-teiligten Akteuren. Es liegt an den beteilig-ten Akteuren, ob sie dieser Verantwortunggerecht werden und bereit sind, aus den Er-fahrungen bisheriger Reformprozesse zulernen. Erst dann wird die Staats- und Ver-waltungsmodernisierung nachhaltig seinkönnen.31 Der Aufbau eines Wissensmana-gements an den Schnittstellen öffentlicherLeistungsprozesse kann dazu beitragen, dasLernen aus bisherigen Reformprozessen zusystematisieren und damit die Handlungs-und Strategiefähigkeit des Staates auf eineneue Grundlage zu stellen.
Bernhard Blanke und Henning Schridde, Wissensmanagement an den Schnittstellen öffentlicher Leistungsprozesse
VM 5/2004 251
29 Straßheim 2002, S. 25.30 Vgl. Blanke, Bernhard/von Bandemer, Step-
han: Der »aktivierende Staat« Gewerkschaftli-che Monatshefte 6/1999, S. 321-330; Blanke,Bernhard/ Schridde, Henning: Bürgerengage-ment und Aktivierender Staat. Ergebnisse ei-ner Bürgerbefragung zur Staatsmodernisierungin Niedersachsen, in: Aus Politik und Zeitge-schichte B 24-25/1999, S. 3-12; AG Aufga-benkritik: Vorschläge für eine Aufgabenkritikim Land Niedersachsen Band I, Hannover, AGAufgabenkritik: Bericht zur Aufgabenkritik imLand Niedersachsen Band II, Hannover; Blan-ke, Bernhard, a.a.O.; Lamping, Wolfram/Schridde, Henning, a.a.O.
31 Vgl. Klages, Helmut: Nachhaltige Verwal-tungsmodernisierung, in: Verwaltung und Ma-nagement 9. Jg., 1/2003, S. 4-12.

Das Konzept des Gender Mainstreamingdringt langsam, aber stetig in die Kommu-nalverwaltung ein und wird zunehmend,wenn auch meist noch in recht allgemeinerForm, für die Verwaltungspraxis bedeut-sam. Zwar mangelt es dabei nicht anIdeen, vereinzelt kommen auch entspre-chende Projekte zustande, aber in der Re-gel fehlt es an einer ganzheitlichen Ge-samtschau des Gender Mainstreaming-Prinzips für alle Fachbereiche derKommunalverwaltung und Aufgabenfelderin der Kommune, außerdem auch an einernachprüfbaren und implementierbaren
Konkretisierung. Echte Umsetzungen ei-nes konkretisierten Ansatzes sind bisherfast überhaupt nicht feststellbar. Wir stel-len im Folgenden die Ergebnisse einer Stu-die* vor, mit der wir vor allem zwei Zieleverfolgten, nämlich:� Die zentrale Bedeutung von Gender
Controlling im Umsetzungsprozess desGender Mainstreaming als ganzheitli-ches Steuerungsprinzip war herauszuar-beiten.
� Eine operationalisierende Form desControlling sollte mit einem spezifi-schen Controlling-Instrument, der Ba-lanced Scorecard (BSC), das nach unse-rer Auffassung sowohl die erwähnteganzheitliche Sichtweise als auch dienotwendige Konkretisierung gewährlei-stet, nachprüfbar angewendet werden.
� Zugleich wollen wir damit auch das In-strument der BSC für den Praxisbereich»Gender Mainstreaming« erproben undsomit auf den Prüfstand stellen.
Im Mittelpunkt unserer Studie steht einumfassendes Gender Controlling-System,bestehend aus Zielen, Maßnahmen undKennzahlen, das wir als Gender-Strategie-Karte bezeichnen.
Gender Mainstreaming als gleichstellungspolitisches Prinzipin der Kommune
In der deutschen Politik- und Verwaltungs-praxis ruft der Begriff Gender Mainstrea-ming nicht selten Kritik hervor, er gilt alssperrig und erklärungsbedürftig. Da es
aber bislang keine griffige deutsche Über-setzung dieses umfassenden Politikprin-zips gibt, hat er sich inzwischen auch imdeutschen Sprachraum durchgesetzt. Zumbesseren Verständnis soll zunächst einkleiner Rückblick auf seine Ursprünge ge-geben werden.
Gender Mainstreaming auf dem Weg von der internationalen zur kommunalen Politik
Der Begriff Gender Mainstreaming hat sei-ne Wurzeln in der internationalen Frauen-bewegung und der Entwicklungspolitik derSiebzigerjahre und wurde 1997 auf eu-ropäischer Ebene als verpflichtendes Prin-zip für alle EU-Mitgliedstaaten im Amster-damer Vertrag verankert. Inzwischen gibtes vermehrt in den Kommunen Bestrebun-gen und Aktivitäten, diese Strategie füreine integrierte Geschlechterpolitik umzu-setzen und Gender Mainstreaming zur Ge-meinschaftsaufgabe zu erklären. Beispiel-haft seien hier die Städte Düsseldorf, Wup-pertal, Hannover, Darmstadt, Wiesbaden,Freiburg, Rostock, Leipzig und Magde-burg genannt. Gender Mainstreaming istalso inzwischen auf der kommunalen Ebe-ne angekommen. Allerdings sind die kom-munalen Umsetzungsaktivitäten bislangnur wenig dokumentiert bzw. öffentlichpubliziert.1 Gerade die kommunale Ebeneist für die Umsetzung von Gender Main-streaming von besonderer Bedeutung, hän-gen doch die konkreten Arbeits- und Le-bensbedingungen von den lokalen Gege-benheiten ab und werden dort sichtbar,zum Beispiel dadurch,
Gender Controlling in der Kommunalverwaltung
von Anke Rösener und Wulf Damkowski
Gender Mainstreaming ist als Begriff in aller Munde, häufig fehltes aber an nachhaltigen Umsetzungen in der Praxis. Wer das Zielder Geschlechtergerechtigkeit ernsthaft verfolgen will, ist daraufangewiesen, ein umfassendes Gender Controlling-System zu eta-blieren. Dabei ist Gender Controlling als Ansatz zur Planung, Or-ganisation, Umsetzung und Kontrolle einer verbindlichen Gleich-stellungspolitik in Organisationen zu verstehen. GenderControlling stellt dabei kein isoliertes Bereichscontrolling dar, son-dern sollte Bestandteil eines Gesamt-Controlling-Systems sein.*
Univ.-Professor Dr.Wulf Damkowski lehrtan der Hamburger Universität für Wirt-schaft und Politik Öffentliches Recht undPublic Managementund ist Gründungsmit-glied von IGUS.
Diplom-PolitologinAnke Rösener, Institutfür Gesundheits-, Um-
welt- und Sozialplanung(IGUS)**, Hamburg.
Evaluierung der Maßnahmen für mehr Geschlechtergerechtigkeit
252 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 252-257
* Die folgenden Ausführungen basieren aufdem Endbericht eines von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projektes. Er wurde inder Reihe »Arbeitspapiere« der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht.
** IGUS ist ein Forschungs- und Beratungsinsti-tut, das Organisationen des öffentlichen undDritten Sektors bei der Gestaltung ihrer Ver-änderungsprozesse unterstützt. Kontakt: IGUSe.V., Rentzelstraße 7, 20146 Hamburg, Tel.(040) 45036000, E-Mail: [email protected].
1 Siehe für kurze beispielhafte Übersichten Fär-ber 2001, Erhardt/Jansen o.J.; Wrangell 2003.

� dass die kommunale Planungs- undVerkehrspolitik über die Mobilität vonFrauen entscheidet
� dass sich Art und Umfang der Erwerbs-tätigkeit von Frauen danach entschei-den, wie der lokale/regionale Arbeits-markt strukturiert wird und in welchemAusmaß die Kommune Kinderbetreu-ungsangebote zur Verfügung stellt
� dass Kultur- und Bildungsangebote dieEntwicklungschancen von Jungen undMädchen beeinflussen
� dass die Einführung familienfreundli-cher Arbeits- und Öffnungszeiten in ei-ner Kommune die Vereinbarkeit vonBeruf und Familie fördern kann oder
� im überschaubaren Bereich der Ge-meinde sich Kommunalpolitik den spe-zifischen Bedürfnissen von Frauenleichter erschließen kann, als dies aufLandes- oder Bundesebene möglich ist.
Die bisherigen Diskussionen und Erfahrun-gen haben gezeigt, dass in allen Aufgaben-und Handlungsfeldern einer Kommunegenderrelevante Faktoren eine Rolle spie-len. Es gibt fast nichts, das es nicht lohnt,hinsichtlich der Auswirkungen auf die Ge-schlechterverhältnisse hin betrachtet zuwerden. Wir beziehen uns im Folgendenauf das politisch-administrative System ei-ner Kommune, also die Verwaltung undden Rat als Hauptakteure im Gender Main-streaming-Prozess. Als Handlungsfelderkommen damit alle Aufgaben und Leistun-gen in Betracht, die im Einflussbereich vonKommunalverwaltung und -politik liegen.Diese sind sowohl auf die internen Prozes-se im politisch-administrativen System ge-richtet als auch auf die Dienstleistungser-stellung gegenüber den Bürgerinnen undBürgern in der Kommune.
Begriff, Ziele und Methoden von Gender Mainstreaming
Gender Mainstreaming bedeutet, dass beiallen Planungs-, Entscheidungs- und Um-setzungsprozessen alle Institutionen vonPolitik und Verwaltung die jeweils spezifi-sche Situation von Frauen und Männerndifferenziert zu beachten und ihr Handelnauf die Beseitigung von Ungleichheitenzwischen den Geschlechtern auszurichtenhaben.2 Es handelt sich somit um einen an-spruchsvollen und konsequenten Grund-satz, der eine gänzlich neue Denk- undSichtweise verlangt:� Gleichberechtigung ist nicht mehr »rei-
ne Frauensache«, und so genannte»Frauen-Defizite« sind nicht ge-schlechtsspezifisch, sondern sie existie-ren aufgrund gesellschaftlich definierterGeschlechterrollen. Das Geschlechter-verhältnis ist nur dann änderbar, wenn
bei beiden Geschlechtern zugleich an-gesetzt wird. Demzufolge wird bei-spielsweise der Anteil vollerwerbstäti-ger Frauen nur dann zu erhöhen sein,wenn zugleich Männer verstärkt Aufga-ben in der Familie übernehmen.
� Allgemeines Ziel von Gender Main-streaming ist die Gleichberechtigungder Geschlechter. Mit diesem Prinzipsoll erreicht werden, dass Frauen undMänner in der gleichen Weise an politi-schen, gesellschaftlichen, wirtschaftli-chen und organisatorischen Prozessenteilhaben. Gemeint ist nicht Gleichstel-lung im formalen Sinne, sondern dieBerücksichtigung der unterschiedlichenAusgangsbedingungen und Lebenssi-tuationen von Männern und Frauen.Diese treten besonders deutlich zutage,wenn Männer und Frauen nicht jeweilsals homogene Gruppen gesehen wer-den, sondern innerhalb dieser Gruppennach unterschiedlichen Bedürfnissenund Bedingungen wie zum Beispiel Al-ter, Familienstand, sozialer Status, An-
zahl der Kinder, Art und Umfang derBeschäftigung u.ä. differenziert wird.Damit ist Gender Mainstreaming auchanschlussfähig an so genannte Diversi-ty-Ansätze, die in US-amerikanischenUnternehmen im Kampf gegen Rassis-mus entstanden sind und auf die positi-ven Wirkungen der Vielfalt von kultu-rellen und ethnischen Werten undNormen in einer Organisation abheben.
� Damit nimmt Gender Mainstreamingeine zweifache Perspektive ein: Zum ei-nen sollen gleiche Rechte, Pflichten undChancen von Frauen und Männern inallen gesellschaftlichen Bereichen er-reicht werden, zum anderen geht esaber auch um die Gleichwertigkeit vonweiblichen und männlichen Lebensmu-stern und Kompetenzen. Die »männli-che« Lebenswelt stellt nicht länger dieNorm dar, an der sich alles Übrige an-zupassen habe, sondern die herrschen-den Werte und Normen selbst werdenunter geschlechterspezifischen Ge-sichtspunkten verändert.
� Der politische Wille der Organisations-spitze ist die unbedingte Voraussetzungzur Umsetzung dieses Prinzips. Darüberhinaus spielen beteiligungsorientierte
Verfahren eine große Rolle. Das gleich-berechtigte Zusammenwirken von Frau-en und Männern muss gekoppelt seinmit dem Zusammenwirken von Organi-sationsleitung und Basis. Diese Strategiegeht damit über den klassischen Top-Down-Ansatz hinaus. Die Verantwor-tung liegt bei allen Verantwortungsträ-gern und allen an der Planung,Durchführung und Steuerung Beteilig-ten, und zwar in jeder Dienststelle, kom-munalen Einrichtung, in Projektgruppen,aber auch in Ausschüssen und im Rat.
� Gender Mainstreaming ist ein Instru-ment, aber nicht das einzige zur Schaf-fung von Geschlechtergerechtigkeit. Esersetzt nicht die bisherige spezifischeFrauenförderung, sondern ergänzt diese.Die klassische Frauen- und Gleichstel-lungspolitik bildet dabei die Basis fürGender Mainstreaming. Sie stellt zum ei-nen notwendiges Wissen und langjährigeErfahrungen bereit, zum anderen ist siezur Beseitigung bestehender Ungleich-heiten weiterhin erforderlich.
Bei den oben skizzierten wesentlichen Ele-menten des Gender Mainstreaming-Prin-zips wird deutlich, dass Gender Mainstrea-ming kein Ziel an sich darstellt, sondernals Methode, Prinzip oder Denkweise erstnoch mit konkreten inhaltlichen Zielenverbunden werden muss. Diese sind Ge-genstand von politischen Entscheidungenund Verhandlungen und müssen für allePolitik- und Arbeitsbereiche weiter kon-kretisiert werden.
Was die Umsetzung in die Praxis an-geht, so gibt es keine allgemein gültigeRegel, vielmehr ist der Prozess abhängigvon der jeweiligen Organisationskultur. Eslassen sich jedoch Aktivitätsbereiche un-terscheiden, in denen jeweils unterschiedli-che Methoden und Instrumente zum Ein-satz kommen.3
So finden sich Maßnahmen wie Infor-mationsveranstaltungen, Beratung undFortbildung, um die notwendige Gender-Kompetenz in den Organisationen und beiallen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Anke Rösener und Wulf Damkowski, Gender Controlling in der Kommunalverwaltung
VM 5/2004 253
»Der Begriff Gender Mainstreaming wurde1997 als verpflichtendes Prinzip für alle EU-Mitgliedstaaten im Amsterdamer Vertrag verankert.«
2 Zur Begriffsdefinition siehe auch Europarat1998, zit. nach Krell/Mückenberger/Tondorf2001: 7; Stiegler 2000: 8.
3 Vgl. auch Döge 2002: 13 f.

herzustellen. Darüber hinaus erfordert Gen-der Mainstreaming die Bereitstellung vonRessourcen für die einzelnen Umsetzungs-maßnahmen. Durch die Einrichtung von in-stitutionellen Arbeitsformen soll eine Gen-der-Verantwortlichkeit in den betreffendenOrganisationseinheiten gewährleistet wer-den. Ein weiterer Aktivitätsbereich zielt aufdie Sicherstellung einer Gender-Verbind-lichkeit durch entsprechende Evaluations-und Controllingmethoden.
Bei Gender Mainstreaming handelt essich um einen langfristig angelegten Lern-prozess, dessen neue Sicht- und Denkwei-se eingeübt werden muss und der als »be-wusst gestaltendes Prinzip«4 zu verstehenist. Wir sehen einen wichtigen Erfolgsfak-tor darin, dass diese Prozesse von Beginnan durch ein kontinuierliches Controllingunterstützt werden, um jederzeit steuerndund korrigierend eingreifen zu können.5
Alle obigen Aktivitätsbereiche lassensich durch Gender Controlling unterstüt-zen und in ihrem jeweiligen Umsetzungs-stand transparent machen; bei dem letztge-nannten Punkt, der Gender-Verbindlich-keit, setzt Controlling an, indem es die
Umsetzung von Maßnahmen und die Ziel-erreichung überprüft und evaluiert.
Was damit gemeint ist und wie es in derPraxis aussehen könnte, soll im Folgendennäher dargestellt werden. Vorab sei ange-merkt, dass der Begriff etwas missver-ständlich ist, denn Gender Controlling sollkeinen eigenständigen Controllingbereichabbilden. Bereits aus dem Anspruch vonGender Mainstreaming als Querschnitts-aufgabe folgt, dass die Gender-Perspektivein alle bestehenden Steuerungselementeeinzuflechten ist. Zahlreiche Kommunenhaben im Zuge der Verwaltungsreform in-zwischen allgemeine Controlling-Systemeinstalliert. Soweit ein solches Controlling-System bereits vorhanden ist, sollte Gen-der Controlling unbedingt in dieses inte-griert und nicht isoliert in der Kommuneeingeführt werden.
Gender Controlling als Umsetzungsstrategie
Controlling mit der Balanced Scorecard(BSC) als einem Controllinginstrument er-
scheint uns besonders geeignet, den not-wendigen Prozess der Operationalisierungvon Gender Mainstreaming voranzutreibenund konkretisierende Impulse für die Um-setzung und Verankerung von Gender Mainstreaming in der Kommunalverwal-tung zu geben.
Verwaltungscontrolling und GenderControlling
Aus dem betriebswirtschaftlichen Grund-verständnis von Controlling folgt, dassVerwaltungscontrolling als wesentlichesElement des neuen Steuerungsmodells le-diglich als Entscheidungshilfe, genauer alsInformations- und Führungsunterstützungs-system, und nicht als Entscheidungsinstanzzu verstehen ist. Daher ist Verwaltungscon-trolling regelmäßig als Stabsstelle zu orga-nisieren, die gegenüber der jeweiligen Lei-tungsinstanz Assistenzfunktionen ausübt,aber auch auf engen Informations- undKommunikationskontakt zu den nachge-ordneten Mitarbeiterinnen angewiesen ist.Auch ist Verwaltungscontrolling nicht mitKontrolle zu verwechseln, sondern Con-
trolling ist unterstützend sowohl in Aufga-benbereichen wie der Planung, Zielent-wicklung und Umsetzungsüberwachung alsauch der Ergebniskontrolle und Evaluationtätig.
Das bedeutet, dass Verwaltungscontrol-ling sowohl längerfristige Konzeptentwür-fe und Zielvorstellungen erarbeitet (strate-gisches Controlling) als auch zum Beispieleher kurzfristig Informationen etwa zumKostenbereich sammelt, auswertet undaufbereitet (operatives Controlling), Soll-Ist-Vergleiche sowie Abweichungs- undUrsachenanalysen durchführt.
Controlling lässt sich problemlos aufden Ansatz des Gender Mainstreamingübertragen und eignet sich, Gender Main-streaming in der Praxis der Kommunalver-waltung zu operationalisieren und zu ver-ankern.6 In diesem Sinne lässt sich GenderControlling definieren als: »ein funktions-übergreifendes Steuerungsinstrument, dasdie Unternehmensleitung und die Füh-rungskräfte im mittleren Management da-bei unterstützt, Gleichstellungsziele zu for-mulieren und gleichstellungsförderndeMaßnahmen zu planen, umzusetzen, zu
evaluieren, zu kontrollieren und zu korri-gieren. Zu diesem Zwecke er- und verar-beitet das Gleichstellungscontrolling diefür die Planung, Steuerung und Kontrolledes innerbetrieblichen Gleichstellungspro-zesses relevanten Kennzahlen und Informa-tionen und übernimmt Beratungsfunktio-nen, die dem Management optimale Ent-scheidungen in der Umsetzung undKorrektur des Gleichstellungsziels ermög-lichen.«7
Controlling arbeitet mit spezifischenControllinginstrumenten. Dazu gehörenunter anderem die Verwendung von Kenn-zahlen und ein darauf bezogenes Berichts-wesen. Ein neueres Instrument spezifischerArt ist in diesem Zusammenhang die Ba-lanced Scorecard.
Die Balanced Scorecard als Controllinginstrument für die Kommunalverwaltung
Die Balanced Scorecard wurde ursprüng-lich von den Autoren Kaplan/Norton fürdie Privatwirtschaft entwickelt und istwohl wörtlich als »Ausgewogene Punkte-karte« zu übersetzen; wir sprechen in frei-er Übersetzung von »Ausgewogener Stra-tegiekarte«. Kaplan/Norton beschreibendiese wie folgt8:� »Klärung und Herunterbrechen von Vi-
sion und Strategie� Kommunikation und Verknüpfung von
strategischen Zielen und Maßnahmen� Planung, Festlegung von Zielen und
Abstimmung strategischer Initiativen� Verbesserung von strategischem Feed-
back und Lernen«.Die Balanced Scorecard dient also bereitsin der Privatwirtschaft der Operationalisie-rung von Unternehmensstrategien bzw. -zielen und beinhaltet vier Dimensionen:� finanzielle Dimension� Dimension der internen Geschäftspro-
zesse� Dimension von Lernen und Entwick-
lung � Kundendimension.Nach unserem Verständnis ist die Balan-ced Scorecard sowohl Steuerungs- undUnterstützungsinstrument als auch Check-Liste, mit der gewährleistet werden soll,dass ein Unternehmen bei der Operationa-lisierung von Zielen und Strategien diesevier Dimensionen zuverlässig berücksich-tigt. Die von Kaplan/Norton für die privat-
Evaluierung der Maßnahmen für mehr Geschlechtergerechtigkeit
254
4 Jung 2003: 199.5 Siehe auch Färber 2001: 22.6 Vgl. auch Sander/Müller 2003: 286 f.; Icking
2002: 1.7 Sander/Müller 2003: 286.8 Kaplan/Norton 1997: 8 f.
»Gender Mainstreaming bedeutet, dass Politik und Verwaltung ihr Handeln auf die
Beseitigung von Ungleichheiten zwischen denGeschlechtern ausrichten.«

wirtschaftliche Unternehmung entwickelteBSC ist nicht ohne weiteres auf den öffent-lichen Sektor und die Kommunalverwal-tung, aber doch in modifizierter Formübertragbar. Wir haben im Rahmen ver-schiedener Projekte diese privatwirtschaft-liche BSC für den öffentlichen Sektor an-gepasst.9 Hierbei haben wir folgendeAspekte verändert bzw. ergänzt: � Für den Prozess der BSC-Entwicklung
erscheint uns wichtig, dass:– sowohl die politische Führung als
auch die Verwaltungsspitze und Ver-waltungsmitarbeiter beteiligt werden
– der Prozess nicht nur top-down, son-dern im »Gegenstromverfahren« topdown bottom-up erfolgt.
� Wir halten alle vier Zieldimensionen fürgleichrangig und haben daher die opti-sche Dominanz der finanziellen Dimen-sion bei Kaplan/Norton aufgegeben.
� Nach unserer Erfahrung ist es zweck-mäßig, zwischen allgemeinen Rich-tungszielen, die direkt aus einer Visionoder einem Leitbild ableitbar sind, unddiese konkretisierenden Einzelzielen zuunterscheiden.
� Die Kundendimension ist nach unsererAuffassung zu eng gefasst und ist umdie Rolle des Bürgers als Mitgestalterzu ergänzen.
� Wir meinen, dass die Dimension »Ge-schäftsprozesse« zu kurz greift und die-se um organisationsinterne Aspekte derMitarbeiterperspektive und der Organi-sationsstrukturen zu erweitern ist.
Aufgrund dieser Veränderungen formulie-ren wir die Dimensionen der BSC für denöffentlichen Sektor, insbesondere dieKommunalverwaltung, folgendermaßen:� Strategische, gesellschaftspolitische Zie-
le (Politikumfeld-Ziele): »Innovationund Entwicklung«
� strategische, verwaltungsinterne Inno-vationsziele einschließlich mitarbeiter-orientierter Ziele (interne Organisati-onsziele): »Geschäftsprozesse« im wei-teren Sinne
� strategische und operative bürger- undkundenorientierte Ziele (Mitgestaltungs-und Service-Ziele): »Kunden/ Bürger«
� operative, finanzwirtschaftliche Ziele:Finanzen.
Es hat sich für uns erwiesen, dass eine sol-che Balanced Scorecard hervorragend ge-eignet ist, die in den vier Dimensionen zuentwickelnden Ziele aufgrund bestimmterMethoden in konkrete Maßnahmen, die dieZiele fördern sollen, und Indikatoren, diedie Zielerreichung messen können, zu ope-rationalisieren.
Obige Zieldimensionen haben wir fürdie Operationalisierung von Gender Main-streaming angewandt und zunächst folgen-
de, für Gender Mainstreaming wiederumleicht modifizierte Zieldimensionen ent-wickelt, wobei uns die englischsprachlicheBegrifflichkeit zwar nicht »schön«, aberdoch kurz gefasster und treffender er-scheint. Wir unterscheiden dabei zwischen»Learning«, »Processing«, »Services« and»Resources«. Sämtliche Begriffe ließensich zweifellos, wenn auch etwas umständ-licher und »holpriger« ins Deutsche über-tragen. In Abwandlung der BSC bildendiese Dimensionen, die in Bild 1 nochnäher erklärt werden, die von uns so ge-nannte »Gender-Strategie-Karte«.
Die Gender-Strategie-Karte: Ein umfassendes Gender Controlling-System
Im Folgenden stellen wir wenige Beispieleaus der von uns erarbeiteten Gender-Stra-tegie-Karte vor. Zur Klärung von Ver-ständnisfragen möchten wir vorab einigeErläuterungen hierzu geben:� Jeder der vier genannten Zieldimensio-
nen wurden allgemeinere Richtungszielesowie konkrete Einzelziele zugeordnet.
Anke Rösener und Wulf Damkowski, Gender Controlling in der Kommunalverwaltung
VM 5/2004 255
9 Vgl. hierzu auch König/Rehling 2002: 13-17.
Bild 1: Die vier Dimensionen der Gender-Strategie-Karte

� Auf der Zielebene haben wir nicht nur»realistische« Ziele, sondern auch vi-sionäre Ziele berücksichtigt. Sicherlichist es richtig, die realistischen, konkre-teren und mittelfristigen Ziele vorrangigim Auge zu haben; dies sind bei uns dieso genannten Einzelziele. Aber wir mei-nen, dass auf die visionären, längerfri-stigen und notwendig allgemeinerenZiele bei uns die Richtungsziele nichtverzichtet werden sollte, damit auf die-se Weise immer bewusst bleibt, in wel-chem strategischen Rahmen sich dieMaßnahmen und Einzelziele bewegen.
� Uns ist bewusst, dass sich einzelne Zie-le und die damit verbundenen kommu-nalen Aufgabenfelder nicht auf kleinereKommunen übertragen lassen, da be-stimmte Aufgaben nur für mittlere undgrößere Kommunen relevant sein dürf-ten. In ganz wenigen Fällen (zum Bei-spiel Gender-Unterrichtsinhalte anSchulen) haben wir Fragen aufgenom-men, die zwar nicht unmittelbar in dieKompetenz der Kommunen fallen, abervon diesen (zum Beispiel gegenüberdem Kultusministerium) angeregt wer-den können.
� In der Dimension »Gender Resources«haben wir absichtlich einen sehr weitenRessourcenbegriff unterstellt, der nebenden klassischen Ressourcen (Geld, Per-sonal, Sachmittel, Grundstücke/Gebäu-de) zum Beispiel auch Informationenund Zeit einbezieht. Deshalb werdenzum Beispiel Fragen der kommunalenZeitpolitik und eines geschlechterge-rechten Zeitangebots in der Dimension»Gender Resources« behandelt.
Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren der Umsetzung
Wir möchten abschließend auf einige wich-tige Bedingungen, förderliche und hinderli-che Faktoren, die aus unserer Sicht bei derUmsetzung von Gender Controlling eineRolle spielen, eingehen. Nach dem hier zu-grunde gelegten Verständnis ist GenderControlling ein zentraler Bestandteil imGender Mainstreaming-Prozess im Sinneeiner ganzheitlichen und integrierten Re-formstrategie im politisch-administrativenGesamtsystem einer Kommune. Somit sindfür Gender Controlling zunächst dieselbenErfolgsfaktoren relevant, wie sie allgemeinfür alle Change Management-Prozesse gel-ten. Dazu gehören:� Politischer Wille und Identifikation der
Verwaltungsspitze mit Gender Main-streaming und Gender Controlling
� Verankerung von Gender Mainstreamingund Gender Controlling im Leitbild einerKommune oder einer Verwaltung
� Verpflichtung aller Führungskräfte,Gender Mainstreaming als durchgängi-ges Arbeitsprinzip in ihrem jeweiligenVerantwortungsbereich umzusetzen
� Herstellung von Problembewusstsein,zum Beispiel durch Workshops und Fort-bildungen, in denen die Ziele und derNutzen der Strategie vermittelt werden.
Betrachtet man die historische Entwick-lung des Gender Mainstreaming-Ansatzes,so zeigt sich, dass vor allem politischerund finanzieller Druck, zum Beispiel überdie Bindung finanzieller Mittel an die Um-setzung von Gender Mainstreaming ein be-sonders wirksames Durchsetzungsmitteldarstellt, wie es sich vereinzelt auch indem Gender-Zielsystem widerspiegelt.
Eine zentrale Voraussetzung für dieUmsetzung von Gender Mainstreaming istdie konsequente geschlechtsspezifischeDatenerhebung und Auswertung in allenRessorts. Auf dieser Grundlage lassensich erstens die Ungleichheiten zwischenden Geschlechtern relativ »emotionslos«abbilden und zweitens konkrete Ziele undMaßnahmen für deren Beseitigung ent-wickeln.
Evaluierung der Maßnahmen für mehr Geschlechtergerechtigkeit
256

Damit Gender Controlling als Rich-tungsanzeiger für den Gender Mainstrea-ming-Prozess verlässlich funktioniert undals Steuerungsinstrument genutzt werdenkann, sollte eine breite Beteiligung aller re-levanten Verwaltungseinheiten und Gender-Kompetenzträger sowie Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter aus dem zentralen Control-ling bereits bei der Entwicklung eines Ziel-und Kennzahlensystems gewährleistet sein.Für den laufenden Prozess sollte es kontinu-ierliche Rückkopplungen zwischen demControlling, einer evtl. eingerichteten Gen-der Mainstreaming-Projektgruppe sowieden jeweils betreffenden Ressorts geben.
Darüber hinaus kann die Schaffung vonAnreiz- oder Bonussystemen für die pro-dukt- und budgetverantwortlichen Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter in der Verwal-tung förderlich sein.
Auch wenn immer wieder betont wird,dass sich Gender Mainstreaming gut mitder Verwaltungsreform verbinden lässt,möchten wir abschließend auf einen ent-scheidenden Unterschied zwischen beidenReformansätzen hinweisen: Es geht beiGender Mainstreaming nicht lediglich umdie Verbesserung von Kundenzufrieden-heit oder Ressourceneffizienz, sondern esgeht im Kern um die Verwirklichung desGrundrechts auf Chancengleichheit vonMännern und Frauen.
Die Etablierung eines Gender Control-ling bedeutet noch nicht, dass sich damitGender Mainstreaming als quasi-automati-scher Prozess von allein vollzieht. Vielmehrist eine neue Organisationskultur erforder-lich, die sich nur über eine durchaus nichtimmer schmerz- und konfliktfreie Reflexionund Auseinandersetzung von tief verinner-lichten Werten, Normen und Strukturenherstellen wird. Gender Controlling kannsolche Diskussionen und Aushandlungspro-zesse nicht ersetzen, sondern diese allen-falls anregen und unterstützen.
Literatur
Döge, Peter (2002): »Managing Gender«. Gen-der Mainstreaming als Gestaltung von Ge-schlechterverhältnissen; in: Aus Politik undZeitgeschichte B 33-34/2002: 9-16.
Erhardt, Angelika/Jansen, Mechthild M. (Hg.)(o.J.): Gender Mainstreaming. Grundlagen, Prin-zipien, Instrumente; Hessische Landeszentralefür politische Bildung: Polis 36.
Färber, Christine (2001): Gender Mainstreamingin der kommunalen Praxis; in: LandeshauptstadtDüsseldorf (Hg.): Gender Mainstreaming inKommunalverwaltung und Kommunalpolitik,Düsseldorf: 17-29
Icking, Maria (2002): ESF-Controlling in NRW– Möglichkeiten für ein Gender Controlling,Vortrag zur Fachtagung »Chancen erkennen –Gleichheit sichern« am 24. Januar 2002 [www.
zfbt/chance/gender_tagung/Icking_vortrag.pdfabgerufen Juli 2002].
Jung, Dörthe (2003): Gender Mainstreaming alsnachhaltige Veränderungsstrategie, in: Hein-rich-Böll-Stiftung (Hg.): Geschlechterdemokra-tie wagen, Königstein/Ts.: 193-201.
Kaplan, Robert S./Norton, David P. (1997): Ba-lanced Scorecard. Strategien erfolgreich umset-zen, Stuttgart.
König, Susanne/Rehling, Mette (2002): ZurÜbertragbarkeit der Balanced Scorecard auf einzukunftsgerichtetes Personalmanagement der öf-fentlichen Verwaltung, PerMit-Diskussionspa-pier 01-02, Universität Oldenburg [www.uni-ol-denburg.de/orgpers/DiskussionsPapier01-02.pdfabgerufen Oktober 2002].
Krell, Gertraude/Mückenberger, Ulrich/Tondorf,Karin (2001): Gender Mainstreaming. Informa-tionen und Impulse. Herausgegeben vom Nieder-sächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit, So-ziales, Hannover.
Sander, Gudrun/Müller, Catherine (2003):Gleichstellungs-Controlling in Unternehmun-gen und öffentlichen Verwaltungen; in: UrsulaPasero (Hg.): Gender from Costs to Benefits,Wiesbaden: 284-298.
Stiegler, Barbara (2000): Wie Gender in denMainstream kommt. Konzepte Argumente undPraxisbeispiele zur EU-Strategie des GenderMainstreaming, Bonn.
Wrangell, Ute von (2003): Gender Mainstrea-ming, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauf-tragte – wie passt das zusammen?; in: MechthildM. Jansen/Angelika Röming/Marianne Rohde(Hg.): Gender Mainstreaming. Herausforderungfür den Dialog der Geschlechter, München: 49-75 [www.hlz.hessen.de/polis36.pdf November2003].
Anke Rösener und Wulf Damkowski, Gender Controlling in der Kommunalverwaltung
VM 5/2004 257
Neuerscheinungen
Kommunale Datenverarbeitungszentralen
Julia Wölm, Situationsanalyse und Entwicklungs-perspektiven, Münster, Berlin, Hamburg, London,Wien 2004, 160 Seiten, ISBN 3-8258-7687-x.Die Rahmenbedingungen für die KommunalenDatenverarbeitungszentralen haben sich in denletzten zehn Jahren grundlegend gewandelt. An-hand von Fallstudien wird die aktuelle Situationin Deutschland untersucht. Im Vordergrund stehtdie Frage, welche Rolle diese Einrichtungen unterBerücksichtigung der aktuellen Entwicklungen inder Verwaltung einerseits und des Wettbewerbsim Informationstechniksektor andererseits künftigfür die Kommunalverwaltungen spielen können.
Lehrbuch über Public Management
Tony Bovaird und Elke Löffler (Hrsg.), PublicManagement and Governance, Routledge, Lon-don 2003, 255 Seiten, ISBN 0-415-25245-8.Leicht verständlich, übersichtlich und prägnantvermittelt das Lehrbuch in 18 Kapiteln Wissenüber neueste Entwicklungen der Verwaltungsmo-dernisierung auf kommunaler und staatlicher Ebe-ne. Das Buch enthält viele Praxisbeispiele ausGroßbritannien, anderen europäischen Ländernund den USA, die auch im Unterricht als Fallstu-dien eingesetzt werden können. Es behandelt aktu-elle Themen wie E-Government, Leistungsmes-sung und Qualitätsmanagement und stellt zugleichNetzwerkmanagement, Leadership, Bürgerenga-gement und Ethik als neue Herausforderungen fürBehörden in Europa vor.

Einführung
Das Thema eGovernance ist von verschie-denen Autoren behandelt worden (Reiner-mann und von Lucke; Malkia; Anttiroikound Savolainen). Aus unserer Sicht dienteGovernance dazu, durch die Anwendungvon Informations- und Kommunikations-technologien die Qualität und Effizienzdes Lebenszyklus von Regelungen in allseinen Phasen zu unterstützen und zu ver-bessern. Für dieses Konzept spielen Com-putermodelle eine zentrale Rolle. Der Be-griff Computermodell umfasst in diesemFall alle Datenmodelle und Metadaten vonGesetzen auf abstrakten und konkretenEbenen, zum Beispiel Volltext, Hypertext,Diagramme und andere Visualisierungs-methoden und auch formellere Methoden,die auf Repräsentationstechniken derKünstlichen Intelligenz beruhen. Welcherder genannten Modelltypen der geeigneteist, wird durch die auszuführende Maßnah-me bestimmt.
Durch den Einsatz wissensbasierterRechtsberatungssysteme (Legal Knowled-ge-based Systems; LKBS) können Kor-rektheit, Transparenz und Effizienz in der
Administration komplexer Gesetze undVerordnungen deutlich erhöht werden. DerSchwerpunkt dieser Abhandlung soll aufder Verwendung von wissensbasiertenRechtsberatungssystemen innerhalb derImplementierungsphase des Lebenszyklusvon Regelungen liegen
eGovernance und seine Beziehungzu eGovernnment
Governance ist ein Thema – kein Stand-punkt, keine These, Methode oder Lösung,auch keine Technologie. Es handelt vonder Führung einer Organisation im Sinneihrer Ziele und zum Schutz ihrer Interes-sen. Im politischen Kontext bedeutet»Good Governance« die Förderung der ge-samtgesellschaftlichen Interessen ein-schließlich derjenigen zukünftiger Genera-tionen. Allerdings ist Governance nicht al-lein eine Angelegenheit von Städten,Ländern, Staaten, Staatengemeinschaftenund anderen politischen Einheiten, sondernebenso von privaten Organisationen.
Verschiedene Entwicklungen begrün-den das Interesse an dem Thema Gover-nance (Malkia, Anttiroiko und Savolai-nen):� die sich ändernde Rolle und wachsende
Bedeutung von Wissen (cf. »the know-ledge society«)
� der Trend zu nicht-hierarchischen For-men von Organisationen und Manage-ment, insbesondere zu Netzwerken
� die Globalisierung und damit verbunde-ne Machtverlagerung von nationalen zuinternationalen Institutionen und welt-weiten Organisationen
� das Potenzial neuer Informations- undKommunikationstechnologien (IuK) zurVerbesserung der Effizienz und Qualitätvon Zusammenarbeit und Unterstützungder Beteiligung am politischen Prozess.
Im gesellschaftlichen Zusammenhang sinddie Begriffe Government, Demokratie undGovernance eng miteinander verknüpft.Alle drei repräsentieren unterschiedlicheSichtweisen auf politische Einheiten wiezum Beispiel Nationalstaaten. Governmentist die institutionelle Sichtweise. Sie kon-zentriert sich auf politische Einheiten wieStädte, Landkreise und Länder, auf die le-gislativen, exekutiven und judikativen Re-gierungsorgane sowie innerhalb der Exe-kutive auf die verschiedenen Abteilungenund Bereiche der öffentlichen Verwaltung.Demokratie ist die Sichtweise der Legiti-mation. Sie beschäftigt sich mit� der Gründung der Autorität öffentlicher
Institutionen durch die Bürgerschaft� der Sicherstellung, dass die Behörden
ernsthafte Bemühungen machen, im In-teresse der Öffentlichkeit zu handeln
� der Gewährleistung, dass letztendlicheKontrolle und Eigentum öffentlicher In-stitutionen bei der Bürgerschaft bleiben.
Governance schließlich ist die Sichtweiseder Regulierung. Sie handelt davon, wiedie Gesellschaft am besten geführt und ge-steuert werden kann, um die öffentlichenInteressen zu erkennen und durchzusetzen.
Nun sind öffentliche Einrichtungen undgesetzliche Vertretungen nicht die einzi-gen Akteure, die in das Regieren (Gover-nance) einer Gesellschaft involviert sind.Governance ist kein Synonym für Govern-ment. Der Begriff Governance hilft uns,unseren Blick über die öffentlichen Behör-den hinauszuheben und über Wege nach-zudenken, andere Akteure aus der Gesell-schaft in Anspruch zu nehmen, um denRegelungsprozess zu erneuern. Nur sokönnen die Herausforderungen der Globa-lisierung gemeistert und die Möglichkeitender IuK in unserer Wissensgesellschaftausgeschöpft werden. Wie in Bild 1 ge-zeigt (Diagramm nach Macintosh), kann
Die Bedeutung von eGovernance für dieÖffentliche Verwaltung
von Thomas F. Gordon*
Im öffentlichen Kontext bedeutet »Governance« das Steuern undFühren der Gesellschaft im Interesse und zum Wohle der Allge-meinheit. Die dazu notwendigen Gesetze und Regelungen unterlie-gen einem spezifischen Lebenszyklus. Unter eGovernance verstehenwir die Anwendung wissensbasierter Rechtsberatungssysteme (»Le-gal Knowledge-based Systems«) für die Durchführung von Aufga-ben innerhalb dieses Lebenszyklus zur Verbesserung der Korrekt-heit, Transparenz und Effizienz von Verwaltungstätigkeiten.
Dr. Thomas F. Gordon,Fraunhofer Institut fürOffene Kommuni-kationssysteme (FOKUS), Berlin.
Wissensbasierte Rechtsberatungssysteme können Schlüsselfunktionen im Lebenszyklus von Recht übernehmen
258 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 258-263
* Ich danke Angela McCutcheon für ihre Hilfebei der Erstellung des deutschen Textes.

Governance kybernetisch als eine Art vonKontrollsystem verstanden werden. Einigeder an dem Governance-Prozess beteilig-ten Akteure sind in der Abbildung darge-stellt, darunter Presse, politische Parteienund Interessensvertretungen, Nicht-staatli-che Organisationen (non-governmental or-ganisations; NGOs), Öffentlichkeit undunterschiedliche Regierungsorgane. DieAkteure im äußeren Ring des Diagrammssind in Bezug auf den inneren Regelkreisso positioniert, dass sie in der Nähe derPhase stehen, in der sie agieren.1 Die Pha-sen des Regelkreises in diesem speziellenGovernance-Modell sind folgende:
Agenda Setting: In dieser Phase bestehtdie Hauptaufgabe darin, die in der Monito-ring-Phase (siehe unten) definierten Sach-verhalte und Probleme zu gliedern. DieAuffassungen über die Priorität der Ange-legenheiten können auseinander gehen.Der Einfluss auf die Agenda stellt eine er-hebliche politische Macht dar.
Analyse: Ziel der Analyse ist es, politi-sche Sachverhalte besser zu verstehen. In-formationen über die Interessen aller An-spruchsberechtigten (»stakeholders«) müs-sen erfasst und strukturiert werden.Lösungsvorschläge und Alternativen müs-sen erarbeitet sowie deren Vor- und Nach-teile abgewogen werden. Letztendlich kön-nen aus der Synthese aller Vorschlägeneue win-win-Lösungen im Interesse allerAnspruchsberechtigten formuliert werden.
Gesetzgebungsverfahren: Die Inhaberpolitischer Autorität und Macht entwerfenin dieser Phase Politik und erlassen dieGesetze. Sie bedienen sich dabei der Er-gebnisse aus der Analyse-Phase und derUnterstützung ihrer Berater.
Implementierung: In dieser Phase wer-den Politik und Gesetze in die Praxis umge-setzt, indem die dafür notwendigen organi-satorischen und technischen Infrastrukturenund Arbeitsprozesse entwickelt und einge-führt werden. Zu diesem Zeitpunkt kann esnötig werden, Politik und Gesetze da, wosie eventuell vom Gesetzgeber vage, wider-sprüchlich, zweideutig oder anders unklargelassen worden sind, zu interpretieren undverfeinern. Das geschieht durch Entwick-lung von administrativen Bestimmungen,die zur Klärung und Funktionalisierung bei-tragen. Diese Phase beinhaltet auch das Design und die Implementierung von Com-puter-Software – ob wissensbasierte Rechts-beratungssysteme oder konventionelle Pro-gramme –, die die Anwendung komplexerGesetzgebung durch Verwaltungsbeamteund andere Benutzer unterstützen.
Monitoring: Da die Menschen nicht all-wissend sind, werden unvorhergeseheneProbleme auftauchen. Inhalt dieser Phaseist es, kontinuierlich zu überprüfen, ob die
Ergebnisse der Politik, der Gesetzgebungund ihrer Durchführung mit den ursprüng-lichen Absichten übereinstimmen. Das be-darf der Erfassung und Auswertung empi-rischer Daten. Neue Erkenntnisse aus die-sem Prozess können selbst die politischeZielsetzung in Frage stellen. Die Durch-führung des Monitoring kann auf unter-schiedliche Art und Weise erfolgen. Zu-sätzlich zu der empirisch-wissenschaftli-chen Forschung können Entscheidungenvon Rechtsstreiten sowie kritische Diskur-se in den Medien dazugehören.
Unser Modell des Lebenszyklus vonRegelungen ist nicht als striktes Wasser-fall-Modell konzipiert. Ergebnisse aus ei-ner Phase können in andere Phasenzurückfließen und diese beeinflussen. Sokönnen zum Beispiel während der Phasedes Gesetzgebungsverfahrens Problemeauftauchen, die zusätzliche Analyse erfor-derlich machen.
Wie in Bild 1 dargestellt, können in al-len Phasen des Lebenszyklus von Regelun-gen, Computer-Modelle von Gesetzen undanderen Normquellen wie zum BeispielVerordnungen, Gerichtsverfahren und bestpractices erstellt, genutzt, aufrechterhaltenoder ausgewertet werden. Diese Compu-ter-Modelle sind im Diagramm als Model-le von Rechtsquellen bezeichnet. Mankönnte zwischen dem Originaltext undMetadaten, Abstraktionen oder Modellendieses Textes unterscheiden. Um der Ein-fachheit willen verstehen wir jedoch denOriginaltext, gespeichert in einer Volltext-Datenbank, als eine Art Computer-Modell.
Obwohl andere Autoren Governanceebenfalls als kybernetischen Regelkreismit ähnlichen Phasen dargestellt haben, istnach unserem Wissensstand unsere Versi-on die erste, die die Bedeutung von Mo-dellen von Rechtsquellen explizit heraus-streicht.
Nachdem wir den Lebenszyklus vonRegelungen inhaltlich und schematischdargestellt haben, möchten wir uns nun derFrage widmen, was Electronic Governance(eGovernance) bedeutet und wie es sich zueGovernment verhält. Zurzeit besteht einTrend, fast jedem Thema ein »e« voranzu-stellen (eCommerce, eLearning, eHealth).Dadurch wird der Einsatz von Informati-ons- und Kommunikationstechnologien in-nerhalb des jeweiligen Themas zum Aus-druck gebracht. So geht es zum Beispielbei eHealth um die Unterstützung der Ge-sundheitsversorgung durch IuK. So istauch eGovernment kein neues Thema,sondern nur ein neuer Name für den inter-disziplinären Bereich von Informatik undöffentlicher Verwaltung. Die Unterschei-dung zwischen eGovernment und eGover-nance stammt demnach von dem unter-schiedlichen Schwerpunkt des zugrundeliegenden Themas, nämlich Governmentoder Governance ab. Während es bei eGo-vernment um die Verwendung von IuK zur
Thomas F. Gordon, Die Bedeutung von eGovernance für die Öffentliche Verwaltung
VM 5/2004 259
1 Die Akteure können ebenfalls in andere Pha-sen involviert sein; in dieser Hinsicht ist dasDiagramm unvollständig.
Bild 1:. Architektur der Wissensbasierten Rechtsberatungssysteme

Unterstützung staatlicher Institutionen undBehörden geht, bezeichnet eGovernancedie Verwendung von IuK zur Unterstüt-zung der Leitung und Steuerung jeglicherOrganisationen. Im speziellen Fall des po-litischen Zusammenhangs beschäftigt sicheGovernance mit dem Gebrauch von IuKzur Steuerung der Gesellschaft und zurUnterstützung der öffentlichen Interessen.
Nicht alle eGovernment-Anwendungensind eGovernance-Anwendungen und um-gekehrt. Zum Beispiel ist eProcurement –die Verwendung von IuK zur Unterstüt-zung der Einkaufsabteilungen von Behör-den – ein Thema von eGovernment, nichtjedoch von eGovernance. Andererseitskann eine IuK-Anwendung, die Interes-sensvertretern ermöglichen soll, wirksamam politischen Prozess teilzuhaben, alseGovernance-Anwendung angesehen wer-den, nicht aber als eine von eGovernment,da die designierten Benutzer keine staatli-chen Behörden sind.
Das Modell des Lebenszyklus von Rege-lungen ermöglicht uns eine konkretere De-finition des eGovernance-Begriffs: Die Nut-
zung von Informations- und Kommunikati-onstechnologien zur Verbesserung vonQualität und Effizienz aller Phasen des Le-benszyklus von Regelungen. Für diese De-finition von eGovernance spielen Compu-ter-Modelle von Gesetzen und anderen Nor-mquellen eine zentrale Rolle. Welche ArtComputermodell im speziellen Fall das ge-eignete ist, hängt von der auszuführendenMaßnahme ab. Im weiteren Verlauf diesesTextes zeigen wir Möglichkeiten auf, einenbestimmten Modelltyp, nämlich die wis-sensbasierten Rechtsberatungssysteme(LKBS) zu verwenden, um die Implemen-tierungsphase des Lebenszyklus von Rege-lungen zu unterstützen. Es gibt darüber hin-aus wichtige Anwendungsbereiche vonLKBS für andere Phasen des Zyklus, insbe-sondere für die Unterstützung des Gesetz-gebungsverfahrens und der Gesetzesent-würfe. Umgekehrt gibt es auch andere In-formations- und Kommunikationstechnolo-gien, die für die Implementierungsphaseeine Rolle spielen, wie zum Beispiel Me-thoden und Werkzeuge für die Optimierungvon Geschäftsprozessen. Diese Themen be-dürfen jedoch der gesonderten Erörterung.
Einführung in die Wissens-basierten Rechtsberatungssysteme
Computer-Modelle als Hilfsmittel im Um-gang mit komplexen Gesetzen und Verord-nungen sind im Grunde nichts Neues. Eingroßer Teil des Wachstums von IBM inden fünfziger Jahren beruhte auf dem erfol-greichen Einsatz und der Verbreitunggroßer Datenverarbeitungsapplikationenfür die Bearbeitung von Steuern und Sozi-alleistungen im öffentlichen Sektor.Rechtsberatungssysteme werden in der Re-gel als konventionelle Computerprogram-me mit prozeduralen Programmiersprachenimplementiert. Dabei wird durch Anwen-dung von juristischem und verwaltungs-technischem Wissen ein schrittweises Ver-fahren entworfen und dann in eine Compu-terprozedur umgesetzt. Die überwiegendeMehrheit von Software-Applikationen fürdie Gesetzesverwaltung wird heute nochauf diesem Wege eingesetzt, obwohl mo-derne Programmierungssprachen, wie Java,COBOL ersetzt haben und neue Software-Engineering-Methoden für Verfahrensmo-
dellierung wie Aktivitätsdiagramme derUnified Modelling Language (UML) wei-testgehend die flow charts verdrängt haben.
Prozedurale Modelle von Gesetzen undanderen Normquellen sind teuer in Kon-struktion und Pflege, da die Gesetze sichändern. Man unterscheidet zwischen demWissen, was Normquellen bedeuten unddem Wissen, wie sie anzuwenden sind, umbestimmte juristische oder administrativeAufgaben zu lösen. In prozeduralen Mo-dellen sind diese beide Wissensarten engmiteinander verflochten. Daher ist es mitdieser Technik nicht möglich, ein Gesetzso zu modellieren, dass mehrere Aufgabendamit lösbar sind. Wenn dies möglichwäre, könnte man Entwicklungs- und Er-haltungskosten erheblich reduzieren.
In den siebziger Jahren begann die inter-disziplinäre Forschung von Juristen und Informatikern. Ziel war, über ein tieferesVerständnis von Gesetzen und juristischenProzessen Modelle von Gesetzen zu ent-wickeln, um die Lösung juristischer Proble-me zu unterstützen (Buchanon und Head-rick). Eine aktive internationale For-schungsgemeinschaft unter dem Namen
Artificial Intelligence and Law2 wurde insLeben gerufen und wuchs in den achtzigerJahren. Diese Gemeinschaft, als Teil desgroßen Bereiches der Künstlichen Intelli-genz (KI), entwickelte Methoden und Tech-nologien für Computermodelle von Geset-zen, Verordnungen und Rechtsprechungen,sowie für die Unterstützung von Rechtsbe-ratungsaufgaben unter Anwendung von regelbasierten Systemen, fallbasiertemSchließen und anderen KI-Methoden.
Mitte der achtziger Jahre erschien dererste Prototyp eines regelbasierten Sy-stems für die öffentliche Verwaltung (Ser-got et al.). Ursprünglich wurden diese juri-stische Expertensysteme genannt, da derSchwerpunkt auf dem Modellieren von Ju-ristischem Fachwissen lag. Im englischenSprachraum wird heute vor allem der um-fassendere Begriff Legal Knowledge-based Systems (LKBS) verwendet. Er istin zweierlei Hinsicht umfassender:� Er beinhaltet neben der Modellierung
der Expertise von Juristen auch die Mo-dellierung jeder Quelle juristischenWissens, insbesondere maßgebliche ju-ristische Originaltexte wie Gesetze undGerichtsentscheidungen.
� Er beinhaltet zusätzlich zu den regelba-sierten Systemen alle Möglichkeiten,mittels Computer Rechtswissen zu mo-dellieren, zum Beispiel Techniken desfallbasierten Schließens und so genann-ter neuronaler Netzwerke.3
Wir verwenden »wissenbasierte Rechtsbe-ratungssysteme« als deutschen Begriff fürLegal Knowledge-based Systems (LKBS).Es muss aber gesagt werden, dass bisherkein deutscher Begriff für LKBS Verbrei-tung gefunden hat.
Die ersten erfolgreichen Anwendungenvon wissensbasierten Rechtsberatungssyste-men in der Praxis erschienen Ende der acht-ziger und Anfang der neunziger Jahre. Indieser Zeit wurden auch die ersten Firmenfür Rechtsberatungssysteme gegründet,zum Beispiel die australische Firma Soft-
Wissensbasierte Rechtsberatungssysteme können Schlüsselfunktionen im Lebenszyklus von Recht übernehmen
260
2 Die führende internationale Organisation indem Bereich ist die International Associationfor Artificial Intelligence and Law (IAAIL),die die International Conference on ArtificialIntelligence and Law (ICAIL) veranstaltet.
3 Vor kurzem wurde damit begonnen, «legalknowledge systems» als Begriff zu verwen-den. So hat zum Beispiel im Jahre 2000 diejährliche Konferenz der JURIX Stiftung ihrenNamen von Legal Knowledge-based Systemsin Legal Knowledge and Information Systemsumgeändert. Der Name Legal Knowledge Systems erweitert den Bereich, um auch Applikationen miteinzubeziehen, die Wis-sensmanagementmethoden und -technologienbetreffen, und betont, dass diese Systeme nichtnur auf juristischem Wissen basieren, sondernauch umfassend dessen Aneignung, Gebrauch,Strukturierung, Verbreitung und Erhaltungfördern.
»eGovernance meint die Nutzung von IKT zur Verbesserung von Qualität und
Effizienz aller Phasen des Lebenszyklus vonRegelungen.«

Law im Jahre 1989. Das gesamte Unterneh-men basiert auf »der Bereitstellung seinerregelbasierten Technologie STATUTE Ex-pert, und dazugehörigen Methoden undDiensten zur Erprobung, Erfassung, Aus-führung und Pflege komplexer Gesetze undVerordnungen, die von der Regierung undden Behörden in der Verwaltung ihrer Pro-gramme angewendet werden.«4
Eine der ersten Lösungen von SoftLawwar ein regelbasiertes System für die aus-tralische Abteilung für Angelegenheitender Veteranen (Department of Veteran’sAffairs), um deren Ansprüche auf Rentenund andere Bezüge besser verwalten zukönnen. Die unabhängige Prüfung derbehördlichen Leistung hatte gezeigt, dassihre Entscheidungen oft sehr inkonsistentwaren, ausreichender Grundlagen undRechtfertigungen entbehrten oder die Be-züge falsch berechnet waren. Diese quali-tativen Probleme waren der primäreGrund, den Verwaltungsprozess durch denGebrauch von wissensbasierten Rechtsbe-ratungssystemen zu reformieren. SoftLawbehauptet, dass, zusätzlich zur Lösung die-ser qualitativen Probleme, die Behördedurch den Gebrauch von LKBS auch eineProduktivitätssteigerung von achtzig Pro-zent erzielt hat.5
Obwohl es unterschiedliche Herange-hensweisen in der Konstruktion von LKBSgibt, beruhen alle ab einem bestimmtenAbstraktionslevel auf der gleichen zugrun-de liegenden Architektur und haben diegleichen Features, verglichen mit der kon-ventionellen prozeduralen Herangehens-weise in der Bauweise von juristischen Ent-scheidungsunterstützungs-Systemen (Fied-ler). Die Grundstruktur der LKBS-Archi-tektur ist in Bild 2 dargestellt. Danachbesteht ein LKBS aus vier Hauptkompo-nenten:� Die Wissensakquisitionskomponente ist
ein Programm für die Erstellung undPflege von wissensbasierten Rechtsbera-tungssystemen. Wie bei Modell-gesteuer-ten Architekturen (model-driven archi-tectures, MDA) wird das ausführbareProgramm automatisch erzeugt und nichtper Hand programmiert. Idealerweisesind Gesetzes- und Verordnungsmodellesauber getrennt von dem Wissen überProblemlösungsverfahren. Die Wissens-akquisitionskomponente enthält Werk-zeuge für die getrennte Modellierung vonrelevanten Regelungen und Problemlö-sungsverfahren sowie für die dazugehöri-ge unterstützende Dokumentation. DieEntwicklung einer juristischen Wissens-basis (legal knowledge-base) erfordertdie interdisziplinäre Zusammenarbeit vonSoftware-Ingenieuren, die auf wissensba-sierte Systeme spezialisiert sind, so ge-
nannten Wissensingenieuren, undRechtsexperten. Die Komponente zurWissensakquisition kann in besondererWeise das gemeinschaftliche Wissensak-quisitionsverfahren unterstützen.
� Die Wissensbasis ist ein Produkt desWissensakquisitionsverfahrens. Sie istein beschreibendes Computer-Modellder ausgewählten juristischen Quellen.
� Die Inferenzkomponente, auch Infe-renzmaschine genannt, ist Teil derLaufzeitumgebung, die die Wissensba-sis und Fakten des Benutzers für die Er-stellung der Fragen, Antworten und Be-gründungen anwendet.
� Die Dialogkomponente ist der Teil derLaufzeitumgebung, der verantwortlichist für das Management der Interaktionzwischen System und Benutzer. Sieübersetzt zwischen der formalen Spra-che der Wissensbasis und der natürli-chen Sprache des Benutzers. Sie ist engverknüpft mit der Benutzeroberflächedes Systems aber nicht notwendiger-weise ein Teil von ihr. UnterschiedlicheBenutzeroberflächen mit unterschiedli-chem »look and feel«, zum Beispiel fürPersonalcomputer mit verschiedenenBetriebssystemen, personal digital assi-stants (PDAs), Handys oder das Web,könnten gegebenenfalls die gleiche Dia-logkomponente benutzen.
Die Vorteile von LKBS bei der Einsetzungunterstützender Systeme für die öffentlicheVerwaltung von komplexen Gesetzen undVerordnungen sind vielfältig. Die saubereTrennung zwischen dem Modell desRechtsgebiets und dem aufgabenspezifi-schen Problemlösungsverfahren erleichtertdie Erhaltung und Überprüfung des Sy-stems während der Änderung von Geset-zen und Verordnungen. Dies bewirkt eineReduzierung der Entwicklungskosten undverringert die Produkteinführungszeit, dasheißt die Zeit, die benötigt wird, um dasrevidierte System einsatzfähig und den er-neuerten Service für Bürger und andere
»Kunden« der Behörden zugänglich zumachen. Die Fähigkeit eines LKBS, klareBegründungen hervorzubringen, ein-schließlich Hilfestellung durch Querver-weise auf maßgebliche Rechtsquellen (Sta-tuten, Fälle etc.), erhöht die Transparenz,Akzeptanz und Nachvollziehbarkeit admi-nistrativer Entscheidungen.
Verglichen mit konventionellen Daten-verarbeitungssystemen bietet die Dialog-komponente eines LKBS eine sehr viel fle-xiblere Form der Interaktion mit dem Be-nutzer. Die konventionelle Methode istDaten-getrieben: Alle Informationen wer-den vom Benutzer durch Ausfüllen einesFormulars abgefragt, dann werden die Da-ten verarbeitet und das Ergebnis in einemBericht formuliert. Die Interaktion mit demBenutzer in einem LKBS ist Ziel-getrie-ben: Ausgehend von einer Frage des Be-nutzers stellt das System nur die Rückfra-gen, die notwendig sind, um die Ausgangs-frage zu beantworten. Der Benutzer behältzu jeder Zeit die Kontrolle über den Dia-log: Das Ziel kann verändert werden; vor-angegangene Fragen können modifiziertwerden; der Benutzer kann fragen, warumer eine bestimmte Frage gestellt bekommt.
Zusammenfassend kann gesagt werden,dass, verglichen mit konventionellen Da-tenverarbeitungsmethoden, wissensbasierteRechtsberatungssysteme umfangreiche Mög-lichkeiten bieten, die Korrektheit, Konsi-stenz, Transparenz und Effizienz in der Be-wertung von Ansprüchen zu erhöhen.
Anwendungsszenarien
eGovernment-Anwendungen werden oftanhand eines Schichtenmodells klassifi-
Thomas F. Gordon, Die Bedeutung von eGovernance für die Öffentliche Verwaltung
VM 5/2004 261
4 http://www.softlaw.com.au/content.cfm?cate-goryid=1.
5 Selbstverständlich müssen solche Behauptun-gen mit Vorbehalt behandelt werden, solangesie nicht empirisch repliziert und durch unab-hängige Forschung bestätigt sind.
Bild 2: Der Lebenszyklus von Regelungen

ziert. Dabei stehen Bereitstellung und Ver-teilung von Information am Anfang, ge-folgt von der Unterstützung von Kommuni-kation und Zusammenarbeit von Behördenmit anderen Behörden (G2G), mit Unter-nehmen (G2B) oder mit Bürgern (G2C).Am Ende steht die Durchführung vonTransaktionen. Die Anwendungen, die bis-her online angeboten werden, sind typi-scherweise recht limitiert. Die gängigenBeispiele beinhalten Anträge für Anmel-dung von Hunden, Änderung der Melde-adresse oder Eintragung von Geschäftsna-men. Das alles sind einfache, «oberflächli-che» Maßnahmen, die wenig oder gar keinjuristisches Wissen erfordern. LKBS bietendie Möglichkeit, die Bandbreite auf kom-plexe, »tiefe« Transaktionen auszudehnen(Johnson). Dadurch können Entscheidungs-prozesse unterstützt werden, die Detailwis-sen komplexer Gesetze und Verordnungenbenötigen wie die Bearbeitung von Sozial-leistungen und Steuern.
Johnson definiert vier Anwendungs-szenarien von LKBS für die Unterstützung
von Entscheidungsprozessen: intelligenteDatenerfassung, one-stop-shops, outsour-ced services und self-service (Johnson).
Die Verwendung des Portable Docu-ment Formats (PDF) für die Übertragungexistierender Formulare ins Internet erin-nert an die Zeiten, in denen Autos wieKutschen ohne Pferde konstruiert wurden.Das Potenzial der neuen Technologie wirdnicht ausgeschöpft. Die intelligente Date-nerfassung nutzt die flexible Dialog-Kom-ponente eines LKBS und bietet dadurcheine viel effektivere, verbraucherfreundli-che und interaktive Möglichkeit, Daten desBenutzers zu erfassen. Da der Dialog ziel-gerichtet und problembezogen aufgebautist, werden nur relevante Daten erfasst. Sokann die Behörde die Zeit minimieren, inder zusätzliche detailliertere relevante Da-ten vom Benutzer abgefragt werden müs-sen. Der Benutzer wird entlastet.
Die Idee eines one-stop-shops in der öf-fentlichen Dienstleistung ist, dass Verwal-tungsprozesse neu strukturiert werden, in-dem die Front Offices unterschiedlicherAbteilungen zusammengelegt werden.Diese Veränderung ist primär organisatori-
scher Natur, wird jedoch durch den Einsatzfortschrittlicher IuK erleichtert. So könnenzum Beispiel E-Mail und andere compu-tergestützte Kommunikationsformen dazudienen, die »Entfernung« zwischen FrontOffice und Back Office zu verringern,auch wenn diese sich nicht im selben Ge-bäude befinden. Wenn ein one-stop-shopmehr sein soll als nur ein »Pamphlet Coun-ter«, so muss er in der Lage sein, selberDienste auszuführen und nicht nur Infor-mationen über diese Dienste zur Verfü-gung zu stellen. Wissensbasierte Rechtsbe-ratungssysteme können dabei eine Rollespielen. Denn das Personal in den FrontOffices muss in der Lage sein, administra-tive Entscheidungen zu fällen, die die An-wendung detaillierter Kenntnisse von Ge-setzen und Verordnungen erfordern. Beider großen Bandbreite an Dienstleistun-gen, die ein one-stop-shop anbietet, ist dasnur möglich, indem der Mangel an Fach-wissen seitens des Personals, durch denEinsatz von LKBS und anderen Entschei-dungshilfe-Systemen kompensiert wird.
LKBS versetzen das Personal in die Lage,zuverlässig korrekte Entscheidungen tref-fen zu können, ohne juristisches Fachwis-sen zu haben. Dieses Szenarium verändertdie Rolle des Back Office. Anstatt Anträgezu bearbeiten, um Fälle zu entscheiden,kann es nun die Verantwortung für dieEntwicklung und Pflege der Wissensbasenübernehmen, die für die LKBS-Applikatio-nen vonnöten sind. Die Verantwortung fürdie Bearbeitung von Anträgen wird nachvorn verlagert. Das ermöglicht dem BackOffice die Durchführung ausgedehnter undgründlicher Überprüfungen zur Sicherzu-stellung, dass die vom Bürger erfasstenDaten korrekt sind und sich auf ausrei-chende Beweise gründen.
Der Trend geht dahin, öffentlicheDienstleistungen an private Unternehmenauszugliedern, indem zum Beispiel öffent-lich-private Partnerschaften gebildet wer-den. Die Verantwortung für die Festlegungvon Ansprüchen und für andere administra-tive Entscheidungen, welche ein tieferesVerständnis komplexer Gesetze und Ver-ordnungen erfordern, kann allerdings nurdann ausgegliedert werden, wenn gewähr-
leistet ist, dass das Personal des privatenUnternehmens die Gesetze korrekt anwen-det. Wissensbasierte Rechtsberatungssyste-me bieten die Möglichkeit, das zu errei-chen. Die Behörden behalten die Kontrolledarüber, wie die Gesetze auszulegen sind,indem sie Verordnungen schaffen, die inden Wissensbasen der LKBS modelliertwerden. Da wissensbasierte Rechtsbera-tungssysteme Begründungen erzeugen,kann die Behörde die Entscheidungen desprivaten Partners jederzeit kontrollieren.Alle Ausführungen können präzise über-wacht werden. Es entstehen neue Vertriebs-wege für öffentliche Dienstleistungen. Au-tohändler könnten zum Beispiel die Zulas-sungsbehörden vertreten, ähnlich wie sieauch Vertreter für Autoversicherungen sind,und dadurch ein one-stop-shop anbieten fürdas »life event« Autokauf inklusive Auto,Versicherung und Anmeldung einschließ-lich Nummernschild. Sollte ein solchesDienstleistungsangebot dazu führen, dassmehr Autos verkauft werden, könnte die öf-fentliche Verwaltung diesen Service für ge-ringe bis gar keine Kosten ausgliedern. Einsolches Szenarium wäre eine win-win-Si-tuation für Verbraucher, Autohändler undVerwaltungsbehörden.
Das letzte Anwendungs-Szenarium, wel-ches wir hier erörtern wollen, ist der self-service. Der Bürger oder Benutzer intera-giert direkt mit dem LKBS, zum Beispielüber eine web-basierte Benutzeroberfläche.Optional kann die Hilfe eines Rechtsanwal-tes, Steuerberaters oder sonstigen persönli-chen Beraters in Anspruch genommen wer-den. Dieses Szenarium ist nicht so neu undanspruchsvoll, wie es auf den ersten Blickerscheint. Denn es wird auch heute schonvon Bürgern und Unternehmen erwartet,dass sie sich in den komplexen Gesetzenauskennen und diese befolgen, um die Din-ge des täglichen Lebens zu regeln. Zum Bei-spiel fordert die öffentliche Verwaltung vonden Bürgern, dass sie ihre Anträge und An-sprüche in einigen Fällen selber bearbeiten,zum Beispiel bei der jährlichen Steuerer-klärung. Mit LKBS werden viele Entschei-dungsprozesse praktikabler. Arbeitskraft-Ressourcen, die für die Bearbeitung von An-trägen erforderlich sind, könnten erheblichreduziert werden. Mitarbeiter würden freifür andere Aufgaben wie Prüfungsverfahren(Auditing), Monitoring und die Weiterent-wicklung und Pflege von Regelungen undVerordnungen. Auch die Bürger würdenprofitieren. Sie wären in der Lage, ihre An-träge bequem von zuhause aus zu stellenund erhielten einen raschen Bescheid oderzumindest einen Vorbescheid mit einergründlichen und verständlichen Erläuterung.Schließlich wären sie auch in der Lage, dierechtlichen Konsequenzen hypothetischer
Wissensbasierte Rechtsberatungssysteme können Schlüsselfunktionen im Lebenszyklus von Recht übernehmen
262
»Die zentrale Rolle von Rechtsordnungen,Gesetzen und Regelungen als den primären
Instrumenten der Steuerung einer Gesellschaft kommt im eGovernance bisher
nicht hinreichend zum Ausdruck.«

Situationen zu analysieren, um die Zukunftbesser planen zu können. Dieses Beispielzeigt, dass LKBS nicht nur Qualität und Ef-fizienz existierender Dienstleistungen ver-bessern können, sondern auch neue Leistun-gen ermöglichen.
Das eGovernance-Konsortium
Wissensbasierte Rechtsberatungssystemestellen eine ausgereifte Technologie dar,mit einigen erfolgreichen Anwendungen intäglichem Gebrauch. Dennoch haben siebisher keine weite Verbreitung in der öf-fentlichen Verwaltung gefunden. DieHauptaufgabe besteht nun darin, Nachfragezu schaffen, indem ihre Verbreitung durchMarketing vorangetrieben und jungenLKBS-Unternehmen bei Start und Wachs-tum geholfen wird. Aus diesem Grunde hatdas Fraunhofer-Institut für offene Kommu-nikationssysteme (FOKUS) ein industriellesKonsortium ins Leben gerufen, genannteGovernance-Konsortium, bestehend ausallen LKBS-Unternehmen in Europa. DasHauptanliegen von Fraunhofer-Institutenwie FOKUS ist es, Unternehmen bei derEntwicklung innovativer Produkte und Lei-stungen zu unterstützen. In dem NameneGovernance-Konsortium spiegelt sich dasBestreben wider, letztendlich ein umfassen-des Portfolio anzubieten mit Produkten undLeistungen für die Durchführung aller Pha-sen des Lebenszyklus von Regelungen.
Das eGovernance-Konsortium wurdeim Oktober 2003 gegründet. Die Grün-dungsmitglieder sind: � Fraunhofer FOKUS, Berlin� KnowledgeTools International GmbH,
Berlin� RuleWise b.v., Utrecht� SoftLaw Corporation Limited, London.Ziel des Konsortiums ist es, fortschrittlicheInformations- und Kommunikationstech-nologien zu fördern und zu entwickeln, umdie Qualität und Effizienz aller Aufgabendes Lebenszyklus von Regelungen, Ver-ordnungen und anderen Normen zu ver-bessern. Wo es möglich ist, fördert dasKonsortium die Anwendung geeigneter In-dustrie-Standards. Dadurch ist es an denAktivitäten beteiligt, die zu diesen Stan-dards führen, und gewährleistet die Intero-perabilität von eGovernance-Produkten.
Weiterführende Informationen über daseGovernance-Konsortium sind auf seinerWebseite abrufbar.6
Schlussfolgerung
Aus mehreren Gründen ist Governance einheißes Thema. Dazu gehören die sich ver-
ändernde Rolle von Wissen und Informati-on, der Trend zu Netzwerken als Organisa-tionsformen, globale Probleme und, lastbut not least, der Fortschritt der Informati-ons- und Kommunikationstechnologien.
Wie bei allen »e«-Themen geht es beieGovernance um die Anwendung fortge-schrittener Informations- und Kommunika-tionstechnologien zur Verbesserung undUnterstützung aller Aufgaben in einem be-stimmten Anwendungsfeld, in diesem FallGovernance. In unserem kybernetischenGovernance-Modell stehen die Modelle ju-ristischen Wissens im Zentrum der zykli-schen Prozesse von Gesetzgebungsverfah-ren, Gesetzesentwürfen, ihrer Umsetzungund Verwaltung, Überwachung und Aus-wertung. Wir messen somit dem Manage-ment des Lebenszyklus von Regelungeneine zentrale Bedeutung für Governancebei. Die meisten bisher veröffentlichten Ar-beiten richten ihr Hauptaugenmerk auf or-ganisatorische und kommunikative Proble-me, die aus dem Trend von hierarchischenhin zu vernetzten Formen von Managementund Zusammenarbeit entstehen. Dagegensetzen wir den Schwerpunkt auf die zentraleRolle von Rechtsordnungen, Gesetzen undRegelungen als den primären Instrumentender Steuerung einer Gesellschaft.
Im eGovernance-Kontext führt dieserSchwerpunkt zu einem erhöhtem Bewusst-sein und größerer Wertschätzung des Po-tenzials wissensbasierter Rechtsberatungs-systeme (LKBS). Unserer Kenntnis nachsind wir die ersten, die den Zusammenhangzwischen eGovernance und den Ergebnis-sen von Artificial Intelligence and Law er-kannt haben. Wir hoffen, dass das Interesseder öffentlichen Verwaltung an wissensba-sierten Rechtsberatungssystemen durch dieGovernance-Debatte neu belebt wird.
Die meisten Versuche der öffentlichenVerwaltung, Transaktionen ins Internet zustellen, sind auf einfachere Maßnamen wieÄnderung von Meldeadressen beschränktgeblieben. Anspruchsvollere Transaktionenerfordern die Anwendung komplexer Ge-setze und Verordnungen. Das gesamte Po-tenzial der Informations- und Kommunika-tionstechnologien zur Verbesserung vonKorrektheit, Transparenz und Effizienz inder öffentlichen Verwaltung kann jedochnur dann zu Tragen kommen, wenn auchdiese Maßnahmen online ausgeführt wer-den können. Wissensbasierte Rechtsbera-tungssysteme sind die fortschrittlichste undeffektivste Technologie, um dieses Poten-zial auszuschöpfen.
Zukünftige Forschungsthemen solltendie Anwendung von Methoden zur Opti-mierung von Geschäftsprozessen beinhal-ten, um die organisatorischen Auswirkun-gen von LKBS analysieren zu können.
Wie werden zum Beispiel die Rollenver-teilung und die dazu erforderlichen Quali-fikationen der Mitarbeiter beeinflusst?Kann die Zunahme an Effektivität undProduktivität, die in der Literatur beschrie-ben wird, erklärt und bestätigt werden?Ein weiteres Thema betrifft die möglichenAbhängigkeiten zwischen der Komplexitätder Gesetze und wissensbasierten Rechts-beratungssystemen. Besteht die Gefahr,dass der Einsatz von wissensbasiertenRechtsberatungssystemen den Trend hinzu immer komplexeren Gesetzen verstär-ken wird? Oder kann im Gegenteil dieQualität der Gesetzgebung durch Verwen-dung von LKBS verbessert werden, sodasseinfachere, klarere Gesetze und Verord-nungen daraus resultieren?
Wissensbasierte Rechtsberatungssyste-me wurden in einer Reihe von bedeuten-den Anwendungen durch öffentliche Ver-waltungen in Australien, den Niederlan-den, Großbritannien und den USAeingesetzt und erprobt. Das hat dazu ge-führt, dass eine kleine, aber wachsendeLKBS-Industrie entstanden ist. Alles deu-tet darauf hin, dass der Zeitpunkt reif istfür die rasche Einführung der wissensba-sierten Rechtsberatungssysteme in die öf-fentlichen Verwaltungen.
Literatur
Buchanon, Bruce G., and Thomas E. Headrick.Some Speculation about Artificial Intelligenceand Legal Reasoning. Stanford Law Review23.1 (1970): 40-62.
Fiedler, Herbert. Expert Systems as a Tool forDrafting Legal Decisions. Logica, Informatica,Diritto. Eds. Antonio A. Martino and FiorenzaSocci Natali. Florence, 1985. 265-74.
Johnson, Peter. Legal Knowledge-Based Sy-stems in Administrative Practice and ElectronicService Delivery (e-government), 2000.
Macintosh, Ann. Using Information and Com-munication Technologies to Enhance CitizenEngagement in the Policy Process. Promisesand Problems of E-Democracy: Challenges ofOnline Citizen Engagement. Paris: OECD,2004.
Malkia, Matti, Ari-Veikko Anttiroiko, and Rei-jo Savolainen, eds. eTransformation in Gover-nance New Directions in Government and Po-litics. London: Idea Group, 2004.
Reinermann, Heinrich, and Jörn von Lucke.Speyerer Definition von Electronic Governan-ce. Electronic Government in Deustchland.Eds. Heinrich Reinermann and Jörn von Lucke.Speyer: Forschungsintitut für Öffentliche Ver-waltung (2002): 9-19.
Sergot, M.J., et al. The British Nationality Actas a Logic Program. Communications of theACM 29.5 (1986): 370-86.
Thomas F. Gordon, Die Bedeutung von eGovernance für die Öffentliche Verwaltung
VM 5/2004 263
6 http://www.egovernance-consortium.org/.

Der Sinn von Leitbildern
Stadtplanung dokumentiert sich traditio-nell vor allem in Bebauungs- und Ver-kehrsentwicklungsplänen. Es geht dabeivorrangig um die funktionale Bestimmung,architektonische Gestaltung und infra-strukturelle Verbindung von Räumen.Leitbilder beziehen sich dagegen üblicher-weise auf Organisationen. Private Unter-nehmen und öffentliche Verwaltungen nut-zen die Erarbeitung von Wertsystemen undlangfristigen Zukunftskonzeptionen, umdas Handeln aller Beteiligten auf gemein-same Ziele auszurichten und ein spezifi-sches Profil zu erhalten.1
Leitbilder reichen weiter und setzengrundlegender an als die meisten Pläne.Sie befassen sich nicht in erster Linie da-mit, was wie zu tun ist, sondern warumund wozu etwas geschehen soll. Zentral ist
die Vermittlung einer übergreifenden Idee,aus der sich im weiteren Umsetzungsstra-tegien und konkrete Einzelmaßnahmen ab-leiten lassen.
»Wenn du ein Schiff bauen willst, danntrommle nicht Männer zusammen, umHolz zu beschaffen, Aufgaben zu vergebenund die Arbeit einzuteilen, sondern lehresie die Sehnsucht nach dem weiten, end-losen Meer.« Diese Antoine de Saint-Exupéry zugeschriebene Empfehlung2 illu-striert wichtige Funktionen von Leitbil-dern: Visionen können eine motivierendeWirkung entfalten, indem sie Sinn stiftenund Identifikationsmöglichkeiten eröffnen.Übergeordnete Ziele definieren einen Rah-men, der eine Steuerung auf Abstand (mitHilfe leistungsbezogener Kontrakte) er-laubt, und sie schaffen Freiräume für eineSelbstorganisation, die Eigenverantwor-tung einfordert und fördert. Statt jedenSchritt vorzuzeichnen, liefern LeitbilderNavigationsinstrumente und beschreibenwichtige Wegmarken. Statt Innovationenvorzuschreiben, setzen sie auf die Kreati-vität der Mitwirkenden3 und begünstigendamit laufende Erfindungen. Darüber hin-aus können sie Entscheidungen erleichternund die Integration und Koordination aktu-eller und künftiger Aktivitäten unterstüt-zen. In der Außenwirkung sollte ein präg-nantes und konsequent kommuniziertesLeitbild die Identifizierbarkeit und Be-kanntheit der jeweiligen Einheit erhöhen.
Seit einigen Jahren geben sich nicht nurmanche Stadtverwaltungen, sondern ver-mehrt auch ganze Städte Leitbilder.4 Wasspricht dafür, einen zunächst für Organisa-tionen gedachten Ansatz auf politisch-geo-grafische Räume zu übertragen?
Viele Kommunen in Deutschland stehenvor großen Herausforderungen: Währenddie Steuereinnahmen und die Einwohner-
zahlen stagnieren oder sogar sinken, steigtder Altersschnitt der Bevölkerung. Städteund Regionen konkurrieren in wachsendemMaße um Einwohner, Wirtschaftsbetriebeund Touristen, die sich allesamt wenigerstark an einzelne Orte binden. Standardan-gebote reichen offensichtlich nicht (mehr)aus, um Gäste anzuziehen und Bürger so-wie Unternehmen dauerhaft zu halten oderneu zu gewinnen. Kommunen, die in dieserSituation nicht die Initiative ergreifen, ge-raten schnell in eine Abwärtsspirale. Insbe-sondere kleinere und mittlere Gemeindenmüssen deshalb ihre Ressourcen auf Spezi-fisches und Herausragendes konzentrieren,um indirekt auch ihre Grundausstattung ab-sichern zu können.
Die Leitbildentwicklung bietet Gele-genheit, Stärken und Schwächen, Chancenund Risiken einer Stadt auszuloten undsich auf aussichtsreiche Handlungsschwer-punkte zu verständigen. Wichtige Vorzügelassen sich durch drei Ps charakterisieren:� Bereits der Erarbeitungsprozess ermög-
licht eine breite Partizipation von Betrof-fenen und Interessierten und ein unmit-telbares Zusammenspiel von Einwoh-nern, Verwaltung, Politik und externenExperten. Der Weg ist somit Teil desZiels: Er kann unter anderem das Zu-
Innovative Leitbilder für StädteDer »Spielraum Soltau« als exemplarischer Rahmen
für Grenzüberschreitungen
von Antje und Mathias Ernst
Wie können Leitbilder dazu beitragen, nachhaltige Zukunftsper-spektiven für Städte zu erschließen? Der folgende Text geht dieserFrage nach, indem er generelle Überlegungen mit einem aktuellenWerkstattbericht kombiniert.
Mathias Ernst, Historiker und Verwal-tungswissenschaftler,leitet das NorddeutscheSpielzeugmuseum inSoltau.
Antje Ernst, Verwaltungswissen-
schaftlerin und Historikerin, ist
Lehrbeauftragte fürMuseumsmanagement
an der Universität Erfurt.
Stadtentwicklung auf neuen Wegen
264 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 264-269
1 Vgl. Knut Bleicher: Leitbilder. Orientierungs-rahmen für eine integrative Management-Philo-sophie. Stuttgart u. a. 1992 (Entwicklungsten-denzen im Management; 1).
2 Dieser Gedanke findet sich zwar auf Englischin Saint-Exupérys 1948 posthum erschiene-nem Werk »The Wisdom of the Sands«, fehltjedoch in der französischen Originalfassung.
3 Vgl. z.B.: Gerhard Hesch: Das Menschenbildneuer Organisationsformen. Mitarbeiter undManager im Unternehmen der Zukunft. Wies-baden 1997.
4 Siehe Ursula Funke und Ewald Müller (Hrsg.):Stadtkonzeption live. Erfahrungsberichte ausneun Städten. Stuttgart u.a. 1999 (Neue Schrif-ten des Deutschen Städtetags; 76).
5 Siehe Wulf Damkowski und Anke Rösener:Auf dem Weg zum Aktivierenden Staat. VomLeitbild zum umsetzungsreifen Konzept. Berlin2003 (Modernisierung des öffentlichen Sektors:Sonderband; 18). Und: Rolf Kreibich (Hrsg.):Bürgergesellschaft. Floskel oder Programm?Baden-Baden 2002 (ZukunftsStudien; 28).

sammengehörigkeitsgefühl verbessern,neue Ideen und Impulse einfangen sowieweitergehendes bürgerschaftliches Enga-gement mobilisieren. Der Einsatz vonLeitbildern passt insofern zum Modelleines aktivierenden Staates, der sichnicht nur als Dienstleister versteht, son-dern als Initiator und Helfer, Motivatorund Moderator auftritt.5
� Das gemeinsam entwickelte Produkt –das Leitbild selbst – kann als wichtigesInstrument für die im Wettbewerb ge-botene Profilierung genutzt werden.Hier lässt sich festhalten, wodurch sicheine Stadt im besten Sinne von anderenabheben soll. Um die Kernbotschaftenzu vermitteln, eignen sich einerseits for-male Verdichtungen (vor allem Logosund Slogans als zentrale Elemente einesschlüssigen Corporate Designs), ande-rerseits beispielhafte Entfaltungen wieerzählerisch ausgemalte Visionen. BeimEinstieg in die Realisierungsphasekommt Pilotprojekten und Prototypenhäufig eine wegweisende Funktion zu.
� In der alltäglichen Praxis liefert das Leit-bild einen Maßstab für Priorisierungen.Wenn Handlungsalternativen konse-quent daraufhin überprüft werden, wassie für die Realisierung der anvisiertenZiele leisten können, fördert dies dieKohärenz und schließlich auch die Effi-zienz und Effektivität von Entscheidun-gen. Die Bedeutung dieses Aspektssteigt, je mehr die Prinzipien der Vorsor-ge und Nachhaltigkeit im Vordergrundstehen. Gerade Kommunen werdendurch langfristige Konzeptionen davonabgehalten, sich auf spontane Aktionenoder nachträgliche Reaktionen zu be-schränken; und dazu angeleitet, voraus-schauend Zukunftsfelder abzustecken,die sich flexibel bearbeiten lassen.6
Ein Leitbild soll nicht zeigen, was eineStadt macht, sondern was sie ausmacht undwas sie aus sich machen kann. Es geht so-mit nicht um eine bloße Vermarktung desBestehenden; angestrebt wird ein Stadtmar-keting, das durch den Austausch von Innen-und Außenperspektiven zur Explikationvorhandener Potenziale und zur Projektioninnovativer Optionen beiträgt.
Ausgangspunkte in Soltau
»Phantasie haben heißt nicht, sich etwas ausdenken; es heißt, sich aus denDingen etwas machen.«
Thomas MannDer Anstoß zu Leitbildentwicklungen er-folgt oft in Situationen der Unsicherheit –aus dem Bewusstsein, es müsse sich etwas
ändern, und dem Wunsch nach einer kla-ren Perspektive. Im niedersächsischen Mit-telzentrum Soltau wurden Einzelhändleraktiv: Um Antworten auf die Krise der In-nenstadt zu finden, wandte sich die örtli-che Interessengemeinschaft Handel undGewerbe (IHG) an eine von der Univer-sität Lüneburg gegründete Firma, die »pro-ject m Marketingberatung«. ZusätzlicherHandlungsdruck entstand durch ein ge-plantes Designer Outlet Center (DOC) amRande von Soltau. Für die Kommunespitzte sich damit die prinzipielle Frage zu,wie der Stadtkern von Besuchermagnetenauf der grünen Wiese profitieren könne.
Soltau zählt gut 23.000 Einwohner undliegt im Dreieck der Großstädte Hamburg,Hannover und Bremen, nur wenige Kilome-
ter vom Naturschutzgebiet Lüneburger Hei-de entfernt. Der landschaftsbezogene Tou-rismus ist stark saisonabhängig, die Kon-kurrenz durch andere Urlaubsgegendennimmt zu. Einzigartig ist die hohe Konzen-tration an Freizeit- und Tierparks. Danebenentstehen neuartige, kommerzielle Indoor-Angebote (wie eine Skisporthalle), die aufErlebnishungrige zielen. Jedes Jahr haltensich Millionen von Touristen vor den Torenund auf den Durchfahrtsstraßen Soltaus auf,ohne die Innenstadt zu betreten. Die Gäste-zahlen sind rückläufig, die Verweildauersinkt. Die Probleme werden insbesondereim Einzelhandel sichtbar: Seit Jahren steigtdie Zahl der leer stehenden Geschäfte.
Konkret verbinden sich in Soltau vor al-lem folgende Erwartungen mit der Ent-wicklung eines Leitbildes: Es soll helfen,die Innenstadt zu beleben und die zentra-len städtischen Funktionen zu stärken; essoll Touristen anziehen und die Identifika-tion der Einwohner mit ihrer Stadt er-höhen. Um diese Zwecke zu erfüllen, mussdie neue Konzeption unverwechselbar undtrendunabhängig sein.
Gelingensbedingungen für Leitbilder
Die letztgenannten Anforderungen betref-fen die generelle Frage, welche Eigen-schaften die Wirksamkeit von Leitbildern
wesentlich beeinflussen. Erste Weichen-stellungen erfolgen bereits während desEntwicklungsprozesses; darüber hinauslassen sich bestimmte Gelingensbedingun-gen für die Dokumente selbst definieren.Auf der Grundlage einer kritischen Sich-tung von Beiträgen zu Leitbildern7 schlägtdie folgende Liste acht Basiskriterien vor:� Sprachliche Klarheit: Leitbilder sollten
möglichst einfach, übersichtlich undpräzise formuliert sein.
� Kohärenz und Konsistenz: Leitbildersollten logisch stringent und sinnvollstrukturiert sein; sie dürfen keine Wider-sprüche enthalten.
� Zukunftsorientierung: Leitbilder solltensich vor allem auf Zukunftspotenzialebeziehen – und kön-nen dabei auf Ver-
gangenheit und Gegenwart aufbauen.� Realitätsbezug: Die Aussagen sollten ei-
nen realistischen Hintergrund haben undsich mit der Praxis verknüpfen lassen;Leitbilder dürfen nicht utopisch, wohlaber visionär sein.
� Grundsätzliche Relevanz: Alle Punktesollten für die meisten Adressaten wich-tig oder von Interesse sein; die Aus-führungen dürfen keine Nebensächlich-keiten behandeln.
� Glaubwürdigkeit und Gültigkeit: Dieprinzipielle Verbindlichkeit und Auf-richtigkeit der Aussagen darf nicht durchdas Leitbild selbst in Frage gestellt wer-den.
� Mehrdimensionalität: Ein Leitbild sollteganzheitlich angelegt sein; es muss – di-
Antje und Mathias Ernst, Innovative Leitbilder für Städte
VM 5/2004 265
»Leitbilder reichen weiter und setzen grundlegender an als die meisten Pläne. Sie befassen sich nicht in erster Linie damit,was wie zu tun ist, sondern warum und wozuetwas geschehen soll.«
6 Siehe z.B.: Henry Mintzberg: Die StrategischePlanung. Aufstieg, Niedergang und Neube-stimmung. München u.a. 1995.
7 Vgl. unter anderem: Bleicher 1992 [s. Anm.1]. – Peter Fenkart und Hansruedi Widmer:Corporate Identity. Leitbild, Erscheinungsbild,Kommunikation. Zürich u.a. 1987. – MartinHilb: Integriertes Personalmanagement. Ziele,Strategien, Instrumente. Berlin 31995. – Wal-demar F. Kiessling und Peter Spannagl: Cor-porate Identity. Unternehmensleitbild – Orga-nisationskultur. Alling 1996. – Sybille Stöbe:Verwaltungsreform durch Organisationsent-wicklung – Leitbilder als Instrument einer Mo-dernisierungsstrategie. In: Fritz Behrens u.a.(Hrsg.): Den Staat neu denken. Reformper-spektiven für die Landesverwaltungen. Berlin1995 (Modernisierung des öffentlichen Sek-tors: Sonderband; 3). S. 129-142.

rekt oder indirekt – alle wichtigen The-men und Stakeholder umfassen bzw. an-sprechen.
� Unverwechselbarkeit: Ein Leitbild soll-te in prägnanter Form Besonderheitenakzentuieren und damit ein klar erkenn-bares Profil aufweisen.
Leitbilder haben nach den Kategorien derSprechakttheorie8 den Charakter von kol-lektiven Versprechen: Mit ihnen stellenMitarbeiter und Bürger sich selbst und ih-rer Umwelt etwas in Aussicht. Solche Zu-sagen bewegen sich im Spannungsfeldzwischen visionärer Phantasie und boden-ständigem Realismus. Aussichtsreiche Pla-nung braucht sowohl die Offenheit fürMöglichkeiten als auch den Sinn fürMachbarkeiten. Um Künftiges realistischzu imaginieren, muss man sich teilweisevon aktuellen Realitäten lösen; um Visio-nen zu verwirklichen, muss man sie auf
aktuelle Realitäten beziehen. Das Verhält-nis zwischen beiden Komponenten hatwichtige Konsequenzen für die Motivati-on: Eine dynamisierende Wirkung kannvor allem dann entstehen, wenn Ziele sovisionär gesteckt sind, dass sie als positiveHerausforderung für die eigenen Fähigkei-ten wahrgenommen werden, dabei aber sorealitätsnah bleiben, dass ein Erreichennicht aussichtslos erscheint.9
Auch die Forderungen nach Klarheit so-wie Unverwechselbarkeit einerseits undnach Mehrdimensionalität andererseits mar-kieren ein Spannungsfeld. Während Ganz-heitlichkeit vor allem auf Integration undIdentifikation nach innen zielt, bezieht sichdas Kriterium der Einzigartigkeit stärker aufdie Identifizierbarkeit von außen. Beide An-sprüche bedürfen einer sorgfältigen Ausba-lancierung. Dieser Grundsatz ist vor allemfür Kommunen von Bedeutung, die eineVielzahl von Beteiligten mit oft sehr unter-schiedlichen Interessen einbinden wollen.In solchen Fällen ist die Versuchung groß,sich auf unspezifische, aber allgemein zu-stimmungsfähige Formeln zurückzuziehen.Motti wie »Stadt mit Herz« oder »Wohl-fühlstadt« liefern jedoch weder Ansätze füreine Alleinstellung noch strategische Orien-tierungshilfen. Sie benennen zwar eine an-gestrebte Wirkung oder Wahrnehmung, eig-nen sich aber in ihrer völligen Beliebigkeitgerade nicht als Mittel, um die gewünschtenZiele zu erreichen.
Etliche Städte setzen für ihre Profilie-
rung auf historische Persönlichkeiten oderBesonderheiten (zum Beispiel Roswitha-Stadt oder Domstadt). Der Rückgriff auf ei-nen speziellen Traditionspunkt gewährtmeist ein relativ signifikantes Image, birgtjedoch auch die Gefahr einer eindimensio-nalen und rein vergangenheitsbezogenen Fi-xierung. Eine Alternative liegt in Konzep-ten, die besondere Voraussetzungen einerStadt nutzen, um neue, vielschichtige Ent-wicklungen anzustoßen (etwa Stadt derBücher oder Hafencity). Dieser Weg eröff-net im Vergleich zur Fortschreibung (vor-)gegebener Traditionen weit reichende Be-stimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.Zugleich verlangt er erhebliche Anstren-gungen: Das angestrebte Profil muss erfun-den werden – und erfordert deshalb denMut, vertraute Grenzen zu überschreiten,zum Beispiel die Zwischenzone zwischenWasser und Land als Spielraum für innova-
tive Nutzungsideen zu begreifen.
Der Entwicklungsprozess in Soltau
Nachdem sich Soltau jahrelang als »Stadtim Herzen der Lüneburger Heide« und mitdem Slogan »Immer irgendwie anders«präsentiert hatte, zielte die Leitbildentwick-lung auf etwas völlig Anderes. Vor diesemHintergrund riet die 1999 beauftragte »pro-ject m Marketingberatung« zu einem breitangelegten, partizipativen Findungspro-zess. Den Auftakt bildete eine Bürgerver-sammlung, die zur Konstituierung mehre-rer Arbeitsgruppen und einer Lenkungs-gruppe führte. »project m« begleitete undmoderierte deren Arbeit und organisierteparallel hierzu Einwohner- und Gästebefra-gungen. Die Ergebnisse der Erhebungenund die Vorschläge der insgesamt mehr alszweihundert Beteiligten wurden anschlie-ßend aufbereitet, zur öffentlichen Diskussi-on gestellt und in einem Zwischenberichtdokumentiert.
Neben zahlreichen Einzelanregungen(von der Vereinheitlichung der Ladenöff-nungszeiten bis zur Verbesserung des Rad-wegenetzes) ging aus den Beratungen vorallem die Idee hervor, Spiel in den Mittel-punkt der künftigen Stadtplanung zu stel-len. Soltau verfügt weder über eine nen-nenswerte Altstadt noch über eine leitbild-geeignete Geschichte, beherbergt aber eine
der weltbesten Spielzeugsammlungen, diegegenüber dem Rathaus im NorddeutschenSpielzeugmuseum zu sehen ist. WeitereAnknüpfungspunkte bieten die Soltau-Therme mit ihren vielfältigen Wasser-spielangeboten und Deutschlands einzigesSchülervarieté, der Showpalast der Haupt-schule. Darüber hinaus könnte der Spielbe-griff eine assoziative Brücke zum bisherdominierenden Imageträger der Stadt her-stellen: dem »Heide-Park Soltau«.
Zweifel am Sinn des Spielmotivs, einevorübergehende Entspannung der Lage (vorallem während der Expo 2000) sowie dieVerzögerung der DOC-Entscheidung durchGerichtsverhandlungen ließen eine Pauseim Prozess eintreten. Obwohl sich der Ratder Stadt dazu entschloss, die Stelle einesCitymanagers zu schaffen, drohten die in-haltlichen Leitvorstellungen als unausge-reifte und ungreifbare Ideen aus dem Blickzu geraten. Die Stadtverwaltung reagierteauf diese Situation, indem sie 2002 Exper-ten aus den Bereichen Marketing, Spiel-pädagogik und Landschaftsarchitektur dazueinlud, einen konkret umsetzbaren Spiel-plan zu gestalten. Die Resultate wurden imMai 2004 auf der Homepage der Stadt so-wie bei einem Bürgerforum vorgestellt, dasdie Stadthalle in einen Spielraum verwan-delte. Parallel hierzu gründete sich eineGruppe, die Requisiten zum Bespielen derFußgängerzone zusammenstellte. Außer-dem entwarfen Studierende der UniversitätErfurt Konzepte für ein interaktives, extro-vertiertes Spielzeugmuseum, das von Spiel-phänomenen ausgeht und mit Spielstationenund Ex-Ponaten nach außen geht.
Insgesamt ist das Soltauer Vorgehendurch einen Wechsel von Bottom-up- undTop-down-Bewegungen10 gekennzeichnet:Offene Phasen mit möglichst großer Betei-ligung wechselten mit Abschnitten, in de-nen externe Fachleute im kleinen Kreiswirkten.
Bedeutungen und Ebenen desSpiels
Am Ende der ersten Entwicklungsphasestand der Arbeitstitel »Stadt der Spiele«.Spiel ist ein außerordentlich facettenrei-
Stadtentwicklung auf neuen Wegen
266
8 Siehe John R. Searle: What Is a Speech Act?In: Ders. (Hrsg.): The Philosophy of Langua-ge. Oxford 1971. S. 115-125.
9 Vgl. Mihaly Csikszentmihalyi: Das flow-Er-lebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: imTun aufgehen. Herausgegeben und mit einerEinführung versehen von Hans Aebli. Über-setzt von Urs Aeschbacher. Stuttgart 1993.
10 Vgl. Helmut Klages: Zwischenbilanz der Ver-waltungsmodernisierung in Deutschland. In:Verwaltung und Management 3 (3/1997), S.132-139.
»Ein Leitbild soll nicht zeigen, was eine Stadtmacht, sondern was sie ausmacht und was sie
aus sich machen kann.«

cher Begriff, wie sich unter anderem ander Fülle alltagssprachlicher Verwendun-gen ablesen lässt:
Man kann etwas spielend leicht bewälti-gen; etwas spielt sich ab; jemand hat ver-spielt, ein anderer ist verspielt; Kinder spie-len (Spiele) miteinander, oder sie spielen mitSpielzeug; ein Erwachsener spielt mit einemanderen (oder dessen Gefühlen) nur; einLächeln umspielt die Lippen; es gibt einSpiel der Wellen und ein Spiel mit Puppen;man kann mit der Fernbedienung, mit Ge-danken, mit dem Glück und mit dem Lebenspielen, alles oder nichts aufs Spiel setzenund manches ins Spiel bringen; es gibt Ta-schenspieler und Vabanquespieler, Spielleu-te und Spielkinder, Falschspieler (die ande-ren etwas vorspielen) und Spielverderber;der Fußballspieler spielt seinen Mitspieleran, der Klavierspieler ein Stück, und derWortspieler spielt auf etwas oder jemandenan; man kann in einer Spielhölle, auf einemSpielplatz oder einem Spielfeld spielen, fi-nanziell oder zeitlich noch Spiel haben undjemandem einen großen oder kleinen Spiel-raum lassen; Dinge können ein Vor- und einNachspiel haben; es ist die Rede von einemZwischen- und von einem Zusammenspiel,vom Mienen- und vom Schauspiel, von Ge-sellschafts- und (Geld einspielenden) Ge-winnspielen, von Kinderspielen und von denSpielen, nämlich den Olympischen; undschließlich heißt es: Das Spiel ist aus!
Unter Leitbildgesichtspunkten erlaubtdie breite Bestimmbarkeit des Begriffs fle-xible Aktualisierungen und vielfältige Ap-plikationen; sie fördert damit die nachhal-tige Integrations- und Innovationskraft desKonzepts. Andererseits stellt das schillern-de, etliche negative Komponenten umfas-sende Bedeutungsspektrum die gewünsch-te Prägnanz des Profils in Frage. In derzweiten Entwicklungsphase fiel deshalbdie Entscheidung, die missverständliche»Stadt der Spiele« durch den »SpielraumSoltau« zu ersetzen: Mit der neuen Formu-lierung tritt ein offener, aber klar positivbesetzter Terminus in den Vordergrund,der mit freien Entfaltungsmöglichkeitenund attraktiven Experimentierfeldern asso-ziiert wird.
Für die gezielte Füllung des Spielraumserscheint es sinnvoll, drei verschiedeneGrundformen von Spiel zu differenzieren.
Der erste Typus ist durch die häufigeWiederholung einer Tätigkeit gekenn-zeichnet und lässt sich als Kreis symboli-sieren.11 Der Akzent liegt auf physischerAktivität. Die Freude an einer zweckfreienBewegung kann als Ausgleich zu denmeist linear gerichteten Tätigkeiten derAlltagswelt betrachtet werden. Diese über-wiegend passiv nachvollziehende Formdes Spiels steht im Mittelpunkt vieler
kommerzieller Freizeitangebote, die dazuanimieren, in den Leerlauf zu schalten.
Beim zweiten Typus tritt ein dynami-sches Entwicklungsmoment hinzu: ImWettbewerb mit sich selbst oder mit ande-ren definieren die Spielenden bei wachsen-den Fähigkeiten immer neue Herausforde-rungen, so dass sich Kompetenz- und An-spruchsniveaus in einem spielerischenLernprozess12 wellen- oder spiralförmigaufwärtsbewegen. Der Schwerpunkt kanndabei ebenso auf physischen wie auf kogni-tiven Prozessen liegen. Verglichen mit demersten Typus, übernehmen die Spieler eineaktivere und stärker selbstbestimmte Rolle.
Mit dem dritten Typus vollzieht sich einSprung von der Entwicklung zur Erfin-
dung. Pendelbewegungen (zum Beispielzwischen Aktion und Reaktion), Perspektiv-wechsel und Grenzüberschreitungen sindkonstitutiv für diese Form des Spiels. Ex-perimentelle Variationen, Um- und Neube-stimmungen des Gegebenen und kreative(Entgegen-)Setzungen erschließen einenMöglichkeitsraum, aus dem Neues ent-springt. In diesem ästhetisch-schöpferi-schen Spiel sieht Friedrich Schiller die ge-gensätzlichen Anlagen des Menschen(Stoff- und Formtrieb) aufgehoben; hieraufbezieht sich sein vielzitiertes Diktum:13
»[...] der Mensch spielt nur, wo er involler Bedeutung des Wortes Mensch ist,und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«
Die Übergänge zwischen den drei umris-senen Spieltypen verlaufen fließend. So bil-det der Übungseffekt des Wiederholungs-spiels eine wichtige Grundlage für das ent-wickelnde Spiel, zu dessen Dynamisierungspielerische Erfindungen beitragen.
Statt sich mit einfach zu realisierendenAngeboten aus dem ersten Bereich zu beg-nügen, dürfte es für den Spielraum Soltaudarauf ankommen, ein ganzheitliches Sor-timent zu entwickeln, das Sinn und Sinnemiteinander ins Spiel bringt und ein Wei-terspielen von Ebene zu Ebene begünstigt.
Spiel bildet nach Huizinga die kulturstif-tende menschliche Kernkompetenz.14 Kulturgründet in der spielerischen Fähigkeit desMenschen, zu sich selbst und seiner Umweltin ein Verhältnis der Potenzialität zu treten.Der Homo ludens ist ein universelles Phäno-men, dessen fundamentale Bedeutung aller-dings oft unterschätzt wird. Spiel vermag
gerade solche Fähigkeiten zu fördern, die inder globalisierten Wissensgesellschaft be-sonders gefragt sind – zum Beispiel Team-fähigkeit und Eigeninitiative, Flexibilitätund Regelbewusstsein sowie Offenheit fürlebenslanges Lernen. Zudem erfüllt Spielwesentliche Erfolgskriterien der Erlebnis-ökonomie15 (wie Spannung, Gemeinschaft-lichkeit und Beteiligung), kann deren typische Schwächen aber vermeiden: ImGegensatz zu den punktuellen, einmaligenEffekten von Events vermag Spiel individu-elle, einzigartige Erfahrungen hervorzubrin-gen und in nachhaltige (Lern-)Prozesse zuintegrieren; im Unterschied zu oberflächli-chen Mitmachmöglichkeiten zum Beispielin Freizeitparks leben vor allem entwickeln-
de und kreative Spiele von den Mitentschei-dungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten derAkteure. Besonderes Gewicht kommt diesenSpielqualitäten angesichts von Prognosenzum Wandel der Erlebnisgesellschaft zu. Sowird damit gerechnet, dass »die selbst erar-beitete Er-kenntnis und Veränderung« insZentrum einer »self transformation eco-
Antje und Mathias Ernst, Innovative Leitbilder für Städte
VM 5/2004 267
»Leitbilder haben den Charakter von kollektiven Versprechen: Mit ihnen stellenMitarbeiter und Bürger sich selbst und ihrerUmwelt etwas in Aussicht.«
11 Vgl. Hans Scheuerl: Das Spiel. Bd. 2: Theori-en des Spiels. 11., überarbeitete und ergänzteNeuausgabe. Weinheim u.a. 1990. Besonders:Kap. IV, Text 17.
12 Vgl. unter anderem: Andreas Flitner: Spielen– Lernen. München 1972.
13 Siehe Friedrich Schiller: Über die ästhetischeErziehung des Menschen in einer Reihe vonBriefen. In: Sämtliche Werke. Hrsg. von Ger-hard Fricke und Herbert G. Göpfert. Bd. 5:Erzählungen/ Theoretische Schriften. 9.,durchgesehene Auflage. München 1993. S.570-669 (Zitat: 15. Brief).
14 Johan Huizinga: Homo ludens. Vom Ur-sprung der Kultur im Spiel. Übersetzung H.Nachod. Mit einem Nachwort von AndreasFlitner. Bibliographisch ergänzte Neuauflage.Reinbek 1987.
15 Vgl. dazu: James H. Gilmore und B. JosephPine II: The Experience Economy. Work IsTheatre and Every Business a Stage. Boston1999. Sowie: Gerhard Schulze: Die Erlebnis-gesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart.Frankfurt a.M. 82000.
16 Vgl. dazu: Peter Littmann und Stephan A.Jansen: Oszillodox. Virtualisierung – die per-manente Neuerfindung der Organisation. Un-ter Mitarbeit von Daniel Kohler. Stuttgart2000.
17 Siehe Gerhard Schulze: Die Zukunft des Er-lebnismarktes: Ausblick und kritische Anmer-kungen. In: Oliver Nickel (Hrsg.): Eventmar-keting. Grundlagen und Erfolgsbeispiele.München 1998.

nomy«16 rückt und dass Kommunikationund Konzentration als Orientierungsgrößenan Bedeutung gewinnen.17
Damit der Spielraum Soltau nicht zu ei-nem Deckmantel für sinnlose Beliebigkeitwird, sondern seine weit reichenden Poten-ziale gezielt und koordiniert aktivieren kann,bedarf es klarer Spielregeln und Qualitäts-maßstäbe. Um diese zu gewährleisten, istein Zertifizierungssystem vorgesehen.
Zu den Basisanforderungen für die Ele-mente des Spielraums gehört eine gewisseHaltbarkeit bzw. Alterungsresistenz. Zu-dem sollten die Angebote in der Regelnicht primär kommerziell ausgerichtetsein. Inhaltlich erscheinen folgende Gelin-
gensbedingungen wesentlich:� Einzigartigkeit und Originalität: Die
Angebote sollten originell sein und ih-rerseits kreative Prozesse anregen. Zuvermeiden ist eine Möblierung desSpielraums mit Konfektionsware.
� Mehrsinnigkeit: Die Angebote solltensich nicht in eindimensionalen Verwen-dungsmöglichkeiten erschöpfen, sondernverschiedene Funktionsebenen kombi-nieren.
� Mitwirkungsmöglichkeit: Die Angebotesollten eine persönliche Beteiligung er-lauben – und können darüber hinaus einSchauspiel bieten.
� Integrationspotenzial: Die Angebote
sollten Brückenschläge zum Beispielzwischen verschiedenen Altersgruppenoder zwischen Einheimischen und Gä-sten erlauben und unterschiedliche Kul-turen oder Zeiten miteinander ins Spielbringen.
Ziel ist die Transformation der Stadt in ei-nen attraktiven, unverwechselbaren Spiel-raum, dessen Elemente sich zu einer ent-wicklungsfähigen und innovationsfördern-den Gesamtkomposition zusammenfügen.
Projekte im Spielraum Soltau
Der Spielraum Soltau wird Materialienund Felder enthalten, mit denen sich ganzunterschiedliche Menschen nach Soltauhineinspielen und spielerisch entwickelnkönnen. Ein typischer Freizeitparkbesu-cher, der die Welt der fertigproduziertenSerienevents verlässt, soll dazu angeregtwerden, sich selbst Lern- und Ent-deckungserlebnisse zu verschaffen.
Die potenziellen Mitspieler werdendurch Portale empfangen – und durch Pfadeweitergeleitet, die keinen roten Faden vor-geben, sondern spielerische Beziehungenzwischen einzelnen Stationen herstellen.Zum Beispiel könnte sich eine Familie überunterschiedlich große und lange Schaukelnzu einer variablen Murmelbahn schwingen,die schließlich ein begehbares Spiegelkalei-doskop mit neuen, vielfarbigen Elementenbereichert. Um ein Netz von Blickfängen zukreieren, bieten sich vor allem optischeSpiele an; so schlugen die Erfurter Studie-renden für eine kahle Supermarktfront amInnenstadtrand ein Riesen-Myriorama mitfrei gestaltbaren Zusatztafeln vor (Bild 1);steuerbare Lichtstrahlen und diverse Linsensollen zu Plätzen weiterführen, die durchverstellbare Großschirme zu wetterunab-hängigen Projektionsflächen und geschütz-ten Spielräumen werden.
Viele Spielformen lassen sich nicht nurauf einer Ebene nutzen, zum Beispiel sinn-lich-wiederholend bespielen. So lädt zumBeispiel die von den Landschaftsarchitek-ten Astrid und Hans-Jochim Adam skiz-zierte Endlostreppe (Bild 2) zum dauerhaf-ten Im-Kreis-Laufen ein; gleichzeitig kannsie Wettkämpfe, grundlegende Reflexionenund eigene illusionistische Konstruktionenmotivieren. Eine solche Mehrdimensiona-lität liegt auch bei sehr einfachen und preis-werten Spielideen nahe. Damit den Gästendas Warten nicht lang(weilig) wird, könn-ten zum Beispiel Restaurants ihre Tischsetsdoppelseitig mit allseits beliebten und eherunbekannten Spielplänen bedrucken; durchLeerseiten und verlockende Preise ließensich außerdem neue Spieleerfinder auf denPlan rufen.
Stadtentwicklung auf neuen Wegen
268
Bild 1 und 2: Unendlich viele Kombinationen und Stufen?oben: Landschaftsmetamorphosen (»Myriorama« von 1824), unten: Raumillusionen (frei nach M.C.Escher)

Alle Spielzonen sind als Bühnen zumMitmachen und Zuschauen zu konzipieren;indem sie Perspektiv- bzw. Rollenwechselbegünstigen, sollen sie die traditionelleDifferenz zwischen Rezeption und Produk-tion aufheben. Im Bereich um die Soltau-Therme werden elementare Experimenteden Hauptfokus bilden, in den Parkanlagenkreative Naturerfahrungen, in der Fußgän-gerzone interaktive Installationen, die hi-storische und künstlerische Spielideen inSzene setzen. Die drei Kernräume sollendurch eine spielerische Infrastruktur ver-bunden werden, die genauso zum Beispielbewegliche Brücken wie klingende Sonder-spuren oder einen Parcours für Stelzenläu-fer umfassen kann. Damit die gewünschtenRequisiten und Transportmittel griffbereitzur Verfügung stehen, sind Ausleihstatio-nen an mehreren Standorten vorgesehen.
Als Ideenquelle kommt in erster Liniedas Spielzeugmuseum in Frage. Vom Hol-länder mit vier Rädern bis zu einem Puzzle-globus, dessen Zwischenebenen Detailan-sichten der Welt liefern, reicht das Spek-trum der Bestände. Die unveränderte Ak-tualität vieler Museumsstücke wird ab 2005in einem Musterzimmer herausgestellt, dasdie Auswahl passender Vorlagen unterstüt-zen und den Umsetzungsprozess kontinu-ierlich begleiten soll. Zugleich will sich dasMuseum mit Ex-Ponaten unmittelbar in denstädtischen Spielraum einbringen. Besonde-res Gewicht wird auf »Outsites« gelegt, dienicht nur räumliche Grenzen überschreiten.So ließe sich zum Beispiel eine für Kinderangefertigte »Automobil-Werkstatt« (Bild3) vergrößert nachbauen und mit einerWerkstatt kombinieren, in der nach demVorbild der Leipziger »GaraGe« aktuelleTechnik (de-)konstruiert werden darf. Einechtes Innovationszentrum ließe sich in diegeplante gläserne Filzfabrik integrieren:Ausgehend von sinnlichen Materialerpro-bungen und einer Produktschau, die exem-plarische Einsatzfelder (zum Beispiel alteKarikaturpuppen und neue Filtersysteme)präsentiert, könnten die Besucher auf dieSuche nach zusätzlichen Anwendungsmög-lichkeiten gehen.
Das Spielzeugmuseum selbst soll zu ei-nem Museum der Zukunft werden, dassich nicht nur mit überlieferten Geschich-ten, sondern mit übergreifenden, zeitlos re-levanten Fragen auseinandersetzt. NeueAusstellungsbereiche werden zentraleSpiel-aspekte (wie Abbilden und Verwan-deln) behandeln, Interaktionen in den Mit-telpunkt stellen und Räume für weiterrei-chende Aktionen eröffnen. Der Schwer-punkt »Experimentieren« könnte zumBeispiel einen Bogen von einer frühen In-fluenzmaschine für Kinder bis zu einerSpieleinheit zur Gewinnung alternativer
Energien spannen. Der Komplex »Bauen«ließe sich nicht zuletzt für die Weiterent-wicklung des Museums und spielerischeStadtplanungen nutzen. Einige der Modulesollten auch außerhalb der Einrichtung ein-setzbar sein. Noch einen Schritt weitergeht die Vision einer klassenzimmer-großen Projektbox, die in der Nähe desMarktplatzes eine schwebende Positionüber den Dingen einnehmen könnte. Parti-zipative Prozesse würden so einen festenRaum erhalten und nicht auf bestimmteThemen und Personen festgelegt sein. Ne-benbei wäre ein solche offene Denkfabrikauch dazu geeignet, Orientierungsdienstewie die überdimensionale hochgestellte In-fobox am Potsdamer Platz (Bild 4) zu lei-
sten.Die geschilderten Ideen entfernen sich
zunehmend vom Ist-Zustand Soltaus. Siekonzentrieren sich auf die innovativen undInnovationen fördernden Aspekte des Leit-bildes und setzen damit auf eine (Eigen-)Dynamik, die im »Spielraum Stadt« ange-legt ist. Damit die Visionen den Sprungvom Papier in die Realität schaffen, ist un-ter anderem die Gründung einer gemein-nützigen »Stiftung Spiel« vorgesehen, dieab dem 1. Januar 2005 das Spielzeugmuse-um sichern und weitertragen soll. Ohnediesen festen Ausgangspunkt bestünde dieGefahr, dass der Spielraum zu einer leeren,beliebig auffüllbaren Formel würde; dennschließlich spielen Menschen in allen
Antje und Mathias Ernst, Innovative Leitbilder für Städte
VM 5/2004 269
Bild 3 und 4: Historische Anregungen für mögliche Zukunftswerkstätten?oben: Ein wandlungsfähiges Miniaturauto aus Bausteinen (1912); unten: eine Infobox für eine Großbaustelle (Potsdamer Platz, 1995-2000)

Interdependenz zwischen Ernennungs- und Disziplinarver-fahren
Nach Dayton1 ist Rechtsstaatlichkeit (ruleof law) unabdingbare Voraussetzung einesanhaltenden Friedens in Bosnien und Her-zegowina (BiH)2. Zur Wiederherstellungdes Vertrauens der Bevölkerung in eineschwer angeschlagene Justiz3 hat der HoheRepräsentant drei eng zusammenarbeiten-de »Hohe Räte der Justiz« (High Judicialand Prosecutorial Councils – HJPCs)4 mitinternationaler Beteiligung geschaffen, de-nen neben zahlreichen anderen Aufgabenwie die komplette Neubesetzung der Rich-ter- und Staatsanwaltschaft5 auch die aus-schließliche Disziplinargewalt überantwor-tet ist6. Damit sind spezifische Probleme
der Interdependenz zwischen Ernennungs-und Disziplinarverfahren verbunden.
Das Disziplinarrecht für Richter undStaatsanwälte in BiH
Die für Richter zwanzig7 und für Staatsan-wälte zweiundzwanzig8 speziellen Diszi-plinarvergehen in den HJPC-Gesetzenwerden durch generalklauselartige Auf-fangtatbestände ergänzt, welche auch jedeandere (in den Aufzählungen nicht ge-
nannte) Verhaltensweise als Disziplinar-vergehen behandeln, die eine ernsthafteVerletzung von Amtspflichten darstelltoder das Vertrauen der Öffentlichkeit indie Unparteilichkeit oder Glaubwürdigkeitder Justiz beeinträchtigt. An disziplinar-rechtlichen Sanktionen sind vorgesehen:9� schriftliche Verwarnung (written war-
ning)� öffentlicher Verweis (public reprimand)� Kürzung der Dienstbezüge (fine that
decreases the offender’s salary) um biszu dreißig Prozent und bis zu sechs Mo-naten
� Entfernung aus dem Amt (dismissalfrom office).
Rechte und Ansprüche aus den arbeits-rechtlichen Beziehungen treten hinter einerEntfernung aus dem Amt zurück. Andersals im Strafrecht werden keine bestimmtenSanktionen oder Sanktionsrahmen für dieeinzelnen Disziplinarvergehen festgelegt.
Disziplinierung der Justiz zwischen Gerechtigkeit und EffektivitätZur Justizreform in Bosnien und Herzegowina
von Axel Schwarz und René El Saman
Wie sichert man die Rechtsstaatlichkeit in den Nachfolgestaatendes ehemaligen Jugoslawien? Wie misst man bei der Neubesetzungder Richter- und Staatsanwaltstellen Gesetzestreue und moralischeIntegrität der Bewerber? Wie ist die Disziplinargewalt in der Ju-stiz auszuüben? Die Autoren berichten am Beispiel Bosnien undHerzegowina über diese Aufgaben.
Rechtsreferendar René El Saman LL.M.
Ministerialrat Dr. AxelSchwarz, International
Member of the High Judicial and Constitutio-
nal Councils of BiH, Sarajevo; SächsischesStaatsministerium für
Soziales.
Vertrauen in die Justiz als Voraussetzung für inneren Frieden
270 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 270-273
No. 42/02; Law on the High Judicial and Pros-ecutorial Council of the Republika Srpska, asenacted by the High Representative on 21 Au-gust 2002, Official Gazette of Republika Srps-ka No.55/02
5 Eingehende Darstellung bei Schwarz, Axel,»Die Hohen Räte der Justiz in Bosnien-Herze-govina (High Judicial and Prosecutorial Coun-cils)«, ZOR (Zeitschrift für Osteuroparecht),2003, 227-245. In der ersten Jahreshälfte 2004wurden die bisherigen drei Räte zu einem einzi-gen, für das gesamte Staatsgebiet zuständigenRat zusammengefasst (Law on High Judicialand Prosecutorial Council of Bosnia and Herze-govina, veröffentlicht am 1. Juni 2004 in »Offi-cial Gazette« of Bosnia and Herzegovina Nr. 25vom gleichen Tag). Die sich daraus ergebendenÄnderungen haben keinen Einfluss auf die indiesem Beitrag dargestellte Problematik. ZurJustizreform in BiH siehe auch ChristopherHarland, »Judicial Reform as a Form of CivilianIntervention in Post-Dayton Bosnia and Herze-govina«, in The Measure of International Law:Effectiveness, Fairness and Validity, KluwerLaw International, The Hague / London / NewYork, 2002, at pages 98 to 110.
6 Vgl. Article 17 Law on HJPC und jeweils Ar-ticle 17 Ziff. 1,2,11 Law on Fed-HJPC/Lawon RS-HJPC.
7 Article 40 Law on HJPC und jeweils Article49 Law on F-HJPC/Law on RS-HJPC.
8 Article 41 Law on HJPC und jeweils Article50 Law on F-HJPC/Law on RS-HJPC.
9 Article 42 Law on HJPC und jeweils Article51 Law on F-HJPC und Law on RS-HJPC.
1 »The General Framework Agreement for Pea-ce in Bosnia and Herzegovina« (GFAP); vgl.www.state.gov/www/regions/eur/bosnia/daytable.html; Internationales Abkommen, ausge-handelt in der Zeit zwischen dem 1. und 21.November 1995 in der Wright-Patterson AirBase in Dayton (Ohio / USA), ca. 170 Seitenmit zahlreichen Agreements, Annexes, Side-Letters, Statements etc. Parteien des Dayton-Abkommens waren die Republik von Bosni-en-Herzegowina, die Republik von Kroatienund die Bundesrepublik von Jugoslawien.)Siehe auch Schwarz, Axel, »Die Verfassungdes Gesamtstaates Bosnien-Herzegovinas«,Europa-Blätter 2003, 128-133.
2 Siehe Article 1 Ziffer 2 der Verfassung desGesamtstaates BiH (Annex 4 GFAP)
3 Vgl. Balkans Report No. 127 »Courting Disa-ster, The Misrule of Law in Bosnia & Herze-govina«, 25 March 2002, der InternationalCrisis Group (ICG)
4 Entsprechend der Unterteilung des Landes ineinen Gesamtstaat und zwei Entitäten, auf dereinen Seite die »Föderation Bosnien und Her-zegowina« und auf der anderen Seite die »Re-publika Srpska«): Law on the High Judicialand Prosecutorial Council of Bosnia and Her-zegovina, as enacted by the High Representa-tive on Mai 23, 2002, Official Gazette of Bos-nia and Herzegovina No. 15/02 on 23 July2002; Law on the High Judicial and Prosecu-torial Council of the Federation of Bosnia andHerzegovina, as enacted by the High Repre-sentative on 21 August 2002, Official Gazetteof the Federation of Bosnia and Herzegovina

Gleichwohl steht die Zumessung der Sank-tion nicht im freien Ermessen. Neben derVerhältnismäßigkeit10 sind zu berücksich-tigen11:� Schwere und Folgen des begangenen
Disziplinarvergehens� Grad der Verantwortlichkeit� Umstände des Einzelfalles� Vorleben� sonstige relevante Umstände.Die Entfernung aus dem Amt kommt nurbei solch schwerwiegenden Disziplinarver-gehen in Betracht, die eine weitere Aus-übung des Amtes verbieten.
Orientierung an anderen Rechtsordnungen
Das Streben nach einheitlicher und vorher-sehbarer Sanktionszumessung wie die bis-lang fehlende Rechtspraxis gebietet dieOrientierung an der Zumessungspraxis an-derer Rechtsordnungen.12 Nach dem»Grundsatz der schrittweisen Steigerung«wird bei einer Häufung kleinerer Vergeheneine schwerwiegende Disziplinarmaßnah-me erst verhängt, wenn sich mildere »er-zieherische« Maßnahmen als unwirksamerwiesen haben.13 Diese Regel ist nichtmehr anwendbar, sobald das Vertrauen derÖffentlichkeit in die Fähigkeit des Richtersoder Staatsanwalts, seine Amtspflichten zuerfüllen, endgültig zerstört ist. Dann wirdin der Regel nur die Entfernung aus demAmt in Betracht kommen. Entsprechendgängiger Rechtspraxis14 werden mehrereEinzelvergehen gemeinsam beurteilt unddurch eine einzige Sanktion geahndet15.Eine Häufung von Verstößen kann selbst-verständlich zur Entfernung aus dem Amtführen, selbst dann, wenn die einzelnenVergehen von geringerem Gewicht sind.16
Beruhen mehrere Vergehen auf einer feh-lerhaften Grundeinstellung zu den Amts-pflichten, so müssen sie gemeinsam ge-ahndet werden17.
Rückwirkung
Der Umstand, dass die HJPC-Gesetze erstim Jahre 2002 in Kraft traten18, die vondiesen erfassten Vergehen jedoch in derRegel vor Inkrafttreten begangen wordenwaren, warf die Frage der Rückwirkungauf, die mit einer aufschlussreichen prakti-schen Komponente verknüpft ist. Eine di-rekte Anwendung hätte einerseits einenVerstoß gegen den Grundsatz »nulla poenasine lege« wie gegen das Rückwirkungs-verbot der Europäischen Konvention zumSchutz der Menschenrechte und Grundfrei-heiten19, die durch Verweis Teil der Ver-
fassung BiHs ist20, bedeuten können. An-dererseits wäre das Ziel, die Justiz vonRichtern und Staatsanwälten zu befreien,die wegen zweifelhafter Praktiken die Ju-stiz in Verruf brachten, verfehlt worden,wären die HJPC-Gesetze nur auf nachihrem Inkrafttreten erfüllte Tatbestände
anzuwenden gewesen. Man hätte sich zwardadurch behelfen können, Vorschriften desfrüheren Rechts21 heranzuziehen, aus de-nen sich entsprechende Pflichtverletzungenherleiten ließen. Die aus der jugoslawi-schen Vergangenheit stammenden, zumZeitpunkt des Inkrafttretens der Verfassungnoch bestehenden Gesetze, Verordnungenund gerichtlichen Verfahrensregeln geltenfort22, soweit sie mit der jetzigen Verfas-sung vereinbar sind. Da jedoch diese Vor-schriften in Serbokroatisch und auch Kyril-lisch geschrieben sind und nur bruchstück-haft und marginal in englischer Überset-zung vorliegen, sind sie den Vertretern der
internationalen Gemeinschaft nur schwerzugänglich, wenn nicht mit Blick auf diebeschränkten Übersetzungskapazitäten sogut wie verschlossen. Die Verfassung derRepublika Srpska lässt überdies ausdrück-lich eine Rückwirkung nur bei ausdrückli-cher Erwähnung in den betreffenden Geset-
zen vor.23 Diesem Erfordernis entsprechendie Artikel 80 der HJPC-Gesetze beiderEntitäten für bis zu zwölf Jahre zurücklie-gende Disziplinarvergehen. Damit ist zu-gleich einem eventuellen Verstoß gegendie Artikel 6 EMRK (fair trial) 24 und Arti-kel 7 EMRK (nulla poena sine lege) 25, je-weils in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2der Verfassung des Gesamtstaates BiH vor-gebeugt. Die in den HJPC-Gesetzen vorge-sehenen Disziplinarmaßnahmen stellen un-ter Berücksichtigung ihrer Klassifizierungnach nationalem Recht, aber auch ihrer Na-tur wie Schweregrad nach keine Strafsank-tionen dar.
Axel Schwarz und René El Saman, Disziplinierung der Justiz zwischen Gerechtigkeit und Effektivität
VM 5/2004 271
»Zur Wiederherstellung des Vertrauens derBevölkerung in eine schwer angeschlageneJustiz wurden drei ›Hohe Räte der Justiz‹ mit internationaler Beteiligung geschaffen.«
17 In der wiederholten Begehung von Diszipli-narvergehen kann auch zum Ausdruck kom-men, dass der Amtsträger seine persönlichenMaßstäbe über seine Amtspflichten erhebt,vgl. Dazu BGH RiSt (R) 1/00, Entscheidungvom 10. August 2001.
18 Die Laws on the HJPCs traten am 23. Juli2003 (Law on HJPC), 11. 9. 2003 (Law on F-HJPC), bzw. 12. September 2003 (Law onRS-HJPC) in Kraft.
19 European Treaty Series of 4 November 1950,i.F. »EMRK« oder »die Konvention«.
20 Vgl. Article 2 Absatz 2 des Annexes 4 zumGFAP/der Verfassung Bosnien-Herzegowinas,im Internet unter: http://www.ohr.int/ohr-dept/legal/const/
21 Für die Föderation, Article IX.5 der F-Verf;für den Gesamtstaat Annex II der Verfassungdes Gesamtstaates BiHs (Annex 4 des DaytonAbkommens).
22 Komplizierter die Rechtslage insoweit im Ko-sovo, vgl. Schwarz, Axel, »Das anwendbareRecht des Kosovo«, in IPRax (Praxis des In-ternationalen Privat- und Verfahrensrechts),2002, 238-241.
23 Article 110 RS-Verf24 Pitkevitch v. Russia, Urteil v. 8. Februar 2001,
Appl. No. 47936/99; weder Beginn und Endenoch die Disziplinierung der Tätigkeit fallen inden Schutzbereich des Articles 6 EMRK.
25 Vgl. Escoubet v. Belgium, Urteil vom 28. Ok-tober 1999, appl. no. 26780/95, Nr.35. ZumSchrifttum siehe Van Dijk and Van Hoof,Theory and Practice of the European Conven-tion on Human Rights, 3. Aufl. 1998, Seite470 mwN.
10 Article 48 (2) Law on HJPC und jeweils Ar-ticle 57 (2) Law on F-HJPC/Law on RS-HJPC.
11 Article 49 Law on HJPC und jeweils Article58 Law on F-HJPC und Law on RS-HJPC.
12 Die Sanktionskataloge anderer Rechtsordnun-gen sind oft umfangreicher als in BiH, inso-fern sie auch die Degradierung (mit und ohneAuswirkungen auf Gehalt oder Pension) unddie Versetzung (auch in den vorzeitigen Ruhe-stand) vorsehen.
13 Auf diesen Grundsatz hat sich der Bundesge-richtshof in einer Entscheidung vom 10. Au-gust 2001 berufen, s. BGH RiSt (R) 1/00, Ent-scheidung vom 10. August 2001,Seite 35, imInternet unter www.bundesgerichtshof.de.
14 Vgl. BGH RiSt (R) 1/00 und ConseilSupérieur de la Magistrature réunis commeConseil de discipline, Entscheidung vom 9Juli 1999, Rapport d’activité 1999, Seite 177.
15 Anders, wenn ein Verstoß unabhängig vonden anderen begangen wurde; in diesem Fallkann Verjährung einer Sanktionierung entge-genstehen.
16 S. im Besonderen Conseil Supérieur de la Ma-gistrature réunis comme Conseil de discipline,Entscheidung vom 9 Juli 1999, Rapport d’ac-tivité 1999, Seite 177: hier wurde festgestellt,dass keines der Vergehen für sich genommenschwerwiegend sei. Aus den während einesZeitraums von sechs Monaten wiederholtenBegehungen ergebe sich jedoch, dass die cha-rakterliche Einstellung des Richters mit seinenAmtspflichten unvereinbar sei, weshalb alsSanktion die Versetzung in den vorzeitigenRuhestand anzuordnen sei.

Disziplinierung und Selektion
Rund 1.600 Juristen aus dem In- und Aus-land bewarben sich auf die ausgeschriebe-nen fast 1.000 Positionen. Gegen die Be-werber lagen bis Mitte August 2003 etwa2.500 Beschwerden vor, die zum größtenTeil, auch wenn nicht durch Fakten belegt,Gegenstand der Bewerbungsunterlagenwurden. Nur etwa zehn Prozent davonwurden nach bestimmten Kriterien vonden dafür eingesetzten Ermittlern (investi-gators) einer näheren Prüfung unterworfen
und wiederum nur ein Teil hiervon demErmittlungsführer (Disciplinary Prosecu-tor) zugeleitet, der bei hinreichender Be-weislage förmlich Anklage (indictment) zudem jeweilig zuständigen Disziplinaraus-schuss erhob, falls keine Einigung (con-sent agreement) mit dem jeweiligen Be-troffenen zustande kam. Die Einleitungstaatsanwaltschaftlicher Ermittlungen ver-hinderte die Weiterführung eines Diszipli-narverfahrens. Damit lassen sich drei Ka-tegorien von Vorwürfen bilden, die ganzunterschiedliche Einflüsse auf die Bewer-bungen nehmen konnten:� Ermittlungs- und Strafverfahren� förmliche Disziplinarverfahren� sonstige Vorwürfe.Für einen Bewerber mit ausreichenderfachlicher Qualifikation eine zu besetzen-de Position bis zur Klärung der gegen ihnerhobenen Vorwürfe frei zu halten, stellteangesichts der genannten Zahlen nur einetheoretische Option dar. Zum einen stan-den weder die personellen und sachlichenMittel zur Verfügung, zum anderen hätteder damit verbundene Zeitaufwand jedenzeitlichen Rahmen gesprengt und die Neu-organisation der Justiz praktisch verhin-dert. In dieser Situation entwickelte sicheine an rechtsstaatlichen Standards gemes-sen vielleicht unbefriedigende Praxis, diemehr oder weniger diffus darauf hinaus-lief, den Erfolg des gesamten Unterneh-mens auf der Basis überschlägiger Beurtei-lungen bestehender Vorwürfe zu sichern.
Ermittlungs- und Strafverfahren
Keine größeren Schwierigkeiten stelltensich, soweit während des Bewerbungsver-fahrens staatsanwaltschaftliche Ermitt-lungsverfahren gegen einen Bewerber ein-geleitet wurden oder bereits liefen. Ging es
dabei um mit Freiheitsstrafe bedrohteStraftaten oder wurde Untersuchungshaftangeordnet, war die Suspendierung anzu-ordnen26, die ansonsten im Ermessen desRates stand.27 Dieselben Gründe, die eineSuspendierung rechtfertigten, verhindertengleichzeitig die Berücksichtigung im Be-werbungsverfahren. Mit dem äußerst hochzu veranschlagenden Wert des Ansehensder Justiz ist es schlichtweg unvereinbar,mit erheblichen Vorwürfen belastete Rich-ter oder Staatsanwälte zu ernennen. Da dasBewerbungsverfahren kein Strafverfahren
darstellt, konnte sich ein Bewerber inso-weit in der Regel auch nicht mit Erfolg aufden Grundsatz »in dubio pro reo« berufen.Ähnlich hatten in der Regel auch Bewerberkeine Chance, deren lange zurückliegendestrafrechtliche Verurteilung auf Grund ent-sprechender Tilgungsvorschriften einemBerücksichtigungsverbot unterlag.
Förmliche Disziplinarverfahren
Erheblich besser gestaltete sich die Situati-on für Bewerber, gegen die förmliche Dis-ziplinarverfahren eingeleitet wurden. Sie
konnten zwar ebenfalls nach Ermessen desjeweils zuständigen Hohen Rates der Justizsuspendiert werden28, und zwar schondann, wenn über die disziplinarische Ver-antwortlichkeit nicht ohne Suspendierungordnungsgemäß zu entscheiden war29.Aber nur sie hatten eine realistische Chan-ce, sich noch während des Bewerbungs-verfahrens zu rehabilitieren. Auch standenSanktionen unterhalb der Entfernung ausdem Amt nicht unbedingt einer Ernennung– in der Regel in Untergerichten und nichtin leitenden Funktionen – entgegen. DieChancen standen dabei nicht allzuschlecht. Denn neben den allgemeinenAuswahlkriterien30 (unter anderem dieFähigkeit, Amtspflichten unparteiisch undgewissenhaft auszuführen31 sowie Inte-grität, Ruf, Kollegialität und außerdienstli-ches Verhalten32) war die ethnische Zu-gehörigkeit33 zwischen den drei wichtig-sten Volksgruppen der Bosnier, Kroatenund Serben sowie der so genannten Ande-ren (others)34 zu beachten.35 Dadurch erga-ben sich Defizite insbesondere an bosni-schen Bewerbern in der Republika Srpska,an serbischen Bewerbern in der Föderationund an kroatischen und »anderen« Bewer-bern in beiden Entitäten, die Ernennungenauch schwächerer Bewerber erzwangen.
Sonstige Vorwürfe
Den bei weitem breitesten Raum nahm da-mit die Grauzone meist nicht erwiesener
Vertrauen in die Justiz als Voraussetzung für inneren Frieden
272
34 Ethnische Verteilung: Bosnier (~Islam) 44 %,Kroaten (~Katholizismus) 17 %, Serben (~Or-thodoxie) 31 %, vgl. Wolf Oschlies, Das politi-sche System Bosnien-Herzegovinas, in Wolf-gang Ismayr (Hrsg), Die politischen SystemeOsteuropas, Opladen, 2002, S. 701-730, S.704.Die Zahlen beziehen sich auf die Vorkriegs-Zählung 1991. Die heutigen Zahlen sind nichtgenau bekannt, vgl.Glas Srpske, cover pagestory vom 17. Juni 2003. Kriegsopfer 1992-1995: 278.000 Tote und Vermisste (6,37 % derBiH-Vorkriegsbevölkerung, davon mehr als dieHälfte Bosniaken – mehrheitlich Zivilisten –,etwa 35 % Serben (mehrheitlich Armeean-gehörige) und mehr als 10 % Kroaten. Insge-samt wurden 1,37 Millionen Menschen (31,39% der BiH-Vorkriegsbevölkerung) vertrieben.Quelle: Demografska Struktura Republike Bos-ne I Hercegovine – Nacionalna struktura premapopisu iz 1991, siehe http://www.hdmagazine.com/bosnia/census.html
35 Article 41 sentence 2 of the Law on F-HJPCiVm Article IX.11 a of the Constitution OfThe Federation Of Bosnia And Herzegovinaund Article 41 sentence 2 of the Law on RS-HJPC iVm Article 97 of the Constitution OfRepublika Srpska. Zu den ungewollten Aus-wirkungen des Minderheitenschutzes am Bei-spiel des Kosovo siehe Schwarz, Axel, »Com-munities and Minorities in UNMIK’s VirtualWorld of a Multicultural Kosovo«, ZaöRV(Zeitschrift für ausländisches und öffentlichesRecht und Völkerrecht), 2003, 761-778
»Ziel ist, Richter und Staatsanwälte zu eliminieren, die wegen zweifelhafter
Praktiken die Justiz in Verruf brachten.«
26 Article 53 Law on HJPC und jeweils Articles62 Law on F-HJPC und Law on RS-HJPC
27 Article 54 (a) Law on HJPC und jeweils Ar-ticles 63 (a) Law on F-HJPC und Law on RS-HJPC; Näheres bei Schwarz, Axel, »Die Ho-hen Räte der Justiz in Bosnien-Herzegovina(High Judicial and Prosecutorial Councils)«,ZOR (Zeitschrift für Osteuroparecht), 2003,227, 243.
28 Article 54 (c) Law on HJPC und jeweils Ar-ticles 63 (c) Law on F-HJPC und Law on RS-HJPC;
29 Article 54 (e) Law on HJPC und jeweils Ar-ticles 63 (e) Law on F-HJPC und Law on RS-HJPC;
30 Niedergelegt in Article 33 Law on HJPC undjeweils Article 41 Law on F-HJPC/Law onRS-HJPC.
31 Vgl. Article 33 Ziffer 5 Law on HJPC und je-weils Article 41 Ziffer 5 Law on F-HJPC/Lawon RS-HJPC
32 Vgl. Article 33 Ziffer 7 Law on HJPC und je-weils Article 41 Ziffer 7 Law on F-HJPC/Lawon RS-HJPC
33 Die ethnische Verteilung war für richterlichePositionen obligatorisch, für den Bereich derStaatsanwaltschaften erfolgte sie aus überge-ordneten Gründen der Gleichbehandlung. Sie-he dazu Schwarz, Axel/Herges, Jean-Pierre:Institutionalised Ethnicity. The Case of VitalNational Interests in Bosnia and Herzegovina(BiH), Südosteuropa (Zeitschrift für Gegen-wartsforschug), 2003, 555-565.

oder nicht beweisbarer, teilweise anonymerVorwürfe ein, die nicht förmlich verfolgtwurden oder nicht zu verfolgen waren undalles Erdenkliche umfassen konnten.
Eigentums-Problematik
Ethnische Vertreibungen und kriegsbe-dingte Zerstörungen von Wohnraumbrachten eine spezielle Variante eines Kri-teriums hervor, an dem die Gesetzestreueund moralische Integrität der Bewerber ge-messen wurde, die so genannte Eigentum-sproblematik (property issue). Menschen,die ihren Wohnraum verloren hatten, wur-de anderer Wohnraum zugewiesen, derdurch zuvor erfolgte Flucht oder Vertrei-bung der früheren Bewohner leer stand.Hinzu kamen die Fälle, in denen kriegs-und vertreibungsbedingt freigewordenerWohnraum aus anderen Gründen in An-spruch genommen wurde. Durch eigen-tumsrechtliche Regelungen, die selbst fuerInsider ständig bis hin zur Unkenntlichkeitgeändert wurden, suchte man, die früherenBewohner zur Rückkehr zu bewegen undwieder zu ihren Rechten zu verhelfen. Diesentspricht letztlich einem Auftrag der Ver-fassungen des Gesamtstaates36 BiH wiebeider Entitäten, sowohl der FöderationBiH37 wie der Republika Srpska38. AufAntrag wurden die früheren Bewohnerwieder in ihre Wohnungen eingewiesen.Entsprechend erhielten die aktuellen Be-wohner Räumungsaufforderungen, deneninnerhalb bestimmter Fristen Folge zu lei-sten war. Hiergegen gerichteten Rechts-mitteln kam keine aufschiebende Wirkungzu. Gemäß den Ausschreibungsbedingun-gen für die Gerichte und Staatsanwalt-schaften waren die Eigentums- und Woh-nungsverhältnisse von den Bewerbern de-tailliert anzugeben. Überschreitungen derRäumungsfrist, selbst mit Einverständnisder früheren Bewohner, wurden als Zei-chen mangelnder Rechtstreue gewertet undführten zum Ausschluss aus dem Kreis derzu ernennenden Personen,39 völlig unab-hängig von den (auch kumulativ auftreten-den) Gründen des jeweiligen Einzelfalles,wie zum Beispiel � der mündlich oder schriftlich erklärten
Einwilligung des berechtigten früherenBewohners40
� der Unmöglichkeit einer Ersatzbeschaf-fung angemessenen eigenen Wohn-raums, zum Beispiel weil die eigeneWohnung zerstört oder noch von ande-ren Vertriebenen besetzt war
� dem Vorliegen sonstiger ernsthafter,zum Beispiel sozialer Gründe41, aberauch unabhängig davon, dass
� der Verstoß gegen Räumungsfrist oderPflicht zur wahrheitsgemäßen Angabe
der Wohnungsverhältnissen in den Be-werbungen in der Regel, soweit esüberhaupt zu förmlichen Disziplinar-verfahren kam, nicht mit der Entfer-nung aus dem Amt geahndet wurde.
Verdachts-Problematik
Der gesamte Rest an Vorwürfen reichtevon schwerwiegenden strafrechtlich rele-vanten Delikten über alle Stufen und Vari-anten von Pflichtverletzungen bis hin zuBeschwerden von Prozessbeteiligten, die inProzessen nicht obsiegt hatten oder verur-teilt worden waren, und offensichtlichen,meist anonymen Verleumdungen. Alle die-se Vorwürfe waren mangels entsprechen-der Beweismittel entweder nicht nachzu-weisen oder wegen ihrer mehr oder minderunbedeutenden Natur nicht förmlich zuverfolgen. Durch die letzteren, die als häu-figste Variante auftraten, konnte einemKandidaten kaum ein Nachteil entstehen,da solche Vorwürfe nur begrenzt Eingangin die Entscheidungsprozesse fanden. Ganzanders hingegen lagen die Fälle schwer-wiegender, meist in der Öffentlichkeit dis-kutierter Vorwürfe, in denen ethnischeVoreingenommenheit (auch in Form derVerweigerung einer Zusammenarbeit mitVertretern der internationalen Gemein-schaft), politische Beeinflussung, Bestech-lichkeit oder Zusammenarbeit mit krimi-nellen Organisationen vermutet wurden.Hier kann durchaus nicht eine persönlicheVerstrickung der Betroffenen in dem Sinneunterstellt werden, dass bereits aus denVorwürfen heraus auf deren Begründetheitgeschlossen werten könnte. Vielmehr isteher wahrscheinlich, dass der eine oder an-dere Bewerber gezielten Verleumdungsak-tionen ausgesetzt worden ist, um ihn ausder Justiz zu entfernen oder von ihr fern zuhalten. Die davon betroffenen Bewerberhatten kaum eine Chance, ernannt zu wer-den. Der Schlüssel zu dieser im Ergebniswohl nicht zu vermeidenden Folge lag inder Automatik der Justizreform BiHs: Mitder Besetzung der Positionen eines be-stimmten Gerichts oder einer Staatsanwalt-schaft verloren die bisherigen, aber nichtwieder ernannten bisherigen Stelleninhaberihr Amt42, wobei das hiergegen zur Verfü-gung stehende Rechtsmittel43 für die Be-troffenen so ausgestaltet war, dass es in derPraxis wegen Nichtvorliegens der formalenVoraussetzungen so gut wie immer als un-zulässig zurückgewiesen werden musste.
Ansehen der Justiz
Die aufgezeigten, in einzelnen Fällen fürdie Betroffenen bedauerlichen Ergebnisse
der Neuorganisation der Justiz lassen sichnicht mit dem Hinweis auf die persönlicheVerantwortung der Kandidaten rechtferti-gen. Denn möglicherweise haben sie gera-de nicht Anlass zu Zweifeln an ihrer Un-parteilichkeit gegeben und damit einem»bösen Schein« Vorschub geleistet, wasimmerhin einen disziplinarrechtlichen Tat-bestand erfüllen würde44. Vielmehr kannnicht ausgeschlossen werden, dass der eineoder andere Kandidat sich gerade durchseine Unparteilichkeit die Feindschaft ein-flussreicher Feinde zugezogen hatte. Indiesen Fällen musste jedoch das persönli-che Interesse des zu Unrecht einem Ver-dacht ausgesetzten Bewerbers letztlichhinter dem hoch zu veranschlagendenWert des Ansehens der Justiz zurücktreten.Auch mit unbewiesenen oder unbeweisba-ren, aber erheblichen Vorwürfen belasteteRichter und Staatsanwälte würden dasVertrauen der Bevölkerung in Justiz unddamit letztlich in die Gerechtigkeit emp-findlich gefährden. Und ohne Vertrauen ineine unabhängige Justiz kann kein Ge-meinwesen auf Dauer bestehen.
Axel Schwarz und René El Saman, Disziplinierung der Justiz zwischen Gerechtigkeit und Effektivität
VM 5/2004 273
36 Dayton, Annex 4, Article II, Paragraph 5, Ge-samtdarstellung bei Schwarz, Axel, »Die Ver-fassung des Gesamtstaates Bosnien-Herzego-vinas«, Europa-Blätter 2003, 128-133.
37 Article II.A.3 und 4 der F-Verf. Die Verfas-sung der Föderation BiH bezieht explizit auchden Verlust des Eigentums im Zuge ethni-scher Säuberung (ethnic cleansing) ein. Ge-samtdarstellung bei Schwarz, Axel, »Entitätenin Bosnien-Herzegovina. Die Verfassung derFöderation BiH«, Europa-Blätter 2004, er-scheint demnächst.
38 Gesamtdarstellung bei Schwarz, Axel, »Ent-itäten in Bosnien-Herzegovina. Die Verfas-sung der Republika Srpska,« erscheint dem-nächst.
39 Auf der Grundlage eines Memorandum derUnabhängigen Justizkommission (Indepen-dent Judicial Commission – IJC) vom 3. Sep-tember 2004 (Investigation And VerificationDepartment – Guidance On Property Issues).
40 Zu beachten ist, dass dem Rückkehrrecht,dem Anspruch auf Rückgabe und ggf. aufEntschädigung des Eigentums entgegenste-hende Vereinbarungen sowie unter Zwang zu-stande gekommene Erklärungen nichtig sind,vgl. Dayton, Annex 4, Article II, Paragraph 5,auch Article II.A.3 und 4 der F-Verf.
41 Zum Beispiel Schutz der Familie und der Kin-der, Article II.A.2 (1) (j) der F-Verf; Rechtauf Sozialfürsorge, Article II.A.2 (1) (n) derF-Verf; Recht auf Wohnung, Article II.A.2 (1)(q) der F-Verf, wohingegen die Verfassungder Republika Srpska insoweit nur die Unver-letzlichkeit der Wohnung garantiert, Article24 RS-Verf.
42 Jeweils Article 81 Law on F-HJPC/Law onRS-HJPC. Das Gehalt wird dabei für 6 weite-re Monate gezahlt.
43 Jeweils Article 79 paragraph 4 Law on F-HJPC/Law on RS-HJPC
44 Vgl. Article 40 and 41 Law on HJPC und Ar-ticle 49 and 50 Law on F-HJPC/Law on RS-HJPC.

Ergebnisse
Ergebnisse des Fragebogens
Auf eine Ergebnisdarstellung des Fragebo-gens wird an dieser Stelle verzichtet, dadie eigentliche Bewertung durch die Stan-dardformulare erfolgte. Zur Interpretationdes Fragebogens ist jedoch zu sagen, dassdie Streuung um den Mittelwert – mit biszu 26 Skalenpunkten – gezeigt hat, dasshier beträchtliche Unterschiede bei derWahrnehmung und Einschätzung der ein-zelnen Mitarbeiter bestanden haben. Es hatden Anschein, als ob einzelne Mitarbeiterdie Erfüllung der Kriterien und die damitverbundene Qualitätssicherung bei der Be-rufsfeuerwehr sehr viel höher eingeschätzthaben als andere. Diese Diskrepanz kannin zwei unterschiedlichen Sachverhaltenbegründet liegen: � Verschiedene Mitarbeiter setzen unter-
schiedliche Maßstäbe bei der Beurtei-lung hinsichtlich der Erfüllung einesKriteriums. Mit anderen Worten: Wäh-rend ein Mitarbeiter zum Beispiel dievorherrschende Kundenorientierung alszufrieden stellend erachtet, bewertet einanderer diese als nicht ausreichend oder
nicht erfüllt. Demzufolge wäre es wich-tig, einheitliche Normen zu definieren,wann und inwiefern ein Kriterium er-füllt ist.
� Andererseits ist es auch möglich, dassdie Mitarbeiter bei der Beurteilung derErfüllung der Kriterien nicht auf das ge-samte Unternehmen zurückgegriffenhaben, sondern nur ihr eigenes Sachge-biet herangezogen haben. Folglich würde ein unterschiedlicher Grad anQualitätsorientierung in den einzelnenAbteilungen vorliegen.
Welcher der beiden Punkte letztendlich zu-treffend war, konnte aus dem vorliegendenDatenmaterial nicht geschlossen werden.Hierfür wären weitere und tiefgehendereKorrelations- und Regressionsanalysenvonnöten gewesen, auf die in Anbetrachtdes festgelegten Rahmens verzichtet wurde.Unabhängig davon ist die Konsequenz, diesich aus diesen beiden Sachverhalten erge-ben würde, dieselbe. Es ist grundsätzlichein Sensibilisierungs- und Schulungsbedarfim Hinblick auf ein TQM bei den Mitarbei-tern der Berufsfeuerwehr erkennbar.
Ergebnisse der Standardformulare
Die nachfolgenden Bewertungsergebnissemittels der Standardformulare in Bild 12bilden das arithmetische Mittel der prozen-tualen Bewertung für die insgesamt 32Teilkriterien.
Einordnung der Bewertungsergebnisse
Bei einer erstmaligen Selbstbewertungnach dem EFQM-Modell erreicht ein Un-ternehmen – bei einer realistischen Bewer-
tung – selten einen Wert von über 20 Pro-zent.1 Basierend auf dieser Grundannahmekann für die Berufsfeuerwehr konstatiertwerden, dass sie bei einem Bewertungser-gebnis von 17,6 Prozent im vergleichbarenRahmen zu anderen Organisationen undUnternehmen liegt, die sich noch nicht ein-gehend mit einem TQM auseinander ge-setzt und kein QM-System wie zum Bei-spiel die DIN EN ISO 9001 implementierthaben.
Die allgemeinen und organisationsüber-greifenden Ursachen hierfür liegen inner-halb der Befähiger-Kriterien.2 Ein Bewer-tungs- und Überprüfungszyklus (Review-Zyklus) ist in den meisten Fällen nichtvorhanden, eine durchweg systematischeVorgehensweise ist eher die Ausnahme alsdie Regel. Die systematische Identifikationder Schlüsselprozesse ist in den meistenFällen noch nicht erfolgt bzw. kann nichtexplizit mit Zahlen belegt werden.3
Es lassen sich aber auch Gründe inner-halb der Ergebnis-Kriterien finden: Kon-krete Zielvorgaben sind meist nur im Be-reich der finanziellen Kennzahlen vorhan-den. Ein durchgängiges Benchmarking istzumeist nicht vorhanden. Kunden- undMitarbeiterbefragungen mit einem überJahre hinweg positiven Trend sind eben-falls eher die Ausnahme als die Regel.4
Unter diesem Aspekt sollte eine Orga-nisation ihren Fokus bei einer erstmaligenSelbstbewertung nicht vorrangig auf diePunktbewertung richten, sondern sich viel-mehr auf die tatsächlichen Stärken undherausgearbeiteten Verbesserungspoten-ziale konzentrieren.5
Die Selbstbewertung nach dem EFQM-ModellDie methodische Vorgehensweise dargestellt am Beispiel der
Berufsfeuerwehr Bochum
(Teil 3 und Schluss)von Michael Trick
Die Berufsfeuerwehr Bochum hat sich zum Ziel gesetzt, die Qua-lität ihrer Leistungserbringung nachhaltig zu erhöhen. Um diesesZiel zu erreichen, wurde als Grundlage für die Einführung einesQualitätsmanagement-Systems eine Selbstbewertung nach demEFQM-Modell in Form eines Pilotprojektes für den Bereich desRettungsdienstes vorgenommen.
Diplom-Sportwissen-schaftler Michael Trick,Kelheim.
Qualitätsmanagement ist auch im Gesundheitswesen sinnvoll und möglich
274 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 274-278
1 Vgl. EFQM 1999e, 32.2 Vgl. Zink et al. 1998, 17.3 Vgl. Zink 1997, 122. Zink geht davon aus,
dass durch das Fehlen dieser Zahlen und derunzureichenden Auseinandersetzung mit denKernprozessen – im Allgemeinen und speziellbei einer erstmaligen Punktbewertung – einErgebnis von »kaum mehr als 300 Punkten er-reicht wird« (1997, 122). Ähnlich auch Zinket al. (1998, 17).
4 Vgl. Zink et al. 1998, 17.5 Ebenda, 17.

Wenn man trotz dieser allgemeinen Be-wertungsproblematik die einzelnen Kriteri-en sowie die Punkteverteilung dezidiert imVergleich zueinander betrachtet, fällt auf,dass die Kriterien 2 »Politik und Strategie«und 4 »Partnerschaften und Ressourcen«mit einem Bewertungsergebnis von 21,4bzw. 21,6 Punkten in einem engen Zusam-menhang stehen. Dieser Zusammenhangbasiert darauf, dass sich auf Grund derStrategieformulierung bei der Berufsfeuer-wehr Konsequenzen für die »Partnerschaf-ten und Ressourcen« ergeben. Gründedafür sind zum Beispiel die Erstellung derRettungsdienstleitung in Kooperation mitden strategischen Partnern. Auch wird dieEinbindung der Krankenkassen und derKrankenhäuser (gemäß RettG-NRW) in-nerhalb dieser Kriterien feststellbar.
Allerdings lässt das Kriterium 1 »Füh-rung« mit einem Gesamtergebnis von16,75 Punkten eine Reduzierung von knapp5 Punkten im Vergleich zu den oben ge-nannten Kriterien erkennen. Es wäre nach-vollziehbarer gewesen, einen deutlicherenZusammenhang zwischen Kriterium 1»Führung« und Kriterium 2 »Politik undStrategie« vorzufinden. Für diesen Bewer-tungsunterschied sind nicht zuletzt die feh-lende Mitarbeiterorientierung und fehlendeVorbildfunktion der Führungskräfte verant-wortlich.
Der Unterschied von 5,5 Punkten zwi-schen dem Kriterium 3 »Mitarbeiter« unddem Kriterium 7 »Mitarbeiterbezogene Er-gebnisse« erklärt sich unter anderem durchfolgenden Sachverhalt: Die Berufsfeuer-wehr hat in den letzten Jahren zahlreicheBefragungen sowie eine Führungskräftebe-urteilung durchgeführt, das heißt Metho-den und Instrumente zur Ermittlung derMitarbeiterzufriedenheit sind bei der Be-rufsfeuerwehr vorhanden (das RADAR-Prinzip berücksichtigt bei den Ergebnis-Kriterien speziell auch den Umfang der erhobenen Daten). Jedoch sind innerhalbdes Kriteriums 3 »Mitarbeiter« konkreteHandlungsmaßnahmen auf Grund der Er-gebnisse nur in Ansätzen erkennbar.
Bei der Betrachtung des Kriteriums 6»Kundenbezogene Ergebnisse« und desKriteriums 8 »Gesellschaftsbezogene Er-gebnisse« (als komplementäre Teile desRettungsdienstes) wird ein Bewertungsun-terschied von 5 Punkten deutlich. Dieserwäre eigentlich in Anbetracht der Über-schneidungstendenzen zwischen Gesell-schafts- und Kundenorientierung bei derRettungsdienstleistung nicht zu erwartengewesen. Diese Diskrepanz liegt in der un-terschiedlichen Fragestellung des EFQM-Modells begründet. Innerhalb des Kriteri-ums 8 werden zum Beispiel Aspekte desUmweltschutzes geprüft und der Auftritt
bzw. das Erscheinen in den Medien behan-delt. Aufgefallen ist speziell bei Kriterium8, dass im Bereich der Gesellschaftsorien-tierung eine Kontinuität und Systematikfehlt. Die Auswertungen der Medienbe-richte und die Öffentlichkeitsarbeit werdenzum Beispiel nicht ausreichend deutlich.Auch die Außendarstellung der Berufsfeu-erwehr im Präventivbereich des Rettungs-dienstes ist nicht eindeutig erkennbar.
Deutlich aus dem Rahmen fällt das Kri-terium 5 »Prozesse« mit einem Ergebnisvon neun Punkten. Dies lässt sich zum ei-nen durch die in sämtlichen Bereichen feh-lende Prozessorientierung begründen. Zumanderen ist dies darauf zurückzuführen,dass der geringe Wert die Konsequenz ausden Rahmenbedingungen einer Berufsfeu-erwehr als Teil der Stadtverwaltung dar-stellt (zum Beispiel Begrenzungen durchdas Haushaltsrecht und die bürokratischeStruktur).
Dagegen stellt die hohe Bewertung der»Schlüsselergebnisse« mit 27,5 Punkteneine Folge der Rahmenbedingungen einerBerufsfeuerwehr dar: Die Genehmigungdes Haushaltes der Berufsfeuerwehr erfolgtim Rahmen der allgemeinen Haushaltkon-solidierung für die gesamte Stadtverwaltungdurch den Rat der Stadt (als politische In-stanz). Auch die Rechnungslegungspflichtgegenüber der Stadtverwaltung muss hier-bei berücksichtigt werden. Zudem sind beider Ausarbeitung des Rettungsdienstbe-darfsplanes 2002-2006 die Krankenkassenals Kontrollinstrument (gemäß § 14 RettG-NRW) eingesetzt, deren Interesse darin be-steht, mit einem Minimum an Aufwand diegesetzlich definierten Schutzziele zu erfül-len. Schließlich konnte durch die Reduzie-rung von ursprünglich fünf auf drei Wachenein positiver Trend aufgezeigt werden unddie Kostenpauschalen im Rettungsdienstgesenkt werden.
Aufgefallen ist bei sämtlichen »Befähi-ger-Kriterien«, dass eine deutliche Reduk-
tion des Gesamtergebnisses darauf zurück-zuführen ist, dass explizit das Bewertungs-element »Bewertung und Überprüfung«bei der Berufsfeuerwehr schwach ausge-prägt vorhanden ist. Dies deckt sich inweiten Teilen mit den allgemeinen Grün-den für eine reduzierte Punktbewertung.6
Prüfung der Arbeitshypothesen
Die derzeitige Situation bei der Berufsfeu-erwehr Bochum ist im Hinblick auf diePersonalführung verbesserungsbedürftig.Kommunikation und Zuständigkeiten sindzurzeit nicht optimal und ablaufsicher ent-wickelt. Dadurch entstehen Missverständ-nisse, Verzögerungen und Doppelarbeit.Dies führt zu:� Unzufriedenheit der Mitarbeiter� mangelnder Prozessqualität� mangelnder Ergebnisqualität.Die ersten drei Arbeitshypothesen konntendurch die vorgenommene Qualitätsdarle-gung anhand der Standardformulare be-stätigt werden. Dagegen konnte (unter an-derem auf Grund der Schwierigkeiten derPunktbewertungsmethode) nicht ermitteltwerden, dass die derzeitige Situation beider Berufsfeuerwehr auch zu einer man-gelnden Ergebnisqualität geführt hat.
Hervorgerufen durch den explorativenCharakter der Untersuchung konnten dieArbeitshypothesen zwangsläufig keineKorrelation aufweisen, da sie als Vorver-such mit dem Zweck der Generierung vonHypothesen eingesetzt wurden. Zudemließ die eingeschränkte Datenmenge beider Auswertung des Fragebogens keineempirische Überprüfung der Arbeitshypo-thesen zu. Zur Bewältigung dieser Proble-me sollen die gewonnenen Erkenntnisse
Michael Trick, Die Selbstbewertung nach dem EFQM-Modell
VM 5/2004 275
6 Vgl. hierzu auch Kapitel »Das RADAR-Prinzip«.
Bild 12: Die Zusammenfassung der Bewertung anhand der Standardformulare

im nächsten Schritt einer breit angelegtenquantitativen Untersuchung zugeführt wer-den, aus der sich statistische Aussagen mitgrößerer Exaktheit ableiten lassen.
Die Untersuchung nach dem EFQM-Modell legt jedoch den Verdacht nahe, dassein Zusammenhang zwischen der schlech-ten Prozessqualität bei der Berufsfeuerwehrund der eingeschränkten Mitarbeiterorien-tierung besteht. Dies kommt speziell bei ei-ner differenzierten Betrachtung der einzel-nen Unterkriterien innerhalb der Kriterien 1»Führung«, 3 »Mitarbeiter« sowie 5 »Pro-zesse« und 7 »Mitarbeiterbezogene Ergeb-nisse« zum Vorschein.
Untersuchungsschwierigkeiten
Anwendungsschwierigkeiten des Fragebo-gens: � Beim Einsatz des Fragebogens ist auf-
gefallen, dass es durch die hohe Stan-dardisierung des Fragebogens und diesehr verdichtete Datenmenge wenig ef-
fektiv ist, eine Einzelbeurteilung durchdie Mitarbeiter durchzuführen. Es er-scheint mit Sicherheit sinnvoller, denFragebogen zum Beispiel in einer mo-derierten Gruppe in Teamarbeit bear-beiten zu lassen. Anschließend darankönnen die unterschiedlichen Bewer-tungsergebnisse in einem Konsenstref-fen beurteilt werden.
� Eine weitere Grundproblematik desFragebogens ist, dass sich aus der Be-antwortung der Fragen keine explizitenHandlungsmaßnahmen ergeben, son-dern nur Tendenzen dazu aufgezeigtwerden können, in welchen Bereichennach Einsschätzung der MitarbeiterSchwächen vorliegen.
Als Konsequenz daraus lässt sich festhal-ten, dass der Fragebogen als alleinige Me-thode der Selbstbewertung – zumindest beieiner Einzelbearbeitung durch die Mitar-beiter – grundsätzlich nicht zu empfehlenist. Der Zweck, das EFQM-Modell unddessen Vorgehensweise zu skizzieren,konnte damit jedoch sichergestellt werden.
Evaluationsschwierigkeiten bei der An-wendung der Standardformulare:
� Ein Hauptkritikpunkt bei der Anwen-dung des EFQM-Modells war, dass in-nerhalb der jeweiligen Unterkriterienund der Ansatzpunkte zahlreiche Über-schneidungen und Doppelungen existie-ren (zum Beispiel im Bereich der Perso-nalführung und Mitarbeiterorientie-rung). Diese haben folglich ihren Nie-derschlag in den Standardformularengefunden. Die wechselseitigen Bezie-hungen zwischen den Kriterien zeigenWunderer et al. zwar als einen integra-len Ansatz des Modells auf.7 Sie er-schwerten jedoch das Bemühen, eineklare Abgrenzung der Evaluationskrite-rien bei der Berufsfeuerwehr vorzuneh-men.
� Kritisch zu hinterfragen, ist die strikteTrennung zwischen Kunden- und Ge-sellschaftsorientierung bei der Anwen-dung des EFQM-Modells im Rettungs-dienst. Sinnvoller wäre es vielleicht,beide Kriterien zusammenzufassen.Dieser Problematik wurde bei der Be-rufsfeuerwehr insofern begegnet, dass
die sog. »Kunden« – also die Patienten– innerhalb des Kriteriums 6 »Kunden-bezogene Ergebnisse« berücksichtigtund die Außenorientierung und Präven-tion im Rettungsdienst innerhalb desKriteriums 8 »GesellschaftsbezogeneErgebnisse« abgehandelt wurden.
� Die Problematik innerhalb des Datener-hebungsprozesses bestand darin zu vermeiden, dass die zusätzlich durchge-führten Interviews zu einer Art »Befind-lichkeitsmessung« des Einzelnen wur-den, damit sie nicht als subjektiveEinschätzungen in die Untersuchungeingingen. Die Unterkriterien solltenvielmehr durch Fakten und Dokumenta-tionen nachgewiesen werden. Obwohldie Nachweise in einigen Bereichen –wie zum Beispiel der Unternehmenskul-tur und Anreizgestaltung – schwer zuerbringen waren, lässt die Einheitlich-keit der Aussagen der Mitarbeiter aufunverzerrte Ergebnisse schließen.
Einen wichtigen Punkt, den es bei derPunktbewertung mit der RADAR-Bewer-tungsmatrix zu beachten galt, sind die kon-stitutiven Elemente und zugleich limitie-
renden Faktoren der Berufsfeuerwehr (wieetwa Gewinnbeschränkung, der hohe For-malisierungsgrad und Bürokratieaufwandeiner Stadtverwaltung – mit den einge-schränkten Anreizstrukturen, das Haus-haltsrecht mit der Verdingungsordnung fürLeistung). Auf Grund des eingeschränktenGestaltungsspielraums mussten bei derAnwendung des EFQM-Modells bei derBerufsfeuerwehr einige wichtige Aspekteberücksichtigt werden:
Hervorgerufen durch die (zwangsläufig)fehlenden Leistungsnachweise führte diesbei der Punktbewertung innerhalb der Kri-terien 2 »Politik und Strategie« und 4»Partnerschaften und Ressourcen« sowiespeziell bei dem Kriterium 5 »Prozesse« zueinem deutlich herabgesetzten Wert. Ausden Schwierigkeiten des Beamtenstatus mitden (teilweise) fehlenden Anreizstrukturenresultierte eine ebenfalls reduzierte Punkt-bewertung im Bereich der Kriterien 1»Führung« und 3 »Mitarbeiter«. Hierdurchwird folglich ein Benchmarking bei derPunktbewertung mit anderen Organisatio-nen außerhalb der Verwaltungsebene er-schwert.
Bei der Anwendung des EFQM-Mo-dells in öffentlichen Verwaltungen bzw. inOrganisationen im Gesundheitswesen be-steht noch ein großer Nachholbedarf. Spe-ziell im Bereich der jeweiligen Ansatz-punkte bei den oben genannten Kriterien,wie aber auch bei den »Schlüsselleistun-gen« muss von der EFQM noch erheblicheAnpassungs- und Ergänzungsarbeit gelei-stet werden.8
Resümee
Bei der Selbstbewertung nach dem EFQM-Modell hat sich eine Vielzahl von Verbes-serungspotenzialen und Stärken herausge-bildet. Die zentralen Themen stellen sichwie folgt dar:
Die Berufsfeuerwehr hat sich den Her-ausforderungen der Zukunft gestellt undihre Organisationsstruktur auf den speziel-len Dienstleistungscharakter der Berufsfeu-erwehr und der Stadtverwaltung im Allge-meinen angepasst. Die Politik und Strategiesind innerhalb des Rettungsdienstbedarfs-planes klar gekennzeichnet. Darin enthal-ten sind die wichtigsten Ziele, die mittel-und langfristig (zum Beispiel Kostenein-
Qualitätsmanagement ist auch im Gesundheitswesen sinnvoll und möglich
276
7 Wunderer 1997, 208.8 Vgl. Wunderer et al. 1997, 14cff. Wunderer et
al. konstatieren, dass das Modell noch zu all-gemein formuliert ist und es notwendig seinwird, aufbauend auf das Grundgerüst spezifi-sche Kriterien, Gewichtungen und Punkte fürdie jeweilige Branche zu erarbeiten (1997,180).
»Bei der Anwendung des EFQM-Modells imGesundheitswesen besteht noch ein großer
Nachholbedarf, es muss aber auch noch erhebliche Anpassungs- und
Ergänzungsarbeit geleistet werden.«

sparung durch die Einstellung von Ange-stellten im Rettungsdienst) erreicht werdensollen. Unterstützt werden diese Zielformu-lierungen unter anderem durch das Bench-marking, den ÄLRD, die Zufriedenheits-messungen der Mitarbeiter, die Dienstbe-sprechungen sowie durch Arbeitskreise undKooperationen mit strategischen Partnern.
Ein System zur Ergebnisüberwachungund Zielvereinbarung wurde in Form einesneuen Berichtswesen eingeführt. Darüberhinaus wurden weitere Kennzahlen ent-wickelt, um die Ergebnisqualität messbarzu machen und die Wirksamkeit und Wirt-schaftlichkeit der eingesetzten Ressourcenzu steigern. Bei diesen Indikatoren gibt esfestgelegte interne Ziele, welche die Be-rufsfeuerwehr in vielen Bereichen erreicht.Die Budgetverwaltung und -einhaltung hin-terlässt einen soliden und gut kontrolliertenEindruck. Unterstützt wird dieser Eindruckdurch gute finanzielle Leistungen bei denErgebnis-Kriterien. In Teilbereichen derErgebnis-Kriterien ist ein positiver Trendfeststellbar. Auch der Krankenstand derMitarbeiter ist im Vergleich zu anderen Be-rufsfeuerwehren relativ niedrig.
Das Verständnis für ein TQM ist insämtlichen Bereichen der Berufsfeuerwehrnicht ausgeprägt, so dass initiativ einegrundlegende Sensibilisierung und Schu-lung der Mitarbeiter notwendig erscheint.
Es fehlt gegenwärtig ein Prozessmana-gement, das die bereits existierenden Kon-zepte zur Qualitätssicherung sowie alleTeilaspekte in einem Gesamtsystem ver-knüpft und integriert.
Entsprechend dokumentierte Verfah-rens- und Arbeitsabläufe im Sinne einesTQM-Systems sind nur in Ansätzen vor-handen. Ein Qualitätszirkel, der als einzentraler Bestandteil eines TQM Schwach-stellen und Probleme analysiert und ent-sprechende Vorschläge einbringt, ist eben-falls nicht implementiert.
Die Verbindung zwischen der Politikund Strategie der Berufsfeuerwehr unddem Qualitätsgedanken sollte nachdrückli-cher herausgearbeitet werden; unterstüt-zend kann dabei die Entwicklung einesLeitbildes zur besseren Identifikation so-wohl nach innen als auch nach außen wir-ken. Das Leitbild zeigt die Vision einerneuen Unternehmenskultur auf und erläu-tert, wie die Berufsfeuerwehr durch eineneue Form der Zusammenarbeit die Zu-kunft angehen will. Es beschreibt die An-forderungen an die Mitarbeiter undFührungskräfte und gibt damit die Orien-tierung für ein Umdenken in RichtungQualität vor.
Der Aspekt der Mitarbeiterorientierungund -beteiligung ist eine der Schwachstel-len bei der Berufsfeuerwehr. Es existiert in
der Realität eine Diskrepanz zwischen demBewusstsein und der Umsetzung von ge-eigneten Maßnahmen. Auf Grund der Re-levanz der Mitarbeiterbeteiligung sollteder Erarbeitung von konkreten Handlungs-maßnahmen in diesem Bereich eine ent-scheidende Priorität eingeräumt werden.Denn es existieren unverkennbare Visio-nen von Seiten der Branddirektion, aller-dings werden diese den Mitarbeitern – vorallem jenen des mittleren Dienstes – aufGrund der eingeschränkten Kommunikati-ons- und Informationspolitik nicht transpa-rent dargestellt.
Es werden bei der Berufsfeuerwehr bisdato wenig externe Messergebnisse (wiebeispielsweise eine Kundenbefragung) er-hoben, die die Außenwirkung und Kunde-norientierung sichtbar machen. Auch inter-ne Ergebnismessungen, die das Image, dieLoyalität und die Qualität der Dienstlei-stung wahrnehmbar machen könnten, wer-
den nur ansatzweise durchgeführt. Inner-halb des Verwaltungsbereichs fehlt nocheine Reihe an Leistungsindikatoren für denRettungsdienst. Beispielhaft seien die Ko-sten- und Aufwandsstruktur der Produkteund des Budgets genannt.
Abschließend betrachtet, lässt sich fest-halten, dass die Selbstbewertung nach demEFQM-Modell nachweisbare Verbesse-rungspotenziale aufgezeigt hat. Des Weite-ren wurden die bestehenden Stärken derBerufsfeuerwehr herausgearbeitet. Dennzur Erhöhung der Qualität der Leistungser-bringung ist es notwendig, sowohl vorhan-dene Stärken auszubauen als auch aufge-deckte Schwachstellen in ihrem weiterenVerlauf abzustellen.
Die durchgeführte qualitätsorientierteEvaluation bietet damit einen wirksamenOrientierungsrahmen, mit dem die Lei-stungsfähigkeit der Berufsfeuerwehr weiterausgebaut werden kann. Auf Grund derKomplexität einer Organisation wie der Be-rufsfeuerwehr ist eine vollständige Erfas-sung der Realität (des Ist-Zustandes) an-hand des EFQM-Modells jedoch nicht er-reichbar. Die vorgenommene Untersuchunghat jedoch aufgezeigt, dass das Modell alsVorgehensheuristik bei der Auseinanderset-zung mit einer umfassenden Qualität alsZwischenstufe für die Entwicklung und zurÜberprüfung einen idealen Rahmen liefert.Damit stellt das Modell ein integrativesEvaluations- und Steuerungsinstrument dar,
das Lücken aufzeigt und vorhandene ange-wandte Verfahren und Instrumente in einemweiteren Zusammenhang fördert bzw. dannauch fordert.9
Trotz der aufgetretenen Schwierigkei-ten bei der Punktbewertung verdeutlichtdiese ebenfalls, dass sich die Berufsfeuer-wehr erst am Anfang des Weges zumTQM befindet. Bei einer erneuten Selbst-bewertung lässt sich die Punktbewertungals Soll-Ist-Vergleich heranziehen, um Än-derungen besser messbar und quantifizier-bar zu machen. Zugleich ist anhand derPunktbewertung ein Benchmarking mit öf-fentlichen Verwaltungen möglich.
Allerdings ist der erstellte Qualitätsbe-richt allein noch kein hinreichendes Argu-ment für die systematische Auseinander-setzung mit einem TQM-System bei derBerufsfeuerwehr. Dies kann sich erst ausder konsequenten und erfolgreichen Um-setzung der selbst definierten Ziele bzw.
aus der sorgfältigen Analyse der Verbesse-rungspotenziale ergeben. Es sollte aberdeutlich zum Ausdruck gebracht werden,dass bei der Realisation von Handlungs-maßnahmen nicht sämtliche Verbesse-rungspotenziale in dem Maße bei der Be-rufsfeuerwehr berücksichtigt werden kön-nen, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Dennaufbauend auf einer Prioritätenliste exi-stiert mit Sicherheit eine Vielzahl von auf-gezeigten Schwächen, deren Beseitigungauf Grund von Mittelknappheit und ande-rer (politischer) Widerstände von vor-neherein zum Scheitern verurteilt ist.
Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse
Die bei der Selbstbewertung aufgetretenenÜberschneidungen mit anderen Aufgaben-gebieten der Berufsfeuerwehr, insbesonde-re im Bereich der Kunden- und Gesell-schaftsorientierung sowie im Bereich derPersonalführung und Mitarbeiterorientie-rung (auf Grund der Doppelfunktion derMitarbeiter), unterstreichen den ganzheitli-chen Charakter des EFQM-Modells undzeigen Ansätze für ein TQM-System beider gesamten Berufsfeuerwehr auf.
Ergänzt wurde die Selbstbewertungdurch eine erweiterte Form der Stärkenbe-
Michael Trick, Die Selbstbewertung nach dem EFQM-Modell
VM 5/2004 277
»Wer nur an die Kosten denkt, senkt die Qualität. Wer Qualität erreicht, senkt die Ko-sten.«
9 Vgl. Wunderer et al. 1997, 45.

trachtung; sie beinhaltet neben den vorhan-denen Stärken auch die formalen Rahmen-bedingungen der Berufsfeuerwehr, so dassaufbauend auf dieser Darstellung ein QM-Handbuch erstellt werden kann. (Ein ent-sprechendes Konzept liegt im Abschluss-bericht vor.)
Die zentralen Themen der Selbstbewer-tung wurden den Mitarbeitern bei einerAbschlusspräsentation vorgestellt. Hand-lungsempfehlungen wurden aufgezeigt.Beispielhaft sei die Durchführung und Fi-nanzierung eines öffentlichkeitswirksamen»Laien-Frühdefibrillationsprojektes« ge-nannt; das Problem der Finanzierbarkeitsoll hierbei über Partner- und Sponsoren-suche gelöst werden. (Das Konzept undder Musterentwurf einer Sponsorenmappewurden vom Verfasser erstellt.)
Im nächsten Schritt wird durch Festle-gung der Qualitätsziele der angestrebteSollzustand definiert. Anschließend wer-den die erforderlichen Maßnahmen in ei-nem Aktionsplan festgelegt (Wer machtwas und bis wann?). Gemeinsam werdenSchwachstellen beseitigt und Verbesserun-gen vorgenommen. Die optimierten be-trieblichen Verfahren und Abläufe werdenin einem QM-Handbuch zusammengefasstund in der Praxis angewandt. In der Folge-zeit müssen die eingeführten Verfahrenund Regelungen regelmäßig auf Zweck-mäßigkeit und Wirksamkeit geprüft undgegebenenfalls nachgebessert werden.
Damit ein TQM-System keine Moment-aufnahme bleibt, sondern die Bewegung inder Organisation erkennen lässt, sind alleSchritte immer wieder durchzuführen, umden einmal erreichten Vorsprung zu haltenund weiter auszubauen. Die Selbstbewer-tung steht damit am Anfang eines Prozes-ses der kontinuierlichen Verbesserung beider Berufsfeuerwehr.
Ausblick
»Es gibt keine günstigen Winde für jene,die nicht wissen, wohin sie segeln wollen.«
Seneca
Der erste Mosaikstein und die Grundvor-aussetzung für ein TQM-System wurdenmit der vorgenommenen Selbstbewertunggelegt. Als nächster Handlungsschritt undlogische Konsequenz daraus ist es nun-mehr von Bedeutung, diese Konzepte undMethoden systematisch in die Praxis um-zusetzen, um die Leistungsfähigkeit derBerufsfeuerwehr fortwährend auszubauen.
Von zentraler Bedeutung für die erfolg-reiche Implementierung eines TQM-Systems bei der Berufsfeuerwehr ist dieErarbeitung eines Systems mit individuel-ler Zielsetzung, welches auf der dargestell-
ten Theorie und den Referenzmodellen ba-siert. Denn Aufbau und Umfang eines ent-sprechenden Systems hängen wesentlichvon der Unternehmenskultur, den organi-satorischen Abläufen, dem Leistungsspek-trum sowie von in- und externen Rahmen-bedingungen ab.
Am Anfang steht damit die Entschei-dung der Amtsleitung, ein TQM-Systemeinzurichten und entsprechende Ressour-cen zur Verfügung zu stellen. Dies sindvor allem Personalressourcen für Mitarbei-ter, die in Qualitätszirkeln und Projekt-gruppen mitarbeiten; finanzielle Mittelwerden für die Schulung der Mitarbeiterund für externe Beratung benötigt. Dassdie Einführung eines solchen Systems Ko-sten verursacht, steht außer Frage. Diezahlreichen Erfolgsbeispiele aus der freienWirtschaft mit der nachgewiesenen (mit-telfristigen) Amortisation und den entspre-chenden Rentabilitätspotenzialen (analogdazu bei der Berufsfeuerwehr: Effizienz-potenzialen10) zeigen deutlich auf, dass einParadigmenwechsel stattfinden muss:
Wer nur an die Kosten denkt, senkt dieQualität. Wer Qualität erreicht, senkt dieKosten.11
Die Gefahr, die dabei besteht, ist, dassTQM nur zum Zwecke der Kostendämp-fung instrumentalisiert wird; es mussprimär auf die medizinische Effektivitätund Effizienz ausgerichtet werden und hatdann sekundär Auswirkungen auf dieWirtschaftlichkeit der Leistungserstellung.Neben den wirtschaftlichen Vorteilen soll-ten vor allem ethische Grundlagen und dasWohl des Patienten im Mittelpunkt der Be-trachtung bleiben.
Systematisch umgesetztes TQM dientdemnach der Verbesserung der Versor-gungsqualität und des Geschäftserfolgeseiner Organisation wie der Berufsfeuer-wehr. Wenn man die allgemeinen Gründefür ein TQM im Rettungsdienst zusammenmit der wachsenden Notwendigkeit vonBinnenreformen innerhalb der Verwaltung(Finanzkrise des Staates) betrachtet, ergibtsich spätestens an dieser Stelle ein ent-scheidender Handlungsbedarf. Als Konse-quenz daraus ergibt sich, dass die Konzep-te zur Implementierung eines TQM-Systems bei der Berufsfeuerwehr einersorgfältigen Bewertung und Betrachtungunterzogen werden sollten, bevor sie als illusionär und nicht realisierbar zurückge-stellt werden.
Literatur
Ahnefeld, F. W./Hennes, P. (2001): Qualitätsm-anagement im Rettungsdienst – Lippenbekennt-nis versus Realität. Notfall und Rettungsmedi-zin, 4 (3), 196-198.
Bleicher, K. (1991): Organisation, Strategien,Strukturen, Kulturen. Wiesbaden.
Brede, H. (2001): Grundzüge der öffentlichenBetriebswirtschaftslehre. München.
Brinkmann, H. (2002): Ist Wohlfahrt drin, woWohlfahrt drauf steht? Eine ökonomische Ana-lyse des deutschen Marktes für Rettungsdienst-leistungen. Edewecht.
Bundesärztekammer (Hrsg.) (1997): LeitfadenQualitätsmanagement im deutschen Kranken-haus. Germering/München.
Diederich, H. (1989): Öffentliche Unterneh-men. In: Chmielewicz, H./Eichhorn, P. (Hrsg.):Handwörterbuch der öffentlichen Betriebswirt-schaft. Stuttgart, 1856-1867.
EFQM (Hrsg.) (1998): Excellence bewerten –Eine praktische Anleitung zur Selbstbewertung.Brüssel.
EFQM (Hrsg.) (1999a): Die acht Eckpfeiler derExcellence. Brüssel.
EFQM (Hrsg.) (1999b): Das EFQM-Modell fürExcellence. Brüssel.
EFQM (Hrsg.) (1999c): Eine Fragebogen-Me-thode. Brüssel.
EFQM (Hrsg.) (2000): Spektrum – Modellbe-wertungsbuch. Brüssel.
Frehr, H. U. (1994): Total Quality Management– Unternehmensweite Qualitätsverbesserung –Ein Praxisleitfaden für Führungskräfte (2.Aufl.). München/Wien.
Knieps, G. (2001): Wirtschaftspolitik – Übung2 Wohlfahrtsökonomie I: Grundlagen. Zugriffam 07.09.2003 unter http://www.vwl.uni-frei-burg.de/fakultaet/vw/0102GruWiueb2.pdf
Moecke, H. P./Ahnefeld, F. W. (1997): Qua-litätsmanagement in der Notfallmedizin. Ana-esthesist, 46 (9), 787-800.
Pinter, E./Swart E./Vitt, D. (1996): Umfassen-des Qualitätsmanagement für das Krankenhaus.Frankfurt.
Richter, M. (1999): Personalführung im Qua-litätsmanagement. München.
Schmiedel, R./Betzler, E. (1999): ÖkonomischeRahmenbedingungen im Rettungsdienst – TeilIII – Finanzierungsstruktur im Rettungsdienst.Notfall und Rettungsmedizin, 2, (3), 171-174.
Wunderer, R./Gerig, V./Hauser, R. (Hrsg.)(1997): Qualitätsorientiertes Personalmanage-ment – Das europäisches Qualitätsmanagementals unternehmerische Herausforderung. Mün-chen/Wien.
Zink, K. J. (1997): Erfahrungen bei der Imple-mentierung des EFQM-Modells. In: Wunderer,R./Gerig, V./Hauser, R. (Hrsg.): Qualitätsorien-tiertes Personalmanagement – Das EuropäischeQualitätsmodell als unternehmerische Heraus-forderung. München/Wien, 119-134.
Zink, K. J./Schmidt, A./Bäuerle, T. (1998): Er-gebnisbericht: Ganzheitliche Unternehmensbe-wertung – Analyse der Wettbewerbsfähigkeit vonOrganisationen. Zugriff am 06.06.2003 unterhttp://w4.siemens.de/zt_pp/ergebnis/b_s6_1a.html
Qualitätsmanagement ist auch im Gesundheitswesen sinnvoll und möglich
278
10 Denn Rentabilität kann teilweise und Gewinndarf in der Regel nicht erreicht werden. Diekonstitutiven Elemente eines Amtes sind hierdie limitierenden Faktoren.
11 Vgl. Bundesärztekammer 1997, 33.

Carl Bertelsmann-Preis 2004
Der mit 150.000 Euro dotierte Carl Bertelsmann-Preis 2004 gehtan Århus Amt (Dänemark). Neben dem Kreis Aarhus waren dreiweitere moderne Verwaltungen nominiert: das Bundesverwal-tungsamt (BVA); die Regulierungsbehörde für Telekommunikati-on und Post (RegTP) sowie der UK Passport Service (UKPS). DieNominierung war das Ergebnis einer europaweiten Recherche. Ge-meinsam mit der Unternehmensberatung Booz Allen Hamiltonhatte die Bertelsmann Stiftung 41 Organisationen nach Kriterienwie Zielorientierung, Werte, Kunden- und Mitarbeiterorientierung,Führungsverhalten und Reformfähigkeit beurteilt. In einem Festaktin der Gütersloher Stadthalle nahm Kreisbürgermeister JohannesFlensted-Jensen die Ehrung von Liz Mohn, stellvertretende Präsi-diumsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, entgegen.
Århus Amt ist für die Versorgung von 640.000 Einwohnern mithauptsächlich kommunalen Dienstleistungen zuständig. Dazugehören die Bereiche Gesundheit, Erziehung und Bildung, Sozia-les, Kultur, Wirtschaftsförderung und Tourismus. Rund 21.000Mitarbeiter orientieren sich an einem Wertesystem, das auf Trans-parenz, Respekt und Reformbereitschaft gründet. Zentrales Steue-rungselement ist der Leistungsvergleich, sowohl innerhalb der Ge-schäftsbereiche als auch mit anderen Kreisen.
Die Ergebnisse der Recherche zeigen, dass viele Verwaltungenzu Reformen bereit sind und ihre eigene Modernisierung konse-quent vorantreiben. Viele haben erfolgreich moderne Steuerungs-elemente wie Leistungsvergleiche, Kosten- und Leistungsrech-nung, Controlling, dezentrale Budgetverantwortung und strategi-sches Personalmanagement eingeführt. Handlungsbedarf zeigt sichnoch in den Bereichen Organisationskultur und Werteorientierung.Diese sind häufig nicht ausreichend umgesetzt. Insgesamt lassendie Ergebnisse darauf schließen, dass die Organisationen meistzunächst im Kontakt zu den Kunden – das heißt Bürgern und Wirt-schaft – wahrnehmbare Veränderungen angestrebt haben. Erst da-nach konzentrieren sie sich auf die Mitarbeiter.
Weitere Informationen: Julia Schormann, Telefon: (05241) 81-81495. Eine Studie zu den Rechercheergebnissen finden Sie unterwww.carl-bertelsmann-preis.de.
Vorschriftendienst Baden-Württemberg
Immer mehr Mitglieder der kommunalen Landesverbände führenden elektronischen Vorschriftendienst in ihrer Verwaltung ein.VD-BW bietet mehr als 4.000 wöchentlich aktualisierte Vorschrif-ten aus Landes- und Bundesrecht. Im Verkündungsdienst sind ta-gesaktuell die Gesetz- und Verkündungsblätter aus Baden-Würt-temberg und das Bundesgesetzblatt verfügbar. In VENSA, der ver-fassungs- und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungssammlung,sind mehr als 11.200 Entscheidungen eingestellt. Das Angebot istseit dem Jahr 2000 online. Der VD-BW ist ein gemeinsames Un-ternehmen des Staatsanzeiger-Verlags und des Boorberg Verlags.
Weitere Informationen und Testzugänge: VorschriftendienstBaden-Württemberg GmbH (VD-BW), Breitscheidstraße 69,70176 Stuttgart, Telefon: (0711) 66601-73, E-Mail: [email protected], Internet: www.vd-bw.de.
Von Kameralistik zur doppelten Buchführung
Siemens Business Services unterstützt die Stadt Hannover dabei,ein neues Rechnungswesen einzuführen. Die Kommune stelltkünftig mit Hilfe einer SAP-Software auf doppelte Buchführungum und löst damit das kamerale Rechnungswesen und eine 20 Jah-
re alte Software ab. Der Siemens-Bereich passt die neue Softwarean, wartet sie für fünf Jahre und schult 1.500 städtische Angestell-te im Umgang damit. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 5Millionen Euro. Die Lösung ist bundesweit einmalig, denn sie er-möglicht der Großstadt einen fließenden Übergang von Kamerali-stik auf doppelte Buchführung. Die Stadt wird künftig noch ge-nauer über ihre finanzielle Situation Bescheid wissen.
Das Projekt beginnt im August 2004. Rechtzeitig zu Beginndes Haushaltsjahrs 2006 soll das System einsatzbereit sein. Ob-wohl bereits einige Großstädte auf doppelte Buchführung umge-stellt haben, ist das System bundesweit einmalig, denn: Die Stadtkann mit der Software sowohl kameralistisch, als auch doppischbuchen. Bei Siemens nennt man das »sanfte Migration«. Der Kun-de hat Zeit, sich auf die neue Buchung umzustellen und muss kei-ne zusätzliche Software für den Übergang installieren. Möglichmacht dies eine einzigartige Lösung, die der Siemens-Bereich mitder arf GmbH auf Basis von »mySAP ERP« entwickelt hat.
Weitere Informationen: Siemens AG, Corporate Communicati-ons, 80312 München, Jörn Roggenbuck, 81730 München, Tele-fon: (89) 636-43734, E-Mail: [email protected].
Integrierte Verwaltungsmanagementsoftware
Zahlreiche Neuerungen sowie eine verbesserte Benutzerfreund-lichkeit bietet die integrierte Verwaltungsmanagementsoftware derMach AG. In seiner ERP-Lösung hat der Anbieter den Funktions-umfang in wichtigen Kernfunktionen, insbesondere der Anlagen-buchhaltung, der Logistik und im Berichtswesen weiter ausgebaut.Im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen wurden dieSchnittstellen zu Landes- und Bundesverfahren erweitert und derBedienkomfort erhöht. Auch in den Lösungen für Informations-,Personal- und Beschaffungsmanagement bietet die neue Versionvielfältige Neuerungen. Vor allem die Web-Produkte wurden un-ter ergonomischen Gesichtspunkten weiter optimiert.
Darüber hinaus gibt es ganz neue Funktionen in der ERP-Soft-ware, so die vollautomatische Anbindung von Handheld-Geräten.Mit der neuen Version bietet MACH zudem eine Optimierung undden Ausbau von Schnittstellen zu unterschiedlichen Zahlungsver-fahren für Bundes- und Landesbehörden.
Weitere Informationen: MACH AG, Jochen Michels, Wieland-straße 14, 23558 Lübeck, Telefon: (0451) 70647-271, E-Mail:[email protected], Internet: www.mach.de.
Mehr Bürger-Dienste
Die Stadt Mülheim an der Ruhr und der IT-Dienstleister MaternaGmbH haben gemeinsam das Konzept für ein kommunales Kom-munikations-Center entwickelt. Mit dem neuen System soll eindeutlich höherer Anteil der telefonischen Anfragen im Erstkontaktbeantwortet werden: Geplant ist, die First Call Rate von derzeit 30Prozent auf zukünftig 75 Prozent zu steigern. Ferner soll die Wei-tervermittlung an den zuständigen Sachbearbeiter zielgenau undqualifizierter erfolgen. Hierzu steht den 15 Call-Center-Agenteneine webbasierte Applikation mit verschiedenen Suchmechanis-men zur Verfügung, die mit der bestehenden Wissensbasis ausdem Internet und Intranet der Stadt gekoppelt ist. Die Call-Center-Agenten sind damit in der Lage, das Wissen aus den Fachberei-chen – zum Beispiel Handlungsrichtlinien, Formulare oder andereDokumente – schnell zu finden. Zur Vermeidung längerer Warte-zeiten wird den Bürgern ab sofort auch ein Rückruf-Service ange-boten. Darüber hinaus ist das bereits in der Bürgeragentur einge-setzte Beschwerde-Management-System der Stadt Mülheim an der
Nachrichten
VM 5/2004 279

Ruhr an das Kommunikations-Center angebunden. Bisher nicht imSystem hinterlegte Antworten werden kontinuierlich hinzugefügt.
Derzeit gehen durchschnittlich 750 Anrufe pro Tag bei der Te-lefonzentrale der Stadt Mülheim an der Ruhr ein, einer Stadt mitrund 173.000 Einwohnern. Häufig gestellte Fragen betreffen insbe-sondere die Aufgabenbereiche von Bürger-, Sozial- und Ordnungs-amt. Die Stadt Mülheim an der Ruhr setzt als erste deutsche Groß-stadt ein Anrufverteilsystem auf Basis von Voice over IP in einemkommunalen Call Center ein.
Weitere Informationen: Materna GmbH, Christine Siepe, Voßk-uhle 37, 44141 Dortmund, Telefon: (0231) 5599-168, E-Mail:[email protected], http://www.materna.de/presse.
Leitfaden eProcurement
Die AKD hat in einer Projektgruppe, besetzt mit Vertretern derStädte Bielefeld, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, derKDVZ Rhein Erft Ruhr sowie der KGSt, einen Leitfaden zum Ein-satz von eProcurement erarbeitet. Er bietet eine umfassende Infor-mationsquelle für alle, die ein Projekt prüfen oder dabei sind, es um-zusetzen. Umfangreiche Quellenangaben verweisen auf verschiede-ne Informationen. Der Leitfaden klärt unter anderem auf zu denverschiedenen eProcurement Komponenten, unter anderem Vergabe– Beschaffung (Katalog) und konzentriert sich auf die Beschreibungvon Standardprozessen. Als Anlage ist dem Leitfaden eine Marktü-bersicht der KGSt auf Basis von Selbstauskünften der Anbieter bei-gefügt.
Der Leitfaden kann angefordert werden beim Institut für an-wendungsorientierte kommunale Software über www.ifaks.de oderper E-Mail: [email protected].
Serviceportal freigeschaltet
Innenminister Dr. Fritz Behrens hat das Serviceportal der Landes-regierung freigeschaltet: Unter www.service.nrw.de bündeln dieneuen Internet-Seiten überschaubar und anwenderfreundlich die E-Government-Angebote des Landes. Aktuell sind über 30 Verfahrenin das Portal integriert worden. Dazu gehören »LEO« (Lehrerein-stellung-Online), »BORIS« (Bodenrichtwertinformationssystem),»ELSTER« (Elektronische Übermittlung von Einkommensteuerer-klärungen) und der »Online-Mahnantrag für Bürger«.
Mit dem Serviceportal wurde, so Behrens, ein weiterer Bausteinim »Masterplan E-Government« der Landesregierung umgesetzt.Das neue Online-Angebot wird fortlaufend erweitert. Beispielsweisesoll es in Zukunft möglich sein, online Gebühren zu bezahlen.
Virtuelle Beraterin beantwortet Bürgerfragen zurGesundheitsreform
Die virtuelle Beraterin Clara beantwortet unter www.die-gesund-heitsreform.de alle Fragen zu den Veränderungen im Gesundheits-system. Die digitale Ministeriumsmitarbeiterin wurde von derHamburger novomind AG zusammen mit deren Berliner PartnerAhrens&Bimboese. face2net entwickelt. Sie führt im Monat bis zu30.000 Dialoge und beantwortet pro Dialog durchschnittlich zehnFragen.
Der Bedarf an solchen digitalen Bürgerservices wird weitersteigen: Neun von zehn Fach- und Führungskräften im öffentlichenSektor sehen in Bürgerportalen das wichtigste Instrument zur Ver-besserung ihrer Kundenorientierung. Clara klärt die Besucher überdie Neuregelungen der Gesundheitsreform auf. Ihre schnelle und
umfassende Beratung entlastet die Mitarbeiter des Callcenters er-heblich. Ob Praxisgebühr, Krankenkasse oder Zahnersatz: Clarakennt die Antwort. Nur wenige Anfragen leitet sie an den Live-Chat des Bürgertelefons weiter. Dort übernimmt ein Berater dasGespräch. Bis zu 100 Anfragen bearbeitete Clara bislang gleich-zeitig durch standardisierte Antworten auf die häufigsten Proble-me. Die Seite wurde behindertengerecht entwickelt.
Neues AWV Seminar: »Vordrucke praxisnah gestalten (2)– Elektronische Be- und Verarbeitung von Formularen aufBasis von PDF-Dokumenten«
Die Teilnehmer lernen in dem Seminar, Formulare zu erstellen unddiese mit dem Formularwerkzeug von Adobe Acrobat Professio-nell zu einem ausfüllbaren PDF-Formular zu erweitern. Sie erler-nen Handwerkszeug und Tricks, wie Sie diese Arbeit beschleuni-gen können, um schnell und effizient an ihr Ziel, ein ausfüllbaresPDF-Formular im Web zu publizieren, zu gelangen. Die Teilneh-mer erfahren, was mit PDF-Formularen möglich ist, aber auch wodie Grenzen liegen. Zeitraubende Stolpersteine eines Selbststudi-ums werden umgangen. So ist gewährleistet, dass Ihre Vordruckeaktuelle Möglichkeiten nutzen, den eigenen Anforderungen ge-recht werden und der Workflow unterstützt wird.
Das Seminar legt seinen Schwerpunkt auf die elektronischeVer- bzw. Bearbeitung von Formularen und geht der Frage nach,wie aus einem Word-Formular ein PDF-Formular wird. In Kurz-form werden die Grundanforderungen an die Gestaltung von Vor-drucken wiederholt. Alle notwendigen Arbeiten werden am kon-kreten Beispiel durchgeführt.
Termin: 9./10. Dezember 2004 in Fulda. Teilnahmegebühr585,- Euro für AWV-Mitglieder, für Nichtmitglieder 650,- Euro.Weitere Informationen bei Jürgen Klocke, Telefon (06196) 495-379, E-Mail: [email protected].
Nachrichten
280
Vorschau auf die kommenden Hefte
Joachim Lohmann: Mischfinanzierung – Gewinn wird Verlust
Hans Peter Fagagnini und Ingo Caspari: Welche Theorien sollenPrivatisierungsprojekte begleiten?
Lothar Streitferdt, Krista Schölzig und Maren Hoffers: Die Balanced Scorecard als stategisches Managementsystem
Magdalena Bleyer und Iris Saliterer: Vom Customer Relation-ship Management zum Public/Citizen Relationship Management
Ulrich Keilmann und Felix Hermonies: Der Leistungsauftrag
Anke Rösener und Wulf Damkowski: Good Governance auf derlokalen Ebene
Rainer Graf und Stephan Rohn: Erfolgreiche Aufgabenkritik inder Landesverwaltung
Dorit Bölsche und Leander Jumin: Kostentransparenz in derBundesverwaltung