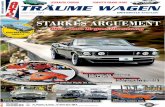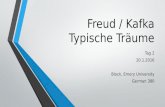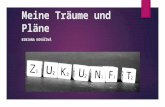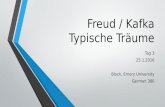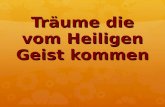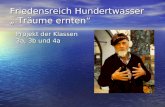Traum-Diskurse der Romantik Volume 78 () || Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch...
-
Upload
christiane -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Traum-Diskurse der Romantik Volume 78 () || Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch...

G E R H A R D L A U E R ( G ö t t i n g e n )
Hoffmanns Träume
Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume
Hoffmann's tales of dreams are generally regarded as the precursors to psycho-analysis. This essay takes the example of his novel Die Elixiere des Teufels to prove the contrary; rather, that Hoffmann's dreams o f f e r insights into the way in which modern narrative works. The dream is a maieutic motif for new narra-tive techniques, and has in fact little to do with psychoanalysis. In the dream motif, cultured literary understanding and the Romantic fascination for natural history meet the popular tradition of the Gothic novel. Only from such a combi-nation could the new intensity of narrative develop to which Hoffmann owes his important position in literary history.
Redet die Literatur vom Traum, so spricht sie über das Bedeutungs-volle. Das hat seit Homers IX. Gesang (V. 561 ff) Tradition. Hinter der „hörnernen Pforte" der Träume werden bei den Alten die unab-änderlichen göttlichen Ratschlüsse verhandelt, bei den Modernen dann die verborgenen Triebe. Träume scheinen unhintergehbar das Leben der Figuren zu lenken und dabei auf letzte Gründe zu verwei-sen. Hinter dem anderen, dem „Tor aus Elfenbein" warten bei Ho-mer wie dann bei Vergil und den vielen, die ihnen in der Verwendung des Traum-Motivs gefolgt sind, die irreführenden Träume. „Zwiefach sind die Pforten des Schlafs: / die hörnerne nennt man / Eine, wo-durch leichtschwebend die wahren Erscheinungen ausgehn; / Weiß die andre und hell aus Elfenbeine geglättet, / Doch ihr entsenden zur Luft falschgaukelnde Träume die Manen",1 so übersetzt 1799 Johann Heinrich Voß den VI. Gesang der A.eneis. Auch die gaukelnden Träume sind in der Literatur von ahndungsvoller Bedeutung. Als
1 Des Publ ius Virgi l ius Maro Werke. Bd. II: Aeneis I-VI. Ubersetxt u. hg. von Johann Heinr ich Voß. Braunschweig 1799, V. 893-896.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

130 Gerhard Lauer
inverse Bilder der „wahren Erscheinungen" verführen sie die Figuren zu Fehldeutungen, die Leser aber zu bedeutungsschweren Vorausah-nungen.
Ob „falschgaukelnde" oder „wahre" Träume vorliegen, will un-terschieden sein. Daher zeigen die irreführenden Träume dem Leser an, daß da, wo in der Literatur von Träumen die Rede ist, immer auch Auslegung notwendig ist. Träume kommen in der Literatur nur als auslegungsbedürftige vor, ähnlich dem Orakel und allem, was sich der Evidenz der fiktionsinternen Handlungsgegenwart entzieht. Träume sind daher mögliche Welten in der Fiktion und wie diese nur der hermeneutischen Anstrengung zugänglich, ohne aber deshalb schon Beobachtungen zweiter Ordnungen zu sein. Sie sind Teil der erzählten Welt, nicht ihre Beobachtung. Sie haben daher mit der Tie-fenstruktur der erzählten Fiktion zu tun, dem was die fiktionale Welt zu lenken scheint. Ihnen gilt die Arbeit der Auslegung der Figuren wie die ihrer Leser. Den Figuren gewähren die Träume momenthaft auslegungsbedürftige Einsichten in eine aufzufindende Ordnung.
Die Einblicke in die darunter liegende Ordnung der erzählten Welt gewähren auch den Lesern Einsichten in letzte Gründe der er-zählten Handlung. Der Traum verknüpft sich dabei stereotyp mit einer Metaphorik der Tiefe. Es scheint so, als würden dem Leser durch die erzählten Träume Fenster in die Abgründe der menschli-chen Existenz gewährt werden, nicht nur der erzählten, auch der realen. Was an verborgener Motivierung der Figuren im Traum auf-scheint, gilt den Lesern nicht bloß als fiktionsinterne Gründe, son-dern als Aussage über die wahren Ursachen des menschlichen Han-delns. Mit der Metaphorik der Tiefe verbunden ist darum eine Metaphorik der Eigentlichkeit. Sind nicht die Abgründe, in die E.T.A. Hoffmanns Figuren blicken, solche, die die allgemein menschliche Triebstruktur betreffen und verweisen sie daher nicht zu Recht auf die spätere Psychoanalyse? Selbst wenn man Freuds Theorien nur für lokale Theoreme der Jahrhundertwende hält oder wohl halten muß, scheint doch Nathanaels Perspektiv in Abgründe der menschlichen Seele und nicht nur in die der erfundenen Figuren zu blicken.2 Die fiktionale Geschichte öffnet sich durch den Traum, so scheint es, für
2 Z.B. Hartmut Böhme: Romant ische Adoleszenzkr isen. Zur Psychodynamik der Venus-kult-Novel len von Tieck, Eichendorff und E.T.A. Hoffmann . In: Literatur und Psycho-analyse. Hg. von Klaus Bohnen u.a. Kopenhagen, München 1981 (= Text & Kontext 10), S. 131-176.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 131
letzte, dann jede Fiktion übersteigende Einsichten in die wirkliche menschliche Verfassung. Das anzunehmen, ist Konsens unter Lesern, auch unter solchen der Literaturwissenschaft. Die Wahrheiten hinter den Pforten des Traumes werden zu Wahrheiten auch ihrer literatur-wissenschaftlichen Deuter, wenn sich die hermeneutische Arbeit nur auf die Deutung der Träume einläßt. Die Erhöhung des Traumes zum Ort der verdeckten Wahrheitsrede gibt der Literatur und ihrer Wis-senschaft Aura. Es scheint, als würde eine Analyse des Traumes in der Literatur zugleich eine Kulturgeschichte der Triebkräfte erlauben, vielleicht gar eine der menschlichen Einbildungskraft und seiner Äs-thetik der Imagination, so als wäre der Traum mehr als Motiv und Topos, eben jener hohe Verhandlungsort der menschlichen Eigen-schaft, mögliche Welten entwerfen zu können, daher ein Schlüssel zur Phantasiebegabung des Menschen.
Meine Überlegungen gehen im folgenden kritisch mit dieser zu-nächst konsensfähig erscheinenden These vom hohen Wahrheitsort Traum um und zielen auf Differenzierung. Ich will plausibel machen, warum Träume für die Literatur und Literaturwissenschaft keinen solchen unmittelbaren Wahrheitswert haben können, wie es zu sein scheint, sehr wohl aber eine angebbare Funktion, eine mindestens, nämlich narrative Innovationen möglich zu machen. Ich komme we-gen der kritischen Absicht von der anderen Seite her, der Seite, die unter dem Verdacht des Trivialen steht und frage, wie funktionieren Träume in Schauerromanen, solchen wie etwa E.T.A. Hoffmanns Elixieren des Teufels. Sagen Hoffmanns Träume etwas über verborgene Triebe? Das wäre die These Freuds.3 Sagen sie etwas über die Fähig-keit zur Anverwandlung der Welt im Traum der Einbildungskraft? Das wäre die romantische These.4 Beides scheint mir als literaturwis-senschaftliche These nicht aufrechtzuerhalten zu sein, ohne das Ob-jekt der Literatur und die Metaebene der Literaturwissenschaft stän-dig durcheinanderzubringen. Beide auseinanderzuhalten, ist aber wichtig, um zu sehen, was der Traum in der Literatur auch und gera-
3 S igmund Freud: Das Unheiml iche [1919], In: Ders. : Studienausgabe. Bd. IV. Psychologi-sche Schriften. Frankfurt/M. 1970, S. 241-274.
4 „Mich dünkt der Traum eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkei t und Gewöhnl ichke i t des Lebens, eine freie Erholung der gebundenen Phantasie , wo sie alle Bi lder des Lebens durcheinander w i r f t . " Noval is : Heinrich von Ofterdingen. Erster Teil : Die Erwartung. In: Schriften. Das Werk Friedrich von Hardenbergs . Histor isch-kr i t ische Ausgabe in 4 Bdn. Bd. I: Das dichter ische Werk. Hg. von Paul Kluckhohn u. Richard Samuel u.a. Stuttgart 1960, S. 183-334; hier S. 199.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

132 Gerhard Lauer
de in der romantischen leisten kann. Traum, so soll am Ende ver-standen werden, ist ein narratives Thema, das gerade weil er immer nur ein erzählter Traum sein kann, viel darüber sagt, wie Erzählen funktioniert. Die Wahrheit des Traums ist die seiner Erzählung, ein mäeutisches Motiv, das aus dem Stoff erst einen modernen Roman macht.
In Hoffmanns Nachgelassenen Papieren des Bruders Medardus eines Ca-pu^iners wird gar viel geträumt. Glaubt man der Figur des Bruder Me-dardus, dann umschweben ihn in nicht endender Zahl Traumbilder, die glücklichen — „und oft, wenn ich, zum Tode matt, auf dem harten Lager schlaflos lag, umwehte es mich wie mit Engelsfittichen, und ich sah die holde Gestalt der lebenden Aurelie, die, himmlisches Mitlei-den im Auge voll Tränen"5 —, aber auch die entsetzlichen vom Schrecken der eigenen Verurteilung in düsteren Kellern und von dramatischer Hinrichtung. Zudem reden die Figuren eine Sprache, in der eine glückliche Erinnerung ebenso als „Traum" bezeichnet wird wie die eigene geistige Abwesenheit oder ein unbewußtes Geschehen: „Wie umfängt mich noch wie ein seliger Traum die Erinnerung an jene glückliche Jugendzeit!",6 erinnert sich Medardus. Obgleich der Roman von sich behauptet, nur die Aufzeichnungen des büßenden Mönchs Medardus zu sein, ist sich dieser seiner eigenen Erinnerun-gen ungewiß: „Ich weiß nicht, ob ich diese Worte wirklich sprach, aber ich hörte mich selbst lachen und fuhr auf wie aus tiefem Traum",7 so schreibt Medardus in seinen Papieren. Selbst das eigene, rückblickende Schreiben kann die Grenze zwischen Traum und Wa-chen nicht sicherer bestimmen als im Moment der erzählten Hand-lung. Auf Augenhöhe der Figuren vergeht so kaum ein Tag ohne Traum, ja das Leben erscheint den Figuren — und hier vor allem der Hauptfigur - wie ein Traum: „Ja! - ein schwerer Traum dünkte mir nicht nur die letzt vergangene Zeit, sondern mein ganzes Leben, seit-dem ich das Kloster verlassen, als ich mich in einem von dunklen Platanen beschatteten Gange befand".8 Traumwandlerischer läßt sich die Handlung kaum erzählen, so daß bis zuletzt die Grenze zwischen
5 E.T.A. Hoffmann : Die Elixiere des Teufels . In: E.T.A. Hof fmann : Sämtl iche Werke in sechs Bänden. Bd. II.2.: Werke 1814-1816. Hg. von Hartmut Ste inecke unter Mitarbeit von Gerhard Al lroggen. Frankfurt/M. 1988, S. 9-352; hier S. 275.
6 Hoffmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 20.
7 Hoffmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 190.
8 Hoffmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 223.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 133
Traum und Wachen unzuverlässig erzählt ist. Weil auch noch Einbil-dungen und Visionen in nicht eben geringer Zahl in die Handlung eingeflochten sind, die unterschiedlich deutlich als Traum oder traumhaft markiert sind, wie etwa die Vision vom eigenen Märtyrer-tod,9 enthält der Roman als ganzer eine träumerische Einfärbung, die jenen romantischen Moment ansteuert, in dem für die Figuren die Unterscheidung von Traum und Leben verschwindet. Soweit ist uns das vertraut.
Die interne Fokalisierung des Romans auf Augenhöhe der Haupt-figur, die ihre Lebensgeschichte in den hinterlassenen Papieren nie-dergeschrieben hat, ist aber nicht mit der des Lesers deckungsgleich. Die Herausgeberfiktion ist für den Leser ebenso durchschaubar wie die Eigentümlichkeit, daß der Roman nicht so erzählt ist, wie er im Rückblick hätte erzählt werden müssen. Es fehlt jede Distanzierung zum erzählten Geschehen, die man in einer auch fingierten Memoi-renliteratur erwarten würde. Medardus scheint so verwirrt von den erinnerten Handlungsfäden und den unwahrscheinlichen Verwandt-schaften zu sein, als würde alles gerade im Moment der Niederschrift geschehen, aber kein Rückblick sein. Eine Vorwegnahme der Lösung fehlt. Damit kann der Leser sehr wohl zwischen der Figurenperspek-tive und der eigenen Leseperspektive unterscheiden. Während die Figuren nur in der Handlung verbleiben bzw. der Erzähler als homo-diegetische Erzählerfigur Teil der erzählten Welt bleibt und keine olympische Position einnimmt, unterscheidet der Leser die allgemein genretypische traumhafte Atmosphäre von dem erzählten Geschehen Traum. Als intertextuell tradierbare Einheit setzt sich der Traum aus einer Sequenz von teils notwendigen, teils hinreichenden Ereignissen bzw. Motiven zusammen, wie der Markierung der Grenze zwischen Wachen und Schlafen, der Traumgesichter, damit der Aufhebung der Regeln der innerweltlichen Handlungskausalitäten, meist einer ver-größerten Wahrnehmung bei gleichzeitiger Passivität des Träumen-den, vielfach auch der Chiffrierung des Geträumten als Vorwegnah-me der kommenden Handlung. Legt man solche, noch sehr allgemein gehaltenen Merkmale an Hoffmanns Roman an, dann bleiben nur eine Handvoll Träume im engeren Sinn übrig, die Träume von der Geliebten Aurelia, die mit der heiligen Rosalia verschmilzt, die Träu-me von der eigenen Verurteilung und drohenden Hinrichtung, die als
9 Hoffmann: Die Elixiere des Teufels . [Anm. 5], S. 313f.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

134 Gerhard Lauer
Binnenerzählung im Rahmen der Herausgeberfiktion eingeflochtenen Träume der Aurelie und eben und am ausführlichsten ausgestaltet die Träume vom eigenen Doppelgänger.
Sehen wir uns eine solche Traumerzählung in den Elixieren an, die im dritten Abschnitt des Ersten Teils erzählte Begegnung des Prota-gonisten mit seinem Doppelgänger. Medardus, selbst zum Mörder geworden und unter falscher Identität unterwegs, gerät von einer romantischen Szenerie heiterer Landschaft mit Postillion in ein För-sterhaus. Medardus wird dort ein Zimmer zugewiesen, von dem es heißt, daß ihn „der frühe Lärm im Hause nicht wecken würde, da ich mich von der übrigen Hausgenossenschaft ganz abgesondert befinde und daher so lange ruhen könne, als ich wolle".10 Dann wird die limi-nale Überschreitung erzählt: „Ich warf mich auf das Lager, und fiel, ermüdet wie ich war, bald in tiefen Schlaf, aber es folterte mich ein entsetzliches Traumbild".11 Hoffmann markiert nun diesen Übergang in den Schauer des Traumes auffällig, indem er die Grenzüberschrei-tung in der Perspektive der Figur des träumenden Mönches - nicht der des Lesers — verwirrt:
Auf ganz wunderbare Weise fing der Traum mit dem Bewußtsein des Schlafs an, ich sagte mir nämlich selbst: ,Nun, das ist herrlich, daß ich gleich eingeschlafen bin und so fest und ruhig schlummere, das wird mich von der Ermüdung ganz erlaben; nur muß ich ja nicht die Augen öffnen.' Aber demunerachtet war es mir, als könne ich das nicht unter-lassen, und doch wurde mein Schlaf dadurch nicht unterbrochen.12
Während dem Träumenden sein eigener Zustand als Träumender unklar ist, kann der Leser aus Hoffmanns Text erschließen, daß der Träumende keineswegs in einen bewußtlosen Zustand gefallen ist, im Gegenteil. Sein Bewußtsein scheint im Schlaf wacher denn je zu sein.
Erst nach dieser doppelten Bedeutungsaufladung von Traum und wachendem Bewußtsein setzt die für den Leser erkennbare Traum-handlung ein:
[...] da ging die Türe auf, und eine dunkle Gestalt trat hinein, die ich zu meinem Entsetzen als mich selbst, im Kapuzinerhabit, mit Bart und Tonsur erkannte. Die Gestalt kam näher und näher an mein Bett, ich war regungslos, und jeder Laut, den ich herauszupressen suchte, erstick-
10 Hof fmann : Die El ixiere des Teufels . [Anm. 5], S. 127f.
11 Hof fmann : Die Elixiere des Teufels . [Anm. 5], S. 128.
12 Hoffmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 128.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 135
te in dem Starrkrampf, der mich ergriffen. Jetzt setzte sich die Gestalt auf mein Bett und grinsete mich höhnisch an.13
Zum Alptraum gehören hier die Ereignisse wie die eigene Bewe-gungsunfähigkei t des Träumenden, die Unmögl ichkeit , der Angst durch Schreien Ausdruck zu verleihen und natürl ich die gespensti-sche Schreckgestalt des Doppelgängers . Das alles ist keine traumhafte Erzählung, sondern noch ganz innerhalb real ist ischer Handlungszu-sammenhänge erzählt. Alpträume gibt es nun mal.
In dem nun folgenden Ereignis scheint die Begegnung mit dem Doppelgänger immer weniger traumhaft , sondern von einem bedrän-genden Real ismus. Im Traum wird gesprochen. Der angesprochene Medardus verl iert seine traumhafte Bewegungsunfähigke i t und Ton-losigkeit :
„Du mußt jetzt mit mir kommen", sprach die Gestalt: „wir wollen auf das Dach steigen unter die Wetterfahne, die ein lustig Brautlied spielt, weil der Uhu Hochzeit macht. Dort wollen wir ringen miteinander, und wer den andern herabstößt, ist König und darf Blut trinken." - Ich fühlte, wie die Gestalt mich packte und in die Höhe zog, da gab mir die Verzweiflung meine Kraft wieder. „Du bist nicht ich, du bist der Teu-fel", schrie ich auf und griff wie mit Krallen dem bedrohlichen Ge-spenst ins Gesicht, aber es war, als bohrten meine Finger sich in die Augen wie in tiefe Höhlen, und die Gestalt lachte von neuem auf in schneidendem Ton.14
Mit dies em Ereignis wacht Medardus auf. Für den Leser ist damit der Übergang vom erzählten Traum zur erzählten Handlung vol lzogen, der Traum im übl ichen Sinne zu Ende. Aber Hof fmann wäre nicht Hof fmann , würde er hier stehenbleiben. Für den Erzähler geht die a lptraumhafte Handlung weiter:
In dem Augenblick erwachte ich, wie von einem plötzlichen Ruck em-porgeschüttelt. Aber das Gelächter dauerte fort im Zimmer. Ich fuhr in die Höhe, der Morgen brach in lichten Strahlen durch das Fenster, und ich sah vor dem Tisch, den Rücken mir zugewendet, eine Gestalt im Capuzinerhabit stehen. - Ich erstarrte vor Schreck, der grauenhafte Traum trat ins Leben. - Der Capuziner stöberte unter den Sachen, die auf dem Tische lagen. Jetzt wandte er sich, und mir kam aller Mut wie-der, als ich ein fremdes Gesicht mit schwarzem verwildertem Barte er-blickte, aus dessen Augen der gedankenlose Wahnsinn lachte: gewisse
13 Hoffmann: Die Elixiere des Teufels. [Anm. 5], S. 128. 14 Hoffmann: Die Elixiere des Teufels. [Anm. 5], S. 128.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

136 Gerhard Lauer
Züge erinnerten entfernt an Hermogen. - Ich beschloß abzuwarten, was der Unbekannte beginnen werde, und nur irgend einer schädlichen Un-ternehmung Einhalt zu tun. Mein Stilet lag neben mir, ich war deshalb, und schon meiner körperlichen Leibesstärke wegen, auf die ich bauen konnte, auch ohne weitere Hülfe des Fremden mächtig. Er schien mit meinen Sachen wie ein Kind zu spielen, vorzüglich hatte er Freude an dem roten Portefeuille, das er hin und her gegen das Fenster wandte und dabei auf seltsame Weise in die Höhe sprang.15
Die Beschreibung, die uns der Erzähler gibt, spielt nun nicht mehr im Irrealis des Traumes. Eine solche Situation mit solchen Verhaltens-weisen der Figuren ist fiktionsintern real, wie der Leser einige Seiten später erfährt. Der Doppelgänger ist ein psychisch kranker Mitbru-der, der in der Obhut des Försterhauses lebt und wie sich sehr viel später zeigen wird, mit Medardus auf wunderliche Weise verwandt ist. Zugleich hat aber der Erzähler die Figur aus dem Traum heraus entwickelt, so daß im Moment des Erzählens weder für die Figur noch für den Leser entscheidbar ist, wie dieser grauenhafte Traum des Doppelgängers ins (erzählte) Leben treten kann. Der Schauer des Traumes wird hier zum Schauer für den Leser, dem ganz offensicht-lich ein Erklärungsstück fehlt, um die Übergänge in der narrativen Logik des Romans erschließen zu können. Gehören erzählter Traum und erzählte Handlung nach dem Aufwachen zusammen, was ist ihr Bedingungsverhältnis? Das ist alles noch grundsätzlich möglich, nur eben seltsam unwahrscheinlich. Diesen verwirrend schaurigen Mo-ment steuert die Erzählung an.
Die Verrätselung nimmt noch zu, als die Figur des irren Doppel-gängers nun genau das wiederholt, was Medardus selbst zu Beginn seiner Entsetzen erweckenden Taten begangen hat, eben das Trinken aus den Elixieren des Teufels:
Endlich fand er die Korbflasche mit dem Rest des geheimnisvollen Weins; er öffnete sie und roch daran, da bebte es ihm durch alle Glie-der, er stieß einen Schrei aus, der dumpf und grauenvoll im Zimmer wi-der klang. Eine helle Glocke im Hause schlug drei Uhr, da heulte er, wie von entsetzlicher Qual ergriffen, aber dann brach er wieder aus in das schneidende Gelächter, wie ich es im Traum gehört; er schwenkte sich in wilden Sprüngen, er trank aus der Flasche und rannte dann, sie von sich schleudernd, zur Türe hinaus. Ich stand schnell auf und lief ihm nach, aber er war mir schon aus dem Gesichte, ich hörte ihn die ent-
15 Hoffmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 128f.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 137
fernte Treppe hinabpoltern und einen dumpfen Schlag, wie von einer hart zugeworfenen Türe.16
Damit ist der Traum ins Leben der Figur gerückt. Was er an Merkma-len des Traumes aufgibt, gewinnt er an Verrätselung. Seinen Leser läßt der Erzähler nicht so sehr im unklaren darüber, wo die Grenze zwischen Traum und Leben verläuft, sondern vielmehr darüber, wie die Ereignis folgen als ein Geschehenszusammenhang zu verstehen sind. Für den Leser ist hinreichend deutlich, daß der Doppelgänger nicht bloß einer der äußeren Ähnlichkeit ist, sondern die Ähnlichkeit zwischen beiden eine innere ist, die sich auf die Figurenmotivation erstreckt und rätselhaft die Handlungen der eigenen Figur in der an-deren wiederholt, hier dem wiederholten Trinken aus der Elixierfla-sche. Die Chiffrierung dieses verborgenen Zusammenhangs zwischen den Figuren braucht am Ende den Traum gar nicht mehr: „Ich ver-riegelte mein Zimmer, um eines zweiten Besuchs überhoben zu sein, und warf mich aufs neue ins Bette" heißt es am Schluß dieser Traum-sequenz. „Zu erschöpft war ich nun, um nicht bald wieder einzu-schlafen; erquickt und gestärkt erwachte ich, als schon die Sonne ins Gemach hineinfunkelte".17 Am Ende wird nicht mehr geträumt. Aber das Grauen ist in der Wirklichkeit der erzählten Welt angekommen.
Der zitierte Ausschnitt aus den Elixieren läßt schon die narrativen Bauprinzipien erkennen, denen Hoffmanns Träume folgen, und zeigt, wie sie ihren Schauer auszulösen vermögen. Ich schicke dabei voraus, daß Hoffmanns Roman wie jeder fiktionale Text zunächst nach dem „principle of minimal departure" konzipiert ist, nach dem narrativen Realitätsprinzip.18 Dieses Prinzip besagt, daß wir als Leser so lange davon ausgehen, eine Geschichte sei so nahe wie möglich an der Rea-lität gebaut, bis wir davon abweichende Informationen erhalten. Wir trennen also zunächst Handlung und Traum und stolpern erst beim weiteren Lesen über die unrealistische Verbindung von Traumge-schehen und Handlung im Wachen. Zum anderen setzen wir ein lite-rarisches Wissen voraus, also Annahmen darüber, was Literatur sei, vor allem darüber, wie sich in ihr abweichend von der Realität Hand-
16 Hof fmann : Die El ixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 129.
17 Hof fmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 129.
18 „This pr inciple states that we reconstrue the world of a f ict ion [...] as being the closest possible to the reality we know. This means that we wil l project upon the world of the statement everything we know about the real world, and that we will make only those ad-justments which we cannot avoid." Marie-Laure Ryan: Fiction, Non-Factua ls , and the Principle of Minimal Departure. In: Poetics. 9/1980, S. 403-422; hier S. 406.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

138 Gerhard Lauer
lungen entwickeln, ohne deshalb schon gleich als unrealistisch zu gelten. Literatur handelt ungern von bedeutungsarmen Zufälligkeiten, von denen der Alltag voll ist. Sie gelten uns schon in Alltagserzäh-lungen als nicht erzählenswert, so oft sie uns ansonsten auch begeg-nen.19 Literatur, spätestens seit sie modern geworden ist, verlangt überkohärente Bedeutungsstrukturen. Thematisch kann nur etwas werden, das sich als ausreichend bedeutungsverdichtend erweist.20
Wenn Medardus' Doppelgänger von dem Elixier trinkt, dann wird dies kein Leser für eine bloß zufällige Handlung halten, sondern auf die vorausgehenden Handlungen der Hauptfigur beziehen. Weil wir als Leser über ein solches Wissen über Literatur und die Logik ihrer Bedeutungsbildung verfügen und die Autoren ihre Geschichten nach den Regeln dieses Wissens bauen, suchen wir um so intensiver nach den fehlenden Erklärungsstücken in der zitierten Traum-Sequenz. Das Realitätsprinzip und das allgemeine Wissen um Literatur setzen wir also voraus, sonst würde der Roman noch nicht einmal in seinen Grundzügen verständlich sein.
Das alles ist noch sehr allgemein. Der Schauer des Traumes und der spezifische Wahrheitsanspruch des erzählten Traumes öffnen sich dem Leser erst dann, wenn er auf historisch spezifischere Wissensbe-stände eingeht. Sie bilden den bedeutungsspezifizierenden Kontext, den der Roman voraussetzt. Schon für den zeitgenössischen Leser Hoffmanns war um 1815 klar, als der erste Teil des Romans bei Duncker und Humblot in Berlin erschien, - der zweite folgte ein Jahr später wieder bei Duncker und Humblot - , daß der Text unter die romantischen zu zählen ist. Und damit der Leser darüber nicht in Zweifel geraten kann, sagt es ihm das Titelblatt: „Von dem Verfasser der Fantasiestücke in Callots Manier". Die Fantasiestücke, die sich schon im Titel als romantisch zu erkennen geben, spielt der Titel doch auf die antiklassizistische Kunst der Zeichnungen und Drucke Callots an, waren Hoffmanns erster großer Erfolg. Ein damaliger Leser konnte daher schon aus dieser Angabe auf dem Titelblatt er-schließen, daß er andere Wissensbestände zum Verständnis des Traumes braucht, als sie sonst gelten mochten. Das ist selten ein scharf konturiertes Wissen vom Traum, so als könne ein Leser für jeden erzählten Traum die von Hoffmann benutzten Quellen ange-
19 Vgl . Konrad Ehlich (Hg.): Erzählen im Alltag. Frankfur t/M. 1980.
20 Vgl . Max Louwerse , Wil l ie van Peer (Hg.): Themat ics . Interdiscipl inary studies. Amster-dam, Phi ladelphia 2002.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 139
ben. Es genügte auch um 1815 zum Verständnis des Romans, wenn Hoffmanns Leser über eine nur schwer auflösbare Mischung von Vorstellungen über Romantik und ihre Besonderheiten im Umgang mit dem Traummotiv Bescheid wußten, vielleicht von den medizi-nisch-naturphilosophischen Auffassungen gehört, die Entwicklung der modernen Ästhetik verinnerlicht und nicht zuletzt über Leseer-fahrungen in der Genreliteratur seiner Zeit verfügt hatten.
Schon früh ist Hoffmann für die Überdeutlichkeit seiner romanti-schen Motive getadelt worden, ist doch sein Erzählwerk ein Kaleido-skop romantischer Motive. Der Vorwurf läßt sich auch gegen die Elixiere des Teufels und hier gegen die Mot iwerwendung der Träume erheben. Um 1815 ist die Verdopplung des Subjektes im Traum so-wenig ein neues, damit potentiell schwer verständliches oder unver-ständliches Motiv wie die geheime Verwandtschaft mit dem Doppel-gänger, ja fast aller Figuren miteinander. Sie gehören zum genealo-gischen Muster der Subjektivität, wie es die romantische Literatur und Ästhetik im Gleichgang zur sich formierenden Transzendental-philosophie entwickelt. Mit Kants Frage nach der Einheit des Subjek-tes in der transzendentalen Apperzeption, also der Frage danach, woher das Ich weiß, daß es das Ich ist, das sich als Ich denkt, sucht die nachkantische und mit ihr die später als romantisch klassifizierte Literatur nach dem verborgenen Grund, in dem Subjekt und Objekt vermittelt sind. In ihm soll die für Kant nicht zu überwindende Grenzlinie zwischen Ich und Nicht-Ich übersprungen werden kön-nen, als könne das Ich sich selbst denken, ohne sich damit zum Ob-jekt zu machen. Nach Kant ist das sowenig möglich wie die Suche nach dem objektiv Schönen, das die romantischen Kunstprojekte anleitet. In der früh- und hochromantischen Literatur führt dieser Versuch zu den Geschichten verborgener Genealogien. E.T.A. Hoffmann zitiert nicht zufällig teilweise fast wörtlich aus dem roman-tischen Roman, der diese Genealogie auf die Spitze treibt, dem „ver-wilderten Roman", wie er sich selbst nennt, dem Go dm-Roman Cle-mens Brentanos von 1801/02. Hoffmanns Roman folgt erkennbar diesem allgemeinen romantischen Muster des mit dem Protagonisten verwandten Doppelgängers, wo ununterscheidbar bleiben soll, wo Ich und Nicht-Ich zusammengehören, wo sie zu trennen sind, wenn auch als populärer Roman nicht in den verwilderten Verwandt-schaftskomplexitäten Brentanos.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

140 Gerhard Lauer
E.T.A. Hoffmann nutzt aus diesem romantischen Umfeld auch die Auffassung des Traumes für seinen Roman. Auf den belegten Einfluß der romantischen Psychiatrie von Kluge, Schubert, Pinel, Cox und Reil und auf die Gespräche mit den Bamberger Ärzten Mar-cus und Speyer ist wiederholt hingewiesen worden.21 Vor allem Gott-hilf Heinrich Schuberts Bücher Ansichten von der Nachtseite der Natur-wissenschaften von 1808 und Die Symbolik des Traumes von 1814, die Hoffmann während der Abfassung seines Romans nachweislich gele-sen hat, gehen selbst auf romantische Subjektivitätsauffassungen vor allem der Jenaer Frühromantiker zurück. Danach ist der Traum der Wachzustand eines gesteigerten Bewußtseins wie in Medardus' Traum, so daß sich die Wirklichkeit nirgends deutücher und damit bedeutungsschwerer erschließt als eben im Traum. Im Traum sei die Sprache „unendlich viel ausdrucksvoller, umfassender",22 schreibt Schubert, ja im Schlaf rede der „versteckte Poet" aus uns.
Indes fragt sich sehr, ob nicht eben jene Sprache die eigentliche wache Rede der höheren Region sei, während wir, so wach wir uns glauben, in einem langen, mehrtausendjährigen Schlaf, oder wenigstens in den Nachhall seiner Träume versunken, von jener Sprache Gottes, wie Schlafende von der lauten Rede der Umstehenden, nur einzelne dunkle Worte vernehmen,23
sagt Schubert über die Symbolik des Traumes. Traumrede ist damit nobilitiert. Sie ist der ausgezeichnete Ort der Wahrheit. Wenn Hoff-manns fingierter Herausgeber den Leser des Teufels-Romans gleich im Vorwort instruiert, „als könne das, was wir insgemein Traum und Einbildung nennen, wohl die symbolische Erkenntnis des geheimen Fadens sein, der sich durch unser Leben zieht",24 dann folgt der Ro-man für den Leser erkennbar der romantischen Traumauffassung und suggeriert genau jenen Wahrheitsanspruch der Traumrede, der nicht mehr danach fragt, ob das nur eine erzählte Wahrheit oder eine tat-sächliche Einsicht in die Abgründe der menschlichen Seele sei.25
21 Vgl . zusammenfassend den Kommentar in Hoffmann : Die El ixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 545ff.
22 Gotthi l f Heinr ich Schubert : Die Symbol ik des Traumes . Bamberg 1814, S. 2.
23 Schubert : Die Symbol ik des Traumes . [Anm. 22], S. 14.
24 Hoffmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 12.
25 Ilse Weidekampf : Traum und Wirkl ichkei t in der Romant ik und bei Heine. Leipzig 1932, S. 20-27 und Paula Ritzler: Der Traum in der Dichtung der deutschen Romant ik . Bern 1943, S. 25-29.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 141
Freilich wird selbst ein historischer Leser um 1815 eine präzise Zuordnung der überhöhenden Auffassung des Traumes als Ort sym-bolischer Deutungshoheit nicht so eindeutig einzelnen romantischen Auffassungen zuordnen können, wie es der philologische Blick auf die Zusammenhänge nahelegt. Mit Recht haben die Herausgeber der jüngsten Hoffmann-Ausgabe Hartmut Steinecke und Gerhard Allrog-gen auf die unsystematische Aufnahme romantischer Vorstellungen bei Hoffmann verwiesen.26 Der Leser braucht gar nicht genau zu wissen, wie abhängig im Detail Hoffmann von der romantisch-naturphilosophischen Auffassung seiner Zeit war, daß etwa die niede-ren Träume aus dem Gangliensystem des Körpers herstammen, die von den höheren, damit auch vorausahnenden Träumen des Zere-bralsystems zu unterscheiden seien und also die Figuren in den Kur-ven ihrer Träume zwischen diesen niederen und höheren Träumen wechseln. Das nicht ruhigzustellende Pendeln zwischen den trösten-den, romantisch-idyllischen Träumen der Ahndung und den er-schreckenden Träumen der Triebe, die Medardus im wiederholten Wechsel durchlebt, hat seine gedankliche Vorbereitung bei Schubert und anderen.
Wir lernen sie [die Seele] nur zu gut kennen, sobald sie, wenn auch nur auf einzelne Augenblicke, aus ihren Ketten losgelassen wird. Ich er-schrecke, wenn ich diese Schattenseite meines Selbst einmal im Traume in ihrer eigentlichen Gestalt erblicke27,
formuliert Schubert nicht anders, als es Hoffmann erzählt. Aber auch wer Schubert und andere romantische Philosophen und Ärzte nicht gelesen hat und damals vielleicht nur von einer Mode im Umgang mit Träumen gehört hat, weiß, daß der Traum ein Tor zu verborgenen Zusammenhängen der Welt eröffnen soll. Das genügt zum Verständ-nis des Romans und seiner Träume. Vor allem genügt es, um vom erzählten Traum auf den wirklichen Traum rückzuschließen. Beides scheint sich wechselseitig ineinander übersetzen zu lassen.
Damit der Leser das akzeptieren und den Fieberkurven der Träumenden bei Hoffmann fraglos als Ausdruck der menschlichen Seele folgen kann, muß er die ästhetischen Voraussetzungen neuzeit-licher Literatur gelernt haben. Erst seit der Mitte des 18. Jahrhun-derts hat sich die Auffassung von der Poesie so verändert, daß sie
26 Hoffmann: Die Elixiere des Teufels. [Anm. 5], S. 563ff.
27 Schubert: Die Symbolik des Traumes. [Anm. 22], S. 118.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

142 Gerhard Lauer
zum ausgezeichneten Ort des seelischen Ausdrucks in seiner ganzen Volatilität ist. Erst das 18. Jahrhundert hat gelehrt, daß es Aufgabe der neuen Disziplin Ästhetik sei, die Seele über sich selbst und ihre Bewegungen aufzuklären: „Wenn also die philosophische Sittenlehre vollständig seyn sol, muss man wissen, wie man den sinnlichen Theil der Seele verbessern soll, dieses aber lehrt uns die Aesthetick",28
schreibt Friedrich Georg Meier in den Anfangsgründen aller schönen Wis-senschaften von 1754. Kunst ist nun der Ort der „schönen Unord-nung", wie Johann Adolf Schlegel Batteux' Formulierung von dem „beau desordre" übersetzt.29 Kunst müsse einer schönen Unordnung folgen, weil die Bewegungen der Seele selbst solche der unregelmäßi-gen und vermischten Empfindungen seien, der „mixed passions". Hoffmanns Traumerzählungen folgen der schönen Unordnung und den wechselnden Empfindungen der Seele und stehen damit für den Leser in dem gleichen ästhetischen Auffassungsraum, wie er mit der Musik eines Carl Philipp Emanuel Bach oder der Eisernen Brücke im Wörlitzer Park begann. Träume dürfen nun sprunghaft sein und ver-raten gerade in ihrer Unordnung etwas Bedeutungsvolles über die menschliche Seele. Das Gleiche etwa für die Träume in Grimmels-hausens Simplicianischen Schriften zu unternehmen, würde den dort angelegten Sinn verfehlen. Hier dagegen ist es angemessen.
Das alles spricht dafür, Hoffmanns Träumen einen Wahrheitswert zuzugestehen, der über den erzählter Geschichten hinausgeht und der mit den uns geläufigen Träumen wenig zu tun hat. Dann wären Hoffmanns Träume doch eine Unterweisung in die Abgründe der menschlichen Seele? Etwas steht dem entgegen und das mit jeder Zeile des Romans: seine Herkunft aus dem Genre der Schauerroman-tik. Um 1815 handelt es sich bei der Schauerromantik bereits um fest etablierte Genres, die man ein halbes Jahrhundert zuvor als gothic revival zusammengefaßt hatte und die in den deutschen Territorien um 1800 mit Blick auf den Roman auch als „Schauer- und Grausro-man" firmierten.30 Horace Walpoles The Castle of Otranto feierte 1765 (in deutscher Übersetzung 1768) weithin sichtbar den sentimentali-
28 Friedrich Georg Meier: Anfangsgründe aller schönen Wissenschaf ten . Erster Thei l , andere Auf lage . Halle 1754, S. 30.
29 Charles Batteux: Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz . Aus dem Französischen übers, u. mit Abhandlungen begleitet von Johann Adolf Schlegel . 3. Auf l . Leipzig 1770, S. 118ff.
30 Jürgen Vier ing: Schauerroman. In: Real lexikon der deutschen Li teraturwissenschaft . Hg. von Jan-Dirk Müller u.a. Bd. 3. Berl in, New York 2003, S. 365-368.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 1 4 3
sehen „terror", der schon den Gegensatz von kirchlicher Religiosität und heidnischem Schrecken ausspielt, wie ihn Hoffmanns Roman selbstverständlich fortführt. Walpoles neugotische Bauten auf seinem Besitz in Strawberry Hill waren im 18. Jahrhundert noch ein Ge-sprächsstoff, auch wenn die englische Tradition ihrerseits französi-schen Vorbildern folgt, vor allem den historischen Novellen von Baculard d'Arnaud31 oder Madame de Tencin.32 Ein halbes Jahrhun-dert später sind schwärmerische, oft auch künstlerisch veranlagte Helden, gotische Handlungsorte, Klöster, Kapuzinermönche und die Tag- und Alpträume längst genretypisches Inventar, das auch für Hoffmann wie für seine Leser. Mit Ann Radcliffes Erfolgsromanen wie The Italian33 waren bereits um 1800 Untergenres ausgebildet, die Radcliffe selbst dann als „school of terror" und „school of horror" unterscheiden sollte.34 Hoffmanns Roman zitiert dieses Genre mit seinen Figuren, Handlungen und Träumen, und das auf jeder Seite. Matthew Gregory Lewis' The Monk (1796),35 eines der europäischen Erfolgsbücher jener Jahre, erwähnen die Elixiere ausdrücklich.36 Aure-lie liest das „fremde", „wunderliche" Buch „Der Mönch" und findet in ihm, so scheint es ihr, ihre eigene Geschichte erzählt. Lewis' Ro-man erscheint bei Hoffmann selbst wie ein ahndungsvoller Traum. Ein Leser um 1815 konnte daher Hoffmanns Träume nicht lesen, ohne an die gotischen Schreckensträume erinnert zu werden.37 Damit aber steht die Trivialität des Genres quer zur hohen Erwartung an den romantischen Traum. Der Schauer des Genretraumes und die romantische Traumrede stellen ganz divergierende Wahrheitsansprü-che, hier der Anspruch, nur eine spannende Geschichte erzählen zu wollen, dort der Anspruch, etwas Letztes über die menschliche Seele
31 Gilbert van den Louw: Baculard d 'Arnaud. Romancier ou vulgar isateur . Essai de sociolo-gie l itteraire. Paris 1972.
32 Raymond Trousson: Romans de femmes du XVIIIe siecle. Paris 1996.
33 Ann Radcl i f fe : The Italian or The Confess ional of the Black Penitents. London 1797, deutsch: Die Ital ienerin, oder Der Beichtstuhl der schwarzen Büßenden (3 Bde). Über-setzt von Dorothea M. Liebeskind. Königsberg 1797.
34 Ann Radcl i ffe : On the Supernatural in Poetry. In: The New Monthly Magazine (1826), S. 145-152; vgl. Hans Richard Brittnacher: Ästhet ik des Horrors . Gespenster , Vampire , Monster , Teufe l und künstl iche Menschen in der phantast i schen Literatur. Frankfur t/M. 1994.
35 Christ iane Zehl Romero: M.G. Lewis ' „The Monk" and E.T.A. Hof fmann ' s „Die Elixiere des Teufe ls" . Two Vers ions of the Gothic. In: Neophi lo logus . 63/1979, S. 574-582.
36 Hoffmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 241.
37 Susanne Olson: E.T.A. Hof fmanns „Die Elixiere des Teufe l s" als Schauerroman. Los Angeles 1973.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

144 Gerhard Lauer
auszusagen. Ist Hoffmanns Roman eine romantische Unterweisung oder eine Adaption populärer Genres?
Meist behilft man sich zur Auflösung des Widerspruchs damit, das triviale Genre als Mittel zum Zweck der bedeutungsvollen, ro-mantischen Traumrede zu verstehen, schließlich löst Hoffmann die verwunschene Handlung bis zum Schluß anders als Lewis oder Rad-cliffe nie ganz auf. Auch kann der ganze Roman Hoffmanns wie ein einziger Traum seines Erzählers gelesen werden.38 Die wunderliche, gespenstische Welt, in der alles rätselhaft bedeutsam ist, ragt selbst noch in den „Nachtrag des Paters Spiridion" hinein. Wenn aber alles so seltsam erschreckend bedeutsam ist, daß selbst dem nüchternen Bibliothekar Spiridion auffällt, daß Tag und Todesstunde des gequäl-ten Bruder Medardus genau ein Jahr später auf den Schreckenstag fällt, an dem „die Nonne Rosalia auf entsetzliche Weise, gleich nach-dem sie das Gelübde abgelegt, ermordet wurde"39 und sich nun Wun-der an Wunder an diesen Tod reihen, dann verweist dies überdeutlich den Text auf sein Genre zurück, nicht auf eine tiefere Wahrheit außer ihm. Denn es gibt keine Wirklichkeit, die solchen Schreckenszufällen entspricht, noch Träume, die das ahnungsvoll miteinander verweben. Das alles ist Genre und Fiktion, der keine philosophische oder ästhe-tische Wahrheit entsprechen kann. Die genretypische Unwahrschein-lichkeit auch der Träume verlegt den Rückweg in die romantische Traumrede. Hoffmanns Träume sind daher auch keine poetische Antizipation späterer, systematischerer Einsichten Freuds oder ähnli-cher Theorien, so als würde uns die Poesie in traumähnlicher, weil ahndungsvoller Rede schon sagen, was die Geheimnisse der mensch-lichen Seele seien, die von der Wissenschaft dann erst eingeholt wer-den müßten. Es ist ja umgekehrt so, daß sich Freud auf romantische Vorstellungen beruft. Daher die suggestive Nähe zwischen Psycho-analyse und romantischer Traumauffassung. Ein Schlüssel zur Inter-pretation ist sie nicht. Weder Psychoanalyse noch Literaturwissen-schaft sind und können eine Traumdeutung avant la lettre sein, es sei denn, man betriebe sie als romantische Wissenschaften.
Was bleibt dann von Hoffmanns Träumen übrig, wenn sie den Horizont romantischer Fiktionen nicht verlassen, ja durch ihr Insi-stieren auf dem Genre die eigene romantische Traumrede unglaub-
38 Peter -Andre Alt: Der Schlaf der Vernunft . Literatur und Traum in der Kulturgeschichte der Neuzeit . München 2002, S. 283.
39 Hoffmann : Die Elixiere des Teufe ls . [Anm. 5], S. 351.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 145
haft wird? Die Antwort auf diese Frage ist, daß Hoffmanns Träume etwas über die um 1800 enorm gewachsene Fähigkeit der Literatur sagen, innere Vorgänge erzählen zu können, ganz gleichgültig, ob wir heute noch annehmen, die erzählten Innensichten seien auch nur ansatzweise wissenschaftlich haltbar und die erzählten Träume hätten etwas mit den heute erschließbaren Bedeutungen der wirklichen Träume zu tun. Die Träume in den Elixieren des Teufels haben mit der Wirklichkeit wenig, viel aber mit der Kunst des Erzählens zu tun. Sie nutzen die gewonnenen Möglichkeiten auch und gerade des „Schau-er- und Grausromans", weil es das Genre erlaubt, Figuren psycholo-gisch ganz anders zu motivieren, als das bis dahin möglich war. Man kann im Genre die Körperlichkeit der Angst dichter erzählen, wenn Medardus von seinem Doppelgänger umklammert wird, sich das böse Ich in seinen Rücken krallt. Die Figuren verstricken sich in ihren eigenen vermischten Empfindungen, verwirren ihre Motivationen und erlauben so mehrdimensionale, oft auch unentscheidbare Figu-rencharakterisierungen wie gerade in der Charakterisierung der Hauptfigur des Medardus. Das alles deshalb, weil das Genre die psy-chologische Verrätselung von Gut und Böse aufsucht. Im Genre des Schauers werden die Genealogien der Figuren komplexer verwoben und überschreiten die Generationen, wenn der Fluch, der auf Medar-dus liegt, über Jahrhunderte zurückreicht und mäandrierende Genea-logien des Schreckens zeugt. Die Ereignisse werden durch den Traum enger als dies bislang möglich war, ineinander geschoben. Denn jetzt sind ahndungsvolle Vorausdeutungen ebenso ein Stilmittel wie die auflösenden und wieder neu verwirrenden Rückdeutungen, so daß eine bedrohlich dichte Handlung entsteht. Gerade dort, wo das Traummotiv Alpträume erzählt, leistet es eine narrative Verdichtung von emotional aufgeladenen Vor- und Rückdeutungen. Das macht aus dem Traum weit mehr als ein Motiv. Der Traum wird zum orga-nisierenden Thema des Romans, das den Stoff bedeutungsvoll an-verwandelt.
Der Traum ist so gesehen ein narratives Mittel für Innovationen des Erzählens. Er kann in der Literatur um 1800 romantische Welt-auffassungen mit einer neuen Technik der inneren Figurendarstellung und einer spannungsvollen Handlungsverdichtung verknüpfen, etwas, was den Träumen im Heinrich von Ofterdingen noch fehlt, eben weil sie die populären Erzählmuster meiden. Vor allem der hochemotionale Alptraum wird bei Hoffmann zu einem Thema im Sinn der Narrato-
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

146 Gerhard Lauer
logie,40 das den Stoff erst erzählt. Das Motiv des Traums als narrati-ves Thema verdichtet die Figurenkonstellationen, motiviert die Handlungen der Figuren zu spannungsvollen Vor- und Rückbezügen, erzeugt ana- und kataphorische Ereignis folgen und intensiviert selbst noch die erzählten Landschaften und Räume zu ängstigenden Seelen-landschaften. Der Traum hebt die Zeit scheinbar auf, um die erzählte Zeit spannungsreicher und intensiver zu ordnen. Der scheinbar kör-perlose Traum erlaubt als erzählter Traum eine unerhörte Körper-lichkeit der Darstellung innerer Konflikte, so daß sich die Finger in die Augen des anderen Ichs bohren können. Die Merkmale der Zeit-losigkeit und Körperlosigkeit des Traumes machen ihn zum geeigne-ten narrativen Mittel, um dichteste Zeit und bedrängenste Leiblich-keit zu erzählen.
Damit trägt der erzählte Traum wesentlich zur Bedeutungsaufla-dung des Romans bei. Jetzt ist es wichtig, die Querbezüge und An-deutungen beim Wort zu nehmen, die Zeitläufte zu ordnen versu-chen, jedem Zittern des Körpers Bedeutung beizumessen. Das alles kann der Traum nicht gegen die populäre Literatur seiner Zeit, son-dern umgekehrt wegen ihr. In den populären Schauerromanen finden sich die narrativen Verdichtungsmuster, die aus dem Motiv des Traumes ein narratives Thema machen, das den Roman regiert und seiner Handlung unerhörte Plastizität verleiht, gerade weil die Hand-lung in der Summe ein Alp träum ist, der nur mit Mühe zu einem Schluß von poetischer Gerechtigkeit findet.41 Kein Zufall dann, daß Hoffmanns Erzählverfahren für die Literatur des 19. Jahrhunderts weit wirksamer wurden als die hochkulturellen Traum er zählungen eines Novalis. In der Moderne werden Roman und Traum zu Wahl-verwandten und bleiben es bis in die Träume eines Harry Potters, eben weil der Traum dem Roman narrative Bedeutung gibt.
Hoffmanns Träume gewähren also keine Einsichten in die Wahr-heit der menschlichen Seele, wohl aber Einsichten in die Wahrheit des Erzählens. Das ist nicht so wenig, wie es denen scheint, die gerne aus Hoffmanns Erzählungen romantische Wahrheiten über den Men-schen ableiten wollen und wenig geübt sind, gerade aus Trivialität Innovation abzuleiten. Aber genau darin sind Hoffmanns Träume so besonders. Aus dem Schauer des Trivialen wird die erzählerische
40 Vgl . Max Louwerse , Wil l ie van Peer (Hg.): Themat ics . Interdiscipl inary Studies. Amster-dam, Phi ladelphia 2002.
41 Vgl . Martha C. Nussbaum: Poet ic Just ice . Boston 1995.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM

Hoffmanns Träume. Über den Wahrheitsanspruch erzählter Träume 147
Innovation geboren, durch die mehr und genauer, spannungsreicher und intensiver erzählt werden kann als bis dahin. Der Traum ist der Geburtshelfer dieser Verbindung. Als mäeutisches Motiv leistet er, was den Stoff zum Roman macht. Die erzählten Träume sind darum Wahrheiten des Erzählens, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Brought to you by | Monash University LibraryAuthenticated | 130.194.20.173
Download Date | 10/20/12 6:57 PM