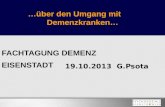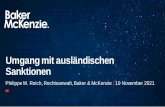Umgang mit Jugenddelinquenz
-
Upload
ulrich-mueller -
Category
Documents
-
view
224 -
download
11
Transcript of Umgang mit Jugenddelinquenz
UMGANG MIT JUGENDDELINQUENZ
Zur methodischen Qualität ihrer sozialwissenschaftlichen Erforschung*
Ulrich Mueller
Umgang mit JugenddelinquenzZusammenfassung: Für den 24. Deutschen Jugendgerichtstag 1998, veranstaltet von der DeutschenVereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V., erstellte das Kriminologische For-schungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) eine Studie ,Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität imLeben junger Menschen – Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter’, die einen umfangreichenLiteraturüberblick mit reichhaltigen eigenen Auswertungen verbindet. In ihrer Zusammenfassungnimmt sie geradezu den Charakter eines autoritativen Gutachtens für den Jugendgerichtstag an.Die Studie bezieht klare rechtspolitische Stellung: Jugenddelinquenz nimmt nach Häufigkeit undDeliktschwere ab, entgegengesetzte Beobachtungen beruhen auf statistischen Verzerreffekten. DiePolitik der Entkriminalisierung von Jugenddelinquenz soll entsprechend unbeirrt fortgesetzt wer-den. Die Lektüre zeigt einen großen Reichtum an statistischem Material, und einen ebenso großenReichtum an schweren, zum Teil unverzeihlichen methodischen Auswertungsfehlern. Zu mehre-ren Gelegenheiten werden möglicherweise unerwünschte Befunde explizit nicht mitgeteilt. DieZusammenfassung der Studie für den eiligen Leser weicht erheblich vom Haupttext ab, was dasVertrauen in die wissenschaftliche Solidität der Untersuchung weiter untergräbt.
Anlass, Herausgeberschaft, Diktion und Renommee der Autoren, die alle dem Krimi-nologischen Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) in Hannover angehören, he-ben die Studie, die im Executive Summary, dem Schlusskapitel „Abschließende Bewer-tung der Forschungsergebnisse und erste Konsequenzen“ geradezu den Charakter einesGutachtens für den Jugendgerichtstag annimmt, zu einem autoritativen Dokument fürdie öffentliche Diskussion. Das KFN spielte eine Schlüsselrolle in den von der Deut-schen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ) getragenenVeränderungen in der Praxis der Jugendstrafrechtspflege in den letzten beiden Jahr-zehnten im Sinne einer umfassenden Entkriminalisierung jugendlicher Delinquenz –erwähnt werden in der Studie die Jugendgerichtstage 1983, 1986, 1989 (S. 27). DieseEntwicklung ist in die öffentliche Kritik gekommen. Die zu diskutierende Studie hälthier entschieden dagegen, und hat über Strecken insofern auch den Charakter einer
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 52, Heft 1, 2000, S. 132–141.
* Eine Auseinandersetzung mit der Schrift: Christian Pfeiffer, Ingo Delzer, Dirk Enzmann undPeter Wetzels, 1998: Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger Menschen –Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter. Herausgegeben von der Deutschen Vereini-gung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ) Lützerodestrasse 9, 30161Hannover. Erschienen als Sonderdruck zum 24. Deutschen Jugendgerichtstag 18.–22. Sep-tember 1998 in Hamburg, 112 Seiten; die Schrift wird kostenlos abgegeben.
Rechtfertigungsschrift, die bemerkenswerte Einblicke in das Denken maßgeblicher Trä-ger jener Entwicklungen im Jugendstrafrecht ermöglicht.
Die Autoren haben klare Werte und Absichten in der politischen Auseinanderset-zung über den richtigen Umgang mit Jugenddelinquenz: Entkriminalisierung, Zurück-drängung aller generalpräventiver Ansätze, Erziehung eines als oft emotional und unin-formiert urteilenden Publikums durch Aufklärung über Fakten und Realitäten.
Der vorliegende Diskussionsbeitrag konzentriert sich auf nur einen Aspekt der Stu-die, nämlich die methodische Qualität der Sozialwissenschaft hinter den empirischenBefunden und ihrer Diskussion. Dieser Aspekt ist allerdings ein zentraler des ganzenAnsatzes. Man kann aus rein weltanschaulichen Gründen härtere oder mildere Strafengegenüber jugendlicher Delinquenz verlangen. Wer aber die Öffentlichkeit mit rationa-ler Argumentation für einen sachlichen, rationalen Umgang mit jugendlicher Delin-quenz gewinnen will, muss sich in besonderer Weise einer wissenschaftlichen Prüfungseiner Sachbehauptungen stellen.
Den Leser erwartet reiches Datenmaterial aus der polizeilichen Kriminalstatistik,der staatsanwaltlichen Strafverfolgungsstatistik, einer breit angelegten Aktenanalyse zuRaub und qualifizierter Körperverletzung in Hannover in den Jahren 1990, 1993 und1996 (1303 Beschuldigte und 1101 Opfer), Dunkelfelderhebungen zu Opfer- und Tä-tererfahrungen in Hamburg, Hannover, Leipzig und Stuttgart mit 9775 vollständigBefragten im Alter zwischen 13 und 24 Jahren, komplettiert durch eine kleine Umfra-ge unter 19 Jugendstrafanstalten über die Anteile von Aussiedlern und Nichtdeutschenunter ihren Insassen. Das gesamte Datenmaterial wird überdies in Bezug gesetzt zu ei-ner Vielzahl einschlägiger Erhebungen aus dem In- und Ausland.
Die Botschaft der Studie ist, dass jugendliche Gewaltkriminalität tatsächlich zuge-nommen hat, wobei Angehörige nicht-einheimischer Ethnien überproportional häufigdelinquent werden. Beide Entwicklungen seien aber zu einem gewissen Teil (Haupt-text) beziehungsweise ganz überwiegend (Executive Summary) Folge eines durch zu-nehmende ethnische Heterogenität gestiegenen Anzeigeverhaltens sowie weiterer stati-stischer Verzerreffekte. Die gegenüber früher milderen Strafen und häufigeren Verfah-renseinstellungen durch Justiz und Strafverfolgungsbehörden seien Folge einer sinken-den Deliktschwere und nicht einer veränderten Sanktionspraxis von Gerichten undStaatsanwaltschaften. Ein besonderes Augenmerk richtet die Studie darauf, wie Gewalt-kriminalität Minderjähriger durch das Erleben innerfamiliärer Gewalt als Opfer oderZeuge gefördert wird. Dieser Teil der Studie ist notwendig und verdienstvoll. Es über-rascht freilich die Behauptung, dass innerfamiliäre Gewalt von Erwachsenen gegenüberKindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit „in der Regel nicht thematisiert“,während etwa das Thema „Gewalt in der Schule ... von den Medien begierig aufgegrif-fen“ werde (88). Ist dies eine zutreffende Einschätzung der öffentlichen Diskussion inDeutschland im Jahre 1998, dass Gewalt von Erwachsenen gegenüber Kindern und Ju-gendlichen von den Medien in der Regel nicht thematisiert werde?
Man merkt den Autoren große Erfahrung beim Umgang mit den Datenquellen wieauch mit der Praxis der Jugendstrafrechtsanwendung an. Im Vergleich der Datenquel-len miteinander, in der Abwägung möglicher Selektivitäten gehen sie mit einem dieserErfahrung entsprechenden Scharfsinn vor.
Dies reicht aber für die Einlösung des hohen Anspruchs der Studie nicht aus. Kri-
Umgang mit Jugenddelinquenz 133
tik ist gegen die wissenschaftliche Qualität der Datenauswertung vorzubringen: Hierverfehlen die Autoren in vieler Hinsicht die heute verlangten und in weiten Bereichender empirischen Sozialforschung, von der Arbeitsmarkt-, Wahl-, Medienwirkungs- undOrganisationsforschung bis hin zur Epidemiologie fest etablierten wissenschaftlichenund methodischen Standards. Solchermaßen ungenügend gesicherte Befunde und Er-gebnisse muss man vorläufig als dahingestellt betrachten, und zur Kenntnis nehmen,dass die weit reichenden Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen der Autorennicht durch Fakten, sondern nur durch Vermutungen gestützt sind. Dies gilt leiderauch für zentrale Ergebnisse der Studie.
Aufklärung bedarf zudem die auffällige Diskrepanz zwischen der Darstellung be-stimmter Befunde im ausführlichen Haupttext und ihrer Wiedergabe im knappen„Executive Summary“ für den eiligen Leser am Ende der Studie.
I.
Es fällt bei der Lektüre das fast völlige Fehlen von Verfahren der prüfenden Statistikauf. In 70 Schaubildern und 18 Tabellen werden eine Unzahl von Gruppendifferenzenvon absoluten und relativen Häufigkeiten und Mittelwerten dargestellt, Zusammen-hangsmasse werden demgegenüber nur etwa 5–10 mal im Text angegeben. In allenFällen wird kein Hinweis gegeben, welche der mitgeteilten Unterschiede beziehungs-weise Zusammenhänge einer üblichen Signifikanzprüfung standhalten und folglichüberhaupt relevant sind. Alles was der Leser dazu erfährt, ist der häufige Gebrauch desWortes „signifikant“ im Text, ohne dass das entsprechende exakte Niveau angegebenwird. Nach Zählung des Verfassers dieser Zeilen wird die einschlägige Kennzahl, aufdie nicht verzichtet werden kann, soll ein selbstständiges Urteil über die Qualität desMitgeteilten möglich sein, nur einmal im Text explizit erwähnt (Seite 77: r = .30;p < .0001). Wie soll man das deuten? Konnten all diejenigen Befunde, die von denAutoren nicht explizit als „signifikant“ bezeichnet werden, durch Verfahren der prüfen-den Statistik nicht gesichert werden? Bedeutet die seltene Erwähnung des exakten Si-gnifikanzniveaus, dass alle anderen als „signifikant“ bezeichneten Ergebnisse nur auf ei-nem viel schwächeren Signifikanzniveau gesichert werden konnten? Bedeutet die sehrseltene Angabe von Zusammenhangsmaßen, dass trotz sichtbarer Mittelwerts- oderHäufigkeitsunterschiede der beobachtete Zusammenhang in der übergroßen Mehrzahlaller Fälle nur schwach war? Und wenn dies so ist, was folgt hieraus für Zuverlässig-keit, Gültigkeit und Aussagekraft all dieser Ergebnisse?
Der Verzicht auf Verfahren der prüfenden Statistik bedeutet das absichtsvolle Öff-nen für Fehl- und Überinterpretationen der Befunde. Hierfür seien drei Beispiele ge-nannt:
Beispiel I.1: Abbildung 43 (Anzeigeverhalten nach ethnischer Zugehörigkeit von Täterund Opfer): Man wüsste gerne, welche Mittelwertunterschiede in den betrachteten In-teraktionseffekten der beiden dichotomen Faktoren (Opfer deutsch/nichtdeutsch; Täterdeutsch/nichtdeutsch) der Abbildung nun „signifikant“ (76) sind. Die Studie selbstdeutet den Befund als Beleg eines allgemeinen „ethnienspezifischen Anzeigeverhaltens“und baut weitestreichende Schlussfolgerungen auf dieser Interpretation auf. Aus den
134 Ulrich Mueller
mitgeteilten Daten geht nur hervor, dass deutsche Opfer nicht-deutsche Täter „signifi-kant“ häufiger anzeigen als deutsche Täter. Zeigen analog auch nicht-deutsche Opferdeutsche Täter „signifikant“ häufiger an als nicht-deutsche Täter? Müssten nicht be-deutsame Differenzierungen im mitgeteilten Befund eines „ethnienspezifischen Anzei-geverhaltens“ (75) vorgenommen werden, wenn nur der erste Mittelwertsunterschiedstatistisch gesichert werden könnte?
Beispiel I.2: Die in Abbildung 61 (Viktimisierung Jugendlicher durch schwere elterli-che Gewalt im letzten Jahr nach Ethnie und Arbeitslosigkeit/Sozialhilfe) mitgeteilten Mit-telwertsunterschiede dürften bei einigen Ethnien einer Signifikanzprüfung nicht stand-halten. Die Interpretation der Gesamtbefunde müsste dann erheblich differenziert wer-den; etwa dahingehend, dass schlechte wirtschaftliche Lage, gemessen durch Arbeitslo-sigkeit/Bezug von Sozialhilfe etwa bei Aussiedlern GUS keinen Einfluss auf die Vikti-misierung Jugendlicher durch elterliche Gewalt habe, – und folglich gerade in dieserbesonders täterdelinquenzbelasteten Gruppe (so in Abschnitt 2.2.1) ethnienspezifischeFaktoren möglicherweise kausal wichtiger für das Abgleiten in jugendliche Delinquenzwären als sozio-ökonomische Faktoren.
Beispiel I.3: Abbildung 62 (Gewalterfahrungen in der Kindheit und selbstberichtetesaktives Gewalthandeln Jugendlicher in 1997) belegt einen lediglich geringfügigen Unter-schied zwischen den Kategorien „nie“ (17,7 Prozent) und „leichte Züchtigung“ (18,8Prozent), der anders als die Unterschiede zu „schwere Züchtigung“ oder „Misshand-lung“ nicht signifikant sein dürfte. Die Schlussfolgerung müsste dahingehend differen-ziert werden, dass eine gelegentliche Ohrfeige oder Klaps (die aus anderen Erwägungenheraus verwerflich sind) noch keinen zum Schläger gemacht hat, sondern erst schwerebzw. häufige Züchtigung oder gar Schlimmeres. Man darf vermuten, dass es keinesfallsdie gleichen Variablen sind, die einerseits Elternhäuser, in denen überhaupt nie ge-schlagen wird, von allen anderen unterscheiden, oder andererseits Elternhäuser, in de-nen häufig und schwer gezüchtigt wird, von allen anderen unterscheiden. Je nach ge-messenem Schwellenwert für den Einfluss von Gewalterfahrungen in der Kindheit aufselbstberichtetes aktives Gewalthandeln Jugendlicher müssten unterschiedliche Strate-gien der Delinquenzprävention empfohlen werden.
II.
Einige der zentralen Behauptungen der Studie lassen sich mit allgemeinen Regeln derLogik und der Kombinatorik nicht vereinbaren.
Beispiel II.1: Die Behauptung auf Seite 75 der Studie, wonach „ethnisch selektiveTendenzen zur Anzeige... sich bei einer Betrachtung kompensieren, welche die ethni-schen Täter/Opfer-Kombinationen nicht berücksichtigt, so daß bei einer alleinigen Be-trachtung der ethnischen Zugehörigkeit der Täter es so erscheint, als gäbe es kein eth-nisch selektives Anzeigeverhalten“ stimmt nur dann, wenn sich ethnisch selektive An-zeigewahrscheinlichkeiten zueinander in höchst speziellen Zahlenrelationen verhalten,die sich aus den relativen Häufigkeiten der einzelnen Ethnien ergeben. Ein Zahlenbei-spiel: Es sei die wahre Täterprävalenz in zwei Ethnien A und B gleich groß. Da dasAnzeigeverhalten der Opfer interessiert, werden entsprechend der Argumentation der
Umgang mit Jugenddelinquenz 135
Studie mögliche Präferenzen der Täter für Opfer bestimmter Ethnien als konstant ge-setzt: einfachheitshalber, aber ohne Verlust an Allgemeinheit, unterstellen wir die Täterhier als indifferent. Homoethnische Täter sollen in beiden Ethnien gleichermaßen zu50 Prozent, heteroethnische Täter zu 75 Prozent von Opfern angezeigt werden. Dann„kompensieren“ sich ethnisch selektive Tendenzen zur Anzeige in der zitierten Weisedann und nur dann, wenn Ethnie A und Ethnie B gleich häufig sind. Werden nun ab-weichend homoethnische Täter in Ethnie B zu 60 Prozent, heteroethnische Täter zu70 Prozent von Opfern angezeigt werden, so werden die ethnisch selektiven Tenden-zen zur Anzeige dann und nur dann kompensiert, wenn Ethnie A 42,9 Prozent undEthnie B 57,1 Prozent der Bevölkerung ausmachen.
Nichts spricht dafür, dass diese stets vorliegende höchst spezielle algebraische Kon-stellation zwischen ethnisch selektiven Anzeigewahrscheinlichkeiten und relativen Häu-figkeiten der Ethnien im Normalfall empirisch vorliegt, sodass man damit empirischePhänomene erklären könnte; der Nachweis wird von den Autoren auch erst gar nichtversucht.
Beispiel II.2: Eine weitere zentrale Behauptung der Studie ist, dass bei Zunahmeder ethnischen Heterogenität und bei größerer Bereitschaft, Täter aus anderen Ethnienanzuzeigen, die registrierte Kriminalität ansteigen würde, ohne dass die tatsächlicheKriminalität zugenommen habe (106). Diese Folgerung ist korrekt. Unmittelbar darauffolgt die Behauptung „die ungleichen Anteile der verschiedenen Ethnien in der Bevöl-kerung und das ethnisch selektive Anzeigeverhalten bewirken zudem, dass die Angehö-rigen von ,fremden’ ethnischen Gruppen in der Tatverdächtigenstatistik stärker reprä-sentiert sind, als ihrem tatsächlichen Anteil entspricht“. Die zweite Behauptung ist indiesem Kontext falsch: Die Überrepräsentierung von Tätern aus Minderheitsethniennimmt mit zunehmender ethnischer Heterogenität notwendigerweise nicht zu, sondernab, wie ein einfaches Zahlenbeispiel zeigt: Annahmegemäß sei die wahre Täterpräva-lenz in zwei Ethnien A und B gleich groß, wieder sei den Tätern die Ethnie ihrer Op-fer egal. Homoethnische Täter sollen zu 50 Prozent, heteroethnische Täter zu 75 Pro-zent von Opfern angezeigt werden. Dann ist bei einer Verteilung von 90 Prozent Eth-nie A und 10 Prozent Ethnie B in einer Bevölkerung und Chance eines Täters derEthnie B, angezeigt zu werden, 138,1 Prozent so groß wie die eines Täters aus derEthnie A, bei einer generellen Anzeigequote von 54 Prozent. Bei einer Verteilung von80 Prozent der Ethnie A und 20 Prozent der Ethnie B steigt die allgemeine Anzeige-quote auf 58 Prozent, während die Chance eines Täters aus Ethnie B, angezeigt zuwerden, zurückgeht auf 127,3 Prozent der Chancen eines Täters aus Ethnie A.
Entscheidend für die Größe des behaupteten Verzerreffekts, wenn es ihn überhauptgibt, ist das unterschiedliche Anzeigeverhalten nach vermuteter Täterethnie von Opfernaus der Mehrheitsethnie: der Verzerreffekt kann maximal so groß sein wie diese Diffe-renz. Aus dem Befund aus Abbildung 43 ergibt sich, dass im Extremfall – es gebe kei-ne ausländischen Opfer – der Verzerreffekt zu einer gegenüber der wahren Täterpräva-lenz maximal um den Faktor 1.5 höheren Prävalenz angezeigter Taten führen kann.Da die Autoren Tatverdächtigenziffern für Nichtdeutsche zwar berechnet haben, dieseaber wegen statistischer Verzerrungen zur Vermeidung von Fehldeutungen nicht veröf-fentlichen (21) – einer wissenschaftlichen Schrift angemessener wäre es gewesen, dieZahlen dann zusammen mit einer Abschätzung der Verzerrungen zu nennen – lässt
136 Ulrich Mueller
sich nicht nachprüfen, wieweit nach Ethnien unterschiedliche Täterhäufigkeiten über-haupt im für die Autoren der Studie günstigsten Fall auf den Effekt eines nach Ethniedes Täters unterschiedlichen Anzeigeverhaltens erklärt werden kann. Immerhin lässtsich aus Abbildung 13 ersehen, dass die Gewaltkriminalität Nichtdeutscher in der Al-tersklasse 14–18 im Zeitraum 1984–1993 um 150 Prozent gestiegen ist. In der Studievon Elsner et al. (1998) auf der Basis von Polizeidaten der Stadt München stieg beiGewaltkriminalität der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger in derselben Altersklasseder Gesamtbevölkerung von 28,5 Prozent im Jahre 1985 auf 64,6 Prozent im Jahre1996. Diese Jahre – insbesondere bis 1993 – sahen zugleich einen massiven Anstiegdes Ausländersanteils dieser Altersgruppe. Die Schlussfolgerung ist zwingend, dass diehöhere Täterprävalenz von Nichtdeutschen in den betrachteten Zeiträumen schon vonder Größenordnung her nicht einmal überwiegend auf den Effekt eines nach Ethniedes Täters unterschiedlichen Anzeigeverhaltens von Opfern der Mehrheitsethnie erklärtwerden kann.
III.
Auffällig ist weiterhin das völlige Fehlen multivariater Auswertungsverfahren. DerenAnwendung würden sicherlich die Daten aus den Dunkelfelduntersuchungen, der Ak-tenanalyse, der Befragung der Jugendstrafanstalten und in eingeschränkter Weise auchdie Daten aus der polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistikdurchaus erlauben. Zentrale Fragestellungen der Studie bleiben durch dieses Versäum-nis unbeantwortet. Ein Beispiel hierfür: angesichts der auch in der Studie vielfach be-legten starken statistischen Relationen zwischen Ethnizität, innerfamiliärer Gewalt, Ar-beitslosigkeit/Sozialhilfebezug im elterlichen Haushalt und Schulbildung des Kindes/Ju-gendlichen muss zwingend die Frage geprüft werden, was der relative Anteil jeder die-ser vier Faktoren für Gewaltdelinquenz jugendlicher Täter ist. Die Antwort auf dieseFrage hat offenkundig auch wichtige praktische Konsequenzen für die Kriminalitäts-prävention. Warum wenden die Autoren niemals sich anbietende Verfahren der Va-rianzanalyse, der multivariaten Regression, der Pfadanalyse an? Sie werden in jedemStatistiklehrbuch für Sozialwissenschaftler abgehandelt, sind in jedem handelsüblichenStatistikprogramm für Datenauswertung auf dem Rechner enthalten, und haben seitJahrzehnten einen festen Platz in der wissenschaftlichen Literatur zur empirischen So-zialforschung. Ihre Kenntnis dürfte also bei einem nicht geringen Teil des Zielpubli-kums der Studie vorausgesetzt werden können. Das Prinzip und die Resultate der ge-nannten multivariaten Auswertungsverfahren dürften sich auch einem Juristen oderLehrer leicht verständlich machen lassen.
IV.
Über die kriminalpolitischen Werte und Absichten der Autoren bleibt kein Leser imUnklaren: Die Autoren erwähnen selbstbewusst, dass „... sowohl wissenschaftliche Be-funde ... als auch die breitgestreuten Fortbildungsaktivitäten des Bundesjustizministeri-
Umgang mit Jugenddelinquenz 137
ums und der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V.(also der Herausgeberin der Studie U.M.) es den Jugendstaatsanwälten nahe gelegt ha-ben, bei der leichten bis mittelschweren Jugenddelinquenz verstärkt auf formelle Ver-fahren zu verzichten. Auch die von vielen Landesjustizverwaltungen erlassenen Diversi-fikationsrichtlinien haben die kriminalpolitische Neuorientierung stabilisiert“ (27). DieAutoren erwähnen weiter anerkennend, dass die Jugendgerichte „ihren in den 80erJahren eingeschlagenen Kurs“ auch bei der Anwendung des Jugendstrafrechts auf Her-anwachsende, trotz eines zunehmenden Drucks der öffentlichen Meinung beibehaltenhaben (33).
Zwingende wissenschaftliche Pflicht politisch engagierter Forscher im Sinne guterwissenschaftlicher Praxis ist es dann, gerade solche Hypothesen, welche die eigenenWerte und Absichten in Frage zu stellen geeignet sind, besonders gründlich zu prüfen.Genau dies unterbleibt hier in einer auffälligen Weise.
Der politisch vielleicht wichtigste Befund im Sinn der Autoren ist, dass die vonTeilen des Publikums – bis hinhein in eher „linke“ Publikationsorgane wie SPIEGEL,STERN und ZEIT – wahrgenommene zunehmende Milde von Staatsanwaltschaftenund Jugendgerichten angesichts einer zunehmenden Kinder- und Jugendgewaltkrimina-lität eine Falschwahrnehmung ist, dass die niedrigeren Strafen stattdessen durch einSinken der durchschnittlichen Deliktschwere bei den immer jüngeren Tätern zu erklä-ren seien. Die auf den Seiten 34–40 mitgeteilten Befunde über Schadenssummen beiRaubdelikten oder die Schwere von Körperverletzungstaten in der Aktenanalyse Han-nover (s.o.) unterstützen diese Behauptung. Wie steht es aber mit dem Befund, dass inHannover nur bei den nicht-zugewanderten Deutschen die Verurteilungen Angeklagterzu Jugendstrafe „rückläufig“ (von 21,5 Prozent auf 18,2 Prozent – ist der Unterschiedüberhaupt signifikant?) waren, sich bei allen anderen Ethnien aber im betrachtetenZeitraum 1990–1996 verdoppelten? Vielleicht weil sich bei diesen Tätern der Anteilder Delikte mit mitgeführter Waffe fast vervierfacht hat (45), während er sich bei dennicht-zugewanderten Deutschen „nur“ um den Faktor 2.2 erhöhte? Wie vertragen sichdiese Beobachtungen mit der These von der abnehmenden Deliktschwere?
Leider waren „die Auswertungen zu dieser Frage ... bei Abschluß dieses Manu-skripts noch nicht abgeschlossen“ (45).
Die alternative Erklärung, wonach tatsächlich Jugendgerichte bei gleicher Delikt-schwere heute mildere Strafen aussprechen als früher – wird auch sonst mehrfach er-wähnt (32ff.), aber stets ebenso ungeprüft verworfen. Beispiel: „Im Jahre 1984 wurdengegenüber Raubdelikten noch vier mal so oft wie gegenüber Diebstahlsdelikten Ju-gendstrafen/Freiheitsstrafen ohne Bewährung angeordnet, 1996 dagegen nur noch 2,3mal so oft. Offenkundig hat sich die Tatschwere der Raubdelikte im Verlauf der12 Jahre zunehmend in Richtung der Diebstahldelikte verändert“ (33). Gleichzeitig be-obachten die Autoren, dass die Häufigkeit der verhängten Jugendstrafen/Freiheitsstra-fen bei den Diebstahlsdelikten kaum abgenommen hat (33). Wie steht es mit der Al-ternativerklärung, dass heute manche Delikte, die früher als Raub angeklagt wurden,heute als Diebstahlsfälle vor Gericht erscheinen? Warum geht die Studie dieser Fragenicht nach, obwohl dies mit dem vorliegenden Datenmaterial leicht möglich wäre?
138 Ulrich Mueller
V.
Obwohl die Daten Längsschnittanalysen auf Individualdatenbasis erlaubten (94), wirdeiner weiteren für die gesamte Interpretation der Ergebnisse entscheidenden Fragenicht nachgegangen – nämlich ob es sich bei dem Trend zu jüngeren Tätern mit ge-ringerer Deliktschwere um eine Vorverschiebung (fängt früher an und hört auch früherwieder auf) oder um einen früheren Beginn (fängt früher an, hört aber nicht früherauf) handelt? Verlagert sich hier ein relativ konstant bleibendes Gewaltdeliktpotenzialin ein früheres Lebensalter, in dem die Deliktschwere grundsätzlich niedriger sein mag,was – über einen längeren Zeitraum betrachtet – eine geringere Gesamtbelastung derGesellschaft durch Jugenddelinquenz erwarten liesse? Oder wächst in jüngeren Kohor-ten ein erhöhtes Gewaltdeliktpotenzial nach, welches sich bereits zu einem früheren Al-ter zum ersten Mal manifestiert?
VI.
Es ist nicht leicht, sich auf diese vielfältigen Versäumnisse mit ihren fatalen Folgen aufdie Qualität der ganzen Studie einen Reim zu machen. Waren die Autoren wirklichnicht über die anzuwendenden methodischen Standards unterrichtet? Oder hat mandiese Standards angewandt, wollte aber die damit erzielten Resultate nicht wiederge-ben, weil sie die eigene Position angreifbarer gemacht hätten? Dass die Autoren selbst-bewusst schreiben, sie hätten Tatverdächtigenziffern für Nichtdeutsche berechnet, woll-ten diese, die im Vergleich zu Deutschen als „überhöht“ erschienen, aber nicht publi-zieren (21), macht die zweite Möglichkeit zur wahrscheinlicheren.
Vielleicht wird sich aber auf manches des hier kritisch Vorgebrachten bei vertiefterAuswertung des großen Datenmaterials der Studie doch noch eine stichhaltige Entgeg-nung im Sinne der Autoren finden lassen.
Noch stärker als durch die methodischen Schwächen der Studie wird aber das Ver-trauen des Lesers in die Sorgfalt der Autoren untergraben durch die auffälligen Diskre-panzen zwischen der Darstellung der Ergebnisse im Hauptteil und ihrer Wiedergabeim knappen Abschnitt „Abschließende Bewertung der Forschungsergebnisse und ersteKonsequenzen“, dem für eilige Leser bestimmte „Executive Summary“. Dazu drei Bei-spiele:
Beispiel VI.1: Die Ausführungen unter Punkt 4 der „Abschließenden Bewertung...“über die Entwicklung der Angeklagtenzahlen aus nicht-einheimischen Ethnien stehenin krassem Widerspruch zu den ausführlichen Darlegungen in Abschnitt 2.2.1 desHauptteils. Das In-einen-Topf-werfen von Ausländern und Aussiedlern und der imHauptteil nirgendwo so auftauchende Zeitrahmen 1991–1996 im Executive Summaryunterschlägt, was auf den Seiten 19–25 detailliert dargelegt wird, dass nämlich wäh-rend dieses Zeitraums die Asylbewerberzahlen bis 1993 zu-, und dann drastisch abge-nommen haben. Die Aussiedlerzahlen hingegen sind während dieses Zeitraums konti-nuierlich angewachsen; ihre Integrationschancen haben sich nach Einschätzung der Au-toren der Studie seit 1992 eher ungünstig entwickelt (22ff.). Entsprechend sind dieTatverdächtigenzahlen für Asylbewerber von einem hohen Niveau seit 1993 gesunken,
Umgang mit Jugenddelinquenz 139
die für Aussiedler gestiegen. Das heißt, die im Hauptteil des Textes detailliert belegtehöhere Delinquenz von Jugendlichen aus nicht-einheimischen Ethnien und die durchdie zahlenmäßige Zunahme solcher Jugendlichen verursachte zeitliche Dynamik derKriminalitätsentwicklung wird im Executive Summary durch die Wahl eines bestimm-ten Zeitrahmens, für den nach den Ausführungen im Hauptteil des Textes sachlichnichts spricht, und durch das bewusste Zusammenzählen von Äpfeln (Asylbewerber)und Birnen (Aussiedler) wieder heruntergerechnet.
Beispiel VI.2: Die massiven Befunde zu einer höheren Täterrate nicht-einheimischerKinder und Jugendlicher, wie im Haupttext Seite 19–25 beschrieben, werden in Punkt6 des Kapitels in auffälliger Weise relativiert, einmal durch die – wie oben gezeigt –falschen Behauptungen über eine aus zunehmender ethnischer Heterogenität und eth-nienselektivem Anzeigeverhalten von Opfern folgende Überrepräsentierung von Täternin der Delinquenzstatistik, oder durch Verweis auf „Verzerrungsfaktoren in den Dun-kelfeldbefragungen“, die über diesen Verweis hinaus nicht belegt werden.
Beispiel VI.3: Die Behauptungen in Punkt 9 des Executive Summary, wonach diedurchschnittliche Tatschwere von Fällen der polizeilich registrierten Raubdelikte undgefährlichen/schweren Körperverletzungen junger Menschen in Hannover 1990–1996erheblich abgenommen habe „... nach allen Kriterien, die wir zur Beurteilung dieserFrage heranziehen konnten: dem Anteil der Ersttäter unter den Angeklagten, der Scha-denshöhe, dem Einsatz von Waffen und dem Grad der durch die Gewalttat eingetrete-nen Verletzung des Opfers“, widersprechen eklatant den Ausführungen zur Vervierfa-chung der Waffenmitführung bei den Ausländern und der starken Verdoppelung beiden Inländern im Hauptteil (45).
Warum wird in der Liste eigentlich Ersttäterschaft als Indikator für Tatschwereaufgeführt? Vielleicht weil Ersttäter milder bestraft werden, und weil mildere Strafenauf geringere Tatschwere hinweisen ...?
VII.
Alles in allem ist die Perspektive nach einer kritischen Lektüre beunruhigend. Von denAutoren wird – jedenfalls im Haupttext – nicht in Frage gestellt, dass es in unseremLand wie im europaweiten Vergleich einen Trend zu mehr Gewaltkriminalität immerjüngerer Jugendlicher gibt, gekennzeichnet durch eine erheblich größere Delinquenzjunger Ausländer, wobei schlechte sozioökonomische Lage, Zugehörigkeit zu bestimm-ten ethnischen Gruppen, innerfamiliäre Gewalt im Elternhaus, geringe eigene Schulbil-dung und schlechte Chancen bei Ausbildungsplatzsuche und auf dem Arbeitsmarkt er-heblich fördernde Faktoren sind.
Dies weist auf große, womöglich noch wachsende Probleme bei der Erfüllung derstaatlichen Aufgaben hin, einerseits allen Kindern in unserer Gesellschaft ausreichendeChancen zu eröffnen auf ein selbstbestimmtes erfolgreiches Leben ohne Anreiz, Le-bensziele durch Rechtsbruch zu erreichen; andererseits alle Bürger und gerade auchKinder und Jugendliche mit aller Kraft und Härte gegen kriminelle Gewalt zu schüt-zen. Von führenden, wohlausgestatteten Forschern wie den Autoren, die umfangreicheaussagekräftige Primär- und Sekundärdatensätze zur Verfügung haben, und sich hier
140 Ulrich Mueller
auch getragen von der Autorität eines wesentlichen Teils der Praktiker der Jugendstraf-justiz an die Öffentlichkeit wenden, erhält man eine Studie mit einem Titel, wie manihn sich kaum breiter angelegt vorstellen kann, welche bei der Auswertung dieses reich-haltigen Materials jedoch die zu fordernden wissenschaftlichen Standards in schwerwiegender Weise missachtet.
Beunruhigend auch, wie die Autoren, sich auf der richtigen Seite der Geschichtewissend, sich belagert sehen von einer durch verantwortungslose Medien emotionali-sierten, uninformierten Öffentlichkeit, die nach dem Zusammenbruch des Kommunis-mus ein neues Feindbild in Gestalt einer überbordenden Jugendgewaltkriminalitätbrauche (4). Da man das schon von vornherein weiß (woher eigentlich?), muss manauch gar nicht mehr fragen, warum ein wachsender Teil der deutschen und auch euro-päischen Öffentlichkeit, die doch in ihrer Mehrheit in den letzten Jahren links gewählthat (und wo nicht, dann sicher nicht aus Kriminalitätsfurcht), der Politik der Entkri-minalisierung der Jugendgewaltdelinquenz nicht mehr folgen will – was etwa eine hol-ländische Erhebung zum Vertrauen der Bevölkerung in Justiz und Polizei von 1998nachdrücklich belegt, über die auch in der Tagespresse (FAZ vom 6. Januar 1999) aus-führlich berichtet wurde – und das, obwohl die allgemeine Kriminalitätsangst inDeutschland wie in Europa seit der Mitte der 90er Jahre eher abgenommen hat (Al-lensbacher Berichte 1999/12).
Literatur
Elsner, E., W. Steffen und G. Stern, 1998: Kinder- und Jugendkriminalität in München. BayerischesLandeskriminalamt.
Allensbacher Berichte, 1999: Deutsche Sorgen und Ängste 1999. Allensbacher Berichte 12. Allens-bach: Institut für Demoskopie.
Korrespondenzanschrift: Prof. Dr. Dr. Ulrich Mueller, Institut für Medizinische Soziologie und So-zialmedizin, Klinikum der Universität Marburg, Bunsenstraße 2, D-35033 Marburg
E-Mail: [email protected]
Umgang mit Jugenddelinquenz 141