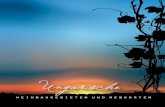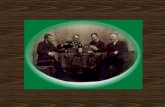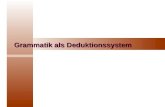Ungarische Grammatik () || MITTEL DER SATZFÜGUNG OHNE SELBSTÄNDIGEN LAUTKÖRPER
Transcript of Ungarische Grammatik () || MITTEL DER SATZFÜGUNG OHNE SELBSTÄNDIGEN LAUTKÖRPER
M I T T E L D E R S A T Z F Ü G U N G O H N E S E L B S T Ä N D I G E N L A U T K Ö R P E R
A) Der Satzton
(§ 204) Über die phonetische Beschaffenheit der Betonung sowie darüber, welche Wortsilbe im allgemeinen den Ton trägt, war schon kurz die Rede.
Ob in der ungarischen Rede der Ton tatsächlich auf ein Wort fällt oder nicht, hängt zumeist vom s i n n g e m ä ß e n , mitunter von g e f ü h l s -m ä ß i g e n , ja auch von r h y t h m i s c h e n Elementen ab.
A) Die s i n n g e m ä ß e Betonung besteht darin, daß der Sprechende die für das V e r s t ä n d n i s , d. h. o b j e k t i v wichtigen — ζ. B. in-haltlich neuen, fallweise zu anderen Details parallelen oder entgegen-gesetzten — Elemente durch das Mehr der Betonung hervorhebt, die in diesem Zusammenhang nebensächlichen Details unbetont läßt (Miert nem /e'Zjegyet vältasz? 'Warum löst du nicht eine Halbkarte ?'; Csak a wagyobb fiam jön: a &isebbel sok baj volna 'Nur mein größerer Junge kommt: mit dem kleineren hätten wir viel zu schaffen').
Die Betonung läßt sich an keine w o r t a r t l i c h e n Komponenten binden; immerhin gibt es Wortarten, die auf Grund ihrer inhaltlichen Ele-mente im allgemeinen betont bzw. unbetont stehen. So ist das I n t e r -r o g a t i v p r o n o m e n bzw. das interrogative Pronominaladverb b e-t o n t C M i t keresel itt ? 'Was suchst du da ?'). Sehr oft t rägt das Demonstra-tivum als S a t z h i n w e i s den Ton (Akkor szep az erdö, mikor zöld [Volkslied] 'Schön ist der Wald, als er grünet'). Ebenso verhält es sich mit den V e r n e i n u n g s w ö r t e r n bzw. mit den negativ fungierenden Pronomina bzw. Pronominaladverbien usw. (Ezert nem te vagy a feielos 'Dafür bist nicht du verantwortlich !'; Ma semmit se mondj neki! 'Sage ihm heute nichts !'). Dasselbe bezieht sich auf die satzwertigen I n t e r j e k -t i o n e n (A t&ncot ο de szeretem ! 'Den Tanz hab' ich ach so gern !').
Umgekehrt sind die F o r m w ö r t e r im Satz zumeist t o n l o s : so der Artikel, die Postposition und die Konjunktion (A hätterböl elö-lepett egy ferfi 'Aus dem Hintergrund t ra t ein Mann hervor'; Eger mellett nyaraltunk 'Wir waren bei Erlau in der Sommerfrische'; Pal es te velünk jöttök? Kommt Paul und du mit?'). — Selbstverständlich ließen sich in beiden Gruppen für Abweichungen reichlich Beispiele anführen.
Die sinngemäße Betonung wird auch dadurch n i c h t eindeutig be-stimmt, welches Wort als das eine oder andere S a t z g l i e d fungiert, weil alle Satzglieder sowohl wesentliche als auch weniger wichtige oder un-wesentliche Momente bezeichnen können. Immerhin ist das q u a l i t a -t i v e und q u a n t i t a t i v e A t t r i b u t z u m e i s t b e t o n t , das Bezugswort jedoch oft tonlos (Hideg vizben fürödj ! 'Bade in kaltem
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
336 DER SATZTON
Wasser!'); auch das dem Grundglied vorangesetzte O b j e k t und A d-v e r b i a l e trägt zumeist den Ton (A gyerek lean yarot kapott 'Das Kind hat Masern bekommen'; $etalni mesz? 'Gehst du spazieren?'). Im prädi-kativen Syntagma trägt auch das dem Subjekt vorangesetzte P r ä d i k a t meistens den Ton (Kel lemes az idö ! 'Angenehm ist das Wetter!'). Oft aber treten andere Satzteile zwischen die Glieder der erwähnten Syntag-men; selbst in den oben zitierten Fällen der Satzordnung kann jeweils das andere syntagmatische Glied betont sein (tonloses Attribut mit beton-tem Bezugswort: Nem az üj Aazat, hanem az uj mrosreszt szeretem 'Ich habe nicht das neue Haus, sondern den neuen Stadtteil gerne'). Ebenso können beide Glieder betont sein, wenn sie ζ. B. jedes für sich ein neues Moment bezeichnen (Egy mdonatüj awtöbuszon utaztunk 'Wir fuhren mit einem nagelneuen Omnibus !').
Im Redezusammenhang bilden die Akzente S p i t z e n , die ein oder mehrere auf das betonte Wort tonlos folgende Wörter an sich ziehen. So gliedert sich der Satz der Betonung entsprechend in P h a s e n : jede Phase hebt mit einem neuen Akzent an (ein einphasiger, aus mehreren Wörtern bestehender Satz: Farjuk meg Annat! 'Warten wir auf Anna!'; ein aus zwei Wörtern bestehender Satz mit zwei Phasen: Ällj | &özelebb ! 'Stelle dich näher [her/hin] !'). Mitunter wird die Phase von einem tonlosen Element, dem sog. P h a s e n a n s a t z eingeleitet (Az elet | elet! 'Das Leben ist Leben !'; ils mi? 'Und wir?'; im Satzinneren: Elvittem | a fakäs-tervet is ! 'Ich habe auch den Wohnungsgrundriß mitgenommen !').
G r u n d e i n h e i t der Betonung ist somit die Satzphase; den Akzent, der den Satz in Phasen gliedert, nennen wir P h a s e n a k z e n t . Die Akzente des mehrphasigen Satzes können jedoch von unterschiedlicher Intensität sein; dann wird der stärkste Akzent — mitunter auch mehrere dieser Art — S a t z a k z e n t oder S a t ζ t ο η genannt (^4kar tetszik, | akar nem: | most odamesz ! 'Ob du magst oder nicht: du gehst jetzt hin !').
Sätze ohne überragende, satztonige Phasen nennen wir t o n l o s e (unbetonte) Sätze (A wVlamos | /assaeskan | ßidöcögött velünk | a ielepre 'Die Straßenbahn zuckelte mit uns langsam in die Siedlung hinaus'). Sätze mit einer satztonigen Phase — oder mit mehreren — bzw. Sätze, die auch solche Phasen enthalten, nennen wir b e t o n t e Sätze (vgl. die oben angeführten zwei Beispiele). Der Unterschied zwischen diesen beiden Typen ist aber mitunter fließend.
B) Die g e f ü h l s m ä ß i g e , emphatische Betonung v e r s t ä r k t , n u a n c i e r t nur, oder aber m o d i f i z i e r t bzw. e r g ä n z t die sinngemäße Akzentuierung (mit einer Übersteigerung des Satztons: De most mär eleg legyen ! 'Nun aber sei' s genug damit!'). Der emphatische Nachdruck kann den Ton mitunter auf den ursprünglich tonlosen Phasen-ansatz verlagern (A kiskesit neki! etwa: 'Sapperlot!'; De a nemjojat! etwa: Verflixt nocheinmal!'). In anderen Fällen wiederum erhält das sonst nur
n e b e n t o n i g e Wortelement einen stärkeren Ton als es im Wortanlaut selbst üblich ist (Termgelt&t! 'Potztausend !'). Dieser besonders intensive Ton kann auch auf das Nachglied eines Kompositums fallen, wobei ihm dann eine kurze Sprechpause vorangeht (8zet\tiprom a ferget! 'Ich zertrete den Wurm !'). — Diese emphatische Akzentuierung kann eine bestimmte regelmäßige, auf den ganzen Satz verteilte Tonfluktuation ergeben (Mit csimzZjak, mit csinaZjak? ! 'Was soll ich tun, was soll ich tun? !').
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DEE SATZXON — DIB WORTFOLGE 337
C) R h y t h m i s c h e Belange beeinflussen unabhängig von den zuvor angeführten Akzentkomponenten nur relativ selten die Betonung. So kann ein am Satzanfang nur einfach wiederholter Teil einen rhythmisch motivierten Phasenton erhalten (Az iskoläban most | Mromsz&zhatvan gyermek tanul Ί η der Schule lernen zur Zeit dreihundertsechzig Kinder').
Akzentänderungen ergeben sich beim Vortrag von Gedichten, in rhythmischen Sprichwörtern, Kinderreimen u. a. m. in vielerlei Varianten (Äzegeny ember | vizzel f6z [Sprichwort] 'Arme Leute kochen mit Wasser'). — Im wichtigtuerischen Sprechen werden oft alle Wörter, die keine Hilfswörter sind, auch ohne Grund betont. Ebeneo gekünstelt wirkt es auch, wenn das Präfix eines damit zusammengesetzten Wortes nicht betont wird, bzw. das Nachglied des Kompositums einen besondere starken Ton erhält (Meg|0rülök ! 'Ich werde verrückt!').
B) Die Wortfolge
(§ 205) Die W o r t f o l g e besteht in der im großen und ganzen traditionellen, jedoch der in der augenblicklichen Aussagerelation gegebenen Wichtigkeit angepaßten Abfolge der einfachen oder syntagmatischen Glieder des Satzes. Im Ungarischen hat die Wortfolge vor allem eine s i n n g e m ä ß - i n h a l t l i c h e Funktion: sie verdeutlicht, daß einzelne Wörter wichtig sind, etwas Neues mitteilen bzw. sie zeigt an, daß andere weniger wichtig sind; des weiteren offenbart sich in der Wortfolge die Beziehung der Wörter zueinander. Die Wortfolge ist oft auch dazu geeignet, e m p h a t i s c h e (gefühlsmäßige) Momente auszudrücken, ja, sie kann mitunter auch durch r h y t h m i s c h e Belange bestimmt sein. (So sind die folgenden Sätze nach der Beziehung ihrer Satzglieder zueinander iden-tisch, sonst aber durch sinngemäße, gefühlsmäßige bzw. rhythmische Nuancen verschieden: A fiü megy az iskollba 'Der Junge geht in die Schule'; Megy a fiu az iskolaba 'Der Junge, er geht in die Schule'; A fiu az iskoläba megy 'In die Schule geht der Junge'; Az iskoläba megy a fiu 'In die Schule geht der Junge'; Az iskoläba a fiu megy 'In die Schule geht er, der Junge'). Ihrer zumeist gleichen sprachlichen Funktion entsprechend hängt die Wortfolge mit der B e t o n u n g aufs engste zusammen.
Dank dieser ihrer Beschaffenheit gibt es keine einheitlichen — im Hauptsatz oder im Nebensatz gültigen — grammatischen Regeln. Darum wird die ungarische Wort-folge oft als u n g e b u n d e n bezeichnet. Tatsächlich aber ist sie nicht jeder Bin-dung bar, nur daß sie sehr komplizierten, eher der Redefunktion angepaßten Regeln unterliegt.
A) Die s i n n g e m ä ß - i n h a l t l i c h e n Grundformen der Wort-folge passen sich vor allem der durch die Voraussetzungen bedingten und der Bedeutung entsprechenden Reihenfolge an, und sind von der w o r t -a r t l i c h e n Prägung der Einzelwörter unabhängig. Immerhin haben einzelne Wortarten im Satz eine gewissermaßen v e r b i n d l i c h e S t e l l u n g , bzw. sie können eine solche haben:
Von den F o r m w ö r t e r n steht der A r t i k e l immer vor dem Bezugswort, dessen Bedeutung er modifiziert; diese Stellung des Artikels ist auch dann wesentlich, wenn in größeren Fügungen zwischen den Artikel und sein Bezugswort das Attribut, fallweise ein anderes determinierendes Glied eingeschoben wird (A renges következteben elö&llott 0pületk4rokb<51 levonhatö t a n u l s d g vilagos 'Die Lehre aus den bebenbedingten
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
338 DIE WORTFOLGE
Gebäudeschäden ist klar', eigtl.: 'Die aus den infolge des Bebens angefallenen Gebäudeschäden ziehbare Lehre . . .'). — Die P o s t p o s i t i o n steht jedoch immer unmittelbar nach dem Bezugswort (Hajnal feie elszenderedtek az utitarsak 'Etwa im Morgengrauen nickten die Reisegefährten ein').
Die K o n j u n k t i o n e n werden nicht nach einheitlichen Regeln in die Wortfolge gefügt. Die meisten stehen am Anfang des Gliedsatzes oder Satzgliedes (Satzteiles), den bzw. das sie koppeln (ßs m^gis mozog a föld! [Jökai] 'Und sie bewegt sich doch I'; Csongor is Tünde [Titel eines Feen-spiels von Vörösmarty] 'Csongor und Tünde'). Manche Konjunktionen stehen jedoch im Satzinnern, zumeist nach der satztonigen — im Falle von mehre-ren solchen nach der ersten satztonigen — Phase ( ö t ismerem, a ferjet viszont nem 'Sie kenne ich, ihren Mann dagegen nicht'). Viele Konjunktionen haben eine schwankende Satzstellung (Sokat betegeskednek, tehdt doktorra van szüks^gük 'Sie kränkeln viel, also brauchen sie einen Doktor', aber: Legjobb tehdt, ha elhallgatok 'Am besten also, wenn ich schweige' [aus ein und demselben Roman von Mikszath]).
Das V e r b a l p r ä f i x ist seinem Bezugsverb bzw. Verbalnomen entweder unmittelbar — in einem Wort — vorangesetzt (eZmondja 'er/sie/es erzählt'), das nennen wir die g e r a d e Wortfolge des Präfixes; oder es ist dem Bezugswort wohl vorangesetzt, von diesem jedoch durch die Einschie-bung eines anderen Wortes getrennt (el is mondja), das nennen wir die u n t e r b r o c h e n e Wortfolge des Präfixes; oder aber das Präfix wird dem Bezugswort nachgesetzt (mondja el, mondja is el), das bezeichnen wir als u m g e k e h r t e Wortfolge des Präfixes. Wenn nun das mit einem Präfix zusammengesetzte Verb a l s G a n z e s im Satze b e t o n t ist — und keine Dauer, keinen Nachdruck oder keine ähnlichen besonderen Um-stände ausdrückt —, so steht es mit gerader Präfixfolge (Mindjärt e/mon-dom az egösz ügyet 'Ich will die ganze Sache sogleich erzählen'). Folgt das zusammengesetzte Verb ( t o n l o s ) nach einer satztonigen Phase, so gehört sie im allgemeinen in die von ihr begonnene Phase, steht aber mit u m-g e k e h r t e r Präfixfolge (Ezt en mondom el! [der Ton liegt auf en] 'Das erzähle ich !').
Ist aber das zusammengesetzte Verb mit z u s a m m e n f a s s e n -d e n , resümierenden Wendungen gefügt — ζ. B. nach mind, sokan, örökre — oder mit Wendungen der S t e i g e r u n g — also etwa mit nagyon, ala-posan, egeszen — , so ist die g e r a d e Präfixfolge üblicher (Sokszor el-mondtam [den Ton trägt sokszor] O f t habe ich es erzählt'; Nagyon eifarad-tunk [der Satzton liegt auf nagyon] 'Wir sind sehr müde geworden').
Wird nun das zusammengesetzte Verb mit a u s s c h l i e ß e n d e n — wie kevesen, ritkän — oder d e m i n u t i v e n — ζ. B . alig, mind-össze — Wendungen gefügt, so herrscht die u m g e k e h r t e Präfixfolge vor (Nehezen mondtam el [der Ton liegt auf nehezen] etwa: 'Ich konnte es nur schwer [d. h. mit Überwindung] erzählen'; Alig mondtam el valamit [am meisten betont ist alig] 'Ich habe kaum etwas erzählt'). Wegen dieser Belange wird die gerade Präfixfolge der Verben auch z u s a m m e n -f a s s e n d e (resümierende), ihre umgekehrte Präfixfolge dagegen a u s-s c h l i e ß e n d e Folge genannt.
Verba mit betonten Präfixen drücken gewöhnlich eine p e r f e k t e Handlung aus und stehen mit gerader Präfixfolge (Mindent | eZmondok 'Ich will alles erzählen').
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIE WORTFOLGE 339
Soll jedoch die i m p e r f e k t e Handlung ausgedrückt werden, BO wird die umge-kehrte Präfixfolge verwendet, wobei sowohl das Verb als auch das Präfix betont wird (Afegyünk | fei 'Wir gehen hinauf'). — Die gerade und umgekehrte Präfixfolge kommt auch in der Frage und in der Aufforderung zur Geltung (vgl. dort).
Die u n t e r b r o c h e n e Präfixfolge kennzeichnet vor allem die mit dem Hilfsverb fog gebildeten Futurformen der zusammengesetzten Verba (El fogsz aludni 'Du wirst einschlafen'); ebenso ist sie typisch für das in-finitivische Subjekt bzw. Objekt modifizierender Prädikate wie kell, lehet, szabad bzw. akar, tud, kepes usw. (El kell välnunk 'Wir müssen uns tren-nen' bzw. El tudom mondani 'Ich kann es erzählen'). Auch die nachdrück-lich hervorhebenden Konjunktionen is, se(m) bewirken die unterbrochene Präfixfolge (El i s megyek 'Ich gehe auch weg, fort/hin'). Ist jedoch das Hilfsverb fog bzw. kell usw. als Prädikat satztonig, so steht meistens die gerade Präfixfolge (Fogsz [akarsz usw.] m£g eZmondani valamit? 'Wirst [willst usw.] du noch etwas erzählen?'). Ebenso wird die gerade Präfixfolge verwendet, wenn vor dem Hilfsverb fog oder dem Prädikat eine hauptto-nige Erweiterung steht (Hol [satztonig] fogsz [akarsz usw.]|megrszällni? 'Wo wirst [willst usw.] du absteigen?'.)
Außer den bisher abgehandelten Regeln gibt es noch weitere seltenere Regel-mäßigkeiten bzw. Ausnahmen. — Auf die mit verschiedenen Präfixen zusammen-gesetzten V e r b a l n o m i n a beziehen sich im großen und ganzen die obigen Regeln (Ez mind eikepzelhetö 'Das alles ist vorstellbar', jedoch: El se kdpzelhetö 'Das ist gar nicht vorstellbar').
Die V e r n e i n u n g s w ö r t e r fügen sich nach folgenden Regeln in die Wortfolge. Nem, ne steht immer vor seinem Bezugsglied (A villamos nem ert oda akkorra 'Die Straßenbahn kam bis dahin dort nicht an'; Ne a kezeddel I 'Nicht mit der Hand!'). Ist die Negation des Prädikats empha-tisch geprägt, so kann nem, ne zur unterbrochenen Präfixfolge führen (El nem megyek innen ! [Jokai] 'Ich gehe nicht fort von hier!'). Ausnahmsweise, vor allem in Polarität oder in emphatisch geprägten, sinngemäß behaupten-den Fragen kann nach der Negation nem das zusammengesetzte Verb als Prädikat mit gerader Präfixfolge stehen (Nem /efezälltunk, hanem le 'Wir stiegen nicht ein, sondern aus'; Nem me^mondtam ? I 'Sagte ich es nicht ?!').
Ist das negierte Prädikat mit dem Hilfsverb fog gefügt oder steht es mit einem Verbalnomen, so wird nem bzw. ne gewöhnlich als betontem Adverbiale der flektierte Teil des Prädikats unmittelbar nachgesetzt, der unflektierte aber hängt weiter hinten nach (fin nem f o g o k a l ä i r n i semmit! 'Ich werde nichts unterschreiben!').
Die Negation sem, se ist immer dem Bezugsglied n a c h g e s e t z t (Kertem, hogy 6k [betont!] se bantsäk a madarat 'Ich bat darum, daß auch sie dem Vogel nichts tun mögen').
Diese Negationspartikeln können aber dem Attribut nicht nachgesetzt werden, weil das die Stelle des Bezugswortes ist; in solchen Fällen werden andere Fügungen verwendet (A feher szßlöt sent erte a jegveres 'Auch die weißen Trauben wurden vom Hagelschlag nicht getroffen'). — Das verbale Prädikat wird gewöhnlich nicht mit sem, se, sondern mit dem entsprechenden vorangesetzten nem is, ne is negiert (Ne is tölts, mert nem ihatok 'Schenk mir nicht ein, weil ich nicht trinken darf'). — Das prädikativ stehende zusammengesetzte Verb richtet sich nach der unterbrochenen Präfixfolge, wenn es mit sem oder se negiert wird (Az ilyet meg se läsd ! 'So etwas sollst
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
340 DIB WORTFOLGE
du gar nicht sehen!'), oder aber wird ne is mit einer anderen Wortfolge verwendet (Az ilyet ne ia läsd meg!)
Die A d v e r b i e n fügen sich sehr unterschiedlich in die Wortfolge. Hier seien nur die wichtigsten Fügungstypen der Adverbien erwähnt. Mit den r e s ü m i e r e n d e n und s t e i g e r n d e n Adverbien richtet sich das Prädikat im allgemeinen nach der geraden (resümierenden) Präfixfolge; das Adverb ist zumeist vorangesetzt (Mindig Aazavittem a keresetet 'Ich brachte den Lohn immer heim'), aber auch nachgesetzt (Ηαζανittem a kere-setet mindig). Ist ein solches Adverb nicht aufs Prädikat bezogen, so wird es nach Möglichkeit dem damit determinierten Satzteil vorangestellt und beeinflußt die Wortfolge des Prädikats nicht direkt (Nagyon e r Ö s e n sütött a nap 'Die Sonne schien sehr heiß').
Mit a u s s c h l i e ß e n d e n und d e m i n u t i v e n Adverbien richtet sich das prädikative zusammengesetzte Verb oder das nominal-ver-bale Prädikat nach der umgekehrten Wortfolge und das haupttonige Ad-verb ist ihm vorangesetzt (Rithin szolitottak oda bennünket 'Selten wurden wir hinbestellt'). Bezieht sich ein solches Adverb nicht aufs Prädikat, son-dern auf einen anderen Satzteil, so wird es nach Möglichkeit diesem vor-angestellt, und die Wortfolge des Prädikats bleibt vom Adverb unabhän-giger (A rozsafärol egy kevSsbd k i η y ί 11 bimbot vägtam le 'Vom Rosen-strauch schnitt ich eine weniger erblühte Knospe ab'). Fällt der Satzton auf ein Adverb ohne resümierenden oder anschließenden Sinn, so steht es zumeist vor dem Prädikat (Sietve irtam a levelet 'Ich schrieb den Brief in Eile'). Die Stellung des Adverbs kann sich aber ändern, wenn es nicht den Satzton trägt (Levelet irtam sietve 'Ich schrieb eilig einen Brief).
Manche m o d i f i z i e r e n d e n P a r t i k e l n beziehen sich auf den satztonigen Teil und sind diesem vorangestellt (Τάη e l p u s k a z t a a ezabo az uj ruhäjat [Kriidy] 'Der Schneider hat wohl seinen neuen Anzug verhaut!'). Bezieht sich ein solcher Satzteil lockerer gefügt eher auf die ganze Aussage des Satzes, so wird er mitunter vorangestellt (Valöban senki se felelhet az ilyen kesäsert 'Tatsächlich kann niemand für solche Verzöge-rungen verantwortlich sein'); aber auch in solchen Fällen können diese Satzteile entweder als besondere Einheiten, oder fast schon als selbständige Sätze im Satzinneren gefügt werden (Az ilyen kesesert, valöban, senki sem felelhet 'Für solche Verzögerungen kann tatsächlich niemand verantwort-lich sein'). Das auf den Z e i t p u n k t des Geschehens verweisende m&r, meg, vegre usw. sowie das einschränkende csak werden im großen und gan-zen ähnlich gefügt (Csak [mar usw.] en vagyok itt 'Nur ich bin [schon bin ich] hier'; fin vagyok csak [mAr] itt 'Ich bin nur [schon] hier').
Aus I n t e r j e k t i o n e n bestehende Segmente werden dem größe-ren Satz zumeist auch dann vorangesetzt, wenn ihr selbständiger Satz-charakter mehr oder minder verblaßt ist; sie können aber auch im Satzinne-ren eingeschoben werden (No, most mit csinälunk ? 'Na, was tun wir jetzt ?'; Jöjjön no vissza! [Mikszäth] 'Kommen Sie doch zurück I').
Die wortfolgliche Stellung der übrigen, begrifflich ausgeprägteren Wortar-ten läßt sich durch ihren wortartlichen Charakter noch weniger präzisieren.
B) Mit der inneren Wortfolge der S y n t a g m e n haben wir uns bereits kurz befaßt. In den selteneren (verbalnominal-verbalen) S u b j e k t -s y n t a g m e n ist demnach das untergeordnete Subjektglied immer vor-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIE WORTFOLGE 341
angestellt (a nap m e l e g i t e t t e viz 'das von der Sonne gewärmte Wasser'). Ebenso geht das subordinierte Glied dem Grundglied in den q u a l i t a t i v e n und q u a n t i t a t i v e n Attributsyntagmen voraus; dagegen steht immer das Grundglied in den a p p o s i t i o n a l e n Syn-tagmen vorn. Das P o s s e s s i v a t t r i b u t geht zwar dem Bezugswort meistens voraus, ist ihm aber nicht selten auch nachgesetzt. In den p r ä -d i k a t i v e n Syntagmen entscheidet über die Folge von Subjekt und Prädikat im allgemeinen nur ihre jeweilige Bedeutung, Wichtigkeit in der gegebenen Aussage. Ebenso wenig kann für die O b j e k t - und A d v e r b -s y n t a g m e n eine andere umfassende Regel geboten werden, weil selbst die als phraseologische Einheit in ihrer Wortfolge gebundene Wendung (kezet f o g ) den allgemeinen Regeln der Hervorhebung entsprechend geän-dert werden kann ([nem] f o g kezet). Immerhin kann man die Stellung des a t t r i b u t w e r t i g e n A d v e r b i a l e s nach dem Grundglied als ständig bezeichnen (u t a ζ ä s a föld körül 'Reise um die Welt'; gomba t o j ä s s a l 'Pilze mit Eiern'). Dagegen ist das Objekt und das Adverbiale eines verbalnominalen — besonders partizipialen — Grundgliedes im allge-meinen v o r a n g e s t e l l t (Megszünt a kirdisben m u t a t k o z ö n^zet-elteres 'Die in der Frage gegebene Meinungsverschiedenheit ist aufgehoben'). — Die Wortfolge der k o o r d i n i e r e n d e n Syntagmen ist durch die sinngemäßen Beziehungen ihrer Glieder bestimmt.
Die erwähnten, auch in ihrer Wortfolge mehr oder minder straff struk-turierten Syntagmen — besonders die attributiven — sind als G a n z e s im allgemeinen s e l b s t ä n d i g e w o r t f o l g l i c h e E i n h e i t e n des Satzes; die in ihnen enthaltenen besonderen syntagmatischen Glieder sind wortfolgliche Einheiten der einzelnen Syntagmen, nicht aber die des ganzen Satzes.
(§ 206) Für die w o r t f o l g l i c h e S t r u k t u r d e s S a t z e s ist zumeist die Stellung des P r ä d i k a t s ausschlaggebend. Doch ist auch hier den Arten bzw. den Formen des Prädikats entsprechend zu unterschei-den.
Im Falle des nicht zusammengesetzten und präfixlosen e i n f a c h e n v e r b a l e n sowie des e i n f a c h e n n o m i n a l e n Prädikats erge-ben sich keine besonderen wortfolglichen Probleme.
Das mit dem Präfix in gerader Folge gefügte v e r b a l e P r ä d i k a t (elment) nimmt als Ganzes seine Stellung als Prädikat ein; ist es jedoch mit dem Präfix in umgekehrter (most ment el) oder unterbrochener (el sem ment) Folge gefügt, so steht nur der flektierte Teil (ment) an der üblichen Stelle des Prädikats, und das Präfix wird wie eine einfache, aber enge Erweiterung gesetzt. Das nach Personen nicht flektierte, h i l f s v e r b l i c h e volna (in veralteten Verbformen auch volt, vala usw.) als Teil des damit gefügten verbalen Prädikats (mentem volna; jött^l volt) wird jedoch auch hinsicht-lich der Wortfolge im allgemeinen als Einheit aufgefaßt. Ebenso verhält sich auch das mit dem personalflektierten hilfsverblichen fog zusammenge-setzte verbale Prädikat, wenn es sich nach der geraden Wortfolge richtet (menni fogok); ansonsten wird das Hilfsverb an die Stelle des verbalen Prädikats gesetzt und das hauptverbliche Prädikatsglied fügt sich wie eine einfache, allerdings straff gebundene Erweiterung in die Wortfolge (most fogok menni 'jetzt werde ich gehen').
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
342 DIE WORTFOLGE
Das nach der geraden Wortfolge gefügte zusammengesetzte ( n o m i -n a l - v e r b a l e ) Prädikat nimmt als Ganzes die Prädikatsstelle ein (ka-tona voltäl 'du warst Soldat'); ist es aber nach der umgekehrten (most voltäl katona) oder unterbrochenen (katona sem voltäl) Wortfolge gefügt, so steht nur der verbale Teil an der Prädikatsstelle, der nominale Teil verhält sich wie eine eng gefügte einfache Erweiterung.
Mitunter hat das Prädikat eine k o m b i n i e r t e Form, insofern die zwei abgehandelten Typen gemeinsam, verquickt auftreten, ζ. B. volna bzw. fog als Hilfsverba mit einem präfigierten oder auch einem mit einem no-minalen Teil gefügten verbalen Prädikat. In solchen Fällen weicht das mit volna gefügte Prädikat von den obigen Regeln nicht ab, weil volna ein dem flektierten Prädikatsteil anhaftendes Element ist (katona lettel volna 'du wärst Soldat gewesen'; most lettel volna katona). Das präfigierte und mit dem Hilfsverb fog gefügte verbale Prädikat verhält sich so wie das aus einem einfachen Verb und fog bestehende, nur wird das Präfix in bestimmten Formen nach dem Muster der selbständigen zweiten Erweiterung gesetzt (el fog menni 'er/sie/es wird fortgehen').
Das Prädikat bzw. dessen flektierter Teil stellt somit den K e r n der wortfolglichen Struktur des Satzes dar. Die übrigen — einfachen oder als wortfolgliche Einheiten anzusehenden — syntagmatischen Einheiten ver-halten sich in ihrer Anordnung wie die »Erweiterungen«: das bezieht sich also nicht nur auf die echten Erweiterungen, sondern auch auf das Subjekt, ja auch auf den nicht flektierten Teil des aus mehreren Wörtern gefügten Prädikats. Die wortfolglichen Einheiten, die ihre Stellung selbständig ver-ändern können, fallen manchmal mit den Einheiten der Betonung, mit den sog. S a t z p h a s e n zusammen (A fiatal gyerek | hallgasson | ez ügyben ! 'Das junge Kind möge in dieser Sache schweigen !'). Es kann aber vorkom-men, daß eine stark betonte wortfolgliche Einheit noch einige, in wortfolg-licher Hinsicht sonst besondere Einheiten in ihre Phase einbezieht (A flu volt | a Ze^csöndesebb 'Der Junge war der schweigsamste').
Die Einheit des präfigierten, zusammengesetzten und kombinierten Prädikats (vgl. oben) ist somit in wortfolglicher Hinsicht n i c h t u n t e i l -b a r : einzelne Teile können sich vom flektierten Teil des Prädikats loslösen, und fügen sich dann wie selbständige Erweiterungen in die Wortfolge des Satzes (z.B. das Prädikatsnomen im obigen Beispiel: a legcsöndesebb). Unter g e m e i n s a m e r Beachtung der Wortfolge und der Betonung können wir im Satz verschiedene P a r t i e n unterscheiden. Die S a t z -p a r t i e besteht von den Akzentverhältnissen und — von der Gliederung in mehrere Phasen abgesehen — z u m i n d e s t a u s e i n e r w o r t f o l g -l i c h e n Grundeinheit (Pista | induljon most | az iskolaba ! 'P. soll sich jetzt auf den Weg zur Schule machen I'). Doch kann eine Partie auch den tonlos gewordenen Teil einer anderen wortfolglichen Grundeinheit oder diese als ganzes erfassen (Sanyi induljon most, | ne Pista ! 'Sanyi soll sich jetzt auf den Weg machen, nicht Pista 1').
Das Prädikat und die in Anbetracht der Wortfolge als Erweiterungen aufzufassenden übrigen Einheiten ordnen sich im Satz dementsprechend zu Partien, wie es ihre Bedeutung bzw. ihre Neuartigkeit im Verhältnis zu den Voraussetzungen und den Umständen erfordert. Darum ist für die Anordnung die Betonheit oder Unbetontheit der Einheiten bzw. die Akzent-intensität der Einheiten (Haupt- und Nebenton) so ausschlaggebend.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIE WOBTFOLGE 343
Wie wir es schon gesehen haben, kann man dem Ton nach u n b e -t o n t e und b e t o n t e Sätze unterscheiden; diese beiden Satzarten sind auch in ihrer Wortfolge verschieden.
A) Im u n b e t o n t e n Satz richtet sich das Prädikat nach der ge-raden Wortfolge, und im allgemeinen stellt jede wortfolgliche Grundeinheit eine S a t z p a r t i e dar. Wohl kann das Prädikat wo immer im Satze stehen, doch belegt es in gefühlsmäßig indifferenteren Mitteilungen zumeist die vorletzte Stelle (mit einfachem Prädikat: A raacska szereti a majat 'Katzen essen Leber gern'; mit präfigiertem verbalem Prädikat: A betyär most feiemelte a pwsk&jät [Möricz] 'Da setzte der Betyare [ = Buschklep-per] seine Flinte an').
Den Ü b e r g a n g zwischen unbetonten und betonten Sätzen kennzeichnet auch, daß sich ihre Wortfolge jener der unbetonten Sätze anpaßt, obschon es in ihnen sinngemäß einige haupttonige Elemente gäbe (mit Verdeutlichung der andauernden Handlung: Afindenki AalZgatta az elßadäst a hangezörön dt 'Alle hörten den Vortrag durch den Lautsprecher'; mit dem Hinweis auf den partitivischen Sinn: Mert az^rt eitünk mindenböl 'Nichtsdestoweniger aßen wir von allem'). — Immerhin kommt es im erzählenden Stil oft zu einer emphatischen Voranstellung des Prädikats (Veit pedig összesen husz forintom [Mikszäth] 'Nun hatte ich aber insgesamt zwanzig Gulden'). Es kommt auch vor, daß sich zwei oder mehr g e g e n ü b e r g e s t e l l t e h a u p t -t o n i g e Einheiten in ihrer Wortfolge sozusagen ausgleichen (.Fiukat es ieänyokat egy&r&nt fölvesznek 'Jungen und Mädchen werden gleicherweise aufgenommen').
B) a) In b e t o n t e n Sätzen mit h a u p t t o n i g e m P r ä d i k a t steht das einfache nominale Prädikat oft vorne und bezieht in seine Partie auch ein anderes Satzglied ein fÖröm ilyenkor a /«rdözes I 'Es ist eine Freude, zu dieser Zeit zu baden!'). Es kann aber dem haupttonigen Prädikat, das vor seinem Subjekt steht, auch eine nicht haupttonige Erweiterung als An-satz vorangestellt werden (A szinhazban Äatäsosabb az ilyesmi 'Im Theater ist so etwas wirkungsvoller'). Solche Prädikate können aber auch am Satz-ende stehen, wenn ihr Subjekt in eine Parellele gehört, oder das nominale Prädikat das Grundglied eines größeren Syntagmas ist usw. (Hat ez ki6 ? 'Und wem gehört denn das?'; Ez bizony a mi Jcedves wendegünke! 'Das allerdings gehört unserem lieben Gast!'). — Auch das betonte e i n f a c h e v e r b a l e Prädikat steht oft vorn und bezieht dann das tonlose Subjekt in seine Partie ein, beläßt jedoch das betonte Subjekt in der anderen Satz-partie (Teiszett az okoskodäs ifopereczkynek [Mikszath] 'Es gefiel Kope-reezky die Tüftelei'; Van-e ennel Jobb megoldas ? ! 'Gibt es etwa eine bessere Lösung als diese? !'). Vor das dem Subjekt vorangesetzte haupttonige Prä-dikat kann auch in diesen Fällen eine andere nicht haupttonige Erweiterung treten (A &ocsiban volt meg hely 'Im Wagen war noch Platz'). — Das haupt-tonige p r ä f i g i e r t e verbale Prädikat richtet sich gewöhnlich nach der geraden Wortfolge, und bezieht oft sein tonloses Subjekt oder eine Erwei-terung in seine Satzpartie ein. Steht es ganz am Satzanfang, so wirkt der Satz zumeist emphatischer (ifigyulladt a pajt&! 'Die Scheune brennt I'). Als Ansatz kann aber auch einem solchen Prädikat das tonschwächere oder tonlose Subjekt bzw. eine ähnliche Erweiterung voraufgehen (A öecsületes ember e/megy onnan ! 'Ein ehrlicher Mensch geht weg von dort!'). Manch-mal aber steht ein solches Prädikat am Satzende (Engemet ez az ^let megö 1! [Jokai] 'Mich bringt dieses Leben um !').
Das haupttonige z u s a m m e n g e s e t z t e (nominal-verbale) Prä-dikat fügt sich immer in gerader Wortfolge. Es führt eine neue Satzpartie
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
344 DIE WORTFOLGE
ein, bezieht jedoch mitunter auch das Subjekt oder die nächststehende ton-lose Erweiterung in seine Partie ein. Beginnt der Satz mit einem solchen Prädikat, so ist es zumeist ein Ausrufesatz (Sok lesz ennyi azert a /alatert! 'Das wird ζ uviel sein für diesen Bissen !'). Auch diesem Prädikat kann ein nicht haupttoniges anderes Satzglied vorangestellt werden (l$ri a 6arätja vagyok ! 'Ich bin sein/ihr Freund !'). Wird ein solches Prädikat ans Satzende gefügt, so verleiht es der Mitteilung zumeist einen besonderen Nachdruck (Az ά/läs a Makroezye volt [Moricz] 'Die Stellung gehörte dem Makroczy').
Jedes beliebige Glied des mit dem H i l f s v e r b fog g e f ü g t e n Prädikats kann haupttonig sein und das haupttonige Glied geht dem nicht haupttonigen vorauf. An den Satzanfang gesetzt, verleiht dieses Prädikat der Mitteilung einen Ausrufecharakter (mit stärkerem Ton auf dem Haupt-verb: Todulni fognak hozzä az ewberek 1 [Mikszath] 'Zuströmen werden ihm die Menschen !'). Auch dieses Prädikat wird mit einem tonlosen voran-gestellten Ansatz gefügt (Mar pedig en /ogok szölni erröl! 'Ich jedenfalls werde darüber sprechen!').
b) Im b e t o n t e n Satz mit h a u p t t o n i g e m S u b j e k t oder einer h a u p t t o n i g e n E r w e i t e r u n g bilden diese Glieder vollständige wortfolgliche Grundeinheiten, so daß der Hauptton auch auf ein subordinierend gefügtes syntagmatisches Element des Subjekts oder der Erweiterung fallen kann.
Ist das S u b j e k t oder eine E r w e i t e r u n g betont, so leitet es bzw. sie immer eine neue Satzpartie ein, die unmittelbar nach dem haupt-tonigen Teil auch das Prädikat bzw. den flektierten Teil des mehrgliedrigen Prädikats umfaßt. Damit wird das nicht einfache Prädikat der tonlosen — umgekehrten — Wortfolge angepaßt (mit einfachem Prädikat: Vizet alig ivott a 6eteg 'Wasser trank der Kranke kaum'; mit mehrgliedrigem, mit volna gefügtem Prädikat: [Ha lett volna idöm,] en vittelek volna orvoshoz '[Hätte ich Zeit gehabt,] hätte ich dich zum Arzt gebracht'; mit präfigier-tem Prädikat: Az e/nök raaga lepett közbe 'Der Vorsitzende selber griff ein'; mit zusammengesetztem Prädikat: Az dflatorvos csak estefeie volt vdr-hato 'Der Tierarzt war erst gegen Abend zu erwarten').
Hat das haupttonige Subjekt oder eine ähnliche Erweiterung einen a u s s c h l i e ß e n d e n , deminutiven, einschränkenden Sinn (oder ent-hält dieser Satzteil eine solche Wendung), dann beginnt damit eine neue Satzpartie und das nachfolgende Prädikat richtet sich nach der ausschlie-ßenden (umgekehrten) Wortfolge. (Das entspricht den bisherigen Fällen.)
Ausschließenden Sinn haben in diesem Zusammenhang die mit der Partikel csak eingeschränkten Wendungen (A vizre bocsätds csak kit hit τηύΐνα m e n t v e g b e 'Der Stapellauf erfolgte erst nach zwei Wochen'); des weiteren die negierten Fügungen (Nem azert m e g y e k e l 'Nicht darum gehe ich fort'); oft der mit dem indefiniten Pronomen determinierte Begriff (Valamicske illat d r a d t b e az ablakon'Etwas Duft strömte zum Fenster herein'); usw. — Mitunter bewirkt die ausschließende Wendung — vor allem die mit adversativen oder parallelen Gliedern — keine ausschließende, sondern eine unterbrochene Wortfolge des Prädikats (A körte drett, de e 1 meg aligha a d h a t ο d 'Die Birnen sind reif, verkaufen aber kannst du sie noch kaum').
Hat jedoch das haupttonige Subjekt oder eine ähnliche Erweiterung einen z u s a m m e n f a s s e n d e n , steigernden Sinn (oder ist darin eine solche Wendung enthalten), so beginnt damit wohl eine neue Satzpartie, das Prädikat richtet sich aber nach der resümierenden (geraden) Wortfolge,
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIE WORTFOLGE 345
wobei es fallweise einen besonderen Ton trägt, d. h. in einer besonderen Satzpartie steht. Dieses Prädikat geht dem haupttonigen Satzteil oft voraus (mit haupttonigem Satzglied vor dem Prädikat: Az ablakbol egisz Pestet b e l ä t h a t t u k 'Aus dem Fenster konnten wir ganz Pest überblicken'; nach dem Prädikat: B e l ä t h a t t u k az ablakbol egSsz Pestet).
Zu den Satzteilen mit resümierendem Sinn zählen auch die mit der k o p u l a -t i v e n Konjunktion is gefügten, nachdrücklieh haupttonigen Satzteile, d. h. das Prädikat richtet sich in solchen Fällen nach der resümierenden Wortfolge (A fiatalok ott is e l a z o r a k o z h a t n a k 'Die Jugend kann sich auch dort unterhalten'). Wird is nur hinzuverstanden und ist die Hervorhebung eher nur an der Betonung zu erkennen, so kann dieser haupttonige Satzteil nur vor dem Prädikat stehen (Α kü-szöböt e i e r t e mär az ärviz 'Bis an die Schwelle reicht schon das Hochwasser'). Der mit is gekoppelte Satzteil wird aber oft — ab und zu mit beträchtlichem Abstand — nach dem Prädikat gesetzt (Persze m e g h i v n a k az ebedre teged is! 'Zum Essen eingeladen wirst freilich auch du!'). Hat aber die mit is hervorgehobene Wendung ansonsten einen ausschließenden Sinn, wird die ausschließende Wortfolge durch die Konjunktion is nicht beeinträchtigt (Alig is a l u d t u n k e l a zaj miatt 'Kaum konnten wir wegen des Lärms auch einschlafen'). Neben dem hervorhebenden is steht das Prädikat auch dann in umgekehrter Wortfolge, wenn es eine imperfekte oder zeitweilig unterbrochene Handlung verdeutlicht (Saldtdt is a d u n k e l neha 'Auch Salat verkaufen wir manchmal').
Der ohne Hinweis gefügte V e r g l e i c h zählt oft — die vor den Zitierungssatz gestellte d i r e k t e R e d e immer — als haupttonige Erweiterung (Mint egy gydr-kemeny f ü j t a k i a cigaretta füstjet 'Wie ein Schlot blies er/sie den Zigarettenrauch [hervor]'; Midrt ? — n e z e t t r ä m a fiü meglepve 'Warum ? — sah mich der Junge überrascht an').
(§ 207) Weitere wortfolgliche Probleme, die mit den i n h a l t l i c h e n Belangen des Satzes zusammenhängen, ergeben sich nur in bestimmten Frage-, Befehls- und Ausrufesätzen.
A) Die Wortfolge der E n t s c h e i d u n g s f r a g e n richtet sich im allgemeinen nach den bereits erwähnten Regeln, doch sind kleinere Ab-weichungen zu beachten. Trägt das P r ä d i k a t den H a u p t t o n , so fügt es sich gewöhnlich der geraden Wortfolge entsprechend und steht mög-lichst am Satzanfang (Felrobbantjdk a hidat? [Gydrfas] 'Wird die Brücke gesprengt?'); es kann aber wegen der drohenden Betonung des Hauptteils auch in umgekehrter Wortfolge stehen (Fogsz te meg feleselnr?! 'Wirst du noch Widerreden? I'); mitunter auch im Falle des Zweifels (Piszkoljam össze a kezemet? 'Soll ich meine Hände beschmutzen?'). Mit besonderer Ausdruckskraft kann es ans Satzende gestellt werden (fis ezt türi ?! 'Und Sie lassen sich das bieten ?!'). Trägt ein a n d e r e r S a t z t e i l den Haupt-ton, so erfaßt er das weniger betonte oder tonlose Prädikat mit seiner Satzpartie ebenso wie in den bisher abgehandelten Aussagesätzen (Boldo-gabbä fogja tenni ez az eletünket ? 'Wird das unser Leben glücklicher ma-chen?'). Ist aber dieser haupttonige Satzteil negiert oder hat er einen aus-schließenden Sinn, so folgt auch das Prädikat der ausschließenden Wortfolge (Benne sent b i z h a t u n k m e g ? ! 'Ihm/ihrkönnen wir auch nicht ver-trauen? !'). Ist der haupttonige Satzteil sinngemäß resümierend, so richtet sich das Prädikat nach der geraden Wortfolge (Neki is megvizsgältäk a tü-dejet? 'Wurde auch seine/ihre Lunge untersucht?').
Die F r a g e p a r t i k e l e haftet im allgemeinen dem einfachen Prädikat bzw. dem flektierten Prädikatsteil an, bei Prädikaten mit volna der ganzen Satzaussage ( g o n d o l h a t t a m v o l n a - e ilyesmire ? [Mik-szath] 'Hätte ich an so etwas denken können ?'; m e g f o g j a - e k a p n i ,
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
346 DIE WORTFOLGE
amit kert? [Moricz] O b er/sie/es es wohl bekommt, worum er/sie/es gebeten hat?')· — Das Fragewort vajon kann auch am Satzanfang stehen (Vajon kit kereshettel? 'Wen magst du gesucht haben?)'; es kann aber auch weiter im Satzinneren als letzter Abschnitt einer anderen Satzpartie gefügt werden.
B) In den E r g ä n z u n g s f r a g e n trägt im allgemeinen das Fragewort den Hauptton und bezieht das tonlose Prädikat oder den flektier-ten Teil des aus mehreren Wörtern in umgekehrter Folge gefügten Prädikats in seine Satzpartie ein (mit prädikativem Fragewort: Mennyi lesz a fize-tösed? 'Wieviel Gehalt wirst du bekommen?'; mit anders fungierendem Fragewort und vorausgeschicktem Ansatz: Eis aztan mit csinälunk ? 'Und was machen wir dann?').
Mitunter kann das P r ä f i x oder ein anderes eng gefügtes Adverbiale wegen seiner Bedeutung vorangestellt werden (Ide pedig mikorra e r s ζ ? 'Und wann triffst du hier ein?'). Das zweite Glied einer Gegenüberstellung kann zwecks Hervorhebung auch in Endstellung sein (Magoknak . . . mindegy . . . De mit szöljak en ? ! [Mikszälth] 'Ihnen . . . ist es gleich . . . Was aber soll ich sagen? !').
Das Fragewort vajon kann auch hier am Satzanfang oder aber im Satzinneren stehen (Vajon ki kopogtat?; Ki kopogtat vajon? 'Wer mag da klopfen?').
C) Unter den B e f e h l s s ä t z e n werden die v e r b l o s e n im allgemeinen von der haupttonigen Erweiterung eingeleitet (Felre most, lant! [Petofi] 'Weg jetzt mit dir, Leier I'). Die mit V e r b e n gefügten Befehlssätze sind im allgemeinen durch die umgekehrte Wortfolge des prä-figierten oder zusammengesetzten Prädikats und durch die Betonung des verbalen Elements gekennzeichnet. Trägt das P r ä d i k a t den Haupt-ton, so steht es — oder sein flektierter Teil — zumeist am Anfang des Satzes (Vesd le a csizmädat, he [Mikszäth] 'Zieh' die Stiefel aus, hörst du !'). In solchen Fällen kann der unflektierte Teil des Prädikats auch weiter hin-ten folgen (Tirjen Ön az asztalhoz vissza! [Jökai] 'Kommen Sie an den Tisch zurück !'). Ist das Prädikat fallweise in gerader Wortfolge gesetzt, so drückt es einen härteren Befehl aus (Elmenj innen! 'Scher' dich weg von da!'). Auch der haupttonige nominale Teil des zusammengesetzten Prädi-kats kann (in gerader Wortfolge) vorn stehen (Gyors legyen az a munka! 'Rasch soll da gearbeitet werden!'). Trägt in einem verbalen Befehlssatz das S u b j e k t oder eine E r w e i t e r u n g den Hauptton, so wird es oft dem — wegen des Befehls auch sonst in umgekehrter Wortfolge gesetz-ten — Prädikat vorangestellt und bezieht es in seine Satzpartie ein (ΑηηάΙ α tisztäsnäl a l l j u n k m e g ! 'Bleiben wir bei der Lichtung [dort] stehen !'). Manchmal aber steht es weiter hinten (Ä 11 j u η k m e g ott! 'Bleiben wir dort stehen !'); oder steht es zwischen dem flektierten und dem unflektierten Prädikatsteil (L e ρ j ü k most [öt] m e g 1 'Überraschen wir jetzt ihn/sie/es !'). Mit einem haupttonigen, sinngemäß resümierenden Satz-teil drückt das Prädikat in gerader Wortfolge einen nachdrücklichen Befehl aus (Jol odaflgyelj ! 'Gut aufpassen sollst du !'). Ist jedoch dieser resümie-rende Sinn weniger wesentlich, so richtet sich das Prädikat nach der umge-kehrten Wortfolge (Jol f i g y e l j o d a l 'Paß gut auf!').
In den V e r b o t s s ä t z e n kommen die Regeln des Befehls und der Negation gemeinsam zur Geltung. Ist das Prädikat der haupttonig unter-sagte Teil, so kann seine Satzpartie sowohl am Anfang als auch am Ende
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIB WORTFOLGE — DIE SATZMELODIE 3 4 7
des Satzes stehen. Im letzteren Fall wird dadurch dem Befehl ein besonderer Nachdruck verliehen (Ne higgy annak többe ! 'Glaube dem/der nie wieder !'; aber: Többe annak ne higgy! 'Nie wieder glaube dem/der !'). Ist das Subjekt oder eine Erweiterung der haupttonig untersagte Satzteil, so wird er dem in umgekehrter Wortfolge gefügten Prädikat vorangestellt, das er auch in seine Satzpartie einbezieht (Ne sot tegy bele, hanem ecetet! 'Nicht Salz tu hinein, sondern Essig!'). In emphatischen Verboten kann das Prädikat auch in unterbrochener Wortfolge gefügt werden (Meg ne lässam öt többet i t t ! [Nemeth] 'Ich will ihn/sie nie mehr hier sehen !').
D) Unter den A u s r u f e s ä t z e n ergeben sich in den näher nicht analysierbaren verblosen Sätzen dieser Art keine besonderen wortfolglichen Probleme (0, az a gyönyörü ü t ! 'Ach, dieser wunderbare Weg!'). In ähn-lichen Ausrufesätzen mit hinzuverstandenem Prädikat steht der haupt-tonige Satzteil vorn (No de ily könnyü leckeböl jelentkezni ! [Kaffka] 'Aber, aber, wer meldet sich schon aus einer so leichten Aufgabe !'). Die Wortfolge der mit Prädikat, jedoch ohne die modifizierenden Partikeln de, be(h) usw. gebildeten Ausrufe entspricht im allgemeinen jener in den entsprechenden Aussagesätzen (Milyen fäjdalmas volt ez a hir! 'Wie schmerzlich war diese Nachricht!'). Die Partikeln wie de, be(h) u. a. stehen im allgemeinen am Anfang des satztonigen Teiles, zumeist am Satzanfang (De jo is lesz akkor ! 'Wie gut wird es dann sein!'; Akkor aztan de jo lesz ! 'Dann wird es gut sein I').
E) Unter den W u n s c h s ä t z e n mit Modifizierungswörtern wie bar, csak, bärcsak stehen diese Partikeln immer vor dem haupttonigen Satz-teil und beziehen diesen oft in ihre Satzpartie ein. In anderen Fällen sind solche Partikeln — hauptsächlich csak — tonlos, behalten aber ihre Stelle in der Wortfolge bei. Das haupttonige Prädikat wird demgemäß in gerader oder umgekehrter Wortfolge gefügt, ob es in seiner Gesamtheit, oder aber nur in seinem flektierten Teil betont ist (Csak e l i n d u l n ä n k mär! 'Wenn wir doch schon gingen !'; nur im flektierten Teil haupttoniges Prädi-kat: Csak ν ο 1 η ά η k fiatalabbak ! 'Wären wir doch jünger 1').
C) Die Satzmelodie
(§ 208) Die Satzmelodie läßt sich phonetisch mit der m u s i k a l i -s c h e n H ö h e d e r R e d e bestimmen. Bei ihrer Messung ziehen wir ihre o b e r e , m i t t l e r e und u n t e r e Stimmlage in Betracht. Wie bereits erwähnt, gibt es keine Wortmelodie; somit gehört die Sprechmelodie vollauf zu den M i t t e l n d e r S a t z f ü g u n g . Sie ist mit der Beto-nung verbunden und hat mit dieser dieselbe Grundeinheit. Die mit einem neuen Akzent anhebende S a t z p h a s e stellt zugleich eine neue satz-melodische Einheit dar; geht dieser Satzphase ein tonloser Ansatz voraus, so ist dieser auch für die Satzmelodie ein indifferenter einleitender Teil (Ha nines kedved, | hat ne gyere! 'Hast du keine Lust, so komme nicht!').
Die Formen der Satzmelodie fördern ebenfalls vor allem die s i n n -g e m ä ß e Mitteilung; darüber hinaus aber werden sie auch zur g e f ü h l s -m ä ß i g e n Nuancierung verwendet, ja, man kann in ihnen mitunter auch r h y t h m i s c h e Momente nachweisen.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
348 DIE SATZMELODIE
A) Die s i n n g e m ä ß e Funktion der Satzmelodie besteht darin, daß sie auf die i n h a l t l i c h e Prägung des Satzes hinweist — d. h. darauf, ob es sich um einen Aussage- (Mitteilungs-), Frage-, Befehlssatz usw. handelt —, wenn das durch keine anderen, zumeist auch sprechmelo-disch besonderen Merkmale deutlich wird.
a) Der A u s s a g e s a t z hat eigentlich keine besondere, nur ihn kennzeichnende Melodie; diese Satzart ist gewöhnlich am strukturellen und wortfolglichen Aufbau, gegebenenfalls an der Sprechsituation, an den Vor-aussetzungen usw. zu erkennen. Somit offenbart sich die G r u n d f o r m d e r S a t z m e l o d i e : diese ist fallend, genauer gesagt anfänglich fal-lend, insofern sie innerhalb der ersten zwei Silben von der oberen Stimmlage fast auf die untere herabfällt, sich in den übrigen Silben auf der unteren fortbewegt, wobei sie mitunter unwesentlich noch weiter absteigen kann. Diese fallende Melodie setzt sich in einsilbigen Sätzen gleitend durch, ζ. B. in einem gefühlsmäßig indifferenten Satze, der aus einer einzigen Phase besteht:
V El-mült hüs-vet. Ostern ist vorbei.' Jo. 'Gut.'
b) Unter den F r a g e s ä t z e n haben die E r g ä n z u n g s f r a -g e n ebenfalls keine besondere Satzmelodie; sie werden nämlich durch das Interrogativpronomen bzw. das interrogative Pronominaladverb eindeutig als Ergänzungsfragen gekennzeichnet. In ähnlichen Beispielen wie oben:
K i hoz-ta a hirt? 'Wer brachte die Nachricht?' K i ? 'Wer?'
Bei den E n t s c h e i d u n g s f r a g e n werden die Fragesätze mit der Fragepartikel e eben durch diese in ihrer besonderen Art gekennzeich-net, nicht aber durch eine besondere interrogative Melodie. In diesem Satz-typus kann es selbstverständlich keine Sätze geben, die aus einer einzigen Silbe bestünden:
\ • > * <
Vitt-e hirt va-la-ki? 'Überbrachte jemand die Nachricht?'
Die i n t e r r o g a t i v e S a t z m e l o d i e kennzeichnet nur die o h n e F r a g e w o r t gebildeten Fragen (vgl. auch das obige Beispiel). Diese interrogative Melodie ist s t e i g e n d - f a l l e n d , genauer gesagt a m E n d e f a l l e n d : während der zwei letzten Silben steigt die Melodie
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIE SATZMELODIE 349
von der oberen Stimmlage zur unteren ab. Sind etwa einige Silben voran-gestellt, so schweben sie entweder in der mittleren Lage, oder steigen ein wenig an, erreichen aber die obere Lage immer nur in der vorletzten Silbe, ein wenig sprunghaft. In einsilbigen Sätzen ist nur der gleitende Anstieg deutlich vermerkbar:
<7 Eljössz velem? 'Kommst du mit mir?' El? 'Ja?'
c) Unter den B e f e h l s - und V e r b o t s s ä t z e n haben jene mit einem verbalen Prädikat im Imperativ keine besondere Satzmelodie, wenn sie gefühlsmäßig indifferent gesprochen werden. In einem Satz von ähnlicher Prägung wie oben:
Vidd el ne-ki I 'Bring es ihm/ihr!' Vidd! 'Bring's (hin)!'
In verblosen Sätzen, deren Befehlscharakter durch ihren Aufbau trotz ihrer Unvollständigkeit eindeutig erkennbar ist, wird ebenfalls diese Grund-form verwendet:
Vi-zet ne-ki! 'Gib/gebt ihm/ihr Wasser!' Igy ! 'So !'
Dagegen haben die Befehlssätze, die nicht nach der Imperativischen Struktur aufgebaut sind, eine besondere, n u r i h n e n e i g n e n d e Melodieform. Hierher gehören die kurzen Warnrufe. Wenn ihr Befehls-charakter durch die Sprechsituation unverkennbar ist, so kann ihre Melodie wie üblich am Anfang fallen:
V - V . V Figyelem! 'Achtung!' Beszäll&s ! 'Einsteigen!' Leülni! 'Setzen !'
Sonst aber bleibt die Melodie dieser Sätze durchwegs in der oberen, hohen Lage:
Feldllas! 'Aufstehen!'
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
350 DIE SATZMELODIE
In mehrsilbigen Sätzen aber fällt sie oft am Satzanfang, um dann am Ende sprunghaft zu steigen:
V Figyelem I 'Achtung Γ Visszalapozni! 'Zurückblättern!'
d) Die A u s r u f e - und W u n s c h s ä t z e werden von vornherein nicht als Mitteilungen, sondern als Ausdruck von G e f ü h l e n oder Gedanken geprägt. Somit kann es unter den sinngemäßen Grundformen keine geben, die ausschließlich für diese Satzarten charakteristische, beson-dere Melodieformen wären. Da nun die anfangs fallende Form das Haupt-merkmal der Mitteilung ist, kann sie in diesen Sätzen nicht die übliche Form sein. Für die Ausrufe- und Wunschsätze ist nämlich ihrer Grundform nach eine allmählich fallende Melodie kennzeichnend, also eine funktions-lose Form, die anzeigt, daß der zur Aussprache notwendige Luftstrom schwächer wird:
De szep ruha ! 'Welch schönes Kleid !' Bar eljönnel! 'Wenn du doch kämest!'
Die sinkende Melodie erreicht jedoch nicht die untere Stimmlage. e ) I n m e h r p h a s i g e n Sätzen — die in der Rede durchwegs
häufiger vertreten sind — enthalten viele Melodiephasen zwangsläufig u n v o l l e n d e t e Aussagen. Die letzte Silbe solcher Phasen steigt gewöhnlich bis zur mittleren Stimmlage an, und zeigt damit an, daß im Redefluß noch etwas nachfolgt (im folgenden Beispiel ist die mittlere Stimmlage mit einer waagerechten, der Phaseneinschnitt mit einer Senk-rechten angedeutet):
Übrigens weisen die mehrphasigen Sätze bis zur letzten Phase eine ziemlich g l e i c h m ä ß i g e Melodie auf, weil diese Phasen die im Ungarischen typische a n f a n g s f a l l e n d e Grundform kennzeichnet, erst in der l e t z t e n Phase stellt es sich heraus, ob es sich bei dem ganzen Satz um eine Mitteilung, Frage usw. handelt.
f) Was nun die verschiedenen L a g e n der Satzmelodie anbelangt, so verbleibt die mehrphasige Aussage oft nicht in der einer durchschnitt-lichen Melodiehöhe entsprechenden m i t t l e r e n Lage: die s a t z t o -n i g e Phase verlagert sich gewöhnlich auf eine h ö h e r e Stufe, wobei die untere Grenze dieser höheren Stufe etwa dem mittleren Punkt der mitt-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIE SATZMELODIE 351
leren Lage entspricht, und der tonlose, auch melodisch indifferente Ansatz auf dieser Höhe der mittleren Lage verbleibt:
Meg vagy te Jolondulva?! 'Bist du denn verrückt?! '
Die in die Hauptmitteilung e i n g e s c h o b e n e n A b s c h n i t t e sind satzmelodisch zumeist durch eine t i e f e r e L a g e als gewöhnlich gekennzeichnet:
Α ίιύ — tudjätok — elutazott. 'Der Junge — müßt ihr wissen — ist abgereist.'
B) Wir haben die sinngemäßen Grundformen bisher ziemlich verein-facht untersucht, obschon sie unter dem Einfluß der unterschiedlichen Grade der g e f ü h l s m ä ß i g e n Intensität in sehr vielen Varianten auftreten. Aus der Vielzahl dieser Varianten wollen wir hier nur die typisch-sten, beständigsten und verbreitetsten erwähnen. In den Varianten setzt es sich als gemeinsame Eigenschaft durch, daß das H a u p t m e r k m a l der s i n n g e m ä ß e n Grundform — wie ζ. B . das Fallen und das sprung-hafte Ansteigen — auch in ihnen u n v e r ä n d e r t bleibt; als Ausdrucks-mittel der Gefühlskomponente dient die in dieser Hinsicht weniger aus-geprägte absteigende, ansteigende bzw. schwebende Komponente der Satz-melodie.
a) Im Aussagesatz kann sich die Satzmelodie unter dem Einfluß des gefühlsmäßigen N e b e n a k z e n t e s verändern, j a selbst die aus einem Wort bestehende Phase in zwei Phasen zerfallen, wenn der Ton besonders stark ist. In solchen Fällen kann zwischen die beiden Phasen eine Sprech-pause eingeschoben werden:
Meg-örülok! 'Ich werde verrückt!'
Der auf die vorletzte Silbe fallende Nebenton bewirkt den etwa s t e i -g e n d - f a l l e n d e n melodischen Verlauf; das ergibt die g e m ü t -l i c h e G e s p r ä c h s v a r i a n t e :
LdJttarn az uj kocsidat! 'Ich habe deinen neuen Wagen gesehen!'
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
352 DIE SAXZMELODIE
Fällt der Nebenton auf die letzte Silbe, so schließt er den Satz s t e i g e n d und vermittelt dadurch eine l e i d e n s c h a f t l i c h e r e bzw. w a r -n e n d e Nuance:
\ . • / Az uj kocsit is lättarn! 'Auch den neuen Wagen habe ich gesehen!'
In der ersten Variante steht das Prädikat selten, in der zweiten dagegen zumeist am Ende des Satzes; ansonsten werden beide Varianten in der Um-gangssprache nur mäßig gebraucht, weit mehr in der Regionalsprache.
b) In den E r g ä n z u n g s f r a g e n trägt mitunter die letzte Wort-silbe den Nebenton und ist in ihrer Melodie a n s t e i g e n d . Diese Form ist etwas f o r d e r n d geprägt und nötigt mehr zur Antwort:
Mit csinälio/fc? 'Was tut ihr?'
Verlautet diese Form als wiederholte, drängende Frage, so deckt sich ihre Melodie mit jener der Entscheidungsfrage, nur ist sie in einer höheren Lage:
Mit csinältok?
Ja , sie kann am Anfang auch in der oberen Lage schweben, wenn sie eine gewisse Gereiztheit ausdrücken soll:
Mit csinaltok? !
Die Entscheidungsfrage mit der Fragepartikel e vermittelt mit einem etwas steigend-fallenden Schluß eine freundlichere, vertraulichere Nuance als mit einer glatt ausklingenden Schließung:
$zeretsz-e korcsoZyazni? 'Läufst du gern Schlittschuh?'
Wenn aber die Frage den Nebenton auf der letzten und melodisch steigen-den Silbe trägt, so wirkt sie ebenfalls drängender, fordernder:
ÜJ/köszültel-e? 'Bist du fertig?'
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIE SATZMELODIE 363
In den Entscheidungsfragen ohne die Fragepartikel e vermittelt der Ansatz in t i e f e r e r Lage im allgemeinen eine indifferentere, der in höherer eine affektbetontere Nuance.
Besonders in Fragen nach Angaben wird die sog. u n t e r b r o c h e n e Frage mit s t e i g e n d o r Satzmelodie verwendet:
Apja neve? 'Name des Vaters?'
c) In den Befehlssätzen mit verbalem Prädikat im Imperativ kann die Melodie infolge der n e b e n t o n i g e n letzten Silbe s t e i g e n ; da-durch wirkt diese Form d r ä n g e n d e r :
iitfvidd a 1 evelet! 'Daß du den Brief hinbringst I'
In verblosen Befehlssätzen, deren Aufbau ihren Befehlscharakter jedoch nicht verkennen läßt, kommt diese Variante ebenfalls vor:
Bort ide! 'Wein her! '
In den Satzstrukturen, die nicht Imperativisch aufgebaut sind, wird die unverändert höhere Lage strenger beibehalten:
9 · ' "β indulas! 'Los/Abfahrt!'
Die in oberer Lage schwebende, sodann jäh abfallende Variante wirkt mil-der, gemütlicher, mitunter etwas gedehnt:
0 O
i7zsonnäzni 1 'Jause! '
d) Die A u s r u f e s ä t z e , die eine Verwunderung ausdrücken, sind in ihrer Melodie eher f a l l e n d , jene jedoch, die leidenschaftlich geprägt sind, zeigen eine ähnliche Melodie wie die a m A n f a n g f a l l e n d e n Formen, besonders wenn sie auch inhaltlich den Aussagesätzen nahestehen. So ζ. B. verwundert:
« ' · » « De buta vagy ! 'Bist du aber dumm !'
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
354 DIE SATZMELODIE
Mehr aussagend, affektbetont:
De buta vagy ! 'Du bist aber dumm !'
Gemütlich geprägt können diese Sätze auch mit ansteigender Melodie verlaufen:
Liegt auf den ungeraden Silben eines Satzes, der einem starken Affekt Ausdruck verleiht, ein gefühlsmäßiger Akzent, so besteht seine Melodie eigentlich aus ebenso vielen Phasen, obschon diese sinngemäß zu einer Einheit zusammengefaßt bleiben. Dadurch aber ergibt sich die wiederholt fallende und sprunghaft ansteigende, stark fluktuierende Satzmelodie:
Mit csindJjak?! Mit csiiwWjak?! 'Wae soll ich tun? ! Was soll ich tun?! '
e) Auch die H ö h e der Stimmlagen kann durch stärkere Affekte beeinflußt werden. Der Abstand zwischen den Lagen ändert sich — was auch richtiger ist — meistens nicht, nur wird die Rede in ihrer Gesamtheit in eine h ö h e r e oder t i e f e r e Lage als üblich t r a n s p o n i e r t . Hierbei drücken die höheren Lagen eher Freude oder Gefühlsausbrüche aus, die tieferen dagegen Schmerz, Betrübnis, Leid und unterdrückte Gefühle. Seltener — und das ist auch weniger richtig — springt der höchste Punkt der Stimmlage in der Silbe der gefühlsmäßigen Akzentuierung be-trächtlich höher als üblich:
R h y t h m i s c h e B e s t r e b u n g e n setzen sich in der Satz-melodie nur insofern durch, als diese auch dem rhythmischen A k z e n t gewissermaßen angepaßt wird. Darum bedürfen die rhythmischen Melo-dieformen keiner besonderen Darlegung.
De okos vagy! 'Bist du aber klug I'
iVekem ilyet ne mondjatok! 'Sagt mir so etwas nicht!'
F e h l e r in der Satzmelodie sind zumeist auf falsche Akzentuierung zurück-zuführen. In den anfangs fallenden Frage-, Ausrufe- und Warnungssätzen kann aber
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
DIE SATZMELODIE — DIE REDEPAUSE 365
die Melodie in der letzten Silbe gleitend ansteigen, wodurch die Bede eine s i n g e n d e Prägung erhält :
U Hol voltä-äl Ϊ 'Wo wäret du ?'
I n den Entscheidungsfragen ohne die Fragepartikel e ist mitunter s t a t t des regel-rechten ansteigend-fallenden Schlusses eine ähnliche Schließung herauszuhören:
»SzöitäJ Aladärna-akΤ 'Hast du Aladär Bescheid gesagt? '
Kichtig:
jS"z<5itfLl Aladärnak? 'Hast du Aladdr Bescheid gesagt? '
D) Die Redepause
(§ 209) Die Redepause ist ein G l i e d e r u n g s z e i c h e n , das zwischen den kleineren oder größeren organischen Teilen des Redeflusses eingefügt wird, um die Einheit der zusammengehörenden Teile zu verdeut-lichen. Obschon die Redepause im allgemeinen zwischen z w e i b e n a c h -b a r t e n T e i l e n als Gliederung fungiert, tr i t t sie, genauer betrachtet, als den folgenden Teil vorbereitende V o r p a u s e bzw. den voran-gegangenen Teil abschließende N a c h p a u s e in Erscheinung. (Praktisch können selbstverständlich eine Vor- und Nachpause zu einer Einheit ver-schmelzen.) Eingeschobene Anredeformen, Interjektionen, Anführungs-sätze, Interpretierungen bzw. Appositionen werden vom übrigen Redefluß gewöhnlich durch ein P a u s e n p a a r getrennt.
In Anbetracht der zeitlichen Dauer können wir wohl von l ä n g e r e n oder k ü r z e r e n Redepausen sprechen, doch ist sowohl die Pausendauer als auch die Unterscheidung der entsprechenden Pausengruppen weit-gehend durch s u b j e k t i v e Faktoren und durch das d u r c h -s c h n i t t l i c h e S p r e c h t e m p o bedingt.
In der gehobenen, gebildeten Rede richtet sich auch die Atmung nach den oben umschriebenen Redepausen. Ebenso sind auch Redepausen zu meiden, die nur durch N a c h d e n k e n , G r ü b e l n (also Zeitgewinnung) begründet sind. — Mitunter kann die fällige Redepause durch andere Mittel der Gliederung (ζ. B. Akzent, Melodie, Verlagerung der Stimmlage) ersetzt werden, so daß die Redepause wegfällt.
Die V o r p a u s e tr i t t vor satztonigen Teilen ein (Most| in vagyok soron ! 'Jetzt bin ich an der Reihe I'); aber auch zwischen dem Subjekt und
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
356 DIB REDEPAUSE — LITERATUR
dem nachfolgenden Prädikatsnomen (.Budapest | az orszdg /όνάrosa 'Buda-pest — die Hauptstadt des Landes'); vor den Gliedern einer Aufzählung, aber nicht vor dem ersten Glied (Egy, | kettö, | hdrom ! 'Eins, zwei, drei 1'); usw.
Die N a c h p a u s e folgt am Ende der abgeschlossenen Sätze (Sötet van. | Fäzom. | 'Es ist dunkel. Mich friert's'); am Ende der Gliedsätze des zusammengesetzten Satzes (Fäzom, | de az ehseg is mind jobban gyötör 'Mich friert's, aber auch der Hunger quält mich immer ärger'). Diese Nach-pause ist im allgemeinen länger als die vorige, obschon zwischen den Glied-sätzen nicht immer eine Redepause eintritt.
P a u s e n p a a r e schließen ζ. B. die Appositionen ein (Ma, | α sztinet elsö napjän, | m&r dolgozol? 'Heute, am ersten Tag der Ferien, arbeitest du schon!'); im allgemeinen auch die eingeschobenen Redeein-heiten, Interjektionen, Anredeformen und oft die modifizierenden Parti-keln. Das aber muß nicht immer der Fall sein.
Soweit aus den bisher vorgenommenen wenigen phonetischen Messungen er-siohtlioh, liegen die kürzeren Pausen zur Trennung von kleineren Redeeinheiten durchschnit t l ich bei 40—50 φ, d . h . bei einer halben Sekunde; die Pausen zwischen den Gliedern eines zusammengesetzten Satzes bei 100—150 φ, d . h . bei einer Sekunde bis ander thalb Sekunden. Doch gibt es in dieser Hinsicht o f t Schwankungen. Es ist interessant, daß die erste Pause eines Paars , das einen eingeschobenen Redeteil um-faß t , o f t nur die Drittel- bis Vierteldauer der zweiten Pause ergibt . Die zur Gliederung von Nebensätzen dienenden Pausen sind zwei- bis dreimal so lang wie jene, die die Glieder einer Satzreihe auseinanderhalten.
Literatart a) Zu A): BALASSA, J . , Α hangsüly a magyar nyelvben 'Die Be-tonung im Ungarischen' (NyK. X X I , 4 0 1 — 3 4 ) ; BULÄNYI, GY., Α magyar hangsüly romlasa 'Der Verfall des ung. Akzents ' (MNy. X L , 3 3 0 — 4 8 ) ; FONAGY, I . , Α hangsülyröl 'Über den Akzent ' (Ny tudEr t . .Nr. 18); JACOB! LÄNYI, Ε . , Α magyar hangsüly vedelme 'Die Wahrung des urig. Akzents ' (MNy. X X X V I , 75 — 9).
b) Zu A) und Β): DBME, L. f Α hangsüly es a szörend kerdesei 'Fragen der Be-tonung und der Wortfolge' (MNyelvh.1 3 2 6 — 4 8 ) ; KICSKA, E . , Hangsüly es szörend 'Betonung und Wortfolge ' (Nyr. X I X , 6 — 18, 1 5 3 — 8, 2 0 3 — 9, 3 9 0 - 5 , 4 3 3 — 4 0 ; X X , 2 9 2 — 8, 3 3 7 — 4 5 , 3 8 5 — 94 , 4 3 3 — 4 5 , 4 8 1 - 9 1 ; X X I , 3 8 5 — 95, 4 3 4 — 4 8 , 486 — 9 7 ; X X I I , 6 — 1 3 , 5 2 — 6 3 ) ; MOLEOZ, Β., Α magyar hangsüly es szörend kapcso-lä ta 'Die Beziehung von Betonung und Wortfolge im Ungarischen' (Nyr. X X X I V , 4 8 9 - 8 2 ) .
o) Zu A) und C): DBME, L., A helyes magyar kiejtes kerdese 'Das Problem der ung. Rech t lau tung ' (NyFK. 2 1 5 — 3 9 ) ; JACOBI LÄNYI, E . , Hangsüly es hanglej tes ' B e t o n u n g u n d Sa tzmelod ie ' (MNy. X X X V , 101 —11); LAZICZIUS, GY., Α m a g y a r hangsüly 6s hanglej tes dolgdban 'Zur Frage der ung. Betonung und Satz-melod ie ' ( M N y . X X X V , 173 — 6).
d) Zu A), B) und C): GYOMLAI, GY., Szörend, hangsüly, hanglej tes a felteteles megengedö monda tokban 'Wortfolge, Betonung, Satzmelodie in den konditionalen Konzessivsätzen' (MNy. X X X I V , 1 6 - 2 6 ) .
e) Zu Β): DEME, L., Szörendi vetsegek es ketsegek 'Fehler und Zweifel bezüglich der Wortfolge ' (IskNyelvm. 293— 302); Szörendi es sorrendi kerdesek 'Fragen der Wortfolge und der Satzordnung' (Nyr. L X X X V , 1 3 7 — 4 7 ) ; A nyomatek ta lan monda t egy fa j td ja rö l 'Von einer Ar t des unbetonten Satzes ' (MNy. L V , 1 8 5 — 9 8 ) ; JOANNOVICS, GY., Szörend 'Wortfolge ' (Nyr . X I I I , 5 3 — 8 , 103—10, 197—204, 299—306 , 3 9 1 - 6 ) ; Szörendi t anu lmänyok ' Studien zur Wortfolge ' (AkNyf i r t . X I I I , Nr . 10 und XIV, N r . 2; N y r . X X X I I , 16—9, 2 1 5 - 2 0 , 318—24 , 361—9, 4 8 6 — 9 0 , MOLECZ, B . , Szörendi tanulmÄnyok 'Abhandlungen zur Wortfolge ' (NyF. Nr . 70); Α magyar szö-rend esztet ikdja 'Ästhetik der ung. Wortfolge ' (Sonderabdr. aus dem J a h r b . des Realgymn. Szentes, 1932 — 33); SCSLACHTEB, W., Megjegyzesek a magyar szörendhez 'Beiträge zur ung. Wortfolge ' (MNy. X L , 4 9 — 5 6 , 1 0 0 — 1 0 ) ; SIMONYI, ZS., Α magyar szörend 'Die ung . Wortfolge ' (NyF. Nr. 1).
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM
LITERATUR DEE SATZFÜGUNGSMITTEL OHNE SELBST. LAUTKÖÄPEB, 367
f) Zu C): C s ü r y , B., A magyar kiejt^e kördlse 'Das Problem der ung . Aussprache ' (MNy. X X X V , 32—9); Α szamoshäti nyelvjäLräe hanglejt0eform4i 'Die Fo rmen der Satzmelodie im Dialekt des Samoschrückens' (MNyTK. Nr . 22); Α magya r hangle j t^s 'Die ung. Satzmelodie' (DebrSzle. 1936, 107 ff.); F ö n a g y , I .—Maqdics , Κ . , Α kördfi monda tok dallamdröl 'Über die Melodie der Fragesätze ' (Bdrczi-Eml. 89—106); Az erzelmek tükrözßdese a hanglejt^eben έβ a zenöben 'Die Widerspiegelung der Gefühle in Satzmelodie und in Musik' (NyK. LXV, 102—45); Magd ics , Κ . , Α m a g y a r hanglej tes problemdjdhoz 'Zur Frage der ung. Satzmelodie ' ( Jahrb . der Phi l . F a k . der E L T E 1954, 416—29); M o l n ä b , I . , Α magyar hanglej t^s rendszere 'Das System der ung. Satzmelodie ' (1954); T o l n a i , V., Ada tok a magyar hanglejt£shez 'Bei t rage zur ung. Satzmelodie ' (MNy. X I , 51 — 9, 108 — 16, 150—6).
g) Zu D): H e g e d ü s , L. , On the Problem of t he Pauses of Speech (ALH. I l l , 1 — 34); Besz&itempö-elemzesek 'Sprechtempo-Analysen' (Nyr. L X X X I , 223 — 7).
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 10/31/13 3:23 PM