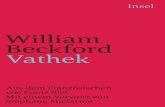Von der Geschmacks-zur Schönheits-ästhetik... und zurück zum Geistesgefühl des Erhabenen
-
Upload
carsten-zelle -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
Transcript of Von der Geschmacks-zur Schönheits-ästhetik... und zurück zum Geistesgefühl des Erhabenen
C ~ N ZELLE
VON DER GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITS- ASTHETIK... UND ZURIJCK ZUM GEISTESGEFI~IHL DES ERHABENEN.
KLEINES PL,StDOYER ZUR DUALISIERUNG DER ASTHETIKGESCHICHTE ZWISCHEN AUFKLARUNG UND ROMANTIK
Im Asthetikkapitel des Bandes, der den ,,Climat g6n6ral" der Wende von der Aufkl~irung zur Romantik skizziert, ist die Entwicklungsrichtung mit einer Skizze ,,De l'esth6tique du got~t ~ l'esth6tique du beau" (3.1.) vorgegeben. In meinem Pliidoyer mOchte ich die Gegenrichtung stark machen, die die- se Entwicklung von vornherein wie ein schlechtes Gewissen begleitet hat. Damit trete ich dem Vorurteil entgegen, dab es sich bei der Asthetik im wesentlichen um eine ,,Lehre vom SchOnen "1 handelt, wie man in einem einschlfigigen philoso~. phischen Handw0rterbuch nachlesen kann. M6gen die Ab- grenzungen von Asthetik und Ethik umstritten, die Theorie- bildungen des Asthetischen in werk' und wirkungs/isthetische Lager gespalten oder mOgen seit den scharfsinnigen Uberle- gungen der Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik auch die nicht mehr schOnen Kiinste als Grenzphanomene des Asthetischen in Blick geraten sein, so bleiben doch selbst fiir die Zeit nach der historischen Wende zur Asthetik um 1750 Sch6nheit und deren Derivate Orientierungshorizont der Kunst- und Literaturtheorie und ihrer Geschichtsschreibung: ,,Beauty I take to be the central concept of esthetics [... ].,,2
1 Z.B.Philosophisches WOrterbuch.Stuttgart 1969, S. 37 f. 2 Jared S. Moore, The Sublime, and Other Subordinate Esthetic Con-
cepts. In The Journal of Philosophy XLV (1948), H. 2, S. 42~7, hier S. 42. Auch die Rede von den ,,varieties of beauty" (Wladyslaw Tatarkiewicz, A History of Six Ideas. An Essay in Aesthetics. The Hague, Boston, London, Warszawa 1980, S. 157 ft.) h/ilt an der Einheit des Sch6nen lest, die durch die Entstehung der Asthetik im 18. Jahrhundert gerade aufgekfandigt wird.
Neohelieon XlX/2 Akad.~m~'/aad.~, Budapea John Benjamlm B. V., Amsterdam
114 CARSTEN ZELLE
Dieser Zentrierung der Asthetik ums SchOne liegt jedoch eine einseitige Sicht auf die Friihphase der ,/~sthetik in der er- sten H~ilfte sowie ein ein~iugiger Riickbezug auf ihre Hochzeit am Ende des achtzehnten Jahrhunderts zugrunde. So tadel- te etwa Kant die Ineinssetzung von SchOnheit (,,pulchritudo") und Asthetik (,,aesthetica") bei Georg Friedrich Meier, dem Popularisator von Baumgartens Aesthetica (1750/58) mit den Worten: ,,es ist aber falsch, dab er schOn und aesthetisch vor einerley h~ilt, denn zur Aesthetic gehOret nicht nur das Schrne, sondern auch das Erhabene. ''3 Und schon ein Jahrhundert zu- vor hatte der franzOsische Frtihaufkl/irer Frnelon (1651-1715) das Vorurteil, dab es die Kunstlehre mit dem SchOnen als ih- rer zentralen Kategorie aUein zu tun habe, mit der Feststel- lung korrigiert: ,,Le beau qui n'est que beau [.. . ], n'est beau qu'~ demi "4 Der also spricht nur tiber die Halfte des SchOnen, der vonder leidenschaftlichen Kraft des Erhabenen schweigt. In Hinsicht auf die ,~xsthetik des Erhabenen einerseits und die Modifikation seines Konzepts der Postmoderne als eines ,,r66crire" einiger charakteristischer Ztige der Moderne ande- rerseits, hat jetzt Jean-Franqois Lyotard wieder daran erinnert, ,,dab es innerhalb der Asthetik einen wesentlichen Bruch mit der ~sthetik selbst gibt". 5
Nun rnOchte ich nicht nur vonder anderen Hiilfte des Schr- nen, das das Erhabene ist, sprechen, vielmehr schlage ich vor, die beiden ~isthetischen Kategorien im Zusammenhang einer seit der Querelle des Anciens et des Modernes sich ausbilden- den doppeltenilsthetik derModerne zu situieren. Ich tue dies im
a Collegium des Herrn Professors Kant tiber Meyers-Auszug aus der Vernunft-Lehre. Nachgeschrieben von Hermann Ulrich Freiherr von Biota- berg [ca. 1771]. In Immanuel Kant: Gesammelte Schriften. Bd. 24. Berlin 1966 (= Akademieausgabe), S. 47.
4 Zit, nach Elbert Benton Op't Eynde Borgerhoff, TheFreedom of French Classicism, (Princeton~ New Yersey 1950)~ S. 231.
5 Das Untarstellbare - wider das Vergessen. Ein Gesprlich zwischen Jean-Franqois Lyotard und Christine Pries. In DasErhabene. Zwischen Grenz- erfahrungund Grfflenwahn. Hg. Christine Pries. (Weinheim 1989), S. 319-347, hier S. 320.
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITSASTHETIK 115
Kontext des westeurop/iischen Literaturensembles und greife nach einigen Stichworten zum/isthetischen Neuansatz Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts (I) zun~ichst drei frtihe Stationen der doppelten Asthetik heraus: Boileaus paradoxen Coup, der ihm 1674 mit der gleichzeitigen VerOffentlichung seiner L'Artpo~tique als Synthese der ldassizistischen Doktrin und seiner Pseudo-Longinos-Ubertragung Trait~ du Sublime als deren Dementi gelingt (IIa). John Dennis' Alpeniiberque- rung im Jahre 1688, in deren Bericht wir erstmals die moderne, d. h. ambivalente Geftihlsmischung eines ,,delightful horror" greifen kOnnen (IIb). Bodmers Separierung des Erhabenen in den Formen des ,,GroBen" und ,,Ungestiamen" vom Sch6- nen und Breitingers System einer doppelten Poetik in der Cri- tischen Dichtkunst yon 1740 (IIc). AbschlieBend mOchte ich zu Schillers ~isthetischen Schriften der neunziger Jahre sprin- gen und die unvers6hnliche Dualit/it von SchSnheit und Er- habenheit als Grund profilieren, warum sein Konzept einer ,,,a~sthetischen Erziehung" Fragment blieb (III). 6
Die Wende der Poetik und Kunstliteraturen zu einer die Einzelkiinste umfassenden ,,Asthetik" im modernen Sinne ei- ner ,,Wissenschaft yon der sinnlichen Erkenntnis "7 entsteht ja gerade nicht im AnschluB an Sch0nheit bestimmende Be- griffe wie Vollkommenheit, Symmetrie und Proportion, mit
6 Abschnitte I bis II c raffen frfihere Ansatze zusammen, die hier erst- reals bis Schiller (III) weitergefiihrt werden. Siehe Carsten Zelle: Sch6nheit und Erhabenheit. Der Anfang doppelter .~sthetik bei Boileau, Dennis, Bod- mer und Breitinger. In Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und Grfflen- wahn. Hg. Christine Pries, Weinheim 1989, S. 55-73; ders.: Sch6nheit und Schrecken. Zur Dichotomie des SchOnen und Erhabenen in der Asthetik des achtzehnten Jahrhunderts. In Literaturkritik - Anspruch und Wirklichkeit. DFG-Symposion 1989. Hg. Wilfried Barner. (Stuttgart 1990), S. 252-270.
7 Alexander Gottlieb Baumgarten, TheoretischeAsthetik. Die .gundlegen- denAbschnitteausder,Aesthetica" (1750/58). Lateinisch/deut.sch. Ubers., Hg. Hans Rudolf Schweizer. (Hamburg 1983)7 w 1, S. 2 f.
116 CARSIENZELLE
denen im Klassizismus und in der Klassik wieder auch For- men zur Ruhe gelangten, gelungenen oder gegliickten Le- bens konnotiert wurden, sondern im Zuge einer die Befind- lichkeit der franz0sischen und englischen MuBeschichten re- flektierenden Psychologie der Langeweile und einer damit ein- hergehenden Emotionalisierung der Kunsttheorie. Baumgar- ten handelt zwar die auf Pseudo-Longinos zuriickzufiihren- den Begriffe ,,~thetische GrOBe", ,erhabene Denkart" oder ,,fisthetischer GroBmut" noch gfinzlich ohne Bezug auf die in England von Dennis oder Addison hervorgebrachte, um ,,ter- ror" und ,,delightful horror" zentrierte Kategorie des Subli- men ab. Doch fiihrt Baumgartens Trennung von metaphysi- scher und fisthetischer Wahrscheinlichkeit bei seinen Nachfol- gern Johann Adolf Schlegel und Mendelssohn zu der Einsicht, dab das Schlimmste in der Natur, n~imlich Furcht, Schrecken, Angst, Traurigkeit und Abscheu in der Kunst dargestellt eine ,,vorztigliche Giite" habe. 8 Erst Hegel beruhigt die Asthetik wieder zu einer ,,Philosophie der sch6nen Kunst", indem er deren dunklere Seite, namentlich das Schrecklich-Erhabene, iibergeht. Den Preis des klassizistischen Riickgewinns und der Hochwertung des SchOnen als sinnlichem Scheinen der Idee rechnet freilich die Randstellung des Erhabenen als frii- he, nur symbolische Kunstform, der Satz vom Ende der Kunst, sowie die Verachtung der romantischen Literatur vor, die dem Zuffilligen und GewOhnlichen, kurz: ,,dem UnschOnen einen ungeschmfilerten Spielraum" gOnnt. 9
Eine friihe Station dieses fisthetischen Neuansatzes mar- kiert der Traite du Beau (1715) des Cartesianers Jean-Pierre de Crousaz (1663-1748). Zwar formuliert Crousaz einer- seits einen werkpoetischen SchOnheitsbegriff, der um die
8 Vgl. Carsten Zelle, ,,Angenehmes Grauen". Literaturhistorische Bei- tri~gezurAsthetik des Schrecklichen im 18. Jahrhundert. (Hamburg 1987), S. 322 ft., S. 387.
0 GeorgWilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen iiberdieAsthetikJ-IIl. Hg. Eva Moldenhauer, Karl Markus Michel. Frankfurt 1970 (= Werke, Bd. 13--15), bes. Bd. 13, S. 13, 23 ft., 139 ft., Bd. 14, S. 127 ft.
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITSASTHET1K 117
Bestimmungen ,,vari6t6", ,,uniformit6", ,,regularit6", ,,ord- re" und ,,proportion" versammelt ist. Andererseits jedoch tendiert Crousaz unter Bezugnahme auf die von Descartes herausgearbeitete Struktur des Selbstgefiihls zu einer wir- kungsasthetischen Fassung des Sch0nen. Ein Gegenstand, der als schOn bezeichnet werden will, mull lebhafle Empfin- dungen hervorrufen. Diese Psychologisierung ffihrt Crousaz zur Erg~inzung des eben angeffihrten Katalogs objektiver Kri- terien um einige ausschliel31ich durch ihre emotive Wirkung begrfindete Prinzipien. Crousaz nennt ,,grandeur", ,,nou- veaut6", ,,diversit6" und den Glanz des die Sch0nheit erhe- benden ,,d6sordre". Die Hauptaspekte dieses iisthetischen Neuansatzes hat Jean Baptiste Dubos (1670-1742) in seinen R~flexions critiques sur la Poesie et sur la Peinture (1719) zusam- mengefallt. FOr unseren Zusammenhang ist vor allem wichtig, dab Dubos unter dem Schlachtruf ,,sublime" einen wirkungs- poetischen Mangel des blo13 SchOnen herausstellt. Es reiche n~imlich nicht aus, wie Dubos gestfitzt auf ein ,,falsches" Zitat aus derArspoetica des Horaz (Verse 99/100) bemerkt, dall die Dichtung nur schOn, regelm~illig und rein sei, vielmehr miisse sie das Herz riihren und aufregen.
II a
Sowohl der poetische Aspekt dcr Unordnung als auch der ~isthetische Effckt der Rfi.h. rung, den Crousaz und Dubos aus- spielen, k6nnen auf die Uberlegungen yon Nicolas Boileau- Dcspreaux (1636-!711) zuriickbezogen werden. Dcnn ihm gc- lingt 1674 mit der gleichzeitigen VerOffentlichung seiner L ;4rt podtique und seines Trait~ du Sublime der doppeldeutige Coup, den im Sinne der doctrine classique ausgedeuteten Poetiken von A_ristoteles und Horaz einen ebenfalls durch die Antike legitimierten, jedoch ,,unverbrauchten" Gew~ihrsmann gleich- rangig zur Seite zu stellen. Mit der neuen antiken Auto- rit/it im Rficken, er6ffnete er sich die M6glichkeit, in werk-, produktions- und wirkungspoetischen Fragen fiber den Klas-
118 CARSTEN ZELLE
sizismus hinauszugehen, ohne ihn jedoch schlechthin in Frage zu stellen. Boileau gehOrte freilich dem Klassisizmus an, aber wie sein bOses Gewissen. Mochte es auch nicht in der Absicht Boileaus gelegen haben, so lieferte er doch mit der Wieder- entdeckung von Pseudo-Longinos die antike Begriindung fOr die Moderne. Denn zun~ichst vor allem in Frankreich wegen seiner mitreiBenden Wirkung favorisiert, entwickelte sich das Erhabene schnell zu der poetischen Kategorie, die aUe jene PNinomene versammelte, die nicht im Prokrustesbett klassi- zistischer SchOnheit Platz fanden, gleichwohl ~isthetisches In- teresse beanspruchten. So verhalten sich L'Art podtique und Trait~ du Sublime zueinander wie Ausgrenzendes zu Ausge- grenztem. 1~ Darin kehrt wieder, was aus jenem verdr~ingt ward. Unter dem Mantel des Erhabenen findet das Nichtsch6- ne: das Entsetzliche, H~iBliche und Schreckliche Einlal3 in die Kunsttheorie des 18. Jahrhunderts.
Boileau selbst betrachtete seine Obertragung der im ersten nachchristlichen Jahrhundert entstandenen Schrift Fore Erha- benen als eine Art Fortsetzung derArtpodtique, denn sie habe mit dem Traktat einigen Zusammenhang und entnehme ihm auch mehrere Lehrsatze 11 - dem 33. Kapitel etwa die folgen- reiche Bemerkung, dab die groBen Dichter ,,keineswegs frei von Fehlern" gewesen seien. Die werkpoetischen Kriterien Fehlerfreiheit, Schliff und eleganter Stil haben gegentiber dem wirkungspoetischen Effekt, dab die Dichtung mitreiBend sein solle wie Feuer und Sturm, das Nachsehen. Boileaus Ober- tragung dieser Passage geht in derArtpo~tique in den auf die Ode bezogenen Begriff einer ,,beau desordre" ein. Ihn reakti- viert Boileau bezeichnenderweise in der Querelle des Anciens et des Modernes unter Riickgriff auf den Topos des ,,je ne sais
10 Vgl. Winfried Wehle, Das Erhabene. ~)ber die Kreativiti~t des Kreatiir- lichen. Entwurf. Romantistisches Kolloquium VI, Bad Homburg 16. bis 29. Marz 1990, Typoskript 44 S. Ich danke Herrn Wehle for die freundliche Uber- lassung seiner Vorlage.
11 Nicolas Boileau-Despr~aux, ,,Au Lecteur." In (Euvres compldtes. Ed. Antoine Adam, Fran~.oise Escal. Paris 1966 (= Bibl. de la Pl6iade, 188), S. 856.
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITS.~'rHETIK 119
quoi", um gegen den Angriff Charles Perraults (1628-1703), die Dichtung der Alten sei voller Fehler, Front zu machen, denn die der schOnen Unordnung zugrundeliegende Regel, sich nicht um Regeln zu scheren, sei das eigentliche ,,myst~re de l'art"J 2
Daneben ist es vor allem der wirkungs~isthetische Effekt, der Boileau am Traktat Vom Erhabenen fesselt. Im ,,Pr6face", das dem Trait~ du Sublime vorangestellt ist, unterlegt er Pseudo- Longinos, dal3 dieser unter dem Sublimen nicht den blol3en Ornatus eines ,,stile sublime" verstehe, sondern vielmehr ,,cet extraordinaire et ce merveilleux qui frape dans le discours, et qui fait qu'un ouvrage enleve, ravit, transporte. ''la Sp~iter sollte Boileau auf die affektgebundene Bestimmung des Sub- limen zuriickkommen, als er in der zwSlften Rdflexion sur Longin festhielt, dab das Erhabene eine gewisse Kraft der Re- de sei, die die Seele erhebt und mitreif~t. 14
Bei seinen Bestimmungen kann Boileau vor allem an die Oppositionen ankniipfen, mit denen Pseudo-Longinos gleich zu Beginn seines Traktats versucht hatte, die emotiven Wir- kungen des Erhabenen auf den Zuh0rer n~iher zu beschreiben. Ausgespielt wird bei ihm die pathetische Kraft des Erstaunens und Erschiitterns gegen eine sich an den Verstand wenden- de, ethische Redefunktion. Gegeniibergestellt erscheinen das Sch/Sne, das gefiillt, und das Erhabene, das durch Macht und Gewalt hinreil3t. 1~ In einer sp~iteren Passage verbindet Longin das zweigliedrige Dispositionsschema schOner und erhabener Redeweisen mit der Dichotomie zweier Landschaftstypen und
12 Boileau-Despr6aux, ,,Discours sur l'Ode" (1693). In (Euvres completes. S. 227: ,,Ce precepte effectivement qui donne pour r~gle de ne point garder quelquefois des r~gles, est un myst~re de l'art [ . . . ]."
13 Boileau-Despr6aux, ,,Trait~ du Sublime." In (Euvres completes, ,,Pr~- face", S. 338.
14 Boileau-DesprEaux, ,,R6flexions critiques." In (Euvres completes, ,,RE- flexion X-XII" (posthum 1713), S. 562 f.
15 Pseudo-Longinos, Vom Erhabenen. Griechisch/deutsch v. Reinhard Brandt. Darmstadt 1966, Kap. 1.4, S. 29 f.
120 CARSTEN ZELLE
liefert damit einen Topos, auf den die doppelte )i~sthetik des achtzehnten Jahrhunderts sich zwanglos wird zurfickbeziehen kOnnen. Die Gr613e yon Rhein, Donau, Nil und dem Ozean steht gegen den kleinen Bach, die Gewalt des Atna- und Son- nenfeuers gegen das klare Kerzenfl~immchen - kurz: ,,Von all diesen Ph~inomenen kann man das folgende sagen: das Niitzli- che oder auch Notwendige ist uns leicht bei der Hand, Bewun- derung jedoch erregt immer das Unerwartete."16
II b
Auch for England gilt, dab die Anknfipfung an Pseudo- Longinos zur Dichotomisierung der Dichtungstheorie fiihrt. ,,Sir Tremendous Longinus", wie die Zeitgenossen John Den- nis (1657-1734) spOttisch nannten, stellte in seinen poetologi- schen Schriflen ,,Terrour" und ,,Horrour" ins Zentrum der Ka- tegorie des Erhabenen, die er im legitimierenden Rtickgriff aus Pseudo-Longinos' Traktat und unter Berufung auf den Bildge- halt von Miltons Paradise Lost (1667) konturierte und vom nur Sch6nen separiert hat.
Dennis' dichtungstheoretisches System wird dabei prafigu- riert durch die Wahrnehmung des Gegensatzes zweier Emp- findungsformen, die sich ihm 1688 auf einer Reise durch Sa- voyen fiber den Mont Cenis nach Italien aufdr~ingten. Die Aussichten, die sich ihm hier er6ffneten, riefen eine vermisch- te Empfindung hervor, wie Dennis in seiner Reisebeschrei- bung niederschreibt: ,,a delightful Horrour, a terrible Joy, and at the same time, that I was infinitely pleas'd, I tremb- led. "17 Die Natur, die solche formlose Landschafl geschaffen hat, erscheint ihm in einer Reflexion, mit der er diesen Ge- fiihlsaufstand zu verarbeiten trachtet, dem genialen Verfasser
16 Pseudo-Longinos, Vom Erhabenen, Kap. 35.4, S. 99. 17 John Dennis, ,,Letter describing his crossing the /kips, dated from
Turin", Oct. 25, 1688. In The Critical Works. Ed. Edward Niles Hooker. 2 Bde. Baltimore 1939/43, Bd. II, S. 380-382.
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITSASTHETIK 121
von Oden vergleichbar. Das von Boileau ftir die Odengat- tung hervorgehobene Strukturmerkmal einer ,,beau d6sordre" i~bertragt Dennis auf die sich ihm darbietende Natur, die das angenehme Schrecken bei ihm ausgel0st hat: ,,we may well say [... ] what some affirm of great Wits, that her [Nature's; Verf.] careless, irregular and boldest Strokes are most admira- ble." Unter wirkungs~sthetischem Vorzeichen wird die sch0ne Unordnung der Odendichtung aufgrund ihrer frappierenden affektiven Kraft auf die schroffe Naturerscheinung iibertragen, was zu ihrer positiven Wertung ftihrt. Es w~ire daher falsch, das Sublime als ein Stilmittel in Frankreich vonder Wahrneh- mungskategorie des Erhabenen in England unterscheiden zu wollen. Es ist vielmehr so, dab nur deswegen, weil Boileaus li- terarische Stillehre dem Engl~inder Dennis die visuelle Wahr- nehmung lenkt, dessen Blick auf der unf6rmigen Gebirgsland- schaft haften bleibt und der Anblick angenehm wird.
Die neue Erfahrung des angenehmen Grauens kontrastiert mit dem vertrauten Vergniigen am Sch0nen. Der alte Ver- gleich, der dem Italienreisenden die gef~ihrliche Durchque- rung der Alpen verstiBen sollte, dieser unordentliche Gebirgs- klotz sei gleichsam eine Mauer, urn etwa die kalten Nordwin- de vom Garten Italiens fernzuhalten, wird von Dennis syste- matisch in eine umfassende Opposition eingefiigt. Vermutlich unter Anspielung auf den einschl~igigen Pseudo-Longinos- Topos, vergleicht Dennis den ,,Garden Italy" mit ,,the Alps", wobei er das alte vertraute Vergniigen gegen die neue und ungew0hnliche Erschiitterung abw~igt. Poetik des SchOnen und Asthetik des Erhabenen, altes und neues Landschafts- ideal, traditionelles und modernes Empfinden stehen neben- einander. Auf deskriptiver Ebene setzt Dennis die gemisch- te Gemtitsbewegung riihrender Erhabenheit angesichts un- geb~indigter Natur der vergn0genden, den Verstand anspre- chenden Sch6nheit am6ner Kulturlandschaft entgegen. Die Wirkung beider Erscheinungsformen, die die Natur dem Auge des Betrachters darbietet, vergleicht Dennis miteinander und kommt dabei zum SchluB: ,,Yet she [Nature; Verf.] moves us
122 CARfflEN ZELLE
less, where she studies to please us more." Dem klassizistischen SchOnheitsbegriff regelhafter Proportion und Harmonie gibt die dissonante Empfindung des ,,delightful Horrour" den Ab- schied.
Die Lekttire von Dennis Grounds of Criticism (1704) er- weist nun, dab der 1688 wahrgenommene Gegensatz der Erfahrungsformen eine Dichotomisierung der Poetik nach sich zieht. Sie betreibt Dennis mit dem Scheidemittel des Schreckens. Und zwar fiihrt ihn die Aufwertung der emo- tiven Seite der Dichtung sowohl zu einer neuartigen Hier- archisierung des Gattungsensembles in ,,greater Poetry" und ,,less Poetry" als auch zur wirkungspoetischen Unterscheidung von ,,Enthusiasm" und ,,Passion". is An Pseudo-Longinos' Ab- grenzung des ekstatischen Effekts erhabener Dichtung vonder nur tiberredenden und gef/illigen Wirkung der Rede orien- tiert, begr/.indet die Trennung von ,,Enthusiasm" und ,,Passi- on" eine Poesie, die in Sujet, Wirkung und Adressatenkreis von allt~iglicher Prosa absticht. Insbesondere das Epos erregt Enthusiasmus, ftir den nur ein kleiner Zirkel empf~inglich ist, denn Tausende haben von ihm weder Vorstellung noch fiir ihn Gesptir. Gew6hnliche Affekte dagegen, die jedermann riih- ren, werden eher durch dramatische Gattungen, insbesondere durch die Trag6die erregt, die zudem for eine ntitzliche Moral- lehre zust~indig ist.
Das Nebeneinander rationalistischer und enthusiastischer Deutungsmuster ist nun etwa nicht einer unausgeglichenen Theoriebildung geschuldet, sondern es weist vielmehr ge- rade auf den Witz von Dennis' dualem poetologischen Sy- stem. Weil die Gefiihlsdissonanz von ,,delightful Horrour" und die Riihrung durch ,,Enthusiastick Terror" nicht rnehr unter dem Begriff der Sch0nheit zu subsumieren ist, treiben beide ~isthetischen Effekte eine neue, gleichrangige Kategorie her- vor: das Erhabene. Eine solche Unterscheidung fal3te Den-
18 John Dennis, ,,The Grounds of Criticism in Poetry" (1704). In The Critical Works. Bd. I, S. 338.
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITSASTHETIK 123
nis selbst ins Auge, als er 1717 in einem Brief rtickblickend ein Verspaar aus derArspoetica des Horaz (Verse 99/100) auf- greift und, ~ihnlich wie Dubos, im Sinne seines doppelten Sy- stems interpretiert: ,,After all, the pulchrum in Poetry moves as certainly as the dulce, but the first moves the Enthusiastick Passions, as the latter does the vulgar ones. ''19
II c
Die programmatische Rolle des Erhabenen fiir ihre Poetik hatten die beiden Schweizer Kunstrichter Johann Jacob Bod- mer (1698-1783) und Johann Jacob Breitinger (1701-1776) bereits in der ,,Vorrede" ihrer gemeinsamen Schrift Von dem Einflufl und Gebrauche der Einbildungs=Krafft (1727) betont. Doch erst einige Jahre sp~iter hat Bodmer in den Critischen Betrachtungen iiber die poetischen Gemahlde der Dichter (1741) erstmals in der deutschen Poetikgeschichte Sch0nheit und Er- habenheit entgegengesetzt und diese andere Kategorie selbst noch einmal unter den Bezeichnungen des ,,Grossen" und ,,Ungestiimen" differenziert. Das SchOne zielt werkpoetisch auf Ubereinstimmung in der Mannigfaltigkeit, auf Ordnung, Ebenmal3 und Harmonie und wirkungs~isthetisch auf Freude, Fr0hlichkeit und Erg(3tzen. Dagegen ist das GroBe ungeheu- er an Mal3 und unendlich an Zahl. Die Sinne werden davon in einem m~ichtigen Gewaltstreich gleichsam ,,verschlungen", wodurch ,,Erstaunung [... ], angenehme Bestiirzung und Stil- le" bewirkt wird. Beim Ungestiimen ist dieser Effekt noch ge- steigert, insofern das Gemiit des Betrachters durch eine ,,ge- waltth~itige Bewegung" g~inzlich niedergeschlagen wird. 2~
Bodmers Entgegensetzung des Schc3nen und Erhabenen und dessen Binnendifferenzierung von Grol3em und Ungest~-
19 John Dennis, Letter ,,To Mr. ***." Dated Oct. 1, 1717. In The Critical Works, Bd. II, S. 401 f.
20 Johann Jacob Bodmer, Critische Betrachtungen iiber die poetischen Gemi~hlde der Dichter. Zfirich 1741 (Ndr. 1971), 7. Abschn. (,,Von den Gem~ihiden des Sch6nen"), S. 152 ft., 8. Abschn. (,,Von dem Grossen"), S. 211 ft., 9. Abschn. (,,Von dem Ungestiimen"), S. 239 ft.
124 CARSrEN ZELLE
mem pr/ifiguriert zum einen die Architektur von Kants ,,Kri- tik der asthetischen Urteilskraft", die bekanntlich in die zwei Analysen des Geschmacks am SchOnen und des Geistesge- fiihls des Erhabenen zerf~illt, wobei dieses wiederum in das Mathematisch-Erhabene und das Dynamisch-Erhabene zer- legt wird. Bodmers Untersuchung der vermischten Empfin- dung, die die angenehme Bestiirzung angesichts des Gro6en gew~ihrt, nimmt zum anderen auch Kants Analyse jenes Wider- streits voraus, da6 eine Lustempfindung nur vermittelst einer Unlust m~3glich ist. Die ,,negative Lust" des Erhabenheitser- lebnisses beschreibt n~imlich schon Bodmer, indem er festhalt, da6 aufeine zun~ichst einsetzende ,,Unterbrechung der wiirck- samsten Kr~ifte des Geistes" ein zweiter Takt folgt, bei dem der Mensch die ,,Wiederkunft seiner wiircksamen Krafle" mit Ge- nu6 realisiertJ 1
Im Licht der fiir Boileau, Dennis und Bodmer herausge- stellten Dichotomie von Sch0nheit und Erhabenheit sch~irft sich auch der Blick for die zweigliedrige Struktur, die Brei- tingers Critische[r] Dichtkunst von 1740 zugrundeliegt. Darin zielt Breitinger auf ein zweifaches Wirkungsmodell der Kunst. Neben dem intellektualistischen Konzept des scharfsinnigen, d. h. in der Terminologie der damaligen Zeit ,,witzigen" Ver- gleichs zwischen Abbild und Urbild steht ein emotionalisti- sches Konzept pathetischer, d. h. ,,hertzrtihrender" Gemiits- bewegung. Die Zuordnung der asthetischen Kategorien des Sch~3nen und Erhabenen zu den VermOgen des ,,Witzes" und des ,,Herzens", die Bodmer an anderer Stelle vorgenommen hatte, 2~ entspricht in der doppelten Wirkungspoetik Breitin- gers die in systematischer Absicht getroffene Unterscheidung zwischen einem ,,Betrug der Sinne", der den Verstand ver- gntigt, und einem ,,Betrug der Affecte", der das Herz riihrt. Das ,,kalte" Vergntigen des Verstandes bezieht sich dabei auf
21 Bodmer, CritischeBetrachtungen, S. 230. Vgl. Kant, KU w 23.
~2 Johann Jakob Bodmer, Lehrs~itze von dem Wesen der erhabenen Schreibart. In Critische Briefe. Zfirich 1746 (Ndr. 1969), S. 102.
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITSASTHETIK 125
die Form der k0nstlerischen Gestaltung, die ,,heiBe" Riihrung des Herzens dagegen auf das Sujet, das der Kiinstler darstellt - weshalb der ,,Wahl der Materie" im kritischen Werk der Schweizer eine iiberragende Bedeutung zukommt3 a
Nun mag, wie die bisherige Bodmer/Breitinger-Forschung kritisiert, das Nebeneinander aristotelischer Vergleichung und Dubosscher Affekterregung keine ,,einheitliche Theorie des ErgOtzens ''24 darstellen. Doch iibersieht das vorschnelle Ur- teil vom ,,eklektischen" und ,,heterogenen" Abwechseln 25 intellektualistischer und emotionalistischer Str6mungen im ~isthetischen System der Schweizer dessen Perspektivierung nicht auf eine, sondern auf zwei werk- und wirkungspoetisch bestimmte Grundkategorien: Sch6nheit und Erg6tzen versus Erhabenheit und Herzriihrung.
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) hat an diese Di- chotomie angekniipft und programmatisch die nur schOne Prosa, die gef/illt und belehrt, gegentiber einer ,,heiligen" Poesie, die riihrt und das Herz erhebt, abgewertet. Die wirkungs/isthetische Essenz seiner doppelten Poetik dr~ingte Klopstock sp~iter in die epigrammatischen Verse: 26
Darum nennen wir SchSn, was gerngef~hlt uns bewegt, Und Erhaben das, was uns am m~ichtigsten trifft.
DaB die doppelte A_sthetik um 1750 nicht abbricht, son- dern fiber die Sattelzeit hinaus von Burke, Diderot, Mendels-
23 Johann Jacob Breitinger, Critische Dichtkunst worinnen die poetische Mahlerey in Absicht auf die Erfindung im Grunde untersuchet and mit Beyspie- len aus den beriihmtesten Ahen and Neuern erliiutert wird. Ztirich 1740 (Ndr. 1966), 9. Abschn. ,,Von der Kunst gemeinen Dingen das Ansehen der Neuheit beyzulegen", S. 291-347.
:~4 Hans Peter Herrmann, Naturnachahmung und Einbildungskrafl. Zur Entwicklung der d eutschen Poetik yon 1670-1740. Bad Homburg, Berlin, Zfi- rich 1970, S. 230.
2~ Alberto Martino, Geschichte der dramatischen Theorien in Deutschland im 18. Jahrhundert. Bd. I: Die Dramaturgie der Aufkli~rung (1730-1780) [ital. 1967]. Ttibingen 1972, S. 73.
26 Friedrich Gottlieb Klopstock, Werke und Briefe.Hist.-krit. Ausgabe. Abt. Werke, Bd. II: Epigramme. Hg. Klaus Hurlebusch. Berlin 1982, Nr. 160, S. 54.
126 CARSTEN ZELLE
sohn, Kant und Schiller bis Nietzsche, vielleicht gar bis Barnet B. Newman und Jean-Francois Lyotard reicht, kann nach dem Gesagten leicht fortgesponnen werden. Auch m0chte ich es otfenlassen, ob sich von Klopstocks Abwertung einer nur sch0- nen Prosa am MaBstabe erhabener, heiliger Poesie der Kreis zu George Steiner schlagen liil3t, der unter dem Schlagwort ,,real presences" einer resakralisierenden Kunstauffassung das Wort redet.
III
Als Entstehungszeit des eben zitierten Epigramms von Klopstock wird die Zeit zwischen 1775 und seinem Tod 1803 vermutet. Mit dieser Datierung riickte die duale Wirkungspoe- tik, die in Klopstocks Zweizeiler zusammengefaBt erscheint, in unmittelbare Niihe zueiner geschichtsphilosophischen Dis- position der doppelten Asthetik, die nicht nur Schillers Disti- chen Die Fahrer des Lebens 2 ~ aussprechen, die zuerst 1795 un- ter dem Titel SchOn und Erhaben erschienen sind, sondern die insbesondere der Architektur seines ~isthetischen Erziehungs- programms zugrundeliegt.
Eine besondere Dringlichkeit hatte die Kl~irung ~isthetischer Fragen for Schiller in den neunziger Jahren bekommen, weil er aufgrund der Entt~iuschung fiber den Verlauf der Franz6- sischen Revolution insbesondere nach den Septembermorden 1792 und nach der Kc)pfung des K6nigs im Januar 1793 glaub- te, durch Asthetik zur menschlichen Emanzipation beitragen
27 Ffiedrich Schiller, Werke. Nationalausgabe. Begr. Julius Petersen. Wei- mar 1943 ft. [nicht abgeschlossen], Bd. I, S. 272: ,,Zweierlei Genien sinds, die dich durchs Leben geleiten, / Wohl dir, wenn sie vereint helfend zur Seite dir stehnl / Mit erbeitemdem Spiel verkfirzt dir der eine die Reise, / Leichter an seinem Arm werden Dir Schicksal und Pflicht. / Unter Scherz und Gesp~ch begleitet er bis an die Kluft dich, / Wo an der Ewigkeit Meer schaudemd der Sterbliche steM. / Hier empflingt dich entschlossen und ernst and schweigend der andre / Tragt mit gigantischem Arm fiber die Tiefe dich hin. / Nimmer wid- me dich einem aUein. Vertraue dem erstem / Deine Warde nicht an, nimmer dem andern dein Glack."
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITSASTHET1K 127
zu kOnnen, nachdem in seinen Augen die politische Emanzi- pation Schittbruch erlitten hatte und gescheitert war38 In den Briefen an den Augustenburger ~9, der Vorstufe zu den Brie. fen aber die asthetische Erziehung des Menschen, gesteht Schil- ler, dab die Kunst iiberfliissig w/ire, wenn die politische Ge- setzgebung der Vernunft iibertragen worden w~ire. Das Ende der Kunst ist quasi durch das Mi61ingen der Revolution nut vorl/iufig aufgeschoben. Es scheint, als habe das Asthetische nur einen provisorischen Wert, sq!ange es noch nicht zu einer ,,Regeneration im Politischen" (AE 20) gekommen sei. Und danach sieht es im Juli 1793 nicht aus. Vor allem ist es das Ochlokratietrauma, das Schiller angesichts der Verlaufs der Pariser Staatsumw~ilzungen bef/illt. Vor allen die dionysische Entgrenzung der Volksmassen, und darunter namentlich jene der Frauen, haben Schiller ebenso wie einen groBen Teil der anderen Schriftsteller seiner Zeit schockiert. 30 Am 13. No- vember 1789 etwa hatte ihm seine Braut Charlotte von Lenge- feld mitgeteilt, dab ihr Bekannter Beulwitz ,,von den Pariser Frauens [... ] sch0ne Geschichten" erz~ihlt h/itte, etwa die- jenige, ,,dal3 [... ] sich einige bei einem erschlagenen Garde du Corps versammelt, sein Herz herausgerissen, und sich das Blut in Pokalen zu getrunken [h~itten]." Den weitverbreite- ten Bacchantinnentopos der Pariser Fischweiber hat Schiller 6fters dichterisch aufgegriffen, u.a. in den bertihmten Versen der Glocke ,,Da werden Weiber zu Hy~inen / und treiben mit Entsetzen Scherz".
Fiir Schiller scheiterte die Franz0sische Revolution nicht politisch, sondern von Anfang an menschlich, weil, wie
volution und Autonomie. Deutsche Autonomiei~sthetik im Zeitalter der Franz6- sischen Revolution. Fig. Wolfgang Wittkowski. Tfibingen 1990, S. 277-296.
29 Friedrich Schiller, Uber die ~sthetische Erziehung des Menschen. Hg. Wolfhart Henckmann. Mfinchen 1967 (zit.: AE).
3o Vgl. Burghard Dedner, Die Ankunft des Dionysos. In Die andere Welt. Studien zum Exotismus. Hg. Thomas Koebner, Gerhard Pickerodt. Frank- furt/M. 1987, S. 200-239.
128 CARSTEN ZELLE
Schiller an den Augustenburger schreibt, ,,der wilde Despo- tismus der Triebe [. . . ] alle jene Untaten aus[heckt], die uns in gleichem Grad anekeln und schaudern machen." (AE 21). Doch als Ursache der Regression macht Schiller neben der ,,Verwilderung" der Triebe auch die ,,Erschlaffung" der Kul- tur verantwortlich. Denn der sinnliche Mensch k0nne ,,nicht tiefer als zum Tier herabstiirzen", falle aber der aufgeklfirte Mensch, ,,so ffillt er bis zum Teuflischen herab" (AE 21). Schiller verallgemeinert hier also einerseits das wilde Treiben der Pariser Volksmassen und andererseits den Terrorismus des WohlfahrtsausschuB.
Vor dem Hintergrund, dab der biirgerliche Traum ins Trau- ma verkehrt wurde, ist Schillers Konzeption einer/isthetischen Erziehung der Menschen zu situieren. Bevor man dem Btir- ger eine Verfassung geben k0nne, so schlieBt Schiller aus sei- ner politischen Erfahrung, miisse man vielmehr for die Verfas- sung Btirger erschaffen. Hier setzt das Programm fisthetischer Erziehung an, in dem Schiller die Aporie der 1782 und 1784 formulierten Nationaltheateridee noch einmal zu tibertrump- fen versucht. Die Schaffung veredelter Charaktere ist, doziert Schiller gegeniiber dem Augustenburger gerade in jenem Brief (13. Juli 1793), dem er bezeichnenderweise ein Separatum seines Aufsatzes OberAnmut und Warde anlegt, die Aufgabe einer/isthetischen Kultur, die die bloB philos0phische Auf- klfirung ergfinzen miisse, da es nicht so sehr an ,,Licht" als viel- mehr an,, Warme" fehle. Da nun, nach Schillers Diagnose, dab Zeitalter an einem zweifachen Gebrechen, an Verwilderung und Erschlaffung, leide, mtisse die ,,fisthetische Bildung", des-
~sen Programm in dem sog. ,,EinschluB" der Augustenburger- Briefe, d.h. einer Anlage zum Brief von 11. November 1793, entworfen wird, doppelt wirksam werden, ,,wenn sie auf der einen Seite die rohe Gewalt der Natur entwaffnet und die Tier- heit erschlafft, wenn sie auf der andern die selbsttatige Ver- nunftkraft weckt und [den] Geist wehrhaft macht" (AE 36). Diese ,,doppelte Wirkung" verspricht sich Schiller einerseits vom SchOnen, das der Verwilderung entgegenarbeitet, indem
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITSASTHETIK 129
es den sinnlichen Menschen ,,auf[ge]10st", und andererseits vom Erhabenen, das der Erschlaffung entgegenwirkt, indem es den rationalen Menschen ,,an[ge]spannt" (AE 37). Mit Sch0n- heit soil die Roheit poliert, mit Erhabenheit die Dekadenz ge- bremst werden. Daher besteht die Aufgabe, die Schiller in der theoretischen Fundierung der ~isthetischen Erziehung zu bew~iltigen hat, in der Rechtfertigung einer ,,doppelten Be- hauptung [... ]: erstlich: dab es das SchOne sei, was den rohen Sohn der Natur verfeinert, und den bloB sensualen Menschen zu einem rationalen erziehen hilfl; zweitens: dab es das Er- habene sei, was die Nachteile der schSnen Erziehung verbes- sert, dem verfeinerten Kunstmenschen Federkraft erteilt und mit den Vorzfigen der Verfeinerung die Tugenden der Wildheit vereinbart." (AE 38).
Dieses Dispositionsschema fibernahm Schiller auch in der Ausarbeitung der ~isthetischen Briefe, die ihm sehr sauer wurde und sich das ganze Jahr 1794 hinzog. Gedruckt la- gen sie endlich Mitte 1795 in den Horen vor. Der sechzehn- te ~isthetische Brief nimmt die Unterscheidung einer ,,aufl6- senden" und einer ,,anspannenden" Wirkungsart des SchOnen bzw. Erhabenen unter der neuen Terminologie der schmel- zenden und energischen Sch0nheit wieder auf und formuliert nun als Programm fiir den ,,Fortgange" der Untersuchung, dab zun~ichst ,,die Wirkungen der schmelzenden Sch0nheit an dem angespannten Menschen" und danach ,,die Wirkungen der energischen [SchOnheit] an dem abgespannten [Menschen]" geprfifl werden sollen, ,,urn zuletzt beide entgegen gesetzte Ar- ten der Sch0nheit in der Einheit des Ideal-SchOnen auszul0- schen" (AE 16, 135). Der Spitzenbegriff einer IdealschOnheit hatte Schiller in den vorangehenden Schriften noch gefehlt. Das Ideal, so schreibt Schiller jetzt im Unterschied zu seiner vorausgegangenen Schrift fiber Anmut und Wtirde in Hinsicht auf den kolossalen Junokopf aus der r0mischen Villa Ludovisi, ,,ist weder Anmut noch ist es Wiirde.[... ]; es ist keines von bei- den, weil es beides zugleich ist." (AE 15, 132) ,,AusgelOscht" ist der Widerstreit erst im G0tter-, nicht im Menschenantlitz.
130 CARSFEN ZELLE
Das Gleichgewicht idealer Sch0nheit ,,[kann] vonder Wirk- lichkeit nie ganz erreicht werden [... ]" (AE 16, 132). In der Empirie bleibt es daher bei einer zweifachen, bei jener ,,dop- pelte[n] Sch6nheit" (,~E 16, 135), deren Schillers philosophi- sche Schriften der neunziger Jahre gelten.
Sowenig das Ideal-Sch0ne in der Erfahrung existiert, sowe- nig gibt es den ,,Ideal-Menschen" (AE 16, 135), dessen For- mung sich Schiller freilich nach den entt/iuschenden Erfahrun- gender Franz0sischen Revolution zun~ichst von dem Plan ei- ner ~isthetischen Bildung versprochen hatte. DaB der Mensch unvollendet bleibt und es dies zu ertragen gilt - diese Einsicht scheint Schiller erst im Verlauf der Abfassung der ~isthetischen Briefe gekommen zu sein. Das Dispositionsschema bleibt da- her unausgeftillt. Der Rest der ~isthetischen Briefe 17 bis 27 wird in der Horen-Fassung von 1795 noch mit der l]berschrift ,,Die schmelzende Sch6nheit" (,~E 136) gedruckt. Weiteres wollte Schiller sich ftir eine Buchfassung aufsparen, die er sei- nem Verleger Cotta am 12. Juni 1795 in Aussicht gestellt hat- te. Das geplante Buch und damit die Fortsetzung des in der Disposition Entworfenen, d.h. Ausftihrungen zur energischen Sch0nheit und ,,zuletzt" fiber das Ideal-Sch0ne (und fiber den Ideal-Menschen) kamen niemals zustande. Das Fragmenta- rische seiner ~isthetischen Briefe scheint Schiller, im Unter- schied zu seinen heutigen Exegeten, durchaus bewul3t gewe- sen zu sein, denn er hat es sp~iter zu verwischen getrachtet. Er tilgt bei der Sammlung seiner prosaischen Schriflen von 1801, die den Wiederabdruck der ~isthetischen Briefe bringen, die erw~ihnte Zwischentiberschrift und streicht auch am Beginn des achtzehnten Briefs aus der rhetorischen Steigerung wegen wiederholten Wortverbindung ,,die schmelzende Sch0nheit" beide Male das Adjektiv (AE 18, 139).
Als einen gewissen ,,Ersatz ''al for den nicht zustande ge- kommenen Teil der ~thetischen Briefe fiber die energische
al Schiller, Nationalausgabe, Bd. 21, S. 330 (,,Anmerkungen" von Benno von Wiese).
GESCHMACKS- ZUR SCHONHEITSASTHETIK 131
Sch6nheit mag man die Schrift Ober das Erhabene ~2 ansehen, die erstmals in der genannten Sammelausgabe von 1801 er- schien. Die Entstehung dieser kurzen Schrift ist positiv nicht zu bestimmen. Ihre inhaltliche Datierung ist freilich mit dem Problem belastet, ob wir dem Schiller der vers6hnten oder dem Schiller der ertragenen Widerspriiche das letzte Wort tiber- lassen wollen. Denn zwar schlieBt die Schrift einerseits an Ober das Pathetische yon 1793 an, setzt aber andererseits auch das Dispositionschema des Einschlusses im Brief an den Augu- stenburger vom 11. November 1793 und dessen Wiederaufnah- me im 16. ~isthetischen Briefvon 1795 voraus. Und zwar betont Schiller unter dem Hinweis, dab sich das Sch0ne bloB um den Menschen als einem sinnlich-iibersinnlichen Doppelwesen, das Erhabene aber um den ,r Damon" in ihm verdient mache, dab das Erhabene zu dem SchOnen hinzukommen mOs- se, ,,um die asthetische Erziehung zu einem vollst/indigen Gan- zen zu machen." (l~IdE 52) Wer daran interessiert ist, aus he- gelianisierender Perspektive der Vers0hnung, Schillers Fort- schritt gegeniiber Kant in der Synthese des Ideal-SchOnen her- auszustellen, der wird versucht sein, wie Jeffrey Barnouw, aa die Erhabenheitsschrift als eine fr0he Fingertibung einer ersten Aneignung kantischer Gedanken herunterzuspielen. Wer da- gegen geneigt ist, wie ich, die Aporien des..VersOhnungskon- zepts und die damit verbundene doppelte Asthetik zu kontu- rieren, der wird sich gerne dem Datierungsvorschlag 1794/95 bis 1796 anvertrauen, den Benno yon Wiese im Kommentar der Schiller-Nationalausgabe ins Spiel gebracht hat.
Mit dem Durchbruchserlebnis des Erhabenen, bei dem der selbst~indige Geist ,,pl0tzlich und durch eine Erschiitterung" (UdE 45) aus den Netzen einer verfeinerten Sinnlichkeit ge- rissen wird, hat Schiller nun ein desillusioniertes, negatives
a2 Schiiler, Nationalausgabe, Bd. 21, S. 38-54 (zit.: ODE). 33 Jeffrey Barnouw, ,,The Morality of the Sublime." In Studies in Roman-
ticism 19 (1980), S. 497 ft., hier S. 510, FuBn. 15.
132 CARSrEN ZELLE
Natur- und Geschichtsbild verbunden. Das Erhabene ist qua- si die Riickzugsposition des Menschen, wenn ihm nichts mehr bleibt - aus dieser Perspektive erscheint die Geschichte als Triimmerhaufen und als Schreckensspur, die ,,aller Regeln [... ] spottet" (UdE 50), und die Naturals ,,gesetzlose[s] Cha- os" und ,,wilde Bizarrerie", in der kein ,,weiser Plan", sondern der ,,tolle Zufall" regiert (OdE 48). Mit dieser hoffnungslo- sen Geschichtsvorstellung und diesem schwarzen Naturbegriff hat Schiller jede M0glichkeit eines Ausgleichs abgeschnitten - demgegeniiber bleibt nur noch die Chance, ,,sich in die hei- lige Freiheit des Geistes zu fliichten" (UdE 51). So changiert Schillers Natur- und Menschenbild je nachdem, ob es aus der Perspektive des SchOnen oder des Erhabenen beleuchtet wird.
Der preul3ische Schulreformer Johann Heinrich Siivern (1775-1829) hatte 1800 dem Weimarer Klassiker seine kriti- sche Schrift Uber SchiUers Wallenstein in Hinsicht auf die grie- chische TragOdie 34 iiberreicht. Darin suchte Stivern auf dem Hintergrund yon Schillers und Friedrich Schlegels geschichts- philosophischer Replik auf die Querelle des Anciens et des Modernes Einsicht in die ,,grosse Gr~inzscheidung zwischen Alten und Neuern" und einen neuen Zugang zur griechischen TragOdie zu erlangen. Gegeniiber dem alten Muster falle nun Schillers Wallenstein ab. Denn w~ihrend die TragOdie der AI- ten seitens ihrer Wirkung durch die Erregung von Mitleid und Furcht kathartisch ,,hindurchgeht" und in eine Stimmung versetzt, ,,welche ein gedeihliches fr0hliches Menschenleben macht", lasse Schillers Drama, nach Siiverns Ansicht, den Zu- schauer in ,,Kleinmuth", ,,Erbitterung" und ,,Angstlichkeit" zurtick. Mit Blick auf seine ,,ganz heterogene[n] Zeit" hat Schiller mit einer bedenkenswerten Uberlegung auf die Kri- tik geantwortet (an Siivern, 26. Juli 1800): ,,Unsere TragOdie [... ] hat mit der Ohnmacht, der Schlaffheit, tier Charakter- losigkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen, sie muB also Kraft und Charakter zeigen, sie mu6 das
34 Berlin 1800, das folgende S. 16, 161 und S. 157.


























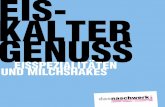


![Pali-Deutsch - Bodhi Vihara...(Namo tassa) bhagavato arahato sammæsambuddhassa [3x] Ehre dem Erhabenen, dem Heiligen, dem vollkommen Erleuchteten. [3x] (Handa mayaµ buddhænussatinayaµ](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5e579230f0601141a572ddad/pali-deutsch-bodhi-namo-tassa-bhagavato-arahato-sammsambuddhassa-3x.jpg)