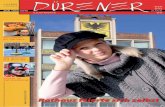Vortrag 500 Jahre Rathaus Aurach
-
Upload
stephan-etzel -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Vortrag 500 Jahre Rathaus Aurach

Festvortrag „500 Jahre Rathaus Aurach“4. Juni 2011
Dr. Andrea M. Kluxen, Bezirksheimatpflegerin
Sie feiern heute den 500. Geburtstag Ihres Rathauses. Sie feiern aber damit nicht nur ein Gebäude, sondern ein halbes Jahrhundert wechselvoller Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit lokalen, regionalen oder auch überregionalen Auswirkungen. Heute ist ein Tag, mit dem Rathaus auch den Ort Aurach zu feiern, dessen Geschichte zwar weit vor dem Bau des Rathauses beginnt, die sich aber in so einem Denkmal manifestiert.
Der stattliche Bau fällt dem Besucher von Aurach gleich ins Auge und wirft die Frage auf, warum in einer doch kleinen Gemeinde, die vor 500 Jahren sicher noch kleiner war, neben der Kirche ein so imposantes Gebäude zu finden ist. Trutzig erhebt sich der Bau, der von dem Eichstätter Bischof Gabriel von Eyb als Amtshaus über einem Vorgängerbau errichtet wurde. Über rechteckigem Grundriss ist ein mächtiger zweigeschossiger Putzbau mit dreistöckigem Giebel aufgerichtet, der von einem mächtigen Satteldach mit Aufschiebling bekrönt wird. Im Osten stützt ein dezentral angesetzter Strebepfeiler den Bau, an der südlichen Seite befindet sich ein bis ins Obergeschoß geführter erkerartiger Vorbau. Der Bau steht innerhalb einer etwas aufgefüllten und trockengelegten Grabenanlage, die ursprünglich mit Wasser gefüllt war. Von Norden führt eine ansteigende zweibogige Brücke mit Steinbrüstung ins Innere, die 1728 angefügt wurde und wohl eine hölzerne Brücke über den Wassergraben ersetzte. Unregelmäßige Fensterachsen, seitlicher Strebepfeiler und Aufzugsluke verdeutlichen, dass es sich um einen Funktionsbau handelt, während das über der Haustür angebrachte bischöfliche Wappen mit spätgotischem Blendbogenfries und Rustica-Inschrift die offizielle Funktion zeigt. Aber es handelt sich nicht um einen Repräsentationsbau, denn der durch den geschlossenen Formcharakter und die Eckverquaderung wehrhaft wirkende Bau hatte weniger repräsentative als funktionale Aufgaben. Er war Wohnstätte des Amtmanns oder Vogts, Amtshaus – also Verwaltungsstelle -, er war Gerichtsstätte und Lagerraum – auf den drei Dachböden wurde etwa der Getreidezehnt aufbewahrt -, das Gebäude beherbergte die Hohen Herren, wenn sie durch das Land zogen, und war in Notzeiten Zufluchtsstätte für die Dorfbevölkerung, die ja nicht in einer ummauerten Stadt lebte.Warum wurde aber in einem Kirchdorf ein so gewaltiges Gebäude errichtet?Ich möchte dazu zunächst einen Blick in die Mittelalterliche Geschichte werfen, dabei

auch das Alltagsleben hier vor Ort thematisieren, dann die Geschichte seit dem Bau unseres Denkmals beleuchten und schließlich noch kurz die Frage nach der Bedeutung des Denkmals heute stellen.
Beginnen wir am Anfang des Dorfes Aurach. Aurach wurde im Frühmittelalter gegründet (7. oder 8. Jh.) und stand von Anfang an bis ans Ende des alten Reichs 1803 in enger Verbindung zum Benediktinerkloster in Herrieden.
Aufgrund der günstigen verkehrstechnischen Lage war Herrieden im Jahr 782 gegründet worden. Denn durch wichtige Fernstraßen und die beiden beiden Wasserläufe von Altmühl und Wörnitz kam der Region hohe militärpolitische Bedeutung zu. Entlang der Altstraßen wurde das Land planmäßig ausgebaut, um die für Heerfahrten notwendigen „Etappenplätze und Verpflegungsdepots" für den König zu schaffen. Der Schreiber der Deocarus-Legende beschrieb das Land um Herrieden als „Dickicht dunkler Wälder“.So wurde das bisher kaum besiedelte Land nördlich des Limes kultiviert und zum Königsland. Das machtpolitische Interesse des Königs an dieser zentralen Region im Reich führte schließlich dazu, dass ihm das Kloster Herrieden als Schenkung zufiel. Die großen und weitgestreuten Besitzungen des Klosters erregten aber auch Begehrlichkeiten des Hochstifts Eichstätt, das die Reichsabtei Herrieden mit all ihren Besitzungen dann im Jahr 888 von König Arnulf geschenkt bekam und bis zur Säkularisation 1803 behielt. Das Hochstift hatte damit seine Besitzungen nach Norden erweitern können, das sog. Oberstift oder Eichstätter Oberland war entstanden. Während der Großteil des Landbesitzes des Stifts unmittelbar östlich von Herrieden seine Grenzen fand, dehnte sich das Gebiet hauptsächlich südlich der Altmühl aus und im Westen bis Aurach, das an einer der bedeutendsten Routen, einer Reichsstraße und späteren Handelsstraße, lag.Die gierigen Blicke des Herzogtums Bayern konnte Eichstätt aber durch königlichen Schutz abwenden. Ganz Franken, das ja kleinteilig war und viele Herren hatte, war daher königs- und reichstreu, um die Bedrohungen durch große Territorialstaaten abwenden zu können. Zur Begriffsklärung: Im Hochstift ist der Bischof der Landesherr mit allen landesherrlichen Rechten, das Bistum ist nur die geistliche Oberherrschaft, die auch in andere Territorien reichte (Bayern, Ansbach).
Um die weltlichen und gerichtlichen Angelegenheiten ihrer Gebiete sicher zu erledigen, beauftragten im Mittelalter Klöster, Kirchen, Fürsten und Könige sog. Vögte als Schirmherren. So wurde auch der dem Stift Herrieden anhängige Landkomplex mit

Vögten besetzt, die die Verwaltungsaufgaben übernahmen.Der Vogt war Inhaber einer Schutzherrschaft, da sich Kirchen ursprünglich aller weltlicher Geschäfte enthalten sollten. Er verwaltete seinen Vogteibezirk, sorgte für den Schutz der Bewohner und konnte auch zu Gericht sitzen. Mit dieser Macht ausgestattet, versuchten die Vögte das zu verwaltende Land für sich zu bekommen. Immerhin wurden seit dem 10. Jh. einige Vogteien als Lehen des Hochadels erblich. So auch im Eichstätter Oberland, wo die Grafen von Öttingen die Vogteirechte innehatten. Anfang des 14. Jh. versuchte Konrad von Öttingen das Gebiet gewaltsam an sich zu bringen. Das konnte sich das Bistum nicht gefallen lassen, und so verloren die Öttinger ihr Lehen 1316, das an den Eichstätter Bischof zurückfiel. Der behielt es von da an unter seiner direkten Verwaltung und gab ihm eine straffe Ämterorgansiation. Von jetzt an erfährt die Verwaltung von Stadt und Land eine grundlegende Änderung. Vögte und Amtleute wurden nun zu einer Art grundherrlicher Beamter, die ein- und abgesetzt werden konnten. Das Amt war nicht mehr erblich. So entstand auch im 14. Jh. das Oberamt Wahrberg und das Unteramt Aurach, ein Verwaltungs- und Gerichtsbezirk mit Niedergerichtsbarkeit, der sich über mehrere Orte erstreckte. Der Vogt oder Amtmann überwachte die Abgaben in Naturalien und Geld, die dann nach Herrieden geschafft wurden – er war also auch Steuerbehörde. Er hatte die Niedergerichtsbarkeit – sprach also Recht über alle Vergehen, die nicht mit dem Tod bestraft wurden; kurz er kümmerte sich um Anstand, Ordnung, Recht und Frieden im ganzen Amtsbezirk.
Doch die mittelalterlichen Verhältnisse blieben kompliziert. So war es üblich, dass Orte verschiedene Herren und verschiedene Rechte hatten. Diese Rechtsverhältnisse sollten erst Anfang des 19. Jh. bereinigt werden.So hatte der Markgraf von Brandenburg-Ansbach die Hochgerichtsbarkeit, also Blutgerichtsbarkeitsbezirk, über fast die Hälfte der Eichstättischen Untertanen im Oberstift.Und dann gab es im 13. und 14. Jh. in Aurach noch die Herren von Aurach, die reichsunmittelbar waren und damit direkt dem König unterstellt, und seit Mitte des 14. Jh. die Herren von Mörnsheim, deren Herrensitz wohl der Vorgängerbau des heutigen Rathauses war.
Die Dorfbewohner störte das weniger, es sei denn die unterschiedlichen Abgaben, die zu tätigen waren – an den Bischof, an den Herriedener Propst, an die lokalen Herren, an die Vögte.

Denn das mittelalterliche Leben auf dem Land war ein stets von existentiellen Nöten begleitetes, da man abhängig war von der Natur, aber auch Heimsuchungen durch Kriege, Seuchen (1383 und 1487 wütete die Pest), Hungersnöte zu erdulden hatte.
Daher gibt es zu so einem mittelalterlichen Dorf neben der politischen Geschichte auch eine Alltagsgeschichte, über die aber wenige Quellen existieren. Dabei ist es durchaus interessant zu erfahren, wie man in Aurach im Mittelalter lebte. Die meisten Menschen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation lebten auf dem Land – schätzungsweise über 90 % der Bevölkerung. Geprägt war das Leben von der Arbeit, den Jahreszeiten und den Feiertagen.
Die meisten Einwohner Aurachs waren Bauern, die Land vom Grundherrn gepachtet hatten. Neben diesen gab es in der Dorfgemeinschaft noch Taglöhner, die am Dorfrand lebten. Spezielle Handwerker siedelten sich seit dem Hochmittelalter an.Die bäuerliche Arbeit verteilte sich ungleich über das Jahr. Spinnen und Weben, Wald- und Holzarbeit fanden hauptsächlich im Winter statt, die eigentliche Bauernarbeit im Frühling und Sommer.Rings um das Dorf erstreckte sich das Ackerland, das in große Feldblöcke, diese wiederum in kleine Parzellen eingeteilt war. Jeder Bauer des Dorfes besaß eine oder mehrere Parzellen in jedem Block. Nachdem es keine Feldwege gab, sorgte eine Flurordnung dafür, dass die Zeit des Säens und des Erntens genau festgelegt war. Nach der Ernte wurde das gesamte Ackerland als gemeinsame Stoppelwiese für das Dorfvieh benutzt. Zur Bearbeitung der Felder wurden im Frühmittelalter Ochsen und Pflüge aus Holz gebraucht, die oft zerbrachen, weshalb das Feld per Hand nachgearbeitet werden musste. Der Ertrag einer Ernte im Frühmittelalter war dabei nur etwa doppelt so hoch wie die Aussaat. Ab dem Hochmittelalter wurde die Landwirtschaft dann durch verschiedene Erfindungen wie Räderpflug, Sense, Windmühle, Dreifelderwirtschaft usw. revolutioniert, und es nun Pflüge aus Eisen und Pferde als Arbeitstiere.
Neben dem Ackerland gab es noch die Allmende oder gemeine Mark, die von den Bauern gemeinschaftlich genutzt wurde. Sie bestand meist aus Wegen, dem Wald zur Holznutzung, Niederwaldhut und Waldbienenzucht, den Gewässern zur Löschwasserversorgung oder dem Weideland wie der Gemeindewiese, auf der jeder seine Nutztiere weiden lassen kann.

Zu den alltäglichen elementaren Bedürfnissen gehörten natürlich Essen und Trinken. Anders als heute, wo man jederzeit Lebensmittel aus aller Welt zur Verfügung hat, war man im Mittelalter abhängig von den Jahreszeiten und den regional begrenzten Angeboten. Die Hauptmahlzeit der armen Bevölkerung bestand aus Brot, Kraut, Rüben und Bohnen. Aus den unterschiedlichen Getreidesorten wurden Brote und Breie hergestellt, wobei Brot das Hauptnahrungsmittel war (pro Person bis zu 1 kg). Befunde an mittelalterlichen Skeletten haben ergeben, dass sich aufgrund von Steinpartikeln, die beim Mahlvorgang aus den Mahlsteinen ins Mehl gerieten (3% Steinabrieb), die Kauflächen der Zähne stark abnutzten, so dass mit 30-40 Jahren ein Gebiss meist ziemlich beschädigt war und Zahnschmerzen zum täglichen Leben gehörten. Hingegen war die Karieshäufigkeit im Unterschied zu heute mangels Zucker sehr gering. Gemüse wurde wenig gegessen. Neben Kohl, Rüben und Bohnen waren besonders Zwiebeln beliebt, die man auch im Winter lagern konnte. Diese Gemüse wurde zu einem gleichförmigen Brei verkocht, da man Verzehr von frischem, rohem Gemüse oder auch Früchten für ungesund hielt.
Auch Fleisch, und dann alles vom hochwertigen Muskelfleisch bis zu den Augen, wurde auf dem Land gegessen, aber weit weniger als auf den Burgen und in den Städten. Denn ein einfacher Bauer konnte sich nicht so viel Fleisch leisten, da seine Tiere hauptsächlich Arbeitstiere waren. Man geht z.B. im 14. Jh. von einem Prokopfverbrauch an Fleisch von etwa 40-50 kg aus. - Zum Vergleich: Getreide ca. 200 kg. Die meist verkochten Speisen wurden stark gewürzt, um ihnen etwas Geschmack zu geben. Da Salz aber sehr kostbar war - es wurde auch als weißes Gold bezeichnet – und auch Pfeffer nur für die reiche Oberschicht erschwinglich (Pfeffersäcke), würzte man hauptsächlich mit einheimischen Gewürzen wie Koriander, Pfefferkraut, Petersilie, Zwiebeln usw.
Als Getränk gab es hauptsächlich Wasser und Milch, wobei das Wasser ungekocht nicht immer genießbar war und daher mit Wein, Süßholzsaft oder Honig verfeinert. Alkoholische Getränke waren beliebter, aber auch Bier, Wein oder Met wurden im Mittelalter immer gewürzt.
Zum alltäglichen Leben gehörten auch Vergnügungen und Feste, die aus Religionsausübung, Lebenskreis, Jahreslauf und Arbeitsrhythmus folgten. Anders als man vielleicht vermuten könnte, gab es im Mittelalter und auch noch in der Frühen

Neuzeit mehr freie Zeit, als man glauben mag. Es gab so viele kirchliche Feiertage, dass man in etwa auf die heutigen Urlaubstage kommt. Das galt natürlich damals wie heute nur eingeschränkt für Bauern. Im Winter durfte zudem wegen der Brandgefahr auch nur so lange gearbeitet werden, wie es hell war – was besonders für Handwerker galt.Religiöse Feier und weltliches Fest fielen bei den Übergangsriten wie Geburt und Taufe, Heirat und Tod zusammen, die von der gesamten Bevölkerung festlich begangen wurden. Damit waren solche Feste nicht privat, sondern gruppenstabilisierende und sozial verbindliche Bräuche, die Gemeinschaft schufen in einer unsicheren Welt..
Das Dorf entwickelte so als räumliche Gemeinschaft eine besondere Form der dörflichen Rechtsgemeinschaft und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Dabei standen oft die eigenen Interessen denen des Grundherrn diametral entgegen.Die Abgabenlast war gerade in Notzeiten oft bedrückend und ließ den Menschen kaum etwas zum Überleben. Gerade im Spätmittelalter, nach Pestwellen und Hungersnöten, strebten die abhängigen Bauern daher mehr und mehr nach Senkung der Steuern. Wo der Landesherr ihren Wünschen nicht nachgab, versuchten die Bauern sich durch Vernachlässigung ihrer Ablieferungspflicht zu entziehen. Hohe Verzugsstrafen, die der Propst von Herrieden gegen derartigen Widerstand verhängte, belegen den Ungehorsam der Bauern im Herriedener Land.Die Steuer, also der Zehnt, musste in Bargeld und in Naturalien abgeliefert werden, z.B. Getreide an Martini (11.11.), Bargeld, Schweine und Malz eine Woche vor Epiphanias, also vor dem 6. Januar. Daneben mussten Hand- und Spanndienste für den Amtmann bzw. Vogt geleistet werden, der wiederum dem Herriedener Propst Abgaben und Dienste schuldete. Nach einer Weisung von 1238 verlangte der Propst von jedem seiner Amtmänner dreimal im Jahre Spanndienste zu leisten, und zwar mit 18 Pferden, für deren Unterhalt der Amtmann zu sorgen hatte. Diese Spanndienste benötigte das Stift, um das auf den Speichern angesammelte Getreide nach Herrieden zu fahren.
Gesammelt wurden die Abgaben in Aurach wohl in der schon im 13. Jh. belegten Vogtei, wahrscheinlich ein kleiner, von einem Wassergraben umgebener Herrensitz, der 1275 als „ehemals adeliger Sitz eines Heinrich von Aurach“ erwähnt und 100 Jahre später in einem Vertrag zwischen den Herren von Mörnsheim und den Grafen von Hohenlohe als "Vestes Haus" zu Aurach unter Wahrberg gelegen genannt wurde. Ob diese Bauten jedoch identisch sind, ist nicht geklärt, aber es ist anzunehmen, dass dort die Abgaben gesammelt, Gericht gehalten wurde und die Untertanen in Notfällen Zuflucht fanden.1510 verkauften die Herren von Mörnsheim diese Wasserburg mit zugehörigem Besitz

an Fürstbischof Gabriel von Eyb.
Gabriel von Eyb (1455-1535) stammte aus einem fränkischen Adelsgeschlecht und studierte - schon als Kanoniker von Bamberg und Eichstätt - an den Universitäten Erfurt, Ingolstadt und Pavia Rechtswissenschaften. Seit 1485 war er in Eichstätt, aber auch in Ansbach tätig. 1496 wählte ihn das Eichstätter Domkapitel zum 52. Diözesan- und Fürstbischof von Eichstätt. Drei Jahre später unternahm er eine Visitationsreise durch das Obere Hochstift um Herrieden, bei der es um Angelegenheiten der fürstbischöflichen Verwaltung ging, wie seine Verordnungen belegen, z.B. das Verbot von Strohdächern in Herrieden wegen der Brandgefahr.1508-10 ließ Gabriel von Eyb die Herriedener Burg wieder aufbauen.In diesem Zusammenhang ist auch die Errichtung des Auracher Amtshauses 1511 zu sehen, das anstelle der alten Wasserburg gebaut wurde. Dieses weist stilistisch auf den gleichen Eichstättischen Baumeister.
Die rege Bautätigkeit von Eybs hängt mit der Erwerbspolitik zum territorialen Ausbau des Hochstifts zusammen. Mit offiziellen Bauten wurden Ansprüche festgeschrieben und auch die Repräsentation der Obrigkeit vor Ort sinnfällig in Szene gesetzt, die gerade in einer Umbruchzeit wie der um 1500 von großer Wichtigkeit war.Denn in die Amtszeit von Eybs fällt auch die Reformation, in deren Folge es zu starken Konfessionskämpfen im Gebiet kam. Zwar konnte der Fürstbischof verhindern, dass sein Hochstift von der Reformation erfasst wurde, aber weite Teile seiner Diözese gingen der alten Lehre verloren. Die Markgrafen von Ansbach schlossen sich 1528 der Reformation an, so dass der Bischof spätestens 1533 im markgräflichen Anteil und damit in einem der wichtigsten Teile des Eichstätter Bistums jegliche Jurisdiktion verloren hatte.
Schäden erfuhr die Region auch im Bauernkrieg von 1525, an dem sich auch Auracher Bauern beteiligten, denen die Abgabenlast immer mehr zusetzte. Von Rothenburg aus breitete sich die Welle des Aufruhrs aus. Während sich die Bauern z.T. den Rebellen anschlossen, stellten sich die Unterämter Aurach, Großenried, Heuberg, Dombühl, Binzwanngen, Neunstetten und Lehrberg auf die Seite des Bischofs. Deshalb beabsichtigten die aufrührerischen Bauern, wie es hieß, „Wahrberg und Schloss Aurach und alles was an der Altmühl ist, zu verderben, die Amtleute zu erwürgen und keinen gefangen zu nehmen.“

Mithilfe des Markgrafen und des Schwäbischen Bundes wurden die Bauern jedoch niedergerungen und hart bestraft. Etwa 100.000 Bauern sollen umgekommen sein, von den hochstiftischen Aufständischen wurden 15 hingerichtet.
Noch schlimmer wütete der 30jährige Krieg ab 1618 im westlichen Mittelfranken. Ständige Durchzüge, Plünderungen, Brandschatzungen gerade an den wichtigen Straßen und Kreuzungspunkten peinigten die Bevölkerung. Westmittelfranken war die am meisten heimgesuchte Region in diesem großen Konfessionskrieg mit bis zu 60 % Verlust an Bevölkerung. Die Kriegsereignisse zerstörten Städte und Dörfer, so auch weite Teile des Oberamts Wahrberg mit Aurach. In Aurach gab es bereits 1619 Einquartierungen, die mit Raub und Diebstahl einhergingen. Ab 1631 vermehrten sich die Durchzüge. So plünderten Kaiserliche Truppen die Kirche in Aurach und trieben 29 Pferde und eine Viehherde fort. Daraufhin beklagte sich der Fürstbischof beim bayerischen Kurfürsten, dass im ganzen Oberstift alle „Flecken und Dörfer“ von der kaiserlichen Armee Tillys überfallen, ausgeplündert, die Untertanen gequält, Vieh und Pferde weggetrieben und auch geistliche Besitzungen nicht verschont würden. Und das, obwohl Eichstätt doch zu den Katholischen, also Kaiserlichen gehörte. Nach Tilly kamen die Schweden, die zwei Jahre in der Gegend hausten und marodierten. Aurach war wie auch viele andere Ortschaften nach dem 30jährigen Krieg ausgeplündert und lag darnieder. Von dem damit zusammenhängenden drastischen Bevölkerungsrückgang, von den Wüstungen, von Hunger und Not konnte sich die Gegend erst allmählich erholen, war jedoch – im Unterschied zu anderen Orten – schon eher wieder handlungsfähig aufgrund seiner strategisch wichtigen Lage an einer Hauptstraße.
Obwohl es in diesem großen Konfessionellen Krieg zu schrecklichen Exzessen zwischen den Kriegsgegnern kam, war man doch gerade in einem nicht geschlossenen Territorium auf ein gutes Miteinander mit seinen Nachbarn angewiesen. Das Fürstbistum Eichstätt und die Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach kamen trotz konfessioneller Unterschiede in der Regel ganz gut miteinander aus. Bereits 1537 hatte man ein Vertragswerk ausgearbeitet, dass die Grenzen und die Gerichtsbarkeiten sowie die Ausübung der Jagd für die Ämter des oberen Stifts genau beschrieb und festlegte. Beim Abschluss dieses Grenzvertrags in Spalt kam es zu einem kuriosen Zwischenfall: Der Markgraf setzte seinem Verhandlungspartner, dem Eichstätter Domdechanten Dr. Johannes von Wirsberg, mit Trinken so hart zu, dass dieser starb.Dieser Vertrag sollte bis Ende des 18. Jh. mit einigen Ergänzungen versehen Bestand

haben. So wurde etwa 1736 für das Amt Wahrberg-Herrieden ein Protokoll zur Fraischgrenzversteinung erstellt - also der Festschreibung der Hochgerichtsbarkeit -, was heute noch an einigen erhaltenen Grenzsteinen erkennbar ist.
Jahrhundertelang hatten die Markgrafen von Ansbach nämlich die Hochgerichtsbarkeit oder Blutgerichtsbarkeit oder Fraisch in manchen Orten der fürstbischöflichen Oberämter Wahrberg-Herrieden und Arberg-Ornbau auszuüben, also auch das Recht, die Todesstrafe zu verhängen. Zwar stand dies den Bischöfen von Eichstätt als Reichsfürsten urspr. in ihrem Gebiet am Oberlauf der Altmühl zu, doch hatten sie die Hochgerichtsbarkeit den Markgrafen nebst dem Wildbann und der Hohen Jagd übertragen.Dies bewährte sich bis zum Übergang der Markgrafschaft Ansbach an das Königreich Preußen 1792, als der preußische Staatsminister Karl August von Hardenberg mit seiner Staats- und Verwaltungsreform begann. Dabei ging es auch um eine „Bereinigung der Untertanen“, da nicht selten ein einziges Dorf drei bis vier Herrschaften hatte.Preußen erklärte die Hochgerichtsgrenzen einfach zu Landesgrenzen und unterwarf damit alle davon betroffenen fremden Untertanen seiner Hoheit. Preußen argumentierte im Sinne einer modernen Staatsauffassung, dass die Hochgerichtsbarkeit und der Wildbann souveräne Hoheitsrechte seien und damit zur Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach und damit zu Preußen gehörten.So wurde 1792 gemeldet, dass nicht nur in Orten mit gemischter eichstättisch-ansbachischer Bevölkerung Besitzergreifungspatente durch preußisches Militär angeschlagen wurden, sondern auch in solchen Orten mit nur eichstättischer Bevölkerung, und zwar in den ganzen Oberämtern Wahrberg-Herrieden und Ornbau-Arberg, und damit auch in Aurach. Trotz Protesten Eichstätts und Anrufung des Reichsgerichts, das Eichstätt Recht gab, blieb noch einige Jahre die Ungewissheit, wer eigentlich die Landeshoheit innehabe.Daher verweigerten auch die Amtmänner, wie der Auracher Amtmann Boller, den Eid auf den König von Preußen. Dass es trotzdem einen modus vivendi gab, zeigt, dass mitunter Eichstättische Vögte auch Justizverwalter für Preußen wurden. So bekam etwa der Auracher Vogt Joseph Engerer 1801 die Verwaltung der Stiftsgüter im Ansbachischen übertragen, nachdem er eine Prüfung im preußischen Recht absolviert hatte. Das bedeutete im Grunde die Anerkennung der preußischen Maßnahmen.Mit der Säkularisation der bischöflichen Gebiete 1803 kam das Herriedener Gebiet und damit auch Aurach ganz offiziell an Preußen. Als die Markgrafschaft dann 1806 insgesamt an das neue Königreich Bayern fiel, wurde dies von der katholischen

Bevölkerung des Herriedener Landes vehement begrüßt. Damit endete in Aurach die hoheitliche Zeit als Vogtamt. Im Amtshaus wurde 1806 eine königlich bayerische Forstdienststelle eingerichtet, die damit die Aufgaben des seit 1726 in Aurach untergebrachten bischöflichen Forstamts fortführte.
Mit Säkularisation und Mediatisierung – und damit Territorialisierung Bayerns – sowie der Industrialisierung verloren die bisherigen wichtigen Fernstraßen ihre Bedeutung. So blieb im 19. Jh. das an Bodenschätzen arme und verkehrsmäßig vernachlässigte Westmittelfranken von der beginnenden Industrialisierung fast unberührt. Daher gab es hier auch wenig Bevölkerungswachstum; im Gegenteil: die Abwanderung in industrialisierte Städte und die Auswanderung in die USA kennzeichnen die Region im 19. Jh. Franken – und hier besonders Mittelfranken - war sogar am stärksten von der Auswanderungswelle in die USA betroffen.
Denn die Erträge der Landwirtschaft waren – auch bedingt durch die fränkische Erbteilung – oft so gering, dass sich viele Bauern zusätzlich nach einer Heimarbeit umsehen mussten. Die 1860 systematisch erstellten Physikatsberichte, die der Regierung Aufschluss über die Lebensverhältnisse geben sollten, berichten über den Herriedener Bezirk, dass hier noch über 87 % der Menschen von der Landwirtschaft lebten. Fabriken gäbe es gar keine im Bezirk – in Aurach sollte sich erst 1912 eine Zigarrenfabrik ansiedeln (1912-1967).
Über die Wohnverhältnisse schreibt der Chronist 1860, dass hier in der Gegend Wohnhäuser in der Regel einstöckig seien. Im Erdgeschoß befänden sich eine Wohnstube, eine Kammer – in der die Eheleute mit kleinen Kindern schliefen -, eine Küche und Stallungen, in denen die Knechte untergebracht waren. In der oberen Etage, dem unteren Dachboden, gab es eine Stube für die erwachsenen Kinder und oft noch eine Vorratskammer. Die Mägde schliefen direkt unterm Dach. Weiter wird berichtet, dass die älteren Häuser noch in billigerem Fachwerk, die neueren schon in Sandstein oder Backstein mit größeren Fenstern errichtet seien. Die Misthaufen wären etwas entfernt vom Haus und tiefer gelegen, daneben die Abtritte.Als Hauptnahrung werden Kartoffeln, Fleisch und Sauerkraut beschrieben, wobei die Bauern Fleisch- und Mehlkost, die Dienstboten hingegen schlechtes Kleien- oder Kartoffelbrot bekämen. Als Getränk gäbe es Wasser und Milch, zumal das Bier so teurer geworden sei, dass weniger getrunken würde. Über das Trinkverhalten heißt es:

„Überhaupt werden die geistigen Getränke nur selten und bei außerordentlichen Gelegenheiten, den Kirchweihen und Jahrmärkten im Übermaß genossen und ist deßhalb das Delirium tremens in unserer Gegend ein höchst seltenes Vorkommen.“Weiter werden Kleidungsverhalten, Steuern, Eheschließungsalter (Männer 30-33 Jahre, für Frauen 25-30 Jahre), Kindersterblichkeit, Geburtenhöhe usw. beschrieben. Und schließlich bemerkt der Berichterstatter, dass „Geschlechtsausschweifungen ….selten“ seien.
Noch 1939 beschrieb ein Berliner Wissenschaftler, dass in der Region erstaunlich ärmliche landwirtschaftliche Betriebe vorhanden seien, die oftmals nur alte Karbidlampen, schlechtes Mobiliar und nicht einmal richtige Betten für die Kinder hätten.Waren die ärmlichen Verhältnisse gerade in Westmittelfranken allenthalben zu finden, kam es jedoch konfessionell bedingt zu unterschiedlichen politischen Stimmungslagen Anfang des 20. Jh. Während die evangelischen Kleinbauern in Franken sich zunächst den Deutschnationalen und dann den Nationalsozialisten zuwandten, war die katholische Enklave von Herrieden und Umgebung konservativ-kirchentreu gesinnt und unterstützte die katholischen BVP (Bayerische Volkspartei), die hier noch 1933 stattliche Mehrheiten holen konnte.
Mit Ende des Zweiten Weltkrieges veränderten sich das Territorium Bayerns, seine Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsstruktur. Geburtenausfälle während der Kriegsjahre, die hohe Zahl der Gefallenen, Vermissten und Kriegsgefangenen führten einerseits zu einem deutlichen Bevölkerungsrückgang; andererseits strömten noch während des Krieges Hunderttausende auf der Flucht vor den Bombenangriffen aus den Städten des ganzen Reichs in die bayerischen Dörfer, wo die Versorgungslage zunächst noch etwas besser war. Dazu kamen nach 1945 noch Heimatvertriebene und Flüchtlinge in großer Zahl. In Aurach wurden über 200 Heimatvertrieben aufgenommen – bei nicht einmal 1.000 Einwohnern bzw. mit eingemeindeten Ortsteilen etwa 1.500 Einwohnern eine enorme Anzahl.Insgesamt mussten ländlich geprägte Gebiete weitaus mehr Menschen aufnehmen als die vor allem durch Luftangriffe häufig schwer zerstörten städtisch-industriellen Ballungsräume. Die Integration von Millionen Vertriebener und Flüchtlinge, die sich über Jahre hinzog, ist sicher eine der herausragendsten Leistung in den Wirren der Nachkriegszeit.

Gerade für Franken bedeutete das, dass es zu einem Schmelztiegel wurde, wovon z.B. die Einebnung des Dialektes zeugt. Der einst kulturell und konfessionell homogene Raum verlor zwar seine innere Homogenität, gewann aber neue Impulse kultureller und wirtschaftlicher Art hinzu.
Nach der Währungsreform 1948 kann man ein Absinken des Anteils der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt beobachten und deshalb auch den Rückgang an Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Ursache waren die Veränderungen von Flur und Landschaft durch Extensivierung und Intensivierung der Landwirtschaft. Denn jetzt erst konnte sich die Industrialisierung der Landwirtschaft flächendeckend durchsetzen, so hatte erst 1960 fast jeder Bauernhof in Mittelfranken seinen Schlepper, so dass Tiere als Helfer des Menschen aus dem Agrarsektor verschwanden, und der Mähdrescher wurde eingeführt. Die seit vielen Jahrhunderten geprägten alten Flächenstrukturen der abwechslungsreichen Landschaft Westmittelfrankens mussten sich nun diesen Notwendigkeiten anpassen, d.h. eine Bewirtschaftung mit modernen Maschinen setzt Flächen von größerem Umfang voraus.
Heute ist Aurach weniger landwirtschaftlich geprägt als früher. Mittelständische Betriebe, Dienstleistungsbetriebe – Aurach liegt wieder an einer wichtigen Fernstraße – und auch touristische Angebote, die die Gemeinde im Naturpark Frankenhöhe und an der Romantischen Straße bietet, machen den Ort zukunftsfähig.
Und das Auracher Amtshaus? Es wurde 1978 nach der Gebietsreform an die Gemeinde Aurach verkauft, die es durch die Umnutzung zum Rathaus und die nun erfolgte Instandsetzung zu einem Schmuckstück der Gemeinde, aber auch der Region gemacht hat. Dieses Rathaus zeugt von der ganzen Geschichte Aurachs und von den wechselvollen Ereignissen, die Aurach charakterisieren. Damit gibt das Denkmal dem Ort sein unverwechselbares Gesicht, denn es wurzelt in der Vergangenheit und spiegelt diese als bildhafte Verdichtung der gemeinsamen Erinnerung im alltäglichen Leben wider. Damit festigt es gesellschaftliches Selbstverständnis und hilft, Gegenwart zu erklären, Identität zu stiften und Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. Daher kann man heute nicht nur zu 500 Jahren Rathaus gratulieren, sondern auch zu erfolgversprechenden Perspektiven für die Zukunft.

PAGE
PAGE 9