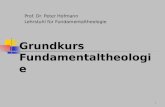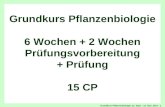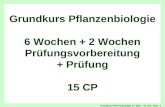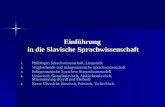Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
-
Upload
hans-peter-wieser -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
1/180
Grundkurs
Sprachwissenschaft
Wintersemester 1997/98
Karl Heinz Wagner
unter Mitarbeit von
Susanne Hackmack
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
2/180
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1. Allgemeine Grundbegriffe ................................................................................... 1
1.1. Was ist Linguistik? ........................................................................................ 1
1.2. Der Gegenstand der Linguistik ...................................................................... 2
1.2.1. Sprache als Alltagsbegriff.................................................................... 2
1.2.2. Was ist Sprache als Gegenstand der Linguistik? ................................. 3
1.2.3. Materialobjekt vs. Formalobjekt .......................................................... 6
1.2.4. Entstehungsbedingungen wissenschaftlicher Gegenstnde ................. 9
1.2.5. Der Sprachbegriff Ferdinand de Saussures .......................................... 11
1.2.6. Die Sprachauffassung von Noam Chomsky ........................................ 12
1.3. Linguistik als Wissenschaft ........................................................................... 18
1.3.1. Exaktheit .............................................................................................. 18
1.3.2. Systematik............................................................................................ 18
1.4. Linguistik als Erfahrungswissenschaft........................................................... 19
1.5. Theorie ........................................................................................................... 21
1.6. Grundbegriffe der Modellbildung.................................................................. 22
1.6.1. Der Modellbegriff ................................................................................ 22
1.6.2. Modellmethode .................................................................................... 25
1.7. Wissenschaftssprache..................................................................................... 27
1.7.1. Alltagssprache und Wissenschaftssprache........................................... 271.7.2. Theoretische und metatheoretische Begriffe........................................ 27
1.7.3. Objektsprache und Metasprache .......................................................... 27
1.7.4. Beschreibungssprache.......................................................................... 31
Kapitel 2. Semiotik............................................................................................................... 33
2.1. Kommunikation ............................................................................................. 34
2.2. Der Zeichenbegriff......................................................................................... 38
2.3. Dimensionen der Semiotik............................................................................. 43
2.4. Zeichentypologie............................................................................................ 48
2.5. Modelle des sprachlichen Zeichens ............................................................... 492.5.1. Das Zeichenmodell von de Saussure ................................................... 49
2.5.2. Bhlers Organonmodell ....................................................................... 51
2.6. Sprache als Zeichensystem ............................................................................ 52
2.6.1. Linguistik als Strukturwissenschaft ..................................................... 52
2.6.2. System und Struktur............................................................................. 53
Kapitel 3. Syntax .................................................................................................................. 59
3.1. Vorbemerkung ............................................................................................... 59
3.2. Konstituenz und Dependenz .......................................................................... 60
3.2.1. Allgemeine Grundbegriffe ................................................................... 60
3.2.2. Die Strukturabhngigkeit grammatischer Prozesse ............................. 63
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
3/180
iv Inhaltsverzeichnis
3.2.3. Konstituenz .......................................................................................... 65
3.2.4. Methoden zur Satzanalyse ................................................................... 67
3.2.5. Dependenz............................................................................................ 73
3.3. Grammatische Kategorien.............................................................................. 76
3.3.1. Konstituentenklassen ........................................................................... 763.3.2. Lexikalische Kategorien....................................................................... 77
3.3.3. Syntaktische Kategorien....................................................................... 78
3.4. Phrasenstruktur-Grammatik (PSG)................................................................ 83
3.4.1. Phrasenstruktur .................................................................................... 83
3.4.2. Phrasen-Struktur-Regeln...................................................................... 85
3.5. Erweiterungen der Phrasenstrukturgrammatik............................................... 91
3.5.1. Rekursive Kategorien........................................................................... 92
3.5.2. Subkategorisierung............................................................................... 95
3.6. Grammatische Funktionen............................................................................. 102
3.6.1. Strukturelle Ambiguitt ....................................................................... 102
3.7. Eine restriktive Theorie der Phrasenstruktur ................................................. 105
Kapitel 4. Grammatische und semantische Struktur............................................................. 107
4.1. Syntax und Semantik ..................................................................................... 107
4.2. Semantische Relationen ................................................................................. 108
4.3. Konzeptgraphen ............................................................................................. 116
4.4. Die Notation von Konzeptgraphen ................................................................ 117
4.4.1. Konzepte .............................................................................................. 117
4.4.2. Konzeptgraphen ................................................................................... 118
4.4.3. Konzeptknoten ..................................................................................... 119
4.4.4. Relationen ............................................................................................ 122
4.5. Faustregeln zur bersetzung von Stzen in Konzeptstrukturen .................... 125
4.5.1. Grundprinzip........................................................................................ 125
4.5.2. Konzepte Typfeld:............................................................................. 125
4.5.3. Konzepte Referenzfeld:..................................................................... 125
4.5.4. Relationen: ........................................................................................... 126
4.5.5. Typische Prpositionen:....................................................................... 1274.6. Typhierarchie ................................................................................................. 128
4.7. Kanon............................................................................................................. 131
4.8. Kanonische Formationsregeln........................................................................ 132
4.9. Der Aufbau von Satzbedeutungen ................................................................. 134
4.10. Die semantische Struktur komplexer Stze ................................................... 136
4.11. Schemata und Prototypen............................................................................... 136
4.12. Konzeptkatalog .............................................................................................. 139
4.12.1. Das Lexikon....................................................................................... 139
4.12.2. Konzepte ............................................................................................ 1404.12.3. Semantische Relationen ..................................................................... 143
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
4/180
Inhaltsverzeichnis v
Kapitel 5. Morphologie.......................................................................................................... 147
5.1. Die Syntax der Wrter ................................................................................... 147
5.2. Wrter und Lexeme ....................................................................................... 148
5.3. Das Morphem................................................................................................. 149
5.4. Flexionsmorphologie und lexikalische Morphologie .................................... 1535.4.1. Flexionsmorphologie ........................................................................... 153
5.4.2. Lexikalische Morphologie ................................................................... 157
5.5. Morphologische Prozesse .............................................................................. 160
5.5.1. Affigierung........................................................................................... 161
5.5.2. Modifikation ........................................................................................ 163
Literaturverzeichnis............................................................................................................... 165
Index ...................................................................................................................................... 165
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
5/180
Kapitel 1.
Allgemeine Grundbegriffe
1.1. Was ist Linguistik?
LINGUISTIK ist eine neuere, und im Hinblick auf die Entsprechungen in anderen Sprachen
(engl. linguistics, frz. linguistique, it. linguistica, sp. lingstica), auch internationalereBezeichnung fr den herkmmlichen Begriff SPRACHWISSENSCHAFT. Es gibt im deutschenSprachraum allerdings Tendenzen einer Bedeutungsverschiebung, wobei die BezeichnungLinguistik speziell fr die moderne, strukturalistisch orientierte Sprachwissenschaft verwendetwird. Besonders in der Pluralform Sprachwissenschaften wird Sprachwissenschafthufigauch synonym mit Philologie benutzt, schliet also z.B. die Literaturwissenschaft mit ein.
Anglistik, Romanistik, Slawistik etc. sind Sprachwissenschaften in diesem Sinne. Wirwerden im folgenden allerdings Linguistik und Sprachwissenschaft synonym gebrauchen.
Im hier intendierten Sinne ist SPRACHWISSENSCHAFT allgemein die WISSENSCHAFT von derSPRACHE. Daraus ergeben sich zwei weiterfhrende Fragen:
1. Was verstehen wir in diesem Zusammenhang eigentlich unter Sprache?
2. Was heit es, Sprache wissenschaftlich zu erforschen.
Sprache ist etwas, das alle Aspekte des menschlichen Lebens durchdringt und somit in denvielfltigsten Zusammenhngen eine wesentliche Rolle spielt. Die Frage Was ist Sprache?ist wie John Lyons (LYONS 1982:1) sich ausdrckt nicht weniger profund als die FrageWas ist Leben?. In einer Hinsicht ist das gesamte Streben der Sprachwissenschaft seit ihrenallerersten Anfngen darauf gerichtet gewesen, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Vondaher ist es mig, eine einfache Definition von Sprache geben zu wollen. Die Definitionfindet sich gewissermaen in allem, was ber Sprache bisher gesagt worden ist. Der britischeLinguist Geoffrey Leech uert sich zu dem vergleichbaren Versuch, den Begriff Bedeutungals Gegenstand der Semantik definieren zu wollen, wie folgt:
An autonomous discipline begins not with answers, but with questions. We might say that the
whole point of setting up a theory of semantics is to provide a definition of meaning that is,a systematic account of the nature of meaning. To demand a definition of meaning before westarted discussing the subject would simply be to insist on treating certain other concepts, e.g.
stimulus and response, as in some sense more basic and more important. A physicist does not
have to define notions like time, heat, colour, atom before he starts investigating theirproperties. Rather, definitions, if they are needed, emerge from the study itself.
Once this commonplace is accepted, the question of how to define meaning [...] is seen in itstrue colour as a red herring. (LEECH 1981:4)
Dies lt sich nahezu direkt auf unseren Fall bertragen, wenn man nur die entsprechendenAusdrcke austauscht: ... the whole point of setting up a LINGUISTIC THEORYis to provide adefinition of language that is, a systematic account of the nature of language, etc.
Wenn wir uns im folgenden dennoch mit der Frage Was ist Sprache? beschftigen, dann mitder Absicht, den Gegenstandsbereich der Sprachwissenschaft ungefhr abzustecken und eineReihe wichtiger begrifflicher Unterscheidungen zu diskutieren, die fr die Gegenstands-bestimmung von Bedeutung sind.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
6/180
2 Kapitel 1
1.2. Der Gegenstand der Linguistik
1.2.1. SPRACHE ALS ALLTAGSBEGRIFF
Sprache und entsprechende Ausdrcke in anderen Sprachen ist ein Wort unsererAlltagssprache, und wir wissen intuitiv, was es in unterschiedlichen Verwendungszusammen-hngen bedeutet. Bei genauerer Betrachtung lt sich allerdings feststellen, da das WortSprachedabei je nach Kontext ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Es ist daher sinnvoll,eine Reihe begrifflicher Unterscheidungen zu treffen.
Die Frage Was ist Sprache? hnelt, oberflchlich betrachtet, der Frage Was ist eine Sprache?.Es bestehen allerdings Unterschiede, sowohl in der Form als auch in der Bedeutung, zwischenbeiden Stzen (LYONS1981:1f.). Im ersten Satz wird das Wort Spracheohne Artikel benutzt undbenennt etwas, worber der Mensch im Gegensatz zu anderen Lebewesen als Gattung verfgt undwas ihm ermglicht, eine spezifische Sprache zu lernen und zu sprechen. Im zweiten Satz wird dasWort Sprachemit dem unbestimmten Artikel einebenutzt und bezeichnet eine Einzelsprache, wiesie in einer Sprachgemeinschaft verwendet wrde, wie z.B. Deutsch oder Englisch. Whrend in der
deutschen oder der englischen Sprache dem Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Stzenmithilfe des Artikels Rechnung getragen wird, gibt es einige europische Sprachen, die ber zweiWrter fr Spracheverfgen, welche den beiden Bedeutungen in etwa entsprechen:
So bezeichnet z.B. im Franzsischen das Wort langage Sprache im allgemeinen, das Wortlangue bezieht sich auf bestimmte Sprachen. Das englische Wort language verhlt sich wiedas deutsche Wort Sprache; es ist mehrdeutig und kann sowohl langage als auch languebedeuten. Die folgenden Beispiele sollen die Mehrdeutigkeit des Wortes Sprache verdeut-lichen:
(1.1.) (a) Er spricht fnf Sprachen(b) Er spricht Deutsch (= Er kann Deutsch)(c) Er spricht jetzt deutsch
(d) Die SpracheGoethes(e) Eine natrliche (kunstvolle, gezierte, geschraubte etc.) Sprache sprechen(f) Die Spracheder Bienen; Programmiersprachen
Im Beispielsatz (1.1.)(a) bezieht sich Sprache auf mehrere Einzelsprachen; (1.1.)(b) bedeutetsoviel wie Er ist der deutschen Sprache mchtig und bezieht sich ebenfalls auf Sprache in derBedeutung des franzsischen langue. Im dritten Beispielsatz kommt eine neue Bedeutung inBezug auf Sprache hinzu. Der Ausdruck (1.1.)(c) kann mit Die uerungen, die er gerademacht, knnen als deutsch identifiziert werden umschrieben werden, es geht also um Spracheim tatschlichen Gebrauch oder um Sprache als Produkt. Im Franzsischen gibt es dafr eineigenes Wort:parole.Im vierten Beispielsatz wird Spracheverwendet, um die linguistischen
Eigenheiten eines Einzelnen, seinen Stil, zu benennen. Am fnften Beispielsatz wird deutlich,da es innerhalb einer Einzelsprache unterschiedliche Stilebenen gibt, die, je nach Situation,angebracht oder unangebracht sein knnen.
Englisch language
Deutsch Sprache
Franzsisch langage langue
Italienisch linguaggio lingua
Spanisch lenguaje lengua
Abb. 1.1. Bezeichnungen fr Sprache
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
7/180
Allgemeine Grundbegriffe 3
Wie wir gesehen haben, verhlt sich das deutsche Sprache hinsichtlich der Bedeutung von langageund langueebenso mehrdeutig wie das englischelanguage. Das nchste Beispiel zeigt eine weitereMehrdeutigkeit des Wortes Sprache, die beim englischen languagenicht vorkommt:
Zwei Personen A und B treffen sich beim Spaziergang im Park und es kommt zu folgendemDialog:
A: In meinem Haus wohnt ein Professor, der spricht fnf Sprachen. Und stellenSie sich vor, jetzt hat er die Sprache verloren.
B: Ja welche denn?
Warum wirkt das erheiternd? Weil das Wort Sprachein er spricht fnf Sprachen (he speaksfive languages) eine andere Bedeutung hat als in er hat die Sprache verloren (he lost hisspeech). In der englischen bersetzung mten auch tatschlich zwei unterschiedliche Wrterbenutzt werden, language einerseits und speech andererseits, und somit htte der Witz dieBasis verloren.
Das Ziel dieser berlegungen war es zunchst, zu verdeutlichen, da das Wort Sprache in
seiner alltagssprachlichen Verwendung ganz unterschiedlichen Bedeutungen hat und daher alswissenschaftlicher Begriff nicht sonderlich geeignet ist. Leider ist es hufig der Fall, daWrter, wie sie in der Alltagssprache gebraucht werden, zu vage und mehrdeutig sind, umohne weiteres als Bestandteil einer wissenschaftlichen Terminologie bestehen zu knnen.
1.2.2. WAS IST SPRACHE ALS GEGENSTAND DER LINGUISTIK?
Was liegt nher, als die Linguisten selber zu ihrem Forschungsgegenstand zu befragen? Diefolgenden Beispiele mgen einen exemplarischen Eindruck davon geben, wie bedeutendeSprachforscher ihren Gegenstand definieren.
Der deutschstmmige amerikanische Sprachwissenschaftler und Anthropologe Edward Sapirdefiniert den Gegenstand der Linguistik wie folgt:
Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions
and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. (SAPIR1921: 8).
Die zentralen Begriffe dieser Definition sind method ofcommunication und system of symbols. Von KOMMUNIKA-TION und Sprache als ZEICHENSYSTEM wird im KapitelSemiotik ausfhrlicher die Rede sein. Sapirs Definition ist,wie John Lyons ausfhrt, in mancher Hinsicht unbefrie-digend:
This definition suffers from several defects. However
broadly we construe the terms idea, emotion and
desire, it seems clear that there is much that iscommunicated by language which is not covered by any ofthem; and 'idea' in particular is inherently imprecise. Onthe other hand, there are many systems of voluntarilyproduced symbols that we only count as languages in whatwe feel to be an extended or metaphorical sense of theword 'language'. For example, what is now popularlyreferred to by means of the expression body language which makes use of gestures, postures, eye-gaze, etc. would seem to satisfy this point of Sapir's definition.Whether it is purely human and non-instinctive is,
admittedly, open to doubt. But so too, as we shall see, isthe question whether languages properly so called are both purely human and non-instinctive.This is the main point to be noted in Sapir's definition.(LYONS 1981: 3f.)
Abb. 1.2. Edward Sapir
(1884-1939)
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
8/180
4 Kapitel 1
Sapirs Zeitgenosse Leonard Bloomfield unternahm in den zwanziger Jahren den Versuch, die
Sprachwissenschaft methodisch nach dem Stand der damals entwickelten Wissenschafts-
theorie zu systematisieren. Seinen Niederschlag fand dieser Versuch in dem 1926 in der kurz
davor von ihm mitbegrndeten ZeitschriftLanguageerschienen Aufsatz A Set of Postulatesfor the Science of Language.1Er definiert darin Sprache mithilfe der Begriffe Utteranceund
Speech-Communitywie folgt:The totality of utterances that can be made in a speech-
community is the language of that speech-community.
(BLOOMFIELD1926: 153)
Sprache bedeutet fr Bloomfield also die Menge allerpotentiellen uerungen in einer Sprachgemeinschaft. Ober-flchlich betrachtet scheint es hier Gemeinsamkeiten zugeben mit der folgenden Definition von Noam Chomsky:2
From now on I will consider a language to be a set
(finite3or infinite) of sentences, each finite in length and
constructed out of a finite set of elements. (CHOMSKY1957: 13)
Chomskys Definition ist jedoch viel umfassender undallgemeiner. Was nach dieser Definition eine Sprache imkonkreten Fall ist, hngt nmlich davon ab, aus welchenElementen sie aufgebaut ist. So bilden danach z.B. allesymbolischen Ausdrcke der Mathematik eine Sprache.Beispielsweise ist der Ausdruck (a+b) = a + 2ab +beinSatz in der Sprache der Mathematik, whrend der Ausdruck
)+ab( a2b=b kein Satz dieser Sprache ist. NatrlicheSprachen sind dann nur eine besondere Art von Sprachenach obiger Definition:
All natural languages in their spoken and written form
are languages in this sense, since each natural language
has a finite number of phonemes4 (or letters in its
alphabet) and each sentence is representable as a finite
sequence of these phonemes (or letters), though there
are infinitely many sentences. Similarly, the set of
sentences of some formalized system of mathematicscan be considered a language. (CHOMSKY1957: 13)
Chomskys Definition unterscheidet sich, wie John Lyons
ausfhrt, auch in anderer Hinsicht von den vorherigen:It says nothing about the communicative function ofeither natural or non-natural languages; it says nothing
about the symbolic nature of the elements or sequences of
them. Its purpose is to focus attention upon the purely
structural properties of languages and to suggest that these
properties can be investigated from a mathematically
1Eine ausfhrliche kritische Wrdigung dazu findet sich in MAAS(1973: 93ff.)
2Noam Chomsky lehrt am berhmtenMassachusetts Institute of Technologyin Cambridge (Mass.) und hat die Entwicklungder neueren Linguistik seit Ende der fnfziger Jahre ganz wesentlich geprgt.
3Man beachte die Aussprache:finite , infinite
4Phoneme sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Lautsegmente einer Sprache. Beispielsweise unterscheiden sichdie Wrterpinund binim Anlaut in den Phonemen /p/ und /b/.
Abb. 1.3. Leonard Bloomfield
(1887-1949)
Abb. 1.4. Noam Chomsky
(1928 -)
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
9/180
Allgemeine Grundbegriffe 5
precise point of view. It is Chomskys major contribution to linguistics to have given particular
emphasis to what he calls the structure-dependence5of the processes whereby sentences are
constructed in natural languages and to have formulated a general theory of grammar which is
based upon a particular definition of this property. (LYONS1981: 7f.)
Der britische Sprachwissenschaftler M.A.K. Halliday schlielich betrachtet Sprache als etwas
Dynamisches:Language does not exist, it happens. It is neither an organism, as many nineteenth-century
linguists saw it, nor an edifice [Gebude, KHW], as it was regarded in the early modernstructuralist period of linguistics. Language is an activity basically of four kinds: speaking,listening, writing and reading.(HALLIDAYet al. 1964: 9)
Es scheint, als htte jeder Linguist eine eigeneDefinition von Sprache. Bis jetzt haben wir Sprachekennengelernt als
1. Symbolsystem zur Kommunikation (Sapir 1921)
2. die Gesamtheit der mglichen uerungen in einerSprachgemeinschaft (Bloomfield 1926)
3. eine Menge von Stzen (Chomsky 1957)
4. eine Ttigkeit (Halliday et al. 1964)
In Theodor Lewandowskis linguistischem Wrterbuch(LEWANDOWSKI1990) sind unter dem Stichwort Sprachenoch ca. 15 weitere Aspekte aufgefhrt, unter welchenuns das Phnomen Sprache erscheint.
Einige Sprachwissenschaftler haben das Problem um-gangen, indem sie Sprache berhaupt nicht, oder nicht
explizit, definieren. Stattdessen werden nur bestimmteAspekte der Sprache als Gegenstand linguistischer Unter-suchung herausgegriffen. Der amerikanische StrukturalistH.A. Gleason sagt z.B.:
Language has so many interrelationships with various aspects of human life that it can be
studied from numerous points of view. All are valid and useful, as well as interesting in
themselves. Linguistics is the science which attempts to understand language from the point
of view of its internal structure. (GLEASON1961: 2)
Wichtig erscheint hier die Vorstellung eines Point of View, aus dem heraus ein Gegenstandbetrachtet wird. Auf dieses Konzept wird im nchsten Abschnitt nher eingegangen. Eine
vergleichbare, doch allgemeinere Ansicht vertritt der britische Linguist R.H. Robins:Language in all its forms and manifestations, that is all the languages of the world and all the
different uses to which in the various circumstances of mankind they are put, constitutes the
field of the linguist. He seeks a scientific understanding of the place of language in human
life, and of the ways in which it is organized to fulfil the needs it serves and the functions it
performs. (ROBINS1964: 2 f.)
Die unterschiedlichen Definitionen zeigen, da es keine einstimmige Meinung ber denGegenstand der Linguistik gibt, und da dieser offensichtlich nicht leicht zu definieren ist. DieLinguisten, scheint es, befinden sich in der gleichen Lage wie die blindgeborenen Bettler, berdie folgende Parabel berichtet:
5Zum Begriff der Strukturabhngigkeit vgl. das Syntaxkapitel.
Abb. 1.5. M.A.K. Halliday
(1925)
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
10/180
6 Kapitel 1
Die Blinden und der Elefant
Es war einmal, so erzhlt Buddha, ein Knig von Benares, der rief zu seinerZerstreuung etliche Bettler zusammen, die von Geburt an blind waren und setzteeinen Preis aus fr denjenigen, der ihm die beste Beschreibung eines Elefantengeben wrde. Zufllig geriet der erste Bettler, der den Elefanten untersuchte, an
dessen Bein, und er berichtete, da der Elefant ein Baumstamm sei. Der zweite,der den Schwanz erfate, erklrte, der Elefant sei wie ein Seil. Ein anderer,welcher ein Ohr griff, beteuerte, da der Elefant einem Palmenblatt gleiche undso fort. Die Bettler begannen untereinander zu streiten, und der Knig warberaus belustigt.6
Um dennoch eine angemessene Beschreibung zu erzielen, bietet es sich an dieser Stelle an,
eine begriffliche und terminologische Unterscheidung zu treffen.
1.2.3. MATERIALOBJEKT VS. FORMALOBJEKT
Der Gegenstand als Materialobjekt
Bereits Ferdinand de Saussure, der Hauptbegrnder des europischen Strukturalismus, unterschiedin seinen Vorlesungen Anfang des Jahrhunderts7zwischen dem Stoff der Sprachwissenschaft (lamatire de la linguistique) und dem Gegenstand der Sprachwissenschaft (l'objet de la lin-guistique).8 Die Einleitung seines spter sehr einflureichen Cours de linguistique gnrale
(1916) enthlt ein sehr kurzes zweites Kapitel, in demes heit: La matire de la linguistique est constitued'abord par toutes les manifestations du langagehumain.9 (SAUSSURE 1916: 20) Das unmittelbarfolgende Kapitel hat jedoch die berschrift Objet de lalinguistique und im ersten Abschnitt dieses Kapitelssagt de Saussure Bien loin que l'objet prcde le point
de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crel'objet10(SAUSSURE1916: 23).
Ferdinand de Saussure unterscheidet also zwischendem Stoffund dem Gegenstandder Linguistik, wobeiletzterer von der Betrachtungsweise des Forschersabhngt. Nach de Saussure ist diese Unterscheidungeine Besonderheit der Linguistik. Einem Vorschlagdes russischen Psycholinguisten A.A. Leont'ev (1971:15ff.) folgend mchte ich jedoch allgemein zwischendem MATERIALOBJEKT und dem FORMALOBJEKT
einer Wissenschaft unterscheiden. Dies ist allerdingskeine neue Unterscheidung. Schon im Wissen-
6Aus: Neumller, G. und Niel, F. Gott und Gottesbilder,Reihe Konzepte 2 (Materialien fr den Religionsunterricht in derSekundarstufe 2), Verlag Moritz Diesterweg u. Kselverlag, 1977, S. 1.
71916 posthum von einigen seiner Studenten auf der Grundlage der Vorlesungsskripten als Cours de linguistique gnraleverffentlicht.8Leider wurde in der deutschen bersetzung der systematische Unterschied zwischen matireund objetnicht gesehen und in
beiden Fllen mit Gegenstand bersetzt.9Der Stoff der Sprachwissenschaft umfat alle Manifestationen der menschlichen Rede
10Weit davon entfernt, da der Gegenstand der Betrachtungsweise vorausgeht, scheint es doch eher so, da dieBetrachtungsweise den Gegenstand erst schafft.
Abb. 1.6. Ferdinand de Saussure
(18571913)
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
11/180
Allgemeine Grundbegriffe 7
schaftsbetrieb der mittelalterlichen Scholastik11 wurde zwischen dem konkreten obiectum
materiale und dem abstrakten obiectum formale unterschieden.
Definition 1.1.Materialobjekt
Das MATERIALOBJEKT (= OBJEKT bei Leontev) einer Wissenschaft besteht aus der
Gesamtheit der zu untersuchenden konkreten Erscheinungen der objektiven Realitt,
die vor einer Wissenschaft und unabhngig von ihr, vom Forscher, seinemBewutsein und seinen Betrachtungsweisen existieren.
Das Materialobjekt existiert also schon bevor irgend jemand sich wissenschaftlicher oderanderweitig damit beschftigt. In diesem Sinne kann man sagen, da verschiedene Wissenschaftendas gleiche Materialobjekt untersuchen knnen, wenn auch aus unterschiedlichem Blickwinkel undmit unterschiedlichen Erkenntnisinteressen. So ist das Phnomen Sprache das Materialobjekt(wenn auch nicht das einzige) von so verschiedenen Disziplinen wie Philosophie, Psychologie,
Soziologie, Physiologie, Medizin, etc. Obwohl sie es alle mit dem gleichen Objekt zu tun haben,
betrachten sie es aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und mit ganz verschiedenen
Zielsetzungen und schaffen damit je verschiedene Formalobjekte als wissenschaftliche Unter-
suchungsgegenstnde.Um zu unserer Parabel zurckzukommen: Der Elefant entspricht unserem Materialobjekt. DieBlinden sind die Wissenschaftler, die dieses Objekt notgedrungen jeweils nur unter einembestimmten Blickwinkel betrachten, wodurch Beschreibungen entstehen, die partiell und vonder Wirklichkeit mehr oder weniger weit entfernt sind. Die Parabel zeigt auch, da dasunbekannte Objekt unter Bezug auf bereits Bekanntes erfat wird: Der Elefant ist wie einBaumstamm, wie ein Seil, wie ein Palmenblatt.
Der Gegenstand als Formalobjekt
Sobald wir unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Eigenschaften eines gegebenen Material-
objektes richten und dabei andere Eigenschaften des gleichen Objektes wenn auch nurvorbergehend auer Acht lassen, machen wir eine Abstraktion.12 Wir abstrahieren vonbestimmten real vorhandenen Eigenschaften des Objektes, um dafr andere Eigenschaftenumso mehr in den Vordergrund zu rcken. Das Resultat einer solchen Abstraktion knnen wirein ABSTRAKTES OBJEKT nennen.
In gewisser Weise ist diese Ttigkeit vergleichbar mit der eines Bildhauers, der aus einemrohen Stein durch Wegschlagen des Irrelevanten eine bestimmte Gestalt herausarbeitet.
Nehmen wir zum besseren Verstndnis ein linguistisches Beispiel: Vom rein physikalischenStandpunkt aus betrachtet ist der Redeflu als stoffliche Manifestation einer sprachlichenuerung ein Kontinuum. Dies gilt sowohl fr die Erzeugung eines Sprachschalles, weil dieSprechorgane, die an seiner Realisierung beteiligt sind, z.B. die Lippen und Zunge, sichkontinuierlich bewegen, als auch fr das Produkt, den Schall selbst. Abb. 1.7. zeigt z.B. diegraphische Darstellung Wellenform des Sprachausschnitts available to us auseiner Sprachaufnahme von Noam Chomsky in ihrem zeitlichen Verlauf.
11Scholastik (vom lat. schola, Schule), wrtlich Schulwissenschaft, heit der Betrieb der Wissenschaft, Philosophie,Theologie und Rechtswissenschaft im abendlndisch-christlichen Mittelalter. Die o.g. Unterscheidung findet sich z.B. beiThomas von Aquin (12251274).
12Abstrahieren heit wrtliche wegnehmen.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
12/180
8 Kapitel 1
Abb. 1.8. Wellenform vonavailable to us
(gesprochen von Noam Chomsky)
Wenngleich an einigen Stellen deutlich Segmente erkennbar sind, ist es jedoch insgesamt
schwierig, genau festzustellen, wo ein Laut aufhrt und der andere beginnt. Wir haben jedochgelernt insbesondere im Zusammenhang mit der Alphabetisierung , die an sich kon-
tinuierliche Rede als Folge von wohlunterschiedenen, abgegrenzten Einheiten aufzufassen.Bezogen auf die Erzeugung knnen wir dies bewerkstelligen, indem wir nur extremeStellungen der Sprechorgane bercksichtigen und die bergnge zwischen diesen Extrem-positionen auer Acht lassen. Bei der uerung des Wortes Papa (phonetisch: [)beginnt die erste Silbe mit einem vlligen Verschlu der Lippen, whrend der Silbenauslaut([]) mit maximaler ffnung des Mundes hervorgebracht wird. Zwischen diesen beidenExtrempositionen vlliger Verschlu und maximale ffnung gibt es jedoch eine Reihevon bergangsstellungen, die als irrelevant betrachtet werden. Indem wir dies tun, schaffenwir jedoch ABSTRAKTE OBJEKTE, die wir LAUTEnennen.
Es ist wichtig, da wir uns stets vor Augen halten, da die meisten Gegenstnde, mit denenwir es in den Wissenschaften zu tun haben, abstrakte, d.h. durch Abstraktion aus demMaterialobjekt erzeugte Objekte sind. Die Menge der abstrakten Objekte in diesem Sinnebilden das FORMALOBJEKTeiner Wissenschaft.
Definition 1.2. Formalobjekt
Das FORMALOBJEKT (= GEGENSTAND bei Leont'ev) einer Wissenschaft ist dieGesamtheit der Abstraktionen, die dadurch geschaffen werden, da das Material-objekt aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Erkenntnis-interessen untersucht wird.
Da Sprache ein alle Lebensbereiche durchziehendes Phnomen ist, ist es nicht verwunderlich, daes in der Alltagssprache eine Reihe von Ausdrcken gibt, die sich auf sprachliche Gegenstnde
beziehen:Laut, Buchstabe, Silbe, Wort, Satz, Sprache, Bedeutung.Sie sind uns so gelufig, da wirsie als etwas sehr Konkrektes betrachten. In Wirklichkeit jedoch handelt es sich bei all diesenDingen um Abstraktionen im oben gezeigten Sinne.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
13/180
Allgemeine Grundbegriffe 9
1.2.4. ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN WISSENSCHAFTLICHER GEGENSTNDE
Da das Formalobjekt einer Wissenschaft erst durch die Betrachtungsweise entsteht, ist es klar,
da es der geschichtlichen Entwicklung dieser Wissenschaft unterworfen ist. Die Zusammen-setzung des Formalobjektes einer wissenschaftlichen Disziplin zu einem bestimmten Zeit-
punkt ist von einer Reihe von Faktoren wie z.B. den folgenden abhngig:1. dem Entwicklungsstand der Wissenschaft,2. den subjektiven und objektiven Erkenntnisinteressen,3. den wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Grundpositionen des Forschers,4. gewissen Abgrenzungsproblemen.
1.2.4.1. Entwicklungsstand der Wissenschaft
Da das Formalobjekt einer Wissenschaft von deren Entwicklungsstand abhngt, ist offen-sichtlich, schlielich soll es, im Idealfall, auf dem Wissen fuen, das sich im Laufe der Zeit indieser Wissenschaft angesammelt hat.
Das Formalobjekt einer Wissenschaft hngt aber auch von der Entwicklung innerhalb andererwissenschaftlicher Disziplinen ab. So profitierte die Sprachwissenschaft von den Fortschrittender allgemeinen wissenschaftlichen Methodologie, der Wissenschaftstheorie, der Physik,Physiologie und Technologie. Erfindungen wie das Grammophon, das Tonbandgert, derLautspektrograph13 und vor allen Dingen der Computer hatten groen Einflu auf dieEntwicklung der Linguistik.
1.2.4.2. Subjektive und objektive Erkenntnisinteressen
Die Sprachforschung ist seit ihren ersten Anstzen sowohl von subjektiven als auch vonobjektiven Erkenntnisinteressen vorangetrieben worden. Zum einen wird Sprache mit dem Zieluntersucht, die Wibegier eines individuellen Wissenschaftlers zu befriedigen. Zum anderen
stehen ganz spezifische, sozial relevante Fragen hinter der Untersuchung. Dazu einigehistorische Beispiele (nach ROBINS1973:8ff):
Im Chinesischen Altertumentsprang die Sprachwissenschaft aus der Untersuchung klassischerliterarischer Texte und diente dazu, ein System zu entwickeln, mit dem das aus einerBilderschrift entstandene Schriftsystem der Chinesischen Sprache systematisch dargestelltwerden konnte.
Ein Hauptanliegen der Sprachwissenschaft im alten Indienwar die semantische, syntaktischeund phonologische Beschreibung des Sanskrit, der klassischen Sprache Indiens, um so dieursprngliche Reinheit der heiligen Texte zu erhalten, die seit der ltesten vedischen Periode(um 1100 v.Chr.) mndlich berliefert waren. Dank der vorzglichen Arbeit indischer
Phonetiker (in der Zeit von 800150 v.Chr.) wissen wir ber die Aussprache des Sanskritmehr als ber die irgendeiner anderen alten Sprache.
Die arabische Sprachwissenschaft wurde sowohl von religisen als auch von weltlichenBedrfnissen motiviert. Durch territoriale Expansion und die Verbreitung des Islam in nicht-arabischen Lndern wurde in diesen eine ausreichende Kenntnis der arabischen Sprachenotwendig, um die Handelspolitik, die Verwaltung und die Rechtsprechung angemessendurchfhren zu knnen.
Eine vergleichbare Situation bestand im antiken Griechenland, insbesondere in der helleni-schen Periode (300 v.Chr.), als sich griechische Zivilisation und Kultur als Folge derEroberungen Alexanders des Groen (400 v.Chr.) in Kleinasien und gypten verbreitete.Griechisch wurde in diesem Gebiet von einer Reihe von Vlkern gesprochen, deren Mutter-
13Ein Lautspektrograph ist ein Gert, das eine komplexe Schallwelle in einzelne Frequenzbereiche zerlegt und aufzeichnet.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
14/180
10 Kapitel 1
sprache nicht Griechisch war. Es entwickelte sich eine gemeinsame Sprache, genannt Koin,eine Lingua Franca,14die von dem klassischen attischen Griechisch der Dichter und Prosa-schriftsteller des 5. und 4. Jahrhunderts v.Chr. abwich. Als Reaktion auf diese Entwicklung
entstand eine Bewegung, die das authentische, klassische Griechisch bewahren und lehren
wollte; sie entwickelte sich gemeinsam mit der Exegese (Auslegung) der Texte der
klassischen Autoren.Auch die Sprachwissenschaft unseres Jahrhunderts ist durch hnliche Interessen geprgt (vgl.NEWMEYER & EMONDS, 1971; EISENBERG & HABERLAND, 1972). 1934 wurde in Arkansas,USA, das SummerInstitute of Linguistics, kurz SIL, gegrndet, welches in etwa identisch istmit der Wycliff Bible Translators Inc. Diese Organisation entstand, weil man die Bedeutung,ie die Linguistik fr die Untersuchung und bersetzung unerforschter Sprachen hatte,erkannte. Missionare sollten sprachwissenschaftlich unterwiesen werden, um dement-sprechend gerstet ihre Aufgabe auszuben.
1.2.4.3. Wissenschafts- und Erkenntnistheorie
Die Formalobjekte einer Disziplin zu einem bestimmten Zeitpunkt hngen auch von denwissenschaftstheoretischen und erkenntnistheoretischen Grundpositionen des Forschers ab.
Beispiel: Empirismus vs. Rationalismus:
Empirismus: Theoriebildung auf der Grundlage (groer) Mengen empirischer Daten; Theoriewird durch beobachtbare Daten verfiziert; induktives Vorgehen, Bezug zumBehaviourismus.
Rationalismus: Theoriebildung auf der Grundlage (weniger) Daten; berprfung und Testender Theorie durch Falsifikation; deduktives Vorgehen, Bezug zu kognitiver Psychologie;Mentalismus.
1.2.4.4. Abgrenzungsprobleme
Wenn, wie wir gesehen haben, Sprache das Materialobjekt von ganz verschiedenen Wissen-schaften sein kann, stellt sich die Frage, was denn die sprachwissenschaftliche Beschftigungmit Sprache von der Art unterscheidet, wie Sprache in den anderen Wissenschaften behandeltwird. Was rechtfertigt denn die Etablierung einer eigenen Wissenschaft von der Sprache (vgl.LINKE ET AL. 1991:5f.)?
1. Sprachbetrachtung um der Sprache willen
Es gibt sicher eine Reihe von Fragestellungen, die sowohl in der Linguistik als auch in anderenDisziplinen intensiv diskutiert werden. Dies trifft beispielsweise auf die Semantik zu, d.h. dieLehre von der Bedeutung sprachlicher Ausdrcke. Die Klrung der Bedeutung sprachlicher
Ausdrcke ist ein wichtigen Anliegen in der Philosophie, der Rechtswissenschaft, derLiteraturwissenschaft und der Theologie. Dort ist die Auseinandersetzung mit Sprache jedochMittel zu einem anderen Zweck (z.B. der Textinterpretation oder Exegese). Der Gegenstand isteigentlich nicht die Sprache selbst, sondern etwas anderes. Sprache gert in den Blick, wo es frdie Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Gegenstand erforderlich ist. Die Linguistik hingegenstellt Sprache selbst in den Mittelpunkt und untersucht sie um ihrer selbst willen.
2. Vollstndigkeit der Beschreibung
Das Ziel anderer Disziplinen ist es nicht, eine systematische Beschreibung der Sprache odereinzelner sprachlicher Phnomene zu liefern. Dies jedoch ist das erklrte Ziel der Sprachwissen-schaft. Sie erstrebt eine gewisse Vollstndigkeit ihrer Beschreibungen. Ihr Gegenstand ist Sprache
14Eine Lingua Franca (wrtl. 'frnkische Sprache') ist eine Sprache, die als gemeinsames Kommunikationsmittel vonSprechern verschiedener Muttersprachen verwendet wird.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
15/180
Allgemeine Grundbegriffe 11
in all ihren Erscheinungsformen und Verwendungsweisen (vgl. das Zitat von Robins auf S. 5).
Eine zentrale Aufgabe der Sprachwissenschaft ist zu bestimmen, was Sprache eigentlich ist und
dies in systematischer Weise in Form von zusammenhngenden Sprachtheoriendarzustellen.
3. Sprachwissenschaftliche Perspektive
Es gibt in der Tat einige wissenschaftliche Teildisziplinen auerhalb der Sprachwissenschaftim engeren Sinne, die sich intensiver mit dem Gegenstand Sprache auseinandersetzen. Dieskommt in der Namensgebung zum Ausdruck, z.B. Sprachphilosophie, Sprachsoziologie,Sprachpsychologie, Sprachpathologie etc. Whrend die Linguistik zunchst versucht hat, sichvon solchen Disziplinen abzugrenzen und ihren Gegenstand auf die Untersuchung derinternen Struktur von Sprache einzuschrnken (vgl. das Zitat von Gleason auf S. 5), mit demErgebnis, da der eigentliche Gegenstand der Linguistik immer kleiner wurde, haben sich inden letzten Jahrzehnten zunehmend analoge Teildisziplinen der Linguistik entwickelt, dieSprache unter zustzlichen Gesichtspunkten betrachten: Sprache und Gesellschaft, Spracheund Denken, Sprache und Biologie etc. Dabei gibt es sicher erhebliche berschneidungen.Die Unterschiede liegen wesentlich in der Perspektive. Man kann sagen, da andere Diszipli-
nen wie Sprachphilosophie, Sprachsoziologie und Sprachpsychologie sich auch noch mitSprache beschftigen. Die Linguistik aber beschftigt sich mit Sprache, und das auch nochunter Bercksichtigung besonderer auersprachlicher Gesichtspunkte, was wiederum in derNamensgebung zum Ausdruck kommt: Soziolinguistik, Psycholinguistik, Patholinguistik(Neurolinguistik), Biolinguistik etc.
1.2.5. DER SPRACHBEGRIFF FERDINAND DE SAUSSURES
Von den vielen Versuchen, den Gegenstand der Sprachwissenschaft nher zu bestimmen,sollen in den folgenden Abschnitten zwei nher betrachtet werden, weil sie den Gang derneueren Sprachwissenschaft ganz wesentlich geprgt haben. Es handelt sich um die Sprach-auffassungen von Ferdinand de Saussure und von Noam Chomsky.
Der Einflu von de Saussure basiert wesentlich auf dem Cours de linguistique gnrale (dt.Grundfragen der Allgemeine Sprachwissenschaft), einem Werk, das 1916 nach seinem Todenach Vorlesungsniederschriften einiger seiner Schler verffentlicht worden ist. Es ist dahernicht immer klar, ob dieser Text die Ansichten de Saussures authentisch wiedergibt. Diefolgenden Ausfhrungen (vgl. Abb. 1.9) geben die Interpretation von LEONT'EV (1971: 19ff.)wieder, der sich auf die textkritische Arbeit von Godel sttzt (R. Godel, Les sourcesmanuscrites de Cours de linguistique gnrale de F. de Saussure. 1957).
Danach stehen sich im System Saussures Spracheals abstraktes berindividuelles System vonZeichen15(lalangue) und Sprachfhigkeitals Funktion des Individuums (facult de langage)gegenber, die durch den Terminus langage zusammengefat werden. Die Sprache (langue)ist der gemeinsame Besitz einer Sprachgemeinschaft und ist ihrem Wesen nachgesellschaftlich bedingt und vom einzelnen Individuum unabhngig. Sie ist andererseits dasProdukt der individuellen facult de langage. Jedes Mitglied einer Sprachgemeinschaftverfgt sozusagen ber eine Kopie der Sprache. Der Begriff langage,der langueundfacultde langageumfat, steht als etwas Potentielles dem Sprechenals individuellem Akt (parole)gegenber (potentiell vs. aktuell). Das Sprechen setzt einerseits die gattungsspezifischeSprachfhigkeit und andererseits die Kenntnis des Sprachsystems (langue) voraus.
15Zum Zeichenbegriff bei de Saussure vgl. das folgende Kapitel zur Semiotik.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
16/180
12 Kapitel 1
Der Sprachbegriff
bei
Ferdinand de Saussure
langage
sozial individuell
langue
als abstraktes
berindividuellesSystem
facult de langageals Funktion des
Individuums
potentiell
parole
aktuell ein individueller Akt, welcher dieSprachfhigkeit mithilfe eines sozialen
Systems realisiert
Abb. 1.9. Der Sprachbegriff bei Saussure
Nach de Saussure ist es die Aufgabe der Linguistik im engeren Sinne, die Sprache als langue
in ihrer inneren Struktur zu untersuchen. Diese Konzeption wurde im Rahmen des linguisti-
schen Strukturalismus fruchtbar, und ist vor allem durch den dnischen SprachforscherLouis Hjelmslev (18991965) konsequent zu Ende gedacht worden.
1.2.6. DIE SPRACHAUFFASSUNG VON NOAM CHOMSKY
Die Entwicklung der modernen Sprachwissenschaft wurde seit Ende der fnziger Jahre bis heuteganz entscheidend durch die Arbeiten von Noam Chomsky, dem Begrnder der sog. generativenTransformationsgrammatik, geprgt. In seinem 1965 erschienenen Buch Aspects of the Theoryof Syntaxtraf er eine dem Gegensatz von langueundparoleanaloge Unterscheidung zwischencompetence und performance. Diese Termini wurden als KOMPETENZ und PEFORMANZ insDeutsche bernommen. Teilweise als Antwort auf Kritik am Kompetenzbegriff wird neuerdings
zustzlich zwischen GRAMMATISCHERund PRAGMATISCHERKompetenz unterschieden.1.2.6.1. Kompetenz und Performanz
Mit dem Terminus KOMPETENZ bezeichnet Chomsky ein THEORETISCHES KONSTRUKT, dasseinerseits auf den Konstrukten eines idealisierten Sprechers/Hrers und einer homogenenSprachgemeinschaft basiert.
Definition 1.3. Theoretisches Konstrukt
Ein THEORETISCHES KONSTRUKT ist ein konstruierter, theoretischer oder theorie-gebundener Begriff, der nur indirekte empirische Bezge hat. Systeme vonKonstrukten ergeben Theorien im Sinne begrifflicher Netze ber einem Gegen-
standsbereich. Linguistische Konstrukte sind Struktur, System, Phonem,Kompetenz, usw.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
17/180
Allgemeine Grundbegriffe 13
An allgemein bekanntes Beispiel fr ein Konstrukt in diesem Sinne ist der Begriff derIntelligenz.
Definition 1.4.idealer Sprecher/Hrer
Der Gegenstand einer linguistischen Theorie ist in erster Linie ein idealer
Sprecher/Hrer, der in einer vllig homogenen Sprachgemeinschaft lebt, seineSprache ausgezeichnet beherrscht und bei der Anwendung seiner Sprachkennt-nisse in der aktuellen Rede von grammatisch irrelevanten Bedingungen wiebegrenztem Gedchtnis, Zerstreutheit und Verwirrung, Verschiebung in derAufmerksamkeit und im Interesse, (zuflligen oder typischen) Fehlern nichtbeeintrchtigt wird. (Chomsky 1965:13)
Eine Sprachgemeinschaft ist homogen, wenn sie frei von dialektalen (regionalspezifischen) odersoziolektalen (gruppenspezifischen) Sprachvarianten ist. Die Aufgabe der Sprachtheorie ist dieErklrung der Kompetenz eines idealen Sprechers/Hrers einer solchen Sprachgemeinschaft.
Definition 1.5. sprachliche Kompetenz
Die Kompetenz ist das im Spracherwerbsproze erworbene (unbewute) Wissen,ber das ein idealer Sprecher/Hrer einer homogenen Sprachgemeinschaft verfgt.Es besteht aus einem System von Regeln und Prinzipien, die mental reprsentiertsind, und die es ihm ermglichen, auf der Grundlage eines endlichen Inventarsvon Elementen (Lauten, Wrtern) eine prinzipiell unendliche Zahl von ue-rungen in einer konkreten Kommunikationssituation hervorzubringen und zuverstehen und Urteile ber die Grammatikalitt, Mehrdeutigkeit und Bedeutungs-gleichheit von Stzen abzugeben.
Die Art und Weise, wie wir von diesem Wissen in konkreten Kommunikationssituationen bedingt durch Faktoren wie Gedchtnis, Konzentration, Mdigkeit etc. mehr oder weniger
einwandfreien Gebrauch machen, wollen wir als sprachliche Performanz bezeichnen.Definition 1.6. sprachliche Performanz
Performanz nennt man den Gebrauch, den ein Sprecher/Hrer in einer konkretenKommunikationssitiation von seiner Kompetenz macht, mglicherweise beein-trchtigt durch Faktoren wie Begrenztheit des Gedchtnisses, Konzentrations-mngel, Mdigkeit, Alkohol etc.
Im folgenden soll an einigen Beispielen verdeutlicht werden, wie sich die sprachliche Kompe-tenz eines Muttersprachlers manifestiert. Sie uert sich u. a. in folgendem. Der kompetenteSprecher kann16
1. ber die Identitt zweier uerungen entscheiden;2. in gewissen Grenzen Ausdrcke korrekt segmentieren, d. h. z. B. eine Folge von Lauten
korrekt in einzelne Ausdrcke (z. B. Wrter) zerlegen;
3. entscheiden, ob ein Ausdruck grammatisch ist oder nicht;
4. die Bedeutungsgleichheit von Ausdrcken sowie die Ambiguitt eines Ausdrucksfeststellen, z. B. die Ambiguitten in den Beispielen
(1.2.) Der Mann berrascht den Liebhaber im Schlafanzug.
(1.3.) Der Vater lt die Kinder fr sich sorgen.
16Die folgenden Ausfhrungen basieren weitgehend auf GREWENDORF/HAMM/STERNEFELD1989:32ff.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
18/180
14 Kapitel 1
5. Grade der sprachlichen Abweichung unterscheiden, wie sie in zunehmendem Mae inden folgenden Beispielen vorliegt:
(1.4.) (a) Klaus kommt aus Fallingbostel.(b) Klaus kommt aus Liebe.(c) Klaus kommt aus Liebe und aus Fallingbostel.
(d) Von mir wird ein Film gesehen.(e) Er hat aus Berlin gestammt.(f) Ich habe gestrzt.(g) Er sagte, da du hast in Italien gelebt.(h) Mancher in Deutschland wollen gehen in Italien.(i) Huming la burbu loris singen vorn.
6. Typen sprachlicher Abweichung unterscheiden, wie etwa in den Beispielen (1.4.)(f) und(1.4.)(g);
7. Unterschiede in den strukturellen Beziehungen innerhalb von Stzen erkennen, z. B. dieUnterschiede zwischen
(1.5.) Lehrer sind schwer zu berzeugen.
(1.6.) Schler sind bereit zu arbeiten.
Ursprnglich hat Chomsky die Kompetenz als Fhigkeit, Stze zu bilden und zu verstehen,der Performanz als dem Gebrauch, der von dieser Fhigkeit unter dem Einflu von mglicher-weise strenden Faktoren gemacht wird, unterschieden.
Nun gibt es aber einen anderen Aspekt der Sprachverwendung, der nicht unter der Performanzzu subsumieren ist, insofern er regelhaft ist und somit zur sprachlichen Kompetenz in einemweiteren Sinne gehrt. Es handelt sich hier um eine Kompetenz, die sich nicht auf die
Beherrschung der sprachlichen Konstruktionsmittel bezieht, sondern auf die kompetenteVerwendungsweise korrekt gebildeterStze in den angemessenen Kontexten. Diese Art vonKompetenz betrifft also Fhigkeiten wie sie sich etwa darin uern
8. da der kompetente Sprecher die uerung
(1.7.) Ich verspreche dir, da ich dir das Buch morgen zurckbringe.
unter entsprechenden Umstnden als ein Versprechen versteht und zu einemVersprechen verwenden kann;
9. da er den Unterschied beurteilen kann zwischen
(1.8.) Kannst du mir helfen, den Schrank hochzutragen?
(1.9.) Kannst du mir wenigstens helfen, den Schrank hochzutragen?
10. da er die uerung bei Tisch
(1.10.) Kannst du mir das Salz reichen?
nicht nur mit ja beantwortet und sonst nichts tut;
11. da er die uerung
(1.11.) Klaus ist ein Lgner, aber ich glaube nicht, da er ein Lgner ist.
als merkwrdig auffat;
12. da er die uerung
(1.12.) Klaus wei, da Peter Maria liebt, aber Peter liebt Maria nicht.
als in irgendeinem Sinne abweichend empfindet;
13. da er einen Akzeptabilittsunterschied zwischen den folgenden Beispielen feststellt;
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
19/180
Allgemeine Grundbegriffe 15
(1.13.) Klaus und Maria haben geheiratet. Er ist blond und sie ist fast schwarz.
(1.14.) Ich habe mir heute eine Schreibmaschine und einen Computer gekauft. Sie ist rot
und er ist fast schwarz.
14. da er den Logbucheintrag des Steuermanns in folgender Anekdote als eine
Diffamierung des Kapitns versteht: Der Kapitn ist erbost ber die Trunkenheit desSteuermanns und trgt ins Logbuch ein:
(1.15.) 8. 1. 86: Der Steuermann ist heute betrunken.
Als der wieder nchtern gewordene Steuermann diesen Eintrag liest, rgert er sich, undschreibt darunter:
(1.16.) 8. 1. 86: Der Kapitn ist heute nicht betrunken.
Chomskys Kompetenzbegriff ist hufig kritisiert worden, weil er diese regelhaften Aspekteder Sprachverwendung nicht ausreichend bercksichtige. So wurde ihm der Begriff der kom-munikativen Kompetenz (HABERMAS 1971; HYMES1972) gegenbergestellt.
Chomsky selbst gesteht inzwischen zu, da eine Theorie des sprachlichen Wissens durch eineTheorie der Sprachverwendung zu ergnzen ist. Er unterscheidet entsprechend zwischen einerGRAMMATISCHEN und einer PRAGMATISCHEN Kompetenz. Erstere entspricht dem, was wiroben als sprachliche Kompetenz definiert haben.
Definition 1.7.pragmatische Kompetenz
Pragmatische Kompetenz bezeichnet die Fhigkeit, auf der Grundlage einer gram-matischen Kompetenz korrekt gebildete Stze situationsangemessen und zweck-entsprechend zu verwenden.
Um den Unterschied noch einmal an einem Beispiel zu illustrieren: Whrend wir aufgrundpragmatischer Kompetenz verstehen, auf wen sich bei entsprechendem Kontext sie im
folgenden Beispiel bezieht(1.17.) Sie glaubt, da Maria schwanger ist.
verstehen wir aufgrund grammatischer Kompetenz, da diese durch sie bezeichnete Personeine andere als die schwangere Maria ist.
Die Aufgabe des Linguisten ist nach Chomsky primr die Rekonstruktion der die Kompetenzkonstituierenden Regelbeherrschung von Muttersprachlern.
1.2.6.2. E-Sprache und I-Sprache
In neueren Arbeiten stellt Chomsky (CHOMSKY, 1987:ch. 2) zwei Sprachbegriffe einandergegenber, die in der modernen Linguistik eine wesentliche Rolle gespielt haben und immernoch spielen: EXTERNALISIERTE SPRACHE (E-SPRACHE; externalized (E-)language) undINTERNALISIERTE SPRACHE (I-SPRACHE; internalized (I-)language).17 Die E-Sprachen-Linguistik, wie sie hauptschlich aus der Tradition des amerikanischen "taxonomischen"Strukturalismus bekannt ist, hat zum Ziel, mehr oder weniger umfangreiche Sprachproben zusammeln (sog. Corpora) und dann deren Eigenschaften zu beschreiben. Eine E-Sprache ist eineSammlung von Stzen, aufgefat als Objekte, die unabhngig von mentalen Eigenschaften vonSprechern existieren. E-Sprachen-Forschung konstruiert eine Grammatik, welche die in einersolchen Sprachprobe enthaltenen Regularitten beschreiben soll. Eine Grammatik ist etwasgegenber der Sprache Sekundres. Sie ist eine Sammlung von deskriptiven Aussagen ber dieE-Sprache. Die Aufgabe des Linguisten ist es, in die Menge der externen Fakten, welche die
17Vgl. Cook (1988: 12ff.)
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
20/180
16 Kapitel 1
Sprache ausmachen, Ordnung zu bringen. Die resultierende Grammatik wird auf der Grundlage
der Eigenschaften solcher Daten als Menge von Strukturmustern (engl.patterns) beschrieben.
Die I-Sprachen-Linguistik hingegen beschftigt sich mit dem, was ein Sprecher ber Sprachewei, und woher dieses Wissen kommt. Sie betrachtet Sprache als eine interne Eigenschaft desmenschlichen Geistes und nicht als etwas Externes. Die Grammatik besteht aus Prinzipien und
Parametern.Chomsky behauptet, da in der jngsten Geschichte der Linguistik eine Verschiebung in derSprachbetrachtung von der E-Sprache zur I-Sprache stattgefunden hat, wobei letztere als einSystem aufgefat wird, das im Geist (im Gehirn) eines einzelnen Individuums reprsentiert ist(CHOMSKY, 1988: 36). Das Ziel der I-Sprachen-Forschung ist es, diesen mentalen Zustand zureprsentieren. Eine Grammatik beschreibt das (intuitive) Sprachwissen, und nicht die Stze,die auf dessen Grundlage hervorgebracht worden sind. Der Erfolg dieses Ansatzes mit sichdarin, wie gut die Grammatik das Sprachwissen als Eigenschaften des menschlichen Geisteserfat und erklrt. Die theoretischen Anstze Chomskys gehren in die Tradition derI-Sprachen-Forschung.
Zum E-Sprachen-Ansatz gehren nicht nur Theorien, welche die physische Manifestation derSprache in den Vordergrund stellen, sondern auch solche, die Sprache als soziales Phnomenbehandeln, als eine Menge (oder ein System) von Handlungen oder Verhaltensweisen. DieErforschung der E-Sprache setzt einen Satz mit anderen externen Phnomenen in Beziehung:mit der (E-)Sprache, die seiner uerung vorangegangen ist, mit der Situation, die zumZeitpunkt der uerung vorlag, und mit den sozialen Beziehungen zwischen dem Sprecherund dem Hrer. Sie konzentriert sich mehr auf das soziale Verhalten zwischen den Menschenals auf deren innere psychologische Welt. Ein Groteil der Forschung in der Soziolinguistikoder der Gesprchsanalyse fllt in den Rahmen der E-Sprachen-Forschung, insofern sie sichmehr auf soziale als auf geistige Phnomene bezieht.
Die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Forschungsanstzen whrt schon seit einigerZeit und wurde mit ziemlicher Schrfe gefhrt. Sie hat auch die anderen Disziplinenbeeinflut, die mit der Linguistik in enger Beziehung stehen. Das Lager Spracherwerbs-forscher teilt sich in jene auf, die Interaktion und kommunikative Funktion in denVordergrund stellen und jene, die nach Regeln und Prinzipien forschen. Sprachlehrer knnenin solche eingeteilt werden, die E-Sprachen-Methoden propagieren und Kommunikation undVerhalten betonen und solche, die I-Sprachen-Methoden verfechten und Sprachwissen frwichtiger halten, wobei erstere zur Zeit Oberwasser haben. Computer-Linguisten knnenebenfalls grob in zwei Lager eingeteilt werden: diejenigen, die riesige Mengen vonSprachdaten analysieren (Corpuslinguisten) und diejenigen, die Regeln schreiben.
E-Sprache vs I-SpracheSprachproben (Corpora) aus tatschlichgeuerten Ausdrcken
Einzelne fr den Zweck konstruierteStze
Beschreibt Merkmale der Probe mitHilfe von aus den Daten gewonnen'Strukturmustern', etc.
Beschreibt mentale Aspekte auf derBasis von Prinzipien
Soziale Konvention Mental Realitt
'Verhalten' 'Wissen'
Die externe Situation Die interne Reprsentation
Pragmatische oder kommunikativeKompetenz
Grammatische Kompetenz
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
21/180
Allgemeine Grundbegriffe 17
Ein E-Linguist sammelt Proben von tatschlich Gesprochenem und tatschlich beobachtetemVerhalten. Seine Evidenz besteht aus konkreter physischer Manifestation. Ein I-Linguisterfindet mgliche und unmgliche Stze; seine Evidenz besteht in den Urteilen vonSprechern ber die Grammatikalitt dieser Stze. Der E-Linguist verachtet den I-Linguistenwegen seiner (angeblichen) Miachtung 'realer' Fakten; der I-Linguist macht sich ber den
E-Linguisten lustig, weil er ber Trivialitten forscht (Erbsenzhler).Das obige Diagramm fat die Unterschiede zwischen E-Sprache und I-Sprache zusammen.
Beobachten und Beschreiben(in Umgangssprache)
Sammeln vonSprachelementen(Laute, Morpheme,Wrter,Syntagmen)
Hypothesen bersystem. Zs. hnge;z.B. Klassenbildung,Regeln (in Arbeits-terminologie)
EmpirischeTtigkeit;induktivesVorgehen
TheoretischeTtigkeit;deduktivesVorgehen
berprfen am Material
System von Hypothesen = Theorie berdas Phnomen (in Terminologie); z.B.Sprachtheorie ber "die" Sprache oderGrammatik und zugeordnetes Lexikonals Theorie ber eine Einzelsprache
besttigte, modifizierteoder neue Hypothesen
Methodologie der empirischenVerfahren; z.B. Entdeckungs-prozeduren, Informantenbefra-gung, Quellenstudium
Prinzipien der Theoriebildung,orientiert an der Wissenschafts-geschichte des Faches und anwissenschaftstheoretischenGrundstzen
Theorie ber die Linguistik
"die" Sprache:Menschen reden
Einzelsprachen(Muttersprachen)
Phnomen
Linguistik
Abb. 1.10. Linguistische Ttigkeiten(nach Bnting)
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
22/180
18 Kapitel 1
1.3. Linguistik als Wissenschaft
Nachdem wir uns nher mit der Frage beschftigt haben, was Sprache ist, soll es in dennchsten Abschnitten darum gehen, was es heit, einen Gegenstand wissenschaftlich zubehandeln, was also die wissenschaftlichen Merkmale eines linguistischen Ansatzes der
Erforschung von Sprache sind.Was in der Linguistik als wissenschaftlich gelten soll, hngt in gewissem Mae von denphilosophischen Ansichten ihrer Vertreter ab. (s.o.)
In anderen wissenschaflichen Disziplinen auerhalb der Sprachwissenschaft besteht weit-gehend bereinstimmung darber, da Forschung EXAKT, SYSTEMATISCHund OBJEKTIV seinmu um als wissenschaftlich anerkannt zu werden.
1.3.1. EXAKTHEIT
Um das Kriterium der Exaktheit zu erfllen, mu eine Aussage, Definition usw. eindeutig undvollstndig formuliert werden und darf nicht Gegenstand subjektiver Auslegung sein. Auchdie Annahmen, auf welchen die Forschung basiert, mssen klar dargelegt und so gestaltetsein, da die Zwischenstufen einer Argumentation durchschaubar sind. Fachtermini mssenprzise und konsistent definiert sein.
1.3.2. SYSTEMATIK
Eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte einer wissenschaftlichen Auseinander-setzung mit dem Gegenstand Sprache findet sich bei Karl-Dieter Bnting (BNTING1987:12ff). Sie ist in graphischer Darstellung in Abb. 1.10.wiedergegeben.
Danach knnen drei Grundkomponenten der wissenschaftlichen Arbeit des Linguisten unter-schieden werden (dargestellt in den drei stark umrandeten Ksten):
1. der zu untersuchende Gegenstandsbereich (Etikett: Phnomen)
2. die Fachdisziplin selbst (Etikett: Linguistik)3. die wissenschaftstheoretischen Grundlagen dieser Fachdisziplin
(Etikett: Theorie der Linguistik)
Zwischen den einzelnen Komponenten bestehen Wechselwirkungen, die durch Pfeile in beideRichtungen angedeutet werden. Man kann ein Phnomen nicht ohne Reflexion ber die zuverwendeten Methoden und ohne allgemein-wissenschaftliche Grundaxiome als Bezugs-punkte beschreiben, und man kann andererseits eine Theorie nicht ohne Bezug auf empirischeDaten aufstellen und berprfen.
1. Das Phnomen
Mit dem Gegenstandsbereich, den die Linguistik untersucht, haben wir uns in den vorange-gangenen Abschnitten bereits ausfhrlich beschftigt. Im Diagramm werden zweiBedeutungen von 'Sprache' unterschieden: Einerseits geht es um die Sprache als allgemeinmenschliche Fhigkeit, andererseits um spezifische Einzelsprachen wie sie von Mitgliederneiner Sprachgemeinschaft als Muttersprache gesprochen werden. Bei jeder Beobachtung desPhnomens Sprache wird eine Einzelsprache beobachtet.
2. Linguistik
Im Linguistik-Kasten ist angedeutet, da die Linguistik einerseits eine empirische Wissen-schaft ist; d. h. sie setzt sich mit einem Teil der realen Welt auseinander und beschftigt sichnicht blo mit abstrakten Gedankengebuden. Sie ist andererseits aber auch eine theoretischeDisziplin, insofern sie ihren Gegenstandsbereich in der Form von zusammenhngendenTheorien zu beschreiben versucht.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
23/180
Allgemeine Grundbegriffe 19
Entsprechend kann zwischen einer EMPIRISCHEN und einer THEORETISCHEN Ttigkeit desLinguisten unterschieden werden (die kleinen Kstchen links und rechts vom Linguistik-Kasten).
Die empirische Ttigkeit besteht im
Beobachten und zunchst informellen Beschreiben (von Ausschnitten) des Material-objektes (des Phnomens);
Sammeln von einzelnen Beobachtungsdaten (sprachliche uerungen in gesprochenerund geschriebener Form; einzelne Sprachelemente wie Laute, Wrter, Wortgruppen,mit allen, auch den individuellen Eigenschaften) und Notieren aufflliger Merkmale;Zusammenstellen des Sprachmaterials in sog. Korpora;
berprfen von Hypothesen am Material
Die Vorgehensweise im Rahmen der empirischen Ttigkeit ist weitgehend INDUKTIV, d.h. siegeht vom Besonderen zum Allgemeinen. Der Wissenschaftler ordnet und systematisiert seineBeobachtungen zunchst nach Kriterien, die er in den Daten selbst findet, z.B. indem erWrter mit orthographisch gleichen Endungen zu Klassen zusammenfat. In einem weiteren
Schritt werden vergleichbare Beobachtungen durch Verallgemeinerung zu Hypothesenzusammengefat.
Die theoretische Ttigkeit besteht in
der Bildung von verallgemeinerten Hypothesen
der Zusammenfassung von empirisch besttigten Hypothesen zu Theorien
Die Vorgehensweise im Rahmen der theoretischen Ttigkeit ist DEDUKTIV, d.h. sie geht vomAllgemeinen zum Besonderen. Zwar ist die Verallgemeinerung von Beobachtungen zu(empirischen) Hypothesen ber das Phnomen z. B. Regeln ber die Wortstellung inStzen ein induktiver Schritt. Wenn jedoch nach der Bercksichtigung relativ wenigerSprachdaten bereits Hypothesen formuliert und systematische Zusammenhnge konstatiert
und postuliert werden, die eigentlich erst zu verifizieren sind, geht man primr deduktiv vor.Als Ergebnis solcher Ttigkeiten sollte eine Theorie ber das Phnomen entstehen, in dersowohl die allgemeinen als auch die individuellen, nur einzelnen Elementen zukommendenEigenschaften des Materialobjektes systematisch erfat sind. Von einer solchen vollstndigenTheorie ber die Sprache ist die Linguistik allerdings noch weit entfernt.
3. Theorie der Linguistik
Die im engeren Sinne linguistischen Ttigkeiten bentigen als Fundament eine Theorie derLinguistik, die wiederum an der Wissenschaftstheorie orientiert sein mu. Die Theorie derLinguistik sollte eine allgemeine Methodologie der empirischen Verfahren und geeignetePrinzipien der Theoriebildung zur Verfgung stellen.
1.4. Linguistik als Erfahrungswissenschaft
Die Linguistik ist eine empirisch-theoretische Wissenschaft. Sie ist eine empirischeWissenschaft (Erfahrungswissenschaft), insofern Erfahrungen am Objekt Sprache ihre Basissind. Sie ist eine theoretische Wissenschaft, insofern sie ber die Beschreibung der uerenEigenschaften ihres Objektes hinaus seine allgemeinen Gesetzmigkeiten erfassen will, unddies ist nur ber eine Theorie mglich. Das Ziel der Linguistik wie anderer Wissenschaften istes, von der Erscheinung ihres Objekts zu seinem Wesen vorzudringen.18
18Dies entspricht der Unterscheidung zwischen Materialobjekt (Erscheinung) und Formalobjekt (Wesen).
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
24/180
20 Kapitel 1
Definition 1.8.Erscheinung
Unter Erscheinung versteht man die Gesamtheit der ueren Eigenschaften derDinge, Prozesse usw., die uns durch die Sinne, durch die Anschauung, dieunmittelbare Erfahrung gegeben sind. (KLAUS/ BUHR1971, s.v. Erscheinung)
Definition 1.9. Wesen
Unter Wesen versteht man die Gesamtheit der allgemeinen, invariantenBestimmungen [Merkmale] eines Dinges, Prozesses usw., die diesem not-wendigerweise zukommen. Das Wesen ... ist im Gegensatz zur Erscheinung derSinneserkenntnis nicht unmittelbar zugnglich. (KLAUS/BUHR1971, s.v. Wesen)
Das Wesen der Dinge manifestiert sich in der Erscheinung und ist nur ber die Analyse derErscheinung erkennbar.
Den allgemeinen Begriffen Erscheinung und Wesen entsprechend hat Noam Chomsky(CHOMSKY1964: 28ff.) in die Linguistik die Begriffe linguistische Daten und linguistische
Fakten eingefhrt. Zur Verdeutlichung des Unterschiedes ein Beispiel:Linguistische Daten:
Die Formen brick, glum, trick und blue kommen in der englischen Sprache vor (pos.Evidenz).
Die Formen *bnick, *plam, *tlick, *dnag, *groth, *clorn *gneam /gni:m/ und *dlopkommen in der englischen Sprache nicht vor (neg. Evidenz).
Im Englischen existiert die Form brick (= Ziegelstein), die Formen blick und bnick kommendagegen nicht vor. Das sind Feststellungen von linguistischen Daten. Daten umfassen alsosowohl die Existenz als auch die Nicht-Existenz von Erscheinungen. Die Analyse dieser und
weiterer Daten zeigt nun, da generell in Anlautverbindungen nnur mit s zulssig ist (z.B.snick Kerbe; die Verbindungen kn-, gn- werden /n/ gesprochen), da lnur in Verbindung miteinem Dental (ausgenommen s) nicht zulssig ist (*tlick, *dlick, aber slick 'glatt') und da rnur in Verbindung mitsnicht zulssig ist (*srick). Lt man die Verbindung mitsauer acht,kann man allgemein formulieren:
a.nkommt in Anlautverbindungen nicht vor;
b. lkommt nur in Anlautverbindungen mit Dental nicht vor.
Das sind Aussagen ber linguistische Fakten.
Die Nicht-Existenz von blick und bnick hat also verschiedenen Status; im Falle von blick ist siezufllig (blick ist nach den Gesetzmigkeiten der englischen Sprache mglich), im Falle von
bnick ist sie SYSTEMATISCH(bnick ist nach den Gesetzmigkeiten des Englischen nicht mglich).Aussagen ber Fakten sind theoretische Aussagen. Inwieweit solche Aussagen das Wesentreffen, mu die Praxis erweisen. Da die Anlautgesetze wesenhafte Zge der englischenSprache beschreiben: zeigt z.B. die Behandlung von Anlautverbindungen in Fremd- undKunstwrtern:
a. In Fremdwrtern werden Anlautverbindungen, die den Anlautgesetzen widersprechen,verndert: Fremdwrter mitps-z.B. (psychology, psalm) werden /s-/ ausgesprochen.
b. Es werden nur Kunstwrter mit Anlautverbindungen gebildet, die nach den Anlaut-gesetzen zulssig sind.
Hauptaufgabe der deskriptiven Linguistik ist die Beschreibung linguistischer Fakten. DieErkenntnis linguistischer Fakten ist nur mglich ber die Analyse linguistischer Daten. Dieerste Aufgabe des Linguisten besteht somit in der Sicherung seiner Daten. Insoweit ist seineTtigkeit rein empirisch.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
25/180
Allgemeine Grundbegriffe 21
Zur Bewertung linguistischen Tuns hat Noam Chomsky Adquatheitskriterien vorgeschlagen,fr die korrekte Wiedergabe der Daten das Kriterium der BEOBACHTUNGSADQUATHEIT:
Definition 1.10.Beobachtungsadquat
Eine linguistische Beschreibung, die nur die Daten korrekt wiedergibt, wird
BEOBACHTUNGSADQUAT genannt. (CHOMSKY1964: 29)
Die Ttigkeit des Linguisten ist eine theoretische, wenn es um die Erkennung undBeschreibung linguistischer Fakten geht. Eine Beschreibung, welche die linguistischen Faktenkorrekt darstellt, nennt Chomsky BESCHREIBUNGSADQUAT:
Definition 1.11.Beschreibungsadquat
Eine linguistische Beschreibung, die die Fakten korrekt wiedergibt und damit die
Daten erklrt, wird BESCHREIBUNGSADQUAT genannt.
1.5. Theorie
In dem zunehmenden Mae, wie die Linguistik versucht, eine exakte Wissenschaft zu sein,werden Aussagen ber ihre Gegenstnde in Form von zusammenhngenden THEORIENformuliert.
Definition 1.12. Theorie
Eine THEORIE ist ein System von HYPOTHESEN oder eine Menge von solchenSystemen, die zur ERKLRUNG bestimmter Phnomenenbereiche entwickeltwerden.
Definition 1.13.Hypothese
Eine HYPOTHESE ist eine empirische Verallgemeinerung ber einer Menge vonBeobachtungsdaten.
Wir knnen zumindest vier Phasen der Theoriebildung unterscheiden.
1. Sammlung und Beschreibung von empirischen Daten
2. Hypothesenbildung
3. Theoriebildung
4. berprfung
PHASE 1
Beobachtungen ber bestimmte Phnomene (Daten) werden gesammelt, beschrieben undklassifiziert. So knnen wir z.B. beobachten, da bestimmte Holzgegenstnde in Wasserschwimmen, whrend bestimmte (feste) Metallgegenstnde untergehen. Zum Zwecke derBeschreibung und Klassifizierung von Beobachtungsdaten werden Beschreibungssprachengeschaffen (z.B. das phonetische Alphabet und die Terminologie der artikulatorischenPhonetik). Das Resultat der Phase 1 ist eine Beschreibung und Klassifizierung einer Mengevon Beobachtungsdaten.
PHASE 2
Auf der Grundlage einer Sammlung von beschriebenen und klassifizierten Beobachtungsdatenknnen wir versuchen Hypothesen zu bilden, wobei eine Hypothese eine empirische
Verallgemeinerung ber die beobachteten Daten ist. Um bei unserem Beispiel zu bleiben:Nachdem wir in einer groen Anzahl von Fllen festgestellt haben, da feste Holzgegenstndein Wasser schwimmen, whrend feste Metallgegenstnde untergehen, bilden wir die Hypo-
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
26/180
22 Kapitel 1
thesenAlle festen Holzgegenstnde schwimmen in Wasser undAlle festen Metallgegenstndegehen in Wasser unter. Wir sehen jedoch noch keinen Zusammenhang zwischen diesenHypothesen.
PHASE 3
Das grundlegende Ziel der Theoriebildung ist es, verschiedene Hypothesen durch allgemeine
Prinzipien miteinander in Beziehung zu setzen, und so eine Erklrung fr die gemachtenBeobachtungen zu erhalten. Diese zur Erklrung herangezogenen Prinzipien werdenTHEORETISCHE KONSTRUKTE genannt. In unserem Beispiel wird das unterschiedlicheVerhalten von hlzernen und metallischen Gegenstnden durch das gleiche allgemeinePrinzip, das wir SPEZIFISCHES GEWICHT nennen, erklrt. Das spezifische Gewicht ist dierelative Dichte einer Substanz, d.h. das Verhltnis der Dichte einer Substanz und der einerVergleichssubstanz (normalerweise Wasser). Mit dem Begriff (theoretischen Konstrukt) desspezifischen Gewichtes knnen nun die beiden Hypothesen
1. Alle Holzgegenstnde schwimmen in Wasser
2. Alle festen Metallgegenstnde gehen in Wasser unter
auf sehr allgemeine Weise miteinander in Beziehung gebracht werden: Alle festen Krper,deren spezifisches Gewicht kleiner ist als das einer bestimmten Flssigkeit, schwimmen indieser Flssigkeit.
PHASE 4
Die berprfung von Theorien. Theorien werden berprft, indem man sie zu falsifizierenversucht. Der Wissenschaftler versucht Flle zu finden, die durch die Theorie nicht erklrtwerden oder im Widerspruch zu den Vorhersagen der Theorie stehen. Eine Theorie ist gltig,solange sie nicht falsifiziert worden ist. In unserem Beispiel kann die Hypothese, da allefesten Metallgegenstnde in Wasser untergehen, durch die Beobachtung falsifiziert werden,
da Natrium in Wasser schwimmt. Es handelt sich hier jedoch um eine Falsifizierung derursprnglichen Hypothese alle Metallgegenstnde gehen unter, aber nicht der Theorie. Dennmit dem theoretischen Konstrukt des spezifischen Gewichts wird auch das Verhalten vonNatrium erklrt, dessen spezifisches Gewicht (0.97) kleiner als das von Wasser (1.00) ist.
1.6. Grundbegriffe der Modellbildung
Sehr hufig wird in neuerer Zeit fr Theorie im oben definierten Sinne die BezeichnungMODELL verwendet und statt von Theoriebildung spricht man entsprechend von Modell-bildung. In den folgenden Abschnitten sollen die wichtigsten Grundbegriffe der Modell-bildung dargelegt werden.
1.6.1. DER MODELLBEGRIFFWie viele andere fr uns relevante Wrter der Alltagssprache auch wird das Wort Modell inunterschiedlichen Kontexten mit ganz unterschiedlicher Bedeutung verwendet.
Journalisten sprechen vom Modellweltkrieg und meinen die Fuballweltmeisterschaft. Wer-beagenten formulieren: Unsere Reisen sind Modelle des gesunden Urlaubs. Kulturpolitikersprechen vomModell der Einheitsschule und vomModell der Gesamtschule, Wahlredner von
Modellen fr die siebziger Jahre, ein politischer Kommentator vom Schrder-Modell der Ge-waltenteilung und hessische Kommunalpolitiker vom neuen Modell fr die Raumplanung,Theologen sprechen vom Modell einer komenischen Kirche, Mediziner erarbeiten Thera-
pienmodelle fr Drogenabhngige und eine Zeitschrift nennt sichModelle fr eine neue Welt.Darber hinaus gibt es eine Flle von standardsprachlichen Zusammensetzungen, in denen
das WortModell vorkommt; nur einige Beispiele: Modelleisenbahn, Modellplanung, Modell-charakter, Modellbau, Flugzeugmodell, Modellexperiment, Modellkleid, Modellpappe,
Schichtenmodell und Klassenmodell der Gesellschaft, Modellhaftigkeit, modellartig, Photo-
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
27/180
Allgemeine Grundbegriffe 23
modell und Studienmodell. Auch ist es blich geworden, die verschiedensten kulturellen, so-zialen und politischen Programme als Modell zu bezeichnen und einen kennzeichnendenOrtsnamen hinzuzufgen; ein bekanntes Beispiel istHonnefer Modell.(WIEGAND1974:90)
Wir stehen hier also vor einem hnlichen Problem wie bei der Analyse des Wortes Sprache.Die folgendende Definition des Modellbegriff ist allgemein genug, um eine Reihe verschie-
dener Verwendungsweisen zusammenzufassen.Definition 1.14.Modell
Ein MODELL ist ein Objekt (ein Gegenstand, ein materielles oder symbolischesSystem), das auf der Grundlage einer Struktur-, Funktions- oder Verhaltensanalogiezu einem entsprechenden Original von einem Subjekt (z.B. einem Menschen)eingesetzt und genutzt wird, um eine bestimmte Aufgabe lsen zu knnen, derenDurchfhrung mittels direkter Operationen am Original zunchst oder berhauptnicht mglich bzw. unter gegebenen Bedingungen zu aufwendig ist.Die Funktion des Modells ergibt sich im Rahmen eines aus Subjekt (S), Original (O)und Modell (M) bestehenden MODELLSYSTEMSin Abhngigkeit von der gegebenenZielstellung des Subjekts (z.B. den Erkenntnisinteressen eines Forschers)...(nach KLAUS/BUHR1971, s.v. Modell).
Als Modelle knnen sowohl materielle (natrliche oder technische) Objekte als auch Zeichen-systeme auftreten. Natrliche Modelle sind z.B. Versuchstiere in der medizinischenForschung und Ausbildung. Eine knstliche Niere ist ein technisches Modell fr eine echte
Niere. Eine mathematische Formel wie IU
R= , ist ein Zeichenmodell fr den Zusammenhang
zwischen Stromstrke I, Spannung U und Widerstand Rin einem Stromkreis, d.h. fr einenphysikalischen Proze.
Damit ein Objekt, egal ob materiell oder ideell, als Modell fr ein Original dienen kann, mues hnlichkeiten (Analogien) mit dem Original aufweisen. Diese Analogien betreffenentweder die Struktur, die Funktionoder das Verhaltendes Originals. Man kann entsprechendzwischen Struktur-, Funktions- und Verhaltensmodellen unterscheiden.
SVerhalten
O
informationelleBeziehungen
Analogien
M
O = Modelloriginal
S = ModellsubjektM = Modell
Abb. 1.11. Schematische Darstellung des Modellsystems
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
28/180
24 Kapitel 1
Strukturmodelle
Fr ein Strukturmodell ist charakteristisch, da es das Original unter dem Aspekt seinerStruktur betrachtet. Unter Struktur wird hier allgemein eine Menge von Beziehungen(Relationen) zwischen den Elementen eines Systems verstanden. Als Beispiel mge einStadtplan dienen, der Modell fr einen Wirklichkeitsausschnitt ist.
Modellsubjekt
Modell
Modelloriginal
StrukturelleAnalogie
Abb. 1.12. Stadplan als Strukturmodell
Die Elemente, die hier im Modell reprsentiert sind, sind Objekte wie Gebude und Straen,die dem Benutzer zur Orientierung in der Wirklichkeit dienen knnen. Dabei bleibt eineMenge von Informationen unbercksichtigt: es wird von der genauen stofflichen Beschaffen-heit dieser Objekte abstrahiert, sie werden nur zweidimensional dargestellt, ihre absoluteGre wird relativiert. Das Modell ist ein Zeichenmodell, das das Original graphisch abbildet.Was bei dieser graphischen Abbildung erhalten bleiben mu, ist die relative geographischeLage der Objekte, wobei Relationen wie nrdlich von, westlich von, sdlich von etc. imOriginal im Modell durch oberhalb von, links von, unterhalb von etc. ersetzt werden.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
29/180
Allgemeine Grundbegriffe 25
Funktionsmodelle
Modellsubjekt Modelloriginal
Nasen-lcher
Lippen
Mundhhle
Zunge
WeicherGaumen
Rachenhhle
Stimmbnder
Lungen-volumen
Atemdruck
Modell
FunktionaleAnalogie
Abb. 1.13. Funktionsmodell
Klassifikation von Modellen:
1. Nach dem Analogieinhalt: Struktur-, Funktions- oder Verhaltensmodelle
2. Nach der Modellfunktion:
Erkenntnisgewinnung: gesucht werden neue Informationen ber das Original. Das
Studium des Modells liefert zunchst neue Erkenntnisse ber das Modell, aus denendurch Analogieschlu hypothetisch auf entsprechende Eigenschaften des Originalsgeschlossen wird. Beispiel: Tierexperimente in der Medizin
Erklrung und Demonstration: Demonstrationsmodelle; Fallbeispiele Projektierung: Konstruktionszeichnungen, Architekturmodelle, virtual reality Steuerung: Ersatzfunktion: knstliche Gliedmaen oder Organe; Herz-Lungen-Maschine
1.6.2. MODELLMETHODE
Definition 1.15.Modellmethode
Methode, mit deren Hilfe ein Subjekt einen bestimmten Typ von Aufgaben lst,indem es ein Modell als analogen Reprsentanten bestimmter Eigenschaften desOriginals zweckentsprechend herstellt und im wesentlichen zur Informations-gewinnung ber das Original benutzt. (KLAUS/BUHR1971: s.v. Modellmethode)
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
30/180
26 Kapitel 1
Abb. 1.14. Schema eines Modells frErkenntnisgewinnung in drei Phasen
Phasen der Modellkonstruktion (nach KLAUS/BUHR1971: s.v. Modellmethode):
1. Auswahl oder Herstellung eines zweckentsprechenden Modells, ausgehend von dergegebenen Aufgabe, den Eigenschaften des Originals und den Bedingungen der Situation;
2. Bearbeitung des Modells zwecks Gewinnung von zustzlichen Informationen ber dasModell, insbesondere Modellexperiment;
3. Analogieschlu oder andersartige Ableitung von Informationen ber das Original,ausgehend von 2. und vom Inhalt der gegebenen Modellrelation;
4. Durchfhrung der Aufgabe direkt gegenber dem Original durch Nutzung der Ergebnissevon 3. zugleich als ihre Verifizierung und als Entscheidungsgrundlage ber die gegebenen-falls zyklische Fortsetzung des Prozesses mit 1. in Richtung schrittweiser verbesserterModellvarianten.
Dieser Teil ist in Arbeit
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
31/180
Allgemeine Grundbegriffe 27
1.7. Wissenschaftssprache
1.7.1. ALLTAGSSPRACHE UND WISSENSCHAFTSSPRACHE
Eine Theorie mu sprachlich ausgedrckt werden.
Definition 1.16. Wissenschaftssprache
Die Gesamtheit der sprachlichen Mittel einer Wissenschaft mit den Regeln frderen Gebrauch nennt man WISSENSCHAFTSSPRACHE.
Die Grundlage einer Wissenschaftssprache ist immer die Alltagssprache. Gerade die Eigen-schaften der Alltagssprache, die ihre Flexibilitt als Kommunikationsmittel ausmachen,machen sie als Wissenschaftssprache jedoch ungeeignet: Wie wir bereits mehrfach gesehenhaben, sind viele Wrter der Alltagssprache mehrdeutig, ihre Bedeutung ist oft unscharf; dieAlltagssprache enthlt Synonyme etc. Die Begriffe der Wissenschaftssprache mssen jedocheindeutig und genau sein. Die Wissenschaftssprache versucht diese Nachteile der Alltags-sprache zu berwinden, indem sie eine spezielle TERMINOLOGIE verwendet, die fr die
jeweilige Wissenschaft genau definierte Begriffe bezeichnet. Durch eine solche Terminologiewird neben der Eindeutigkeit auch eine krzere und damit bersichtlichere Ausdrucksweisemglich.
1.7.2. THEORETISCHE UND METATHEORETISCHE BEGRIFFE
Definition 1.17. Theoretische Begriffe
Begriffe, die sich auf den von einer Theorie beschriebenen Gegenstand beziehen,und die somit unmittelbare Bestandteil der Theorie sind, werden THEORETISCHEBegriffe genannt.
Theoretische Begriffe der Sprachtheorie sind z.B.: Satz, Wort, Relativpronomen, Phonem etc.Daneben sind auch Begriffe erforderlich, die Eigenschaften der Theorie selbst erfassen, mitdenen man also ber Theorien spricht.
Definition 1.18.Metatheoretische Begriffe
Begriffe mit denen man ber Eigenschaften von Theorien spricht werdenMETATHEORETISCHE Begriffe genannt.
Metatheoretische Begriffe der Sprachtheorie sind z.B.: Transformationsregel, Struktur-beschreibung, Regelschema, Symbolkette, grammatische Kategorie etc.
1.7.3. OBJEKTSPRACHE UND METASPRACHEDie Wissenschaftssprache ist die Sprache, mit der eine Wissenschaft ber ihre Gegenstndespricht. Betrachten wir zunchst die Verwendung der Wissenschaftssprache durch denNicht-Linguisten. Der Chemiker, z.B., verwendet Sprache um ber Gegenstnde zu sprechen,die keine Sprache sind. Die Sprache, die er dazu verwendet, unterscheidet sich jedoch von derAlltagssprache. Es ist eine besondere Sprache mit einem speziellen Vokabular, einerTerminologie. Es ist ein Teil der Sprache, die wir Wissenschaftssprache genannt haben.Nehmen wir folgendes Beispiel:
(1.18.) Natriumchlorid ist ein Salz
Natriumchlorid ist ein chemischer Terminus, den wir in der Alltagssprache nicht verwenden.
In einem Spezialwrterbuch wrden wir als Bedeutung Salz finden. Was passiert jedoch,wenn wir im BeispielNatriumchlorid durch Salz ersetzen?
(1.19.) Salz ist ein Salz.
-
7/22/2019 Wagner Grundkurs Sprachwissenschaft UniBremen1997
32/180
28 Kapitel 1
Das ist etwas seltsam.19Fr den Chemiker hat das Wort Salz eine besondere und allgemeinereBedeutung.
(1.20.) Salz ist eine Substanz, die durch die Reaktion einer Sure mit einer Baseentsteht.
Noch genauer knnte diese Aussage wie folgt formuliert werden:(1.21.) In der Chemie wird das Wort Salz zur Bezeichnung jeder Substanz verwendet,die durch die Reaktion einer Sure mit einer Base entsteht.
Damit sollte deutlich geworden sein, da auch der Nichtlinguist Sprache in zweierleiFunktionen verwendet. Er verwendet Sprache, um ber Gegenstnde zu sprechen, die selbstnicht Sprache sind. Die Sprache, die er zu diesem Zweck verwendet, wird OBJEKTSPRACHEgenannt.
Definition 1.19. Objektsprache
Der Teil der Wissenschaftssprache, mit der man ber nicht-sprachliche Ge-
genstnde einer Wissenschaft spricht, wird OBJEKTSPRACHE genannt.Der Wissenschaftler verwendet Sprache jedoch auch, um ber Sprache zu sprechen, z.B. berdie Objektsprache seiner Wissenschaft. Das kann notwendig sein, um z.B. die Bedeutungeines bestimmten Terminus zu definieren, wie im obigen Beispiel.
Objektsprache(Fachterminologie)
linguistische Objektsprache(Alltagssprache)
Naturwissenschaften Linguistik
Metasprache der 1. Stufe(z.B. normale Sprache)
linguistische Beschreibungssprache(Fachterminologie)
Metasprache der 2. Stufe linguistische Metasprache
(linguistische Methodologie)
Metasprache der n-ten Stufe Metasprache der 2. Stufe
auersprachliche Gegenstnde
Abb. 1.15. Objektsprache und Me