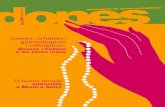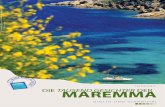Wahlsystemen und Sprachminderheiten de
-
Upload
oskar-peterlini-phd -
Category
Documents
-
view
247 -
download
21
description
Transcript of Wahlsystemen und Sprachminderheiten de
-
1
Wahlsysteme und
Sprachminderheiten
Die Auswirkungen von Wahlsystemen auf die Vertretung von Sprachminderheiten im
Parlament am Beispiel Sdtirols
Zustzliches Forschungsprojekt
und drittes Studienjahr 2009 - 2010
zwecks Anerkennung des Studientitels in Italien
des akademischen Grades
eines Forschungsdoktorates der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
an der Fakultt fr Politikwissenschaften und Soziologie
der Leopold Franzens Universitt Innsbruck
Eingereicht von
Oskar Peterlini
Erstbegutachter: Univ. Prof. DDr. Gnther Pallaver (Politikwissenschaften)
Weitere Begutachter: Univ. Prof. B.A. PhD Alan Scott (Soziologie)
Univ. Prof. Dr. Gottfried Tappeiner (Volkswirtschaft und Statistik)
Innsbruck, im September 2010
-
2
Peterlini, O. (2010): Wahlsysteme und Sprachminderheiten, Die Auswirkungen von Wahlsystemen auf die Vertretung
von Sprachminderheiten im Parlament am Beispiel Sdtirols -
Sistemi elettorali e minoranze linguistiche, Le ripercussioni dei sistemi elettorali sulla rappresentanza delle minoranze
linguistiche in Parlamento sullesempio delle minoranze dellAlto Adige Sdtirol. Leicht aktualisierter Nachdruck 7.5.2012.
Forschungsprojekt/ Progetto di ricerca di dottorato, Leopold Franzens Universitt Innsbruck
2010, Wiedergabe nur mit ausdrcklicher Erwhnung des Verfassers und der Quellenangabe.
Riproduzione concessa solamente con la citazione dellautore e della fonte. Kontakt/ Contatto: [email protected], [email protected].
-
3
An meine Izumi
An meine Kinder Michael, Sylvia, Elisabeth und Laurin
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
4
Wahlsysteme sind seltsame Gerte - gleichzeitig Kameras und
Projektoren. Sie registrieren Bilder, die sie teilweise selbst erstellt haben.
Electoral systems are strange devices - simultaneously cameras and
projectors. They register images which they have partly created
themselves. Maurice Duverger (1984)
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
5
Zusammenfassung
Die Wahlsysteme wirken sich direkt auf die Vertretung der Parteien im Parlament aus.
Besondere Auswirkungen haben Wahlgesetze auf ethnische Minderheiten. Sie knnen eine
Minderheit strken, schwchen oder ganz aus dem Parlament verdrngen.
Sdtirol wurde nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Italien geschlagen. Schon 1921
errangen die Sdtiroler vier Abgeordnete im Parlament in Rom. Eine Wahlreform der
Faschisten reduzierte ihre Vertretung zunchst auf zwei (1924) und brachte sie dann zum
Verschwinden. Nach dem Zweiten Weltkrieg garantiert der Pariser Vertrag zwischen Italien
und sterreich von 1946 der Sdtiroler Minderheit eine Autonomie. Bei allen politischen
Wahlen seit 1948 errangen die Sdtiroler eine Vertretung im nationalen Parlament (von
fnf, manchmal sogar sechs Mitgliedern). Seitdem hat Italien mehrere Wahlreformen
vorgenommen. Von einem fast reinen Proporz-System schritt Italien 1993 zu einem
kombinierten System. Drei Viertel der Sitze wurden im Mehrheitswahl-System gewhlt, ein
Viertel im Verhltniswahl-System, mit einer Wahlhrde1 von vier Prozent. Die Sdtiroler,
die nur einen halben Prozent ausmachen, rekurrierten dagegen, blitzten allerdings sei es
beim Verfassungsgerichtshof als bei der Europischen Kommission fr Menschenrechte ab.
Sie behielten ihre Vertretung ber die Mehrheits-Wahlkreise.
Neuerdings, im Jahre 2005, nderte das Parlament erneut das Wahlsystem und kehrte
wieder zu einem Proporz-System zurck, mit abgestuften Wahlhrden und einer
Mehrheitsprmie fr die siegreiche Liste oder Koalition.
Die Vertretungen der Sdtiroler im Parlament, nach der Annexion der Deutsche Verband
(DV) und seit 1948 die Sdtiroler Volkspartei (SVP), waren direkt von den
Wahlnderungen betroffen. Teilweise konnten sie sich nur mit Sonderbestimmungen retten.
Diese erzielten sie mit Berufung auf die internationale Verankerung der Sdtirol Autonomie
und den Minderheitenschutz in der italienischen Verfassung. Als typische ethnoregionale
Parteien eignen sich der DV und die SVP deshalb besonders, um die Auswirkungen von
Wahlsystemen empirisch zu untersuchen. 1 Wahlhrde, Schwelle, Sperrklausel oder Prozentklausel werden in dieser Studie synonym verwendet.
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
6
Summary
Electoral systems and linguistic minorities
The impact of electoral systems on the representation of linguistic minorities in the
parliament by the example of South Tyrol
The electoral systems in general, directly influence the representation of the parties in
Parliament. They have certain consequences for ethnic minorities. These include the
strengthening, the weakening or the eliminations of the minorities.
After the First World War the southern part of Tyrol (Sdtirol) was annexed to Italy. South
Tyrolean succeeded (1921) in electing four representatives to Parliament in Rome. A fascist
electoral reform reduced their representation first (1924) to two and cancelled it later on
completely. After the Second World War the so called Paris Agreement signed in 1946
between Italy and Austria grants autonomy to the population of South Tyrol. In all the
political elections, since 1948, the South Tyrolean have been able to gain a representation
(of five or even six members) in the national Parliament. Since then, Italy has made a
number of election reforms. From an almost proportional system Italy passed to a combined
system in 1993. Three quarters of the seats were elected by the majority system, one quarter
by the proportional system with a threshold (minimum allowance) of four percent. The
South Tyrolean, which counts for just a half percent on national level appealed against the
minimum threshold low, but lost in front of the Italian Constitutional Court and then the
European Commission of Human Rights. Although they did not succeed for the
proportional part of seats, they were able to save their representation in the Parliament
through the majority system in the constituencies. Recently, in 2005, the Parliament
changed the electoral low again and returned to a proportional system, with degrees of
thresholds and a premium for the winning party or coalition.
The representations of the South Tyrolean in the Parliament, after the annexation the so
called Deutscher Verband (DV), since 1948 the Sdtiroler Volkspartei (SVP), have been
directly affected by the changes of the electoral system. They could survive in part only
with special provisions. These special provisions could be reached by appealing to the
international anchored autonomy and the protection of ethnic minorities founded in the
Constitution. The DV and the SVP can be taken as good examples of typical ethno regional
parties, in order to examine the effects of electoral systems on ethnic minorities.
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
7
Keywords
Abgeordnetenkammer / Autonomiestatut / Camera dei Deputati / Deutscher Verband
/ Italia Italien / Ethnische Minderheiten / Parlament / Region / Trentino Sdtirol /
Alto Adige / Senat / Sperrklausel / Sdtiroler Minderheit / Sdtiroler Volkspartei /
Wahlkreise / Wahlsystem
*
Autonomy / Chamber of deputies / Constituencies / Deutscher Verband / Electoral
Reform / Electoral system / Ethnic minorities / Italian Parliament / Italy / Region /
Senate / South-Tyrol / Special Autonomy / South Tyrolean minority / Special Statute
/ Sdtiroler Volkspartei / Threshold / Trentino
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
9
Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung .............................................................................................................................. 5
Summary ............................................................................................................................................. 6 Einfhrung und Problemstellung ................................................................................................... 15 1 Untersuchungsobjekt und Abgrenzung des Themas ............................................................ 15 2 Die zentrale Frage und die Thesen ......................................................................................... 19 3 Theoretischer und methodischer Zugang .............................................................................. 20
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze und Auswirkungen ................................................ 23 1.1 Die Wahlsysteme und ihre Typologien .............................................................................. 23
1.1.1 Was sind Wahlsysteme? ....................................................................................................................... 23 1.1.2 Was ist Wahlrecht? .............................................................................................................................. 25 1.1.3 Was regeln Wahlsysteme? ................................................................................................................... 26 1.1.4 Die Wahlkreiseinteilung ....................................................................................................................... 28 1.1.5 Die Wahlsysteme nach der Stimmenverrechnung: Majorz und Proporz .............................................. 30 1.1.6 Das Mehrheitswahlsystem (Majorz-System) ....................................................................................... 31 1.1.7 Das Verhltniswahlsystem (Proporz-System) ...................................................................................... 38 1.1.8 Methoden der Mandatszuteilung beim Proporz .................................................................................. 40 1.1.9 Klassische und kombinierte Wahlsysteme aus Majorz und Proporz .................................................... 55
1.2 Die Grundstze des Europarates ........................................................................................ 59 1.2.1 Die Venedig-Kommission .................................................................................................................... 59 1.2.2 Der Verhaltenskodex fr Wahlen ......................................................................................................... 60 1.2.3 Die Bedingungen fr die Umsetzung der Grundstze .......................................................................... 62 1.2.4 Die Grundstze des Europarates fr das Wahlrecht von nationalen Minderheiten .............................. 65
1.3 Die Wahlsysteme und ihre Auswirkungen im Allgemeinen .............................................. 66 1.3.1 Die Auswirkungen auf die Wahlergebnisse ......................................................................................... 66 1.3.2 Der Einfluss auf das Verhalten der Whler .......................................................................................... 70 1.3.3 Die Auswirkungen auf die Parteien ..................................................................................................... 70
2 Auswirkungen auf die Vertretung von Minderheiten .......................................................... 75 2.1 Nationale Minderheiten und ethnoregionale Parteien ........................................................ 75
2.1.1 Nationale Minderheiten und Wahlsysteme .......................................................................................... 75 2.1.2 Ethnoregionale und regionale Parteien................................................................................................. 76
2.2 Direkte Garantien fr Minderheiten oder Volksgruppen ................................................... 80 2.2.1 Kroatien ................................................................................................................................................ 80 2.2.2 Slowenien ............................................................................................................................................. 81 2.2.3 Rumnien ............................................................................................................................................. 82 2.2.4 Belgien ................................................................................................................................................. 84 2.2.5 Bosnien-Herzegowina .......................................................................................................................... 86 2.2.6 Weitere Lnder mit Vertretungsrechten ............................................................................................... 90
2.3 Bestimmungen, welche die Vertretung erleichtern ............................................................ 91 2.3.1 Polen .................................................................................................................................................... 91 2.3.2 Deutschland .......................................................................................................................................... 92 2.3.3 Italien ................................................................................................................................................... 94
2.4 Auswirkungen auf nationale Minderheiten mit politischen Parteien ................................. 96 2.4.1 Die griechische Minderheit in Albanien .............................................................................................. 96 2.4.2 Die trkische Minderheit in Bulgarien ................................................................................................. 98 2.4.3 Die Minderheiten in der Trkei ............................................................................................................ 99 2.4.4 Das multiethnische Georgien ............................................................................................................. 101 2.4.5 Die Auswirkungen der Wahlsysteme auf ethnoregionale Parteien .................................................... 104
2.5 Auswirkungen auf nationale Minderheiten ohne politischen Parteien ............................ 107 2.6 Schlussfolgerungen ber die Auswirkungen von Wahlsystemen auf die Minderheiten . 108
3 Auswirkungen auf die Vertretung der Sdtiroler 1921-2013 ............................................ 113 3.1 Das Wahlsystem unter dem Knigreich Italien ............................................................... 113 3.2 Die Vertretung Sdtirols in Rom vom Knigreich bis zum Faschismus ......................... 117
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
10
3.2.1 Die Annexion und der Zusammenschluss zum Deutschen Verband .................................................. 117 3.2.2 Die ersten Wahlen von 1921 .............................................................................................................. 117 3.2.3 Die Wahlreform von 1923 und der Untergang der Demokratie ......................................................... 122 3.2.4 Die Parlamentswahlen 1924 und das Ende der Demokratie ............................................................... 125
3.3 Der Aufbau der Republik und das demokratische Italien nach dem Krieg .................... 132 3.3.1 Die demokratische Verfassung und das Parlament Italiens nach 1948 .............................................. 132 3.3.2 Die Regionen und die Lokalkrperschaften ....................................................................................... 134 3.3.3 Die Sonderautonomien und die Region Trentino Sdtirol ................................................................. 135 3.3.4 Das Wahlrecht im demokratischen Italien von 1945 bis 1993 ........................................................... 137 3.3.5 Die sogenannte Erste Republik .......................................................................................................... 144
3.4 Das Ringen der Sdtiroler um Autonomie und Parlamentsvertretung ........................... 145 3.4.1 Die Sdtiroler Minderheit im Ringen um eine Autonomie ................................................................ 145 3.4.2 Die Grndung der SVP als Sammelpartei .......................................................................................... 147 3.4.3 Die erste Feuerprobe bei der Wahl im Jahr 1948 ............................................................................... 148 3.4.4 Die Wahlen von 1953 bis 1987 im berblick .................................................................................... 156
3.5 Die Neueinteilung der Senatswahlkreise in der Region 1991.......................................... 161 3.5.1 Die Manahme 111 des Sdtirol-Paketes .......................................................................................... 161 3.5.2 Die Verhandlungen zur Durchfhrung der Manahme 111 des Paketes............................................ 163 3.5.3 Der Durchbruch und das Gesetz zur Neueinteilung ........................................................................... 170 3.5.4 Die Auswirkungen auf die Senats-Wahlen von 1992 und die Ergebnisse in der Kammer ................ 170 3.5.5 Das Gesamtergebnis fr Kammer und Senat 1992 ............................................................................ 174
3.6 Die Wahlrechts-Reform von 1993 ................................................................................... 175 3.6.1 Die Sitzverteilung im Proporzsystem der Kammer ........................................................................... 178 3.6.2 Die Sitzverteilung im Proporzsystem des Senates ............................................................................ 180
3.7 Die Auswirkungen der Reformen auf die Wahlen von 1994 bis 2001 ............................ 182 3.7.1 Die Parlamentswahlen von 1994 auf staatlicher Ebene...................................................................... 182 3.7.2 Die Sperrklausel in der Wahlreform und die Verfahren dagegen ...................................................... 184 3.7.3 Die Auswirkungen auf die Parlamentswahlen in Sdtirol 1994 ......................................................... 194 3.7.4 Die Auswirkungen auf die Parlamentswahlen 1996 .......................................................................... 197 3.7.5 Die Auswirkungen auf die Parlamentswahlen 2001 .......................................................................... 202
3.8 Die Wahlreform von 2005 und die Sonderbestimmung fr Sdtirol ............................... 207 3.8.1 Die Sperrklausel und das Ringen um eine Ausnahmeregelung .......................................................... 207 3.8.2 Seit der Reform von 2005: Proporz in Kammer und Senat ............................................................... 209 3.8.3 Das neue Wahlsystem fr die Abgeordnetenkammer ........................................................................ 210 3.8.4 Das neue Wahlsystem fr den Senat .................................................................................................. 217
3.9 Die Auswirkungen der Reform von 2005 auf die Wahlen............................................... 219 3.9.1 Die Kammer-Wahlen von 2006 ......................................................................................................... 219 3.9.2 Die Wahlen im Senat 2006 ................................................................................................................ 222 3.9.3 Die Senatswahlen 2008 und die blockfreie SVP ............................................................................. 226 3.9.4 Der Alleingang der SVP in der Kammer im Jahr 2008 ...................................................................... 230
3.10 Die Wahlen im berblick: 1921 2008 .......................................................................... 233 3.10.1 Die Minderheit im langfristigen Vergleich ....................................................................................... 233 3.10.2 Die Parlamentarier aus Sdtirol in Rom 1921 bis 2013 .................................................................... 238
4 Anstze zur Reform des Wahlsystems in Italien und der Minderheitenschutz ............... 241 4.1 Die Reform-Versuche von Mitte Rechts 2001-2006 ....................................................... 241
4.1.1 Die divergierenden Ziele von Lega und Forza Italia/Alleanza Nazionale......................................... 241 4.1.2 Der Verfassungsentwurf von Mitte-Rechts ........................................................................................ 241 4.1.3 Der gescheiterte bergang zu unterschiedlichen Kammern .............................................................. 242 4.1.4 Die Wahlreform von Mitte-Rechts ..................................................................................................... 243
4.2 Die Anlufe zur nderung des Wahlgesetzes 2006 -2008 .............................................. 245
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
11
4.2.1 Der Druck fr ein neues Wahlsystem ................................................................................................ 245 4.2.2 Die Parlamentswahlen von 2006 ........................................................................................................ 245 4.2.3 Ein unterschiedliches Wahlsystem im Senat ...................................................................................... 248 4.2.4 Die Stolpersteine im Senat ................................................................................................................. 249 4.2.5 Das Damokles-Schwert Referendum ................................................................................................. 250 4.2.6 Die Grundstze der damaligen Mehrheit fr ein neues Wahlrecht..................................................... 251 4.2.7 Die Kleinparteien gegen das Referendum .......................................................................................... 251 4.2.8 Die Grundstze des Ex-Ministers Chiti von Mitte-Links ................................................................... 252 4.2.9 Die mglichen gemeinsamen Punkte fr eine Wahlreform ................................................................ 253 4.2.10 Die Vorbehalte der Rechtsparteien .................................................................................................... 255 4.2.11 Der Reformvorschlag von Roberto Calderoli von Mitte-Rechts ....................................................... 255 4.2.12 Sonder-Klausel fr sprachliche Minderheiten .................................................................................... 258 4.2.13 Die Gemeinsamkeiten in den Vorstellungen fr das Wahlgesetz ...................................................... 258 4.2.14 Der Gesetzentwurf Bianco ................................................................................................................. 259 4.2.15 Sonderregelung fr Sdtirol ............................................................................................................... 260
4.3 Die Reduzierung der Parteien und die neue Legislatur ab 2008 ...................................... 261 4.3.1 Das Referendum, die Justizaffre und die Regierungskrise ............................................................... 261 4.3.2 Die Wahlen von 2008 vereinfachen die politische Landschaft .......................................................... 262 4.3.3 Mangelnde Beteiligung am Referendum ............................................................................................ 264
4.4 Kritik am bestehenden Wahlgesetz in Italien .................................................................. 266 4.4.1 Proporz mit starken Einschrnkungen ................................................................................................ 266 4.4.2 Demokratiepolitische Mngel bei den sprachlichen Minderheiten .................................................... 266 4.4.3 Demokratische Reprsentanz des Parlamentes in Frage gestellt ........................................................ 267 4.4.4 Starke Parteien, aber schwaches Parlament ....................................................................................... 268 4.4.5 Die Macht der Parteien ist schwierig zu brechen ............................................................................... 271 4.4.6 Ausblick auf mgliche Neuerungen des Wahlsystems ...................................................................... 271
5 Schlussfolgerungen und Erkenntnisse ................................................................................. 273 5.1 berprfung der Thesen .................................................................................................. 273
5.2 Detail-berprfung am historischen Ablauf .................................................................... 276 5.2.1 Nach der Annexion und im Faschismus: Abhngig vom Wahlkreis .................................................. 276 5.2.2 Nach dem Krieg bis 1993: Kammer im Proporzsystem ..................................................................... 276 5.2.3 Senat bis 1992: Wahlkreise mit 65% Hrde und Proporzausgleich ................................................... 277 5.2.4 nderungen der Wahlkreise 1992 fr den Senat ................................................................................ 278 5.2.5 Vorwiegend Majorz von 1993 bis 2005 ohne Hrde im Senat .......................................................... 279 5.2.6 Vorwiegend Majorz von 1993 bis 2005 auch in Kammer.................................................................. 279 5.2.7 Proporz mit Hrden und Mehrheitsprmie in der Kammer seit 2005 ................................................ 280
5.3 Eine empfindliche Schraube ............................................................................................ 282
6 Literatur, Quellen und Hinweise zum Autor....................................................................... 285 6.1 Literatur, Quellen und Abkrzungen ............................................................................... 285
6.1.1 Bcher und Buchbeitrge ................................................................................................................... 285 6.1.2 Agenturen, Zeitungen, Zeitschriften .................................................................................................. 293 6.1.3 Verfassungen, Gesetze, Archive und Internet-Seiten ......................................................................... 294 6.1.4 Ethnoregionale und italienische Parteien ........................................................................................... 303 6.1.5 Abkrzungsverzeichnis ...................................................................................................................... 305
6.2 Dank und Hinweise zum Autor ........................................................................................ 307 6.2.1 Dank ................................................................................................................................................... 307 6.2.2 Lebenslauf von Oskar Peterlini .......................................................................................................... 308 6.2.3 Bcher und Buchbeitrge des Autors ................................................................................................ 309
6.3 Eidesstattliche Erklrung ................................................................................................. 315
Tabellenverzeichnis Tab. 1: Vergleich von Divisoren oder Hchstzahlverfahren .................... Fehler! Textmarke nicht definiert.
Tab. 2: Slowenien: Nationale Zugehrigkeit und Muttersprache der grten Gruppen ................................. 81
Tab. 3: Lnder-bersicht ber Wahlsysteme, Hrden, Prmien und Minderheiten-Schutznormen ............ 110
Tab. 4: Abgeordnetenkammer 15. Mai 1921 Wahlkreis Bozen (Sdtirol) ............................................. 120 Tab. 5: Abgeordnetenkammer 15. Mai 1921 Wahlkreis Trentino .......................................................... 121 Tab. 6: Abgeordnetenkammer 6. April 1924: Verteilung der Minderheitensitze im Veneto ....................... 129
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
12
Tab. 7: Verhltnis der Sprachgruppen in Sdtirol ........................................................................................ 147
Tab. 8: Kammer 18. April 1948 Gesamtergebnis Region Trentino Sdtirol ............................................. 150 Tab. 9: Kammer 18. April 1948 Sdtirol ................................................................................................... 151 Tab. 10: Senat 18. April 1948 Wahlkreis Bozen ........................................................................................ 152 Tab. 11: Senat 18. April 1948 Wahlkreis Brixen ....................................................................................... 152 Tab. 12: Senat 18. April 1948 Gesamtergebnis Region Trentino Sdtirol ................................................. 154 Tab. 13: Die Bevlkerung Sdtirols und des Trentino .................................................................................. 161
Tab. 14: Regierungsvorschlge Cossiga Rognoni: Simulation mit Wahlergebnissen 1987 .......................... 165
Tab. 15: Senat 5. April 1992 - Wahlkreis Bozen Unterland .......................................................................... 171
Tab. 16: Senat 5. April 1992 Gesamtergebnis Region Trentino Sdtirol ................................................... 172 Tab. 17: Senat/Region: DC und MSI/AN von 1979-1992 ............................................................................ 173
Tab. 18: Kammer - Verhltniswahlsystem: Vergabe von Mandaten (1. Schritt) .......................................... 178
Tab. 19: Kammer Verhltniswahlsystem: Vergabe von Mandaten (2. Schritt) ......................................... 179 Tab. 20: Senat Mandatsvergabe .................................................................................................................. 180 Tab. 21: Abgeordnetenkammer 27. Mrz 1994 Gesamtergebnisse Italien................................................. 183 Tab. 22: Abgeordnetenkammer 27.Mrz 1994, Proporz-Wahlen Trentino Sdtirol ..................................... 188
Tab. 23: Abgeordnetenkammer 27. Mrz 1994, Proporz-Wahlen ganz Italien ............................................. 188
Tab. 24: Abgeordnetenkammer 27.Mrz 1994, Wahlkreis Bozen Leifers .................................................... 194
Tab. 25: Senat 27. Mrz 1994 Wahlkreis Bozen Unterland ....................................................................... 196 Tab. 26: Senat 21.April 1996, Wahlkreis Bozen Unterland .......................................................................... 197
Tab. 27: Abgeordnetenkammer 21. April 1996 Wahlkreis Bozen ............................................................. 199 Tab. 28: Abgeordnetenkammer 21.April 1996, Proporz-Wahlen ganz Italien .............................................. 201
Tab. 29: Abgeordnetenkammer 21. April 1996, Proporz-Wahlen Trentino Sdtirol .................................... 202
Tab. 30: Abgeordnetenkammer 13. Mai 2001, Proporz-Wahlen ganz Italien ............................................... 203
Tab. 31: Abgeordnetenkammer 13.Mai 2001, Proporz-Wahlen Trentino Sdtirol ....................................... 204
Tab. 32: Abgeordnetenkammer 13. Mai 2001 - Wahlkreis Bozen Leifers .................................................... 205
Tab. 33: Senat 13. Mai 2001 Wahlkreis Bozen Unterland ......................................................................... 205 Tab. 34: Abgeordnetenkammer 9. April 2006 Wahlbezirk Trentino Sdtirol ............................................. 220 Tab. 35: Senat 9. April 2006 Wahlkreis Bozen Unterland ......................................................................... 224 Tab. 36: Senat 13./14. April 2008 - Wahlkreis Bozen Unterland .................................................................. 227
Tab. 37: Abgeordnetenkammer 13. 14. April 2008 Wahlbezirk Trentino Sdtirol .................................... 230 Tab. 38: Die Wahlergebnisse des DV von 1921-1924 .................................................................................. 233
Tab. 39: Wahlsysteme und Ergebnisse der SVP von 1948-2008 .................................................................. 235
Tab. 40: Deutschsprachige Parlamentarier aus Sdtirol vom Knigreich bis zum Faschismus 1921-1939 . 238
Tab. 41: Italienischsprachige Parlamentarier aus Sdtirol vom Knigreich bis zum Faschismus: 1921-1939
....................................................................................................................................................................... 238
Tab. 42: Deutschsprachige Parlamentarier aus Sdtirol im demokratischen Italien (alle SVP) ................... 239
Tab. 43: Italienischsprachige Parlamentarier aus Sdtirol im demokratischen Italien .................................. 240
Tab. 44: Abgeordnetenkammer 9. April 2006 Knapper Sieg fr Prodi ...................................................... 246 Tab. 45: Die politischen Fraktionen in der Abgeordneten-Kammer nach den Wahlen 2008 ........................ 263
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
13
Abbildungsverzeichnisverzeichnis Abb. 1: Zweck von Wahlsystemen .................................................................................................................. 17
Abb. 2: Auswirkungen von Wahlsystemen ..................................................................................................... 18
Abb. 3: Definition von Wahlsystem ................................................................................................................ 23
Abb. 4: Wahlsysteme im engeren Sinn ........................................................................................................... 24
Abb. 5: Definition des Wahlrechtes ................................................................................................................ 25
Abb. 6: Missbrauch von Wahlsysteme ............................................................................................................ 26
Abb. 7: Die Einteilung der Wahlsysteme nach Majorz und Proporz............................................................... 30
Abb. 8: Die Klassifizierung der Wahlsysteme nach Nohlen ........................................................................... 31
Abb. 9: Die Mehrheitswahl ............................................................................................................................. 31
Abb. 10: Gliederung des Majorz ..................................................................................................................... 32
Abb. 11: Relative Mehrheitswahl in Grobritannien ...................................................................................... 33
Abb. 12: Wahlkreise in Grobritannien .......................................................................................................... 33
Abb. 13: Absolute Mehrheitswahl in Frankreich ............................................................................................ 34
Abb. 14: Wahlkreise in Frankreich.................................................................................................................. 35
Abb. 15: Auswirkungen der Mehrheitswahl .................................................................................................... 36
Abb. 16: Die fnf Mehrheitswahl-Systeme nach Nohlen ................................................................................ 37
Abb. 17: Verhltniswahl .................................................................................................................................. 38
Abb. 18: Die fnf Verhltniswahl-Systeme nach Nohlen ............................................................................... 39
Abb. 19: Natrliche und normative Hrden .................................................................................................... 40
Abb. 20: Zuteilung der Sitze im Verhltnis der Stimmen ............................................................................... 40
Abb. 21: Was sind Mandats- oder Sitzzuteilungsmethoden? .......................................................................... 41
Abb. 22: Die zwei Methoden der Mandats- oder Sitzzuteilung beim Proporz ................................................ 41
Abb. 23: Die Schtzung der Wahlzahl ............................................................................................................ 42
Abb. 24: Ein Beipiel fr das DHondt-Verfahren .......................................................................................... 43 Abb. 25: Das Verfahren nach DHondt ........................................................................................................... 44 Abb. 26: Die Berechnung der Wahlzahl (Wahlquotienten) ............................................................................. 49
Abb. 27: Zuteilung der vollen Sitze im Wahlzahl-Verfahren .......................................................................... 50
Abb. 28: Formel fr Berechnung und Zuteilung der Sitze .............................................................................. 51
Abb. 29: Das Quotenverfahren ........................................................................................................................ 52
Abb. 30: Zuteilung der Restmandate ............................................................................................................... 53
Abb. 31: Auswirkungen der Verfahren auf kleine Gruppen ............................................................................ 54
Abb. 32: Grundstzliche, vereinfachte Einteilung der Wahlsysteme .............................................................. 55
Abb. 33: Kombinierte Systeme ....................................................................................................................... 56
Abb. 34: Die Einer-Wahlkreise in Deutschland .............................................................................................. 56
Abb. 35: Wahlsystem Deutschlands ............................................................................................................... 57
Abb. 36: Kombiniertes vorwiegendes Mehrheitswahlsystem in Italien 1993-2005 ........................................ 58
Abb. 37: Sitzverteilung im Deutschen Bundestag nach der Wahl 2009 .......................................................... 93
Abb. 38: Italien nach der Einigung ................................................................................................................ 113
Abb. 39: Nur wenige waren wahlberechtigt .................................................................................................. 114
Abb. 40: Das Parlament im Knigreich Italien ............................................................................................. 115
Abb. 41: Wahlsystem und Wahlkreise 1921 ................................................................................................. 118
Abb. 42: Giolitti gewhrt eigenen Wahlkreis fr Sdtirol ............................................................................ 119
Abb. 43: Das Listenzeichen des DV bei den Wahlen 1921 ........................................................................... 119
Abb. 44: Wahlberechtigte und Wahlausgang 1921 ....................................................................................... 120
Abb. 45: Kleiner Wahlkreis ermglichte vier Abgeordnete .......................................................................... 121
Abb. 46: Das Acerbo Gesetz ......................................................................................................................... 122
Abb. 47: Sdtirol wehrt sich gegen die Wahlreform ..................................................................................... 123
Abb. 48: Der Antrag zur Tagesordnung der Sdtiroler Abgeordneten ......................................................... 124
Abb. 49: Das Listenzeichen des DV 1924 ..................................................................................................... 126
Abb. 50: Wahlbezirk Veneto fr die Wahlen 1924 ...................................................................................... 127
Abb. 51: Der Stimmzettel 1924 ..................................................................................................................... 127
Abb. 52: Wahlen 1924: Sdtirols Vertretung halbiert ................................................................................... 128
-
Zusammenfassung und Inhaltverzeichnis
14
Abb. 53: Folgen des Mehrheitsbonus im Veneto .......................................................................................... 129
Abb. 54: Die Parlamentswahlen 1924 ........................................................................................................... 130
Abb. 55: Die schrittweise Abschaffung der Demokratie ab 1924 ................................................................. 131
Abb. 56: Das Wahlrecht im demokratischen Italien ...................................................................................... 132
Abb. 57: Die Verfassungsgebende Versammlung 1946-1947 in Montecitorio ............................................. 133
Abb. 58:Die demokratische Verfassung von 1948 ........................................................................................ 133
Abb. 59: Die fnf Regionen mit Sonderstatut ............................................................................................... 136
Abb. 60: Die Grundstze des Wahlrechtes in der italienischen Verfassung ................................................. 137
Abb. 61: Das perfekte Zweikammernsystem ................................................................................................ 138
Abb. 62: Erste Wahlmodalitten und Dauer der Legislatur-Periode ............................................................. 139
Abb. 63: Das Wahlrecht fr die Kammer 1948-1993 ................................................................................... 140
Abb. 64: Senat 1948 1993 .......................................................................................................................... 141 Abb. 65: Das sogenannte Betrugsgesetz ........................................................................................................ 142
Abb. 66: Die Wahlsysteme Italiens seit 1948 ................................................................................................ 143
Abb. 67: Der Proporz wird fr die Kammer auf Staatsebene berechnet ....................................................... 149
Abb. 68: Die Wahlergebnisse im berblick: Trentino Sdtirol Kammer 1948 ............................................ 151
Abb. 69: Die Wahlergebnisse im berblick: Senat Bozen Meran 1948 ...................................................... 153
Abb. 70: Die Wahlergebnisse im berblick: Senat Brixen 1948 ................................................................. 153
Abb. 71: Proporz fr verfehltes Quorum im Senat ........................................................................................ 154
Abb. 72: Die Wahlergebnisse im berblick: Gesamtergebnis Trentino Sdtirol Senat 1948 ....................... 155
Abb. 73: Die Manahme 111 des Paketes und die Neueinteilung der Senatswahlkreise .............................. 169
Abb. 74: Die ersten Ergebnisse im neuen Senatswahlkreis Bozen Unterland ............................................... 173
Abb. 75: Das Gesamtergebnis im berblick. Trentino Sdtirol Senat 1992 ................................................. 174
Abb. 76: Die Wahlreform in Italien von 1993 im berblick......................................................................... 181
Abb. 77: Ein Viertel des Parlamentes wurde (1993-2005) im Proporz gewhlt ........................................... 184
Abb. 78: Klage beim Verfassungsgericht gegen die 4 Prozentklausel .......................................................... 187
Abb. 79: Protestkandidatur von Magnago 1994 ............................................................................................ 187
Abb. 80: Rekurs der SVP wegen Verletzung der Menschenrechte ............................................................... 193
Abb. 81: Der umkmpfte Senatswahlkreis Bozen Unterland 1996 ............................................................... 198
Abb. 82: Der umkmpfte Senatswahlkreis Bozen Unterland 2001 ............................................................... 206
Abb. 83: Der Entwurf des Wahlgesetzes gefhrdete Minderheiten............................................................... 207
Abb. 84: Sonderregelungen fr Minderheiten 2005 ...................................................................................... 208
Abb. 85: Das aktuelle Wahlsystem in Italien ................................................................................................ 209
Abb. 86: Das Wahlgesetz von 2005: Proporz mit Prmie in Kammer und Senat ......................................... 210
Abb. 87: Sperrklauseln fr Kammer.............................................................................................................. 211
Abb. 88: berblick ber die Sitzzuteilung in der Kammer ........................................................................... 212
Abb. 89: Beispiel fr die Berechnung der Wahlzahl in der Kammer ............................................................ 213
Abb. 90: Die Erstverteilung der Sitze laut Parlamentswahlen von 2008 ....................................................... 213
Abb. 91: Neuberechnung des Wahlquotienten fr die Mehrheit und die Minderheit ................................... 215
Abb. 92: Die Berechnung der Mandate aufgrund des Mehrheitsbonus ......................................................... 215
Abb. 93: Die Berechnung der Mandate fr die Verliererlisten ..................................................................... 216
Abb. 94: Sperrklauseln fr den Senat ............................................................................................................ 217
Abb. 95: Die breit angelegte Koalition Unione SVP gewinnt im Wahlkreis ................................................ 225
Abb. 96: Die SVP im Senatswahlkreis Bozen Unterland 1992 2008 ......................................................... 228 Abb. 97: SVP in Senatswahlkreisen Brixen-Pustertal und Meran-Vinschgau 1992 2008 ......................... 229 Abb. 98: Abgeordnetenkammer 2008 - Verteilung der 277 Sitze der Verlierer-Listen ................................ 231
Abb. 99: SVP-Wahlergebnisse in Prozenten 1948-2008 ............................................................................... 237
Abb. 100: Die Abgeordnetenkammer 2006-2008 ......................................................................................... 247
Abb. 101: Der Senat der Republik von 2006- 2008 ...................................................................................... 249
Abb. 102: Die Abgeordnetenkammer nach den Wahlen 2008 ...................................................................... 263
Abb. 103: Der Senat nach den Wahlen 2008 ................................................................................................. 264
-
Einfhrung und Problemstellung
15
Einfhrung und Problemstellung
1 Untersuchungsobjekt und Abgrenzung des Themas
Unser Untersuchungsobjekt sind die Wahlsysteme und ihre Auswirkungen auf sprachliche
Minderheiten. Wir wollen das Thema am Beispiel von sprachlichen Minderheiten in Europa und
besonders am Fallbeispiel Sdtirol untersuchen.
ber ethnische Minderheiten im Allgemeinen und ber Sdtirol im Besonderen gibt es eine
reichhaltige Literatur, welche die vielseitigen Probleme, von ihren historischen Wurzeln ausgehend
bis hin zu den kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten bereits ausgeleuchtet hat. Auch
ber die rechtlichen und politischen Fragen gibt es eine Vielzahl von Verffentlichungen. Auf diese
Fragen wollen wir hier nicht weiter eingehen.
Wir wollen uns auf einen, aber wichtigen Aspekt beschrnken, nmlich das zentrale Thema dieser
Arbeit: Wie wirken sich Wahlsysteme auf die Vertretung von sprachlichen Minderheiten in
nationalen Parlamenten aus? Dieses Thema war zwar ebenfalls Untersuchungsobjekt verschiedener
Studien, auf denen wir aufbauen knnen,2 aber bietet noch ein weites Feld an offenen Fragen. Auch
kann es am Fall-Beispiel Sdtirol, ber ganze neun Jahrzehnte lang, konkret empirisch untersucht
werden. Damit hoffen wir zur wissenschaftlichen Diskussion einen bescheidenen, aber interessanten
Mosaikstein dazufgen zu knnen.
Es geht um die Mglichkeiten der demokratischen Mitgestaltung von Minderheiten
Minderheiten in einem Staat, ganz gleich ob ethnischer, kultureller, religiser oder anderer Art,
knnen sich am besten entfalten, wenn sie in einem geschlossenen Siedlungsgebiet leben und ber
ihr Schicksal mitbestimmen knnen, in der Gemeinde, im Land oder der Region. Aus dieser Sicht
ist es entscheidend, welchen Grad an Mitbestimmung man diesen Minderheiten gewhrt, ob sie in
einem zentralistischen oder fderalen System eingebettet sind und ber welchen Grad an
Autonomie sie verfgen knnen. Diesen Aspekt habe ich in der Dissertation untersucht, die ich
parallel mit dieser Forschungsarbeit im Rahmen meines Doktoratsstudium vorgelegt habe. Unter
dem Titel Fderalismus und Autonomien in Italien werden die Auswirkungen der
Fderalismusentwicklung in Italien auf die Sonderautonomien und im Besonderen auf das
2 Vgl das Literaturverzeichnis im Kap 6, ua Bardi, L. (2009), Tronconi, F. (2009), Peterlini, O. (2009), Council of
Europe (2008). Nohlen, D. (2007), Ferrandi, G./Pallaver, G. (Hg) (2007), Glbahar, M. (2006), Pallaver, G. (2005),
Alionescu, C.C. (2004), De Winter, L. (1998), Trsan, H. (1998), De Winter, L./Trsan H. (Hg) (1998), Mller-Rommel,
F. (1998), Urwin, D. (1983), Sartori, G. (1982).
-
Einfhrung und Problemstellung
16
Autonomiestatut von Trentino Sdtirol untersucht.3 Diese Arbeit ist komplementr dazu. Wir
wiederholen hier deshalb nicht den theoretischen Ansatz zum Thema Fderalismus, Autonomie und
Minderheiten, sowie die historische Entwicklung und den rechtlichen Rahmen, auf die wir hier nur
verweisen mchten.
Um Angehrige von Minderheiten wirksam politisch beteiligen zu knnen, kommt es auch auf die
Ausgestaltung und den Wirkungsbereich gewisser Wahlrechtsinstrumente an, bemerken zu Recht
Alber und Parolari in einem umfangreichen, neuen Werk ber die Entwicklung des Wahlrechtes in
Europa.4
Die Mitgestaltung auf lokaler Ebene
Eine besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie sich diese
Mitgestaltung auf regionaler Ebene am Besten organisieren lsst. Carlo Fusaro hat die
theoretischen und praktischen Aspekte der neuen regionalen Wahlgesetze in Italien in einem
umfangreichen Werk zusammengefasst, zu dem namhafte Autoren beigetragen haben.5 Es wurde
von der angesehenen Vereinigung der akademischen und nicht-akademischen Forscher in Italien
(SISE)6 herausgegeben. Zu Recht verweist er auf die Kernfrage, die den Themen Autonomie (sei es
auf lokaler als auch auf regionaler Ebene), Regionalismus und Fderalismus gemeinsam ist: Alle
diese Formen beschreiben unterschiedliche Perspektiven, aber sie sind vereint vom grundstzlichen
Ziel, wachsende Quoten an politischer Macht auf dem Territorium zu verteilen.7
Wie diese Mitsprache erfolgt, kommt auch in den regionalen Wahlgesetzen zum Ausdruck.8 Seit
1993 werden die Brgermeister in Italien und seit 1999 die Prsidenten der Regionen direkt
gewhlt.9 Eine Ausnahme bilden die Region Aosta und die autonome Provinz Bozen Sdtirol. Diese
Reformen haben zu einer Strkung der Lokalkrperschaften und der Regionen, besonders deren
Prsidenten gefhrt. Zu Recht spricht man deshalb auch von einem Wahlfderalismus. 10
Die vorliegende Studie geht aber einen Schritt weiter. Im Vordergrund steht nicht die Teilhabe der
Minderheiten am lokalen Geschehen, sondern deren Beteiligung in nationalen Parlamenten. Und
diese hngt wiederum von den Wahlsystemen ab. Wie bei einer Schraube knnen diese Systeme
3 Peterlini, O. (2010h, it) (2010e, de).
4 Alber, E. / Parolari,S. (2010) S 355.
5 Fusaro, C. (2010) (Hg).
6 Societ Italiana di Studi Elettorali: http://www.studielettorali.it/storia/storia.htm, abgeladen am 15.5.2010.
7 Fusaro, C. (2010) (Hg) S 4.
8 Vgl dazu auch Gamper, A. (Hg) / Fraenkel-Haeberle, C. (2010), darin besonders Alber, E. / Parolari, S. (2010) S 355
ff, Greco, M.A. (2010) S 395 ff, Pallaver, G. (2010) S 519 ff, Zwilling, C. (2010) S 541 ff. 9 ber Vor- und Nachteile der Direktwahl der Brgermeister vgl Di Virgilio, A. (2010) S 47 ff, besonders 65-67.
10 Fusaro, C. (2010) (Hg) S 5. Zum System der Regional- und Gemeindewahlen vgl auch: Pallaver, G. (2005), Baldini,
G. (2004), Chiaramonte, A./ D'Alimonte, R. (2004), Cecanti, S./ Vassallo (2004a), Fusaro, C. (2004), Fusaro, C./ Carli,
M. (2002), Fusaro, C. (2002), Grasse, A. (2000), Chiaromonte, A./ DAlimonte, R. (Hg) (2000): Barbera, A. (1999), Fusaro, C. (1997), Grilli, A. (1997), Barbera, A./ Ceccanti, (1995), Barbera, A. (1980).
-
Einfhrung und Problemstellung
17
den Spielraum erweitern oder einengen und Minderheiten den Zutritt gewhren, erschweren oder
gar verhindern.
Zweck und Auswirkungen von Wahlsystemen
Wahlsysteme haben in demokratisch-parlamentarisch organisierten Staaten den Zweck, eine
mglichst reprsentative Vertretung der Whler, aber auch die Regierbarkeit zu gewhrleisten.
Nationale Wahlsysteme haben deshalb direkte Auswirkungen auf die Zusammensetzung des
jeweiligen Parlamentes.11
Abb. 1: Zweck von Wahlsystemen
Neben diesen Idealzielen von Wahlsystemen, knnen Wahlsysteme auch missbraucht werden, um
die eigene Macht zu strken oder die Opposition zu schwchen. Bei Reformen knnen diese Ziele
nie ganz ausgeschlossen werden. Die Parteien, die an der Macht sind, versuchen meistens, das
System zu ihren Gunsten zu ndern
Wahlgesetze haben auch ihre Auswirkungen auf die Parteien und knnen durch ein reines
Proporzsystem beispielsweise zu einer greren Vielfalt fhren, gleichzeitig aber auch die
Regierungsbildung erschweren oder durch ein Mehrheitswahlsystem einen Zusammenschluss
frdern bzw Minderheiten ausschlieen.12
11
Nohlen, D. (2007). 12
Caretti, P./ De Siervo, U. (2004) S 106-110. Falcon, D. ( 2001) S 197-211.
-
Einfhrung und Problemstellung
18
Besondere Auswirkungen knnen Wahlgesetze auf ethnische Minderheiten im Staate haben. Diese
knnten rein zahlenmig in einem System komplett untergehen bzw durch eine Sondernorm
gerettet werden, in dem man einfach ein verfassungsrechtliches Vertretungsrecht - unabhngig von
deren Strke - vorsieht. Das ist beispielsweise fr die kleine rtoromanische Minderheit (Ladiner)
im Sdtiroler Landtag und im Trentiner Landtag der Fall, wo das Autonomiestatut die Vertretung
der ladinischen Sprachgruppe gewhrleistet.13
Das gleiche Problem stellt sich fr ethnische
Minderheiten auf Staatsebene.
Abb. 2: Auswirkungen von Wahlsystemen
13
Autonomiestatut, Art. 48.
-
Einfhrung und Problemstellung
19
2 Die zentrale Frage und die Thesen
Die zentrale Frage, die wir uns in dieser Arbeit stellen, ist folgende: Welche Auswirkungen haben
nationale Wahlsysteme auf eine ethnische Minderheit? Zu diesem Zweck wollen wir folgende
Thesen aufstellen und empirisch am Beispiel der Sdtiroler Minderheit in Italien berprfen.
1. These: Nationale Wahlsysteme knnen die Vertretung einer Minderheit durch eine
ethnoregionale Partei strken und schwchen.
2. These: Proporzsysteme erleichtern die Vertretung von Minderheiten nur, wenn diese
gebietsmig zerstreut sind, aber wirken eher nachteilig, wenn diese in einem geschlossenen
Siedlungsgebiet leben.
3. These: Mehrheitswahlsysteme mit Einer-Wahlkreisen frdern die Vertretung von
nationalen Minderheiten, wenn diese in geschlossenen Siedlungsgebieten leben.
4. These: Die Wahlkreiseinteilung kann Minderheiten begnstigen oder benachteiligen. Je
weiter die Wahlkreise ber das Siedlungsgebiet hinaus auf weitere Regionen erweitert
werden, desto kleiner wird die Quote, die diese Minderheit ausmacht und umso schwieriger
eine Vertretung.
5. These: Wenn gleich das Proporzsystem grundstzlich gnstig fr verstreute Minderheiten
ist, benachteiligen Sperrklauseln und Mehrheitsprmien Minderheiten und knnen diese
sogar ausschlieen.
-
Einfhrung und Problemstellung
20
3 Theoretischer und methodischer Zugang
Um auf dem bestehenden Wissenstand aufzubauen, sollen zunchst an Hand der wissenschaftlichen
Literatur die theoretischen Grundlagen ber die Wahlsysteme systematisch dargestellt und
untersucht werden. Wichtig ist dabei, vor allem die Instrumente kennenzulernen und sie auf ihre
Auswirkungen zu untersuchen. Das erfolgt im Kapitel 1.
In einer Feinabstimmung dieser Instrumente kann man dann die Auswirkungen auf die Vertretung
von Minderheiten allgemein und auf sprachliche Minderheiten im Besonderen messen. Dazu sollen
auch die politischen Organisationsformen von ethnischen Minderheiten und speziell die
ethnoregionalen Parteien dargestellt werden, die eine wichtige Rolle zur Wahrnehmung der
Interessen und der Mitsprache darstellen. Bedeutungsvoll sind auch die Grundstze des Europarates
fr das Wahlrecht. In einigen europischen Lndern gibt es wichtige Sonderbestimmungen fr
Minderheiten. Wir werden diese, sowie deren Auswirkungen in einem Panoramabild beleuchten
und vergleichen. Das erfolgt im Kapitel 2.
Der Kernaufgabe stellen wir uns im Kapitel 3. Wir untersuchen die eingangs aufgestellten Thesen
empirisch am Beispiel der Vertretung der Sdtiroler im Parlament, zunchst am Deutschen Verband
(DV), der schon 1921 Abgeordnete nach Rom entsandte, ab 1948 an der Sdtiroler Volkspartei
(SVP), die seitdem die Sdtiroler Minderheit im italienischen Parlament vertritt.14
Beides sind
typische regionale ethnische Minderheitenparteien. Im Besonderen beleuchten wir die
Auswirkungen folgender Reformen: der faschistischen Wahlreform von 1923, des vorwiegenden
Proporzsystems im demokratischen Italien ab 1948, der nderung der Senats-Wahlkreise15
in
Trentino Sdtirol im Jahre 1992, der Reformen des italienischen Wahlsystems von 1993 und 2005.
Gegen die nderungen des staatlichen Wahlgesetzes, im Konkreten gegen die Einfhrung einer
Prozenthrde im Jahre 1993, gab es auch Verfahren beim italienischen Verfassungsgerichtshof und
bei der Europischen Kommission fr Menschenrechte, die ebenfalls Gegenstand dieser
Untersuchung sein werden. Ein Przedenzfall aus Belgien bietet sich ebenfalls dafr an.
Dabei soll die Studie nicht bei einer formalen Beschreibung der einzelnen Wahlgesetze und der
Sonderregelung fr Minderheiten stehen bleiben, sondern auch empirisch die Wahlergebnisse, die
Mandate und die Bndnisse beleuchten, die sich auf Grund der nderung der Wahlsysteme ergeben
14
Zur Geschichte des Deutschen Verbandes und der SVP vgl Holzer, A. (1991), sowie Pallaver, G. (2007) S 629 ff,
Peterlini, O. (2009 de) (2008a, de). 15
Das italienische Wahlgesetz unterscheidet circoscrizioni (grere Wahlbezirke), die eine Region oder Teile derselben
oder auch mehrere Regionen umfassen knnen, sowie collegi (Wahlkreise), in der Regel Einer-Wahlkreise, auer dem
Collegio unico nazionale, dem nationalen Wahlkreis, der ganz Italien umfasst.
-
Einfhrung und Problemstellung
21
haben. Es geht dabei vor allem um jene Wahlergebnisse, welche dem Einfluss staatlicher
Wahlnderungen unterlagen. Diese werden im Detail auf ihre Auswirkungen untersucht. Um aber
trotzdem einen Gesamt-berblick zu bieten, werden alle Wahlgnge und deren Ausgang von 1921
bis 2008 dargestellt.16
Das Kapitel 4 befasst sich mit den Plnen zur Reformierung der Wahlgesetze in Italien, die nicht
oder noch nicht zum Tragen gekommen sind und wagt somit einen Blick in die Zukunft, immer aus
der Sicht der Minderheiten. Eine Kritik am bestehenden System rundet das Thema ab.
Im Kapitel 5 werden die Schlussfolgerungen gezogen und die zu Beginn aufgestellten Thesen
werden an den erworbenen Erkenntnissen berprft.
Das abschlieende Kapitel 6 bringt einen berblick ber die verwendete Literatur und die Quellen,
sowie Hinweise zum Autor und seinen Schriften.
16
Eine kurze Fassung dieser Arbeit, ohne den theoretischen Teil ber die Wahlsysteme, deren Auswirkungen auf die
Minderheiten in Europa , den internationalen Vergleich und ohne vergleichende Literatur in: Peterlini O. (2009 de); ein
erster Aufsatz in: Peterlini O. (2008a, de).
Die wichtigsten Daten und Ergebnisse der Studie werden in Tabellen und Schaubildern
dargestellt. Diese bildeten auch die Grundlage fr eine Lehrveranstaltung, die der Verfasser
als Gastreferent an der Fakultt fr ffentliches Recht am Institut fr italienisches Recht der
Universitt Innsbruck im April 2010 zu folgendem Thema hielt: Wahlrecht, Wahlsysteme,
italienische Wahlgesetze und Reformen und ihre Auswirkungen auf Minderheiten. Sie sollen
dazu beitragen, die komplizierte Materie der Wahlsysteme mglichst bersichtlich und
verstndlich darzustellen.
-
Einfhrung und Problemstellung
22
Alle vier Jahre machen die Whler ihr Kreuz.
Und hinterher mssen sie's dann tragen.
Ingrit Berg-Khoshnavaz (*1940)
deutsche Satirikerin
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
23
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze und Auswirkungen
1.1 Die Wahlsysteme und ihre Typologien
1.1.1 Was sind Wahlsysteme?
Wahlsysteme, sagte Maurice Duverger, "sind seltsam Gerte: gleichzeitig Kameras und
Projektoren. Sie registrieren Bilder, die sie teilweise selbst erstellt haben".17
Damit beschrieb er
bildlich, dass Wahlsysteme nicht nur die Wahlergebnisse registrieren und in Sitze umrechnen,
sondern auch Einfluss nehmen auf das politische System.
Der Begriff Wahlsystem kann in einem engeren oder einem weiteren Sinne verstanden werden. Im
weiteren Sinne umfasst er alles, was den Wahlprozess betrifft, einschlielich des Wahlrechtes und
der Wahlorganisation. In Anlehnung an Dieter Nohlen wollen wir den Begriff im engeren Sinne
verwenden. In seinem Standartwerk Wahlrecht und Parteiensystem (2007) befasst sich Nohlen
mit der Theorie und Empirie der Wahlsysteme und untersucht deren Auswirkungen auf die
Parteiensysteme.18
Abb. 3: Definition von Wahlsystem
17
Duverger, M. (1984) S 34. 18
Nohlen, D. (2007) S 61.
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
24
Unter Wahlsystem im engeren Sinne verstehen wir den Modus, mit dem die Whler ihre Partei und
ihre Kandidatenprferenz ausdrcken und mit dem diese in Mandate bertragen werden. Mit den
Wahlsystemen werden Stimmenergebnisse (data of votes) in Mandate (parliamentary seats)
umgewandelt. Wahlsysteme regeln hierfr die Einteilung der Wahlkreise, die Wahlbewerbung, die
Abgabe der Stimmen und die Stimmverrechnung.
Abb. 4: Wahlsysteme im engeren Sinn
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
25
1.1.2 Was ist Wahlrecht?
Wahlrecht ist das Recht zu whlen und gewhlt zu werden. Das Wahlrecht regelt die
Voraussetzungen hierfr. So selbstverstndlich heute das allgemeine Wahlrecht ist, so lange war der
Weg dazu. Denken wir nur an das Wahlrecht fr Frauen, das in Italien 1946 eingefhrt wurde.
Abb. 5: Definition des Wahlrechtes
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
26
1.1.3 Was regeln Wahlsysteme?
Die wichtigsten technischen Regelungen von Wahlsystemen betreffen folgende Elemente:
- die Einteilung von Wahlkreisen: nach mglichen verschiedenen Ebenen, ihre regionale
Verteilung, ihre Gre,
- die Wahlbewerbung: Einzelkandidatur oder Liste, Listenformen (starre Liste, los gebundene
Liste oder freie Liste), Listenverbindung,
- die Stimmgebung: Der Whler hat dabei folgende Mglichkeiten: Nur eine Stimme
(Einzelstimmgebung), Prferenzstimme fr Kandidaten, Mehrstimmgebung, Beschrnkte
Mehrstimmgebung (weniger Stimmen als zu Whlende), Alternativstimmgebung (Zweit- Dritt-
oder Viertprferenzen), Stimmen-Kumulierung (mehrere Stimmen fr einen Kandidaten),
Panaschieren (Kandidaten auf verschiedenen Listen whlen), Zweitstimmen (eine fr den
Wahlkreis; eine fr die Liste),
- die Stimmenverrechnung: Majorzsystem (mit relativer oder absoluter Mehrheit) oder
Proporzsystem (nach Hchstzahl-Verfahren oder Wahlzahl-Verfahren, mit oder ohne
Sperrklausel), sowie mgliche Kombinationen in kombinierten Systemen.
Die Bedeutung des Wahlsystems ist in der Wissenschaft und in der Politik umstritten. Einige
Wissenschaftler verbinden mit dem Wahlsystem das Schicksal der Demokratie.
Abb. 6: Missbrauch von Wahlsysteme
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
27
So fhrt etwa Ferdinand A. Hermens den Untergang der Weimarer Republik auf die Verhltniswahl
zurck.19
Das mag sicher bertrieben sein, aber genauso falsch wre es, den Einfluss von
Wahlsystemen auf die Demokratie zu unterschtzen.
19
Hermens, F. A. (1941) (1968).
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
28
1.1.4 Die Wahlkreiseinteilung
Eine besondere Bedeutung fr die Wahlchancen der politischen Parteien ist die Einteilung der
Wahlkreise. Die Wahlkreise knnen unterschiedlich gro sein. Es gibt die Mglichkeit,
Einerwahlkreise zu errichten, in denen ein einziger Abgeordneter zu whlen ist, oder
Mehrpersonen-Wahlkreise, in denen mehrere Abgeordnete gewhlt werden knnen. Es gibt auch
sogenannte nationale Wahlkreise, bei denen das gesamte Staatsgebiet den Wahlkreis bildet. Der
demokratische Grundsatz lautet, dass jede Stimme den gleichen Zhlwert haben soll. Das bedeutet,
dass es auf einen zu whlenden Abgeordneten die gleiche Anzahl an Whlern treffen sollte. Immer
sollte deshalb das Verhltnis der Bevlkerung, oder noch besser der Wahlberechtigten
bercksichtigt werden.
Die Einteilung kann zu bewussten oder unbewussten Manipulationen fhren, beispielsweise in der
Bildung von groen oder kleinen Wahlkreisen bei Mehrpersonen-Wahlkreisen, in der
geographischen Abgrenzung, im Stadt Land Verhltnis, in der mangelnden Bercksichtigung der
Migration usw. Bei Mehrpersonen-Wahlkreisen geht es nicht nur um eine verhltnismige
Bercksichtigung der Bevlkerung zu den zu Whlenden, sondern auch um die Gre. Je grer der
Wahlkreis ist und umso mehr zu Whlende sind, desto mehr wird das System proportional. Dies
frdert kleinere Parteien und Minderheiten, welche in kleinen Wahlkreisen untergehen. Je kleiner
nmlich der Wahlkreis ist, umso hher wird die natrliche Wahlhrde; in einem Einer-Wahlkreis ist
sie am hchsten. Dort schafft es nur die im Wahlkreis strkste Partei oder Parteiengruppe, whrend
die Minderheiten untergehen. In kombinierten Wahlsystemen, die wir spter betrachten, kann durch
ein Proporzsystem auf Staatsebene ein Ausgleich zu den Nachteilen der Einer-Wahlkreise gefunden
werden, wie es beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Die bewusste, knstliche Ziehung von
Grenzen der Wahlkreise zum Schaden von bestimmten Gruppen nennt man Gerrymandering. Dabei
wird die unterschiedliche Streuung der Whlerschaft ausgentzt. Ein solcher Plan wurde
beispielsweise im aufflammenden Faschismus gegen die Sdtiroler Minderheit ausgeheckt, um sie
auf zwei groe Wahlkreise zu verstreuen und sie, die auf ihrem Gebiet die Mehrheit stellen, in die
Minderheit zu setzen.20
Die regionale Verteilung kann ebenfalls zum Problem werden. Auch wenn der Schlssel einer
gerechten Reprsentation bercksichtigt wird, kann es zu Verzerrungen kommen. In der Regel
werden nmlich die Wahlkreise nicht einheitlich gebildet, das heit mit gleich vielen Einwohnern
und gleich viel zu Whlenden, sondern nach Verwaltungseinheiten. Das kann dazu fhren, dass in
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
29
den Ballungszentren groe Wahlkreise gebildet werden und am Lande kleinere, mit den eben
beschriebenen Folgen fr die kleineren Parteien, die am Lande, in den kleineren Wahlkreisen
benachteiligt wren.
Die Gre des Wahlkreises beeinflusst nicht nur das Verhltnis zwischen Stimmen und Mandaten,
sondern auch das Verhltnis zwischen Whlern und Gewhlten. Im Einerwahlkreis hat der Whler
die Auswahl zwischen verschiedenen Persnlichkeiten, die er besser kennt, als in groen anonymen
Wahlkreisen, wo die Kandidaten oft kaum bekannt sind. Wenn es sich zudem um starre Listen
handelt, bei denen es keine Vorzugsstimmen gibt, wird die Beziehung zwischen Whler und
Gewhlten weiter entfremdet.21
20
Vergleich Kap 3.2.3 Die Wahlreform von 1923 und der Untergang der Demokratie. 21
Nohlen, D. (2007) S 86-102.
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
30
1.1.5 Die Wahlsysteme nach der Stimmenverrechnung: Majorz und Proporz
Abb. 7: Die Einteilung der Wahlsysteme nach Majorz und Proporz
Nach der Wahlkreis-Einteilung ist die Stimmenverrechnung und Umwandlung in Mandate der
zweitwichtigste Mechanismus. Dafr gibt es grundstzlich zwei Systeme, das Mehrheits-
Wahlsystem (Majorz) und das Verhltnis-Wahlsystem (Proporz). Dazwischen gibt es verschiedene
kombinierte Formen. Je nachdem welches von den beiden Systemen berwiegt, werden diese
kombinierten Systeme dem Majorz oder dem Proporz zugeteilt. Dieter Nohlen hat die meisten der
verschiedenen Mischformen klassifiziert und einem der beiden Systeme zugeteilt und kommt dabei
auf je fnf Wahlsysteme fr den Majorz und den Proporz.22
Trotzdem verbleiben einige
kombinierte Formen, die sich nur schwerlich dem einen oder anderen System zuteilen lassen.
22
Nohlen, D. (2007) S 192.
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
31
Abb. 8: Die Klassifizierung der Wahlsysteme nach Nohlen
1.1.6 Das Mehrheitswahlsystem (Majorz-System)
Abb. 9: Die Mehrheitswahl
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
32
Beim Mehrheitswahlsystem, wird das Staatsgebiet in viele kleine Einer-Wahlkreise aufgeteilt. In
jedem Wahlkreis wird ein einziger Kandidat gewhlt. Die Wahl gewinnt, wer die meisten Stimmen
erzielen kann. Er allein gewinnt, alle anderen Stimmen sind verloren.
Die Mglichkeiten, die sich beim Mehrheitswahlsystem bieten, sind grundstzlich zwei. Man
verlangt vom Sieger entweder die einfache (relative) Mehrheit, oder die absolute Mehrheit.
- Die einfache Stimmenmehrheit (Relatives Mehrheitswahlsystem, Plurality-System): Wer mehr
Stimmen im Wahlkreis erzielt als die Mitbewerber (relative Mehrheit), ist der oder die
Gewinner/in.
- Die absolute Stimmenmehrheit (Absolutes Mehrheitswahlsystem, Majority-System). Es
gewinnt, wer im Wahlkreis die absolute Mehrheit (mehr als 50%) der Stimmen erzielt; wenn
diese im ersten Wahlgang nicht erreicht wird, erfolgt eine Stichwahl. Die politische Bedeutung
der Stichwahlen, liegt in der Bedeutung, die kleine Parteien erhalten, weil sie fr die groen
Parteien die entscheidenden Stimmen liefern knnen.
Abb. 10: Gliederung des Majorz
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
33
1.1.6.1 Das relative Mehrheits-Wahlsystem in Grobritannien
Grobritannien ist ein klassisches Beispiel fr die relative Mehrheits-Wahl. Das ganze Land wird
(seit 2010) in 650 Wahlkreise (Constituencies) eingeteilt. In jedem Wahlkreis gewinnt, wer die
Mehrheit erzielt, also mehr Stimmen hat als seine Herausforderer.
Abb. 11: Relative Mehrheitswahl in Grobritannien
Abb. 12: Wahlkreise in Grobritannien
Quelle: http://www.parliament.uk/about/how/elections/general.cfm.
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
34
Fr die Sitzverteilung im Unterhaus (House of Commons) und die Regierungsbildung ist demnach
alleine die Zahl der gewonnenen Wahlkreise ausschlaggebend, nicht der prozentuale Stimmenanteil
insgesamt. Das bedeutet, dass der Prozentsatz an Whlerstimmen, den eine Partei insgesamt
landesweit auf sich vereinen kann, nicht entscheidend ist fr die Zahl ihrer Sitze im Unterhaus. So
erreichte zum Beispiel die Labour Party bei den Unterhauswahlen im Jahr 2005 mit rund 35% der
Stimmen ber 55% der Sitze im Parlament.
Das Mehrheitswahlrecht kann in seltenen Fllen auch dazu fhren, dass Parteien mit den meisten
Whlerstimmen sich in der Opposition wiederfinden, wie die Labour Party bei den Wahlen 1951
oder die Konservative Partei bei den Wahlen im Februar 1974. Die Befrworter des
Mehrheitswahlrechts verweisen darauf, dass das bestehende britische Wahlrecht in der Regel fr
klare politische Verhltnisse sorge, d.h., die relative Stimmenmehrheit einer Partei fr eine absolute
Zahl der Sitze im Unterhaus ausreichend sei. 23
1.1.6.2 Das absolute Mehrheits-Wahlsystem in Frankreich
Frankreich bietet das klassische Beispiel fr das absolute Mehrheitswahlsystem. Die Assemble
Nationale besteht aus 577 Abgeordneten, die in ebenso vielen Einer-Wahlkreisen gewhlt werden.
Abb. 13: Absolute Mehrheitswahl in Frankreich
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
35
Um gewhlt zu werden, muss man die absolute Mehrheit im Wahlkreis erringen und mindestens ein
Viertel der Wahlberechtigten muss an der Wahl teilgenommen haben. Anderenfalls erfolgt eine
Stichwahl eine Woche spter. Daran nehmen die Kandidaten teil, die mindestens 12,5% der
gltigen Stimmen des Wahlkreises erzielt haben. Wenn nur ein Kandidat dieses Quorum erreicht,
wird auch der nchste Meistgewhlte zugelassen, auch wenn er nicht die 12,5% erreicht hat. Bei der
Stichwahl gengt die relative Mehrheit der Stimmen.
Abb. 14: Wahlkreise in Frankreich
Ein Mehrheitswahlsystem, besonders mit der einfachen Mehrheit (nach dem Plurality-System)
bevorzugt grundstzlich die groen Parteien, whrend kleinere Parteien, die keine territoriale
Konzentration darstellen, riskieren keinen einzigen Sitz zu erzielen. Das gilt allerdings nicht
unbedingt fr ethnoregionale Parteien oder Minderheiten, die eine konzentrierte Prsenz in einem
oder mehreren Wahlkreisen aufweisen.
23
Bartsch, K./ Krmer, J. (2010).
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
36
Abb. 15: Auswirkungen der Mehrheitswahl
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
37
1.1.6.3 Die Einteilung der Mehrheitswahl nach Nohlen
Nohlen teilt die Mehrheits-Systeme in fnf Kategorien ein und weist die kombinierten Systeme,
wenn das Mehrheitssystem berwiegt, diesem System zu. Die ersten beiden Systeme sind die
klassischen, die anderen kombinierte Systeme.
Abb. 16: Die fnf Mehrheitswahl-Systeme nach Nohlen
Sogar die Verhltniswahl in kleinen Wahlkreisen wird de facto zu Recht dem Mehrheits-
Wahlsystem zugeordnet: Je kleiner der Wahlkreis und damit je weniger zu Whlende, desto mehr
nhert man sich dem Majorz. Wenn der Wahlkreis nur mehr einen zu Whlenden vorsieht, handelt
es sich um das klassische Majorz-System.
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
38
1.1.7 Das Verhltniswahlsystem (Proporz-System)
Abb. 17: Verhltniswahl
Whrend bei der Mehrheitswahl gewinnt, wer die relative oder absolute Mehrheit der Stimmen
gewinnt, entscheidet bei der Verhltniswahl der Anteil der Stimmen ber die Verteilung der
Mandate.24
Grundstzlich sollen alle Parteien entsprechend ihrer verhltnismigen Strke im
Parlament vertreten sein. Damit kommen auch kleine Parteien zum Zuge, auch wenn sie territorial
versprengt sind, aber auf Staatsebene die notwendigen Stimmen fr mindestens einen Sitz im
Verhltnis dazu erzielen knnen. Das System fhrt in der Regel zu einer starken Zersplitterung der
Parteienlandschaft und kennzeichnet auch das italienische Parteien-System bis herauf zu den
jngsten Wahlreformen.
Damit kommen auch kleine ethnoregionale Parteien zum Zug, und zwar im Verhltnis zu ihrer
Strke. Allerdings bedeutet das nicht grundstzlich, dass dieses System besser fr ethnoregionale
Parteien sei. Wenn diese nmlich territorial konzentriert in den entsprechenden Wahlkreisen den
Charakter einer lokalen Mehrheitspartei aufweisen, knnte das Mehrheitswahlsystem fr sie
vorteilhafter sein. Auch das soll Gegenstand dieser Untersuchung sein.
24
Nohlen, D. (2007) S 140.
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
39
1.1.7.1 Kategorien der Verhltniswahl
Bei der Klassifizierung der Wahlsysteme weist Nohlen die kombinierten Systeme weist er der
Mehrheits- oder der Verhltniswahl zu, je nachdem welche Charakteristika berwiegen. Wenn also
die proportionalen Zge berwiegen, zhlt er sie zum Proporz. Die klassischen Proporz-Systeme
sind:
- die Verhltniswahl in relativ groen Mehrpersonen-Wahlkreisen (die erste in der Abbildung),
wie in Spanien, Portugal und zT in Italien und
- die reine Verhltniswahl, wie in den Niederlanden und in Israel, ohne jegliche Hrden (letzte in
der Abbildung): Es gibt nur mehr einen einzigen Wahlbezirk. Das ist ohne jegliche
Verzerrungen - das perfekte Proporzsystem.
Dazwischen liegen verschiedene kombinierte Systeme (in der Abbildung die Systeme 2 bis 4).
Abb. 18: Die fnf Verhltniswahl-Systeme nach Nohlen
1.1.7.2 Natrliche und normative Hrden
Je hher die Hrden und je kleiner die Wahlkreise (natrliche Hrden), desto mehr nhert man sich
dem Gegenteil, nmlich dem Mehrheits-Wahlsystem.
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
40
Abb. 19: Natrliche und normative Hrden
1.1.8 Methoden der Mandatszuteilung beim Proporz
Im Proporzsystem werden die Sitze den Parteien im Verhltnis zu ihrem Wahlergebnis zugeteilt.
Abb. 20: Zuteilung der Sitze im Verhltnis der Stimmen
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
41
Mandats- oder Sitzzuteilungsmethoden sind Verfahren der proportionalen Vertretung, wie sie bei
der Verhltniswahl bentigt werden, um Whlerstimmen in Abgeordnetensitze umzurechnen. Man
unterscheidet zwei Gruppen von Sitzzuteilungsverfahren:
a. das Hchstzahlverfahren (auch Divisorenverfahren genannt) und
b. das Wahlzahlverfahren oder Quotaverfahren.
Abb. 21: Was sind Mandats- oder Sitzzuteilungsmethoden?
O.Peterlini: Wahlsysteme
Univ.Innsbruck 12.4.2010
31
Mandatszuteilungsmethoden
Sind Verfahren der proportionalen Vertretung, wie sie bei der Verhltniswahl
bentigt werden, um Whlerstimmen in
Abgeordnetensitze umzurechnen
Man unterscheidet zwei Gruppen von Sitzzuteilungsverfahren:
Hchstzahlverfahren
oder Divisorenverfahren
Wahlzahlverfahren
oder Quotenverfahren
Abb. 22: Die zwei Methoden der Mandats- oder Sitzzuteilung beim Proporz
O.Peterlini: Wahlsysteme
Univ.Innsbruck 12.4.2010
32
Proporz
Verfahren der
Mandatszuteilung
Hchstzahlverfahren oder
DivisorenverfahrenWahlzahlverfahren oder
Quotenverfahren
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
42
1.1.8.1 Das Hchstzahlverfahren (oder Divisorenverfahren)
Bei diesem Verfahren versucht man alle Mandate schon in der ersten Zuteilung so zu verteilen, dass
keine Restsitze in einem Restverfahren zugeteilt werden mssen. Das Ziel ist dabei auch eine
mglichst gleichmige Stimmenanzahl (Wahlziffer oder Wahlzahl) festzulegen, die es fr einen
Sitz braucht.
Die Kosten fr einen Sitz sollen fr alle mglichst gleich hoch sein, was beim Wahlzahlverfahren
(Quotaverfahren) nicht der Fall ist, weil Restsitze brig bleiben und diese gnstiger (um weniger
Stimmen) zu erhalten sind, was eine Chance fr kleine Gruppen darstellt.
Um eine Zuteilung aller Sitze in einer einzigen Division ohne Restsitze zu erzielen, kann man auch
die Stimmenanzahl schtzen, die es fr einen Sitz braucht, ohne dass Restsitze brig bleiben. Jede
Partei erhlt dann soviel Sitze, wie oft sie diese Stimmenanzahl voll aufbringen kann. Wenn
beispielsweise die Wahlzahl 7.000 ist und eine Partei 21.000 oder mehr Stimmen erhalten hat,
bekommt sie drei Sitze, ab 28.000 vier Sitze.
Die notwendige Stimmenanzahl fr einen Sitz wird Wahlzahl oder Wahlziffer genannt. Um sie zu
errechnen, dividiert man die Gesamtzahl aller Partei-Stimmen durch einen gemeinsamen Divisor
(Zahl der Mandate + n), der geschtzt werden muss. Man schaut dann, wie oft diese Wahlzahl in
der Stimmenanzahl der Parteien Platz hat. Diesen Divisor muss man schtzen und so lange
probieren und austauschen, bis er so passt, dass alle Sitze in einem Gang vergeben sind. Dieses
Verfahren, bei dem man den Divisor probieren muss, nennt man Zweischrittverfahren.
Abb. 23: Die Schtzung der Wahlzahl
O.Peterlini: Wahlsysteme
Univ.Innsbruck 12.4.2010
39
Schtzung der Wahlzahl
Mandate werden schon in der 1.Zuteilung so verteilt, dass keine Restsitze brigbleiben.
Ziel: gleichmige Wahlzahl fr alle, Kosten fr einen Sitz fr alle gleich hoch, was bei den Restsitzen nicht der Fall ist.
Stimmen durch einen Divisor teilen, der geschtzt (oder probiert) werden muss (Sitzzahl + x), so dass alle Mandate in der 1. Zuteilung verteilt werden.
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
43
Zweischrittverfahren: Die Stimmen der Parteien werden durch einen geeigneten zu schtzenden
Divisor (Stimmen pro Sitz) dividiert. Die Zahl lsst sich durch Probieren ermitteln. Eine gute
Schtzung ist immer der Quotient aus Gesamtstimmenzahl und Gesamtsitzzahl. Die sich ergebenen
Quotienten werden nach der Rundungsregel des Verfahrens auf ganze Zahlen gerundet. Ist die
Summe der gerundeten Zahlen kleiner oder grer als die Anzahl der zu vergebenden Sitze, wird
das Verfahren mit einem etwas kleineren bzw greren Divisor wiederholt, bis die festgelegte
Gesamtsitzzahl vergeben wird. Der geeignete Divisor kann durch dieses zweistufige Verfahren
effektiv bestimmt werden. Dieser Weg ist der schnellste fr Computerprogramme.25
Hchstzahlverfahren: Viel einfacher kommt man mit dem Hchstzahlverfahren (oder
Divisorenverfahren) zu einem vergleichbar hnlichen Ergebnis. Die Stimmen der Parteien werden
durch eine Folge von Divisoren (zB durch 1, dann 2, dann 3 usw) geteilt. Dividiert werden immer
die ursprnglichen Stimmen der jeweiligen Parteien (also nicht die sich ergebenden Quotienten).
Die bei der Division erhaltenen Bruchzahlen werden auf- oder abgerundet. Bei der
Standardrundung wird ein Bruchteilsrest ab- bzw. aufgerundet je nachdem, ob er kleiner oder
grer als 0,5 ist; in den seltenen Sonderfllen, in denen mehrere Reste genau gleich 0.5 sind,
entscheidet das Los.
Abb. 24: Ein Beipiel fr das DHondt-Verfahren
25
Pukelsheim, F. (2002) S 83.
O.Peterlini: Wahlsysteme Univ.Innsbruck 12.4.2010
35
D Hondt System (H ufig f r Restsitz - Verteilung)
Stimmen Sitze Stimm. Sitze Stimm. Sitze Stimm. Sitze Stimmen Sitze
Stimmen geteilt durch
1 132.291 1 51.106 - 30.073 1 45.091 - 42.343 : 1
1 66.145 - 25.333 - 15.036 - 22.545 - 21.166 : 2
1 44.097 - 17.035 - 10.024 -
15.030 - 14.111 : 3
DC Laici MSI SVP PCI
Verteilung von 5 Sitzen
Wahlprognose Senat 1987 Peterlini
-
1 Wahlsysteme, Typologien, Grundstze
und Auswirkungen
44
Quelle: Peterlini, O. (1988c, de).
Die hchsten Quotienten werden als Hchstzahlen bezeichnet. Sie werden danach absteigend nach
ihrer Gre geordnet. Die Sitze werden in der Reihenfolge der grten sich ergebenen
Hchstzahlen (den hchsten Quotienten) aller Parteien zugeteilt, solange, bis alle verfgbaren Sitze
vergeben sind.
Man schafft praktisch eine Tabelle, in der man die Parteien und darunter ihre Stimmen auf einer
horizontalen Linie anfhrt. Vertikal hingegen werden links untereinander die Divisoren angefhrt,
zB 1, 2, 3 usw, durch die die Parteistimmen nacheinander, Zeile fr Zeile, dividiert werden. Die
hchsten Ergebnisse (Quotienten) sind eben die Hchstzahlen, denen die Mandate in absteigender