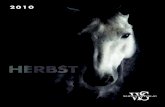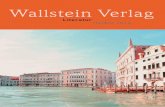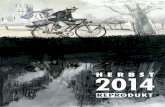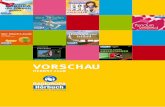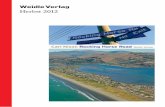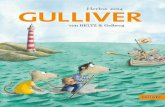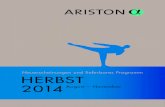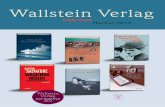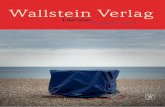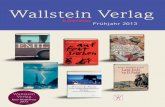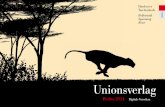Wallstein Vorschau Herbst 2012
-
Upload
wallstein-verlag -
Category
Documents
-
view
220 -
download
9
description
Transcript of Wallstein Vorschau Herbst 2012

Wallstein Verlag GmbHGeiststraße 11 D-37073 Göttingen
Tel: 05 51 / 5 48 98-0 Fax: 05 51 / 5 48 98-34
e-mail: [email protected] Internet: www.wallstein-verlag.de
Wenn Sie unseren monatlichen Newsletter zu aktuellen Neuerscheinungen, Veranstaltungen und Auszeichnungen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Folgen Sie uns via Twitter unter: http://twitter.com/WallsteinVerlagoder besuchen Sie uns auf facebook: http://www.facebook.com/wallstein.verlag
Wir unterstützen die Arbeit der Kurt-Wolff-Stiftung
Ansprechpartner im Verlag
Vertrieb:
Lisa Jakobi Tel: 05 51 / 5 48 98-15 [email protected]
Vertrieb und Veranstaltungen:
Claudia Hillebrand Tel: 05 51 / 5 48 98-23 [email protected]
Presse und Öffentlichkeitsarbeit:
Monika Meffert Tel: 05 51 / 5 48 98-11 [email protected]
Rechte und Lizenzen:
Hajo Gevers Tel: 05 51 / 5 48 98-22 [email protected]
Antina Porath Tel: 05 51 / 5 48 98-14 [email protected]
Werbung:
Marion Wiebel Tel: 05 51 / 5 48 98-28 [email protected]
Auslieferungen
Deutschland:
GVA Gemeinsame Verlags-auslieferung Göttingen Postfach 2021 D-37010 Göttingen Tel: 05 51 / 48 71 77 Fax: 05 51 / 4 13 92 [email protected]
Schweiz:
AVA Verlagsauslieferung AG Centralweg 16 CH-8910 Affoltern am Albis Tel: 044 / 762 42-50 Fax: 044 / 762 42-10 [email protected]
Österreich:
Mohr Morawa Buchvertrieb Sulzengasse 2 A-1230 Wien Tel: 01 / 6 80 14-0 Fax: 01 / 6 80 14-140 [email protected]
Verlagsvertretung
Deutschland:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, SaarlandNicole Grabert
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern, Schleswig-HolsteinJudith Heckel
Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ThüringenChristiane Krause
Verlagsvertretungen Nicole Grabert/ Judith Heckel / Christiane Krause c/o indiebook Bothmerstraße 21 D-80634 München Tel: 089 / 1 22 84 704 Fax: 089 / 1 22 84 705 [email protected] www.indiebook.de
Schweiz:
Graf Verlagsvertretungen GmbH Sebastian Graf Uetlibergstraße 84 CH-8045 Zürich Tel: 044 / 4 63 42 28 Fax: 044 / 4 50 11 55 [email protected]
Österreich:
Helga Schuster Verlagsvertretungen Schönbrunnerstr. 133/4 A-1050 Wien Tel: 06 76 / 5 29 16 39 Fax: 06 76 / 5 29 16 39 [email protected]
Wallstein VerlagHerbst 2012
Gegenwart
Editionen
Geschichte
Kulturwissenschaften
Wissenschaftsgeschichte
Über Literatur
W_Vorschau_Titel_cl_2_12_RZ_1.indd 4-5 26.04.12 15:30

Wallstein Verlag Herbst 2012
Die angegebenen österreichischen Euro preise sind die Letzt verkaufs mindestpreise der österreichischen Auslieferung.
Inhalt
Gegenwart 3 Hans Wollschläger Die Gegenwart einer Illusion 4 Mit Gunst und Verlaub!
Editionen
5 Stefan Andres Die Versuchung des Synesios 6 Christine Lavant Das Wechselbälgchen 8 Joseph Roth Heimweh nach Prag 9 Armin T. Wegner Der Knabe Hüssein und andere
Erzählungen 10 Franz Kafka In der Strafkolonie 12 Rainer Maria Rilke Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge 14 Arnold Höllriegel Amerika-Bilderbuch 15 Constantin Brunner Ausgewählte Briefe 16 Da wir uns nun einmal nicht vertragen 17 Johann Heinrich Merck Gesammelte Schriften 18 Berliner Kunstakademie und Weimarer Freye
Zeichenschule 19 LouisSébastien Mercier Bücher, Literaten und Leser
am Vorabend der Revolution
Geschichte
20 Jörg Lahme William Drennan und der Kampf um die irische Unabhängigkeit
21 Urte von Berg Patriotische Salons in Berlin 22 Peter Reichel Glanz und Elend deutscher Selbst -
darstellung 24 Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter Vorträge 25 Helmut Lethen Suche nach dem Handorakel 26 Quentin Skinner Genealogie des Staates 27 Lyndal Roper Der feiste Doktor 28 Kurt F. Rosenberg »Einer, der nicht mehr dazugehört« 30 Berthold Schenk Graf von Stauffenberg Auf einmal ein
Verräterkind 31 Alexander Gallus Heimat »Weltbühne« 32 Das soziale Gedächtnis und die Gemeinschaften der
Überlebenden 33 Emil Behr: Briefzeugenschaft vor, aus, nach
Auschwitz 1938 –1959 34 Der Holocaust in der deutschsprachigen
Geschichtswissenschaft 35 Ungleichheiten im »Dritten Reich« 36 Regina Fritz Nach Krieg und Judenmord 37 Christian Lannert »Vorwärts und nicht vergessen«? 38 Dorothea Trebesius Komponieren als Beruf 39 Europabilder im 20. Jahrhundert 40 Jenny Pleinen Die Migrationsregime Belgiens und der
Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg 41 Hamburgische Biografie 6 42 Den Unterdrückten eine Stimme geben? 43 History by Generations 44 Das Politische als Kommunikation 44 Christian Büschges Demokratie und Völkermord 45 Neithard Bulst Recht, Raum und Politik 45 Olaf Kaltmeier Politische Räume jenseits von
Staat und Nation 46 Ulrich Meier / Martin Papenheim /Willibald
Steinmetz Semantiken des Politischen 46 Stephan Merl Politische Kommunikation
in der Diktatur 47 Sebastian Thies Ethnische Identitätspolitik
im Medienwandel 47 Tobias Weidner Die Geschichte des Politischen in der
Diskussion
Kulturwissenschaften
48 Christian Kiening und Ulrich Johannes Beil Urszenen des Medialen
49 Markus Bertsch Sammeln – Betrachten – Ausstellen 50 Der Raum in den Künsten 51 Reden und Schweigen über religiöse Differenz 52 Das Imaginäre im Sozialen 53 Erik Jayme Zugehörigkeit und kulturelle Identität 54 Helga Nowotny Auf der Suche nach Exzellenz
Wissenschaftsgeschichte
55 Christine von Oertzen Strategie Verständigung 56 Wiederanfang und Ernüchterung in der Nachkriegszeit
Über Literatur
57 Wolfgang Braungart und Joachim Jacob Stellen, schö-ne Stellen
58 Martin von Koppenfels Schwarzer Peter 59 Nadja Müller Moral und Ironie bei Gottlieb Wilhelm
Rabener 60 Susanne Mildner L’Amour à la Werther 61 Katharina Mommsen »Orient und Okzident sind nicht
mehr zu trennen« 62 Yvonne Nilges Schiller und das Recht 63 Denk- und Schreibweisen einer Intellektuellen
im 20. Jahrhundert 64 WiebkeMarie Stock Denkumsturz 65 Sylvia Weiler Jean Amérys Ethik der Erinnerung 66 Zwischen Sprache und Geschichte 67 Horst Bienek – Ein Schriftsteller in den Extremen
des 20. Jahrhunderts 68 Macht und Ohnmacht des Wortes 69 Europa in der Schweiz
Periodica
70 Lessing Yearbook/Jahrbuch 70 Goethe-Jahrbuch 70 Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 71 Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 71 Blätter der Rilke-Gesellschaft 71 Zuckmayer-Jahrbuch 72 Johnson-Jahrbuch 72 Das achtzehnte Jahrhundert 72 Geschichte der Germanistik 73 Valerio 73 Potsdamer Almanach des Zentrums für Zeithistorische
Forschung 73 Orden Pour le mérite für Wissenschaft und Künste
74 Erfolgreiche Titel aus dem Frühjahrsprogramm 2012 75 Literaturprogram Herbst 2012

Wallstein Verlag Herbst 2012Gegenwart 3
Religionskritik als Erinnerungs-arbeit – mit rhetorischer Wucht gegen das Monstrum Kirche.
Diese Reden gegen das Monstrum Kirche – wobei sich die beiden ›großen‹ und die zahllosen kleinen christlichen Konfessionen angesprochen fühlen dürfen – stehen in der Tradition der Aufklärung, die sich grundsätzlich und entschieden über die Jahrhunderte gegen die Macht des Monstrums zur Wehr setzte. In den Texten dieses Bandes zeigt sich ein kämpferischer, humaner Agnostizismus als Literatur von Rang, etwa in Wollschlägers be drückendem Essay über die Hexenverfolgungen in Bamberg, der auf intensivem Quellenstudium beruht und seinerzeit großes Aufsehen erregt hat.
Hans WollschlägerDie Gegenwart einer IllusionReden gegen ein Monstrum
Hans Wollschläger – Schriften in Einzelausgaben.Herausgegeben von Monika Wollschläger
ca. 300 S., Leinen, Schutzumschlagca. € 28,– (D); € 28,80 (A)ISBN 9783835311039September WG 1118
Hans WollschlägerDie Gegenwart einer IllusionReden gegen ein Monstrum
Der AutorHans Wollschläger (1935 – 2007) war Übersetzer (u.a. von James Joyces »Ulysses«), Schriftsteller, Historiker, Religionskritiker, Rhetor, Essayist und Literarhistoriker. Er erhielt neben vielen anderen Auszeichnungen 1982 den erstmals vergebenen ArnoSchmidtPreis. Posthum wurde ihm 2007 der AugustGrafvonPlatenPreis der Stadt Ansbach verliehen.
In gleicher Ausstattung erschienen
Herzgewächse oder Der Fall Adams (2011); Der Andere Stoff. Fragmente zu Gustav Mahler (2010); »Wie man wird, was man ist«. Autobiographische Schriften (2009); Die Insel und einige andere Metaphern für Arno Schmidt (2008); Von Sternen und Schnuppen I. Bei Gelegenheit einiger Bücher (2006); Von Sternen und Schnuppen II. Bei Gelegenheit einiger Bücher (2006); Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens (2004); Die bewaffneten Wallfahrten gen Jerusalem. Geschichte der Kreuzzüge (2003); »Tiere sehen Dich an«. Essays, Reden (2002)

Wallstein Verlag Herbst 2012 4 Gegenwart
Lange Zeit vergriffen, jetzt aktualisiert und wieder liefer-bar: Das Standardwerk zu Handwerkern auf der Walz.
Als dieses Buch 1989 zum ersten mal erschien, war es eine kleine Sensation: Erstmals hatten hier wandernde Gesellen und Gesellinnen ein Buchprojekt über die Walz durch bereitwillige Auskünfte und ausführliche Berichte unterstützt. Das Buch beschreibt reisende Handwerker in Geschichte und Gegenwart: Gesellen, die eine uralte Tradition zum Alltagstrott wählen – die Walz. Historische Darstellung des Gesellenwanderns, Erfahrungsberichte junger Handwerker und Handwerkerinnen und Beobachtungen zur Sprache der Wandernden sind in diesem reich bebilderten Band zusammengefasst. Das Buch wurde von der Presse gelobt und auch viele wandernde Gesellen waren begeistert. Nach fünf Auflagen war das Buch fast zehn Jahre nicht mehr lieferbar. Die Herausgeber haben es für diese Neuauflage umfassend aktualisiert.
Neben einem kleinen Glossar, das die Walzsprache erschließt, sowie einer kurzen Vorstellung der Schächte finden sich zahlreiche Literaturhinweise im Anhang.
Mit Gunst und Verlaub!Wandernde Handwerker: Tradition und Alternative
Aktualisierte Neuausgabe
Herausgegeben von Anne Bohnenkamp und Frank Möbus
Mit Fotos von Ulla Lüthje
ca. 216 S., ca. 30 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 24,90 (D); € 25,60 (A)ISBN 9783835311909November WG 1753
Mit Gunst und Verlaub!Wandernde Handwerker: Tradition und Alternative
Die Herausgeber
Anne Bohnenkamp, geb. 1960, ist Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts / Frankfurter GoetheMuseums und lehrt als Honorarprofessorin Neuere deutsche Literatur an der Universität Frankfurt.
Frank Möbus, geb. 1958, ist außerplanmäßiger Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Göttingen und leitet dort eine Arbeitsstelle zur Provenienzforschung.
Die Fotografin
Ulla Lüthje, geb. 1947, Ausbildung als Fotografin, Arbeit als Porträtfotografin und freie Fotografin. Seit 1991 als Grundschullehrerin im Schuldienst tätig.

EditionenWallstein Verlag Herbst 20125
Ein historischer Roman, in dem die Umbruchszeit der Spätantike lebendig wird.
In den Mittelpunkt seines letzten großen Romans, 1971 posthum erschienen, stellt Stefan Andres die eindrucksvolle historische Gestalt des Synesios von Kyrene (um 368 – 413). Der Literat und Philosoph, Schüler der alexandrinischen Philosophin Hypatia, versucht in der Umbruchszeit zwischen Spätantike und Mittelalter das Erbe der griechischen Antike in Freiheit und Toleranz zu bewahren. Sein friedliches Leben auf dem Land wird durch Widersprüche und Feindschaften bedroht, die ihn schließlich zwingen, Verantwortung zu übernehmen. So gerät er schließlich als christlicher Bischof in den gefährlichen Strudel der Politik: Seine Berufung zwingt ihn in die Rolle des politischen Täters, der am Ende, überrannt von der Gewalt seiner Gegner, scheitert – eine zugleich tragische und leuchtende Gestalt.
Der Roman entfaltet vor dem Hintergrund der antiken Landschaft Nordafrikas alle Themen aus Philosophie, Theologie und Politik, die Andres sein Leben lang beschäftigt haben.
Nachwort und ausführliche Erläuterungen stellen die Entstehungsgeschichte des Romans dar und gehen auf die historischen Quellen ein.
Stefan AndresDie Versuchung des SynesiosRoman
Herausgegeben von Sieghild von Blumenthal und Doris Weirich
Stefan Andres – Werke in Einzelausgaben.Herausgegeben von Christopher Andres, Michael Braun, Georg Guntermann, Birgit Lermen, Erwin Rotermund
ca. 424 S., geb., Schutzumschlagca. € 32,– (D); € 32,90 (A)ISBN 9783835311886Oktober WG 1110
Stefan AndresDie Versuchung des SynesiosRoman
Stefan Andres
(1906 –1970) gilt als einer der wichtigsten Vertreter der inneren Emigration und war nach dem Zweiten Weltkrieg ein vielgelesener Autor. Zu seinen bekanntesten Werken zählen »Der Knabe im Brunnen« (1953), und »Wir sind Utopia« (1943).
Die Herausgeberinnen
Sieghild von Blumenthal, geb. 1942, unterrichtete nach dem Studium als Gymnasiallehrerin die Fächer Griechisch, Deutsch und Evangelische Religion; Dozentin für Evangelische Theologie an der Universität Marburg.
Doris Weirich, geb. 1955, studierte Katholische Theologie, Germanistik und Erziehungswissenschaften. Sie arbeitet als Bildungsreferentin in der Erwachsenenbildung im Bistum Trier und als Dekanatsreferentin. Von 1997 bis 2007 war sie Vize präsidentin der StefanAndresGesellschaft.
In gleicher Ausstattung erschienen
Der Knabe im Brunnen. Roman (2011); Wir sind Utopia. Prosa aus den Jahren 1933–1945 (2010); Terrassen im Licht. Ita lienische Erzählungen (2009); Gäste im Paradies. Moselländische Novellen (2008); Die Sintflut. Roman (2007)

6 Editionen
Christine Lavant Das WechselbälgchenErzählung
Zitha ist vom Schicksal geschlagen. Sie ist das uneheliche Kind einer Bauernmagd, geistig zurückgeblieben und körperlich entstellt. Die Leute im Dorf, die so katholisch wie abergläubisch befangen sind, haben für das traurige Schicksal des Mädchens eine einfache Erklärung: Böse Geister haben der unglücklichen Magd nach der Geburt das Kind geraubt und ihr stattdessen ein verhextes Mädchen untergeschoben. Einen Wechselbalg, wie er aus Sagen und Gespenstergeschichten der Alpengegenden bekannt ist. Er werde das ganze Dorf ins Unglück stürzen, heißt es. So nimmt der kollektive Wahn seinen Lauf, gegen den auch die Liebe der Mutter nichts auszurichten vermag. Schließlich wird dem Mädchen sogar nach dem Leben getrachtet.
Christine Lavant beschreibt die Ausgrenzung einer Schwachen aus der dörflichen Gemeinschaft mit großer Eindringlichkeit. Die erst 1998 posthum veröffentliche Erzählung steht auch für die Gefährdung unserer Zivilisation, die sich nicht zuletzt zu Lebzeiten Christine Lavants in der »Vernichtung unwerten Lebens« durch die Nationalsozialisten gezeigt hat.
Nachdem »Das Wechselbälgchen« längere Zeit vergriffen war, erscheint die Erzählung nun erstmals im Wallstein Verlag, herausgegeben von Klaus Amann, der eine kommentierte Werkausgabe von Christine Lavant vorbereitet.
Christine Lavant, die große österreichische Lyrikerin, ist als Prosaautorin neu zu entdecken.
Ihre ganz unvergleichliche Erzählung »Das Wechsel-bälgchen« – jetzt wieder lieferbar.
Christine Lavant
geboren 1915 in ärmlichsten Verhältnissen in St. Stefan im Kärntner Lavanttal, litt seit früher Kindheit an schwersten Erkrankungen, die sie lebenslang beeinträchtigten. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie mit Stricken. Sie begann schon in den 1930er Jahren mit dem Schreiben, ihre ersten Veröffentlichungen erschienen ab Ende der 1940er Jahre. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt sie 1954 und 1964 den GeorgTraklPreis für Lyrik und 1970 den Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur. Christine Lavant starb 1973. Ein beträchtlicher Teil ihres literarischen Nachlasses ist noch unveröffentlicht.
Der Herausgeber
Klaus Amann, geb. 1949, studierte Germanistik und Anglistik, Professor für Geschichte und Theorie des Literarischen Lebens, Leiter des Robert MusilInstituts Klagenfurt. Bücher u.a. über Adalbert Stifter, Robert Musil, Ingeborg Bachmann. Mitherausgeber der kommentierten digitalen Gesamtausgabe von Robert Musil.
Wallstein Verlag Herbst 2012

Wallstein Verlag Herbst 2012Editionen 7
Christine LavantDas WechselbälgchenErzählung
Herausgegeben von Klaus Amann
ca. 108 S., geb., Schutzumschlagca. € 16,90 (D); € 17,40 (A)ISBN 9783835311473September WG 1110

EditionenWallstein Verlag
Herbst 2012 8
Die Beiträge des großen Jour-nalisten Joseph Roth für das legendäre »Prager Tagblatt«.
Für keine andere Zeitung hat Joseph Roth so lange geschrieben wie für das seinerzeit weit über die Grenzen der Tschechoslowakei hinaus gelesene »Prager Tagblatt«: Der erste Beitrag des damals noch ganz unbekannten Germanistik studenten, ein Gedicht, erschien 1917, der letzte 1937, als der mittlerweile berühmte Journalist und Romancier schon seit Jahren im Exil lebte. Das »Prager Tagblatt« war für seine liberale und demokratische Gesinnung ebenso bekannt wie für sein vorzügliches Feuilleton – hier schrieb in den zwanziger Jahren, was in der deutschen Literatur Rang und Namen hatte. Falsches Pathos ließ der besondere Stil dieser Zeitung – Max Brod und Friedrich Torberg haben das ihm eigentümliche Element von Bohème beschrieben – nicht zu. Das tat Roth wohl, und noch wichtiger war ihm ihre verantwortungsvolle politische Haltung: Mit dem »Prager Tagblatt« brauchte er niemals zu brechen, hier konnte er ohne Vorbehalt über die Entwicklung in Deutschland berichten.
Die Edition, die mit über 150 Beiträgen eine weit umfangreichere Mitarbeit Roths beim »Prager Tagblatt« erkennen lässt, als bisher erschlossen wurde – auch mit noch unbekannten Texten –, folgt den Drucken im »Prager Tagblatt« in unveränderter Textgestalt.
»Auch in der kleinen Form, in sogenannten Brot- und Gelegenheitsarbeiten, erweist sich Roth als unerreichter Seismograph seiner Epoche.«
Manfred Papst, Neue Zürcher Zeitung
Joseph RothHeimweh nach PragFeuilletons – Glossen – Reportagen für das »Prager Tagblatt«
Herausgegeben von Helmuth Nürnberger
ca. 600 S., Leinen, Schutzumschlagca. € 39,90 (D); € 41,10 (A)ISBN 9783835311688Oktober WG 1118
Joseph RothHeimweh nach PragFeuilletons – Glossen – Reportagen für das »Prager Tagblatt«
Joseph Roth
(1894 –1939) zählt zu den wunder barsten und bedeutendsten deutschsprachigen Erzählern und Journalisten des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1894 im galizischen Brody geboren und starb 1939 im Pariser Exil. Werke u.a.: Hiob (1930); Radetzkymarsch (1932); Die Kapuzinergruft (1938); Die Legende vom heiligen Trinker (1939).
Der Herausgeber
Helmuth Nürnberger, geb. 1930, lehrte neuere deutsche Literaturwissenschaft in Flensburg und Hamburg. Mitherausgeber u.a. der Werke, Schriften und Briefe Theodor Fontanes sowie des FontaneHandbuchs. 1981 veröffentlichte er in der Reihe der RowohltMonographien einen Band über Joseph Roth (11. Aufl. 2006).
In gleicher Ausstattung erschienen
»Jede Freundschaft mit mir ist verderblich«. Joseph Roth und Stefan Zweig. Briefwechsel 1927 –1938. Hg. von Madeleine Rietra und Rainer Joachim Siegel. Mit einem Nachwort von Heinz Lunzer (2011)
Joseph Roth: »Ich zeichne das Gesicht der Zeit«. Essays – Feuilletons – Reportagen. Hg. und kommentiert von Helmuth Nürnberger (2010)
auch als E-Book erhältlich

Alltagsleben im Orient, Krieg und Greueltaten im Konflikt zwischen Türken und Armeniern, die Großstadt Istanbul am Anfang des 20. Jahrhunderts und die italienische Idylle.
Armin T. Wegner ist heute vor allem für sein Eintreten gegen den Völkermord an den Armeniern bekannt. Nun wird sein literarisches Werk endlich selbst wieder zugänglich. Als Autor von Hörspielen, Reise und RomanBestsellern, aber auch als Verfasser beherzter politischer Stellungnahmen hat er gegen die Mächtigen seiner Zeit angeschrieben (»Brief an Hitler«). Der vollendete Erzähler und Lyriker wird in einer dreibändigen Werkausgabe, die mit dieser Auswahl der Erzählungen startet, wieder lesbar.
Wegners frühe Miniaturen, die er selbst »Gedichte in Prosa« nannte, sind von dramatischem, kuriosem oder auch märchenhaftem Duktus. Ebenso zeitlos lesen sich seine »Türkischen Novellen«, die – inspiriert von seinen Erfahrungen in Anatolien – bis heute nichts von ihrer Spannung eingebüßt haben. Den Band beschließen Beispiele seiner späten Prosa.
Armin T. WegnerDer Knabe Hüssein und andere Erzählungen
Herausgegeben von Volker Weidermann
Armin T. WegnerAusgewählte Werke in drei Bänden, Bd. 1.Herausgegeben von Ulrich Klan im Auftrag der Armin T. Wegner Gesellschaft
ca. 304 S., geb., Schutzumschlagca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835311046Oktober WG 1110
Armin T. WegnerDer Knabe Hüssein und andere Erzählungen
Armin T. Wegner
(1886 –1978) war Jurist, expressionistischer Schriftsteller und Sanitäts unteroffizier während des Ersten Weltkriegs; später freier Schriftsteller, ab 1934 im italienischen Exil.
Der Herausgeber
Volker Weidermann, geb. 1969, ist Ressortleiter der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er studierte Germanistik und Politische Wissenschaften. Veröffentlichungen u.a.: Das Buch der verbrannten Bücher (2008); ausgezeichnet mit dem KurtTucholskyPreis für literarische Publizistik, Licht jahre (2006).
Im Wallstein Verlag erschienen
Armin T. Wegner: Die Austreibung des armenischen Volkes in die Wüste. Ein Lichtbildvortrag (2011)
Armin T. Wegner. Schriftsteller – Reisender – Menschenrechtsaktivist, hg. von Johanna WernickeRothmayer (2011)
EditionenWallstein Verlag Herbst 20129
auch als E-Book erhältlich

EditionenWallstein Verlag
Herbst 2012 10
Das Schreiben als Qual – Kafkas weltberühmte Erzählung typographisch gestaltet von Klaus Detjen.
Franz Kafkas Erzählung »In der Strafkolonie« beeindruckt noch fast 100 Jahre nach ihrer Entstehung als Parabel über die Abgründe der Menschheit. Ein Strafgefangener wird aufgrund einer geringen Verfehlung (»den Dienst verschlafen«) ohne sichtbare Verhandlung zum Tode verurteilt. »›Kennt er sein Urteil?‹ ›Nein‹, sagte der Offizier … ›Er kennt sein eigenes Urteil nicht?‹ ›Nein‹, sagte der Offizier wieder … ›Es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja auf seinem Leib.‹« Die Vollstreckung des Urteils soll durch einen namenlosen ›Apparat‹ ausgeführt werden, einer Erfindung des früheren Kommandanten der Kolonie, die dem Verurteilten das Urteil mit todbringenden Nadeln buchstäblich in den Körper »einschreibt«, bis das Ende eintritt.
Die Gestaltung der graphischen Abschnitte, im Druck in zwei Farben ausgeführt, entwirft eine Dramatik des Geschehens, indem eine »Partitur« des Einschreibsystems der Maschine strukturiert und visualisiert wird. Die Typographie des Textverlaufs wird in zwei verschiedenen Typen dargeboten, so treffen sich sinnbildlich Mensch und Maschine in ihrer »Verschriftlichung«.
Den Band beschließt ein kritscher Essay des KafkaSpezialisten Peter André Alt.
Franz KafkaIn der StrafkolonieEine Erzählung
Franz Kafka
(1883 –1924), einer der wichtigsten deutsch sprachigen Schrift steller des 20. Jahrhunderts.
Der Herausgeber
Klaus Detjen, geb. 1943 in Breslau, Typograph, Buchgestalter, lebt in der Nähe von Hamburg. Bis 2009 Professor für Typo graphie und Gestaltung an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Auszeichnungen und Preise zur Buchgestaltung und Typographie.
Peter-André Alt
geb. 1960 in Berlin, Literaturwissenschaftler an der FU Berlin. Schillerpreis 2005 der Stadt Marbach für die zweibändige SchillerBiographie (2. Aufl. 2004). Veröffentlichungen u.a.: Von der Schönheit zerbrechender Ordnungen. Körper, Politik und Geschlecht in der Literatur des 17. Jahrhunderts (2007); Ästhetik des Bösen (2010).
In der Reihe erschienen
Heinrich von Kleist: Über das Marionettentheater, hg., gestaltet und mit einer Nachbemerkung versehen von Klaus Detjen (2011); Edgar Allan Poe: Ein Sturz in den Malstrom. Übersetzt von Hans Wollschläger, hg., gestaltet und mit einer Nachbemerkung versehen von Klaus Detjen (2011)

EditionenWallstein Verlag Herbst 201211
Franz KafkaIn der StrafkolonieEine Erzählung
Mit einem Essay von PeterAndré Alt
Herausgegeben, gestaltet und mit einer Nachbemerkung versehen von Klaus Detjen
Typographische Bibliothek, Bd. 9
96 S., 16,0 x 24,0 cm, z.T. zweifarbig, Leinen, Schutzumschlag€ 29,– (D); € 29,90 (A)ISBN 9783835309791August WG 1111

12Wallstein Verlag
Herbst 2012 Editionen
Die Herausgeber
Thomas Richter, geb. 1964, Studium der Germanistik, Anglistik und Alten Geschichte in Münster, Lehraufträge an den Universitäten München, Eichstätt, Bern und Fribourg. Veröffentlichungen zu editionswissenschaftlichen Themen und u.a. zu Goethe, Bettina v. Arnim, Harry Graf Kessler und zur Exilliteratur.
Franziska Kolp, geb. 1954, Studium der Germanistik und der französischen Literatur an den Universitäten Bern und Poitiers; wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schweizerischen Literaturarchiv und dort unter anderem Betreuerin des Schweizerischen RilkeArchivs. Veröffentlichungen u.a.: Gestaltungen des Venus und Aphroditenmythos bei Joseph von Eichendorff (1989).
Irmgard M. Wirtz, geb. 1960, Studium der Germanistik und Geschichte; seit 2006 Leiterin des Schweizerischen Literaturarchivs der Nationalbibliothek, Privatdozentin am Institut für Germanistik der Universität Bern. Veröffentlichungen u.a.: Joseph Roths Fiktionen des Faktischen (1997); Affekt und Erzählung. Zur ethischen Fundierung des Barockromans nach 1650 (2007).
Ein erstaunlicher Einblick in Rilkes Schreibprozess und die Entstehung eines der Schlüsseltexte der Moderne. Gestaltet von Friedrich Forssman.
Ein wichtiger Teilnachlass Rainer Maria Rilkes (1875 –1926) befindet sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern. Das sogenannte Berner Taschenbuch, ein schwarzes Notizbuch im Format 14 x 8 cm, ist eines der bedeutendsten Stücke aus diesem Bestand. Die Handschrift enthält den zweiten Teil des Entwurfs von Rilkes Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge« (1910). Wie man einem Brief vom 20. Oktober 1909 an seinen Verleger Anton Kippenberg entnehmen kann, muss es mindestens ein weiteres, nicht überliefertes Notizbuch gegeben haben, das den Anfang des Romantextes enthielt.
Das Berner Taschenbuch ermöglicht einmalige Einblicke in Rilkes Arbeitsweise und den Schreibprozess des Romans. Rilke zeigt sich hier nicht als »Originalgenie«, sondern als ein Autor, der in seinem Manuskript umfangreiche Änderungen vornahm und Varianten erprobte. So enthüllt diese Entwurfshandschrift eine Offenheit des Textes an verschiedenen Stellen, eine Fülle von Textvarianten, die in den früheren Editionen des Romans nicht enthalten sind.
Diese Edition macht die umfangreichen gestrichenen Stellen nun in zwei Bänden – Faksimile und Transkription mit Kommentar – zugänglich. Die topografische und seitenidentische Transkription wurde vom bekannten Typografen Friedrich Forssman entworfen. Ein kritischer Apparat weist die Veränderungen des Texts in Bezug auf den Erstdruck von 1910 nach. Ein editorischer Bericht und ein Nachwort erschließen die Ausgabe und führen in Rilkes Arbeitsweise und den Schreibprozess des Romans ein.
Rainer Maria RilkeDie Aufzeichnungen des Malte Laurids BriggeDas Manuskript des »Berner Taschenbuchs«. Faksimile und Textgenetische Edition

Wallstein Verlag Herbst 201213Editionen
Rainer Maria RilkeDie Aufzeichnungen des Malte Laurids BriggeDas Manuskript des »Berner Taschenbuchs«. Faksimile und Text genetische Edition
Herausgegeben von Thomas Richter und Franziska KolpMit einem Nachwort von Irmgard M. Wirtz
ca. 536 S., ca. 215 farb. Faksimiles, 2 Bde., geb. im Schuberca. € 39,90 (D); € 41,10 (A)ISBN 9783835311251August WG 1111

14 EditionenWallstein Verlag
Herbst 2012Wallstein Verlag
Herbst 2012 14
Der Autor
Arnold Höllriegel (eigentlich Richard A. Bermann, (1883 –1939), jüdischer Romanautor, Reiseschriftsteller und Feuilletonist aus Wien. Autor des ersten Filmromans »Die Films der Prinzessin Fantoche« (1911), Berichterstatter im Ersten Weltkrieg. Er bereiste Ägypten, Palästina, den Amazonas, die Südsee, die libysche Wüste und mehrmals die USA.
Der Herausgeber
Michael Grisko, geb. 1971, studierte Germanistik, Politik und Europäische Medienwissenschaften in Kassel und Dijon. Seit 2010 bei der SparkassenKulturstiftung HessenThüringen beschäftigt. Veröffentlichungen: Neueditionen von Höllriegels Romanen »Die Films der Prinzessin Fantoche« (2004), »Bimini« (2008) und »Du sollst Dir kein Bildnis machen« (2010).
Der Fotograf
Hans G. Casparius (1900 –1985) unternahm 1930 seine erste Reise als Fotograf mit Arnold Höllriegel nach Afrika, 1931 reisten beide nach Alaska und Kanada und kamen auf der Rückreise auch durch New York. Nach zahlreichen Arbeiten für Filmproduktionen (u.a. »Die Dreigroschenoper«) wanderte Casparius 1935 nach England aus.
Lakonisch und kritisch – Arnold Höllriegels »Amerika-Bilder-buch« zeigt die Gesellschaft der USA am Ende der 1920er Jahre jenseits aller Klischees.
Arnold Höllriegel gehört zu den populärsten Feuilletonisten und Reiseschriftstellern der Weimarer Republik. Wie viele seiner Kollegen besuchte auch er in den 1920er Jahren gleich mehrmals die USA. Mit dem »AmerikaBilderbuch« liegen nun erstmals seine Aufzeichnungen einer Reise aus den späten 1920er Jahren vor, die ihn mit dem Auto durch ganz Amerika, von New York bis Los Angeles, von Chicago bis Mexiko führte.
Seine Betrachtungen der amerikanischen Gesellschaft im Alltag, aber auch der einzigartigen Natur eröffnen einen ebenso lakonischen wie kritischen Blick auf die noch junge Geschichte der Vereinigten Staaten, jenseits stereotyper und auf die großen Städte fixierter Betrachtungen.
Der erstmals aus dem Nachlass edierte Text wird von Michael Grisko in einem Essay historisch eingeordnet. Ergänzt wird diese außergewöhnliche Neuedition durch zahlreiche, ebenfalls erstmals ver öffentlichte Fotos von einer späteren Reise Arnold Höllriegels durch Nord amerika mit Hans Casparius.
Arnold HöllriegelAmerika-BilderbuchMit Fotografien von Hans Casparius
Herausgegeben von Michael Grisko im Auftrag des Deutschen Exilarchivs 1933 –1945
ca. 160 S., ca. 20 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 19,90 (D); € 20,50 (A)ISBN 9783835310988Oktober WG 1118
Arnold HöllriegelAmerika-BilderbuchMit Fotografien von Hans Casparius

Wallstein Verlag Herbst 2012Editionen 15
Zum 150. Geburtstag und 75. Todestag am 27. August erscheinen aus unpublizierten Quellen die leidenschaftlichen Briefe eines Denkers, der sich einer Lebens praxis verschrieben hatte, die von seiner Philosophie bestimmt war.
Der Philosoph und Gesellschaftskritiker Constantin Brunner konzipierte mit seiner 1908 erschienenen »Lehre von den Geistigen und vom Volk« ein Werk, dessen lebenspraktische Intention einen begeisterten und kulturhistorisch bemerkenswerten Anhängerkreis fand, zu dem u.a. Gustav Landauer, Walther Rathenau, Lou AndreasSalomé oder auch Rose Ausländer zählten. Brunner gehörte zu den frühen Kritikern des Nationalsozialismus, bekämpfte andererseits aber auch den Zionismus als einen falschen politischen Ausweg. 1933 musste er emigrieren, der Kreis seiner Anhänger wurde zersprengt.
Brunners Korrespondenz dokumentiert eindrücklich diese Geschehnisse.Aus den 4.000 überlieferten Briefen Brunners wurden für diese Edition die kulturgeschichtlich, philosophisch und literarisch bedeutsamsten ausgewählt und in ihren Bezügen zum Zeitgeschehen und zu Brunners philosophischen Anliegen kommentiert. Sie geben ein anschauliches Bild dieses umstrittenen Denkers, seiner markanten Persönlichkeit, seines unbeirrten Lebensweges und seines nachdrücklichen philosophischpolitischen Anliegens, das überraschend neue Perspektiven auf Denkbewegungen zwischen dem Kaiserreich und der Nazizeit eröffnet.
Constantin BrunnerAusgewählte Briefe1884 –1937
Herausgegeben von Jürgen Stenzel und Irene AueBenDavid.Mit einem Vorwort von Gerhard Lauer
ca. 608 S., ca. 30 Abb. und 2 Faksimilesgeb., Schutzumschlagca. € 49,90 (D); € 51,30 (A)ISBN 9783835310940Oktober WG 1117
Constantin BrunnerAusgewählte Briefe1884 –1937
Constantin Brunner
(eigentlich Leo Wertheimer, 1862 –1937) war Philosoph, Literatur und Gesellschaftskritiker in Hamburg, Berlin und – ab 1933 als Exilant – in Den Haag. Er nahm zu zentralen politischen, kulturellen, sozialen und theologischen Debatten seiner Zeit Stellung, insbesondere zur »Judenfrage«. Hauptwerke: Die Lehre von den Geistigen und vom Volk (1908); Der Judenhass und die Juden (1918); Unser Christus oder das Wesen des Genies (1921); Materialismus und Idealismus (1928).
Die Herausgeber
Jürgen Stenzel, geb. 1962, Studium der Philosophie und Germanistik; Promotion in Hannover; wissenschaftlicher Mitarbeiter im Seminar für Deutsche Philologie an der Universität Göttingen; Forschungen zur deutschjüdischen Philosophie und zum Spinozismus.
Irene AueBenDavid, geb. 1972, Studium der Mittleren und Neueren Geschichte, Soziologie und Pädagogik; Promotion in Göttingen; wissenschaftliche Mitarbeiterin am Franz Rosenzweig Minerva Forschungszentrum in Jerusalem.
Gerhard Lauer, geb. 1962, ist Professor für Deutsche Philo logie an der Universität Göttingen.

EditionenWallstein Verlag
Herbst 2012 16
Mit diesem Band wird die dreibändige Edition des Briefwechsels von Bettine von Arnim mit ihren Söhnen Freimund (Band 1), Siegmund (Band 2) und Friedmund (Band 3) abgeschlossen.
Der Briefwechsel zwischen Bettine von Arnim und ihrem zweitältesten Sohn Siegmund ist eine der ungewöhnlichsten ElternKindKorrespondenzen überhaupt. Siegmund war politisch konservativ bis zum Reaktionären und verfolgte seine Überzeugungen mit Unnachgiebigkeit und Dogmatismus. Die Schriftstellerei seiner Mutter lehnte er ebenso ab wie ihr politisches und soziales Engagement.
Obwohl der Sohn sie immer wieder verbal attackierte und ihr harsche Vorwürfe machte, dass sie ihre Funktion als Mutter nicht adäquat ausfülle, setzte sich Bettine von Arnim wiederholt nachdrücklich für ihn ein. Indem sie ihm in ihren Briefen ausführliche Darstellungen der politischen und sozialen Verhältnisse in Berlin lieferte, versuchte sie ihn zugleich von der Richtigkeit ihrer politischen Ansichten zu überzeugen. Siegmunds Briefe dokumentieren in ungewöhnlicher Plastizität die Laufbahn eines mittleren preußischen Diplomaten um 1850, der als Legationssekretär in Karlsruhe erst die Märzrevolution von 1848 und dann die Badische Revolution hautnah mitverfolgen konnte.
Da wir uns nun einmal nicht vertragenBettine von Arnims Briefwechsel mit ihrem Sohn Siegmund
Herausgegeben von Wolfgang Bunzel und Ulrike Landfester
Bettine von Arnims Briefwechsel mit ihren Söhnen, Bd. 2
ca. 736 S., ca. 8 Abb., Leinen, Schutzumschlagca. € 59,– (D); € 60,70 (A)ISBN 9783892442417Oktober WG 1117
Da wir uns nun einmal nicht vertragenBettine von Arnims Briefwechsel mit ihrem Sohn Siegmund
Bettine von Arnim
(1785 –1859), geborene von Brentano, hatte mit Achim von Arnim sieben Kinder. Berühmt wurde sie durch ihr Buch »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde«. Sie war eine vielbeachtete Dichterin der Romantik. In ihrem politischen Wirken trat sie vor allem für die geistige und politische Emanzipation von Frauen wie auch Juden ein.
Siegmund von Arnim
(1813 –1890) war der zweitgeborene Sohn. Als einziger der Söhne kümmerte er sich nicht um die Bewirtschaftung der familieneigenen Güter, sondern schlug die Laufbahn eines preußischen Diplomaten ein.
Die Herausgeber
Wolfgang Bunzel, geb. 1960, studierte Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Komparatistik und Philosophie in Regensburg und München. Er ist Leiter der BrentanoAbteilung im Freien Deutschen Hochstift, Frankfurt.
Ulrike Landfester, geb. 1962, Studium der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft, Mediävistik und Anglistik in Freiburg und München. Habilitation über Bettine von Arnims politisches Werk. Seit 2003 ist sie Professorin für deutsche Sprache und Literatur an der Universität St. Gallen.

EditionenWallstein Verlag Herbst 201217
Das Jahr 1778 zeigt Merck auf dem Höhepunkt seines publizistischen Schaffens.
Das Jahr 1778 zeigt Merck auf dem Höhepunkt seines publizistischen Schaffens. Dem versierten Darmstädter Kriegrat Johann Heinrich Merck steht der »Teutsche Merkur« jetzt in all seinen Sparten offen. In fünf Lieferungen erscheint, changierend zwischen Novelle und agrarischer Aufklärungsschrift, die »Geschichte des Herrn Oheims«, flankiert von dem poetologischen Seitenstück »Ueber den Mangel des Epischen Geistes in unserem lieben Vaterland«. Als Kunstkritiker schafft Merck Standards, durch sensible Bildbeschreibungen ebenso wie durch die kenntnisreiche Identifizierung von Fälschungen und die Kriterien zur Anlage einer Kupferstichsammlung. Mit 81 Rezensionen unterschiedlichster Werke übernimmt er den überwiegenden Anteil im ›Kritischen Fach‹. Mit Intellektualität und Taktik meistert er den Konflikt zwischen Lavater und Lichtenberg, in den der »Teutsche Merkur« mitsamt seinem Herausgeber Wieland zu geraten droht.
Der Ertrag des Jahres 1778 füllt Band 4 innerhalb der chronologisch angelegten Ausgabe der »Gesammelten Schriften«.
Johann Heinrich MerckGesammelte Schriften1778
Herausgegeben von Ulrike Leuschner unter Mitarbeit von Amélie Krebs
Gesammelte Schriften, Bd. 4
ca. 576 S., ca. 10 Abb., Leinen, Schutzumschlagca. € 34,90 (D); € 35,90 (A)ISBN 9783835311053Oktober WG 1111
Johann Heinrich MerckGesammelte Schriften1778
Der Autor
Johann Heinrich Merck (1741 –1791) war Kriegsrat in Darmstadt und als Kunst, Literatur und Wissenschaftskenner publizistisch tätig.
Die Herausgeberin
Ulrike Leuschner ist Literaturwissenschaftlerin in Darmstadt. Studium der Germanistik und Philosophie in Würzburg; Herausgeberin von Maler Müllers »Dramatisirtem Faust« (1996). Mitherausgeberin von »treibhaus. Jahrbuch für die Literatur der fünfziger Jahre«.
Bisher erschienen
Johann Heinrich Merck: Gesammelte Schriften, Bd. 1, hg. von Ulrike Leuschner (2011)
Johann Heinrich Merck: Gesammelte Schriften, Bd. 3, hg. von Ulrike Leuschner (2011)
Im Wallstein Verlag erschienen
Johann Heinrich Merck: Briefwechsel, hg. von Ulrike Leuschner (2007)

EditionenWallstein Verlag
Herbst 2012 18
Ein Berliner Aufklärer über seine Liebe zu Weimar und den Kampf um Gewissensfreiheit im nachfriderizianischen Preußen.
Nach seinem Besuch bei dem Verleger und Unternehmer Friedrich Justin Bertuch in Weimar im Herbst 1788 schrieb der Buchhändler und Sekretär der »Königlich Preußischen Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften«, Andreas Riem, 17 Briefe an seinen neuen Geschäftsfreund. Sie werden, ausführlich kommentiert, hier erstmals vorgelegt. Die Briefe berichteten vom Kampf Riems und anderer Berliner Aufklärer gegen die Restriktionen durch das Religions und das Zensuredikt unter Friedrich Wilhelm II. und belegen zudem die Bedeutung, die die Berliner Kulturpolitiker der Unterstützung aus Weimar bei der Reform ihrer Kunstakademie nach 1786 beimaßen. Sie zeigen, wie durch Riems Initiative die enge Zusammenarbeit zwischen Berliner und Weimarer Kunst und Kulturpolitikern begann und wie die Ehrenmitgliedschaften der Akademie für Herzog Carl August, Bertuch, Goethe, Wieland, Herder und Georg Melchior Kraus zustande kamen. Sie bringen damit auch Licht in eine Frage der GoetheForschung und schaffen zudem Klarheit über die Hintergründe der von Goethe und Carl August beförderten »Bestallung« von Karl Philipp Moritz zum Professor der schönen Künste an der Berliner Kunstakademie.
Berliner Kunstakademie und Weimarer Freye ZeichenschuleAndreas Riems Briefe an Friedrich Justin Bertuch 1788/89
Herausgegeben von Anneliese Klingenberg und Alexander Rosenbaum
ca. 176 S., ca. 10 Abb., geb., Schutzumschlag ca. € 19,90 (D); € 20,50 (A) ISBN 9783835311916 Juli WG 1117
Berliner Kunstakademie und Weimarer Freye ZeichenschuleAndreas Riems Briefe an Friedrich Justin Bertuch 1788/89
Andreas Riem
(1749 –1814), Theologe, Schriftsteller, Buchhändler, Verleger und Publizist, Verfasser radikaler aufklärerischer Schriften.
Friedrich Johann Justin Bertuch
(1747 –1822), Schriftsteller, Übersetzer, herzoglicher Geheimsekretär und Schatullverwalter, Unternehmer und Verleger, Initiator der »Herzoglichen Freyen Zeichenschule«.
Die Herausgeber
Anneliese Klingenberg, geb. 1933, von 1971 bis 1990 Mitarbeiterin an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 1991 bis 2000 Projektleiterin am Forschungszentrum Europäische Aufklärung Berlin/Potsdam sowie 1991 bis 1998 Privatdozentin und außerplanmäßige Professorin an der Universität Leipzig, Mitherausgeberin der kritischen Karl Philipp MoritzGesamtausgabe, Aufsätze und Datenbank zur »Sächsischen Aufklärung«.
Alexander Rosenbaum, geb. 1973, von 2007 bis 2010 Mitarbeiter des Goethe und SchillerArchivs, seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFGProjekt »Johann Heinrich Meyer – Kunst und Wissen im klassischen Weimar«, Veröffentlichungen zum Phänomen des Dilettanten und Amateurkünstlers im 18. Jahrhundert und zum Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller.
auch als E-Book erhältlich

EditionenWallstein Verlag Herbst 201219
Ein faszinierender Einblick in das literarische Leben im Paris vor der Revolution.
Mit seinem »Tableau de Paris« hat LouisSébastien Mercier als erster überhaupt die Großstadt als sozialen Kosmos entdeckt und mit empathischer Hingebung und scharfem Witz beschrieben. Das Werk, das in zwölf Bänden mit mehr als tausend Kapiteln ab 1781 veröffentlicht wurde, vibriert von der Unruhe der Jahre vor der Revolution, die der unermüdliche Flaneur und kritische Beobachter uns in jedem Abschnitt spüren lässt.
In dieser Auswahl sind erstmals ausschließlich Passagen zusammengefasst, die von Literaten und Publikationen, von Theater und Zensur erzählen. So wird die Welt der ›gens de lettre‹ wieder lebendig, in der Mercier agierte und in der die Revolution herannahte. Es entsteht ein wirbelndes Bild von Autoren, Verlegern, Journalen, Zensoren und all der kontroversen Kräfte und Spannungen unter ihnen – vieles davon ist in verwandelter Form auch im heutigen literarischen Leben zu beobachten: Mercier hält mit diesen Texten, die nun erstmals in deutscher Übersetzung vorliegen, nicht nur seiner Zeit, sondern gelegentlich auch uns den Spiegel vor.
Louis-Sébastien MercierBücher, Literaten und Leser am Vorabend der RevolutionAuszüge aus dem »Tableau de Paris«
Ausgewählt und übersetzt von Wulf D. v. Lucius
ca. 160 S., ca. 6 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 19,90 (D); € 20,50 (A)ISBN 9783835309180September WG 1111
Louis-Sébastien MercierBücher, Literaten und Leser am Vorabend der RevolutionAuszüge aus dem »Tableau de Paris«
Der Autor
LouisSébastien Mercier (1740 –1814), war ein überaus fruchtbarer Theaterautor und Journalist, der neben seinem Mammutwerk »Tableau de Paris« (1781 ff.) mit seinem utopischen Roman »Das Jahr 2040« (1771) als einer der Begründer des Science FictionGenres gilt.
Wulf D. v. Lucius
geb. 1938, wissenschaftlicher Verleger in Stuttgart und leidenschaftlicher Büchersammler. Veröffent lichungen u.a.: »Das Glück der Bücher« (2012); »Anmut und Würde. Bücher und Leben um 1800« (2005); »Bücherlust. Vom Sammeln« (1999).
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 20
Leben und Denken des vergessenen Gründers der United Irishmen – der wichtigsten irischen Unabhängigkeitsbewegung des 18. Jahrhunderts.
Der Arzt, Poet und Politiker William Drennan (1754 –1820) ist eine zu Unrecht vergessene Figur der irischen Geschichte. Als Poet hat er den berühmten irischen Dichter Thomas Moore und dessen »Irish Melodies« maßgeblich beeinflusst. Als Denker war er der Mentor des heutigen Übervaters aller irischen Freiheitskämpfer, Theobald Wolfe Tone. Als Politiker war er der Mitgründer der United Irishmen, der Vorläufer der heutigen IRA.
Lahmes Biographie bietet die erste zusammenhängende wissenschaftliche Studie über sein Leben und Wirken. Auf der Grundlage zahlreicher privater Briefe, unveröffentlichter Manuskripte und Notizbücher geht seine Untersuchung bis an die Wurzeln des heutigen Nordirlandkonfliktes. Daneben wird ein kompakter Überblick über das kulturelle und politische Irland des 18. und 19. Jahrhunderts geboten. Wer den Nordirlandkonflikt unserer Zeit und das nach wie vor schwierige Verhältnis zwischen irischen Katholiken und irischen Protestanten verstehen will, kommt nicht umhin, sich mit den United Irishmen und ihren Ideen zu beschäftigen. William Drennan als der wesentliche Ideengeber der Bewegung darf dabei nicht fehlen.
Jörg LahmeWilliam Drennan und der Kampf um die irische UnabhängigkeitEine politische Biographie
ca. 480 S., ca. 5 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 34,90 (D); € 35,90 (A)ISBN 9783835310339Oktober WG 1555
Jörg LahmeWilliam Drennan und der Kampf um die irische UnabhängigkeitEine politische Biographie
Der Autor
Jörg Lahme, geb. 1976, studierte Deutsch und Geschichte in Kiel, forschte in den Archiven von Belfast und Dublin und lebt heute in Göttingen.
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201221
Ein lebendiges Panorama der »Franzosenzeit« im Berlin der Jahre 1806 bis 1813.
Salons als Orte zwangloser Geselligkeit versprechen anregende Unterhaltung in kultiviertem Rahmen, bieten aber auch Gelegenheit für grundsätzliche Gespräche oder gar politische Absprachen.
Als Preußen nach der vernichtenden Niederlage gegen Napoleon (1806) am Boden lag, engagierten sich auch Frauen politisch. An drei ausgewählten Salons wird gezeigt, wie sie auf ganz unterschiedliche Art an der Befreiung Preußens von der Fremdherrschaft mitwirkten:
Im Salon der Gräfin von Voß wurde der Aufstand Ferdinand von Schills (1809) unterstützt und begleitet. Bei Amalie von Beguelin traf sich der Politiker Hardenberg mit dem Offizier Gneisenau zu heimlicher Beratung. Die Künstlerin Elisabeth Stägemann hatte schon in Königsberg/Pr. einen musischen Salon geführt, wo die königliche Familie während ihres ostpreußischen Exils (1806 –1809) verkehrte. Ab 1810 wurde dieser nun patriotische Salon in Berlin weitergeführt.
Wenn Preußen als Staat überleben wollte, musste es sich durch Bildung und Reformen von innen heraus erneuern. Dafür bedurfte es der Begegnungen und Gespräche, die nicht zuletzt in patriotischen Salons stattfanden.
Urte von BergPatriotische Salons in Berlin1806 –1813
ca. 264 S., ca. 20 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 24,90 (D); € 25,60 (A)ISBN 9783835310308Oktober WG 1563
Urte von BergPatriotische Salons in Berlin1806 –1813
Die Autorin
Urte von Berg, geb. 1935, studierte Wissenschaftliche Politik, Germanistik und Anglistik in Hamburg, Oxford und Freiburg und arbeitete als freie Mitarbeiterin für Radio Bremen und DIE ZEIT. An der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel baute sie ein pädagogisches Programm auf.
Im Wallstein Verlag erschienen
Caroline Friederike von Berg – Freundin der Königin Luise von Preußen. Ein Portrait nach Briefen (2008); Theodor Gottlieb von Hippel. Stadtpräsident und Schriftsteller in Königsberg. 1741 –1796 (2004)

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 22
Peter ReichelGlanz und Elend deutscher SelbstdarstellungNationalsymbole in Reich und Republik
Als eine sinnliche Nation ist Deutschland kaum auffällig geworden. Aber auch mit der SinnBILDlichkeit tut man sich hierzulande schwer, zumal in der Politik. Sie spiegelt in zeichenhaft verdichteter Weise, wovon hier berichtet werden soll: von Glanz und Elend der Selbstdarstellung einer Nation, die erst in jüngerer Zeit ein neues Verhältnis zu ihren politischen Farben, Festen und Liedern findet.
Der kriegerische Kampf Deutschlands um seine nationalstaatliche Einheit hat den Deutschen viel und der Welt noch mehr zugemutet. Fünf verschiedene politische Systeme sind in gut einhundert Jahren ausprobiert und verschlissen worden. Revolutionen, Weltkriege, Gewaltverbrechen, Besatzungsherrschaft und Teilung waren der Preis, unser Land aus expansionistischer Aggression und politischer Regression herauswachsen zu lassen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland ein zivilisierter und fest integrierter Partner der Staatengemeinschaft geworden. In der Geschichte der symbolischen Selbstdarstellung Deutschlands sehen wir in das Spiegelbild einer Nation, die mehr als drei Generationen gebraucht hat, in diesem Sinne politisch erwachsen zu werden.
Nationalsymbole als Spiegelbild einer Nation: über Denkmäler, Bauten, Hymnen, Farben und Feiertage.
Der Autor
Peter Reichel, geb. 1942, ist emeritierter Professor für Historische Grundlagen der Politik an der Universität Hamburg. Veröffentlichungen u.a.: Robert Blum 1807 –1848. Ein deutscher Revolutionär (2007); Der schöne Schein des Dritten Reiches. Gewalt und Faszination des deutschen Faschismus (Neuaufl. 2006); Schwarz – Rot – Gold. Kleine Geschichte deutscher Nationalsymbole (2005).

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201223
Peter ReichelGlanz und Elend deutscher SelbstdarstellungNationalsymbole in Reich und Republik
ca. 416 S., ca. 40, z.T. farb. Abb., geb., Schutzumschlagca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835311633September WG 1559

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 24
Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter VorträgeHerausgegeben von Bernhard Jussen und Susanne Scholz
Eine neue Reihe kurzer Essays zu zentralen Fragestellungen geisteswissenschaftlicher Forschung.
Die Reihenherausgeber
Bernhard Jussen, geb. 1959, ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Frankfurt a.M. und Sprecher des Forschungszentrums für Historische Geisteswissenschaften. Veröffentlichungen u.a.: Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit (Hg., 2005).
Susanne Scholz, geb. 1966, ist Professorin für englische Literatur und Kultur an der Universität Frankfurt a. M. Veröffentlichungen u.a.: Medialisierungen des Unsichtbaren um 1900 (Mithg., 2010); MenschenFormen. Visualisierungen des Humanen in der Neuzeit (Mithg., 2007).
Warum ›Historische Geisteswissenschaften‹? Welche Fragen stellen sie sich und mit welchen Ansätzen arbeiten sie? Wie wandern Methoden zwischen den einzelnen Disziplinen, wie kommunizieren sie, und lassen sich überhaupt die unterschiedlich arbeitenden Disziplinen unter dem Dach des ›Historischen‹ vereinen? Die Reihe »Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter Vorträge« stellt in pointierten Essays Ergebnisse geisteswissenschaftlicher Forschung vor. Sie dokumentiert damit die Arbeit des Frankfurter Forschungszentrums Historische Geisteswissenschaften, das sich die transdisziplinäre Vernetzung historisch perspektivierter geisteswissenschaftlicher Forschung zur Aufgabe gemacht hat.

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201225
Die Reflexionen eines Angehörigen der 68er Generation über die Wegscheiden seiner politischen Biografie.
»Handorakel« nannte der spanische Jesuit Balthasar Gracián 300 Regeln der Weltklugheit, die er 1647 zusammenstellte. Helmut Lethen zeigte in seinen Verhaltenslehren der Kälte (1994), dass das spanische Brevier durch alle politischen, philosophischen und künstlerischen Fraktionen der Weimarer Republik kursierte. In seinem Essay »Suche nach dem Handorakel« berichtet er jetzt davon, wohin der Wunsch nach einem radikalen Handbrevier, das Orientierung bietet und politische Handlungsräume öffnet, einen Angehörigen der 68er Generation treiben konnte. Die Erinnerungen, die sich auf den Zeitraum von 1964 bis 1980 konzentrieren, stehen dabei unter der paradoxen Parole: »Die historische Konstellation hat mehr aus uns herausgeholt, als drin war.«
Helmut LethenSuche nach dem HandorakelEin Bericht
Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter Vorträge, Bd. 1.Herausgegeben von Bernhard Jussen und Susanne Scholz
ca. 100 S., brosch.ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311596Oktober WG 1559
Helmut LethenSuche nach dem HandorakelEin Bericht
Der Autor
Helmut Lethen, geb. 1939, Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften (IFK) in Wien.Veröffentlichungen u.a.:Unheimliche Nachbarschaften: Essays zum KälteKult und der Schlaflosigkeit der philosophischen Anthropologie im 20. Jahrhundert (2009); Der Sound der Väter. Gottfried Benn und seine Zeit (2006); Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen (1994).
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 26
Ein Essay über die Geschichte der Vorstellungen vom Staat.
Verfolgt man die Genealogie des Staates zurück, stellt man fest, dass es nie ein übereinstimmendes Konzept gab, worauf sich der Begriff Staat bezog.
Quentin Skinner, einer der renommiertesten Forscher auf dem Feld der politischen Denkmuster, entwickelt im Anschluss an Kantorowicz’ vielzitierte Ausführungen zu den »zwei Körpern des Königs« eine intellektuelle Genealogie des Staates, beginnend in der Antike und endend in einem normativen Entwurf.
Quentin SkinnerGenealogie des Staates
Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter Vorträge, Bd. 2.Herausgegeben von Bernhard Jussen und Susanne Scholz
ca. 80 S., brosch.ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311572Oktober WG 1559
Quentin SkinnerGenealogie des Staates
Der Autor
Quentin Skinner, geb. 1940, Professor of Humanities an der University of London. Veröffentlichungen u.a.: Visionen des Politischen (Mithg., 2009); Freiheit und Pflicht. Thomas Hobbes’ politische Theorie (2008); Machiavelli zur Einführung (2008).
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201227
Ein kulturhistorischer Beitrag über die Bedeutung der Gestalt und Darstellung Martin Luthers.
In beinahe allen Darstellungen nach 1525 wird Martin Luther beleibt dargestellt. Im Unterschied zu Heiligen und anderen frommen Gestalten, deren Schlankheit als Beweis für ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Verführungen des Fleisches gilt, war Luthers Beleibtheit untrennbar mit seinem Image verbunden. Warum wurde Luther so dargestellt und wieso war sein Körper so wichtig für das Luthertum? In diesem Essay untersucht Roper, wie und warum das Bild seines Körpers seine Biographie bestimmte.
Lyndal RoperDer feiste DoktorLuther, sein Körper und seine Biografen
Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter Vorträge, Bd. 3.Herausgegeben von Bernhard Jussen und Susanne Scholz
ca. 80 S., ca. 10 Abb., brosch.ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311589Oktober WG 1559
Lyndal RoperDer feiste DoktorLuther, sein Körper und seine Biografen
Die Autorin
Lyndal Roper, geb. 1956, Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Oxford. Veröffentlichungen u.a: The Witch in the Western Imagination (2012); Hexenwahn. Geschichte einer Verfolgung (2007); Ödipus und der Teufel (1995); Das fromme Haus. Frauen und Moral in der Reformation (1995).
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 28
Kurt F. Rosenberg»Einer, der nicht mehr dazugehört« Tagebücher 1933 –1937
Kurt F. Rosenberg hatte seit seiner Jugend Tagebuch geführt. Seine Aufzeichnungen von 1933 bis 1937 geben einen lebendigen Eindruck davon, wie er und seine Familie, seine Bekannten und Berufskollegen die ersten fünf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft wahrnahmen. Eingeklebte Fotos und Zeitungsartikel ergänzen und illustrieren das Geschriebene. Rosenberg sammelte Nachrichten und Gerüchte über die Judenverfolgung, las aufmerksam die in und ausländische Presse und hielt die eigenen Erfahrungen fest, bittere wie auch positive. Er beschrieb seine kleinen und großen Fluchten in die Welt der Kunst, zu den Menschen, die er liebte, oder seine Reisen.
Nicht im Nachhinein – um den Ausgang der Judenverfolgung wissend – präsentiert uns Kurt F. Rosenberg seine Sicht auf die politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, sondern als Zeitgenosse und Betroffener, der sich seine Handlungskompetenz nicht nehmen lassen wollte. Als er sich Ende 1937 entschloss, mit der Familie in die USA zu emigrieren, stellte er das Tagebuchschreiben für immer ein.
Ein zeitgenössischer Blick eines jüdischen Rechtsanwalts auf das nationalsozialistische Deutschland ab 1933.
Der Autor
Kurt Fritz Rosenberg (1900 –1977), studierte Jura in Heidelberg, München und Hamburg. Nach seiner Promotion trat er als Syndikus in die Vereinigung Hamburger GetreideImporteure ein und gründete eine Anwaltskanzlei in Hamburg. 1933 verlor er als Jude die Zulassung als Anwalt und arbeitete als Rechtsberater weiter. Mit seiner Frau, der Ärztin Margarethe Rosenberg, und den beiden Töchtern wanderte er 1938 in die USA aus.
Die Herausgeber
Beate Meyer, geb. 1952, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg. Veröffentlichungen u.a.: »Jüdische Mischlinge«. Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933 –1945 (2007).
Björn Siegel, geb. 1977, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg. Veröffentlichungen u.a.: Österreichisches Judentum zwischen Ost und West. Die Israelitische Allianz zu Wien 1873 –1938 (2010).
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201229
Kurt F. Rosenberg»Einer, der nicht mehr dazugehört«Tagebücher 1933 –1937
Herausgegeben von Beate Meyer
Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden, Bd. 41.Herausgegeben in Zu sammenarbeit mit dem Leo Baeck Institute, New York
ca. 592 S., ca. 250 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 42,– (D); € 43,20 (A)ISBN 9783835311145September WG 1556

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 30
Eine sehr persönliche, minutiöse Darstellung der dramatischen Tage und Monate um den 20. Juli 1944.
In den Sommerferien 1944 erfuhren der zehnjährige Berthold Schenk Graf von Stauffenberg und seine Geschwister durch das Radio von einem »verbrecherischen Anschlag auf den Führer« – dass ihr Vater Claus Schenk Graf von Stauffenberg maßgeblich an diesem Umsturzversuch beteiligt gewesen war, erschien ihnen unfassbar: In der NSPropaganda galten sie nun als »Verräterkinder«.
Nach dem 20. Juli überschlugen sich die Ereignisse: die erwachsenen Familienmitglieder wurden verhaftet, die Kinder unter Aufsicht der Gestapo zunächst im Haus der Großmutter zurückgelassen und dann in ein Kinderheim in Bad Sachsa gebracht, wo sie bis zum Kriegsende zusammen mit zahlreichen anderen Kindern aus Widerstandsfamilien einquartiert blieben.
Ohne jegliche Sentimentalität berichtet von Stauffenberg nicht nur von der Zeit kurz vor dem Umsturzversuch und von seinen Erfahrungen und Erlebnissen im Nachkriegsdeutschland – besonders eindrücklich schildert er den Alltag im Kinderheim, der geprägt war von Verlustangst, Kontaktsperre und ständiger Sorge um den Verbleib der Familienmitglieder, mit denen er und seine Geschwister erst im Juni 1945 wieder zusammentrafen.
Berthold Schenk Graf von StauffenbergAuf einmal ein Verräterkind
Stuttgarter Stauffenberg Gedächtnisvorlesung 2011
Herausgegeben vom Haus der Geschichte BadenWürttemberg und der Landesstiftung BadenWürttemberg
48 S., Klappenbroschur€ 7,90 (D); € 8,20 (A)ISBN 9783835311060Juni WG 1556
Berthold Schenk Graf von StauffenbergAuf einmal ein Verräterkind
Der Autor
Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, geb. 1934, Offizier der Bundeswehr, vielfältige Truppen und Stabsverwendungen, u.a. Lehrtätigkeiten am britischen Army Staff College und an der Führungsakademie der Bundeswehr 1994, Eintritt in den Ruhestand als Generalmajor.
In der Reihe erschienen
Klaus von Trotha: Carl Dietrich und Margarete von Trotha – Kreisau und der Kreisauer Kreis (2011); Alfred von Hofacker: Cäsar von Hofacker – ein Wegbereiter für und ein Widerstandskämpfer gegen Hitler, ein Widerspruch? (2010); Richard von Weizsäcker: Die Brüder Stauffenberg (2009); Detlef Graf von Schwerin: Stauffenberg und die Junge Generation im deutschen Widerstand (2009); Hartmut von Hentig: Nichts war umsonst. Stauffenbergs Not (2008)
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201231
Die »Weltbühne« als geistiger Sehnsuchtsort für die »heimatlosen« Intellektuellen des 20. Jahrhunderts.
Die »Weltbühne« war eine der herausragenden politischkulturellen Zeitschriften der Weimarer Republik. Sie galt schon früh als Inbegriff für kritisches Engagement in Deutschland, und von ihr ging eine weit über ihr Verbot im März 1933 hinausreichende Wirkungskraft aus. Für viele Intellektuelle bildete sie eine geistige Heimat, deren Verlust sie melancholisch stimmte und die sie wiederbeleben wollten. Zu diesen »heimatlosen« Intellektuellen zählten Axel Eggebrecht, Kurt Hiller, William S. Schlamm und Peter Alfons Steiniger. Alexander Gallus zeigt anhand ihrer Biografien eine facettenreiche Intellektuellengeschichte des 20. Jahrhunderts. Er zeichnet ihr politisches Denken von den 1920er Jahren an bis in die 1970er Jahre hinein nach, untersucht ihr intellektuelles Rollenverständnis und ihre Positionierung in der politischen Öffentlichkeit.
Alexander GallusHeimat »Weltbühne«Eine Intellektuellengeschichte im 20. Jahrhundert
Hamburger Beiträge zur Sozial und Zeitgeschichte, Bd. 50.Herausgegeben von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg
ca. 416 S., ca. 20 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 34,90 (D); € 35,90 (A)ISBN 9783835311176September WG 1559
Alexander GallusHeimat »Weltbühne«Eine Intellektuellengeschichte im 20. Jahrhundert
Der Autor
Alexander Gallus, geb. 1972, Juniorprofessor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock, Vertretungsprofessur für »Politische Theorie und Ideengeschichte« an der Universität Chemnitz. Veröffentlichungen u.a.: Die vergessene Revolution von 1918/19 (Hg. 2010); Die Neutralisten. Verfechter eines vereinten Deutschland zwischen Ost und West 1945 –1990 (2006).
Im Wallstein Verlag erschienen
Rückblickend in die Zukunft. Politische Öffentlichkeit und intellektuelle Positionen um 1950 und um 1930, hg. von Alexander Gallus und Axel Schildt (2011); Intellektuelle im Exil, hg. von Peter Burschel, Alexander Gallus und Markus Völkel (2011)
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 32
Die Gemeinschaften und Verbände von Überlebenden der NS-Verbrechen als wichtige Akteure der Erinnerungskultur.
Aus dem Inhalt:Claus Füllberg-Stolberg / Andrea Rudorff: Überlebensbedingungen in KZAußen
lagern für FrauenThomas Rahe: Erinnerung im Übergang vom Konzentrationslager zum jüdischen
DPCamp BergenBelsenJoanna Wawrzyniak: Survivors, Memory and Politics in PostWar PolandOlivier Wieviorka: The Evolution of the French MemoryPhilipp Neumann: Das Internationale Komitee BuchenwaldDora und Komman
dosHarold Marcuse: Die Organisationen der Überlebenden von DachauJörg Skriebeleit: Milieux de mémoire – Gemeinschaften auf ZeitClaus Füllberg-Stolberg / Shaun Hermel: Die Erinnerung an die Israelitische
Gartenbauschule Ahlem in IsraelKenneth Waltzer: Child and Youth Survivors at Buchenwald and BergenBelsenJanine Doerry: Französische Frauen und Kinder von Kriegsgefangenen im Aus
tauschlager BergenBelsenRamona Saavedra Santis: Kommunikative Erinnerungsmuster von Über lebenden
des FrauenKonzentrationslagers Ravensbrück aus der Sowjet unionDominique Schröder: Geschlechterperspektiven in Tagebüchern aus Bergen
BelsenHeidemarie Uhl: Die Erinnerung der Überlebenden und die Zukunft des kul
turellen Gedächtnisses
Das soziale Gedächtnis und die Gemeinschaften der ÜberlebendenBergenBelsen in vergleichender Perspektive
Herausgegeben von Janine Doerry, Thomas Kubetzky und Katja Seybold
BergenBelsen – Dokumente und Forschungen, Bd. 3.Herausgegeben von der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten
ca. 288 S., ca. 10 Abb.,brosch.ca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835311893Dezember WG 1557
Das soziale Gedächtnis und die Gemeinschaften der ÜberlebendenBergen-Belsen in vergleichender Perspektive
Die Herausgeber
Janine Doerry, geb. 1972, Historikerin, Dissertationsprojekt zu Juden aus Frankreich in deutscher Kriegsgefangenschaft und im KZ BergenBelsen. Veröffentlichungen zur Geschichte der NSVerfolgung, zur Erinnerungskultur und Gedenkstättenpädagogik.
Thomas Kubetzky, geb. 1971, Historiker, Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der TU Braunschweig. Veröffentlichungen zur Militär und Mediengeschichte des Zweiten Weltkriegs, Geschichte der NSVerfolgung, Erinnerungskultur und zur Geschichtsdarstellung in Computerspielen.
Katja Seybold, geb. 1977, Historikerin, Dissertationsprojekt zum jüdischen Displaced Persons Camp BergenBelsen. Veröffentlichungen zur Geschichte der NSVerfolgung, zur Erinnerungskultur und zur Geschichte der DDR.
Im Wallstein Verlag erschienen
John Cramer: Belsen Trial 1945. Der Lüneburger Prozess gegen Wachpersonal der Konzentrationslager Auschwitz und BergenBelsen (2011)
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201233
Ein Plädoyer für eine Neudefinition der »Zeugenschaft« im Zusammenhang mit den Ereignissen des Holocaust und der frühen Nachkriegszeit.
Der Band erscheint begleitend zur gleichnamigen Ausstellung, die von November 2012 bis März 2013 im Jüdischen Museum Frankfurt zu sehen ist.
Zeugenschaft ist ein kommunikatives Ereignis, zu dem (mindestens) zwei Personen gehören. Ist also eine Zeugenschaft ohne lebende Zeugen denkbar? Ist es möglich, allein aufgrund eines Zugangs über schriftliche Dokumente Zeuge für eine Geschichtserfahrung zu werden? Ohne ansprechbares Gegenüber?
Anhand eines einzelnen, privaten Briefkonvoluts aus den Jahren 1938 bis 1959 versuchen verschiedene Autoren diese Fragen zu beantworten. Emil Behr, der seit 1938 in einem jüdischen Altersheim arbeitete, wurde 1944 nach Auschwitz deportiert, nachdem er versucht hatte, vor einem Arbeitsgericht sein Gehalt einzuklagen. Er überlebte und trat später als Zeuge in den Voruntersuchungen zum Frankfurter Auschwitzprozess auf. Den in dem Buch versammelten, akribischen Auseinandersetzungen mit den Briefen und Dokumenten liegt die Annahme zu Grunde, dass auch die Lektüre von Briefen ein kommunikatives Ereignis sein kann – es kommt nur darauf an, wie man sie liest. Diesem methodischen Konzept folgend, versammelt der Band ca. 100 farbig reproduzierte Dokumente in einer integrierten Loseblattsammlung.
Mit Beiträgen von: Monique Behr, Jesko Bender, Kurt Grünberg, Beate Meyer, Andree Micha elis, Werner Renz, Christoph Schneider, Kevin Vennemann und Harald Welzer.
Emil Behr: Briefzeugen-schaft vor, aus, nach Auschwitz 1938 –1959
Herausgegeben von Monique Behr und Jesko Bender
Format: 20 x 25,5 cm, mit eingebundener Dokumentenmappe, ca. 144 S., ca. 140, überw. farb. Abb., brosch.ca. € 19,90 (D); € 20,50 (A)ISBN 9783835311862November WG 1550
Emil Behr: Briefzeugenschaft vor, aus, nach Auschwitz 1938 –1959
Die Herausgeber
Monique Behr, geb. 1965, studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie in Karlsruhe, Heidelberg und Paris. Seit 1997 arbeitet sie als Ausstellungsmanagerin im Mu seum für Kommunikation Frankfurt und lehrt seit 2008 an der Universität Frankfurt Ausstellungskonzeption. Sie kuratiert regelmäßig für das Jüdische Museum in Frankfurt am Main.
Jesko Bender, geb. 1980, Studium der Germanistik und Politikwissenschaft, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur der Universität Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte umfassen Theorien und Poetiken der Zeugenschaft, die Schnittstellen von Politik, Geschichte und Literatur, sowie die Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts.

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 34
Die Ära der Zeitzeugen endet: eine aktuelle Standortbestim-mung der Holocaust-Forschung in Deutschland unter sich wan-delnden Vorzeichen
Das Ableben der letzten Zeitzeugen, das langsam nachlassende Medieninteresse sowie die neue Schwerpunktsetzung von zeitgeschichtlich ausgerichteten Instituten erfordern eine neue Standortbestimmung der HolocaustForschung. Die Autorinnen und Autoren diskutieren, inwieweit der Holocaust in der akademischen Lehre an deutschen und österreichischen Universitäten verankert ist und welche Forschungstendenzen sich in den letzten beiden Jahrzehnten abzeichneten.
Aus dem Inhalt:Peter Longerich: Forschungssituation in DeutschlandDieter Pohl: Holocaust, Genozid und Gewalt in Forschung und LehreJürgen Matthäus: HolocaustForschung in Deutschland: eine Geschichte ohne
Zukunft?Wendy Lower: HolocaustStudien in Deutschland im internationalen KontextStefanie Schüler-Springorum: Zum Umgang mit jüdischen Selbstzeugnissen
und TäterdokumentenThomas Sandkühler: Ghettos und Lager in mikrogeschichtlicher PerspektiveRobert Sigel: Holocaust Education oder historischpolitischer Unterricht zum
NationalsozialismusAndreas Wirsching: Schwerpunktsetzungen in der akademischen LehreMaximilian Strnad: »Grabe, wo Du stehst«: Zur Bedeutung des Thema »Holo
caust« für die Geschichtswerkstattbewegung
Der Holocaust in der deutschsprachigen GeschichtswissenschaftBilanz und Perspektiven
Herausgegeben von Michael Brenner und Maximilian Strnad
Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte, Bd. 12.Hg. i.A. der Stadt Dachau und des Jugendgästehauses Dachau von Bernhard Schoßig
ca. 288 S., ca. 10 Abb., brosch.ca. € 20,– (D); € 20,60 (A)ISBN 9783835311497Oktober WG 1947
Der Holocaust in der deutschsprachigen GeschichtswissenschaftBilanz und Perspektiven
Die Herausgeber
Michael Brenner, geb. 1964, Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur am Historischen Seminar der LudwigMaximilians Universität München, Internationaler Vizepräsident des Leo Baeck Instituts. Veröffentlichungen u.a.: DeutschJüdische Geschichte in der Neuzeit (Mithg. 1996 – 2012); Kleine Jüdische Geschichte (2008); Nach dem Holocaust: Juden in Deutschland 1945 –1950 (1995).
Maximilian Strnad, geb. 1976, arbeitet am NSDokumentationszentrum München, Forschungsschwerpunkt: Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Veröffentlichungen u.a.: Zwischenstation »Judensiedlung«. Vertreibung und Deportation der jüdischen Münchner (2011).
In der Reihe zuletzt erschienen
Die Kirchen und die Verbrechen im nationalsozialistischen Staat, hg. von Thomas Brechenmacher und Harry Oelke (2011)
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201235
Das NS-Regime schuf eine dynamische Ordnung der Ungleichheit, die jedem Einzelnen seinen gesell-schaftlichen Platz zuwies.
Aus dem Inhalt: Lars Amenda / Christoph Rass: Gastarbeiter, Fremdarbeiter, Ostarbeiter.
Semantiken und Praktiken der Ausländerbeschäftigung im »Dritten Reich«.Wolfgang Ayaß: »Gemeinschaftsfremd (asozial) ist insbesondere …« Semantik
der Ungleichheit im Nationalsozialismus.Christian Bunnenberg: »Das Schicksal hat euch berufen, die Ritter der Nation
zu sein.« NSSchulungen als Instrument einer nationalsozialisti schen Elite(n) bildung?
Andrea Löw: Die Erfahrung der radikalen Ungleichheit – vom sprachlichen Umgang mit Ausgrenzung, Terror und Tod: Texte aus dem Getto Litzmannstadt.
Anne Prior: Die »Stürmerkastenaktion des Buchhalters Hans Georg Käbel im Sommer 1935 in Dinslaken.
Arvi Sepp: »Das Gift der LTI«. Nationalsozialistische Rhetorik und deutsch jüdische Subjektkonstituierung bei Victor Klemperer.
Janosch Steuwer/Hanne Leßau: Wer ist Nationalsozialist?Kerstin Thieler: Der Topos der »politischen Zuverlässigkeit« und die Katego
risierung der »Volksgenossen« durch die NSDAPKreisleitungen.Mareike Witkowski: Hausgehilfinnen im Nationalsozialismus.Gerhard Wolf: »Volksgemeinschaft« in Oberschlesien: Das Beispiel der
»Deutschen Volksliste«.
Ungleichheiten im »Dritten Reich«Semantiken, Praktiken, Erfahrungen
Herausgegeben von Nicole Kramer und Armin Nolzen
Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 28
ca. 288 S., ca. 10 Abb., brosch. ca. € 20,– (D); € 20,60 (A)ISBN 9783835311138September WG 1556
Ungleichheiten im »Dritten Reich«Semantiken, Praktiken, Erfahrungen
Die Herausgeber
Nicole Kramer, geb. 1978, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Veröffentlichungen u.a.: »Volksgenossinnen« an der »Heimatfront«. Mobilisierung, Verhalten, Erinnerung, Göttingen 2011 (ausgezeichnet mit dem FraenkelPrize for Contemporary History); Lieschen Müller wird politisch. Geschlecht, Staat und Parti zipation im 20. Jahrhundert, München 2009 (hg. zus. mit Christine Hikel und Elisabeth Zellmer).
Armin Nolzen, geb. 1968, Historiker, Redakteur der »Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus«. Veröffentlichungen u.a.: Zerstrittene »Volksgemeinschaft«. Glaube, Konfession und Religion im Nationalsozialismus (hg. mit Manfred Gailus 2011); Faschismus in Italien und Deutschland. Studien zu Transfer und Vergleich (hg. mit Sven Reichardt 2005).
Im Wallstein Verlag erschienen
Berlin im Nationalsozialismus. Politik und Gesellschaft 1933 –1945, hg. von Rüdiger Hachtmann, Thomas Schaarschmidt und Winfried Süß (2011)
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 36
Eine Untersuchung zu Ungarns Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg – ausgezeichnet mit dem »Irma Rosenberg-Förder-preis für die Erforschung der Geschichte des Nationalsozia-lismus« und mit dem »Preis des Theodor-Körner-Fonds«.
Am 19. September 1946 rief Winston Churchill die einstigen Kriegsgegner zu einem »segensreichen Akt des Vergessens« auf. Trotz dieser Forderung gab es unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von Seiten der Nationalstaaten große Bemühungen, die Verbrechen der vergangenen Regime zu dokumentieren und zu ahnden. So zunächst auch in Ungarn. Regina Fritz untersucht die ungarische Auseinandersetzung mit dem Holocaust von 1944/45 bis nach der Jahrtausendwende: Wie und aus welchen Gründen wurde dieser Teil der Geschichte thematisiert, genutzt, umgedeutet und schließlich zunehmend tabuisiert? Das Beispiel Ungarn zeigt in eindrucksvoller Weise, wie stark das Umschreiben von Geschichte nach 1945 politisch motiviert und von politischen Akteuren gelenkt wurde. Die Autorin bettet den Erinnerungsdiskurs in Ungarn in den internationalen Zusammenhang ein und untersucht, wie internationale Prozesse auf die innerungarische Aufarbeitung wirkten.
Regina FritzNach Krieg und JudenmordUngarns Geschichtspolitik seit 1944
Diktaturen und ihre Überwindung im 20. und 21. Jahrhundert, Bd. 7.Herausgegeben von Carola Sachse und Edgar Wolfrum
ca. 368 S., brosch.ca. € 34,90 (D); € 35,90 (A)ISBN 9783835310582September WG 1558
Regina FritzNach Krieg und JudenmordUngarns Geschichtspolitik seit 1944
Die Autorin
Regina Fritz, geb. 1980, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Editionsprojekt »Judenverfolgung 1933 –1945« an der Universität Wien. Veröffentlichungen u.a.: Politische Gewalt und Machtausübung im 20. Jahrhundert. Zeitgeschichte, Zeitgeschehen und Kontro versen (2011, mit Heinrich Berger, Melanie Dejnega und Alexander Prenninger); Nationen und ihre Selbstbilder. Postdiktatorische Gesellschaften in Europa (2008, mit Carola Sachse und Edgar Wolfrum).
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201237
Politik und Geschichte zwischen DDR-Nostalgie und kommunistischer Utopie.
Keine der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien steht so sehr im Banne der eigenen Geschichte wie die Partei DIE LINKE und ihre Vorgängerin PDS. Keine andere hat eine so wechselhafte Geschichte, wie diese aus der SED hervorgegangene Partei. Daraus ergibt sich die Frage, wie DIE LINKE dieses Erbe verwaltet und wie sie ihre Geschichte als Mittel der Politik und der Profilierung nutzbar zu machen versucht.
Christian Lannert schildert systematisch die Vergangenheitspolitik der Partei und beleuchtet einige der zum Verständnis ihrer Triebkräfte wesentlichen Diskurse. Am Ende steht ein zwiespältiger Befund: Der Autor zeigt eine Partei, die ihren hohen moralischen Ansprüchen bei der Aufarbeitung der SEDVergangenheit zu genügen versucht, aber allzu oft mit aberwitzig geführten Debatten und ausufernden Grabenkämpfen in einem konfliktreichen Spannungsfeld zwischen DDRNostalgie und kommunistischer Utopie verharrt.
Christian Lannert»Vorwärts und nicht vergessen«?Die Vergangenheitspolitik der Partei DIE LINKE und ihrer Vorgängerin PDS
Diktaturen und ihre Überwindung im 20. und 21. Jahrhundert, Bd. 8.Herausgegeben von Carola Sachse und Edgar Wolfrum
ca. 304 S., brosch.ca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835311152September WG 1557
Christian Lannert»Vorwärts und nicht vergessen«?Die Vergangenheitspolitik der Partei DIE LINKE und ihrer Vorgängerin PDS
Der Autor
Christian Lannert, geb. 1984, studierte Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaft und Öffentliches Recht an den Universitäten Heidelberg und Catania und ist seit 2011 Lehrer.
In der Reihe zuletzt erschienen
Stephan Ruderer: Das Erbe Pinochets. Vergangenheitspolitik und Demokratisierung in Chile 1990 – 2006 (2010); Julie Trappe: Rumäniens Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit (2009)
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 38
Über die Professionalisierung des Künstlerberufs in zentra-listischen Staaten.
In Frankreich und in der DDR gewannen Musik und Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen neuen Stellenwert in Politik und Gesellschaft. Davon profitierten auch künstlerische Berufe wie der des Komponisten. Die Berufsausübung, die Ausbildung und die Berufsverbände der Komponisten wurden dabei ebenso grundlegend umgestaltet wie die staatliche Unterstützung.
Dorothea Trebesius analysiert diesen Wandel in den beiden Ländern aus der Perspektive der Professionalisierung des künstlerischen Feldes in zentralistischen Staaten. Sie untersucht die Strategien und Stellung der Komponisten, ihre Selbstbilder und Wahrnehmung, ihre Ausbildung und Funktion in der Gesellschaft. Sie fragt insbesondere, welche Rolle der Staat und dessen demokratische bzw. staatssozialistische Kulturpolitik bei der Konstruktion und Praxis des Komponistenberufes spielten. Sie arbeitet sowohl systembedingte und nationale Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern heraus, die sich durch geteilte Traditionen und Erfahrungen sowie durch europäische Austauschprozesse erklären lassen.
Dorothea TrebesiusKomponieren als BerufFrankreich und die DDR im Vergleich. 1950 –1980
Moderne europäische Geschichte, Bd. 4.Herausgegeben von Hannes Siegrist und Stefan Troebst
ca. 400 S., geb., Schutzumschlagca. € 39,90 (D); € 41,10 (A)ISBN 9783835310674September WG 1559
Dorothea TrebesiusKomponieren als BerufFrankreich und die DDR im Vergleich. 1950 –1980
Die Autorin
Dorothea Trebesius, geb. 1980, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Vergleichende Kultur und Gesellschaftsgeschichte am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig.
In der Reihe zuletzt erschienen
Der HitlerStalinPakt in den Erinnerungskulturen der Europäer, hg. von Anna Kaminsky, Dietmar Müller und Stefan Troebst (2011); Adamantios Skordos: Griechenlands Makedonische Frage. Bürgerkrieg und Geschichtspolitik im Südosten Europas 1945 –1992 (2011)
auch als E-Book erhältlich

Vorstellungen von Europa seit 1900 – erklärt aus der Begegnung mit den Rändern des Kontinents.
»Europa« zählt zu den Schlüsselbegriffen des 20. Jahrhunderts. Was jeweils darunter verstanden wurde, wandelte sich jedoch fortlaufend. Auf welche Weise Vorstellungen über Europa in unterschiedlichen Ländern aufkamen wird in diesem Band untersucht.
Dabei wird deutlich, dass das europäische Bewusstsein im hohen Maße durch die Auseinandersetzung mit den Rändern des Kontinents geprägt wurde. Entsprechend stehen die Wahrnehmung der Länder im Norden, Osten und Süden des Kontinents, aber auch die Begegnung mit den USA und den Kolonien im Vordergrund. Im Unterschied zu klassischen Darstellungen, die vor allem die Einigung Westeuropas nach 1945 oder ideengeschichtliche Entwürfe im Fokus haben, entsteht auf diese Weise ein deutlich anderes Bild. So lassen sich bereits im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts vielfältige EuropaEntwürfe jenseits der Politik und von Gelehrtenkonzepten nachweisen. Durch seine kulturhistorische Perspektive zeigt der Band zudem, wie durch öffentliche Diskurse und gesellschaftliche Praktiken vielfältige und weit verbreitete Vorstellungen von dem »Europäischen« aufgebracht und angeeignet wurden – sei es durch Medien, Begegnungen, Vereinstätigkeiten oder Reisen.
Europabilder im 20. JahrhundertEntstehung an der Peripherie
Herausgegeben von Frank Bösch, Ariane Brill und Florian Greiner
Geschichte der Gegenwart, Bd. 5.Herausgegeben von Frank Bösch und Martin Sabrow
ca. 320 S., geb., Schutzumschlagca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835311732September WG 1559
Europabilder im 20. JahrhundertEntstehung an der Peripherie
Die Herausgeber
Frank Bösch, geb. 1969, ist Professor für Deutsche und Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung. Veröffentlichungen u.a.: Mediengeschichte. Vom asiatischen Buchdruck zum Fernsehen (2011); Die AdenauerCDU. Gründung, Aufstieg und Krise einer Erfolgspartei, 1945 –1969 (2001).
Ariane Brill, geb. 1983, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und arbeitet im Forschungsverbund »Lost in Translation. Europabilder und ihre Übersetzungen«. Ihre Dissertation untersucht den Wandel von Europavorstellungen 1945 –1980.
Florian Greiner, geb. 1981, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und arbeitet im Forschungsverbund »Lost in Translation. Europabilder und ihre Übersetzungen«. Seine Dissertation analysiert den Wandel von Europavorstellungen 1914 –1945.
auch als E-Book erhältlich
GeschichteWallstein Verlag Herbst 201239

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 40
Eine Migrationsgeschichte Westeuropas.
Die Zuwanderung der letzten 50 Jahre ist eine der gesellschaftlichen Entwicklungen, die besonders viele und – wie zuletzt die SarrazinDabatte erneut gezeigt hat – besonders emotionale Diskussionen ausgelöst hat.
Jenny Pleinen beleuchtet die Migrationsgeschichte zweier der wichtigsten Einwanderungsländer Europas erstmals verstärkt aus der Perspektive der Migranten. Die Autorin analysiert die Entwicklung der bundesrepublikanischen und belgischen Migrationsregime – also des Zusammenspiels der verschiedenen Akteure und Maßnahmen bei der Zuwanderung – seit dem Zweiten Weltkrieg. Insbesondere berücksichtigt sie dabei die Auswirkungen der europäischen Integration sowie internationaler Verträge.
In einem zweiten Schritt kombiniert die Autorin diese Analyse mit der biographischen Perspektive der Zuwanderer. Im Fokus steht dabei die Frage, welche Auswirkungen die Risiken und Chancen der Anerkennung und Integration auf individuelle Biographien der Betroffenen hatten. Für diese Arbeit wurden erstmals Einzelfallakten von über 1800 Personen ausgewertet, die bisher der Forschung nicht zur Verfügung gestanden hatten.
Jenny PleinenDie Migrationsregime Belgiens und der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg
Moderne Zeit. Neue Forschungen zur Gesellschafts und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 24. Herausgegeben von Ulrich Herbert und Lutz Raphael
ca. 432 S., geb., Schutzumschlag ca. € 42,– (D); € 43,20 (A)ISBN 9783835311855September WG 1559
Jenny PleinenDie Migrationsregime Belgiens und der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg
Die Autorin
Jenny Pleinen, geb. 1981, Studium der Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und Germanistik an der Universität Trier; wissenschaftliche Mitarbeiterin im SFB 600 »Fremdheit und Armut« in Trier. Veröffentlichungen u.a. zu Migration und sozialer Ungleichheit.

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201241
Der sechste und letzte Band des »Who is Who« der Hamburger Literatur-, Kultur-, Wissen-schafts- und Stadtgeschichte.
Das mehrbändige Nachschlagewerk bietet biografische Artikel über Personen, die für die Entwicklung der Stadt Hamburg von besonderer Bedeutung waren. Dabei wird das gesamte Spektrum der hamburgischen Geschichte durch sämtliche Epochen berücksichtigt. Der sechste Band der »Hamburgischen Biografie« erweitert die bisher vorliegenden 1641 Artikel um 282 weitere biografische Porträts. Unter den Porträtierten finden sich z.B. Politiker wie Wilhelm Drexelius und Ernst Thälmann, Schriftsteller wie Matthias Claudius und Kurt Hiller, Künstler wie Arthur Illies und Heinrich Stegemann, Wissenschaftler wie Fritz Fischer und Hans Schimank oder auch Schauspielerinnen und Regisseure wie Heidi Kabel und Helmuth Gmelin.
Die »Hamburgische Biografie« entsteht seit 2000 in der Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte der Universität Hamburg. Die ersten fünf Bände erschienen 2001, 2003, 2006, 2008 und 2010. Jeder Band enthält Einträge von A bis Z, die seit Band 2 durch ein kumulatives Register erschlossen werden. Band 6 enthält zusätzlich ein erweitertes Personenregister für alle bisher erschienenen Bände, das auch solche Personen berücksichtigt, die nicht mit einem eigenen Eintrag vertreten sind.
Hamburgische Biografie 6Personenlexikon
Herausgegeben von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke
Hamburgische Biografie, Bd. 6
ca. 424 S., ca. 130 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835310254Oktober WG 1558
Hamburgische Biografie 6Personenlexikon
Die Herausgeber
Franklin Kopitzsch, geb. 1947, ist Professor am Historischen Seminar der Universität Hamburg und Leiter der Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte. Veröffentlichungen zur Sozialgeschichte der Frühen Neuzeit.
Dirk Brietzke, geb. 1964, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte am Historischen Seminar der Universität Hamburg. Veröffentlichungen zur Sozial und Regionalgeschichte der Frühen Neuzeit.
Im Wallstein Verlag erschienen
Hamburgische Biografie Band 1 bis 5
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 42
Ein kritischer Blick auf das Netzwerk der International Oral History Association.
Die Ende der 1970erJahre ins Leben gerufene International Oral History Association (IOHA) ist in ihrer Internationalität und Interdisziplinarität einmalig in der Wissenschaftslandschaft. Angetrieben von dem Wunsch, Geschichtswissenschaft zu demokratisieren, wollten ihre Mitglieder den bis dahin ungehör ten Gruppen – z. B. Frauen, Arbeitern, Migranten oder den Opfern politischer Gewaltherrschaft – »eine Stimme geben«.
Die Beiträge setzen sich mit dem wissenschaftlichen Ansatz und den politischen Überzeugungen ihrer Vorgängergeneration auseinander.
Aus dem Inhalt:Christian König: Bewegung und Zusammenhalt – Ein Freundschaftsnetzwerk
als wissenschaftsgeschichtliches PhänomenAgnès Arp: Plattform, Fluchtpunkt und Etablierungsraum – Die Internationalität
der IOHAFranka Maubach: Das freie Wort als Menschenrecht – Schweigen und Sprechen
in der IOHA Annette Leo: Das Interview im Interview – Abenteuer einer OralHistoryUnter
suchung mit Oral Historians
Den Unterdrückten eine Stimme geben?Die International Oral History Association zwischen politischer Bewegung und wissenschaftlichem Netzwerk
Herausgegeben von Annette Leo und Franka MaubachMit einem Nachwort von Lutz Niethammer
ca. 376 S., brosch.ca. € 34,90 (D); € 35,90 (A)ISBN 9783835311619September WG 1559
Den Unterdrückten eine Stimme geben?Die International Oral History Association zwischen politischer Bewegung und wissenschaftlichem Netzwerk
Die Herausgeberinnen
Annette Leo, geb. 1948, Historikerin, derzeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Institut der FriedrichSchillerUniversität Jena. Veröffentlichungen u.a.: Erwin Strittmatter. Die Biographie (2012); »Das ist schon ein zweischneidiges Schwert hier unser KZ«. Der Fürstenberger Alltag und das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück (2007), ausgezeichnet mit dem AnnaLiseWagnerPreis, 2008.
Franka Maubach, geb. 1974, Historikerin, derzeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Graduiertenkolleg »Generationengeschichte«, Göttingen. Veröffentlichungen u.a.: Die Stellung halten. Kriegserfahrungen und Lebensgeschichten von Wehrmachthelferinnen (2009).
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201243
Die Bedeutung des Gene-rationenkonzepts für die Demographie-, Ökonomie- und Migrationsforschung aus internationaler Perspektive.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen aus einer gemeinsamen Tagung des Graduiertenkollegs »Generationengeschichte« der GeorgAugustUniversität Göttingen und des Deutschen Historischen Instituts in Washington hervor. Verschiedene Generationenkonzepte standen sich hier gegenüber: die europäische Idee von »Jugendgenerationen« und »politischen Generationen« und die eher pragmatische amerikanische Lesart von den »demographischen Generationen« oder den »Konsumgenerationen«.Immer, so scheint es, wird die generationelle Logik überlagert von nationalen Vorstellungen der Dazugehörigkeit. Sehr deutlich arbeiten die Beiträge aus Europa und den USA heraus, dass die historische Zeit wohl in Generationen gelesen wird, doch wird Geschichte nicht von Generationen gemacht.
Aus dem Inhalt:Elwood D. Carlson (Florida State): Generations as Demographic Category –
20th Century US GenerationsUffa Jensen (Berlin): Emotional ties and generational belonging – Youth move
ment in interwar GermanyDirk Schumann (Göttingen): Youth culture and generational formation
Der Band ist komplett englischsprachig.
History by GenerationsGenerational Dynamics in Modern History
Herausgegeben von Hartmut Berghoff, Bernd Weisbrod,Uffa Jensen und Christina Lubinski
Göttinger Studien zur Generationsforschung, Bd. 11.Herausgegeben von Dirk Schumann
ca. 280 S., geb., Schutzumschlagca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835311626Oktober WG 1551
History by GenerationsGenerational Dynamics in Modern History
Die Herausgeber
Hartmut Berghoff ist Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Washington D.C., Professor für Wirtschafts und Sozialgeschichte an der Universität Göttingen.
Bernd Weisbrod, bis zu seiner Emeritierung Professor für Neuere Geschichte an der Universität Göttingen, zuletzt Gastprofessor in Stanford.
Uffa Jensen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsbereich »Geschichte der Ge fühle« des MaxPlanckInstituts für Bildungsforschung in Berlin.
Christina Lubinski, Research Fellow am Deutschen Historischen Institut in Washington DC mit einem Projekt zu multinationalen Unternehmen in Indien.
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 44
Christian BüschgesDemokratie und VölkermordEthnizität im politischen Raum
Das Politische als Kommunikation, Bd. 5.Herausgegeben von Willibald Steinmetz
ca. 128 S., Klappenbroschur ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835310414Oktober WG 1734
Der Autor
Christian Büschges, geb. 1965, Professor für Allgemeine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der iberischen und lateinamerikanischen Geschichte an der Universität Bielefeld. Veröffentlichungen u.a.: Culturas políticas en la región andina (Mithg., 2011); Die Ethnisierung des Politischen. Identitätspolitiken in Lateinamerika, Asien und den USA (Mithg., 2007).
Einerseits wurden die in den 1990er Jahren weltweit erhobenen Forderungen indigener Völker nach kultureller Anerkennung und politischer Teilhabe vielfach als Ausdruck einer voranschreitenden Demokratisierung gedeutet, andererseits gelten die Bürgerkriege in Jugoslawien oder Ruanda im gleichen Jahrzehnt als Extremformen einer ethnischen Gewalt, die das politische Gemeinwesen zerstört. Christian Büschges untersucht dieses spannungsreiche Verhältnis von Ethnizität und Politik in historischer und systematischer Perspektive.
Der zweite Teil der Reihe mit kurzen Essays zu zentralen Diskussionen der zeitgenös-sischen Politikforschung.
Der Reihenherausgeber
Willibald Steinmetz, geb. 1957, ist Professor für Historische Politikforschung an der Universität Bielefeld und Sprecher des SFB 584 »Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte«. Veröffentlichungen u.a.: Political Languages in the Age of Extremes (Hg., 2011); ›Politik‹. Situationen eines Wortgebrauchs im Europa der Neuzeit (Hg., 2007).
Das Politische als KommunikationHerausgegeben von Willibald Steinmetz
Was ist eigentlich Politik? Wo und wie wird Politik gemacht? Was ist politisch, was gilt als unpolitisch? Die historische Perspektive auf diese aktuellen Fragen zeigt: Es gab und gibt keine allgemeingültigen und überzeitlichen Definitionen dessen, was unter Politik, dem Politischen oder der Bestimmung eines Sachverhalts als politisch verstanden wird.
Die Reihe »Das Politische als Kommunikation« verfolgt die Erscheinungsformen des Politischen in Geschichte und Gegenwart. Pointierte Essays behandeln Strategien und Prozesse der Politisierung oder Entpolitisierung an ausgewählten Themen: von Fragen zu Ethnisierung und Ethnizität über die kommunikative Herrschaftssicherung in Diktaturen und die Begriffsgeschichte des Politischen bis hin zu politischen Räumen jenseits von Staat und Nation. Ein abschließender Band nimmt die politikgeschichtliche Theoriediskussion selbst in den Blick.
auch als E-Book erhältlich

GeschichteWallstein Verlag Herbst 201245
Moderne Politikgeschichte ist untrennbar mit Vorstellungen von Territorialität und Nation verbunden. In historischer Perspektive erweist sich jedoch der Nationalstaat als Ausnahmeerscheinung. Olaf Kaltmeier lenkt den Blick auf politische Räume jenseits von Staat und Nation und entwirft alternative Raumkonzepte für das Projekt einer neuen Politikgeschichte.
Der Autor
Olaf Kaltmeier, geb. 1970, JuniorProfessor für transnationale Geschichte der Amerikas und geschäftsführender Direktor des Center for InterAmerican Studies an der Universität Bielefeld. Veröffentlichungen u.a.: Selling EthniCity. Urban Cultural Politics in the Americas (Hg., 2011); Jatarishun. Testimonios de la lucha indígena de Saquisilí (2008).
Der Autor
Neithard Bulst, geb. 1941, emeritierter Professor für Allgemeine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung des Mittelalters an der Universität Bielefeld. Veröffentlichungen u.a.: Politik und Kommunikation. Zur Geschichte des Politischen in der Vormoderne (Hg., 2008); Die französischen Generalstände von 1468 und 1484. Prosopographische Untersuchungen zu den Delegierten (1992).
Das Recht ist ein unverzichtbarer Faktor bei der Konstituierung, Beherrschung und Sicherung des politischen Raums. Dadurch gerät aber auch das Recht selbst in den Sog des Politischen. Anhand von Beispielstudien, die vom späten Mittelalter bis zur Ausgestaltung und Integration der europäischen Union reichen, stellt Neithard Bulst Fragen nach der politischen Bedeutung von Recht zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen politischen Handlungsräumen.
Neithard BulstRecht, Raum und Politik
Das Politische als Kommunikation, Bd. 6.Herausgegeben von Willibald Steinmetz
ca. 128 S., Klappenbroschur ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311503Oktober WG 1734
Olaf KaltmeierPolitische Räume jenseits von Staat und Nation
Das Politische als Kommunikation, Bd. 7.Herausgegeben von Willibald Steinmetz
ca. 128 S., Klappenbroschur ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311510Oktober WG 1730
auch als E-Book erhältlich
auch als E-Book erhältlich

auch als E-Book erhältlich
auch als E-Book erhältlich
GeschichteWallstein Verlag
Herbst 2012 46
Stephan MerlPolitische Kommunikation in der DiktaturDeutschland und die Sowjetunion im Vergleich
Das Politische als Kommunikation, Bd. 9.Herausgegeben von Willibald Steinmetz
ca. 128 S., Klappenbroschur ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311534Oktober WG 1551
Der Autor
Stephan Merl, geb. 1947, Professor für Allgemeine und Osteuropäische Geschichte an der Universität Bielefeld. Veröffentlichungen u.a.: Elections in the Soviet Union, 19371989: A View into a Paternalistic World from Below, in: Ralph Jessen/Hedwig Richter (Hg.), Voting for Hitler and Stalin. Elections Under 20th Century Dictatorships (2011).
Wie gelingt es Diktaturen nach einer Phase von Gewalt und Terror, die Verhaltensweise der Bevölkerung nachhaltig zu beeinflussen und dadurch ihre Herrschaft langfristig zu festigen? Stephan Merl nimmt erstmals vergleichend die kommunikativen Strategien des NSStaates, der DDR und der UdSSR (vor und nach Stalins Tod 1953) in den Blick: Wie wurde die Bevölkerung jeweils in die kollektive Identität einbezogen? Wie wurde die öffentliche Kommunikation kontrolliert? Welche Bedeutung kam dem nichtöffentlichen Kommunikationskanal ›Brief‹ zu? Und schließlich: Wie ist das Ende der kommunistischen Diktaturen zu erklären?
Was heißt eigentlich »politisch«? Ulrich Meier, Martin Papenheim und Willibald Steinmetz gehen der Frage nach, wie unterschiedlich das Politikvokabular von den mittelalterlichen Gesellschaften über die frühneuzeitlichen Staatsbildungen bis hin zu den modernen Demokratien verwendet und gedeutet wurde.
Ulrich Meier / Martin Papenheim /Willibald SteinmetzSemantiken des PolitischenVom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert
Das Politische als Kommunikation, Bd. 8.Herausgegeben von Willibald Steinmetz
ca. 128 S., Klappenbroschur ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311527Oktober WG 1730
Die Autoren
Ulrich Meier, geb. 1948, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Bielefeld. Veröffentlichungen u.a.: Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen (1994).
Martin Papenheim, geb. 1956, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Augsburg. Veröffentlichungen u.a.: Karrieren in der Kirche. Bischöfe in Nord und Süditalien 1676 –1903 (2001); Erinnerung und Unsterblichkeit. Semantische Studien zum politischen Totenkult in Frankreich 1715 1794 (1992).
Willibald Steinmetz, geb. 1957, siehe S. 44.

auch als E-Book erhältlich
auch als E-Book erhältlich
GeschichteWallstein Verlag Herbst 201247
Was ist neu an der ›Neuen Politikgeschichte‹? Tobias Weidner beleuchtet die politikgeschichtliche Theoriediskussion des letzten Jahrzehnts im Spiegel ihrer zentralen, umstrittenen Begriffe. Er skizziert verschiedene Ansätze, lässt ihre Kritiker zu Wort kommen und fragt nach den Potenzialen, aber auch den Problemen der Neukonzeptionen. Die Kernfrage ist: Was wird durch den Perspektivwechsel von der ›Politik‹ zum ›Politischen‹ in den Blick gerückt?
Der Autor
Tobias Weidner, geb. 1977, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bielefelder Sonderforschungsbereichs »Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte«. Veröffentlichungen u.a: »Die Mediziner und das Politische im ›langen‹ 19. Jahrhundert«.
Der Autor
Sebastian Thies, geb. 1968, ist Professor für Romanistik und Interamerikanische Studien an der Universität Bielefeld. Veröffentlichungen u.a.: Screening the Americas. Narration of Narration in Documentary Film (Mithg., 2011); E Pluribus Unum? National and Transnational Identities in the Americas (Mithg., 2009).
Vielerseits wird die Krise des Multikulturalismus beschworen. Zugleich haben Ethnizität und kulturelle Differenz global Konjunktur in Gesellschaft und Politik. Zwiespältig ist hierbei die Rolle der Medien: einerseits ist die Verfügungsmacht über mediale Inhalte ungleich verteilt, wodurch ethnische Grenzziehungen in der Gesellschaft verfestigt werden; andererseits bieten Medien immer häufiger auch jenen Gruppen eine Plattform, die zuvor vom kulturellen und politischen Leben ausgeschlossen waren. Sebastian Thies geht der Frage nach, welche Perspektiven sich vor dem Hintergrund des Medienwandels für die Ethnisierung des Politischen ergeben.
Sebastian ThiesEthnische Identitätspolitik im MedienwandelEthnizität im politischen Raum
Das Politische als Kommunikation, Bd. 10.Herausgegeben von Willibald Steinmetz
ca. 128 S., Klappenbroschur ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311541Oktober WG 1744
Tobias WeidnerDie Geschichte des Politischen in der Diskussion
Das Politische als Kommunikation, Bd. 11.Herausgegeben von Willibald Steinmetz
ca. 128 S., Klappenbroschur ca. € 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311558Oktober WG 1733

KulturwissenschaftenWallstein Verlag
Herbst 2012 48
Eine Mediengeschichte anderer Art: Auf faszinierende Weise werden die Leser durch eine 2500-jährige Geschichte des Wechselspiels von Vermittlung und Unmittelbarkeit geführt.
Mediengeschichte existiert seit bald einem Jahrhundert. Die meiste Zeit wurde sie als Geschichte von technischen Innovationen betrieben: der Schrift, des Buchdrucks, der Fotografie, des Films, des Radios, dann der elektronischen Medien. Die Autoren des vorliegende Buchs suchen einen anderen Zugang: Sie fragen weniger danach, was Medien sind, als danach, was in welchen historischen Situationen zum Medium wurde.
So entsteht eine Geschichte des Medialen – entlang an Konstellationen und Szenarien, die für das abendländische Imaginäre bestimmend geworden sind: von Moses, der auf dem Sinai die Gesetzestafeln empfängt, über den Höhlenbewohner, dessen Erfahrung sich bei Platon als medialer Schein entpuppt, zu Narcissus und Echo, bei denen die Abgründe von Stimme und Spiegel zum Ausdruck kommen, dann zu den mittelalterlichen Formen der Ekphrasis und der Körperschrift bis hin zu wichtigen Neuansätzen der Moderne – der Unterscheidung von Text und Bild bei Lessing oder der Spannung von spiritistischem und technischem Medium im frühen Film.
Christian Kiening und Ulrich Johannes BeilUrszenen des MedialenVon Moses zu Caligari
ca. 424 S., geb., Schutzumschlagca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835311275August WG 1559
Christian Kiening und Ulrich Johannes BeilUrszenen des MedialenVon Moses zu Caligari
Die Autoren
Christian Kiening, geb. 1962, ist Ordinarius für Ältere deutsche Literaturwissenschaft an der Universtität Zürich. Direktor des Nationalen Forschungsschwerpunkts Medienwandel – Medien wechsel – Medienwissen. Veröffentlichungen u.a.: Der absolute Film (Hg., 2012); Mystische Bücher (2011); Modelle des Medialen im Mittelalter (Hg., 2010).
Ulrich Johannes Beil, geb. 1957, ist Senior Researcher am Nationalen Forschungsschwerpunkt Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen an der Universität Zürich. Veröffentlichungen u.a.: Medien – Technik – Wissenschaft. (Hg., 2011); Die hybride Gattung (2010); Rudolf Kurtz, Expressionismus und Film (Hg., 2007, 2010).
auch als E-Book erhältlich

KulturwissenschaftenWallstein Verlag Herbst 201249
Carl August von Sachsen- Weimar-Eisenach als Sammler von Druckgraphiken und Zeichnungen.
Lange Zeit betrachtete die kunsthistorische Forschung deutsche Fürstenmuseen um 1800 als »Gegenspieler der revolutionären bürgerlichen Museen«. Solche dualistischen Modelle halten einer Überprüfung längst nicht mehr Stand. Vielmehr wurde das Verhältnis zwischen Hof und Bürgertum von vielfältigen Wechselwirkungen bestimmt. Besondere Konsequenzen hatte dieser Austausch für die Druckgraphik, deren starke Präsenz auf dem expandierenden Kunstmarkt im Zusammenhang mit der Herausbildung eines neuen bürgerlichen Kunstpublikums stand.
Markus Bertsch nimmt erstmals die Geschichte der Graphik und Zeichnungssammlung in den Blick, die Carl August von SachsenWeimarEisenach (1757 –1828) von den 1770er Jahren an zusammengetragen hat. Ihre Genese, Struktur und Funktion thematisiert der Autor vor dem Hintergrund der sich wandelnden geschmacklichen Präferenzen des Herzogs. Dabei beleuchtet er die Rolle der Kunstagenten, insbesondere von Johann Heinrich Merck, der weitaus größeren Anteil als Goethe an der frühen Profilierung dieser Sammlung hatte.Einen breiten Rahmen widmet der Autor der institutionellen Dimension der Sammlung: ihrem Weg über temporäre museale Präsentationen bis hin zum ersten Weimarer Kunstmuseum.
Markus BertschSammeln – Betrachten – AusstellenDas Graphik und Zeichnungskabinett Herzog Carl Augusts von SachsenWeimarEisenach
Ästhetik um 1800, Bd. 9.Herausgegeben von Reinhard Wegner
ca. 592 S., ca. 70 Abb.,geb., Schutzumschlagca. € 39,90 (D); € 41,10 (A) ISBN 9783835305151November WG 1559
Markus BertschSammeln – Betrachten – AusstellenDas Graphik- und Zeichnungskabinett Herzog Carl Augusts von Sachsen-Weimar-Eisenach
Der Autor
Markus Bertsch, geb. 1970, Studium der Kunstgeschichte, Klassischen Archäologie und Mittelalterlichen Geschichte an der FU Berlin und der HU Berlin, seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hamburger Kunsthalle; Kurator der Ausstellungen »Kosmos Runge. Der Morgen der Romantik« (2010/11) und »Max Liebermann. Wegbereiter der Moderne« (2011/12).
Im Wallstein Verlag erschienen
Bd. 8: »Mit vieler Kunst und Anmuth«. Goethes Briefwechsel mit Christian Daniel Rauch, hg. v. Rolf H. Johannsen (2011); Bd. 7: Landschaft am »Scheidepunkt«. Evolutionen einer Gattung in Kunsttheorie, Kunstschaffen und Literatur um 1800, hg. von Markus Bertsch und Reinhard Wegner (2010)

KulturwissenschaftenWallstein Verlag
Herbst 2012 50
Ein interdisziplinärer Blick auf den »Raum in der Kunst«.
In einer Studie über Andere Räume schrieb Michel Foucault 1967: »Die große Obsession des 19. Jahrhunderts war die Geschichte. (…) Unsere Zeit ließe sich dagegen eher als das Zeitalter des Raumes begreifen. Wir leben im Zeitalter der Gleichzeitigkeit, des Aneinanderreihens, des Nahen und Fernen, des Nebeneinander und des Zerstreuten.« Damit hat er eine Entwicklung diagnostiziert, die sich in jüngster Zeit mit dem spatial turn, mit der Wendung von Wissenschaften und Kunst zum Raum als Kategorie von Erkenntnis und Gestaltung noch einmal intensiviert hat. Da die Rede vom »Raum« heute so selbstverständlich geworden ist, muss geradezu betont werden, dass der Begriff bis ins 18. Jahrhundert keine Rolle in den Theorien zu Kunst, Architektur, Musik oder Literatur spielte und erst Ende des 19. Jahrhunderts als Element der Gestaltung, Ordnung und Reflexion Bedeutung gewann.
Unter dem Motto »Vermessung des Raums« handeln die Beiträge vom Klangraum der Musik und den poetischen Räumen der Literatur, dem »leeren Raum« des Theaters und dem Fiktionsraum des Films, vom spezifischen Raum der bildenden Künste und dem Realraum der Architektur.
Mit Beiträgen von:Gottfried Boehm, Hinderk M. Emrich, Wolfgang Kemp, Dietrich Krusche, Ulrich Mosch, Edgar Reitz und Hans Joachim Ruckhäberle
Der Raum in den KünstenSechs interdisziplinäre Ansätze
Herausgegeben vom Präsidenten und vom Direktorium der Bayerischen Akademie der Schönen Künste
Mit einem Vorwort von Dieter Borchmeyer
Kleine Bibliothek der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Bd. 6
ca. 192 S., ca. 20 Abb.,geb., Schutzumschlagca. € 19,– (D); € 19,60 (A)ISBN 9783835311312Oktober WG 1559
Der Raum in den KünstenSechs interdisziplinäre Ansätze
In der Reihe erschienen
Kunst in Ost und West seit 1989. Rückblicke und Ausblicke (2010); Feindbild Geschichte. Positionen der Kunst und Architektur im 20. Jahrhundert, hg. von Helmut Gebhard und Willibald Sauerländer (2007)

KulturwissenschaftenWallstein Verlag Herbst 201251
Über Konzepte und Praktiken religiöser Toleranz in Europa von der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert.
Die Koexistenz verschiedener christlicher und anderer Religionsgemeinschaften erforderte in Europa – und über seine Grenzen hinaus – schon seit dem späten Mittelalter rechtliche, institutionelle und individuelle Arrangements. Diese Regelungen und die ihnen zugrunde liegenden Aushandlungsprozesse beleuchten die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Bandes.
Vergleichend unterziehen sie ›klassische‹ Dokumente der europäischen Toleranzforschung einer empirischen Revision. Darüber hinaus befassen sie sich mit weniger prominenten, doch ebenso originellen regionalen Entwürfen und Praktiken. Reflektiert wird auch, inwieweit Toleranz ein europäisches Modell ist und welche Alternativen denkbar sind.
Die Autorinnen und Autoren betrachten das Thema aus historischer, religions und literaturwissenschaftlicher Perspektive und nutzen ein breites Spektrum an Quellen und Methoden.
Mit Beiträgen von:Halina Beresnevicute-Nosálová, Josef Hrdlicka, Kerstin S. Jobst, Jan-Friedrich Mißfelder, Dirk Sadowski, Stefan Schreiner, Hubert Seiwert, Ludwig Stockin-ger und Silke Törpsch.
Reden und Schweigen über religiöse DifferenzTolerieren in epochenübergreifender Perspektive
Herausgegeben von Dietlind Hüchtker, Yvonne Kleinmann und Martina Thomsen
ca. 352 S., brosch.ca. € 24,90 (D); € 25,60 (A)ISBN 9783835311282Dezember WG 1559
Reden und Schweigen über religiöse DifferenzTolerieren in epochenübergreifender Perspektive
Die Herausgeber
Dietlind Hüchtker ist seit 2003 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig, seit 2009 im Projekt »Religionsfrieden«.
Yvonne Kleinmann ist Leiterin der EmmyNoetherNachwuchsforschungsgruppe »Wege der Rechtsfindung in ethnischreligiös gemischten Gesellschaften« an der Universität Leipzig. Veröffentlichungen u.a.: Kommunikation durch symbolische Akte. Religiöse Heterogenität und politische Herrschaft in PolenLitauen (Hg., 2010).
Martina Thomsen ist Juniorprofessorin für die Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Kiel. Sie war zuvor Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig.
auch als E-Book erhältlich

KulturwissenschaftenWallstein Verlag
Herbst 2012 52
Beiträge zur kritischen Sozial- und Subjekttheorie von Cornelius Castoriadis
Cornelius Castoriadis, griechischfranzösischer politischer Theoretiker und Psychoanalytiker hinterließ ein umfangreiches Werk, das hierzulande erst allmählich entdeckt wird. Am Leitfaden der Kategorie des Imaginären hat er die Umrisse einer originellen kritischen Sozial und Subjekttheorie entworfen, die das kreative Element des Sozialen wie des Subjekts in den Mittelpunkt stellt. Die Beiträge dieses Bandes umkreisen und diskutieren verschiedene Aspekte seines Entwurfs und verorten ihn im sozialtheoretischen Kontext.
Aus dem Inhalt: Cornelius Castoriadis: Das Imaginäre: die Schöpfung im gesellschaftlich
geschichtlichen BereichJohann P. Arnason: Über Marx hinaus – Castoridis’ Ort in der SozialtheorieHarald Wolf: Das Richtige zur falschen Zeit – zur Schöpfung des Imaginären bei
CastoriadisBernhard Waldenfels: Revolutionäre Praxis und ontologische KreationFerdinando G. Menga: Die autonome Gesellschaft und das Problem der Ordnungs
kontingenz
Das Imaginäre im SozialenZur Sozialtheorie von Cornelius Castoriadis
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Harald Wolf
Arbeiten am LichtenbergKolleg, Bd. 2.Herausgegeben von Dagmar CoesterWaltjen
ca. 144 S., brosch.ca. € 24,90 (D); € 25,60 (A)ISBN 9783835311077November WG 1710
Das Imaginäre im SozialenZur Sozialtheorie von Cornelius Castoriadis
Cornelius Castoriadis
(1922 –1997) griechischstämmiger französischer politischer Theoretiker, Akti vist, Ökonom, Philosoph und Psychoanalytiker. Aus gebildet als Jurist, Widerstandskämpfer im griechischen Bürgerkrieg. Castoriadis arbeitete u.a. als Wirtschaftsfachmann für die OECD. Als zentrales Werk gilt: Gesellschaft als imaginäre Institution. Entwurf einer politischen Philosophie (dt. 1984).
Der Herausgeber
Harald Wolf, geb. 1959, Soziologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Soziologischen Forschungsinstitut (SOFI) an der Universität Göttingen und Privatdozent an der Universität Kassel. Veröffentlichungen zur Arbeitssoziologie und Gesellschaftstheorie, u.a.: Arbeit und Autonomie (1999). Herausgeber (zusammen mit Michael Halfbrodt) der Aus gewählten Schriften von Cornelius Castoriadis.

KulturwissenschaftenWallstein Verlag Herbst 201253
Postmoderne Lebensformen und Internationales Privatrecht – welcher Rechtsordnung gehört der Mensch in der globalisier-ten Welt an?
Welchen Einfluss haben die postmodernen Gesellschaftsformen auf die staatlichen Gerichte in Zeiten des Multikulturalismus und der vorangeschrittenen Globalisierung? Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet das Internationale Privatrecht auf diesem Gebiet? Diesen Fragen geht der international angesehene und mehrfach ausgezeichnete Rechtswissenschaftler Erik Jayme in seinem Vortrag »Zugehörigkeit und kulturelle Identität« nach.
Jayme greift die vom französischen Soziologen Michael Maffesoli entworfenen Begriffe zweier postmoderner Lebensformen auf, den des nomadisme und den des tribalisme. Der Mensch ist demnach nicht mehr nur an einem Ort zuhause und gehört nicht mehr nur einer Gruppe an. Seine Zugehörigkeit und damit die Zuständigkeit und Anwendbarkeit der verschiedenen staatlichen Rechtsbestimmungen müssen vielmehr aus einer Anzahl relevanter Faktoren bestimmt werden, die dem Begriff der kulturellen Identität gerecht werden.
Abstammung, Staatsbürgerschaft, Sprache und territoriale Verbundenheit entscheiden im Einzelfall darüber, auf welcher Rechtsgrundlage welchen Staates ein Urteil gefällt wird. Jayme schildert anschaulich, wie Rechtsfragen z.B. des Familien, Erb und Schuldrechts unter Berücksichtigung kultureller Identität und gruppenspezifischer bzw. religiöser Rechte entschieden werden können.
Erik JaymeZugehörigkeit und kulturelle IdentitätDie Sicht des Internationalen Privatrechts
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Dagmar CoesterWaltjen
Reden am LichtenbergKolleg, Bd. 3.Herausgegeben von Dagmar CoesterWaltjen
64 S., franz. brosch.€ 9,90 (D); € 10,20 (A)ISBN 9783835311015Sofort lieferbar WG 1778
Erik JaymeZugehörigkeit und kulturelle IdentitätDie Sicht des Internationalen Privatrechts
Der Autor
Erik Jayme, geb. 1934 in Montreal/Kanada, war bis zu seiner Emeritierung 2002 Ordinarius für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung sowie geschäftsführender Direktor des Instituts für ausländisches und inter nationales Privat und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg. Er ist Vizepräsident des Kuratoriums der Haager Akademie für Internationales Recht. Zahlreiche Veröffentlichungen zum internationalen Privat und Verfahrensrecht.
Die Herausgeberin
Dagmar CoesterWaltjen, geb. 1945, Direktorin des LichtenbergKollegs sowie Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches, europäisches und internationales Privat und Prozessrecht an der Universität Göttingen; Gastprofessuren in Fribourg, Oxford, New York, Austin, Tel Aviv. Ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Bayerischen Verdienstorden.
In der Reihe erschienen
Christian Starck: Errungenschaften der Rechtskultur, hg. von Dagmar CoesterWaltjen (2011); Hans Georg Meyer: »Ich bin eigentlich nach England gegangen, um deutsch schreiben zu lernen« – Nachdenken mit Georg Christoph Lichtenberg über den Wert des Fremden, hg. von Dagmar CoesterWaltjen (2010)
auch als E-Book erhältlich

KulturwissenschaftenWallstein Verlag
Herbst 2012 54
Ein kritischer Blick auf die Bewertung wissenschaftlicher Leistungen in der globalen Forschungslandschaft.
Die Suche nach Exzellenz findet inmitten struktureller Umbrüche in einer globalen Forschungslandschaft statt. Im weltweiten Wettbewerb gilt Forschungsproduktivität als die dominante messbare Einheit. Universitäten, Forschungseinrichtungen, Förderorganisationen und Forscherinnen und Forscher stehen vor neuen Herausforderungen. Die Abschottung nationaler Bildungssysteme wird durch den länderübergreifenden Wettbewerb aufgebrochen. Die Bewertung wissenschaftlicher Leistungen nimmt zunehmend eine multidimensionale Eigendynamik an. Wie viel – und welche Formen – von Evaluierung das Wissenschaftssystem verträgt, wird von der Balance zwischen der von der Politik geforderten »no evidencefree zone« und der Fähigkeit abhängen, jene Urteilsfähigkeit zu bewahren, die ausschließlich der wissenschaftlichen Exzellenz verpflichtet ist.
Helga NowotnyAuf der Suche nach ExzellenzWie viel Evaluierung verträgt das Wissenschaftssystem?
Göttinger Universitätsrede 2011
ca. 26 S., Klappenbroschurca. € 9,– (D); € 9,30 (A)ISBN 9783835309432November WG 1118
Helga NowotnyAuf der Suche nach ExzellenzWie viel Evaluierung verträgt das Wissenschaftssystem?
Die Autorin
Helga Nowotny lehrte und forschte als Professorin für Wissenschaftsforschung an der Universität Wien sowie an der ETH Zürich. Seit 2010 ist sie Präsidentin des Europäischen Forschungsrates. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehört das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse. Die Universität Göttingen verlieh ihr die DorotheaSchlözerMedaille.
In der Reihe erschienen
Jutta Limbach: Der Wissenschaftler als Bürger und Beamter. Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik (2010); Detlev Ganten: Evolutionäre Medizin – Evolution in der Medizin (2009); Wolfgang Frühwald: Die Autorität des Zweifels. Verantwortung, Messzahlen und Qualitätsurteile in der Wissenschaft (2008); Dieter Grimm: Wissenschaftsfreiheit vor neuen Grenzen? (2007); Wolfgang Huber: Wissenschaft verantworten. Überlegungen zur Ethik der Forschung (2006)

Wallstein Verlag Herbst 2012Wissenschaftsgeschichte 55
1917 trat eine länderüber-greifende weibliche Bildungs-elite an, um die Völker-verständigung und ihr eigenes Fortkommen zu befördern. Das Buch untersucht die Umsetzung dieser doppelten Mission.
In den düstersten Tagen des Ersten Weltkriegs formierte sich ein neues akademisches Netzwerk mit einem hochgesteckten Ziel: Eine länderübergreifende weibliche Bildungselite sollte für die Verständigung der Völker eintreten und gleichzeitig ihr eigenes wissenschaftliches Fortkommen international befördern. Das Buch rekonstruiert am Beispiel Deutschlands, inwiefern es den amerikanischen und britischen Initiatorinnen der International Federation of University Women (IFUW) gelang, ihre doppelte Mission nicht nur über die Gräben des vergangenen Krieges hinweg, sondern auch unter den dramatischen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der folgenden Jahrzehnte umzusetzen. Eine besondere Rolle spielt die Zeit des Nationalsozialismus, während der die IFUW die akademische Fluchthilfe für Kolleginnen aus Deutschland und seinem wachsenden Machtbereich zur obersten Priorität erhob.
Christine von OertzenStrategie VerständigungZur transnationalen Vernetzung von Akademikerinnen 1917 –1955
ca. 528 S., brosch.ca. € 39,90 (D); € 41,10 (A)ISBN 9783835309210Oktober WG 1559
Christine von OertzenStrategie VerständigungZur transnationalen Vernetzung von Akademikerinnen 1917 –1955
Die Autorin
Christine von Oertzen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am MPI für Wissenschaftsgeschichte Berlin und Privatdozentin am Historischen Seminar der TU Braunschweig. Veröffentlichungen zur vergleichenden Sozial und Kulturgeschichte sowie zur Bildungs und Wissenschaftsgeschichte, u.a.: Teilzeitarbeit und die Lust am Zuverdienen. Geschlechterpolitik und gesellschaftlicher Wandel in Westdeutschland, 1948 –1969 (1999).
Im Wallstein Verlag erschienen
Romana Weiershausen: Wissenschaft und Weiblichkeit. Die Studentin in der Literatur der Jahrhundertwende (2004)
Heißer Streit und kalte Ordnung. Epochen der Querelle des femmes zwischen Mittelalter und Gegenwart, hg. von Friederike Hassauer unter Mitarbeit von Kyra Waldner, Wolfram Aichinger, Annabell Lorenz und Nikolaos Katsivelaris (2008)
Der Weg an die Universität. Höhere Frauenstudien vom Mittelalter bis zum 20. Jahr hundert, hg. von Trude Maurer i. A. der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der GeorgAugustUniversität Göttingen
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 2012 56 Wissenschaftsgeschichte
Zur Erinnerung an einen Historiker, der die Geschichte erlitten hat – so sehr, dass er die Historie als Problem des Aushaltens für den Historiker empfand.
In Leben und Œuvre des Althistorikers Hermann Strasburger (1909 –1985) spiegeln sich Deutsche Geschichte und Wissenschaftsgeschichte in besonders eindringlicher Weise.
1931 in Frankfurt am Main promoviert, wurde Strasburger 1936 als sogenanntem Vierteljuden die Habilitation versagt. Gleichwohl in die Wehrmacht eingezogen, kehrte er schwerverwundet aus dem Krieg zurück. 1946 konnte er sich in Heidelberg habilitieren, seine alte Alma Mater bot ihm bald darauf eine Diätendozentur. 1955 erhielt er dort den Lehrstuhl für Alte Geschichte. Als Opfer der Geschichte war sein Blick für die Perspektive des Zeitgenossen geschärft. Sogenannte Große Männer konnte er – im Unterschied zu manchem Kollegen der Nachkriegszeit – nicht mehr erkennen. Caesar etwa war ihm kein Staatsmann.
Anlässlich des 100. Geburtstages von Hermann Strasburger veranstaltete das Historische Seminar der GoetheUniversität Frankfurt am Main eine vielbeachtete Gedenkfeier, deren Beiträge hier vorgelegt werden. Im Zentrum steht die bewegende Rede von Strasburgers Frankfurter Schüler Christian Meier. Beigelegt sind Aktenstücke aus dem Universitätsarchiv, die Schlaglichter auf das akademische Leben in der Nachkriegszeit werfen.
Wiederanfang und Ernüchterung in der NachkriegszeitDem Althistoriker Hermann Strasburger in memoriam
Herausgegeben von Frank Bernstein und Hartmut Leppin
Schriftenreihe des Frankfurter Universitätsarchivs, Bd. 4.Herausgegeben von Notker Hammerstein und Michael Maaser
ca. 64 S., brosch.ca. € 12,– (D); € 12,40 (A)ISBN 9783835311268September WG 1559
Wiederanfang und Ernüchterung in der NachkriegszeitDem Althistoriker Hermann Strasburger in memoriam
Die Herausgeber
Frank Bernstein, geb. 1964, ist Professor für Alte Geschichte am Histo rischen Seminar der Johann Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt am Main.
Hartmut Leppin, geb. 1963, ist Professor für Alte Geschichte am Histo rischen Seminar der Johann Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt am Main.
In der Reihe erschienen
Notker Hammerstein: Geschichte als Arsenal. Ausgewählte Aufsätze zu Reich, Hof und Universitäten der Frühen Neuzeit (2010); Stadt, Universität, Archiv, hg. von Michael Maaser (2009); Frankfurter Wissenschaftler zwischen 1933 und 1945, hg. von Jörn Kobes und JanOtmar Hesse (2008)
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 201257Über Literatur
Die neue Reihe behandelt Grundlagenprobleme einer literarischen Ästhetik durch die Zeiten und Stile. Band 1 diskutiert die Ästhetik der »Stelle«.
Über die Reihe
Die »Kleinen Schriften zur literarischen Ästhetik und Hermeneutik« verbinden in essayistischer Form Interpretation und Reflexion auf die spezifische Ästhetik der Literatur. In Themenwahl und Stil richten sich die Essays zugleich an die wissenschaftliche und die literarisch interessierte Öffentlichkeit.
Stellenlektüre ist verpönt. Und doch eröffnet die Stelle den Zugang zum Ganzen. Die Stelle ist der Ort, an dem die literarische Erfahrung konkret und von besonderer Intensität wird. So ist es kein Zufall, dass durch die Literaturgeschichte des Abendlands hindurch seit Augustinus ›tolle lege‹ die Stelle im Buch auch immer wieder zum Kreuzungspunkt zwischen Literatur und Leben wurde.
Wolfgang Braungart und Joachim JacobStellen, schöne StellenOder: Wo das Verstehen beginnt
Kleine Schriften zur literarischen Ästhetik und Hermeneutik, Bd. 1.Herausgegeben von Wolfgang Braungart und Joachim Jacob
ca. 80 S., Klappenbroschur ca. € 12,90 (D); € 13,30 (A) ISBN 9783835310797 Oktober WG 1562
Wolfgang Braungart und Joachim JacobStellen, schöne StellenOder: Wo das Verstehen beginnt
Die Reihenherausgeber und Autoren von Band 1
Wolfgang Braungart, geb. 1956, Professor für Neuere deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld.
Joachim Jacob, geb. 1965, Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine Literaturwissenschaft an der JustusLiebigUniversität Gießen.
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 2012 58 Über Literatur
Zum identifikatorischen Lesen am Beispiel des Romans »Les bienveillantes« von Jonathan Littell.
Jonathan Littells »Les bienveillantes« (2006) löste in Frankreich und Deutschland eine Debatte aus. Den Kern der Provokation bildet die Tatsache, dass der Roman den Leser zu einer Identifikation mit einem NaziTäter nötigt. Von Koppenfels nimmt diesen Fall zum Anlass, die abgründige Seite des identifikatorischen Lesens in Augenschein zu nehmen. Er untersucht die literarische Tradition der infamen IchErzählung, die psychologischen Mechanismen, die solche Tätererzählungen aktivieren, und die Rolle der deutschen Sprache in diesem literarischen Spiel aus Vereinnahmung und Abstoßung.
Martin von KoppenfelsSchwarzer PeterJonathan Littell und die Identifikation mit dem Täter
Kleine Schriften zur literarischen Ästhetik und Hermeneutik, Bd. 2.Herausgegeben von Wolfgang Braungart und Joachim Jacob
ca. 120 S., Klappenbroschurca. € 12,90 (D); € 13,30 (A)ISBN 9783835311756Oktober WG 1562
Martin von KoppenfelsSchwarzer PeterJonathan Littell und die Identifikation mit dem Täter
Der Autor
Martin von Koppenfels, geb. 1967, Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der LudwigMaximiliansUniversität München.
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 201259Über Literatur
Rabeners Spiel mit der Satiretradition und den Konventionen der Aufklärungspoetik – erstmalig erschlossen.
Die »Sammlung satyrischer Schriften« Gottlieb Wilhelm Rabeners erschien in erster Auflage 1751 –1755. Nadja Müller erschließt diese Texte erstmals als komplexes Spiel mit der Satiretradition sowie den Konventionen der Aufklärungspoetik. Die vermeintlich trockenmoralisierende explizite Satirekonzeption in den rahmenden Vor und Zwischenworten darf nicht ohne ironischen Subtext gelesen werden, der auf Rabeners ironische Grundhaltung im Bewusstsein seiner Pflichten als ›guter Bürger‹ verweist. Die implizite Satirekonzeption, bei der er durchgängig Herausgeber und/oder Autorfiktionen verwendet, erweist sich als eine subversiv gesellschaftskritische Poetikstrategie mit moralischästhetischem Anspruch in Zeiten von Zensur und Militarismus. Diese Strategie wird anhand der Paratext und Palimpseststruktur und des Verhältnisses von Satire und Ironie dargestellt. So werden Rabeners satirische Schriften als Praxis einer ironischen Ethik charakterisiert, die sowohl eine moralische Lebensmaxime als vir bonus in der Tradition des Horaz und im Sinne Shaftesburys didaktisiert als auch die literarischen Umsetzungsmöglichkeiten reflektiert und in ihre Grenzen verweist.
Nadja MüllerMoral und Ironie bei Gottlieb Wilhelm RabenerParatext und Palimpsest in den Satyrischen Schriften
ca. 320 S., ca. 2 Abb.,geb., Schutzumschlagca. € 29,90 (D); € 30,80 (A)ISBN 9783835311695Oktober WG 1562
Nadja MüllerMoral und Ironie bei Gottlieb Wilhelm RabenerParatext und Palimpsest in den Satyrischen Schriften
Gottlieb Wilhelm Rabener
(1714 –1771), deutscher Schriftsteller der Aufklärung. Arbeitete als Steuerbeamter in Leipzig und ab 1753 in Dresden; seine satirischen und essayistischen Zeitschriftenartikel und Prosasatiren entlarvten gesellschaftliche Missstände und menschliche Schwächen. Durch seine vierbändige »Sammlung satirischer Schriften« von 1751 –1755 wurde er europaweit bekannt.
Die Autorin
Nadja Müller, geb. 1972, Studium der Philosophie, der Neueren und Älteren dt. Philologie in Köln und Düsseldorf; Promotion 2011. Seit Oktober 2010 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik der HeinrichHeineUniversität Düsseldorf. Publikationen zur Literatur des 18. Jahrhunderts, des Realismus und der klassischen Moderne (u.a. Rabener, Kleist, Fontane, Kafka).
Im Wallstein Verlag erschienen
Gottlieb Wilhelm Rabener: Briefwechsel und Gespräche, hg. von E. Theodor Voss (2012)
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 2012 60 Über Literatur
Die produktive und wider-sprüchliche Werther-Rezeption in literarischen und kulturphilo-sophischen Werken.
Johann Wolfgang von Goethes Leiden des jungen Werther wurden zu einem Welterfolg. Für Madame de Staël war Werther der Repräsentant der einzig wahren Liebe, Charles de Villers bewunderte dessen »Sehnsucht, Ahndung, Schwärmerei«, Stendhal benannte das Phänomen der deutschen Liebe erstmals konkret als »Amour à la Werther qui ouvre l’âme à tous les arts«. In dem Wunsch, ihrer Heimat Frankreich ein Modell der Ergänzung oder gar, wie Villers, des Ersatzes vorzuführen, übertrugen diese Autoren das »romantische« Liebeskonzept des Werther auf seinen Schöpfer und die Deutschen.
Susanne Mildner richtet den Blick auf ein bisher kaum wahrgenommenes Phänomen der Liebeskonzeptionen um 1800: Diese wurden jeweils mit Blick auf den Anderen entwickelt. Die Darstellung und Deutung der Liebe wird zu einer Art Streitpunkt im Austausch deutscher und französischer Autoren. Die bei diesem »geistigen Handelsverkehr« auftretenden, aus Stereotypen der Fremdwahrnehmung resultierenden Missverständnisse sind wesentlicher Teil der Interaktion. Indem Goethe, Villers, de Staël und Stendhal die Images zwar aufnehmen, aber unterlaufen, stellen sie Liebe viel komplexer dar, als eine oberflächliche Betrachtung des Nationalitätendiskurses vermuten lässt. Liebe geht in nationalen Stereotypen nicht auf. Zwar stellen sie eine Möglichkeit der Wahrnehmung von Identität dar, stoßen vor diesem Phänomen jedoch an ihre Grenzen.
Susanne MildnerL’Amour à la WertherLiebeskonzeptionen bei Goethe, Villers, de Staël und Stendhal
ca. 368 S., brosch.ca. € 34,90 (D); € 35,90 (A)ISBN 9783835311763August WG 1560
Susanne MildnerL’Amour à la WertherLiebeskonzeptionen bei Goethe, Villers, de Staël und Stendhal
Die Autorin
Susanne Mildner, geb. 1980, studierte an der Universität Potsdam Germanistik und promovierte an der Universität Potsdam und der Université Sorbonne Nouvelle Paris III. Für die vorliegende Arbeit erhielt sie den Podsdamer NachwuchswissenschaftlerPreis der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen u.a.: (Des)Illusionen in Weimar De Staëls Begegnung mit »Werther«. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik (2012); Konstruktionen der Femme fatale: Die LuluFigur bei Wedekind und Pabst (2007).
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 201261Über LiteraturÜber Literatur
Katharina Mommsen versam-melt hier ihre wichtigsten Auf-sätze, Reden und Vorträge zu Goethes kultureller Neugier.
»Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen« – diese von Goethe 1826 ebenso kühn wie prophetisch formulierte und vorgelebte Einsicht erscheint angesichts unserer globalisierten Gegenwart geradezu zwingend. Goethes Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen, seine Gabe, sich ihnen anzuvertrauen und sie sich produktiv anzuverwandeln, hat der Verständigung zwischen den Völkern neue Wege gebahnt und dem Dichter in allen Teilen der Welt Sympathie und Bewunderung eingetragen. Sie verdient heute größere Beachtung denn je.
Katharina Mommsen ist in ihrer jahrzehntelangen Forschungsarbeit und ihrem Wirken für eine Verständigung zwischen den Kulturen Goethes Spuren gefolgt. Sie zeigt Goethe als geistigen Dolmetscher und echten Brückenbauer zwischen den Kulturen – mithin in seinen heute wahrscheinlich aktuellsten Rollen.
Katharina Mommsen»Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen«Goethe und die Weltkulturen
Schriften der Goethe Gesellschaft, Bd. 75.Herausgegeben von Jochen Golz
ca. 480 S., ca. 20 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 28,– (D); € 28,80 (A)ISBN 9783835310001August WG 1563
Katharina Mommsen»Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen«Goethe und die Weltkulturen
Die Autorin
Katharina Mommsen, geb. 1925, ist emeritierte Professorin für Germanistik an der Stanford University, Kalifornien; zahlreiche Veröffentlichungen, insbesondere zu Goethe und zu Goethes Verhältnis zur islamischen Welt; seit 1958 gibt sie das Grundlagenwerk »Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten« heraus.
Im Wallstein Verlag erschienen
Katharina Mommsen: Kein Rettungsmittel als die Liebe. Schillers und Goethes Bündnis im Spiegel ihrer Dichtungen (2010)
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 2012 62 Über Literatur
Die erste interdisziplinäre Gesamtdarstellung über Schiller als Vordenker unseres modernen Rechts-verständnisses.
Das Thema »Literatur und Recht« ist in den vergangenen Jahren zu einem der innovativsten Forschungsfelder der Literaturwissenschaft geworden. Dabei wurde Friedrich Schiller, in dessen Œuvre die Rechtsthematik eine grundlegende Rolle spielt, bislang noch viel zu wenig Beachtung geschenkt.
In ihrer interdisziplinären Arbeit beleuchtet Yvonne Nilges Schillers intensive Auseinandersetzung mit sämtlichen Fragen des Straf und Staatsrechts im Zusammenhang mit der Rechtsgeschichte und der Rechtsphilosophie. Die herausragende Bedeutung des juridischen Diskurses in Schillers literarischem und theoretischem Gesamtwerk geht untrennbar mit politischen, theologischen wie auch sozialanthropologischen Aspekten einher, die von der Aufklärung bis in die Gegenwart hinein wirken.
Die Untersuchung beruht dabei in wesentlichen Teilen auf bisher noch unbekanntem Quellenmaterial zu Schillers Studium der Jurisprudenz an der Stuttgarter Karlsschule.
Yvonne NilgesSchiller und das Recht
ca. 432 S., ca. 3 Abb.,geb., Schutzumschlagca. € 44,90 (D); € 46,20 (A)ISBN 9783835311299August WG 1563
Yvonne NilgesSchiller und das Recht
Die Autorin
Yvonne Nilges, geb. 1980, studierte deutsche und englische Philologie an der Universität Heidelberg. Seit 2010 Privatdozentin an der Universität Heidelberg. Veröffentlichungen u.a.: Richard Wagners Shakespeare (2007); Auf der Suche nach dem verlorenen Gott: Thomas Manns Theologie (im Entstehen).
Im Wallstein Verlag erschienen
Thomas Stackel: Der Ring der Notwendigkeit. Schiller nach der Natur (2010); Schillers Schädel. Physio gnomie einer fixen Idee, hg. von Jonas Maatsch und Christoph Schmälzle i. A. der Klassik Stiftung Weimar (2009)
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 201263Über Literatur
Ricarda Huchs Hauptwerke werden neu gelesen und ihre Begegnungen mit Zeitgenossen rekonstruiert.
Ricarda Huch (1864 –1947) war Dichterin und Historikerin zugleich. Neben Romanen, Erzählungen und Lyrikbänden verfasste sie Biographien und Epochendarstellungen. Sie hinterließ ein vielschichtiges und weitgehend noch unerforschtes Œuvre, das von der Frage nach der Stellung des Menschen in der Moderne und dem Gewicht der Überlieferungen angetrieben wurde.
Aus dem Inhalt:Cornelia Blasberg: Der letzte Sommer. Zur Leistungskraft von Brief erzählungen
im 20. JahrhundertBarbara Hahn: »Unsre Sache«. Franz Rosenzweig begegnet einem besonderen
WissenDorit Krusche: Die Romantik und die Literaturgeschichte der Romantik im
19. JahrhundertAngelika Schaser: Der große Krieg in Deutschland. Literarische Geschichts
schreibung als weibliche Geschichtswissenschaft?Bastian Schlüter: »Jene PoetinGeschichtsschreiberin, die am liebevollsten, grau
samsten in seine wunderliche Seele blickte …« Begegnungen mit Golo MannMichael Schmidt: Anarchie statt Chaos oder Bakunin: ein deutscher Diskurs?
Zur Biographie des russischen Anarchisten
Denk- und Schreibweisen einer Intellektuellen im 20. JahrhundertÜber Ricarda Huch
Herausgegeben von Gesa Dane und Barbara Hahn
ca. 244 S., geb., Schutzumschlagca. € 34,90 (D); € 35,90 (A)ISBN 9783835311404Juli WG 1563
Denk- und Schreibweisen einer Intellektuellen im 20. JahrhundertÜber Ricarda Huch
Die Herausgeberinnen
Gesa Dane, Professorin für Literaturwissenschaft an der FU Berlin. Veröffentlichungen u.a.: Zeter und Mordio. Vergewaltigung in Literatur und Recht (2005); Die heilsame Toilette. Kosmetik und Bildung in Goethes »Mann von fünfzig Jahren« (1994).
Barbara Hahn, Distinguished Professor of German an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Veröffentlichungen u.a.: Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde (Hg., 2011); Hannah Arendt – Leidenschaften, Menschen und Bücher (2005); Die Jüdin Pallas Athene. Auch eine Theorie der Moderne (2002).
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 2012 64 Über Literatur
Die Denkbewegungen eines großen Intellektuellen der Moderne – Hugo Balls Weg vom Dada-Begründer zum religiösen Asketen.
Hugo Ball war ein Intellektueller, der sich an den geistigen Auseinandersetzungen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts auf vielfältige Weise betei ligt hat: von der wortspielerischen Lautpoesie des Dadaismus, über geschichtsphilosophischpolitische Essays und weitsichtige Kommentare zur zeitgenössischen Kunst bis hin zu radikalen Stellungnahmen zur religiösen Krise der Moderne. In seinem Denken verbinden sich Fragen der Ästhetik, der Sprachphilosophie, der Religionsphilosophie und der politischen Philosophie. Die Positionen wandeln sich, aber es lassen sich doch klare Linien erkennen, die vom Nietzscheleser und dem Begründer des Dadaismus über den politischen Journalisten und Geisteshistoriker zum Leser der »Acta Sanctorum«, der Legendensammlungen über Heilige und Märtyrer, führen.
WiebkeMarie Stock legt die spezielle Kombination aus Ästhetik, Sprachphilosophie und politischer Philosophie im Denken Balls frei. Sie verfolgt seinen turbulenten geistigen Entwicklungsweg und zeigt, dass viele seiner Positionen überraschend aktuell und bedenkenswert erscheinen.
Wiebke-Marie StockDenkumsturzHugo Ball. Eine intellektuelle Biographie
ca. 224 S., geb., Schutzumschlagca. € 24,90 (D); € 25,60 (A)ISBN 9783835311848September WG 1563
Wiebke-Marie StockDenkumsturzHugo Ball. Eine intellektuelle Biographie
Die Autorin
WiebkeMarie Stock, geb 1977, studierte Philosophie, Religionswissenschaft und Kunstgeschichte in Heidelberg, Paris und Berlin und promovierte 2007 mit einer Arbeit über den von Hugo Ball geschätzten frühchristlichen Philosophen Dionysius Areopagita. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin. Veröffentlichungen u.a.: Geschichte des Blicks. Zu Texten von George DidiHuberman (2004).
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 201265Über Literatur
Zu seinem 100. Geburtstag am 31. Oktober 2012: Jean Amérys phänomenologische Ethik als Äquivalent zu Adornos Auschwitz-Diskurs.
Mit seinem AuschwitzDiskurs legt Jean Améry (1912 –1978) der westdeutschen Nachkriegsliteratur und Erinnerungskultur ein einzigartiges Fundament. Er schreibt über Auschwitz wie über ein Phänomen, das nur über die körperliche Erinnerung der jüdischen NaziOpfer an die erlebte Vernichtung erfasst werden kann. Seine Werke entfalten eine philosophische Theorie der Moral nach Auschwitz, eine Ethik der Erinnerung.
Sylvia Weiler untersucht diese Ethik erstmalig in ihren phänomenologischen Bezügen anhand aller EssayBände Jean Amérys, die zwischen seinem Eintritt in den westdeutschen Literaturbetrieb 1966 und seinem Freitod 1978 entstanden sind. Zudem vollzieht sie die Genese dieser Ethik vor dem Hintergrund der Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts nach, wozu sie sämtliche Arbeiten aus dem AméryNachlass auf ihren erinnerungspolitischen Gehalt hin analysiert: jene Texte, die er zur Zeit seiner schriftstellerischen Anfänge im Wien der dreißiger Jahre schrieb und jene aus dem unmittelbaren Nachkrieg. Die Einzig und Neuartigkeit von Amérys Erinnerungsdiskurs verdeutlicht ein Vergleich mit dem AuschwitzDiskurs Theodor W. Adornos, der als philosophischer Begründer der Nachkriegsliteratur gilt.
Sylvia WeilerJean Amérys Ethik der ErinnerungDer Körper als Medium in die Welt nach Auschwitz
ca. 480 S., geb., Schutzumschlagca. € 49,90 (D); € 51,30 (A)ISBN 9783835311305Juli WG 1563
Sylvia WeilerJean Amérys Ethik der ErinnerungDer Körper als Medium in die Welt nach Auschwitz
Die Autorin
Sylvia Weiler, geb. 1977, ist Gymnasiallehrerin und Literaturwissenschaftlerin.
Veröffentlichungen u.a.: Jean Amérys erinnerungspolitische Kritik an Hannah Arendt, in: Gedächtnis und Widerstand (Hg. zus. mit Mireille Tabah und Christian Poetini, 2009). Für die vorliegende Studie erhielt sie den »Prix de mérite« der Fondation Auschwitz in Brüssel 2010.
Im Wallstein Verlag erschienen
Seiner Zeit voraus. Jean Améry – ein Klassiker der Zukunft? Hg. von Irene HeidelbergerLeonard und Irmela von der Lühe (2009); Kritik aus Passion. Studien zu Jean Améry, hg. von Matthias Bormuth und Susan NurmiSchomers (2005)
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 2012 66 Über Literatur
Eine Rekonstruktion von Kosellecks Œuvre und dessen Verortung im Kontext seiner intellektuellen Nachbarschaften zu Karl Löwith, Hans-Georg Gadamer, Carl Schmitt u.a.
»Sprache und Geschichte« ist nicht nur der Titel einer Buchreihe, die Reinhart Koselleck herausgegeben hat, sondern das Leitthema seines wissenschaftlichen Lebenswerkes. Die Frage nach den sprachlichen Bedingungen der Geschichte prägt Kosellecks bahnbrechende Arbeiten zur Begriffsgeschichte ebenso wie seine Studien zur Geschichte der Aufklärung und zur Theorie historischer Erkenntnis. Im Hintergrund steht dabei auch eine lebensgeschichtliche Prägung, die Koselleck 2003 auf die Formel gebracht hat: »Krieg und Russische Gefangenschaft = Erfahrungswissenschaft«.
Dauerhaft aktuell bleibt Kosellecks Einsicht in den unhintergehbaren Zusammenhang und die unaufhebbare Asymmetrie von Sprache und Geschichte: »Geschichte ist immer mehr oder aber weniger, als begrifflich über sie gesagt werden kann – so wie Sprache immer mehr oder weniger leistet, als in der wirklichen Geschichte enthalten ist.«
Zwischen Sprache und GeschichteZum Werk Reinhart Kosellecks
Herausgegeben von Carsten Dutt und Reinhard Laube
marbacher schriften, neue folge, Bd. 9.Herausgegeben von Ulrich Raulff, Ulrich von Bülow und Marcel Lepper
ca. 280 S., ca. 6 Abb., brosch.ca. € 19,90 (D); € 20,50 (A)ISBN 9783835311701November WG 1560
Zwischen Sprache und GeschichteZum Werk Reinhart Kosellecks
Reinhart Koselleck
(1923 – 2006) war Professor in Bochum, Heidelberg und Bielefeld. Er war Mitglied zahlreicher Akademien und Kollegien; Träger u.a. des Preises des Historischen Kollegs 1989, des SigmundFreudPreises 1999 und des Historikerpreises der Stadt Münster 2003. Seine grund legenden Studien zur euro päischen Aufklärung, Begriffsgeschichte und Theorie der Geschichte wirkten über die Fachgrenzen der Geschichtswissenschaft hinaus.
Die Herausgeber
Carsten Dutt, Dr. phil., geb. 1965, ist seit 2012 Assistant Professor of German an der University of Notre Dame (USA). Veröffentlichungen u.a.: Reinhart Koselleck: Vom Sinn und Unsinn der Geschichte, (Hg., 2010).
Reinhard Laube, Dr. phil, geb. 1967, ist Historiker und wissenschaftlicher Bibliothekar. Seit 2011 ist er Leiter der Abteilung Handschriften und Alte Drucke und seit 2012 zweiter stellv. Direktor der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover.
In der Reihe erschienen
Was war Bielefeld? Eine ideengeschichtliche Nachfrage, hg. von Sonja Asal und Stephan Schlak (2009)
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 201267Über Literatur
Horst Bienek hat wie kaum ein Autor vor ihm die Abgründe des 20. Jahrhunderts zum Thema seines Werkes gemacht.
In den sechzig Jahren seines Lebens hat der Schriftsteller Horst Bienek den Zweiten Weltkrieg, die Diktatur des Nationalsozialismus, die Vertreibung aus Oberschlesien, stalinistisches Arbeitslager und den Kalten Krieg erlebt. Diese prägenden Erfahrungen lieferten den Stoff für seine künstlerische Arbeit: »Ich habe mir meine Themen nicht ausgewählt, sie sind mir aufgezwungen worden. Zumeist durch die Biografie – was ich übrigens als den einzigen und gerechtesten Zwang anerkenne«.
Die Beiträge von internationalen BienekForschern und Zeitzeugen beleuchten Leben und Werk eines Autors, der auf überraschende Weise aktuell ist.
Aus dem Inhalt:Wolfgang Frühwald: Eine »Brücke aus Papier«. Zeiterfahrung und Sprach
vertrauen im Werk von Horst BienekReinhold Görling: Das Denken der Zelle. Über Horst Bieneks FilmprojektHans-Joachim Hahn: Wahrheit, Wirklichkeit und Geschichte – Aspekte von
Horst Bieneks »poetischem Realismus«Jürgen Joachimsthaler: Das Atmen der Sätze in der Enge des WortRaums. Zu
Horst Bieneks SchreibweiseDirk Kemper: Horst Bienek und DostoevskijMichael Krüger: Der Lektor und Verleger Horst Bieneks im Gespräch mit Stephan
LohrAndreas Petersen: Zu Horst Bieneks ungeschriebenem WorkutaRomanKarol Sauerland: Meine Begegnung mit Horst Bienek
Horst Bienek – Ein Schrift-steller in den Extremen des 20. Jahrhunderts
Herausgegeben von Reinhard Laube und Verena NolteMit einem Vorwort von Georg Ruppelt und einer Einleitung der Herausgeber
Aus der Forschungs bibliothek.Herausgegeben i. A. der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
ca. 256 S., ca. 10 Abb., brosch.ca. € 19,90 (D); € 20,50 (A)ISBN 9783835309715September WG 1563
Horst Bienek – Ein Schriftsteller in den Extremen des 20. Jahrhunderts
Horst Bienek
Horst Bienek (1930 –1990) war Schriftsteller, Künstler und Filmemacher. In den 1960erJahren arbeitete er u.a. beim Hessischen Rundfunk und als Lektor bei dtv ehe er ab 1968 als freier Schriftsteller in München lebte. Bis 1990 leitete er die Literaturabteilung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Neben zahlreichen anderen Preisen erhielt er den WilhelmRaabePreis und den JeanPaulPreis.
Die Herausgeber
Reinhard Laube ist wissenschaftlicher Bibliothekar und Leiter der Abteilung Handschriften und Alte Drucke sowie des HorstBienekArchivs der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Hannover.
Verena Nolte ist Autorin und freie Kuratorin von internationalen Literatur und Kunstprojekten in München. Im Jahr 2011 kuratierte sie die Literaturausstellung »Ich habe die Zeit gesehen«.

Wallstein Verlag Herbst 2012 68 Über Literatur
Das Wort kann auch noch da heilsam sein, wo die Schul-medizin am Ende ist. Ein inter-disziplinärer Blick auf die Bedeutung des Wortes in der Medizin.
Die moderne Medizin: sie setzt auf Naturwissenschaften, auf Technik, auf Reparatur. So als wäre die Krankheit allein ein Defekt, den es zu beheben gilt. Innerhalb einer solchen Konzeption von Medizin wird alle Kraft auf das Machen gerichtet und verkannt, dass dem kranken Menschen oft eher durch das Wort als durch Verrichtungen geholfen werden kann.
Worin liegt die Macht des Wortes in der Medizin, und wo seine Grenze? Dieses Buch gibt einen Einblick in die verschiedenen Facetten dieses Zusammenhangs, um so für eine Medizin zu sensibilisieren, die als humane Medizin sich nur als eine personale Medizin begreifen kann.
Dietrich von Engelhardt hat in seinem bisherigen Lebenswerk die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Behandlung des Patienten und einer ganzheitlichen Medizin im soziokulturellen Kontext unterstrichen und dem Wort eine besondere Bedeutung beigemessen. Ihm ist dieser Sammelband zum 70. Geburtstag gewidmet.
Aus dem Inhalt:Werner Ingensiep: Kants Worte im Angesicht von Leben und TodIngrid Kästner: Heilungsversprechen. Arzneimittelreklame in der ersten Hälf
te des 20. JahrhundertsHeinz Schott: Die Macht des Geistes und die Magie des Wortes. Medizin
historische Anmerkungen zum Placebo/NoceboProblemGünter Virt: Vom Informieren zum heilsamen Wort in der Medizin
Macht und Ohnmacht des WortesEthische Grundfragen einer personalen Medizin
Herausgegeben von Giovanni Maio
ca. 512 S., geb., Schutzumschlagca. € 34,90 (D); € 35,90 (A)ISBN 9783835311480September WG 1691
Macht und Ohnmacht des WortesEthische Grundfragen einer personalen Medizin
Der Herausgeber
Giovanni Maio, geb. 1964, ist Philosoph und Mediziner; seit 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik an der Universität Freiburg und Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Veröffentlichungen u.a.: Mittelpunkt Mensch. Ethik in der Medizin – Ein Lehrbuch (2011); Das Gehirn als Projekt. Über neurotechnologische Selbstgestaltung (Mithg., 2011); Das technisierte Gehirn. Neurotechnologien als Herausforderung für Ethik und Anthropologie (Mithg., 2009).
Dietrich von Engelhardt
geb. 1941, war langjähriger Direktor des Instituts für Medizin und Wissenschaftsgeschichte in Lübeck; Gründungsmitglied und ehemaliger Präsident der Akademie für Ethik in der Medizin. Er gilt als einer der Pioniere der Medizinethik, dem es vorbildlich gelungen ist, das Fach in die Medizinische Fakultät zu integrieren. Veröffentlichungen u.a.: Ästhetik und Ethik in der Medizin (Mithg., 2006); Krankheit, Schmerz und Lebenskunst. Eine Kulturgeschichte der Körpererfahrung (1999).
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 201269Über Literatur
Die vielsprachige Schweiz gilt als Paradigma des Kultur-kontakts und -austauschs, gerade auch im Zeitalter der Aufklärung – ein Stereotyp?
Ein interdisziplinäres Beiträgerfeld zeichnet in diesem Band ein detailliertes und facettenreiches Portrait der Schweiz des 18. Jahrhunderts im Kontext der Aufklärung und liefert damit einen substanziellen Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte.
Aus dem Inhalt:Daniela Kohler: Zürich – Göttingen – Weimar: Der Lavaterschüler und Göt
tingenStudent Johann Georg Müller als Vermittler zwischen Lavater und Herder
Klaus Manger: »Vierzehn glükliche Tage in der förenen Hütte« – Wieland in der Schweiz
Alfred Messerli: Transnationale Medienereignisse im Appenzeller Kalender in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Bild und Text
Ulrich Pfister: Der Textilhandel der Familie Zellweger in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Protoindustrialisierung – kommerzielle Revolution – Konsumrevolution
Bärbel Schnegg: Der Briefwechsel zwischen Laurenz Zellweger und Johann Jakob Scheuchzer. Zur Dynamik eines Alpendiskurses im Innern
Andreas Urs Sommer: Ideentransfer und Ideentransferverweigerung – Basel zwischen Hochorthodoxie und Aufklärung
Markus Winkler: Zum Verhältnis von Natur und Geschichte in Idyllen von Geßner (»Daphnis und Micon«) und Goethe (»Der Wandrer«)
Europa in der SchweizGrenzüberschreitender Kulturaustausch im 18. Jahrhundert
Herausgegeben von Heidi Eisenhut, Anett Lütteken und Carsten Zelle
ca. 352 S., ca. 42 Abb., brosch.ca. € 29,– (D); € 29,90 (A)ISBN 9783835309227September WG 1560
Europa in der SchweizGrenzüberschreitender Kulturaustausch im 18. Jahrhundert
Die Herausgeber
Heidi Eisenhut, geb. 1976, seit Oktober 2006 Leiterin der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Trogen. Arbeitsschwerpunkte zu Historiographiegeschichte, Kultur und Mentalitätsgeschichte sowie Ideen und Geistes geschichte.
Anett Lütteken, geb. 1966, Aktuarin der SGEAJ. Mitarbeit an der Edition der Werke Anton Ulrichs von BraunschweigLüneburg und Publikationen zur Sozial und Kulturgeschichte der Literatur des 18. bis 20. Jahrhunderts sowie zu Heinrich von Kleist.
Carsten Zelle, geb. 1953, Professor für Neugermanistik, insbes. Literaturtheorie und Rhetorik, am Germanistischen Institut der RuhrUniversität Bochum. Hg. der Zeitschrift Das achtzehnte Jahrhundert.
In der Reihe erschienen
Heilkunst und schöne Künste. Wechselwirkungen von Medizin, Literatur und bildender Kunst im 18. Jahrhundert, hg. von Heidi Eisenhut, Anett Lütteken und Carsten Zelle (2011); Der Kanon im Zeitalter der Aufklärung. Beiträge zur historischen Kanonforschung, hg. von Anett Lütteken, Matthias Weishaupt und Carsten Zelle (2009)
auch als E-Book erhältlich

Wallstein Verlag Herbst 2012 70 Periodica
Goethe-Jahrbuch 2011Band 128
Herausgegeben von Jochen Golz, Albert Meier und Edith Zehm
512 S., 39 Abb., brosch.€ 29,95 (D); € 30,90 (A)ISBN 9783835311237ISSN 03234207Juli WG 1563
Das GoetheJahrbuch 2011 versammelt die Vorträge der Konferenz »Goethe und die Künste«, die im Juni 2011 ca. 600 Goethefreunde aus 20 Ländern in Weimar zusammengeführt hat. Es enthält zudem Abhandlungen und Miszellen zu Goethes Leben und Werk. Veröffentlicht werden auch die Essays der Preisträger des 3. internationalen EssayWettbewerbs der GoetheGesellschaft. Ein umfangreicher Rezensionsteil zu wichtigen Neuerscheinungen sowie Berichte über das Wirken der GoetheGesellschaft im In und Ausland ergänzen den Band.
Lessing Yearbook/Jahrbuch XXXIX, 2010/2011
Edited for the Lessing Society by Monika Fick and Stephan Braese. Book Reviews edited by Monika Nenon
ca. 464 S., ca. 6 Abb., geb., Schutzumschlagca. € 24,– (D); € 24,70 (A)ISBN 9783835311350ISSN 00758833Oktober WG 1560
Mit Beiträgen von:Cord-Friedrich Berghahn, Klaus Brieg-leb, Monika Fick, Gideon Freudenthal, Willi Goetschel, Ursula Goldenbaum, Grazyna Jurewicz, Roman Lach, Tho-mas Martinec, Norbert Mecklenburg, Aamir R. Mufti, Andrea Schatz, Grit Schorch, Gideon Stiening, Adam Sut-cliffe, Liliane Weissberg
Jahrbuch der Deutschen SchillergesellschaftInternationales Organ für Neuere Deutsche Literatur, 56. Jahrgang 2012
Hg. von Wilfried Barner, Christine Lubkoll, Ernst Osterkamp und Ulrich Raulff
ca. 560 S., ca. 5 Abb.,geb., Schutzumschlag ca. € 24,60 (D); € 25,30 (A)ISBN 9783835311381 ISSN 00704318Dezember WG 1563
Mit Beiträgen u.a. von: Dieter Borchmeyer, Michael Davidi, Franz-Josef Deiters, Jeffrey L. High, Stefan Knodler, Dieter Steland

Wallstein Verlag Herbst 2012Periodica 71
Im Schwarzwald – Uncollected Poems 1906 –1911 Im Auftrag der RilkeGesellschaft herausgegeben von Erich Unglaub und Jörg Paulus
Blätter der RilkeGesellschaft, Bd. 31/2012
ca. 320 S., ca. 10 Abb., brosch.ca. € 19,90 (D); € 20,50 (A)ISBN 9783835311374September WG 1563
Der Band enthält Vorträge der RilkeTagung in Bad Rippoldsau (2010) – Im Schwarzwald, wo Rilke 1909 und 1913 zur Kur war sowie die Vorträge des RilkeTreffens in Harvard und Boston (2012), wo Rilkes Verstreute Gedichte – Uncollected Poems im Mittelpunkt standen. Ebenfalls enthalten sind die Erstpublikation von Rilkes Briefen an Pia Valmarana, ein Bericht über die RilkeLiteratur (2009 – 2012) und Rezensionen.
Carl Zuckmayer – Theodor HeussBriefwechselund andere Beiträge zur ZuckmayerForschungZuckmayerJahrbuch, Bd. 11
Im Auftrag der Carl ZuckmayerGesellschaft herausgegeben von Gunther Nickel und Erwin Rotermund
ca. 240 S., brosch. ca. € 29,– (D); € 29,90 (A)ISBN 9783835310148ISSN 14347865 November WG 1117
Carl Zuckmayer war einer der erfolgreichsten Autoren der Literatur, Theater und Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das 1998 gegründete »ZuckmayerJahrbuch« dient zur Dokumentation bislang unveröffentlichter Quellen und als Forum für wissenschaftliche Studien zu seinem Leben und seinem Werk. Der 11. Band dokumentiert neben dem Briefwechsel zwischen Zuckmayer und Theodor Heuss u.a. das Manuskript zu dem nicht realisierten KordaFilm »Pocahontas« (1938/39).
Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 2011/12
Herausgegeben von Anne Bohnenkamp
ca. 320 S., ca. 20, z.T. farb. Abb.,geb., Schutzumschlagca. € 39,– (D); € 40,10 (A)ISBN 9783835311244ISSN 00719463 August WG 1563
Das »Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts« ist ein literatur und kunstwissenschaftliches Periodikum zur deutschsprachigen Literatur und zu den Wechselbeziehungen zwischen Dichtung und Kunst. Die Schwerpunkte liegen in der Goethezeit, der Romantik und der frühen Moderne bis zur Gegenwart. Begründet im Jahr 1902 und herausgegeben vom Direktor des Hochstifts ist das Jahrbuch seit langem ein Forum internationaler Forschung. Neben Abhandlungen erscheinen in ihm kleinere Editionen und Berichte, in denen bedeutendere Neuzugänge oder zu Unrecht unbekannt gebliebene Bestände der Sammlungen erschlossen werden.

Geschichte der GermanistikMitteilungen. Heft 41/42 (2012)
Herausgegeben von Christoph König und Marcel Lepper in Verbindung mit Michel Espagne, Ralf Klausnitzer, Denis Thouard und Ulrich Wyss
ca. 100 S., ca. 3 Abb., brosch. ca. € 14,– (D); € 14,40 (A)ISBN 9783835311091ISSN 16130758 Oktober WG 1563
Aus dem InhaltDenis Thouard: Bemerkungen zur
»École de Lille«Philine Lautenschlager: Deutsche Mu
sikforschung nach 1945 und die Rolle von Friedrich Blume
Bernhard Böschenstein: Heideggers Anmerkungen zu Hölderlin
Christoph König: Kritik und principle of charity – Grundzüge einer Forschungsgeschichte Rilkes (Bollnow, Gadamer, Fülleborn)
Michael Lackner: Victor Segalen als Sino loge
Per Ohrgaard: Carl Roos (1884 –1962), dänischer Germanist. Nazi oder unpolitisch?
Schöpferischer Wettbewerb?Ästhetische und kommerzielle Konkurrenz in den schönen Wissenschaften
Zusammengestellt von YorkGothart Mix und Carlos Spoerhase
Das achtzehnte Jahrhundert. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, 36/2.Herausgegeben von Carsten Zelle
ca. 144 S., brosch.ca. € 17,– (D); € 17,50 (A)ISBN 9783835311411 ISSN 0722740XDezember WG 1562
Aus dem Inhalt:Johannes Rößler: Die Konkurrenz zwi
schen Johann Gottfried Schadow und Alexander Trippel in Rom und Berlin
Martin Mulsow: Hofgelehrte: Wissen zwischen politischer Kommunikation und intellektuellem Markt
Thomas Wegmann: Die Funktion von Paratexten für die Organisation von Aufmerksamkeit und Distinktion im literarischen Feld des 18. Jahrhunderts
Johnson-Jahrbuch 19/2012
Im Auftrag der Uwe JohnsonGesellschaft herausgegeben von Holger Helbig, Bernd Auerochs, Katja Leuchtenberger und Ulrich Fries
ca. 200 S., ca. 10 Abb., geb., mit Schutzumschlag
ca. € 38,– (D); € 39,10 (A) ISBN 9783835311343 ISSN 09459227 November WG 1563
Aus dem Inhalt:Katja Leuchtenberger: Detektivbüro
Malina. Uwe Johnson, Ingeborg Bachmann und ein verhindertes »Lektorat auf Reisen«
Peter Neumann: »Fortbedeutende Vergangenheit« – Erinnerungs, Zu kunfts und Gegenwartsbewusstsein in den Jahrestagen
Eva Schauerte: Uwe Johnson und die New York Times
auch als E-Book erhältlich
Wallstein Verlag Herbst 2012 72 Periodica

Der Band enthält die Reden und Gedenkworte der Herbsttagung 2011 und der Frühjahrstagung 2012 des Ordens Pour le mérite, u.a. den Festvortrag von Alfred Brendel: »Franz List: Vom Überschwang zur Askese«. Ebenfalls enthalten sind die Laudationes auf die Neumitglieder des Ordens Hermann Parzinger, András Schiff, Peter Stein und Eric Wieschaus.
Wallstein Verlag Herbst 2012Periodica 73
EditionVom Herausgeben
Hg. von Joachim Kalka Valerio, Bd. 15/2012
ca. 96 S., brosch. ca. € 10,– (D); € 10,40 (A) ISBN 9783835311398 Oktober WG 1561
Das vorliegende Heft enthält Beiträge, die sich mit einer oft fast unsichtbar bleibenden Tätigkeit auseinandersetzen: mit ganz verschiedenen Aspekten und Formen des Herausgebens von Texten. So schreiben Peter Gülke über die Edition einer BachPartitur, Elisabeth Edl über die akribische Kommentierung ihrer Übersetzungen klassischer französischer Romane, Jens Malte Fischer über die Wirkung der Veröffent lichung der Briefe von Karl Kraus an Sidonie von Nádherny und Joachim Kalka über die überraschenden Figurationen des Herausgeberschicksals in der phantastischen Literatur. Mit Aufsätzen und Glossen weiterer Autoren wie Peter Hamm ergibt sich das komplexe Bild einer für das geistige Leben grundlegenden HintergrundPraxis: der Edition.
Orden Pour le mérite für Wissenschaft und KünsteReden und Gedenkworte. Vierzigster Band 20122013
ca. 320 S., zahlr. z.T. farb. Abb., geb.,ca. € 38,– (D); € 39,10 (A)ISBN 9783835311367ISSN 0473145X Dezember WG 1510
ZeitRäumePotsdamer Almanach des Zentrums für Zeithistorische Forschung 2011
ca. 240 S., franz. brosch.ca. € 19,80 (D); € 20,40 (A)ISBN 9783835311206ISSN 18682138 Dezember WG 1550
ZeitRäume versammelt jährlich eine Auswahl von zeitgeschichtlichen Analysen, die am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam (ZZF) vorgestellt wurden oder aus der Arbeit des Instituts entstanden sind. Die Zusammenstellung hat nicht den Anspruch, die am ZZF betriebenen Forschungen repräsentativ zu spiegeln. Aber sie vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt und Vielgestalt der Wege, die uns zum Verständnis unserer zugleich so nahen und so fernen Zeitgeschichte im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert

Arthur SchnitzlerTräume
Das Traumtagebuch 1875 –1931
Hg. von Peter Michael Braunwarth und Leo A. Lensing
493 S., 4 Abb., geb., Schutzumschlag34,90 € (D); 35,90 € (A)
ISBN 9783835310292
Kay Schiller und Christopher YoungMünchen 1972Olympische Spiele im Zeichen des modernen Deutschland
396 S., 23 Abb., geb., Schutzumschlag29,90 € (D); 30,80 € (A)ISBN 9783835310100
Ute Frevert Gefühlspolitik
Friedrich II. als Herr über die Herzen?
152 S., 26 Abb., geb., Schutzumschlag16,90 € (D); 17,40 € (A)
ISBN 9783835310087
1989 und die Rolle der Gewalt
Hg. von Martin Sabrow
428 S., 2 Abb., brosch.34,90 € (D); 35,90 € (A)ISBN 9783835310599
Heinz Ludwig ArnoldWilflinger Erinnerungen
Mit Briefen von Ernst Jünger
144 S., geb., Schutzumschlag19,90 € (D); 20,50 € (A)
ISBN 9783835310704
Friedrich Christian DeliusDer Held und sein WetterEin Kunstmittel und sein ideologischer Gebrauch im Roman des bürgerlichen Realismus
221 S., geb., Schutzumschlag24,90 € (D); 25,60 € (A)ISBN 9783835310285
Berlin TransitJüdische Migranten aus Osteuropa
in den 1920er Jahren
Hg. von der Stiftung Jüdisches Museum Berlin in Zusammenarbeit mit dem
Forschungsprojekt »Charlottengrad und Scheunenviertel
160 S., 157 farb. Abb., Klappenbroschur24,90 € (D); 25,60 € (A)
ISBN 9783835310872
Wollust des Untergangs100 Jahre Thomas Manns »Der Tod in Venedig«
Hg. von Holger Pils und Kerstin Klein
188 S., 226 farb. Abb., Klappenbroschur22,90 € (D); 23,60 € (A)ISBN 9783835310698
Fischl SchneersohnGrenadierstraße
Roman
Hg. von AnneChristin Saß
278 S., geb., Schutzumschlag19,90 € (D); 20,50 € (A)
ISBN 9783835310827
Bild dir dein Volk!Axel Springer und die Juden
Hg. von Fritz Backhaus, Dmitrij Belkin und Raphael Gross
224 S., 64, überw. farb., Abb., brosch.19,90 € (D); 20,50 € (A)ISBN 9783835310810
74 Erfolgreiche Titel aus dem Frühjahrsprogramm 2012Wallstein Verlag
Herbst 2012

Unser neues Literaturprogramm finden Sie in unserer Vorschau Literatur Herbst 2012
Aktuelle Veranstaltungshinweise finden Sie unterhttp://www.wallstein-verlag.de/events.html
Teresa PräauerFür den Herrscher aus
ÜberseeRoman
ISBN 9783835310926
Matthias ZschokkeDer Mann mit den zwei AugenRoman
ISBN 9783835311114
Harald HartungDer Tag vor dem Abend
Aufzeichnungen
ISBN 9783835311107
Gaston SalvatoreDie Stücke
ISBN 9783835311466
Heinrich DeteringOld GloryGedichte
ISBN 9783835311671
Peter RühmkorfIn meinen Kopf passen viele WidersprücheÜber KollegenMit Dichterporträts von F. W. Bernstein
ISBN 9783835311718
Im Bergwerk der Sprache
Eine Geschichte des Deutschen in Episoden
ISBN 9783835311787
»Die eigene Rede des andern ...«Dichter über Dichter
die horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik 57. Jahrgang, Band 246
ISBN 9783835311428
Wallstein Verlag Herbst 2012Literatur 75

Wallstein Verlag GmbHGeiststraße 11 D-37073 Göttingen
Tel: 05 51 / 5 48 98-0 Fax: 05 51 / 5 48 98-34
e-mail: [email protected] Internet: www.wallstein-verlag.de
Wenn Sie unseren monatlichen Newsletter zu aktuellen Neuerscheinungen, Veranstaltungen und Auszeichnungen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Folgen Sie uns via Twitter unter: http://twitter.com/WallsteinVerlagoder besuchen Sie uns auf facebook: http://www.facebook.com/wallstein.verlag
Wir unterstützen die Arbeit der Kurt-Wolff-Stiftung
Ansprechpartner im Verlag
Vertrieb:
Lisa Jakobi Tel: 05 51 / 5 48 98-15 [email protected]
Vertrieb und Veranstaltungen:
Claudia Hillebrand Tel: 05 51 / 5 48 98-23 [email protected]
Presse und Öffentlichkeitsarbeit:
Monika Meffert Tel: 05 51 / 5 48 98-11 [email protected]
Rechte und Lizenzen:
Hajo Gevers Tel: 05 51 / 5 48 98-22 [email protected]
Antina Porath Tel: 05 51 / 5 48 98-14 [email protected]
Werbung:
Marion Wiebel Tel: 05 51 / 5 48 98-28 [email protected]
Auslieferungen
Deutschland:
GVA Gemeinsame Verlags-auslieferung Göttingen Postfach 2021 D-37010 Göttingen Tel: 05 51 / 48 71 77 Fax: 05 51 / 4 13 92 [email protected]
Schweiz:
AVA Verlagsauslieferung AG Centralweg 16 CH-8910 Affoltern am Albis Tel: 044 / 762 42-50 Fax: 044 / 762 42-10 [email protected]
Österreich:
Mohr Morawa Buchvertrieb Sulzengasse 2 A-1230 Wien Tel: 01 / 6 80 14-0 Fax: 01 / 6 80 14-140 [email protected]
Verlagsvertretung
Deutschland:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, SaarlandNicole Grabert
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern, Schleswig-HolsteinJudith Heckel
Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ThüringenChristiane Krause
Verlagsvertretungen Nicole Grabert/ Judith Heckel / Christiane Krause c/o indiebook Bothmerstraße 21 D-80634 München Tel: 089 / 1 22 84 704 Fax: 089 / 1 22 84 705 [email protected] www.indiebook.de
Schweiz:
Graf Verlagsvertretungen GmbH Sebastian Graf Uetlibergstraße 84 CH-8045 Zürich Tel: 044 / 4 63 42 28 Fax: 044 / 4 50 11 55 [email protected]
Österreich:
Helga Schuster Verlagsvertretungen Schönbrunnerstr. 133/4 A-1050 Wien Tel: 06 76 / 5 29 16 39 Fax: 06 76 / 5 29 16 39 [email protected]
Wallstein VerlagHerbst 2012
Gegenwart
Editionen
Geschichte
Kulturwissenschaften
Wissenschaftsgeschichte
Über Literatur
W_Vorschau_Titel_cl_2_12_RZ_1.indd 4-5 26.04.12 15:30