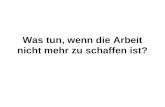Was tun, wenn das Trinkwasser verdreckt ist?
-
Upload
patrik-tschudin -
Category
Documents
-
view
224 -
download
4
description
Transcript of Was tun, wenn das Trinkwasser verdreckt ist?

region.land. BaZ | Dienstag, 15. Dezember 2009 | Seite 26
BaZ direkt. Sie erreichen die BaZ-Regional redaktion in Liestal tagsüber unter 061 927 13 33, abends unter 061 639 18 75 oder per E-Mail [email protected] oder [email protected]. Le-serbriefe senden Sie bitte an [email protected]
lokaltermin
Heute um 11 Uhr findet auf dem ehe-maligen Ziegelei-areal in Allschwil die Grundsteinlegung für das Bauprojekt der UBS «Allschwiler Höhe» statt. Ge-plant sind 17 verschiedene Gebäude.
Foto
Ale
xand
er P
reob
raje
nski
Poststelle schliesströschenZ. Eine weitere Poststelle in der Nordwestschweiz schliesst. Im März werden die Postdienstleistungen in einer Postagentur angeboten. Diese wird im Denner Satellit an der Oberdorfstrasse 12 untergebracht. Gemäss Angaben der Post bedauert der Gemeinderat die Schliessung, unterstützt aber die Agenturlösung.
laufen. Zwischen Soyhières und Delémont sind Hunderte Liter Kohlenwasserstoff in die Birs gelangt. Auf dem Baselbieter Abschnitt des Flusses wurden Sperren errichtet. Der Verursacher ist nicht bekannt. Urs Campana, Präsident des Fischereiverbandes Baselland, sagte, dass ihm keine Angaben über ein Fischsterben vorliegen.
Birs verschmutzt
«Was tun, wenn das trinkwasser verdreckt ist?» Philippe Roch (60), Ex-Direktor des Bundesamtes für Umwelt, zum Umgang mit Chemiemülldeponien
IntERvIEw: SUSanna PEtRIn
heute gilt das Bundesamt für umwelt (Bafu) als zurückhal-tend bei der sanierung von deponien: es unterstützt die arbeiten so weit wie gesetz-lich notwendig, heisst es aus Bern. der frühere amts-direktor tönte da ganz anders: deponien sollen von allen chemikalien, die sich länger als ein bis zwei Generationen im Boden halten, gesäubert werden. das sagt Philippe roch auch heute noch.
BaZ: Wenn Sie in Basel wohnten, würden Sie das Hahnenwasser trinken?
PhiliPPe roch: Das ist eine echte Frage. Die Schadstoffgrenzwerte werden dank dem Aktivkohlefilter wahrscheinlich nicht mehr überschritten. Aber allzu gut ist die Qualität nun mal nicht. Sobald es noch Chemikalien drin hat, ist das problematisch. Und falls sich im Trinkwasser noch Reste von Chlorprodukten nachweisen lassen, würde ich es lieber nicht trinken. Ich will jetzt aber den Baslern nicht sagen: Trinken Sie bitte dieses Wasser nicht! Ich hoffe einfach, die Leute werden über die Wasserqualität von den Behörden richtig informiert.
Wenn Sie zwischen einem Glas Basler Wasser und einem Glas Mineralwasser wählen könnten, welches nähmen Sie?
Trotzdem lieber das Hahnenwasser. Es hat zwei Vorteile: Es ist direkt Naturwasser und braucht keine grosse Industrie für die Herstellung und den Transport. Zweitens: Wenn wir von diesem Wasser abhängen, tragen wir auch zur Natur, die es produziert, mehr Sorge – oder sollten es zumindest. Ich wünsche mir, dass wir dieses Wasser bedenkenlos trinken können.
Wird Mineralwasser nicht mögli-cherweise durch Petflaschen so weit verschmutzt, dass es sogar schlechter ist als Hahnenwasser?
Fast alles, was wir in unserer Gesellschaft nutzen, ist voller
organischer Giftstoffe. Kanzerogene Weichmacher treten auch aus Petflaschen aus. Hahnenwasser wird nicht derart manipuliert, bis es auf den Tisch kommt, deshalb ist es grundsätzlich besser.
Dann kann man sagen: Wozu die Panik, das Trinkwasser ist ver-gleichsweise gut?
Ich bin nicht in Panik. Aber man sollte das eine Problem nicht gegen das andere ausspielen. Wir müssen für sauberes Grund und Trinkwasser kämpfen. Als ich BuwalDirektor war, da habe ich klar entschieden, dass wir alle gefährlichen Altlastendeponien entfernen müssen. Alles, was nicht innert einer, maximal zweier Generationen auf natürliche Art sauber wird, das muss weg.
Sie haben während Ihrer Zeit als Bafu-Chef 2001 auch der Basler Zeitung ein Interview gegeben und gesagt: «Es gibt keine Aus-nahme: Wo Chemikalien liegen, die gefährlich sind, müssen sie weg. Jede Million, die in die Sicherung dieser Deponien in vestiert wird, ist schliesslich verlorenes Geld, weil sich in ein paar Jahrzehnten die gleichen Probleme wiederholen und viel-leicht noch teurere Massnahmen erfordern.» Sehen Sie das heute immer noch so?
Ja, klar, das sage ich auch heute noch: Wo Chemikalien Jahrzehnte lang lagern, dort sollten sie restlos entfernt werden. Bei den Muttenzer Deponien erschwert das riesige Volumen die Sanierung, da wurden echt gefährliche Abfälle vermischt mit anderen. Aber die Gifte sind da, die Verantwortungslosigkeit der Vergangenheit muss wieder gutgemacht werden.
In Muttenz ist geplant, eine Depo-nie ganz zu sanieren und zwei vorerst zu überwachen. Reicht das nicht?
Das kommt darauf an, wie stark und direkt das Wasser gefährdet ist. Es könnte vorerst ausreichen, bis endgültig klar ist, wie die Situation dort aussieht. Aber wenn man gefährliche Chemikalien findet, die sich über mehr als eine bis maximal zwei Generationen halten, dann müssen sie anstandslos weg. Im Zweifelsfall gilt das Vorsorgeprinzip: Eine gewisse Anzahl Indizien dafür, dass es gefährlich sein könnte, sollte
genügen, um die Gefahr zu beseitigen.
Heute empfiehlt das Bafu, die Überwachungsmassnahmen «auf das fachlich begründete Mini-mum zu beschränken». Das tönt viel zögerlicher, als Sie einst auf-traten. Weshalb dieser Wandel?
Mein Eindruck ist, dass das Bafu weiterhin gute Arbeit leistet. Die Verwaltung kann aber nicht so offen sprechen wie eine Organisation wie Greenpeace. Ich war damals von der Problematik überzeugt und war hart mit der Industrie. Es ist möglich, dass mein Nachfolger etwas vorsichtiger ist. Aber ich kritisiere nicht das Amt, ich kritisiere die Politik: Generell hat die Schweiz ihre Vorreiterrolle beim Umweltschutz verloren. Uns fehlt seit Jahren ein starker Umweltminister.
Aber muss der Bund nicht befürchten, ein Fass ohne Boden zu öffnen? Wenn er bei den Muttenzer Deponien zu sehr nachgibt, dann muss er fürchten, die Sanierung etlicher weiterer Standorte mitfinanzieren zu müssen.
Das mag mitspielen. Aber davor hat die chemische Industrie noch viel mehr Angst. Sie ist immer noch die Hauptverant
wortliche für die Verschmutzungen und wird wohl auch finanziell den grössten Teil übernehmen müssen. Es gibt auch Unternehmen, die merken, dass es besser ist für sie, sich ökologisch zu verhalten. Eine gute Industrie ist eine, die sozial und umweltgerecht arbeitet. Ich habe auch schon gut mit der Chemie zusammengearbeitet, etwa bei der Sanierung der Deponie in Bonfol. Doch ohne den Druck von Organisationen und vom Bund würden sie nichts tun, damals und heute nicht.
Es heisst von der Pharmaseite oft, man habe damals nicht genau gewusst, was diese Altlasten bewirken.
Das ist ganz klar eine Lüge. Eine Industrie, die Chemikalien nutzt und herstellt, die weiss genau, was diese bewirken, da gibt es keine Überraschung. Diese Leute wussten mehr als alle anderen, sie tragen die Hauptverantwortung. In den 50er bis 70erJahren haben Behörden und Industrie verantwortungslos agiert, ja kriminell. Eigentlich sollte es ein weltweites Umwelttribunal geben, das Leute in solchen Fällen verurteilt.
Die Sanierung der Deponie Feld-reben wird auf bis zu einer halben Milliarde geschätzt, die Sanierung aller drei Muttenzer Deponien auf 0,9 bis 1,4 Milliarden Franken. Ist es das viele Geld wert?
Ja. Wasser ist unsere wichtigste Ressource, wir brauchen sie
langfristig und müssen jetzt korrigieren, was wir damals falsch gemacht haben. Und nicht erst in drei Generationen, wenn wir vielleicht alle krank sind. Dass NovartisChef Daniel Vasella 30 Millionen Franken im Jahr verdient und die Leute in der Region schlechtes Wasser bekommen, das geht nicht auf. Es gibt auch Aktionäre, die sehr viel Geld gewonnen haben in diesen Unternehmen.
Wie würden Sie die Kosten ver-teilen?
Die öffentliche Hand, die Behörden, haben auch grosse Fehler gemacht in dieser Zeit. Deshalb ist für mich klar, dass auch die Gemeinschaft – der Kanton und je nachdem auch die Gemeinden – ihren Teil beitragen muss.
Was die Gefährdung des Trink-wassers betrifft, so untergräbt bei fast allen Deponien der Region eine Untersuchung die nächste, und die Resultate werden von Chemie und Behörden anders interpretiert als von Gutachtern. Wem und welcher Studie kann man vertrauen?
Wichtig ist, dass die Verwaltung die Studien gut überwacht. Wenn sie stark ist, dann funktioniert das. Ganz wichtig wäre zudem, eine Begleitgruppe zu bilden, in der Industrie, Behörden, Gemeindevertreter, Grundstückbesitzer und Organisationen wie Greenpeace vertreten sind. Wenn man von
Anfang an transparent vorgeht und einen Konsens findet, dann erspart man sich später Opposition und Verzögerungen.
Nach welchen Kriterien würden Sie beim Sanieren die Prioritäten setzen?
Es bräuchte eine Agenda, in der festgehalten wird, was in den nächsten 15 bis 30 Jahren wann saniert wird. Die Priorität muss sich nach der Gefährlichkeit richten.
Verglichen mit der Dritten Welt haben wir aber hier ein Luxuspro-blem, oder?
Ich finde, gesund zu leben, ist kein Luxus. Wir haben das Geld, etwas zu tun, wir müssen mit gutem Beispiel voran gehen und für unsere Bevölkerung kämpfen. Was in der Dritten Welt geschieht, ist schrecklich, nicht zuletzt die dortigen Verschmutzungen durch die westliche Industrie. Die Welt geht kaputt durch diese Schweinereien. Aber wenn wir besser sein wollen, dann ist Grundwasserschutz das Minimum. Wir sind in erster Linie verantwortlich für unsere Region und danach für eine gute Entwicklung in der Dritten Welt. Wenn das Wasser in Basel einmal verschmutzt ist, was machen wir dann? Kaufen wir es anderswo ein?
klare Worte. Philippe Roch nimmt bei Umweltanliegen kein Blatt vor den Mund. Foto Keystone
«Wo Chemikalien Jahrzehnte lang lagern, dort sollten sie restlos entfernt werden.»
chemie kann freiwillig mehr Geld beitragenverhandlunGen. Wer zahlt wie viel für die Unter-suchung und darauffolgende Sanierung der Depo-nie Feldreben sowie für die Überwachung der De-ponien Margelacker und Rothausstrasse in Mut-tenz? Und: Wie intensiv soll überhaupt untersucht, saniert und überwacht werden? Darüber verhan-deln seit Monaten der Kanton Baselland, betroffe-ne Gemeinden, Grundstückbesitzer sowie die Pharmaindustrie. Im Herbst sind die Gespräche ins Stocken geraten, nun soll es im Januar weiter-gehen, sagt Alberto Isenburg, Leiter des Baselbie-ter Amts für Umwelt und dieses Runden Tischs. Die Runde warte jetzt auf eine Stellungnahme des Bundesamts für Umwelt (Bafu). Das Amt kläre ab, wie viele Massnahmen das Gesetz vorschreibe. Nur an den Kosten dessen, «was gemäss Um-weltschutzgesetz wirklich nötig ist», werde sich
der Bund zu 40 Prozent finanziell beteiligen, sagt Christoph Wenger vom Bafu. Laut Isenburg kön-nen aus rechtlichen Gründen die Pharmafirmen nicht zu einer höheren Kostenübernahme als «ma-ximal 50 Prozent» gezwungen werden. Aber: «Es gibt auch eine moralische Verpflichtung. Am Ende können die Chemiefirmen freiwillig mehr tun», sagt Isenburg, «so wie im Elsass». Nach Umwelt-schutzgesetz und Rechts praxis tragen die Depo-niebetreiber (das war nicht immer die Chemie) die Hauptverantwortung. «Diese waren für die Depo-nieausgestaltung verantwortlich und konnten den Abfall annehmen – oder nicht», sagt Wenger. Isen-burg hofft, mit einer Einigung verhindern zu kön-nen, dass eine Partei Rekurs einlegt. Ein Gang vor Gericht könnte die Arbeiten «lange blockieren»: «Sind alle kooperationsbereit, gewinnen alle.» spe
Gemeinde prüft aufwendige filteranlagen
muttenZ. Die Gemeinde Muttenz prüft den Bau einer mehr- stufigen Filteranlage für ihr eigenes Trinkwasser. Das einstufige Konzept der Hardwasser AG, die Muttenz als Kundin gewinnen möchte, überzeugt den Gemeinderat nicht. Er will ein mehr- stufiges Verfahren mit Aktivkohle und Oxidation für die bestehen-de eigene Trinkwasseranlage. Diese pumpt rund zwei Drittel ihres Wassers ebenfalls aus der Hard. Die Gemeindeversammlung stellt die Weichen im Juni. Die eigene Anlage so aufzurüsten, würde Muttenz schätzungsweise 16 Millionen Franken kosten, wie Gemeinderat Kurt Kobi sagt. Der Wasserpreis würde um etwa 30 Rappen auf etwa 1.10 Franken pro Kubikmeter steigen. SDa
Zur Person
umWeltexPerte. Der Welschschweizer Philippe Roch (60) war von 1992 bis 2005 Direktor des Bundes-amts für Umwelt (Bafu), das damals noch Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-schaft (Buwal) genannt wur-de. Zuvor war er General- direktor von WWF Schweiz. Roch lebt in Russin, nahe bei Genf, und setzt sich heute weiterhin als unab- hängiger Berater für Umwelt-anliegen ein. spe