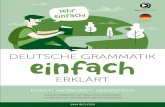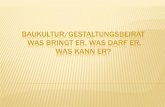Wasser zum „Schützenswerten Gut“ erklärt
description
Transcript of Wasser zum „Schützenswerten Gut“ erklärt

RotFuchs / Juni 2014 Seite 23
Wie dem EU-Parlament ein Zugeständnis abgerungen wurde
Wasser zum „schützenswerten Gut“ erklärt
Ohne Wasser gibt es kein Leben. Trink-wasser ist das wichtigste Lebensmit-
tel der Menschen. Da sich der Markt jede Ressource unterwerfen will, soll auch das Trinkwasser zum profitablen Geschäft werden. Zugleich bedeutet die Verfügung darüber Macht. Noch befindet sich die Trinkwasserversorgung weltweit zu 90 Prozent in öffentlicher Hand. Doch die Privatisierung schrei-tet – gefördert von der Weltbank, dem Internationalen Währungs-fonds (IWF) und der EU-Kommis-sion – unter dem verschleiernden Begriff „Liberalisierung“ voran. Derzeit teilen sich etwa 20 Was-serkonzerne den Markt, wovon
„Veolia“ und „Suez“ die Hälfte kon-trollieren.Im Kampf gegen die Privatisie-rung ist ein bescheidener Erfolg errungen worden: Die erste er-folgreiche europäische Bür-gerinitiative hat am 19. März der EU-Kommission in einer Erklärung das Zugeständnis abgetrotzt, daß „Wasser als öffentliches Gut für alle Bür-ger der Union von grundlegen-dem Wert ist“. Darüber konnte sich eine Gruppe engagierter Berliner Bürger aus erster Hand informieren. Sie war unter Federführung des Charlottenburg-Wil-mersdorfer Kreisverbandes der Grünen auf Einladung der bisherigen Abgeord-neten Hiltrud Breyer noch vor den Wah-len nach Brüssel gereist. Zu ihr gehörte auch Wolfgang Deinlein aus Karlsruhe. Er ist Unterstützer der Bürgerinitiative „Right2Water“, welche die Kommission zu der eingangs zitierten Erklärung zwang. Sie hatte diese aufgerufen, allen EU-Bür-gern das Recht auf Wasser zu garantie-ren, die Versorgung mit Trinkwasser und die Bewirtschaftung der Wasser-ressourcen von den Binnenmarktregeln auszuschließen und weitere Anstrengun-gen zu unternehmen, um weltweit uni-versellen Zugang zu Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu sichern. Knapp zwei Millionen Bürger aus EU-Mitgliedsstaaten unterstützten in über 20 Initiativen dieses Anliegen. Dadurch mußte es auf die Tagesordnung der EU gesetzt werden. In ihrer Mitteilung kon-statiert deren Kommission, daß Wasser ein „ererbtes Gut ist, das geschützt und verteidigt werden muß“.Der Bericht von Wolfgang Deinlein über die Fallstricke und Hürden, die sich hinter solchen wohltönenden Worten verbergen, verhinderte eine unangemessene Eupho-rie in der Besuchergruppe. Eher wuchsen die Besorgnis und das Mißtrauen gegen-über den demokratischen Möglichkeiten des Parlaments. Einige Bürger gewannen sogar den Eindruck, daß die politische Struktur der Europäischen Union eher
geeignet ist, Konzerninteressen den Weg zu bahnen, als dem politischen Willen der Bürger Rechnung zu tragen.Die EU behandelt die Trinkwasser- und Abwasserversorgung als eine Dienstlei-stung, die auch von privaten Konzernen erbracht werden soll. Das ist eine Einla-dung, wenn nicht gar Aufforderung zur
Privatisierung der Wasserversorgung. Deutlich wird dies gerade in Griechen-land und Portugal, wo die Troika aus EU-Kommission, IWF und Europäischer Zentralbank weitere Hilfen von der Pri-vatisierung der kommunalen Wasser-betriebe abhängig macht. Damit solle die Staatsverschuldung verringert wer-den. In die gleiche Richtung laufen die gegenwärtig seitens der EU mit den USA geführten Verhandlungen über ein Frei-handels- und Investitionsabkommen. Des-sen Bestandteil sind Schiedsgerichte, vor denen die Investoren, einzelne Staaten, Regionalparlamente und Kommunen ver-klagen können, sollten deren demokra-tisch gefaßte Beschlüsse oder Gesetze den zu erwartenden Profiten Hindernisse in den Weg legen. In einem solchen Falle hät-ten die jeweiligen Länder Schadensersatz zu zahlen. Für Hiltrud Breyer, die nicht wieder für das Europaparlament kandi-dierte, ist die Tatsache, daß sich Privat-unternehmen derart über demokratisch verfaßte Körperschaften erheben dürfen, eine Ungeheuerlichkeit. Es wäre über-haupt die Frage zu stellen, weshalb in sogenannten Rechtsstaaten Richtergre-mien mehr zu sagen haben als der Sou-verän – die Parlamente. Wie Kommunen mit Forderungen auf Schadensersatz erpreßt werden kön-nen, erleben die Bürger, die nach Brüs-sel gereist waren, derzeit gerade in ihrem Berliner Heimatbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ein US-Finanzunternehmen hat dort bundeseigenes Kleingartenge-lände gekauft und durch die Umwand-lung zu Bauland eine Wertsteigerung von
8582 Prozent erzielt. Um die Rendite rea-lisieren zu können, sollen nunmehr die Kleingärtner ihre Parzellen räumen. Dem Bezirk wurde im Verweigerungsfalle eine Schadensersatzforderung von zunächst 50 Millionen Euro, die man dann auf 25 Millionen Euro reduzierte, angedroht. Der SPD-Stadtrat ist eingeknickt und hat
einen Kompromiß ausgehandelt, demzufolge nur die Hälfte der Kleingärtner weichen muß, dafür aber auf der anderen Hälfte der Fläche doppelt so hoch gebaut werden darf. Der Grundstücks-spekulant verliert nichts, aber die Hälfte der Kleingärtner büßt ihre Parzellen ein. Dieses Ergeb-nis auf den erfolgreichen Berliner „Wassertisch“ umgelegt, könnte bedeuten, daß sich Politiker rüh-men, einen Kompromiß gefun-den zu haben, wonach die Hälfte der Berliner zu trinken bekommt, während die andere Hälfte dür-stet. Nach dem Prinzip „Teile und herrsche“ dürfen dann die Dur-stigen die Auseinandersetzung mit den Trinkenden führen. Wasser mag in Berlin ein eher
fernliegendes Problem sein. Das verdan-ken die Bürger allein der geographischen Vorzugslage. In anderen deutschen Städ-ten, wo Trinkwasser aufwendig geför-dert werden muß, besitzt es bereits einen höheren Stellenwert. Noch deut-licher wird das beim Blick auf andere Kontinente. In Australien nimmt in Fla-schen abgefülltes Regenwasser schon die größte Fläche in den Supermärkten ein. Und nur in guten Hotels und Luxuswoh-nungen gibt es einen zweiten Hahn, aus dem Trinkwasser fließt. Politisch brisant wird es, wenn Trink-wasserressourcen Staatsgrenzen über-schreiten, wie das bei Flüssen, Seen und im Grundwasser der Fall ist. Die UNO zählt 263 solcher Vorkommen. Wenn der Zugang nicht durch gerechte Verträge geregelt wird, kommt es oftmals zu krie-gerischen Auseinandersetzungen. Das ist in Afrika bereits Realität. Die Präsiden-tin der westafrikanischen Hilfsorganisa-tion FAI Marie-Ginette Amani berichtet, das sich die Trockenregion der Sahelzone immer weiter nach Süden ausbreitet und auf die Küsten zubewegt. Bei den ethni-schen Konflikten in Mali und Burkina Faso geht es bereits ums Wasser.Die UNO schätzt, daß jährlich mehr als fünf Millionen Menschen – darunter zwei Millionen Kinder – sterben, weil sie kein reines Trinkwasser erhalten. Bis zu 1,3 Milliarden Menschen haben zu ihm keinen Zugang. Es wird erwartet, daß 2025 zwei Drittel der Erdbevölke-rung unter der Wasserknappheit leiden werden.
Dr. Frank Wecker, Leegebruch
Karikatur: Klaus Stuttmann