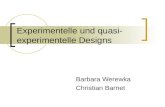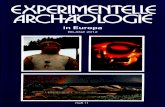Weitere experimentelle Untersuchungen über die Quelle und den Verlauf der intraokularen...
-
Upload
erich-seidel -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of Weitere experimentelle Untersuchungen über die Quelle und den Verlauf der intraokularen...
(Aus der Universit/tt, s-Augenklinik Heidelberg. [Direktor: Geh. Hofrat Prof. Dr. Wagenmann.])
Weitere experimentelle Untersuehungen tiber die Quelle und den Verlauf get intraokularen Saftstr~mungl).
Von Professor Dr. Erich Seidel,
OberarzI~ der Klinik.
I. Teil. t~ber den ,,physiologisehen" PupillenabsehlulI in die vitale Ciliar-
kfirperffirbung.
Mit 7 A b b i l d u n g e n auf Tale1 X.
Nach L e b e r s Lehre yore FliissigkeiCsweehsel im Auge ist tier Ciliar- kOrper als das Sekretionsorgan des Auges zu betraehten, wo unter nor- malen physiologischen Verh~iltnissen eine stetige, aber ~uBerst langsame Neubildung yon Kammerwasser statffindet, das sich - - sei es stetig oder in kurzen AbsEtzen m jedenfalls ab~r in unmerklieh langsamer Fliissigkeitsbewegung yon der hinteren Kammer durch die Pupille in die vordere Kammer entleert, um durch die Abflullwege der Iris, haupt- s/iehlich abet durch den Kammerwinkel und S e h l e m m s e h e n Kanal alas Auge zu verlassen.
Wenn man diese sehr langsame Fliissigkeitsbewegung im Auge, die naeh einer ungefEhren SehEtzung L e b e r s mit einer so minimalen Ge- sehwindigkeit erfolgt, die noch mindestens 3real geringer ist ,,als die des Minutenzeigers einer gew6hnlichen Tasehenuhr" mit dem 1%men ,,Str6mung" bezeichnen will, so mull man sieh gegenw~rtig halten, dab Le b e r selbst wiederholt betont hat, dab die yon ibm angen0mmene stetige Erneuerung des Kammerwassers vie1 zu langsam erfolge ,,als dab man alas Recht, h~itte, yon einer Str6mung tier Fliissigkeit zuspreehen" (1895)").
Diese Ansehauung L e b e r s yon der iiullerst langsarnen Kammer- wasser-Bewegung, die den lqamen Str6mung eigentlieh nieht verdieneS), s~anden damals im scharfen Gegensatz zu den Vorstellungen anderer Forseher (z. B. P. E h r l i e h s ) , die lebhafte ,,ErIl~ihrungsstr6me" im Auge annahmen, die nicht nut die vordere Kammer und den Glas-
z) Vgl. v. Graefes Archiv 95, 1; 95, 210; Ber. d. 40. Vers. d. Ophth. Gesellsch. Heidelberg, S. ~31; Ber. d. 41. Vers. d. Ophth. Gesellseh. Heidelberg, S. 44.
~) Berieht fiber die 24. Vers. d. Ophth. Gesellsch. 1895, S. 89. ~) ,,Der Fliissigkeitswechsel in der vorderen K ammer is$ also ein
/~uBerst tangsamer und yon einer StrSmung der F1iissigkei~ im gew6hnlichen Sinne des Wortes karm dabei keine gede sein." Th. Leber, Die Zirkulations- und Ern/ihrungsverh/tltnisse des Auges. 2. Aufl. 1903, S. 227. lCfandb, v. Graefe.Saemisch.
384 Erich Seidel : Weitere experimentelle Untersuchungen
k6rper durchfluten, sondern sogar noeh die Kraf t haben so]tten, Ii~s und Cornea an ganz umschriebener Stelle zu dnIchsetzen. L e b e r lnn Bte wiederholt gegen diese damals verbreiteten irrigen A~schauusgen Stellung nehmen und bemfihte sich, durch }IitteiIung se~ner theore- tischen, allgemein physio]ogischen L~berlegusgen, die Jhm die ]~rkes~tsJs yon der hauptsgchlich optisehen und statisehen :Funktion des Xammer- wassers braehten, sowie durch Bekanntgabe seiner wichtigen ktinischen und experimentellen Beobachtungen, den t~ewe~s zu erbri~gen fiir die Riehtigkeit seiner Ansieht, die ihn jede lebhaftere, sichtbare physio- logisehe Sekretionsstr6mnng im Auge verneinen lieB. So teilte er 1895 seine teilweise am Cornealmikroskop angestel]ten klinischen :Beobach- tungen ani ta Vorderkammerwasser suspendierten Cholestearinkrysta]len mit, sowie an anderen feinen Kammerwasserfl6ekehen (z. B. kleinen Linsenbr6ekeln nach Diszission) und betonte auschiieklieh, dab er ,,keine Spur" einer Str6mung aus der Pupille naeh dem Kammerwinkel wahr- genommen habe, als Beweis fiir das Nichtvorhandensein der yon anderen angenommenen s i e h t b a r e n Sekretionsstr6mungen im Auge. Dabef beobaehtete L e b e r schon damals (1895 nnd 1899) 1) eine ganz lang- sam stetige, in kreisf6rmigen Bogen vertikal vor der Pupille und Iris auf- und abschwebende Bewegung der in der Vorderkammer sehwim- menden Partikel, eine Beobachtung, die bekanntlich neuerdings mit Hilfe der Nernstspaltlampe best~igt und alsWgrmestr6mung [Tiirk~)] gedeutet wurde [ErggeletS) , Berg 4) P l o e h er~)],
Wenn man jetzt, auf Grund (der yon L e b e r gefundenen Tatsaehe} der N i e h t s i e h t b a r k e i t einer Fliissigkeitsbewegung aus der Pupille den SehluB ziehen wollte, dab L e b e r s Lehre yore intraokularen Fliissig- keitsweehsel unriehtig sei, so wiirde man L e b e r damit eine Auffassung yon der Geschwindigkeit der sekretorisehen Fliissigkeitsbewegung im Auge unterlegen, die er hie gehabt und ge~uBert hat, sondern se]bst stets aufs naehdriiekliehste bekgmpfte.
Wenn heute einige :Forseher se]bst die yon L e b e r immer nur an- genommene minimale yore Ciliark6rper ausgehende Saftstr6mung im Auge leugnen, so sind sie damit nut einen ldeinen Sehritt auf dem alten yon L e b e r angebahnten und besehrittenen Wege weitergegangen, den L e b e r aber auf Grund eingehender, theoretiseher allgemein-physio- logischer ~Joer]egungen sowie experimenteller und ldinischer Erfahrungen unbedingt sorgfgltig vermeiden zu mfissen glaubte.
1) Bericht tiber die 24. Vers. d. Ophth. Ges. Heidelberg 1895, . S. 90, 94 u, 95. - - ~ber die Ern~hrungsverhg, ltnisse des Anges. Vortr. b. d. 9. internat. Kongr. in Utreoht 1899, sowie im ttandb. Graefe-Saemisch. Kap. XI, S. 228.
2) v. Graefes Arehiv 64, 481. 1906: Kiln. Monatsbl. f. Augenheilk. 49~ 300. 1911. s) Klin. Monatsbl. f. Angenheilk. 53, 449. 1914; 55, 229. 1915. 4) Ebenda 55, 61. 1915. 5) FAin. Monatsbl. f. Augenheilk. 58, 371. 1917; Ebend~ 62, 491. t919.
tiber die Quelle and den Verlauf der intraokularen Saftstr~Jmung. 385
Da es sich bier um Fragen hande]t yon fundamentMcr Be- deu~ung ffir Physiologie und Patholog~e des Auges, fiber die die An- sichten, wie die Worte 1% 6 m e r s I) wieder yon neuem zeigen, immer n oeh weir auseinandergehen, so setze ieh im folgenden die Mitteilung mel ter in den ]etzten 4 Jahren gewonnenen Versuchsergebnisse fiber den in- traokularen Flfissigkeitswechsel fort, in der Hoffnm~g, dab sie zu der dringend nOtigen K]~rung dieses so wichtigen :Problems der Ophthal- mologie beitragen mOchten.
Um L e b e r s Lehre yore intraokularen FlfissigkeJtswechsel zu wider- legen, berief mail sich zuerst yon neuem auf die IJypothese vom physio- togischen Pul0illenabsehluB.
Man versteht darunter bekanntlich die Annahme einer wasser- dichten Trennung zwisehen Vorder- und I-Iinterkammer am Jntakten normMen Auge nach Art eines Ventflversehlusses, wodureh selbst die nach L e b e r aueh unter physiologischen Verh~ltnissen vorhandene, ~uBerst langsame Bewegung des stetig neugebildeten CiliarkOrl0ersekretes durch die Pupille in die Vorderkammer unmOglieh gemaeht werden sollte und ste]lte gegeniiber L e b e r die Lehre auf: ,,Den gewShnIichen, ~ul~erst geringen :Bedarf am Kamme~wasser deckt die Iris, wird der Stoffweehset abet lebhafter, sei es dutch eine Entziindung, eine Punktion der Hornhaut, oder auch nur dutch eine st~rkere tIyper~mie, so beteiligt sich auch der CiliarkSrper" (unter Sprengung des physiologisehen Pupillenabschlusses), ,,und zwar fibertrifft Msdann seine Sekretion bei weitem die der Ir is" (Hamburge r )~ ) .
Haupts~chlieh sind es 3 Versuche, die diese Hypothese, dab unter norlnMen Verhg]tnissen die Pupille ffir Flfissigkeit undurehggngig sei, angeblieh einwandfrei beweisen sollten: Zwei yon H a m b u r g e r aus- geffihrte Tierexperimente mit ]~arbstoffen, sowie die yon K a h n vor- genommenen Durchspfilungsversuche.
Auf Grund eigener experimenteller Erfa,hru~g babe ich reich bereits eingehend friiher f iber d e n e r s t e n V e r s u e h H a m b u r g e r s (Ein- brJngen eines kleinen F]uoreseeintr6pfchens in die hintere Kammer) geguBertS), sowie auch fiber die von K a h n vorge:nommenen Durehspfi- lungsversuche 4) und meine Ansicht unter eingehender Begriindung
1) Lehrb. d. Augenheilk. 1919, S. 304. 3.~Aufl.: ,,Diese ttypothese" (Lebers Lehre yore iuta'aokuldren Fliissigkeitsweehsel) ,,ist abet jetzt yon einer Anzahl AugeniJ.rzten nieht mehr anerkannt und wird yon der gesamten Ophthalmologie dereinst verlassen werden, well sie mit lJhysikalisehen und physiologisehen Tat- saehen in Widersprueh stel~t. Nur dem Autoritgtsglauben verdankt sie ihre Er- haltung his auf den heutigen Tag."
~) Berieht fiber die 30. Vers. d. Ophth.-Ges. Heidelberg 1902, S. 249, 250. a) v. Graefes Archiv 95, 46. 4) Da Kahn auf meine Ein~4nde gegen die yon ibm aus seinen Versuchen
gezogenen Schlfisse [(Graefes Archly 95, 210) da er doch naeh seinen friiher ge-
386 Erich Seidel: Wei~ere experimenteHe Untersttehungen
dahin ausgesprochen, dab den mit beiden Versuchen gewonnenen Er- gebnissen jede Beweiskraft gege n eine Fliissigkeitsstr6mung im wahren L e b e t schen Sinne a bgesprochen werden mug. Ieh m6ehte mir deshalb je tz t zungehst einige Bemerkungen zu dem 2. H a m b u r g e r s c h e n Versueh erlauben, den ieh in meiner friiheren Arbeit mi t Absicht nicht besprochen hatte, in der Annahme, dab dieser Versuch aus best immten Griinden (die ich in folgendem darlegen werde) keine Anhgnger finden und sieh daher eine Widerlegung eriibrigen wiirde.
Da ieh abet bemerke, dab auch R 6 m e r diesen Versuch fiir so wichtig hgl{, dab er ihn Ms experimembellen Beweis eines physiologischen Pu- pillenabschlusses in die neueste-Auflage seines Lehrbuches aufnimmt und ihm daselbst eine Tafelfigur widmetl), halte ich einige kurze Worte je tz t doch fiir angebraeht.
I t a m b u r g e r*) entleerte die Vorderkammer beim lebenden Kaninchen mittels Ieiner Kaniile und ersetzte den Kammerinl/al~ durch egwa 150 cmm fiI~rierter Neugralro~16sung2proz., deren Abflu8 dutch Kont ra - punk~ion der zur Injektion beniitzten Kaniile verhindert ward.
Nach 1/2--1 t/2 Stunden wurde das Versuchsauge enucleiert, die Linse vorsichtig ausgel6st und in ein GefgB mit Wasser gebracht, we die Linse einen leicht opalescierenden Farbenton annimmt, wodurch die Beob- achtung erteichtert werden sell.
Der danach yon t I a m b u r g e r erhobene Befund: i~otfgrbung nur im Bereich der Pupille, die streng auf das Pupillarbereieh der vorderen Linsenfliiche beschr£nkt bleibt, soil den Beweis darstellen ffir das Be- stehen eines physiologischen Pupillenabschlusses.
Wurde derselbe Versuch an einem einige Zeit vorher iridek~omierten Kaninchenauge ausgefiihrt, so ents tand eine streng auf das Kolobom- bereich beschr£nkte l~otf£rbung der vorderen Linsenfl/~che.
Bei Anstellung desselben Versuchs 24 Stunden nach dem Tode des Tieres erzielte I - I a m b u r g e r ebenfalls eine nut auf dasPupil larbereieh
/~uBerten eigenen Worten (Graefes Arehiv 95, 19) den offenbaxen experimentellen Beweis ftir das Bestehen clues physioIogischen Pupillenabschlusses erbraeht heben wollte] nunmehr selbst erkl~r~ (v. Graefes Archly 101, Ill) , d~g er sieli mig seinen Experimenten an der Fr~ge nach dem Besgehen elner kontinuierliehen intra- okularen Fliissigkeitssgr6mung unbeteiligt fiihle, habe ieh keine Veranlassung naeh~meinen friiheren Ausfiihrungen fiber diese Versuehe, auf die ieh verweise, noeh weiter reich mit ihnen zu befa~sen..Dag es zum Zustandekommen aueh selbs~ der minimMsten, vor atlem ~ber einer deutlieh siehtb~ren FlfissigkeigssgrS- mung yon der ttinterk~mmer naeh der Vorderkammer unter allen Umstgnden clues gewissen Druekes bedarf, was K a h n, wie er jetzg.in seiner 2. Arbeit ausfiihrt, Mleia hat beweisen wollen, ist doch eine selbstverst~ndlictie physikalisehe Not- wendigkeit, die bisher yon niem~nd bestritten worden ist, und fttr die es eines experimentellen Beweises daher rm E. nicht bedurfg hgtte.
~) S. 320, T~f. XXVII, Fig. 1, vgl. S. 304. ~) Berieh?~ fiber die 39. Vers. d. Oph~l~-Gesellseh. Heidelberg 1913. S. 119.
VgL Emghrung des Auges. 1914. S. 42.
tiber die Quelle und den Verlauf der intraokularen Saftstr6mung. 387
beschr~nkte Rotf~rbung der vorderen LinseIffl~che, ohne etwa (ira Gegensatz zu einem Hinweis Seefe lde rs ) dabei postmortal zustande gekommene hintere Synechien 1) bemerkt zu haben.
Ich m6chte zu diesem Versuehe folgendes bemerken: 1. Der H a m b u r g e r s e h e Neutralrotversuch baut sieh offenbar auf
die Voraussetzung auf, da.I1 yon dem die Vorderkummer anfiillenden konzentrierten Furbstoff nur infolge Verbreitung dutch Diffusion im Kummerwasser Farbstoffmolekiile dutch die Pupflle in die hintere Kammer gelangen, und dab die peripher v o n d e r Pupillen6ffnung gelegene Linsenvorderfl~ehe daher nur beim Vorhandensein einer kon- tinuierliehen Fliissigkeitsschicht, d .h. bei Fehlen eines ,,wusserdiehten" Pupillenabsehlusses zwiscl~en beiden Kummern gef~rbt werden k6nnte.
Auf Grund dieser Voruussetzung wird die beobachtete, streng aufs Pupillargebiet besehr~nkte Rotf~rbung der Linsenvorderfl~che als Beweis einer wusserdiehten Trennung zwisehen Vorder- und Hinter- kammer angesehen, da auf Grund derselben Voruussetzung beim Fehlen eines Pupillenabsehlusses eine Rotf~rbung der peripheren Linsenvorder- fl~ehe h~tte erwartet werden miissen.
Diese Voraussetzungen sind uus physikulisehen Griinden unzu- treffend, du es noch 2 andere Wege fiir den Farbstoff gibt, um die Linsen- Vorderfl~ehe zu erreichen, die ebenso berficksichtigt werden miissem
Die ges~ttigte, die Vorderkammer unfiillende FarbstofflSs.ung muB naeh den Gesetzen der Diffusion notwendigerweise, genau wit in die vordere Linsenkupsel im Pupillurgebiet, auch in die Iris eindringen und, nach Durchsetzung derselben, ins Hinterkammerwasser und zur peri- pheren, hinter der Iris gelegenen Linsenvorderftgehe gelangen.
}Veiterhin muB naeh denselben Gesetzen veto Pupiliurgebiete der Linsenvorderflgehe aus, in welehe das Neutralrot, wie H a m b u r g e r ju selbst beobuehtete, sehr leieht eindringt, der Farbstoff sieh in der Linsenkapsel oder der Linsensubstanz dureh Diffusion weiterverbreiten, so dug es auf diesem Wege ebenfalls zu einer Fgrbung aueh derjenigen Teile der LinsenvordefflSehe .kommen muB, die hinter der Iris, also peripherwgrts vom Pupitlargebiet gelegen sind. I-Iieraus folgt, dab setbst unter der Annahme vom Vorhandensein eines Pupillenabsehlusses der Farbstoff notwendigerweise zur Vorderfl~Lehe der peripher yon der Pupillar6ffnung gelegenen Linsenteile gelangen mug.
Es ergibt siehweiter mit Notwendigkeit der SehluB, dab das Fehlen oder das Vorhandensein einer Fgrbung der peripheren, hinter der Iris gelegenen Linsenvorderflgehe, nieht uuf das Bestehen oder Niehtbestehen eines Pupillenabsehlusses bezogen werden duff, wie das von H a m b u rge r geschieht.
1) Bei einem yon mir am vorher get6teten Tier angestellten Versueh (Tar. I.. Abb. 5) fund ich zahlreiehe hintere Syneohien.
388 Erich Seidel: Weitere e~perimentelle Untersuehungen
Aus diesen sehr einfachen UberIegungen geht hervor, dab die ganze Beweiskraft des Versuchs sich auf unzutreffenden ¥oraussetzungen aufbaut, und dab aul3erdem die yon H a m b u r g e t erhobenen Befunde mit physikalischen Gesetzen in Widerspruch s~ehen.
2. Die yon H a m b u r ge r mit seinen Neutralrot-Experimenten a m i r i d e k t o m i e r $ e n A uge gewonnenen Versuehsresultabe fiihren not- wendigerweise zu Schliissen, die physikalische U~mSgliehkeiten da r - stellen (wasserdiehte Trennung zwisehen Vorder- und t t in t e rkammer bei fehlender Iris !) und stehen in Widerspruch mi t selnen eigenen mit seinem ersten Versueh erzielten Ergebnissen (I~jektion eines mini- malen Fluoresceintr6pfehens in die t t in terkammer) , wobei er, wie ausdriicklieh betont, nach Iridek~omie k e i n e n Pupillenabschlul~ ge- funden haste.
Da beide Versuche bei derselben Tierar t (Kaninehen) a~gestell~ wurden, k6nnen Besonderheiten des operat, iven Eingriffesl ) gerade bei dieser Tierart diesen Widersprnch~) nich~ erkl~ren, sondeIn often- baren klar und dentlieh die Untauglichkeit der Versuche zu dem beab- siehtigten Zweeke.
3. Die Entleerung der Vorderkammer, der Ersatz des Kammerwassers dureh ehle konzentrierte, giftige :Farbstoffl6sung, die zweifaehe Dureh- bohrung der Hornhaut mit der Xaniile, die augerdem noch 1/~--11/2 Stunden liegen bleibt, stellt zweifellos f'fir ein Auge eine der denkbar st~rksten Reizm~gen dar. Wenn nun nach diesen iiberans sehweren Eingriffen wirklich ein l~pil lenabschlu$ vorhanden wgre, so kSnnte man diesen hSehstens ats einen ,,pathologisehen", niemals abet als einen ,,physiologisehen" PupillenabsehluB bezeiehnen. Fiir die Beantwortung der Frage naeh dem Bestehen eines ,,physiologisehen" Pupillenab- sehlusses ist daher dieser Versueh yon vornherein unbrauchbar.
1) Bericht fiber die 39. Vers. d. Ophth. Gesellseh. Heidelberg 1913, S. 131. 2) Derartige Widersprtiehe finden sich aueh sonst bei Hamburge r . -- So
empfiehlt er bei der Beschreibung seines erst~m Versuehs (zum Beweis eines physio- togisehen Pupillenabsehlusses) ausdriicklich bei der Vornahme der Injektion des Fluoresceintrfpfchens in die ttinterkammer des Kaninehens den Bulbus des Tieres voriibergehend zu luxleren (Zentralbl. f. prakt. Augenheilk. 22). Andererseits schreib~ er aber selbst: . . . . . denn ich babe sehon in meiner ersten Arbeit (1898) gezeigt, dab die vortibergehende Luxation, beim Kaninchenauge bekanntlich ein ganz unerheblieher Eingriff, in we~figen Minnten dazu ftihrt, die T~tigkeit des CiliarkSrpers in Gang zu bringen: Denn injiziert man subcutan den in Rede stehen- den Farbstoff (d. h. Fluoreseein), so tritt in diesen unerSffneten bis auf die vor- iibergehende Bintstauung unversehrt gebliebenen Bulbus sehr bald grtines Seh'et aus der Hinterkammer in die vordere unter Bildung des griin leuehtenden Hypo- pyons"/(ErnKhrung des Auges 1914, S. 22). Itierdureh hat H a m b u r g e r doeh ganz offenbar sohlagend bewiesen (ohne sich dessert bewuBt zu sein), dab die Deutung, die er seinem ersten Versuche gab (Vorhandensein eines wasserdiehten Pupillenabschlusses unter den gew~hlten Versuchsbedingungen) unrichtig sein muB.
tiber die Quelle und den Verlauf der intraokularen Saftstr(lmung. 389
4. Da es eine allgemein bekannte sehr leicht zu beweisende Tatsache ist, dab schon bei sehr geringen geizen des Auges der Ciliark6rper in abnorme sekretorisehe Tgtigkeit versetzt wird, so konnte mit volIer Sieherheit behauptet werden, d a b es g a n z u n d ga r a u s g e s e h l o s s e n war, dab unter den yon H a m b u r g e r gewghlten Versuehsbedingungen ein PupillenabsehluB bestehen soltte.
Da H a m b u r g e r trotzdem einen sotehen findet, so erg, ibt sieh wie- derum, dab sieh notwendigerweise in den bei der Anlage seines Versuehs gemachten Voraussetzungen, in seinen Beobaehtungen oder den daraus gezogenen Schliissen, Fehler befinden miissen.
5. Der dutch den Reiz der Versuchsbedingungen mit Sieherheit hervorgerufene, sieh dutch die Pupille in die Vorderkammer ergie- gende, abnorme Sekretionsstrom des Ciliark6rpers muB notwendiger- weise die Verbreitung des Farbstoffes dutch Diffusion aus der Vorder- kammer dureh die Pupille ins Hinterkammerwasser stark beeintr~eh- tigen, da die Farbstoffmolekiile, gleiehsam gegen den Strom sehwimmend, immer wieder in die Vorderkammer zuriiekgespiilt werden miissen, so dal~ auf diesem Wege eine zur Fgrbung der vorderen Linsenfl~che n6tige Farbstoff-Konzentration in der Hinterkammer m6g]ieherweise verhindert werden k6nnte.
Aus diesem Grunde hgtte man m. E., ohne den sieheren Boden experimenteller Erfahrung zu verlassen, aus dem H a m b u r g e r s c h e n Befunde nie m a l s auf einen physiologischen PupillenabsehluB, sondern im G e g e n t e i l nur h6ehstens auf einen sieh in die Vorderkammer er- gieBenden gesteigerten Sekretionsstrom schliegen diirfen.
6. Wenn somit aueh fiir mich naeh Anstellung dieser liYberlegungen der H a m b u r g e r s e h e Neutralrotversuch jegliehe Bedeutung fiir die Frage des physi01ogisehen Pupillenabsehlusses verloren hatte und iiberhaupt kein physiologisehes Interesse mehr darbot, moehte H a m b u r g e r s Beobaehtung an sieh nun riehtig sein oder nieht, so entsehlol~ ieh reich sehliel~lich doeh dazu, zur Aufklgrung der meiner Ansicht nach im H a mb u r g e r schen Befund (d. i. streng auf das Pupillar- gebiet besehrgnkteRotfgrbung) vorliegenden bereits er6rterten p h y s i - k a l i s c h e n Unm6gliehkeit (s. u. 1.) einige Tierversuehe vorzunehmen, um den mir unerkl~rlichen Beobaehtungsbefund aus eigener Ansehauung kennenzulernen.
Ich habe daher genau naeh H a m b u r ge r s Vorsehrift Versuehe am Kaninehenauge mi t 2 proz. filtrierter Neutralrotl6sung vorgenommen und verweise auf Tafel I, Abb. 1 - Abb. 7, die Versuehsergebnisse einiger derartiger von mir angestellten Experimente darstellen. Die Linsen warden unmittelbar nach der Herausl6sung yon t terrn Dr. S e h 1 a e f ke, Assistenzarzt der Heidelberger Augenklinik, gezeiehne?~, und zwar die auf Abb. 1 dargestellte Linse bei Lampenbeleuehtung an der
390 Erich Seidel: Weitere experimentelle Untersuchungen
Luft liegend, die auf Abb. 2 - - Abb. 7 dargestellten I~lsen ~mter Wasser ]iegend, be i h e l l s t e r T a g e s b e t e u e h t u n g a u f wei l3em G r u n d e .
Ieh beobachtete in allen meinen Versnchen eine intensive Rot- fgrbung der Linsenvorderflgehe ira Pupillargebiet. Die Rotfgrbung war aber durehans nieht auf das Pup~llargebiet streng beschr~nkt, wie H a m b u r g e r angib~, sondern setzte sich in zarter Rosaf~rbung auf der vorderen Linsenflgche naeh der Peripherie zu fort und erreiehte in einigen l~gllen sogar den Linsengqnator. Diese zarte, periphere, nicht naeh allen Richtungen gleichmgBig ausgedehnte und gleich stark entwickelte Rosafgrbung der vorderen Linsenfl~ohe, setzte slob, gegeniiber der viel intensiveren ltotf~rbung des Pupillargebiets, meist ziemHch scharf ab und war stets sehr deutlich bei hellem T~geslicht ~uf weil~em Grnnde zu sehen. Brachte man nun dieselbe Linse ~uf schwarzen Grund, dann begann die Linse einen leicht op~lescierenden Farbenton ~nzunehmen, und die periiohere Rosaf~rbung wurde unsichtbar (so dab dann nur die in*ensive von I i s m b u r g e r beob~chtete Rotf~rbu~g des Pupillarge- biers wahrgenommen werden konnte), um erst dann wieder hervor- zutreten, als das Pr~purat auf weii~en Untergrund zuriickgebracht wurdel).
D~ nun H a m b u r g e r besonders hervorhebt, dal~ die Beobaehtung der angeblich streng auf das Pupillargebiet beschr~nkten t~otf~rbung dureh die Opalescenz der Linse erleichtert werde und diese ]etzte~e auf schwarzem Grunde am deutlichsten hervortri t t , und da fernerhin die yon H a m b u r g e r ats Beteg fiir die Richtigkeit seiner Befunde ge- gebenen Abbildungen Linsen a u f s c h w a r z e m U n t e r g r u n d e dar- stellen~), so k~nn es wohl keinem Zweifel unterliegen, dab I-Ia mb u r g e r infolge der yon ihm unzweckmgl~igerweise aussehlie~Iieh gewghlten Beobaehtungsweise auf s c h w a r z e m Untergrunde die zarte periphere Rosaf~.rbung tier vorderen Linsenkapsel nicht wahrgenommen und aus dieser p h y s i k a l i s c h b e d i n g t e n E r s e h e i n u n g p h y s i o l o g i s e h e Seh t i i s se g e z o g e n ha*, was natiirlich nieht ang~ng~g ist.
Einige Versuche s~ellte ieh in der Weise an, daI~ ieh bei pigmentierten Kaninehen nu t in die Vorderkammer des e i n e n Auges Neu~ralrot in- jizier~e, wahrend am ~nderen Auge nach vorausgegangener Entlee~ung der Vorderkammer dieselbe Menge Kamme~wasser zuriiekgespritzt wurde. Injiziert man nun dem Tier eine kleine Menge Ftuorescein in
~) M~n k~nn sieh yon der T~ts~ehe, d~l~ eine zarte ~uf weiBem Gmnde sehr deutliehe Ros~fgrbung auf schw~rzem Grunde f~st oder g~nz urisich~b~r wird, dnrch folgendes einf~ehes Experiment sofort aberzeugen: M~n verreibe ~uf der Oberflgohe einer Konvexlinse yon etw~ 12 D (des Brillenk~stens) etwas rote Tinte mit der Fingerspitze und betrschte die Linse dun~ch ~bwechselnd ~uf weilter nnd sehwarzer Unterl~ge.
~) Bericht d. Ophth. Gesellsch. 39, Ta~. VII, Fig. 1 u. la. Ern~hrung des Auges S. 43, Fig. 10; vgl, l~i~mers Lehrbueh 3. Au~l. 1919. Tar. XXVII, Fig. 1.
tiber die Quelle und den Ver]auf der intraokularen SaftstrCimung. 391
e~ne Ohrvene, dann beobachtet man bald danach am neutraIrotfreien Auge griine FarbwOlkchen aus der Pupil!e in die Vorderkammer fiber- treten und sich da zu Boden se~ken.
T6tete man nun das Tier nach etwa 1 Stunde 1) und erOffnete die enucleierten Augen rnit Equatorialem Rasiermesse~schnitt, so land man beiderseits [also aueh am neutralrotfreien Auge, trotz des infolge Ab- wesenheit des Farbstoffes viel geringeren 1Reizes!2)] den CfliarkOIloer leuchtend griin gef/~rbt, als Zeiehen der abnormen Fiillung3) seiner Gef/iBe und seiner gesteigerten sekretorischen TEtigkeit.
Diese angefiihrten Beobaehtungen spreehen flit die Riehtigkeit tier bereits (unter 4.) mitgeteilten ~bertegungen und beweisen die abnorrne sekretorische TEtigkeit des CfliarkSrpers und sonfit das Niehtvorhanden- sein eines Pupillenabsehlusses unter den t t a m b u r g e r s c h e n VeIsuehs- bedingungen.
Auf Grund der vorstehend mitgeteilten ~berlegungen und experi- mentellen Tatsachen mug ieh auch diesem 2. I - I amburger ' schen Versuch jede Beweiskraft gegen die Richtigkeit yon L e b e r s Lehre: vom intraokularen Fliissigkeitswechsel abslorechen.
Wit miissen daher feststellen, dal~ alle expe~}mentellen Versuche, die tIypothese yore physiologischen PupillenabschluB zu beweisen,. fehlgeschlagen sind, und dab somit gegen die Annahme einer stetigen sehr langsamen sekretorischen lVliissigkeitsbewegung yore Ciliark6~per dureh die Pupille in die Vorderkammer yon dieser Seite her keinerlei begriifidete Bedenken b e s t e h e n . -
Man hat nun weiterhin dutch Beobachtungen nach int~a vitam ein- verle~bten Farbstoffen die sekretorische Inaktivit~t des CiliarkOrpers in physiologischen Zeiten direkt beweisen zu kOnnen geglaubL
Die allen diesen Versuchen zugrunde liegende Annahme, dab bei magvoller Dosierung die Verbreitung diffusibter t%rbstoffe ira Tier- k6rper physiologisehe sekretorische SaftstrOmungen markieren mfiBte,~ ist jedoeh naehweisiieh aus verschiedenen Griinden unrichtig.
Erstens ist es schon lange bekannt, dab gerade die Driisenzellen ein ausgesproehenes ,,SelektionsvermOgen" besi~zen und gewJsse, dem Tiere kiinstlich beigebrachte diffusible Stoffe zuriickweisen und nieht
1) Die in einigen Versuehen sodann vorgenommene refraktometrische Unter- suchung des Kammerwassers ergab einen Breehungsindex yon n = 1,3379 -- 1,3400~ d. tL einen abnorm gesteigerten ~weil~gehalt yon 11/2--21/2% (gegeniiber I/~0%~ der Norm).
2) Die Reizwh'kung des Farbstoffs erkermt man regelm~l~ig an den deutlichen bei der Injektion beobachteten Schmerz~uBerungen der bis dahin vol]st~ndig ruhigen Tiere.
8) Am iiquatorial halbierten Auge des albinotischen Tieres kann man auch ohne intraven0se ~luoresceininjektion die afiBerordentlich starke Hyper~mie der CiliarkSrpergef~13e nach dem Neutralrotversuch dire kt wahrnehmen.
392 Erich Seidel: Weitere experimentelle Untersuchungen
in ihr Sekret i ibertreten lassen, so dal~ der Satz zu Reeh t besteht, dab ein Organ sehr wohl sekre~orisehe Eigenschaften besitzen kann, ohne jedoch vorher ins Blut injizierte diffusible Farbstoffe mi t seinem Sekret aus t re ten zu Iassen ( H e i d e n h a i n , W e s s e l y ) .
Zweitens wissen wir ( E h r l i c h , G o l d m a n n ) , daft bei Driisen ,,eine Proport ional i t~t zwischen Farbgeh~l t der "Parenehyme und der kor- respondierenden Sekrete" keineswegs zu bes~ehen braueht , so dab somit ein Sekret deutlieh gefgrbt sein kann, ohne dab der Parbstoff in den procluzierenden Zellen selbst nachweisbar istl). Da es weiterhin a]s eine feststehende Tatsaehe be t rachte t werden muB, dab bei t i e r i s e h e n ] ~ e m b r a n e n (Capillarwand) eine physikalische Permeabi l i tg t sieher vorhanden ist2), so ist v6Uig ktar, dab der naeh intraven6ser In jekt ion diffusibler Farbstoffe aus den C~pillaren zu beobaehtende geringfiigige Aus t r i t t derselbsn keinerlei sekretorisehe Eigensehaften beweisen kann.
Auf Grund dieser Er fahrungen ist es daher dtrrehaus unzulEssig, wenn man , ,dureh L?berschwemmen" eines Kaninehens mi t 4 0 ~ 5 0 ecru 2proz . Indigearminl6sung (intraven6s) die a m unberf ihr ten Auge , ,meistens" eintretende F/£rbung der GefEl~w~nde des Ciliark6rpers, sowie derjenigen der Iris [ H a m b u r g e r 3 ) , K n a p e ] , auf eine sekreto- rische Funk t ion beider [ K n a p e 4 ) ] oder nun gar der Iris allein ( H a m b u r g e r ) , beziehen willS).
1) So fand G o l d m a n n (Beitr/~ge z. klim Chir. 64 [1], S. 253) bei seinen vitalen Farbstoffversuchen z. ]3. Leberzellen und Mitchdriisenzelten ungef/~rbt, w~hrend Galle und Milchwasser ausgesprochene F/~rbung zeigten. G. betont wiederhott, dab auch sonst bei vSlligem Farblosbleiben der Selcretgranula die Sekrete ungeaehtet dessen gef~rbt~ sein kSnnen.
3) Vgl. dazu Oppenheimer Biochemie S. 410. 1919. 2. Aufl.; desgl, meine frtiheren Ausfiihrungen in v. Graefes Archly 95, 62 u. 66.
3) Klin. ]~Ionatsbl. f. Augenheillu 48 (II), 72. 1910. 4) Skand. Archly f. Physiol. ~4, 309. 1911. 5) Wenn man einmal die Ansieht vertritt, dab aus den am punktierten Auge
nach X~luoreseeininjektion zu beobachtenden Absonderungsvorggngen kein Sehlul~ zul~ssig sei, ~uf die im intakten Auge sich abspielenden ( E h r 1 i e h, H a m b u r g e r ), so erscheint es mir yon diesem Standpunkte aus nieh~ folgerichtig, bei einem anderen Farbstoffe, naeh intravenSser Indigearmininjektion, aus mikroskopiseh erhobenen Befunden, naeh sogar wiederhoI~en Kammerpunktionen, Schltisse auf die am intakten Auge vorhandenen Absonderungsvorgg, nge zu ziehen, wie das H a m b u r g e r rut (Ernahrung des Auges Tar. II, Fig. 6 [Text], sowie S. 30; desgl. K]/n. Monatsbl. f. Augenheilt~ 48, S. 72. 1910. Taft IV, Fig. 4). -- Da wir wissen, dab das naeh Punktion der Vorderkammer regenerierte Kammer- wasser nach vorheriger intraven6ser Farbstoffinjektion stets einen st/~rkcren Farb- stoffgeh~lt aufweist und die Iris anerkannterweise ein R e s o r p t i o n s o r g a n dar- stellt, so kSnnen doeh die yon H a m b u r g e r einige Zeit nach Vorderkammer- punktion mikroskopiseh in den vorderen Iristeilen nachgewiesenen feinsten Farb- stoffk6rnehen h5chsf~ns als Beleg f fir die r e s o r p t i v e Irisfunktion verwertet werden, ganz u n m S g l i c h abdr doeh einen Beweis far die sekre~or isehe Arbeit der Iris in p h y s i o t o g i s c h e n Zeit, en d~rstelte~. -- Da aber das Eindr!figen des
t~ber die Quelle und den Verlauf der intraokalaren Saftstr~mung. 393
Aus denselben Gri inden ist es n icht richtig, in dem nach intravenOser F luoresce in in jek t ion erfolgenden min ima len ~ 'arbstoffaustr i t t aus der Ir is in die Vorderkammer Ms Beweis fiir ehm physiologische sekreto- rische Funkt im~ der Iris anzusehel~_. [ E h r l i c h l ) , H a m b u r g e r . ]
Ebenso une r l aub t war es aber auch, aus dem am i n t a k t e n Auge v e r m e i n t l i c h e n Fehlen eines Fluoresceini iber t r i t tes in das Hin te r - kammerwasser , im Gegensatz zu dessen Vorhandense in im Vorder. kammelwasser~ eine sekretorische F u n k t i o n des CiliarkSipeIs in physio- logischen Zeiten ausschlieBen zu we]ten, da m a n sich doch, ga~z abge- sehen yon den bereits e rwghnten , ,e lekt iven" Eigenschaften gerade der Dii isenzellen dari iber ktar sein mu~te , da~ die physikal ischen Ver- h~ltnisse fiic eine Farbs tof fverbre i tu~g aus den CiliarkSrpe~gef~Ben in das Hinterkamme~wasser aus ana tomischen G d i n d e n (mehrschich~ige
Farbstoffes in die Iris auch physikaliseh dureh Diffusion, sowohl yon dem nach Kammerpunktion erheblieh stgrker farbstoffhaltigen regenerierten Kammer- wasser aus, ale auch durch Diffusion aus den IrisgefgBen, zustandegekommen s<in kann (zumal noch auBerdem dbch bei Entleerung der Vorderkammer ein k'fiustlich erzeug~es Druckgefgtle aus den Iriscapillaren zm" Vorderkammer er- zeugt wlrde), so Iiegen in diesem HamburgerschenVersuehe wiederum so kom- p t i z i e r t e Verhgltnisse vor, dab er m. E. nach k e i n e r Sei te mit nut einiger Sieherheit v e r w e r t e t werden kann.
1) Eh r l i ch kam zu dieser Auffassung, weft er yon der damals verbreiteten Annahme ansging, dab die im Auge vorhandenen SekretionsstrSmungen sehr leb- haft seien, so da~ die unmittelbar naeh der Fluoreseeininjektion zu beobaehtende Farbstoffverbreitung im Auge auf diese, nach seiner Annahme, sehr lebhaften physiologisehen Saf{strSmungen bezogen werden k6nnte, da die Verbrdtm~g des Farbstoffes dutch die erst gewisge Zeit zur Entwieklung brauehende Diffusion erst etwas sp~ter in Erscheinung tri~te und daher, im Anfang wenigstens, nur physiologische FltissigkeitsstrSmungm3 dutch den Farbstoff markiert warden. -- Da heute auf Grund yon Lebers Arbeiten feststeht., dab yon lebhaften physio- logischen SekretionsstrSmungen im Auge kehle Rede sein kann und nut unmerk- lieh langsame Fl~sigkeitsbewegungen im Auge in Be{rach~ kommen, so hat sieh die Annahme Ehr l i ehs , auf die er den aus seinen Fluoreseeinversuchen gezogenen Sehtul~ itber die sekretorische Funktion der lrisvorderflgehe griindete, ale un- riehtig erwiesen. -- Trotz dieser vergnderten Sachlage hielt H a m5 u rg e r dennoeh an dem!,Ehrliehsehen Sehlusse test, offenbar in dem Glauben, den sich hieraus ergebenden Widerspruch dadureh iiberbriicken zu kSnnen, da$ er die vSllig neue Behauptung aufstellte, dal~ selbst ein so minimaler {}bprgang yon Farbstoff aus den Irisgef/tl~en in die Vorderkammer, wie der in E h r l i e h s Experimenten be- obaehtete, physikalisch dutch Diffusion i i b e r h a u p t n i e h t raSgtich sei, womi~ er sieh im Gegensatz zu Eh r l i ch und vet allem zu feststehenden T~/tsaehen der Bioeheraie setzte. -- Wenn H a m b u r g e r aus den wiederholten Warnungen Lebers vor vordligen Sehli~ssen a~s Versuehen mit diffusiblen Farbstoffen ab- leiten zu kSnnen glaubt, L eb e r habe die lebenden Capillarwgnde mit getroekneten Dialysierschl~uehen verwechsdt, so vermag ich ihm aueh darin nicht zu folgen, da doch immer nut die 3gede davon war, dal~ der im Verhgltnis zur Konzentration des Farbstoffes im Blute n u r m i n i male F l u o r e s c e i n i i b e r t r i t b ins K a m m e r - wasser dutch eine entsprechend auch n u t m i n i m a t e p h y s i k a l i s e h e P e r m e - a b i l i t g t der C a p i l t a r w g n d e zu erktgren sei.
v. Graefes Archly fiir Ophfhalmologie. Bd. 101. ~6
394 Erich Seidel: Weitere experimentelle Untersuchungen
hohe Zellmembran) viet uI~gfi~s~iger liegen Ms an der Irisvorder- fl£ehe.
Aueh aus dem vermeintliohen Fehlen einer ~italen Ciliark6rperf~rbung h£tte man bei dem gleiehzeitigen Fehlen einer solehen an der Iris nieht ohne weiteres Sehlfisse gegen eine sekre~orisohe l~unkt, ion des Ci]iar- k6rpers ziehen dfirfen.
Da ieh nun inzwisehen gefunden habe (v. Graefes Arehiv 95, 41} (mit I-Iilfe der Nernstspaltlampe), dab aueh bei mEBiger I)osierm~g naeh einiger Zei~ ein deutlicher' FluoresceingehMt des Hinterkamme~wassers im unberiilar~en Auge vorha~den is~, in nut e~was geri~geIern MaSe als in der Vorderkammer, und da yon mir weiterhin nach intravei~Oser Fluoreseein- und Indigcarmin-tnjektion eine vii.ale Cilia.rkSrpe~f~:,bm~g beobachtet werden konn~e x) bei v611igem Fehlen einer solchen in der Iris, so sind alle Argumente, die sieh auf das zu Unreeht behaupte~e NichtvorhandenseJn einer vitalen Ciliark6rpeIf£rb~ng sowie auf das angebliche , ,hermetisehe" Zurfiekgehaltenwerden des Farbstoffes dnIeh die CiliarkOrpergefMte st.fitzten, hiermit h i n f g l t ig g e word e n.
Da die yon mir beobaehtete vitale Ciliark6rloerfgrbu~g naeh Fluo- rescein und Indigcarmh~, wie jede wirktiehe vitale Fgrbung im Oegen- satz zu den yon H a m b u r g e r beobaehte~en physiko-ehemisch zu er- klgrenden Erseheinungen e i n e n p h y s i o l o g i s e h e n V o r g a n g dar- stell~ und daher aueh, im Gegensatz zu diesen, wichtige Sehliisse auf Lebensvorg£nge gestattet , so mOehte ieh im folgenden naeh einer kurze13 allgemeinen Bemerkung fiber diesen Oegenstand linch einige m e l t e r bereigs vor 2 gahren gemaehten Beobaehtungen mitteilen.
H a m b u r g e r beruft sieh zur Begriindung der yon ihm gemaeht~en Annahme, dab bei maBvoller Dosierung diffusible Farbs~offe im tierisehen K6rper physiologisehe Saft strOmungen markieren sollen, auf die t I e i - d e n h M n s e h e n Versuehe ini~ !ndigearmin fiber die NJerensekretiol_ ~). Bekannt l iehhat } t e i d e n h a i n gefunden, daBnaehintraven6ser Injekt ion dieseslipoidunt6sliehen Farbs~offes die Glomeruti ungefg.rbt Meiben, m~d dab der Farbstoff allein innerhMb de~ Zellen der Tubuli eontorti
~) Ebend~ S. 35. Tar. I - - I I I . ~) Entspreohend der Funkgion der Niere als osmo-regula~0risches Exkretions-
organ, dessenAufgabe es is~, ein im Blur dutch Stoffwechselprodukte oder ktingtlich beigebraehte Stoffe (vitale F~rbe) entst~ndenes osmotisches iJbergewieh~ dutch Eliminierung des betreffenden molekularen LTbersohusses zu beseitigen dutch so- fort einsetzende lebhafte Ausseheidung dieser Stoffe (dutch al~tive Zellt£tigkeit ihrer Epithelien) in ihr Exkre~, st.eht, die Niere physiologiseh dem int.raokuturen Sekretionsorgan diametrM gegeniiber, da bek~nntheh im Gegensatz zur Niere immer nur minimale Mengen derartiger im Blur befindlieher oder gebraehter di~fusibler Stoffe ins normale Kammerwasser iiberzutreten vermSgen. Wenn man es daher iiberhaupt fiir zhlgssig halt, ein Exk re t i onso rgan , wie es die Niere darstellt, mit dem in~rao kulare n Se kret io nsorga n zu vergleiohen, so mug man sieh jedetxfalls dieses fund~mentaten Unterschiedes zwisehen beiden stets bewuBt sein.
iiber die Quelle und den Verlauf der intraoku]a,ren Saftstrsmung. 395
reiehlich gespeichert wird in Form yon intensiv gef~rbten Farbstoff- trSpfchen und -st~bche~l.
Obgleich die H e i d e n h M n s c h e n B e f u n d e in der Tat zu den ,,ge- sichertsten Ergebnissen der Physiologie" gehSren, so-is t doch ihre. D e u t u n g bis auf den heutigen Tag durchaus strittig. Denn ,,diese Speicherm~g der ~arben kann nun an sich ebensowohl bedeuten, dab die Farbstoffe auf dem Weg in den Harnkang~lcheninhatt als auch auf dem umgekehrten Wege der Riickresorption ins [Blut sich befinden. Fiir das zweite spricht, dab die Auf~rbung der Epithetien stets an ihrem gegen das Lumen gerichteten Abschnitt beginnt, und dag das Maximum der Farbstoffausscheidung im Harn zu einer Zeit erreicht wird, we die Epithelien erst anfangen, den Farbstoff in ihrem Im:ern zu speichern [Asehof f , v. M S l l e n d o r f f l ) ] °'.
Da bis auf den heutigen Tag eine Entscheidu~g; ob die Farbe in den H e i d e n h M n s c h e n Versuchen dutch A b s e h e i d u n g oder dutch R i i e k r e s o r p t i o n in die Zellen ~ela~gt ist, nicht mSg]ich war, so ist eine Berufung auf diese Versuehe in t I a m b u r g e r s Sinne nicht an- ggngig, zumal bet Zutreffen der zweiten M6g]iehkeit das stark gefgrbte Harnwasser dutch die G]omeruli getreten sein miiBte, ohl~e dieselben gef~rbt zu haben und yon maBgebender Seite wiede~ho]t darauf hin- gewiesen wurde, dab die Farblosigkeit der Glomeiuli ,,nicht etwa als zureichendes Argument gegen die Filtration in den B o w m a n s c h e n Kapseln und weiter in die Kang]ehen angesehen weIden kSnne, sehon weft verdiinnte FarblSsungen in :mikroskopiseh diinner Sehi.eht sehr oft farblos erseheinen ~)".
Da das Indigearmin zu den lipoidun16sliehen Farbstoffen gehSrt und daher nieht die F~ihigkeit hat, auf physikalisehem Wege fn s I n ne re d e r 1 e b e n d e n Z e 11 e eil~ zudringen, so beweisen die t t e id e n h ai n sehen Versuehe nur, dab bet der Sgugerniere gewisse Zellen daranf ei~geriehtet sind, lipoidunl6sliehe Stoffe zu sammeln in folge ihrer vitMen Eigen seha ften.
Es hande/t sieh delnnaeh in den t t e i d e n h a i n s e h e n Veisuehen um den Naehweis ether physiologisehen I Permeabilitgt gewisser Einzel- zellen, also um einen Lebensvorga~g, der sieh in der vitalen Zellfii~bm~g gui3ert, wghrend H a m b u r g e r mit demselben Farbstoff am Auge nur die bekannte , , p h y s i k o - e h e m i s e h e P e r m e a b i l i t g t " gewisser Membra~en (Capillarwi~nde) beobaehtete, also einen nieht vitMen Vor- gang, der deshMb aueh gar nieht mit den t l e i d e n h M n s e h e n Befunden vergliehen werden kann.
Bet der AnstelIusg yon Versuehen mit vitMen Fgrbungen mnB man sieh eine Reihe experimelltell gefundener feststehender Tatsaehen
1) H6ber, Physiologie, S. 230. 1919. 2) Vgl. dazu HSber, PhysikMische Chemie der Zelle und Gewebe. 4. Aufl.
I914. S. 649 u. 430,
26*
396 Erich Seidel: Weitere experimentelle Untersachangen
gegenw~r~ig hal.ten, um Fehlerquellen und somit Trugschltisse zu vermeiden.
So ist bekannt, da6 ,,gewOhnlieh, d. h. wenn man nieht besonders starke FarblOsungen verwendet", das Protoplasma, welche Farbe auch gewirkt haben mag, farblos aussieht, ,,well die Farbl6sung in einer so diinnen Schieht, wie sie der H6he einer Zelle entspricht, farblos erseheint" ( O v e r t o n). Dagegen hat sich herausgestellt, dab die in manchen Zellen vorhandenen Granula fiir einzelne Farben, aber durchaus nicht fiir alle ein ,,brillantes L6sungsmittel" darstellen. Ferner h~t man gefunden, dab manche Farbstoffe nur scheinbar vital f~rben, well sie giftig sind und ,,nut durch die l~dierte Plasmahaut eindringen, und dab andere Farbstoffe scheinbar nicht vital f i rben, welt sie im Innern der Zelle sofor~ dutch ~edukt ioa oder dureh ehlgreifendere Reak~ionen entfirbt. werden" ( H 6 b e r , t t e i d e n h M n ) .
Besondere Vorsicht ist nun gerade bei Versuchen mit Indigcarmin geboten.
So ha t sehon H e i d e n h a i n auf die Unsichtbarkeit des verdiinnten Farbstoffs in diinnen Schichten hingewiesen und ebenso den Ubergang des Farbstoffs in seine unsiehtbaren Leukobase beobachtet, wodurch seine Abwesenheit im Innern der Zelle vorget~uscht wird. H e i d e n h ai n sprieht fernerhin sehon ldar und d eutlich aus, dab das Zustandekommen einer wahrnehmbaren F ~ r b u ng i ibe r h a u pt , sowie die Art und Weise wie die F~rbung in den Tubulis eontortis der Niere auftr i t t , y o n d e r M e n g e des s e z e r n i e r t e n F a r b s t o f f e s und somit~ v o n d e r gewShlten Dosiernng abhgngt, und dab man bei k l e i n e n D o s e n , t rotz blau gefgrbten tIarns, ,,in den Nieren kaum imstande ist, aueh nur Spuren yon Blguungwahrzunehmen, well das Sekret doeh in geringerem .Grade gef i rb t ist, a m in den diinnen Sehiehten, die bei der mikroskopisehen Untersuehung in nerhalb der I-Iarnkaniilehen voriiegen, sieh merklich zu machen"i) , und dab die gerade so charakteristisehe Farbstoff- speieherung in ]~'orm yon Tr6pfehen und St ibehen innerha!b der Epithel- zellen der Tubuli confetti aueh nieht bei mi~tleren, sondern nur bei hohen Dosen zu beobaehten ist 2). Da H e ide nh ai n welter berichtet:
~) Archly f. mikr. Anat. 10, 35. 1874. ~) Ebenda S. 40. Es ist daher wiederum nicht angiingig, wenn H~mburge r sieh auf Heiden-
ha in bemfft, um die Behanptung zu stiitzen, dab beim Studium -con Sekretions- vorg/ingen mit vitMen Farben im atlgemeinen und mit Indigcarmha im besonderen i mmer n ur die kleinen Faxbs~offdosen geeignet seien, um physiotogische Diffe- renzen der Zelteafunktionen av2zudecken. Vielmehr das Umgekehrte kann man den I-Ieidenhainschen Beobachtungen entnehmen. Die Farbstoffdosen diirfen nich$ zu klein, sie miissen ausreichend sein. Nan ersieh~ daraus deuttieh, wie willkiirlich es war, wenn man den bei etwas hSheren Fluoreseeindosen (z. B. der urspriinglichen Ehrliehschen Dosierung) am intakten pigmentierten Kaninchen- auge regelmggig ohne weiteres zu beobachtenden Farbstoffaustritt aus dem Cigar-
fiber die Quelle und den Verlauf der intraokularen Saftstr~mung. 397
Bei einem Tiere, (lessen HatCh nach Ljekt ion yon indigschwefelsaurem Natron tier dunkelblau sezerniert wird, entleelen die Ohr- ~md Unter- kieferspeicheldriisen auf Ner venreizung ein v611ig farbloses Sekret, und in den mit St~bchen veIsehenen G~ngen derselben ist keine Spur des Pigmentes zu entdecken, so waren aus den H e i d e n h a i n s c h e n Er- fahrungen fiir die Verhgltnisse am Auge 2 Dinge mit Sieherheit zu ent- nehmen. Bei derselben Farbstoffdosierm~g war:
1. Bei dem bekannten nur spurenweise ei'folgenden ~az-bstoffiibe~- tritt ins Kammerwasser ira Gegensgtz zum profusen Ubergang des- selben ins Nierensekret (immer unter der Vorunssetzung eines gewissen Parallelismus), nur eine sehr schwache vitale Fgrbusg im intraokularen Sekretionsorg~n zu ezwarten.
Um eine deut]ichere Fgrbung zu e~zielen, wgre die ~%rbstoffdosis zu erhShen gewesen.
2. Fiir den Fall, da[~ eine CiliarkSrperf~rbung wirklich ausblieb, konIlte kein SchluI~ g e g e n die sekretorische Fnnktion des Ciliark6rpeIs aus dieser Tatsache gezogen wezden.
Ich land nun, daf~ in der T~t eine wirkliche vitale Zellfgrbm~g des Cili~rk6rpers dm'ch Indigcarmi~ ein~ritt im Gegensatz zur Iris, d~e farblos bleibt und lasse unter Velweisung auf das f~iiher yon mir bereits dariiber Mitgeteilte 1) noch einige kurze Notizen folgen aus einigen bereits vor 2 Jahren niedergeschriebenen Versuchsprotokollen.
Versuch I (starke Dosierung). Albisiot. Xaninchen. Gewicht 1500 g. 12 Uhr 15:20 ccm Indigcarmin 2 proz. (aus ]3reslau bezogen) mtraperitoneal. 3 Uhr 30: 10 ecru Indigcarmin 2 proz. (aus Breslau bezogen) intraioeritoneal. 3Uhr45:20 ccm Indigcarmin 2 proz. mtravenSs. 4 Uhr 07: TStung des Tieres dm'ch Dekapitieren. Bulbi enncleiert und mit ~Lqnatorialem gasiermesserschnit~ erSffnet. CiliarkSrper in~ensiv blau gef~ixbL Iris so gut wie vSllig farblos. Kammerwasser: n ---- 1,3352 (17,5 ° C); zeigt einen schwaeh blgulichen Far-
benton. Mikroskopische Untersuchung yon CiliarkSrper und Iris. I. Beobachtungen ~m frischen Pr~parate:
kOrper in die Hinterkammer, einer Mlgemein best~Ltig~n Beobachtung (die Mler- dings durchaus nicht mit Hamburgers ttypothesen harmoniert), als auf einer zu groSen Farbstoffdosis beruhend, jede Beachtung versagte. Beim capillaren Charakter der ttinterkammeI" mul3 eben der l~luoresceingeha.lt ihres Inhaltes und somit die ~ngewandte l~arbstoffdosis einen gewissen Schwellenwert iiberschreiten, damit der l~luoresceingehalt in der capillaren IIinterkammerwasserschicht bei der einfaehen Besichtigung ohne Zuhilfenahme besonderer optischer t-IiIfsmittel wahr- nehmbar wird, wora.uf ich ja schon gelegentlich meiner hierauf beztiglichen Unter- suchungen mit der Gullstrandschen :Nernstspaltlampe hinwies, wodurch der Fluoresceinnachweis im Hinterkammerwasser auch nach sehr m~Biger Dosierung mSglich war.
~) v. Graefes Archiv 95, 35ff.
398 Erich Seidel: Weitere experimentelle Untersuchungen
Starke Bl~uung des CiliarkSrpers, besonders in der Umgebung der Gef~Be, Epithel zeigt eine deutliehe, aber sehr viel geringere diffuse Blaufiirbung des Protopl~smas; Ablagerung des Farbstoffes in Form yon TrSpfehen nicht vor- handen.
II. Beobaehtung am fixierten Pr/~purat: Sektor yon Iris und CiliarkSrper im Zus~mmenhang abgelSst; 1/2 Stunde in
mehffaeh geweehseltem Alkohol absolu~, fixiert; 5 Min. XyloI, Canadab~lsam. Befund: Iris vollkommen ungefarbt. Ciliark6rper st~rk bl~u gefarb~; Ciliurepithel deutlich, aber erheblieh weniger
~ls das Stroma des Ciliarfor~sa~zes gebl~ut. III . Beobuehtung am ~ixier~en und in Paraffin eingebe~teten und gesehnit~eneu
Pr~para~. Vordere Bulbush~lfte 1~/~ Stunde in mehrfach gewechseltem Alkohol absolu~. :
8ek~or yon Corpus oi~are und Iris im Zus~mmenhang heruusgelSs~; i/4 S~unde Xylol, 1 Stunde Xylot -- Paraffin; Paraffin 1 Stunde.
Befund im Par~ffinschnitt versehiedener I)ieke (5--30 #): CiliarkSrper sehr ~usgesproohen blau gef~rbt, Iris vollkommen farblos.
EpitM1 ze i~ eine diffuse geringe BI~uung, die erhebtich schw~her is~ ~ls die des Stromas, stellenweiseVauoh eine geringe F~rbung der Kerne ira Epithel siehtb~r. Jedooh keine Ablagerung des Farbstoffes in TrSpfehenform, die man in einzeluen Bindegewebszellen des Stromas einw~rts vom Epithel finder.
Plexus ehorioideus zeig~ deu~liehe Blauf~rbung.
Versuch I I (sohw~che D~sierung). KMnes atbinot. Ka.ninchen. Gewieht 600 g. 6ccmIndigcarmin2proz. (Tri ib ner , Brest~u)in~raperitoneat. DieBeobacheung
ergibt, dab die st/£rkste Blaufiirbung etwa nach 4--6 Stunden auftritt. 20 Tage sp/~ter: 7 ecru Indigearmin 2 proz. intraperitoneal. Nach 6 Stunden: T6tung (lurch Deka'pitieren. Bulbi enucleiert; Equatorial aufgesehnitten. CfliarkSrper deutlich blaugriin
gefErbt, Iris vollkommen ungefi£rbt. Kammerwasser: Andeutung yon bl~ugrfinem Farbenton.
Mikroskopische Untersuchung yon Ciliark6rper und Iris.
I. Beobaehtung am irischen Pri~parat: Deutliche Blaufarbung des CiliarkSrpers, besonders in der Umgebung der
Gef~Be bis zum Epithel; das Epithel selbst ebenfalls deu~lich diffus blau gefiirbt, abet erheblieh schwi£eher.
II. Beobachtung am fixierten Pr~p~rat: 1. Alkohol. absolut. 30 Min. Xylol, 5 Min. Farbstoff vSllig verblal~t. 2. Einlegen in ges~tigte ChtorealeillmlSsung (He idenhMn) . Farbe geh~
r~seh aus. 3. Einlegen in Formol; Farbe geht aus. Plexus ehorioideus nieh~ gef/~rbt.
Versueh III. Versueh mit Isaminblau 6 B (sog. ,,Pyrrolblau Ehrlieh")I). Albinot. Xaninehen. Gewicht 1100 g. Im Verl~ufe yon 6 Monaten erhielt das Tier 13 in~raperitoue~le Injektionen
yon 10 ccm 5proz. Isaminbl~ulSsung. TStung des Tieres dm'eh Dekapitieren 14 T~ge n~eh der letzten Injektion. ErSffnung des enueleierten Auges mit /iquatoriatem Rasiermessersehnitt.
1) v. Gra~fes Archiv 95, 39, 40.
tiber die Quelle und den Verlauf der intraokularen Saftstrfmung. 399
B ef u nd: Ciliark6rper blaugriin gef/~rbt. Iris vollst~ndig ungef/~rbt. Kammer- wasser zeigt mu" Spur yon blauer F/irbung.
Plexus chorioideus: ebenfalls blau gefi~rbt; starker als der Ciliark6rper. 1V[ik~oskopische Untersuehung: 1.! Beobachtung am frischen Objekte: Im bindegewebigen Stroma des Ciliark6rpers liegen zahlreiehe Zellen, die
~dieht mit kleineren und grSBeren blauen Farbstofftr6pfehen angeffillt sind, ,,Pyrrol- zellen"; auBerdem sieht man deutlieh auch feinste Farbstoffk6rnchen im Ciliar- epithel. Dieselben liegen in der Hauptsaehe in der basalen Zellh~lfte, w£hrend die obere Zellh/~lfte frei bleibt. Eine diffuse Zellf~rbung kann nicht wahrgenommen werden.
Im Plexus ehorioideus zahlreiehe blaue K6rnehen, die KSrnelung ist aus- gesproehener als ira Ciliarepithel.
£. Beobachtung am fixierten Objekte: Ein Sektor yon Iris und CiliarkSrper wird naeh Formolfixierung (24 Stunden)
und Behandlung mit Alkohol absolut. Xylol, in Canadabalsam eingeschlossen und direkt betraehtet.
Ein anderer Sektor naeh derselben Behandlung in Paraffin eingebettet; ge- schnitten und mit Alauncarmin gegengef/trbt.
Be fund : Blguung des CiliarkSrpers, Iris rdcht gefgrbt. Am CiliarkSrper unterscheidet man bei schwaeher VergrfBerung eine diffuse Bl~uung und aul~erdem zahlreiehe gesehweifte Bindegewebszellen im Stroma, die mit dunkel. blauen FarbstofftrSpfchen angefiill~ sind (,,Pyrrolzellen"). Bei starker Ver- grfl~erung erkenn~ man deutlieh zahlreiehe feinste blaue KSrnchen innerhalb der Epithelzellen des CiliarkSrpers liegen, und zwar meist in der basalen tIglfte, wiihrend die obere ttglfte frei ist.
Pl, exus chorioideus viel stgrker gefgrbt; blaue KSrnelung zahlreicher als im Ciliarepithel.
"In den Tubuli confetti der Niere deutliehe blaue FarbstoffkSrnehen. Am stgrksten ist der Plexus ehorioideus gefttrbt; dann die Niere und verhgltnis-
mgBig am sehwgehsten der CiliarkSrper, ganz farbstofffrei ist die Iris.
Aus den eben kurz gesehilderten Versuchen mit vitalen FaIbs toffen [die ieh, wie bereits berichtet , der grSl~eren Sieherheit halber auf einige weitere Farben, sowie auf das bereits yon S c h n a u d i g e P ) am Auge studierte Trypanb lau ausgedehnt habe] ergibt sich deutlich, dab wir es in tier beobachteten vitalen CiliarkSrpeffgrbung mit einem L e b e n s - v o r g a n g zu tun h a b e n , denn das lipoidunl~sliche Indigcarmin und das sehr sch~ver diffusible I saminblau fand sieh i n n e r h a l b d e r l e b e n d e n Z e l l e n , wohin es nur dutch v i t a l e K r g f t e gelang~ sein kann.
Wi t bei den Nieren in H e i d e n h a i n s Exper imenten bei geringem Farbstoffgehal{ ihres Sekretes nu t eine leichte Epi the lb lguurg auftr i t t , so l inden wir im Ciliarepithel, dem geringen Farbstoffgehal t des K a m m e r - wasseis entsprechend, nur eine mi~l~ige diffuse Blaufgrbung des Proto- p]asmas. Die im Gegensatz dazu naeh Isaminblau (sog. , ,Pyrrolblau E h r l i e h " ) wahrgenommene Ablage_Tur~g des Farbstoffes in eir.zelnen feinsten KSrnchen, innerhalb der Epithelzellen, was iibrigens auch in
1) v. Graefes Archiv 86.
400 Erich Seidel; Weitere experimentelle Untersuchungen
vereinzelter Menge yon Gold m a n n 1) innerhalb echt.er Driisenzellen (Milchdrfise) m~d in verst~rktem Mat]e in dem entwickelungsgesehiehtlieh den Ciliarforts~tzen gleiehstehenden und die Cerebrospinalfliissigkeit~ sezernierenden Epithe] des Plexus chorioideus, beobachtet wurde (Gold- mann), sowie das geh~ufte Auftreten der sog. Pyrro]ze]]en im Ciliar- kSrperbindegewebe und ihr Fehlen in der Iris, lassen naeh den eingehen: den Studien G o l d m a n n s , der diese Zellen regelm~l~ig in alveo]~ren D r i i s e n b i n d e g e w e b e und iiberhaupt da fund, ,,we immer lebhafte Stoffwechselvorg~nge physiol0giseher und pathologischer Art sich ab- spielen"~), dariiber keine Zweifel, dal3 auf Grand dieser mik~oskopi- schen Befunde die uns bier interessierende Frage nach dem physiologi- sehen intraokularen Sekretionsorga.n z u g u n s t e n des Ci l i a rkOrpers und n i e h t der I r i s entschieden werden mull
Die erhobenen mikroskopischen Befunde erklgren nun sehr einfach die yon mir gefundene Tatsache des leichten Naehweises der erfo]gten vitalen CiliarkSrperf~rbung nach Fluoreseein, Indigearmin (m~d~ einJgen anderen vitalen Farbstoffen) bei eJnfa.eher ma.kroskopiseher BesJehtigung des albinotischen Kaninchenauges im Gegensatz zum pigmentierten Tierauge, an dem die eingetretene vitale FSrbung bei gew0hnlicher Be- traehtung nicht wahrgenommen werden kann, woraus irrtfimlieherweise ihr Nichtvorhandensein gefolgert wurde (H a mburger ) .
Die starke Farbstoffspeieherung innerhalb bestimmter Bindegewebs- ze]len des Ciliark6rperstromas, sowie die diffuse F~rbung des Stroma- gewebes yon den Gef~l~en bis zum Epithet, ~drd uns beim pJgmentierten Kaninehen dutch das undurchsichtige, tiefsehwarze Pigmentepithel verdeckt, und die im Gegensatz zur Stro,rnaf~rbung viel geringere und weniger intensive l~Srbung der unpigmentierten Ciliarepithelien ver- mOgen wir, wegen der diinnen, nurder H6he eJner Zelle entsprechenden Schicht bei dem optiseh dazu noeh ungfinstigen sehwarzen, dutch das Pigmentepithe] gebilcletell Itintergrund, nicht zu erkennen.
Da~s Feh]en einer wahrnehmbaren F~rbung des eigentlichen Iris- gewebes erkl~rt sieh dadureh, daI~ in der Iris iiberhaupt keine vitale l~rbung, d. h. eine Aufn~hme des F~rbstoffes ins Innere der Zelle er- folgt, und dal3 die nach physiko-chemischen Gesetzen in bestimmter Zeit aus den Irisgefgl~en herausdiffundierenden Fa.rbstoffmesgen gleich- m~l~ig in derselben Zeit and iVIenge naeh denselben Gesetzen dutch das flache Irisendothe] hindureh ins KammeIwasser weiteIwanden~, wie wir das ja nach Fluoreseeinanwendung direkt beobaehten k0nnem Der Austritt des Farbstoffes aus den Gefg~en der Ciliarforts~tze in Jhr bindegewebiges Stroma ist natiirlich genau so, wie der aus den Iris- gefgl~en erfolgende, derselbe physiko-ehemisehe Vorgang. Die Tatsache
~) L. c. S. 220. s) Goldmann, 1. c. S. 253.
fiber die Quelle nnd den Verlanf der intraokularen SaftstrSmung. 401
jedocb, dag der Farbstoff im CiliarkSiper i~s Inhere gewisser Zel]en eindring t und zwar tells in vermehrter tei]s in verri~gerter Ko~zen- tration, als es der dutch F~rbstoffdiffusion aus den CiliarkSrpergefgSen heraus entstandenen diffusen Stromaf~rbu~g entspricht, zeigg eben sehr deu~lich, dab es sich am CiliarkSrper n i ch¢ n u r u m p h y s i k a l i s c h e , sondern a u c h u m v i t a l e Vorg~nge hande]t, so dag uns gerade hier im mikroskopisehen Bride nebeneinander der ~ntersehied zwischen physiko- chemischer Permeabili~gt ~ (IrisgefgBe, Irisendothel, CiliarkS~peIgef~l~e) und physiologischer Permeabilit~t (Ciliarepithel, ,,Pyrrolzellen") sehr deutlich vor Augen trier.
Dadurch, dag das Cfliarepithe] infolge seiner ibm zukomme~den spezifischen physiologisehen Permeabflitgt den Farbstoff nicht fiber- nimmt, in der Konzentration wie das Stromagewebe diesen ibm g]eich- sam darbietet, sondern, wie das mikreskopische Bi]d (nach Indigcarmin- anwendung) zeig~, in einer erheblich schw~eheren, kommt es zu einem r e l a t i v e n Z ur i ie k g e h a l t e n w e r d e n des Farbstoffes innerhalb der Ciliafforts~tze info]ge der den Ciliarepithe]ien innewohnenden beson- deren Lebenseigenschaften 1).
Die Versuche mit vitalen Farbstoffen Iassen uns daher nicht nut im CiliarkSrper das Quellgebiet des physio]egischen XammeIwasseis erkennen, sondern sie weisen anch deut]~ch auf die ~a tu r des bei der KamraeIwasserbildmig sich abspieleI~den Abso~:de~rgsve~ga~gs h ~ , indem sie uns die vitalen, ausw~hlenden Eigensehaften, das Se le k t i o ns- v e r m 6 g e n der Ciliarepithelien enthiillen, was bekanntlich eine be- senders hervortretende, charakteristische Eigenschaft echter ])~iisen- ze]len ~st. - -
Wie die eben besprochenen Beobachtu~gen mit vitale~ Falbstoffen a m i n t a k t e n A u g e mit der Funktion des Ciliark61pers a]s physioio- gisches Sekretio~sorgan in vollem Einklang stehen und eine neue Stfitze dafiir darstellen, so lassen sich a u ch d ie n a c h Vord er ka mine r - p u n k t i o n e n u n d a n d e r e n R e i z e n zu b e o b a c h t e n d e n E r s c h e i - n u n g e n ohne wei~eres auf Grund allgemein anerkannter u~d fest- stehender physiologischer Gesetze erk]~en.
,,Bei allen AusCauschprozessen zwischen BInt und Geweben, z~sehen Gewebsfltissigkei~ und Zelle, zwisehen D~fise~zel]e m~d Sekret, km:z bei allen Ern~hrungsprozessen der Zelle, bei al~en Abgaben der ZeIIe an Sekreten n~d Exkreten, also bei Speiehel, Ita~n, SehweJ$, bei der
~) Das verschiedene Verhalten einzelner Farbstoffe zum C i l i a r e p i t h e ] geht aus den mitgeteilten Befunden hervor. - - Ich verweise noehmals auf die yon mir festgestellte ausgesprochene ~' a r b s 13 e i c h e r u n g yon Ieaminblau in K6rnchenform innerhalb des Ciliarepithels, im Gegensatz zura Indigearmin (und naeh S e h n a u d i g e ] auch zum Trypanblau), wobei nur eine ira Vergleich zum Stromagewebe schw~ehere diffuse Epithelbi]dung auftrat.
402 Erich Seide[: Weitere experimentetle Untersuchungen
Bildung der Lymphe und der Trar~ssudate, bei der Resorption im Dram und aus den ser6sen H6hlen, finden ~dr stets ein Inein~ndergIeifen von drei Prozessen, wobei der Einflug eilles jeden yon ihnen fiR' jeden einzelnen dieser Prozesse als weitgohend verschieden angenommen sei. Zwei davon verlaufen ohne Energieaufwand auf dem ~Wege der Aus- gleichung vorhsmder~er Druekuntersehiede, die einfaehe Filtration dmeh hydrost, atisehen Druek, die Diffusion 'dutch osmotischen Diimk. Der dritte ist ein Arbeitsvorgang der Zetle und verliiuft mit Verbrauch von Energie: der Transport yon Stoffen gegen diese Gefglle und damii also Bildung neuer Ungleichgewiehte 1).,,
Setzen wir im Auge dureh Punktion der Vorderkammer, also kiinst- lieh, den Augendruek herab~'), so mutt dadm'eh ktinst, lieh das Druck- gefNle aus den CiliarkSrpergefgllen zum Bulbusinhalte sofort pl0tzlich vermehrt werden und somit eine Xnderung der auf Filtration beruhenden Komponente des physiologisehen Sekretionsvorgangs eintreten. Dureh die infolge davon naeh jeder Punktion regelm~iBig zu beobaehtenden H)20er~mie der Ciliark6rpergef~lle muB es zu einer Dehnung der GefgBwand kommen, wodureh eine Xnderung ihrer physikalischen Eigensehaften - - VergrSllerung ihrer Poren - - bedJngt ist. Diese Ver- grSBerung der GefEBwandporen hat eine v e r m e h r t e D u r e h l / i s s i g k e i t d l e s e r Me m b r a n zur Folge und beeinflugt naturgemEll neben dem Filtrationsvorgang aueh den beim Sekretionsvorgang mitwirkenden zweiten ProzeB, die Diffusion, indem sic nun aueh dem grollen EiweiB- molekiil und den daran dureh Adsorption ( F r i e d m a n n , Lebe r ) lose gebundenen Fluoreseeinmolekiil, aunmet~" aul3er dem hydrosta- tisehen Drucke aueh dem osmotischen Drucke s) fo]geI:d, den Uber-
t) Oppenheimer, Biochemie. 2. Aufl. t919. S. 414. 2) Vgl. dazu die Ausfiihrungen Lebers (Die Zirkul~tions- und Ern/~hrungs-
verhgltnisse des Auges. 2. Auft. Handb. v. Graefe-Saemiseh S. 251ff.), sowie Wesselys (Ergebnisse der Physiologic IV, 1, 2, S. 622£, 627).
3) Bekanntlieh erh~lten die EiweiBkSrper dauernd einen gewissen osmotischen Oberdruck innerhalb der Blutbahn ~ufreeht, da die Capillarwgnde in physio- logisehem Zustande fiir diese nut im besehrgnkten MaBe permeabel sin& Diesem osmotischen Uberdruek innerhalb der GefN3e wird beim Austausch zwischen Capillaren und Gewebsfliissigkeit eine wichtige Rolle zuerkann~ (0 p p e n h e i m e r, Biochemie 1919; S. 410), und diirfte ~uch belm AbfluB des doeh fast elwmf3frelen Kammerwassers sehr zu beriicksichtigen sein. -- Obgleich ieh die Absicht h~be, reich fiber dis AbfluBverhgltnisse im Auge erst spgter im Zus~mmenhang zu ~.uBern, mSehte ich doch hier sehon kurz auf die meines Erachtens grof~e Be- deutung der eben erw~hnten Tatsaehe flit den physiologisehen AbfluB des Xam- merwassers aus dem intakten Auge hlnweisen. -- Es ergibt sich aus dieser Tat- sache mi~ No~wendigkeit, dab selbst dann, wenn die ,,Kalkulationen" yon Weil~ (Zeitsehr. f. Augenheitk. ~5, 10. 1911) richtig sein sollten, nach denen der Druek im Sinus venosus Schlemmii und in den Irisvenen hSher ist als der Augendruck {was die Annahme einer Filtration der Fliissigkeif aus der Vorderkammer in diese Gefgl3e unmSgtieh maehen wiirde), dennoeh dutch den im Innern der Blutbahn
aber die Quelle und den Verlauf der intraokularen SaftstrSmung. 403
t r i t t ins Bulbus innere in gegeni iber der N o r m v e r s t a r k t e m Mal~e er- mSgl icht .
Dieselben Xnderungen , die sieh aus physikMischen G~iinden s,n de r das Gef~I~rohr b i ldenden Z e l l m e m b r a n der Ciliargef~l~e abspie len, miissen in g.hntieher Weise auch an der dureh die Ciliaxepi~helien ge- b i lde ten Ze l lmembran Plat, z greifen. Denn du tch den ve rmehr t en Aus- t.rit~ yon eiweil~haltiger F l i i ss igkei t a, us den Cil iaxkSrpercapil la~en k o m m t es nachweis l ieh zu einer Vermehrung des RauminhM~es jedes e inzelnen Ci l iar for tsa tzes und somi~ zu e]ner Dehr:,ung der durch die Ci l iarepi thel ien gebi lde ten Z e l l e n m e m b r a s , die auch, wenn sie n ich t in Blasen ( G r e e f ) abgehoben wird, doeh mindes t ens zu ghnl ichen phys i - kMischen E igenschaf t sgnderungen und ihren Folgen f i ihren mul~, wie dies yon der Cap i l l a rwand eben bespxoehen.
Durch d0.s s ta rke , du t ch die K a m m e ~ p u n k t i o n geschaffene ki inst - l iche ~ b e r g e w i e h t der be iden bei der Absonde rung des Ka.mmerwasse~s s t a t t f i ndenden phys ika l i schen Prozesse der F i l t r a t i o n und der Diffusion, mul~ der driP, e, du rch die P u n k t i o n n ich t d i r ek t beeinflul~t.e Vorgang, die eigentl iche, spezifische vi tMe Zel l tg t igke i t der Ci l iarepi thel ien bei der Sekre~ion mehr oder weniger in den H i n t e r g r u n d t re ten .
infolge des hSheren EiweiGgehaltes herrschenden osmotischen Uberdrucks gleich- sam eine s~ctige Ansaugung yon Kammerwasser, d. h. ein stetiger Abflul~ in die Blutbahn effolgen mu], selbst gegen ein eventaell bestehendes geringes hydro- statisches Druckgef/~lle. Da nun der KonzentratioJ:sunterschied des Eiwei~- gehaltes zwischen Kammerwasser (1/t0%) und Blur (7%) viel grSl~er is~ Ms zwischen Gewebsfliissigkeit (3% Eiwei$) und BluL so mug auch die auf das Kammerwasser ausgeiib~e Ansaugung in die Gef~]e eine viel s~rkere seia Ms die auf die inter- stitielle Gewebsfliissigkeit erfotgende. Mi~ andern WorSen mug Mlein sohon nach den Gese~zen der Osmose d~r FliissigkeitsabfluI~ aus dem Auge durch den S c hl e m m- schen Kanal und die Irisvenen ein v im l e b h a f t e r e r sein Ms der etwa in einer beliebigen Spatte des inters~itielten Gewebes vorhandene. DaG die Gesetze der Osmose am Auge volle Giiltigkei~ haben, beweisen bekgnntlich die wichtigen Ver- suohe ' l i e r t e l s , auf die ich friiher schon hinwies (v. Graefes Archly 9~, 63). - - Die Notwendigkeit eines stetigen, gegeniiber dem iibrigen Kiirpergew~be gesteiger- ten Abflusses yon Fliissigkeit aus dem Auge hat das Vorhandensein eines in dem- selben MaGe erfolgenden ~euersatzes zur Fotge. ~¥ir gelangen also auf Grund dieser (~berlegung (trotz der vorlaufig gemach~en ungtinstigen, durchaus unbe- wiesenen =4mnahme yon der UnmSglichkeit. elner l~il~ration) zu dem Ergebnis, da6 elne langsame F l i i s s i g k e i t s s t r S m u n g in L e b e r s Sinne im Auge vor- handen sein muG. -- Ausdriicklich sei noch darauf hingewiesen, daG die ver- gteichenden Untersuchungen zwischen osmotischem Druck des Kammerw~ssers and dem des Blutes diese Auffassung durchaus Ms zuli~ssig erscheinen lassen, da v. d. H o e v e (v. Gravfes Archly 8~) auf Grund der bisher vorliegenden sowie seiner eigenen Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangte, ,,dal~ bei l%indern und Kaninchen osmotischer Druck yon Augen~liissigkei~ und Blu~sertun nicht in festem Verhgltnis zueinander stehen, sondern dab bisweilen Augenftiissigkeitjbisweilen Blutserum hyperisotonisch ist", und ,,dab bisweilen Angenfliissigkeit hyperiso- tonisch sein kann an Arterien-, hypoisotonisch am Venenblutserum dessetben Tieres".
~04 :Erich Seidel: Weitere experimentelle Untersuehungen
I)a somit dutch Entleerun g der Vorderkam mer der ]Vie e h a n i s m u s des physiologischen Absonderungsvorgangs des Kammerwassers offen- siehflieh ~iefgreifend abgeEndert wird, so muB as eigen~lieh selbs~ver- stEndliah erseheinen, dab aueh da s P r o d u k t des gegentiber der Norm so abge~nderten Absonderungsvorgangs ebenfalls ein wesentlieh anderes is~. In dem gegenilber der Norm gesteigerten t~iweiB- nnd :F]uorescein- gehalt des regenerierten Xammerwassels offenbart sieh daher nut der in wiehtigen Teilen v e r g n d e r t e M e e h a n i s m u s in der Entstehungs- weise des Ciliarsekretes unter den gegenfiber der Norm, i~folge der Karamerpmak~ion, a b g e g n d e r t e n p h y s i k a l i s e h e n V e r h g l t n i s s e n . Die 1%iehtigkeig dieser, sieh auf Grund sehr einfaeher 10hysioIogiseher ~berlegungen yon selbst ergebenden Auffassung, wird nun dutch eine Reihe experimenteller Tatsaehen klar bewiesen. Dutch W e s s e l y s Adrenalinversuehl), sowie den yon mir erbraehten Naehweis yon der ehemisehen Iden~itgt des physiologisehen Ciliarsekretes mit dem nor- mMen Vorderkammerwasser2), sowie dureh den weiteren Naehweis yon dem sehr geringen ehemisehen Vntersehied des Ciliarsekretes gegen- fiber dem normalen Kammerwasser bei entspreeher~der sehr geri~ger Punktion der Vorderkammer.
I t iermit ist die zungehst yon t g h r l i e h auf G~nnd seiner F]nolescein- versuehe aufgestell4ce und spgter yon H a m b u r g e r aufgenomme~e Hypo~hese, dab d~r Ciliark6rper laur stark eiwaiB- und stark farbstoff- hMfiges Sekret tiefern kSnne, u~d deshalb a]s Sekretionsorgan des phy- siologischen Kammerwassers nieht in Betracht kEme (und dab deshalb die Funktion der physiologisahen Kammerwassersekretien der Izis- vorderf]~i, ahe zuzusehreiben sei), m i t S i c h e r h e i t a ls u n r i e h t i g e r w i e s e n , zumM ieh noeh den wei~eren Naehweis fiihren konnte~), dab aueh das naeh Aufhebung der Vorderkammer all der freigelegten Irisvorderf]~,che in minimalen Menge~ zutage t, retende Transsudat ebenfalls stark eiweighaltig ist. - -
Zum SehIuB noah einige Worte fiber den anatomisehen Ban der Gefiig- wand im CiliarkSrper und in der Iris.
Man hat mehrfaeh die AI~sieh~ gegul]ert, dab der Ciliark6rper des- halb kein Sekretiol~sorgan darstellen k S ~ e , weft er allgeblich im Gegen: satz zur Iris n u r v e n 6 s e GefgBe er~thalte. Obgle~eh nun ~ieht eili- zusehen ist, warum das Xamme~wssser mit seh~er ~n der tIauptsache optJsehen und statisehen Fu~ktion ~ieht ven6sen lJrspru~gs sein sollte, zumal doeh die gr6Bte Driise des K6~pers, die Leber, auf ven6se GeffiBe angewiesen ist, babe ieh doeh zur Beantwor~n~g dieser Frage anatom~sehe Untersuehm~gen vorge~?ommen.
~) Bericht iiber die 28. Vers. d. Ophth. Gesellseh. Heidelberg 1901, desgt. meine Bemerkungen dazu, v. Graefes Arehiv 9~. 17-~20.
~) v. Graefes Arehiv 9~, 11--14. z) v. Graefes Archly 9~, 14--17.
fiber die Quelle und den Verlauf der intraokularen Saftstr~mung. 405
Ausgehend von der leststehenden Tatsaehe, dab der arterie]le Cha- rakter eines Gefi~Bes sieh im anatomisehen Bilde seiner Hiillen, ngmlich in dem reiehliehen AuItreten elas~iseher Fasern, der ven0se dagegen in einer sehr geringen Ausbitdung oder Fehlen dieser etastischen EIe- mente, offenbart, nahm ich beim Kaninchen histotogisehe Unter- suehungen vor mit W e i g e r t s Elastinf~rbung.
Ieh land im Citiark6rper wie in der Iris zweierlei GefgBw~nde, ngmlieh solehe mit sehr reiehlich entwickelten und solche ohne nennens- werten Elastinfasergehalt, wobei ein aueh relatives (~[berwiegen der elastisohen Fasern in den Gefgl3wgnden der Iris keineswegs festzu- stellen war.
Aus diesen Belunden ziehe ieh den SchluB, dab die Natur der GefgBe in Iris und CfliarkOrper die gleiehe ist, und dab es daher nieht berechtigt ist, auf Grund gegenteiliger Behauptungen einem dieser Organe vor dem andern eine funktionelle Bedeutung zuzuerkennen bezw. abzusprechen.
Wit miissen somit feststellen~ dab alle Versuche, die yon Th. L e b e r gelehr~e funktionelle Bedeutung des CiliarkOrpers als physiologisches Sekretionsorgan als unriehtig zu beweisen, geseheitert sind, dab Beweise fiir die physiologisehe, sekretorisehe Tgtigkeit der Irisvorderflgehe yon nJemand bisher erbracht warden, und dab gerade die Effahrungen mit vitalen Farbstoffen eine wiehtige neue Stiitze flit die t~ichtigkeit yon L e b e r s Atfffassung veto intraokularen Fliissigkeitswechsel darstellen.
Es wird nun die Aufgabe tier folgenden Mitteilungen sein, auf Grund experimenteller Untersuehungen der letzten 2 Jahre zu zeigen, dal~ mehrere von gesieherter, breiter, physiologiseher Grundlage ausgehende ex]?erimentetle }Vege zu einer weiteren ganz wesentliehen Klgrung dieses fiir die Ophthalmologie so wiehtigen Problems fiihren und dabei hOchst interessante Einblieke in die am intakten Auge sieh abspielenden Lebens- vorg-gnge gestatten.
Erkl~irung zu den Abbildungen 1--7 auf Tafel X.
Die Linsen wurden auf weiBen U n t e r g r u n d gebracht und Abb. 2--7 bei hellstem Sonnenlieht, Abb. 1 bei kiinstlichem (elektrischem) IAcht in 2facher VergrSBerung gezeiehnet. :Die auI Abb. 2--7 d argestellten Linsen befanden sich dabei unter Wasser, die auf Abb. 1 dargestellte lag ffei an der Luft.
Abb. l. F~rbung der Linsenvorderfl~ehe 50 Min. nach Ersatz des Kammer- wassers durch Neutralrot 2 proz. (150 cram) am lebenden Kaninchen. -- Die Linse zeigt auf der Mitte ihrer Vorderfl~ehe einen intensiv roten, runden Fleck. It]eran sehtieSt sich eine matte Pmsa~.rbung direkt an, die sieh naeh dem Linsen~quator zu allmghlieh verliert, ohne denselben jedoeh zu erreiehen.
Abb. 2. Fgrbung der Linsenvordeffl~ehe 45 Min. naeh Ersatz des Karamer- wassers dureh Neutralrot 2 proz. am lebenden Kaninchen. -- Intensive Roffgrbung auf der ~fitte der Linsenvorderfl~ehe, Grenze nnr annghernd kreisfSrmig. Daran anschlieBend matte Rosafgrbung, die aber naeh verschiedenen Seiten ungleieh
406 Erich 8eidel: Weitere experimentelle Untersuchungen t~ber die Quelle usw.
stark entwiekelt ist. Der Linsengquator wird yon der Rosafgrbung nicht errelcht (Cilial~orts~ze blieben beim Herauslbsen im Zusammenhang mit der Linse).
Abb. 3. Fgrbung der Linsenvorderflgehe 30 Min. nach Ersatz des Kammer- wassers durch Neutralrot 2 proz. am lebenden Kaninehen. - - Intensive Retf~rbung a:tff der Linsenvorderfl~che (yon nur ann~hernd kreisfbrmiger ]3egrenzung), dib si6h in sehr zar~er t%osafarbung auf die loeripheren Teile der vorderen Linsenvorder- flEche fortsetzt.
Abb. 4. F'grbung der Linsenvorderfl~ehe 30 t~fin, naeh Ersatz des Kammer- wassers durch Neutralrot 2 proz. am 10 Min. vorher dutch Verbtuten ge~StctenKanin- chen. -- Auf der Mitre der Linsenvorderflache nahezu runder, starker, jedoeh nicht gleiehm/il]ig gef/~rbter toter Fleck. Die iibrige Lir~senvorderfl~chelzeigt m~tte Rosafgrbung, die sieh jedoch n i c h t t ibera l l u n m i t t e l b a r an den ze~tralen ro~en Fleck ~nschlieBt, sondern yon einer schmalen, ungef/~rbt erscheinenden, ringf6rmigen Zone yon diesem getrennt ist, die nur an 2 Sietlen yon 2 mattrosa- gef~rbten Farbstoffstrat~en iibersehri~ten wird, die die Verbindung zwisehen der zentralen stgrkeren und der peripheren, sich nach dem Xquator zu allmghlich verlierenden, viet schw~cheren Fgrbung darstellen.
Abb, 5. F~rbung der Linsenvorderftgche 52 Min. n~eh Ersatz des Kamraer- wassers durch Neutr~lrot 2 proz. am 10 Min. vorher durch Verbluten getSteten Kaninehen. -- Auf der Mitre der Linsenvorderflgche runder, intensiv rotgefg.rbter Fleck, dessert Gl'enze teitweise mit sehws~rzen Pigmentpunkten besetz~ ist (post- mortal entst~ndene hintere Synechien !). Die iibrige Linsenvorderflgche ist bis zum _~quator ziemlich kr~ftig ros~gefgrbt (Ciliar~orts~tze blieben beim HerauslSsen im Zusammenha~ng mit der Linse).
Abb. 6. Fgrbung der Linsenvorderfl~che 50 Min. nach Ersatz des Karamer- wassers dureh NeutralroC 2 proz. am lebenden Kaninchen. -- Zentrnler roter, nahezu kreisrunder Fleck, der dutch eine striehfSrmige schmate, r~di~tr gelegene, viel sehw~cher ge~/~rbte Zone unterbrochen ist. An die Grenze des zentralen r0ten Fleckes sehlie~t sieh unmittelbar eine sehr matte Rosafgrbtmg der Linsenvorder- flache an, die sieh nach dem Xquator zu unmerktieh verliert. (Bringt man d~s Pr~parat auf schwarzen Grund, d~nn nimmt die Linse einen leicht opalescierenden Farbenton an und die periphere matte Rosafgrbung verschwindet vollstandig, am erst auf wei~em Un~ergrtmd wieder deutheh hervorzutreten.)
Abb. 7. F~rbung der Linsenvorder~l~che 46 Min. nach Ersatz des Kammer- w~ssers dutch Neutralrot 1 proz. am lebenden Kaninchen. -- Zentraler, intensiv ro~gefgrbt~r, n~hezu kreisrunder Fleck, der dutch eine schmale, radigr getegene, schw~cher gef~rbte Zone unterbrochen ist. Unmittelbar daran ansehhe~end matte, nach verschiedenen t~ichtungen bin verschieden starke Rosg~rbung, die sich nach dem Linsengquator zu allmahlieh verliert. (Die periphere matte l~os~f~rbung, nur auf weil~em Untergrusd siehtb~r, versehwindet auf schwarzer Unterl~ge.)