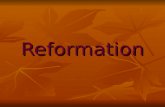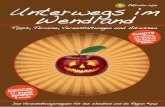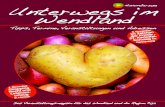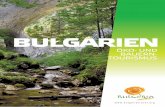WENDLAND NET Wir haben es satt! Bauern starten …€¦ · Auch im Wendland macht die...
Transcript of WENDLAND NET Wir haben es satt! Bauern starten …€¦ · Auch im Wendland macht die...
WENDLAND NET
"Wir haben es satt!" Bauern starten große Protest-Sternfahrt
Bis zum Kanzleramt nach Berlin wollen Landwirte aus ganz Deutschland ziehen, um
dort ihre Forderung an Bundeskanzlerin Merkel, die industrielle Agrarwirtschaft zu
stoppen, vehement vorzubringen. Auch im Wendland macht die Bauern-Sternfahrt
Stopp: am 3. und 4. Juni.
Nach der großen Demonstration
für eine neue Agrarpolitik am 22.
Januar 2011 in Berlin, machen
sich am 29. Mai 2011 Bäuerinnen
und Bauern mit ihren Traktoren
aus Süddeutschland und
Ostfriesland auf den Weg, um am
9. Juni in Berlin für eine
bäuerliche, faire, tiergerechte und
ökologische
Landwirtschaftspolitik vors
Kanzleramt in Berlin zu ziehen.
Start ist um 10 Uhr im Hafen von
Greetsiel/ Ostfriesland und auf dem Auerberg bei Marktoberndorf im Allgäu. Weitere Routen
aus Hessen und Mecklenburg-Vorpommern folgen in den nächsten Tagen, kündigte die
Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirte (AbL) an.
Die Bauernsternfahrt im Rahmen der Kampagne „Meine Landwirtschaft – unsere Wahl“ zieht
unter dem Motto „Frau Merkel - Mut zum Umdenken! Industrielle Landwirtschaft stoppen!
Die Zukunft ist bäuerlich-ökologisch-fair“ bis vors Kanzleramt. Unterwegs machen die
Sternfahrer Station an „Denkmälern einer sich industrialisierenden Landwirtschaft“, wie
beispielsweise dem sich in Planung befindenden Hähnchenschlachthof im niedersächsischen
Wietze (432 000 Hühnchen am Tag), der geplanten riesigen Schweinemastanlage in Haßleben
(Sachsen-Anhalt/ 85 000 Tierplätze), Europas größtem Schlachthof für Schweine in
Weißenfels (geplante Erweiterung auf 20 000 Schweine am Tag) bei Leipzig und dem
Gentechnikschaugarten in Üplingen.
Die Sternfahrerinnen und -fahrer sind aber auch unterwegs, um beim Bauerntag des
Niedersächsischen Landvolkverbands in Cloppenburg, beim Evangelischen Kirchentag in
Dresden und vielen weiteren Veranstaltungen in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern für
eine Neuausrichtung der Agrarpolitik zu werben.
Im Wendland machen die Sternfahrer am 3. und 4. Juni Station: für Freitag, den 3. Juni ist um
20.00 Uhr eine Diskussion mit dem Thema " „Warum wir eine Andere Agrarpolitik brauchen
- Sternfahrer im Gespräch mit Wendlandbauern“ geplant. (Quickborn, Gaststätte Jägerhof)
Am Samstag, dem 4. Juni sind die Landwirte den ganzen Tag am geplanten Atom-Müll-
Endlager in Gorleben zu finden.
Am 9. Juni ist die Abschlussveranstaltung Bauerntafel: "Angela, wir müssen reden" von 10
bis 12 Uhr vor dem Kanzleramt.
Hier gehts zum Mobilisierungsvideo der Bauern - und hier gibt es den gesamten Routenplan
inkl. Ansprechpartnern zum Downloaden.
Foto: Aus dem Mobilisierungsvideo zur Bauern-Sternfahrt
von Angelika Blank , 2011-05-24 15:28
Proplanta ® | 30.05.2011 |
Agrarpolitik >>
Deutschland
Bauernsternfahrt nach Berlin gestartet
Auerberg/Greetsiel - Mit jeweils mehr als 200 Teilnehmern bei den beiden
Auftaktveranstaltungen ist gestern Mittag die Bauernsternfahrt von Auerberg
im bayerischen Allgäu und vom Fischerdorf Greetsiel an der ostfriesischen
Nordseeküste gestartet.
Begleitet von mehreren geschmückten Traktoren haben sich aus
beiden Orten zwei Traktoren auf den über zehntägigen Weg nach
Berlin bis vor das Kanzleramt gemacht.
"Frau Merkel, die bäuerliche Landwirtschaft, die dieser Region
das typische Gesicht gibt, muss erhalten werden. Dazu braucht es
eine grundlegend andere Agrarpolitik. Deshalb sind wir nun
unterwegs", so Jan Wendel, Sternfahrer und Studierender der
Agrarwissenschaften in Kassel. "Die Bundesregierung ist
maßgeblich verantwortlich dafür, wie die anstehende Reform der
EU-Agrarpolitik ausfallen wird. Weil uns das alle etwas angeht
und keine Sache der Hinterzimmer sein darf, mischen wir uns aktiv
in diesen Prozess ein", so Wendel weiter. "Wer weiter auf
agrarindustrielle Strukturen setzt, entzieht den Bäuerinnen und Bauern die
Existenzgrundlagen, wie das in viele Regionen Europas leider jetzt schon der Fall ist. Um
diesen Prozess zu stoppen, fahren wir nach Berlin."
"Die Reform der EU-Agrarpolitik darf sich nicht auf das Geld beschränken. Wir brauchen
vernünftige Rahmenbedingungen für den Markt. Wir Bauern wollen nicht von staatlichen
Direktzahlungen abhängig sein, sondern von den Erlösen für unsere Erzeugnisse leben
können", so Karin Mannsholt, Vertreterin des BDM Niedersachsen in Greetsiel. "Wir streiten
für faire Preise und für politische Rahmenbedingungen, die das ermöglichen", machte
Romuald Schaber, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter in
Auerberg deutlich. "Das können wir nur durch dieses starke Bündnis aus Bauern,
Verbrauchern, Umweltschützern und Eine-Welt-Organisationen erreichen. Deswegen sind
wir sehr froh um die breite Unterstützung von 33 Organisationen im Bündnis "Meine-
Landwirtschaft.de". Denn die Landwirtschaftspolitik in Europa ist entscheidend für das
Überleben unserer Bauern, aber auch unseres Planeten.
"Die bisherige Agrarpolitik haben wir satt", so Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland auf dem Auerberg. "Sie zerstört nicht nur bäuerliche
Existenzen, sondern sie schadet auch unserem Klima, unserer Umwelt und verursacht
dadurch hohe gesellschaftliche Kosten. Wir wollen und wir können uns diese verfehlte
Agrarpolitik nicht mehr erlauben. Ein Systemwechsel hin zu bäuerlich-ökologischer
Landwirtschaft ist dringend notwendig. Deswegen unterstützen wir die Bauernsternfahrt."
Auch die Küstenfischer an der Nordseeküste brauchen einen Fairen Markt für ihre Krabben.
Deswegen haben sie mehreren Wochen gestreikt. "Wer weiter unsere Preise ruiniert, wird
bald keine Kutter mehr in diesem idyllischen Hafen einlaufen sehen und keine Kuh mehr hier
auf der Weide sehen", so Dirk Sander, Vertreter der Norddeutschen Fischer beim Sternfahrt-
Auftakt in Greetsiel.
Die Sternfahrt ist eine Aktion der Kampagne "Meine Landwirtschaft - unsere Wahl"
www.meine-landwirtschaft.de. Diese sendet Videobotschaften, die an an die Kanzlerin
gerichtet sind und am 9. Juni 2011 in Berlin auf einer Großleinwand vor dem
Kanzleramt gezeigt werden. (AbL)
Kreiszeitung
Tierschutz: Land will Dialog mit Bauern / Landvolk fordert weniger Emotionen
„Man fühlt sich an den Pranger gestellt“
31.05.11|Niedersachsen
Niedersachsen - CLOPPENBURG · Bei der Umsetzung des neuen Tierschutzplans setzt die
niedersächsische Landesregierung auf einen Dialog mit den Landwirten. Die Agrarwirtschaft
solle dabei konstruktiv mitwirken, sagte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Gert
Lindemann (CDU) gestern auf dem Landesbauerntag in Cloppenburg.
Agrarminister Gert Lindemann (r, CDU) diskutiert mit Wolfgang Apel, Präsident des
Deutschen Tierschutzbundes. ·
„Nur eine Lösung, die praxistauglich ist, kann den Tierschutz wirklich voranbringen.“
Ministerpräsident David McAllister (CDU) betonte, der ländliche Raum sei das Rückgrat des
Landes. Aber Nutztierhaltung könne auf Dauer nur erfolgreich betrieben werden, wenn sie
gesellschaftlich akzeptiert werde. Und jeder Verstoß gegen Tierschutz schade letztlich dem
Ruf der Landwirtschaft.
Landvolk-Präsident Werner Hirse sagte zu dem 38-Punkte-Plan der Landesregierung, er
hoffe, dass darüber ergebnisoffen diskutiert werde. Er erwarte in der Tierschutzdiskussion
weniger Emotionen. Das Thema werde von Angst gesteuert, bei den Verbrauchern von der
Angst um Umwelt, Tierwohl und Lebensmittelsicherheit und bei den Bauern von Angst um
die Zukunft und Existenz ihrer Betriebe.
„Man fühlt sich an den Pranger gestellt“, sagt Landwirtin Clara Rolfes. Die junge Frau
arbeitet in einem Familienbetrieb mit Großeltern und Eltern – ein Hof mit 4 500 Schweinen
und Ackerbau. „Moderne Stallgebäude haben Lüftung, Wasser, Licht“, sagt sie und zeigt auf
ein Transparent „Kein Platz. Kein Licht. Kein Leben. Stoppt Tierfabriken“.
Der Deutsche Tierschutzbund demonstrierte vor dem Landesbauerntag für artgerechte
Tierhaltung und den Erhalt bäuerlicher Strukturen. Wolfgang Apel, Präsident des
Tierschutzbundes, betonte, „es kann nicht so bleiben, wie es ist“. Er forderte Lindemann auf,
konsequent den Weg zu mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung zu gehen.
Der 38-Punkte-Plan soll bis 2018 abgearbeitet sein. Erste Maßnahmen sollen bereits in diesem
Jahr greifen. Dazu zählen unter anderem Eingriffe an Nutztieren ohne Betäubung wie das
Kastrieren männlicher Ferkel und das Kupieren der Schwänze bei Schweinen. „Ohne der
Diskussion vorweg zugreifen – für mich steht fest: Das Schnabelkürzen bei Puten und die
Kastration bei Ferkeln ohne Betäubung sind mit meinen ethischen Maßstäben nicht
vereinbar“, erklärte McAllister.
Niedersachsen ist das Agrarland Nummer eins. Rund 2,6 Millionen Rinder, 8,2 Millionen
Schweine, 50 Millionen Hühner und 5,3 Millionen Puten werden gehalten. · dpa
DPA
Bauern-Sternfahrt macht Station in Hannover
Mittwoch, 01. Juni 2011, 16:25 Uhr
Hannover (dpa/lni) - Bei einer Protest-Sternfahrt nach Berlin haben Bauern am Mittwoch in
Hannover Station gemacht. Unter dem Motto «Wir haben es satt» forderten sie von der
Bundesregierung eine neue Ausrichtung der Agrarpolitik, die fair, tiergerecht und ökologisch
sein soll. Die Landwirte hatten auf ihren Traktoren Plakate mit Aufschriften wie «Gegen
Tierfabriken», «Milchproduktion nach Maß - nicht maßlos» und «Bauernhöfe statt
Agrarindustrie» angebracht. Die Landtagsfraktion der niedersächsischen Grünen unterstützte
die Sternfahrt. Landwirte, Verbraucher, Umwelt- und Tierschützer zögen für eine nachhaltige
Entwicklung an einem Strang, erklärten die Grünen. Die Sternfahrt, an der sich mehr als 30
Verbände beteiligen, endet am 9. Juni in Berlin vor dem Kanzleramt.
HAZ
01.06.2011 21:07 Uhr
Sternfahrt
Bauern fordern in Hannover neue Agrarpolitik Bei einer Protest-Sternfahrt nach Berlin haben Bauern am Mittwoch in Hannover Station
gemacht. Unter dem Motto „Wir haben es satt“ forderten sie von der Bundesregierung eine
neue Ausrichtung der Agrarpolitik.
© Thomas
Bei einer Protest-Sternfahrt nach Berlin haben Bauern am Mittwoch in Hannover Station
gemacht. Unter dem Motto „Wir haben es satt“ forderten sie von der Bundesregierung eine
neue Ausrichtung der Agrarpolitik, die fair, tiergerecht und ökologisch sein soll. Die
Landwirte hatten auf ihren Traktoren Plakate mit Aufschriften wie „Gegen Tierfabriken“,
„Milchproduktion nach Maß - nicht maßlos“ und „Bauernhöfe statt Agrarindustrie“
angebracht.
Die Landtagsfraktion der niedersächsischen Grünen unterstützte die Sternfahrt. Landwirte,
Verbraucher, Umwelt- und Tierschützer zögen für eine nachhaltige Entwicklung an einem
Strang, erklärten die Grünen. Die Sternfahrt, an der sich mehr als 30 Verbände beteiligen,
endet am 9. Juni in Berlin vor dem Kanzleramt.
dpa
NDR
Stand: 01.06.2011 19:03 Uhr
Protestfahrt für mehr Artenvielfalt bei Bauernhöfen
Am Mittwoch machte der norddeutsche Teil der
Sternfahrt in der hannoverschen Altstadt an der Marktkirche Station. Tomaten, Salat oder
Gurken kommen aufgrund der EHEC-Gefahr bei vielen derzeit nicht mehr auf den Tisch.
Doch auch unabhängig von immer neuen Lebensmittel-Skandalen fordern immer mehr
Menschen ein Umdenken bei der landwirtschaftlichen Produktion. Ein Zusammenschluss von
Landwirtschafts-, Natur- und Tierschutzverbänden organisiert derzeit vier bundesweite
Sternfahrten in Richtung Berlin, um einen Wechsel in der Agrarpolitik zu erreichen. Am
Mittwoch machte der norddeutsche Teil der Sternfahrt in der hannoverschen Altstadt an der
Marktkirche Station.
"Faire Preise für faire Milch"
Um 12.00 Uhr mittags rollten mehrere Trecker auf den Marktkirchenplatz. Einige hatten
Motivwagen angehängt, auf denen unter anderem Modell-Kühe in Deutschlandfarben zu
sehen waren. Dazu gab es Transparente und Plakate mit Aufschriften wie "Faire Preise für
faire Milch" und "Agrarindustrie zerstört Bauern und Vieh".
"Agrar-Exporte setzen unsere Projekte unter Druck"
Auch Uwe Becker von 'Brot für die Welt' nimmt an der Sternfahrt nach Berlin teil. Er
kritisiert vor allem die Agrar-Exporte.
Mehr regionale Landwirtschaft
Die Initiatoren der Sternfahrt fordern von der Bundesregierung und der Europäischen Union
einen gravierenden Kurswechsel: Weg von der Förderung von Agrarfabriken und
Massentierhaltung - hin zu einer bäuerlichen, regionalen Landwirtschaft. Es müsse sich
dringend etwas ändern, selbst bei ökologisch hergestellten Lebensmitteln gehe der Trend zur
globalen, industriellen Produktion, warnt Mitinitiatorin und Milchviehhalterin Johanna Böse-
Hartje.
Am Donnerstag macht die Sternfahrt in Wietze im Landkreis Celle Station, um dort gegen
den Bau des Geflügelschlachthofes zu protestieren.
Ostsee-Zeitung
dpa vom 01.06.2011 17:15
Trecker-Sternfahrt für bäuerliche Landwirtschaft
Schwerin (dpa/mv) - «Mit dem Traktor nach Berlin», heißt es in den kommenden Tagen für
Bauern aus mehreren Bundesländern. Sie wollen am 9. Juni vor dem Kanzleramt für eine
bäuerliche, faire, tiergerechte und ökologische Landwirtschaft demonstrieren, wie die
Umweltorganisation BUND als Mitveranstalter am Mittwoch in Schwerin mitteilte. In
Mecklenburg-Vorpommern starten Bauern am Samstag in Rostock. Zum Auftakt ist eine
Kundgebung geplant. Der BUND- Agrarexperte Burkhard Roloff sagte, die bisherige
Agrarpolitik zerstöre bäuerliche Betriebe, schade dem Klima und der Umwelt und verursache
dadurch hohe gesellschaftliche Kosten. «Ein Systemwechsel hin zu bäuerlich-ökologischer
Landwirtschaft ist dringend notwendig.»
MERKUR
Schlepper-Sternfahrt vom Auerberg nach Berlin
29.05.11|Bernbeuren
Bernbeuren - Mit einer Schlepper-Sternfahrt bis nach Berlin, die auf dem Auerberg bei
Bernbeuren gestartet wurde, werben Landwirte und Milcherzeuger für eine Neuausrichtung
der Agrarpolitik.
Das Motto der Bauern-Sternfahrt „Wir machen uns auf den Weg für eine bäuerliche
Landwirtschaft zum Wohle Aller“ sagt eigentlich alles - Veränderung muss her, der
Vormarsch der agrarindustriellen Produktion muss gestoppt werden. Die Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und der BDM Ostallgäu haben dazu die
Auftaktveranstaltung mit Gottesdienst, Gastrednern und dem Startschuss der Sternfahrt mit
rund 30 Traktoren, drei Autos und zwei Fahrrädern auf dem Auerberg organisiert.
Pfarrer Rainer Remmele ging in der Auerbergkirche der Frage nach: „Und was wird aus mir?“
Das Gefühl, einen solchen Aufschrei machen zu müssen, hätten Menschen, deren Leben
bedroht ist. Menschen, die in einer Minderheit leben, die nicht ernst genommen und nicht
wertgeschätzt werden. Remmele forderte die anwesenden Bauern, und Verbraucher auf, „ein
klares Ja zum Schutz der Arten“ zu geben.
Anschließend sprachen Vertreter verschiedener Interessensgruppen und riefen zur
Zusammenarbeit auf. Bayerns Landesvorsitzende der AbL, Edith Lirsch, führte durchs
Programm und war überwältigt von den gut 200 Zuhörern. Jan Wendel von der jungen AbL,
der maßgeblich an den Vorbereitungen der Südroute mitgewirkt hatte, freue sich schon auf
das Zusammentreffen mit Angela Merkel. Auf den vier Routen ins Kanzleramt nach Berlin
warten 50 Veranstaltungen auf die Sternfahrer, die unterwegs sind, für eine Neuausrichtung
der Agrarpolitik zu werben. Unterstützung gibt es vom BDM, Misereor, Bioland, Demeter
und anderen Organisationen.
BDM-Chef Romuald Schaber wünschte den Sternfahrern viel Glück auf ihrem Weg, denn es
„geht um die Lebensgrundlage der kommenden Generationen“. Der Präsident des
Europäischen Berufsimkerverbandes, Walter Haefeker, sprach über die Bemühungen,
Gentechnik in Deutschland und der EU zu verhindern. Derzeit werde ein Urteil des EUGH
erwartet, welches beim Sieg der Imker eine Schutzzone von zehn Kilometern um jeden
Bienenstock in Europa bedeuten würde, da Bienenerzeugnisse besonders von gentechnisch
veränderten Pflanzen beeinflusst würden.
Im Rahmen der Veranstaltung kam auch eine Meldung aus Greetsiel in Ostfriesland am
Auerberg an, nachdem sich dort rund 200 Menschen versammelt und 30 bis 40 Schlepper
Richtung Kanzleramt aufgemacht hatten. Dort wird die Kanzlerin zwei Tage nach Ankunft
der Bauern-Sternfahrt am 9. Juni für ein Gespräch zur Verfügung stehen.
Zum Abschluss erläuterte der 77-jährige Walter Mauk aus Eurasburg (Kreis Bad Tölz-
Wolfratshausen) seine Beweggründe, mit dem Traktor nach Berlin zu fahren. Es müsse ein
Zeichen gesetzt werden, denn „es ist unchristlich, an der Börse auf Lebensmittel zu
spekulieren, Importe aus Übersee zu holen und mit der Überproduktion die Bauern in Afrika
und Indien kaputtzumachen“, sagt er. Danach machten sich die Sternfahrt-Teilnehmer zur
Musik der Oberland-Kapelle auf den Weg Richtung Marktoberdorf und weiter bis nach Ulm,
dem Ziel der ersten Etappe.
RADIO GONG
Kitzingen: Bauernsturm macht Halt in Kitzingen
02.06.11 - 07:36 Uhr
Foto: Anne Millanovic
Eine zehnköpfige Gruppe von Bauern aus dem Allgäu hat auf ihrer
Sternfahrt nach Berlin am Mittwoch in Kitzingen halt gemacht. Die
Landwirte sind unter dem Motto „Wir haben es satt!“ auf ihren
Trekkern nach Berlin unterwegs. Dort wollen sie an höchster Stelle für
Artenvielfalt und faire Bedingungen in der Landwirtschaft werben.
Bei der Kundgebung auf dem Platz der Partnerstädte wurden die
Sternfahrer von regionalen Bauern aus dem Landkreis Kitzingen
unterstützt. Besonders bitter beklagten die Landwirte, dass kleinere
bäuerliche Betriebe immer öfter von der Landkarte verschwinden und
einer regelrechten Agrarindustrie weichen müssen. Am 9. Juni treffen
alle Teilnehmer der Sternfahrt in Berlin ein. Dort hoffen sie auf ein
Gespräch mit der Kanzlerin.
MZ
1.6.2011
Burgenlandkreis
Traktoren rollen bis zum Kanzleramt VON HEIKE RIEDEL, 01.06.11, 20:15h, aktualisiert 01.06.11, 21:35h
WEISSENFELS/ZEITZ/MZ. Am 7. Juni macht eine Bauernsternfahrt zum Kanzleramt in
Weißenfels Station. An Europas größtem Schweine-Schlachthof wollen Teilnehmer aus Süd-
und Mitteldeutschland gemeinsam mit der Bürgerinitiative Pro Weißenfels ihre Forderungen
nach einer bäuerlichen, fairen, tiergerechten und ökologischen Landwirtschaftspolitik
festmachen.
Es wird nur eine kleine Gruppe sein, sagt Lea Unterholzner vom Presseteam der Sternfahrt.
Seit dem 29. Mai sind aber Traktoren aus vier Richtungen zur Fahrt nach Berlin
aufgebrochen. Sie wollen den Forderungen der Demonstration von 20 000 Bäuerinnen und
Bauern im Januar vor dem Kanzleramt Nachdruck verleihen. Ihnen geht es um die
Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik und einen Systemwechsel in der Landwirtschaft. "Weg
von der Industrialisierung hin zur bäuerlich-ökologischen Landwirtschaft. Die Agrarreform
2013 bietet die Chancen", sagt Unterholzner, die Mitglied der jungen Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (ABL) ist. Diese Organisation habe gemeinsam mit dem Bund
Deutscher Milchviehhalter (BDM) Niedersachsen die Aktion ins Leben gerufen. Aus ihrer
Sicht vertrete die Bundesregierung die Interessen der Agrarindustrie und Großgrundbesitzer
und nicht die der bäuerlichen Betriebe.
"Wir wollen mit der Sternfahrt die Debatte um die zukünftige Landwirtschaft in die
Bevölkerung tragen", sagt Claudia Gerster vom Sonnengut in Dietrichsroda, einem Hof mit
100 Hektar Ackerland und 30 Hektar Wiesen und Weiden. Weil sie auch zukünftig noch
naturnah und nachhaltig Lebensmittel herstellen will, unterstütze sie die Aktion in Thüringen
und in unserer Region. Doch sie gehört damit zu einer Minderheit unter den hiesigen
Landwirten. Denn nur wenige sind in der ABL oder im BDM organisiert, die Mehrzahl im
Bauernverband. Und der hält sich mit Äußerungen zu der Aktion zurück. "Wir müssen erst
einmal abwarten, was in Brüssel herauskommt", sagt Bernd Schunke vom Kreisverband
Sachsen-Anhalt Süd. "Es bringt nichts, gewachsene effektive Strukturen zu zerschlagen", lässt
sich Hans Schulze vom Burgenlandkreisbauernverband entringen.
Deutlich das Wort ergreift hingegen eine Nicht-Bäuerin, Nicole Reppin vom Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Bürgerinitiative Pro Weißenfels. Sie
hat in Weißenfels die Aktion am Dienstag früh vor dem Tönnies-Schlachthof in Regie. In
einer Videobotschaft will sie den Bauern den Protest gegen das Unternehmen mit auf den
Weg nach Berlin geben. "Kleine und mittlere Strukturen sind gesund in der Kette der
Lebensmittelproduktion", sagt sie. Der Schlachthof sei in seiner Größe ein Krebsgeschwür für
die Landwirtschaft. Es laufe etwas schief, wenn ein Betrieb 20 000 Schweine täglich
schlachten dürfe und für die Erweiterung noch Fördermittel erhalte. Ein überdimensionierter
Schlachthof ziehe überdimensionierte Tierhaltung nach und Umweltschäden.
HNA Bauern-Fahrt macht Halt in Witzenhausen
<p>Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames
anzeigen</p>101.06.11|Witzenhausen
Witzenhausen. Traktoren werden am Samstag, 4. Juni, gegen 18 Uhr den Marktplatz von
Witzenhausen besetzen. Auf einer Sternfahrt von Wiesbaden nach Berlin wollen Bauern aus
Hessen hier Station machen und in einer Kundgebung über ihre politischen Ziele informieren.
„Wir haben es satt!“ lautet das Motto der Bauern-Sternfahrt auf vier Routen zum Kanzleramt
in der Bundeshauptstadt, wo für einen Systemwechsel – „weg von der Industrialisierung der
Landwirtschaft hin zur bäuerlich-ökologischen Landwirtschaft“ – demonstriert werden soll.
Die Sternfahrt ist eine Aktion der bundesweiten Kampagne „Meine Landwirtschaft – unsere
Wahl“. Am Samstag macht die in Wiesbaden gestartete Tour zunächst in Kassel Station, wo
von 10 bis 16 Uhr auf dem Königsplatz ein „Markt der Initiativen“ veranstaltet wird“ Das soll
es dann von 18 bis 20 Uhr auch in Witzenhausen geben.
Nach einem Grußwort von Bürgermeisterin Angela Fischer (CDU) stehen Reden von
Biolandbauer Hans-Jürgen Müller (Gut Fahrenbach), Heinfried Emden (Bundesverband
Deutscher Milchviehhalter) und Henrik Maaß (Junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft) auf dem Programm. Zudem gibt es Unterhaltung durch eine Samba-
Trommelband und Informationen zur Umkehr in der Landwirtschaftspolitik an mehreren
Ständen. (sff)
Hier können Sie Pressefotos für Ihre Berichterstattung einsehen. Wenn Sie Bilder in
druckfähiger Auflösung benötigen, wenden Sie sich bitte an fritz(at)wir-haben-es-satt.de oder
info(at)bauernsternfahrt.de
Pressemitteilung, Auerberg / Greetsiel, 29.05.2011
Bauernsternfahrt "Meine Landwirtschaft",
Bauern sind auf dem Weg
Bauernsternfahrt mit beeindruckendem Auftakt an Nordsee und im Allgäu nach Berlin
gestartet. "Meine Landwirtschaft - die es zu erhalten gibt"
(Auerberg/ Greetsiel/29.Mai 2011)Mit jeweils mehr als 200 Teilnehmern bei den beiden
Auftaktveranstaltungen ist heute Mittag die Bauernsternfahrt von Auerberg im bayerischen
Allgäu und vom Fischerdorf Greetsiel an der ostfriesischen Nordseeküste gestartet. Begleitet
von mehreren geschmückten Traktoren haben sich aus beiden Orten zwei Traktoren auf den
über zehntägigen Weg nach Berlin bis vor das Kanzleramt gemacht.
"Frau Merkel, die bäuerliche Landwirtschaft, die dieser Region das typische Gesicht gibt,
muss erhalten werden. Dazu braucht es eine grundlegend andere Agrarpolitik. Deshalb sind
wir nun unterwegs", so Jan Wendel, Sternfahrer und Studierender der Agrarwissenschaften in
Kassel. "Die Bundesregierung ist maßgeblich verantwortlich dafür, wie die anstehende
Reform der EU-Agrarpolitik ausfallen wird. Weil uns das alle etwas angeht und keine Sache
der Hinterzimmer sein darf, mischen wir uns aktiv in diesen Prozess ein", so Wendel weiter.
"Wer weiter auf agrarindustrielle Strukturen setzt, entzieht den Bäuerinnen und Bauern die
Existenzgrundlagen, wie das in viele Regionen Europas leider jetzt schon der Fall ist. Um
diesen Prozess zu stoppen, fahren wir nach Berlin."
"Die Reform der EU-Agrarpolitik darf sich nicht auf das Geld beschränken. Wir brauchen
vernünftige Rahmenbedingungen für den Markt. Wir Bauern wollen nicht von staatlichen
Direktzahlungen abhängig sein, sondern von den Erlösen für unsere Erzeugnisse leben
können.", so Karin Mannsholt, Vertreterin des BDM Niedersachsen in Greetsiel. "Wir streiten
für faire Preise und für politische Rahmenbedingungen, die das ermöglichen", machte
Romuald Schaber, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter in
Auerberg deutlich. "Das können wir nur durch dieses starke Bündnis aus Bauern,
Verbrauchern, Umweltschützern und Eine-Welt-Organisationen erreichen. Deswegen sind
wir sehr froh um die breite Unterstützung von 33 Organisationen im Bündnis "Meine-
Landwirtschaft.de". Denn die Landwirtschaftspolitik in Europa ist entscheidend für das
Überleben unserer Bauern, aber auch unseres Planeten.
"Die bisherige Agrarpolitik haben wir satt", so Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland auf dem Auerberg. "Sie zerstört nicht nur bäuerliche
Existenzen, sondern sie schadet auch unserem Klima, unserer Umwelt und verursacht
dadurch hohe gesellschaftliche Kosten. Wir wollen und wir können uns diese verfehlte
Agrarpolitik nicht mehr erlauben. Ein Systemwechsel hin zu bäuerlich-ökologischer
Landwirtschaft ist dringend notwendig. Deswegen unterstützen wir die Bauernsternfahrt."
Auch die Küstenfischer an der Nordseeküste brauchen einen Fairen Markt für ihre Krabben.
Deswegen haben sie mehreren Wochen gestreikt. "Wer weiter unsere Preise ruiniert, wird
bald keine Kutter mehr in diesem idyllischen Hafen einlaufen sehen und keine Kuh mehr
hier auf der Weide sehen", so Dirk Sander, Vertreter der Norddeutschen Fischer beim
Sternfahrt-Auftakt in Greetsiel.
Die Sternfahrt ist eine Aktion der Kampagne "Meine Landwirtschaft - unsere Wahl"
www.meine-landwirtschaft.de. Diese sendet Videobotschaften, die an an die Kanzlerin
gerichtet sind und am 9. Juni 2011 in Berlin auf einer Großleinwand vor dem Kanzleramt
gezeigt werden.
Alle Informationen unter: www.bauernsternfahrt.de
Tourdaten im Detail: www.meine-landwirtschaft.de/sternfahrt/route.html
Sternfahrt-Presseteam:
Jochen Fritz: 0171-8229719, [email protected]
Lea Unterholzner: 0176-70408888, [email protected]
Pressebilder: www.meine-landwirtschaft.de/sternfahrt/presse/pressefotos.html
Kontakt:
Bauern-Sternfahrt: Wir haben es satt!, c/o INKOTA-netzwerk e.V., Chrysanthemenstr. 1-3,
10407 Berlin-Lichtenberg Fon: 030-420820259, Fax: 030-420820210, Email:
------------------------------
AbL - Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V.
Bahnhofstraße 31
D - 59065 Hamm/Westf.
Tel.: 02381-9053171
Fax: 02381-492221
NWZ 26. Mai 2011
Auf Sternfahrt Protest gegen Fehlentwicklungen in der Agrarpolitik
von Hartmut Kern
FRAGE: Frau Mansholt, worauf wollen Sie mit der am 29. Mai geplanten Sternfahrt von
Greetsiel nach Berlin aufmerksam machen?
MANSHOLT: Die Fahrt steht unter dem Motto „Angela, wir müssen reden!“ und es geht
darum, deutlich zu machen, dass wir in Deutschland eine andere und bessere Agrarpolitik
brauchen.
FRAGE: Welche Versäumnisse werfen Sie der Bundesregierung vor?
MANSHOLT: Die Politik zielt immer noch zu sehr auf Industrialisierung ab. Was wir aber
benötigen, ist eine Nachhaltigkeit vor kurzfristigem Gewinnstreben. Wir fordern daher faire
Marktbedingungen für alle.
FRAGE: Was bedeutet das in der Praxis?
MANSHOLT: Um auf Augenhöhe verhandeln zu können, müsste zum Beispiel die
Marktstellung der Milchbauern gestärkt werden. Neu geordnet werden müsste auch die
Verteilung der Agrarsubventionen innerhalb der EU mit einer sozialen Ausgewogenheit.
Noch immer werden Konzerne unverhältnismäßig stark unterstützt.
FRAGE: Wer beteiligt sich an der Protestaktion ab 29 . Mai?
MANSHOLT: Mittlerweile sind es 31 Verbände von der Kirche über den Naturschutz, die
Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, den Bundesverband deutscher Milchviehalter
und Hilfsorganisationen, wie Brot für die Welt und Misereor, bis hin zum Bund für Umwelt
und Naturschutz sowie Naturschutzbund. Schließlich beteiligen auch die Krabbenfischer und
Mitglieder der Antiatomkraft-Bewegungen. Auf der Fahrt werden wir auch die Käserei des
Deutschen Milchkontors in Edewecht und den Bauerntag in Cloppenburg besuchen.
FRAGE: Was planen Sie am Ziel beim Kanzleramt ?
MANSHOLT: Am 9. Juni kommen wird dort an und stärken uns bei einer Bauerntafel. Dabei
fordern wir die Bundeskanzlerin auf, Gespräche mit uns führen. Die für uns wichtigen
Themen werden wir öffentlichkeitswirksam präsentieren.
Karin Mansholt ist ehrenamtlich als Regionalleiterin für Ostfriesland im Bundesverband
deutscher Milchviehhalter tätig und dort Mitglied des Bundesbeirats. Die 45-Jährige betreibt
einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau und Milchvieh in Woltzeten bei Pewsum
(Kreis Aurich).
TAZ NORD
27.05.2011
Agrarindustrie in Niedersachsen
Sind so viele Euter
Der Riesenkuhstall im niedersächsischen Barver wird jetzt nicht für 3.200 Milchkühe gebaut,
sondern für 1.600. Eine Weide sehen die Tiere nie, die Molkereien und die
Futtermittelindustrie profitieren. VON BENNO SCHIRRMEISTER
Keimzelle des Protests: Auf dem Hof von Friedhelm Feldhaus im niedersächsischen Barver.
Foto: dpa
BREMEN taz | Keine 3.200 Stück Milchvieh, der größte Kuhstall Deutschlands wird in
Barver nicht gebaut, das ist die Botschaft: Mit der soll wieder Ruhe einkehren im dünn
besiedelten Ortsteil der Samtgemeinde Rehde im Landkreis Diepholz.
Die Kuh sei vom Eis, wortspielt der Ortsteilbürgermeister, Entwarnung kommt aus dem
Samtgemeinderat Rehde, und auch die Kreisverwaltung stimmt mit ein. Aber noch längst sind
nicht alle beruhigt. "Die Sache hat doch einen Haken", befürchtet Bauer Friedhelm Feldhaus,
"und der ist so groß, dass man ihn nicht sieht."
Am Sonntag geht die bundesweite Proteststernfahrt gegen eine industrielle und für eine
bäuerliche Landwirtschaft los, ein Arm in Rostock, einer in Hessen, einer in Marktoberndorf
und einer in Greetsiel an der Nordsee.
Bis 9. Juni soll sie dauern, das Kanzleramt ist das Ziel. Sie führt über die Hotspots der
deutschen Agrarpolitik. Und Feldhaus Hof ist eine wichtige Etappe: Montag und Dienstag
hält hier der Bauerntreck.
Denn "Barver ist ein symptomatischer Ort geworden", sagt Ottmar Illchmann vom Bund
deutscher Milchviehhalter (BDM). Ein Symptom dafür, dass die Agrar-Industrialisierung
nach der Fleischproduktion nun auf die Milch übergreift, genau hier, im Gründlandgebiet mit
den Einsiedlerhöfen. Einer davon gehört Feldhaus, und dessen Nachbar ist der Milchfabrikant
Jörn Kriesmann, der die Anlage mit 3.200 Kühen bauen wollte.
Direkt vis-à-vis hat der seine Stallungen, verborgen durch eine drei Meter hohe Deichanlage
rings ums Terrain: Nur wer die besteigt, erhascht einen Blick auf die Flachbauten. In denen
leben 1.100 Kühe sommers wie winters.
Mit herausragendem Liegekomfort, wie der Fachmann sagt, unter tollen hygienischen
Bedingungen. Die Weide? Kennen sie nicht. Für Weidehaltung gelten 120 Tiere als
Obergrenze. Zwar, der Milch täte das gut. Stallhaltung verschlechtert das Fettprofil. Aber wer
merkt das schon?
Wie er seinen Hof mit 100 Kühen und 180 Hektar Weideland gegen Kriesmanns
Expansionsdrang behaupten soll, das bereitet Feldhaus Sorgen. Auch wenn der hat
zurückstecken müssen: Anstelle des Giga-Stalls mit 3.200 Milchkühen darfs jetzt nur ein
Megastall werden, mit 1.600 Tieren.
Das ist zwar noch immer das 20fache der niedersächsischen Durchschnittsherde. "Aber man
muss auch", sagt Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch, "die Entwicklung der
Nachbarkreise im Auge behalten". Gerade Vechta setzt weiter auf Agrarindustrialisierung.
"Da gibt es starken Druck auf unseren Flächenmarkt."
Denn Barver ist ein Extrem-, aber kein Einzelfall: Bauvoranfragen für 1.000er Ställe gibts im
Kreis Leer/Ostfriesland, in Rotenburg/Wümme, in Vechta und im ganzen Land: Die
Milchquote läuft aus. Der Markt ordnet sich neu.
Und wenn die EU im Sommer keine neue Form der Regulierung findet, gehts rund: Offenbar
gibts die Hoffnung, für die Molkereien durch Größe attraktiv zu werden. Für die ist es ja
praktisch einen statt 20 Höfe anzufahren.
Besonders interessant ist das Modell natürlich auch für die Futtermittelindustrie. Denn
Grünland heißt ja: relative Autonomie. Bislang konnte die Milchbauern deshalb Front machen
gegen Gen-Futter. Aber so entstehen Abhängigkeiten.
Woher das Geld für den aktuellen Investitionsschub kommt, ist unklar. Als hochprofitabel
galt die Milchwirtschaft zuletzt nicht. Sicher ist nur, dass ein Stall mit 3.200 Kühen einen
Jackpot im Lotto kosten würde.
Bürgermeister Bloch ist nicht wenig stolz auf den "Kompromiss, der die Belange aller
Beteiligten berücksichtigt". Und für den "unzählige Gespräche" geführt wurden, sagt er,
zwischen Kommunalverwaltung und Investor, zwischen Bauern und Gemeinde, und
interfraktionell im Rat. "Wir wollten nicht, dass es zum Politikum wird."
Dabei wars das längst: Der örtliche Protest, der gleich im Februar vom Hof der Feldhaus
ausging, schlug Wellen, erst im Gemeinderat, dann im Kreistag und schließlich in den
Medien, bundesweit.
Am Ende fand sogar Niedersachsens Agrarminister Gert Lindemann (CDU) deutliche Worte:
"Stallprojekte dieser Größenordnung lehnt die niedersächsische Landesregierung ab", schrieb
er an die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die sich an den Protesten
beteiligt hatte, neben dem BDM und dem Bündnis gegen Agrarfabriken.
In Barver hatten manche Sorge vor einer Spaltung des Dorfs. Auf der einen Seite sehen
selbstständige Bauern ihre Existenz bedroht: Wenn einer so viel Milch anbietet wie sonst 40,
dann wird das Höfesterben forciert.
Auf der anderen sind die Lohnarbeiter: Denn vollautomatisch reinigen sich die Ställe nicht,
gemolken werden muss auch, und die Futterlieferungen vom Staplerfahrer in die Lagerhalle
verbracht. Das halbe Dorf arbeite für die Kriesmanns, ist in Barver zu hören.
Also hat "die Gemeinde das Verfahren an sich gezogen", erklärt Bloch. Und also fand man
besagten Kompromiss, dem Feldhaus nicht traut:"Der hatte doch die ganze Zeit gesagt: Er
muss sich mindestens verdoppeln, damit es sich lohnt", sagt der Bauer. "Und jetzt soll er
plötzlich damit zufrieden sein?"
Die Kriesmanns finden, zum Thema sei alles gesagt. Und auf die Frage, ob sie jetzt statt
einem für 3.200 bloß zwei Ställe à 1.600 Milchkühe bauen, antworten sie, ihnen sei bloß
"wichtig, dass es unseren Tieren gut geht".
Bloch schließt ein solches Schlupfloch aus. Dreifach abgesichert hat man das
Verhandlungsergebnis, im Gemeindeentwicklungs-, im Flächennutzungs- und im
Bebauungsplan. Die sind geeint, die Zustimmung im Gemeinderat also sicher. Und der
Zuwachs von 500 Kühen, der nun gestattet wird, der sei ja doch auch noch ein erheblicher.
Bloch hat Recht. Kommunal haben sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft, im Fall Barver, der
ein Symptom ist. Dem haben sie eine Grenzen stecken können. Nicht weniger. Aber auch
nicht mehr.
Kreiszeitung
Diskussion habe Dorf belastet
„Die Kuh ist vom Eis“
25.05.11|Lemförde
Lemfoerde - BARVER · In Barver wird es keine Anlage mit 3 200 Kühen geben. Alle
Beteiligten hätten sich auf einen Kompromiss geeinigt, der eine Erweiterung des Betriebs von
1 100 auf 1 600 Milchkühe vorsieht, sagte Rehdens Samtgemeindebürgermeister Hartmut
Bloch gestern (siehe Bericht Seite „Kreis und Region“).
Um diesen Kompromiss zu finden, waren im Vorfeld „unzählige Gespräche“ geführt worden.
Klar sei schon bei der ersten Informationsveranstaltung gewesen, dass „man nichts übers Knie
brechen will“, so Bloch. „Wir mussten uns eine gewisse Zeit nehmen, das ist hier geschehen
und ist die Basis für einen fachlichen Kompromiss“, ergänzte Henrich Meyer zu Vilsendorf,
Leiter der Bezirksstelle Nienburg der Landwirtschaftskammer Hannover.
Landwirtschaftliche Betriebe würden weniger, aber größer, betonte Holger Schwenzer,
Fachdienstleiter Bauordnung und Städtebau beim Landkreis Diepholz. „Wir können das nur
steuernd begleiten.“ Er freue sich, dass Samtgemeinde und Gemeinde das Vorhaben über
Flächennutzungs- und Bebauungsplan steuerten und das ganze flankiert werde von einem
städtebaulichen Vertrag. „Die Bauleitplanung ist genau das richtige Instrument, um Dinge zu
begleiten, Spielräume zu geben, abzuwägen uns auszugleichen“, lobte Schwenzer. Für diese
solle ein Planer tätig werden, erklärte Bloch. Für das Vorhaben sollen ein Sondergebiet und
ein Bauteppich ausgewiesen werden.
Wie alle Beteiligten lobte auch Meyer zu Vilsendorf den Kompromiss, der es dem Betrieb
Kriesmann ermögliche, „neu zu bauen und den Tierschutz, der ohnehin schon eine große
Rolle auf dem Betrieb spielt, noch weiter in den Vordergrund zu stellen“. Kriesmann selbst
betonte, dass der Tierhygiene und -gesundheit mit dem Neubau noch besser Rechnung
getragen werden könne. „Wir sind gut, wollen noch besser werden – und das ist auch ernst
gemeint“, so der Landwirt. Er habe gute Mitarbeiter, die überwiegend aus Barver kämen und
voll hinter dem Betrieb stünden.
Barvers Bürgermeister Detlev Osterbrink betonte auch, dass kleinere Kollegen nicht aus dem
Blick verloren werden dürften. „Milchviehbetriebe haben heute 100 Tiere im Schnitt, leben
davon. Auch denen muss es möglich sein, sich weiter zu entwickeln, damit sie den
Anforderungen der Zukunft gerecht werden.“ Aber auch Osterbrink freute sich über den
Kompromiss. „Die Kuh ist vom Eis.“ Die Unruhe in der Gemeinde sei, gerade in letzter Zeit,
groß gewesen. „Die Diskussion hat das Dorf belastet“, sagte auch sein Stellvertreter Eckhard
Meyer. „Es ist gut, dass wieder mehr Ruhe ins Dorf kommt, damit wir in 14 Tagen schön
Schützenfest feiern können.“
Angesichts des Wirbels um den ursprünglich geplanten Bau räumte Henrich Meyer zu
Vilsendorf ein, dass es Öffentlichkeitsarbeit bedarf, um mit Vorurteilen aufzuräumen. „Wir
müssen heraus stellen, dass die Größe an sich nichts Negatives für Tiergesundheit und -
hygiene ist. Bei der Entwicklung der modernen Tierhaltungsbetriebe stellen wir fest, dass die
Akzeptanz dafür teilweise nicht gegeben ist.“
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) begrüße und unterstütze den
Kompromiss, dass der Betrieb Kriesmann in Barver auf nur 1 600 statt 3 200 Milchkühe
erweitert werden kann. Das teilte die AbL gestern mit. „In Anbetracht der jetzt schon im
Betrieb Kriesmann gehaltenen Tiere bewegt sich diese Größenordnung weitgehend im
Rahmen des gesetzlichen Anspruchs auf Bestandswahrung“, so AbL-Sprecher Eckehard
Niemann. Gleiches meinte auch Jochen Vogt, Sprecher des Netzwerkes „Bauernhöfe statt
Agrarfabriken“: „Gut, dass ein Kompromiss gefunden worden ist, prima.“ Er betonte aber:
„Ich muss nicht jubeln. Es ist ein Kompromiss, den ich unter dem Kapitel Bestandswahrung
abhefte.“ Das Netzwerk fordere, Bestandsobergrenzen von 300 bis 400 Milchkühen
einzuführen. Im Rahmen des Bestandschutzes sei eine größere Zahl aber akzeptabel. Der
Syker betonte jedoch, dass das keinesfalls ein Signal sein solle und andere Betriebe ermuntern
solle, mit vierstelligen Beständen zu planen. „Das kann kein Präzedenzfall sein.“ · cs
Antragsteller wird wahrscheinlich gegen Bescheid klagen - 24.05.2011
Kreis lehnt Megastall ab Von ANKE LANDWEHR
Verden. Ein im Etelser Ortsteil Giersberg geplanter Hähnchenmaststall mit 100000 Plätzen
darf nicht gebaut werden. Der Landkreis Verden hat den Antrag des Landwirts Jürgen Ernst
nach langwierigen Auseinandersetzungen abgelehnt. Das hat Landrat Peter Bohlmann gestern
bestätigt. Als Grund nannte er die "nicht ausreichend gesicherte Erschließung".
Ernst wird die Entscheidung mit großer Wahrscheinlichkeit vor dem Verwaltungsgericht
anfechten. "Verloren habe ich schon, ich kann nur noch gewinnen", erklärte er. Zu seinem
Hof führt die Giersbergstraße, die nach Auffassung des Landkreises für den zu erwartenden
Verkehr viel zu schmal ist. Eine Verbreiterung auf seine Kosten lehnt Ernst ab, er hält sie
auch nicht für notwendig. Sein Rechtsanwalt Jochen Hollinderbäumer aus Oldenburg: "Wir
haben da augenblicklich rein rechnerisch 2,4 Lkw-/Traktor-Bewegungen täglich, diese Zahl
würde sich durch den Stall nicht einmal verdoppeln."
Landrat Bohlmann verweist dagegen auf Gerichtsurteile, die der Landkreis seinem
Ablehnungsbescheid zugrunde gelegt habe. Danach seien wegen ungesicherter Erschließung
schon weitaus kleinere Vorhaben gescheitert. Er sehe einer Klage deshalb gelassen entgegen.
Gleichzeitig erneuert Bohlmann die Forderung an den Gesetzgeber, im Baugesetzbuch
die Privilegierung gewerblicher Tierhaltungsanlagen von deren Größe abhängig zu
machen. Nach dem Hähnchenmaststall war im Kreishaus ein weiterer Megastall beantragt
worden - diesmal für 6000 Mastschweine in der Samtgemeinde Thedinghausen.
Top agrar Keine Genehmigung für 3200er-Stallanlage
[25.05.2011]
Das berichtet die Kreiszeitung heute. Die bestehende Anlage dürfe maximal auf 1600 Kühe
erweitert werden. Derzeit hält der Betrieb 1100 Kühe. Alle an der Entscheidungsfindung
beteiligten Behörden wie Gemeinde und Landwirtschaftskammer hätten sich auf den
Kompromiss von 1600 Kühen geeinigt.
Wie alle Beteiligten lobte auch Henrich Meyer zu Vilsendorf von der Landwirtschaftskammer
Bezirksstelle Nienburg den Kompromiss, der es dem Betrieb ermögliche, „neu zu bauen und
den Tierschutz, der ohnehin schon eine große Rolle auf dem Betrieb spielt, noch weiter in den
Vordergrund zu stellen“.
Der Bauherr, Jörn Kriesmann, betonte, dass der Tierhygiene und -gesundheit mit dem Neubau
noch besser Rechnung getragen werden könne. Barvers Bürgermeister Detlev Osterbrink
betonte auch, dass kleinere Kollegen nicht aus dem Blick verloren werden dürften.
„Milchviehbetriebe haben heute 100 Tiere im Schnitt, leben davon. Auch denen muss es
möglich sein, sich weiter zu entwickeln, damit sie den Anforderungen der Zukunft gerecht
werden.“
Voraus gegangen waren wochenlange Diskussionen und hitzige Debatten in der Gemeinde
Barver und Umgebung. Nach Angaben des Bürgermeisters habe das Projekt eine große
Unruhe in die Gemeinde gebracht. Angesichts des Wirbels um den ursprünglich geplanten
Bau räumte Henrich Meyer zu Vilsendorf ein, dass es Öffentlichkeitsarbeit bedarf, um mit
Vorurteilen aufzuräumen.
Ldw. Wochenblatt Westfalen-Lippe
AKTUELLES
Billerbeck verliert und zahlt
Die Hähnchenmast lohnt sich, deshalb bauen Landwirte Ställe – was nicht immer auf
Begeisterung stößt. Foto: B. Lütke Hockenbeck
Streit um Hähnchenställe beendet: Oberverwaltungsgericht NRW hat Antrag der Stadt
Billerbeck auf Zulassung der Berufung zurückgewiesen.
Anfang 2007 hatte Landwirt Josef G. den Bau eines Masthähnchenstalles für 39.900 Tiere in
der Bauerschaft Beerlage beantragt. Doch die Stadt Billerbeck versagte ihr Einvernehmen.
Der Stall stehe zu nah an der Siedlung Aulendorf, es gebe bereits zu viele Hähnchenställe in
Billerbeck und im gesamten Münsterland, zudem würden solche gewerblich betriebenen
Tierhaltungsanlagen nicht mehr unter den Begriff „Landwirtschaft“ fallen.
Weil Josef G. jedoch alle Auflagen für den Stall nachweisen konnte, setzte sich die
Bezirksregierung Münster über die Bedenken der Stadt hinweg und erteilte die erforderliche
immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 35, 1 Nr. 4 BauGB (sonstige Bauvorhaben).
Hitzige Debatten und Stimmungsmache
Gegen die Ersatzvornahme klagte die Stadt, vorausgegangen waren hitzige Debatten im
Stadtrat, eine Bürgerinitiative hatte massiv Stimmung gegen Landwirte gemacht, die im
Stadtgebiet Geflügelställe beantragt und teils schon errichtet hatten.
Am 27. Mai hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster jetzt den Antrag der Stadt
Billerbeck auf Zulassung der Berufung zurückgewiesen und ihr die Kosten beider Verfahren
aufs Auge gedrückt. Der Streit um die Ställe, einer davon steht in Aulendorf und wird seit
Mitte 2010 betrieben, dürfte damit beendet sein. As
Den ausführlichen Bericht lesen Sie in Wochenblatt-Folge 23/2011.
Nordkurier
Artikel vom 01.06.2011
"Der Fisch stinkt vom Kopf her"
Alt Tellin/Neubrandenburg (sth).
Nach wie vor besitzt der Investor rein rechtlich gesehen einen
Freifahrtschein für den Bau der in der Gemeinde Alt Tellin
geplanten großen Schweinezuchtanlage. Denn anscheinend hat das
Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) in
Neubrandenburg noch keinen endgültigen Bescheid auf dessen
Widersprüche verschickt, mit denen die Auflagen für den Bau erst
einmal ausgehebelt worden sind. Damit aber gilt bis auf Weiteres
die von der Behörde angeordnete sofortige Vollziehbarkeit der
Baugenehmigung, obwohl StALU-Chefin Christa Maruschke
gegenüber dem Nordkurier bereits vor zweieinhalb Wochen Abhilfe
versprach. Passend dazu liefen in der vergangenen Woche
Bauarbeiten auf dem Gelände an, wobei sich die Beteiligten streiten,
ob das Ganze rechtlich tatsächlich als Baustart für die Stallanlage
gilt.
Unabhängig davon wird der Ruf nach Konsequenzen aus der
jetzigen Situation immer lauter. "Wie sieht es mit der Übernahme
von Verantwortung aus", fragt die Bürgerinitiative "Rettet das
Landleben am Tollensetal" in ihrem jüngsten am Wochenende
erschienenen Flugblatt. "Herr Backhaus ist verantwortlich für das
StALU, Minister Seidel für die dort durchgeführten
Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz."
Denn nach Ansicht von Jörg Kröger von der BI kommen nur zwei
Varianten in Frage: Entweder der von der Behörde sogar
eingeräumte "Fehler" sei absichtlich passiert und wäre dann ein Fall
für den Staatsanwalt oder es handele sich wirklich um ein Versehen.
Auch dann seien Konsequenzen im Amt selber überfällig, ganz
abgesehen von der Korrektur im Verfahren. "Der Fisch stinkt
bekanntlich vom Kopf her", so der BI-Sprecher.
Neue Nahrung bekommen die Vorwürfe durch eine öffentliche
Aussage des rechtlichen Vertreters des Investors in der
Gemeindevertretung Alt Tellin. Demnach hätte die Behörde schon
längst reagieren können: "Unsere Begründung für den
Widerspruchsbescheid liegt dem StALU seit Anfang April vor",
erklärte dort Dr. Helmar Hentschke von einer Potsdamer Kanzlei.
Amtsleiterin Maruschke war gestern nach Aussage ihres
Vorzimmers nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Sie weilte
demnach im Ministerium in Schwerin.
Fenster schließen
SVZ
HAGENOW
Scharbow: Broilermast teilt das Dorf
30. Mai 2011 | von Mayk Pohle
Gedränge im Zelt, Scharbow hatte leider keinen vernünftigen Raum für die
Informationsveranstaltung zur geplanten Broilermastanlage zu bieten, die Stimmung war von
Anfang an gereizt. Am Ende gab es bei aller Information viel Streit. Mayk Pohle
SCHARBOW - Der Hagenower Ortsteil hat am Sonnabend eine denkwürdige Veranstaltung
erlebt, im Zelt und beim Rattern eines Stromaggregates. Geplant war eine
Informationsveranstaltung unter den Fittichen der Stadtverwaltung über die nahe des Dorfes
geplante Broilermast Zwar gelang die Weitergabe der Informationen, doch am Ende der mehr
als zweistündigen Veranstaltung im viel zu kleinen Zelt stritten die Gegner mit den
Befürwortern und vor allem mit dem Investor Ingo Fischer immer wieder. Es gab viel
Grundsätzliches über Profite, über Gefahren über Tierquälerei. Fischer, zugleich
Ortsteilvertreter und auch SPD-Stadtvertreter, hatte mit seinem Planer Dr. Wilfried Eckhof
früh die Stimmung gegen sich. Die Gegner der für 126 000 Tiere geplanten Anlage hatten die
Stimmungshoheit, die Befürworter und Zweifler agierten stiller.
Dennoch konnte der Planer Eckhof alle Details zur Anlage vorstellen und zusammen mit
seinem Auftraggeber und Investor Fischer Fragen beantworten. Das Gerücht, es sei noch eine
Biogasanlage geplant, konnte Fischer schnell entkräften. Gedacht ist vielmehr an einer
Verbindungsleitung zur nahe gelegenen Anlage in Presek. Klar ist auch, dass die drei Ställe
keine Filter haben werden. Da mochte Eckhof noch sehr auf die Gesetzeslage hinweisen, die
nämlich in dieser Frage nichts vorschreibt, die Befürchtungen der Gegner aus Scharbow und
Bobzin waren nicht aus dem Weg zu räumen. Das gilt noch viel mehr für die Befürchtungen,
die zu erwartenden Lkw-Transporte würden der Bobziner Straße endgültig den Hals
umdrehen. Auch hier verfing das Argument der Planer, es seien doch nur ganz wenige
Fahrten pro Tag, nicht.
Bevor der Streit und die grundsätzlichen Auseinandersetzungen über abzuwertende
Grundstücke, Geruchsbelastungen, Keime losbrachen konnten immerhin die Nachricht
vermittelt werden, das die Abfälle aus den Stallanlagen nicht auf irgendwelche Felder
gefahren werden sondern in die Biogasnalage kommen. Informiert wurde auch über den Stand
des Verfahrens. Noch ist man in der Planung, es gibt noch keinen Antrag bei den Behörden.
Dennoch machten der Planer mit seiner Mannschaft und auch der Investor klar den Eindruck,
dass sie die Anlage sehr wohl für genehmigungsfähig halten.
Wie zerstritten das Dorf bei dieser Frage inzwischen ist, zeigte sich in der anschließenden
Diskussion. Wer die Mehrheit hat ist nicht klar, denn der Investor ist kein Fremder sondern
ein sehr anerkannter Landwirt und Nachbar. Fischer beklagte sich dann auch, dass die
Anfeindungen inzwischen sehr ins Persönliche gingen. So habe man seine komplette Adresse
auf einer Internet-Seite veröffentlicht, das könne er nicht mehr lustig finden.
Bürgermeisterin Gisela Schwarz hatte nicht nur eingeladen, sie wagte sich auch mutig in die
Moderation. Aus Sicht vieler beging sie dabei den Fehler, sich zu sehr auf die Seite des
Investors zu stellen.
Für die Gegner jedenfalls ist klar, dass ihr Widerstand weitergehen wird, sicherlich auch vor
Gericht.
NDR
Stand: 31.05.2011 14:13 Uhr
Emlichheimer wollen keine Mega-Mastanlage
Für bis zu 330.000 Tiere soll die geplante
Mastanlage ausgelegt sein. (Archivbild) In Nordhorn wird am Dienstag über die
Einwendungen von Naturschutzverbänden und Anwohnern gegen eine geplante
Hähnchenmastanlage beraten. Ein Landwirt will im Ortsteil Weusten in der Samtgemeinde
Emlichheim einen Maststall für rund 330.000 Tiere errichten. Beim zuständigen Landkreis
Grafschaft Bentheim sind insgesamt 48 Einwendungen gegen die geplante Großanlage
eingegangen.
Gesundheits-, Geruchs- und Verkehrsbelastung befürchtet
Die geplante Mastanlage gefährdet nach Ansicht
von Anwohnern und Naturschützern die Gesundheit der Bevölkerung. (Archivbild) Nach
Angaben eines Sprechers ähneln sich viele der Einwendungen. Es geht vor allem um
befürchtete Staub- und Geruchsbelästigungen, sowie die Gefahr durch sogenannte
Bioaerosole. Das sind luftgetragene Partikel biologischer Herkunft - also beispielsweise Pilze,
Bakterien und Viren. Sie können zu Atemwegs- und allergischen Erkrankungen führen.
Außerdem erwarten einige Beschwerdeführer eine Zunahme der Verkehrsbelastung durch an-
und abfahrende LKW. Und nicht zuletzt haben viele Angst davor, dass ihre Häuser enorm an
Wert verlieren könnten, wenn die Anlage erst einmal in der Nachbarschaft steht. Der
Antragsteller betreibt bereits einen Stall für 140 Milchkühe und etliche Zuchttiere. Dazu noch
eine Biogasanlage für Getreide.
Landkreis sieht derzeit keine Möglichkeit, Bauantrag abzulehnen
Der Landkreis Emsland hat die Auflagen für
Baugenehmigungen von Mastanlagen kürzlich verschärft. (Archivbild) Bislang, so der
zuständige Sachbearbeiter, habe der Landkreis keine Handhabe, den Bauantrag abzulehnen.
Der benachbarte Landkreis Emsland hatte die Auflagen für eine Genehmigung kürzlich
verschärft, unter anderem durch Brandschutz- und Keimgutachten. Auch Niedersachsens
Ministerpräsident McAllister (CDU) will den Kreisen mehr Steuerungsmöglichkeiten
verschaffen. Nutztierhaltung könne auf Dauer nur erfolgreich betrieben werden, wenn sie
gesellschaftlich akzeptiert werde, so McAllister am Montag auf dem Landesbauerntag in
Cloppenburg.
SALZGITTER ZEITUNG Donnerstag, 26.05.2011 Nachrichten / Salzgitter
Rat appelliert an Landwirte, keine Mastanlagen zu errichten Von Ingo Kugenbuch
Der Rat der Stadt Salzgitter hat sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich gegen die
industrielle Massentierhaltung ausgesprochen. Auch die SPD unterstützte einen
entsprechenden Antrag der Gruppe Linke/Grüne.
Der Antrag fordert, dass die Verwaltung bei der Genehmigung solcher Mastanlagen den
rechtlichen Rahmen voll ausschöpft, also möglichste hohe Hürden für die Antragsteller
errichtet. Außerdem wird an die Landwirte in Salzgitter appelliert, auf den Bau "industrieller
Tierproduktionsstätten" zu verzichten. Zudem sollen auch Bund und Land die Gesetze so
ändern, "dass ein Stallbauboom wie im Emsland verhindert werden kann".
"Es geht uns dabei nicht nur um Hühner, sondern um Massentierhaltung allgemein", sagte
Marcel Bürger (Linke/Grüne). "Wer Fleisch essen will, sollte es aus bäuerlicher
Landwirtschaft kaufen – und muss dann eben etwas mehr bezahlen."
Neue OZ online 27.05.2011, 23:32 Fenster schliessen drucken
Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/artikel/54536027/nach-ehec-nun-
auch-gefluegelpest-mehr-tote--betriebe-in-niedersachsen-gesperrt
Ausgabe: Neue Osnabrücker Zeitung
Veröffentlicht am: 27.05.2011
Nach EHEC nun auch Geflügelpest: Mehr Tote – Betriebe in Niedersachsen gesperrt hab/kj/fho/ra Osnabrück
hab/kj/fho/ra Osnabrück. Für Verbraucher, Bauern und Lebensmittelbranche ist es
kein gutes Frühjahr. Der EHEC-Darmkeim verdirbt Appetit und Geschäfte, die
Geflügelpest hat aus Ostwestfalen inzwischen Niedersachsen erreicht, und die
Landwirte leiden obendrein unter der Trockenheit. „Der Trend ist dramatisch“, sagte
Bauernpräsident Gerd Sonnleitner in einem Interview mit unserer Zeitung.
In Glandorf und Melle (Landkreis Osnabrück) sowie in Wietzen (Kreis Nienburg) wurden
gestern drei landwirtschaftliche Betriebe wegen des Verdachts der Geflügelpest vorläufig
gesperrt. Die Höfe waren nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums
in den letzten Wochen mit insgesamt 115000 Küken aus einem Zuchtbetrieb in Ostwestfalen
beliefert worden, in dem die mildere Variante der Geflügelpest ausgebrochen ist. Ob die
Bestände in Niedersachsen getötet werden müssen, sollen Untersuchungen bis heute ergeben.
Unterdessen zeichnen sich Spannungen zwischen den Landesregierungen in Hannover und
Düsseldorf ab. Die Niedersachsen behaupten, die Geflügelpest habe in NRW bereits drei
Wochen „geschwelt“; dadurch sei eine Weiterverbreitung begünstigt worden. Das
Agrarministerium in Düsseldorf bestreitet dies.
Nach dem Dioxin-Skandal Anfang des Jahres könnte es derzeit für die Bauern besonders in
Norddeutschland kaum schlimmer kommen – zumal der EHEC-Keim sich weiter rasant
verbreitet. Bislang sind deutschlandweit vermutlich rund 1000 Menschen wegen des EHEC-
Erregers erkrankt, davon mehr als 200 in Niedersachsen. Sechs Patienten sind bislang an den
Folgen einer EHEC-Infizierung gestorben. Mehrere Menschen schweben immer noch in
Lebensgefahr. Außer in Deutschland ist der Darmkeim nun auch in Dänemark, Schweden und
Österreich festgestellt worden.
Zu allem Übel bringt die Trockenheit die Landwirte in ungeahnte Schwierigkeiten.
Bauernpräsident Sonnleitner sprach in unserer Zeitung von einem dramatischen Trend. „Bei
Getreide könnte es auf leichten Standorten zu einem Ausfall von bis zu 30 Prozent kommen.
Bundesweit ist im Durchschnitt ein Fünftel der Getreideernte in Gefahr“, so der
Bauernpräsident. Bei Raps ist nach Sonnleitners Worten deutschlandweit ein Minderertrag
von 15 bis 30 Prozent oder sogar mehr zu befürchten.
Die Energiewende der Bundesregierung sieht der Bauernpräsident skeptisch. Die für
Landwirte vorgesehenen Entgelte als Kompensation für Flächenverlust durch neue
Stromtrassen seien „vollkommen unfair angesichts der Milliardengewinne der Investoren“,
sagte Sonnleitner. Seiten 4, 5 und 7
[ » ah nachrichten für die Landwirschaft » Geflügel » Geflügelgrippe ]
Samstag, 28.05.2011
Geflügel | 27.05.2011
Geflügelgrippe in Ostwestfalen - 20 000 Hühner werden getötet Gütersloh - Auf einem Hof im ostwestfälischen Kreis Gütersloh ist die Geflügelgrippe
ausgebrochen. Vorsorglich wurde begonnen 20 000 Tiere zu töten.
Vorsorglich sei in der Nacht zum Donnerstag damit begonnen worden, die Tiere auf dem Hof
in Rietberg zu töten, teilte der Landkreis mit. Es handle sich aber nicht um den aggressiven
Erreger (H5N1) der Vogelgrippe, erklärte die Abteilung Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung des Kreises. Nach derzeitigem Stand gehe man von einem milden
Typus aus. Eine Gefahr für den Menschen bestehe nicht. Die im Umkreis von einem
Kilometer um den betroffenen Betrieb liegenden Geflügelhaltungen wurden gesperrt.
dpa
TOP AGRAR Geflügelgrippe: Neue Verdachtsfälle
[27.05.2011]
Im Kreis Gütersloh gibt es drei weitere Geflügelbetriebe, in denen eventuell die
Geflügelgrippe ausgebrochen ist. In den drei Betrieben in Rietberg und Rheda-Wiedenbrück,
ein Putenmastbetrieb und zwei Legehennenbetriebe, sind vermehrt Tiere mit Symptomen
aufgefunden worden oder die Legeleistung ging zurück, berichtet der Kreis Gütersloh. Die
Höfe liegen außerhalb des Ein-Kilometer-Radius um den Hof in Rietberg, auf dem die
Geflügelgrippe nachgewiesen worden ist. Von diesem Legehennenhof liegt inzwischen das
endgültige Laborergebnis vor: Es handelt sich wie bereits angenommen um die leichte Form
der Vogelgrippe, hat das Friedrich-Loeffler-Institut mitgeteilt.
In dem Putenmastbetrieb wird im Laufe des Freitags eine Probe entnommen, ein erstes
Untersuchungsergebnis soll am Samstag vorliegen. In den anderen beiden Betrieben werden
am Montag Proben genommen. Alle drei Betriebe sind vorläufig gesperrt.
Die beiden Legehennenbetriebe haben zusammen zirka 8000 Tiere, der Putenmastbetrieb
zirka 5000 Tiere. Darüber hinaus werden noch Betriebe untersucht, die von dem
Legehennenbetrieb, auf dem die Geflügelgrippe zuerst ausgebrochen ist, Tiere erhalten haben.
Die Ursache für den Ausbruch der Geflügelgrippe ist nach wie vor unklar. Es handelt sich um
den zweiten Ausbruch in Deutschland innerhalb dieses Jahres. Vor rund einem Vierteljahr gab
es einen Ausbruch der Geflügelgrippe im Raum Cloppenburg, vor rund vier Wochen einen in
Niederlanden.
Geflügelgrippe: Verdacht hat sich bestätigt
[27.05.2011]
Der Verdacht auf Geflügelgrippe im Kreis Gütersloh hat sich bestätigt. Das haben
Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts bestätigt. Um welche Variante des Erregers
es sich handelt, werde erst im Laufe des Freitags zweifelsfrei feststehen, berichtet der Landrat
des Kreises. Indizien sprechen dafür, dass es sich um die niedrig ansteckende Variante
handelt. Bei dieser Geflügelgrippe ist die Ansteckungsgefahr nicht besonders hoch. Der
Krankheitsverlauf ist sehr viel milder und auch die Sterblichkeit unter den Tierbeständen
deutlich geringer.
Im Laufe des Donnerstags wurde in einem Einen-Kilometer-Radius um den betroffenen Hof
alle Geflügelhalter informiert, dass eine Sperrzone eingerichtet wurde: Sie dürfen unter
anderem vorerst keine Tiere aus ihrem Bestand abgeben. Tierärzte der Abteilung
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh untersuchen die
Bestände. Innerhalb der Sperrzone gibt es 13 Geflügelhalter mit ca. 600 Tieren. Des Weiteren
werden Kontaktbetriebe ermittelt. Die ersten Anzeichen für die Geflügelgrippe hatte der
Hofinhaber selbst entdeckt. Die Legeleistung war zurückgegangen und er fand vermehrt tote
Tiere. Bereits in der Nacht zu Donnerstag war mit Unterstützung des ABC-Zuges der
Feuerwehr begonnen worden, die 20.000 Tiere des Geflügelhofes vorsichtshalber zu töten.
Neue OZ online 29.05.2011, 20:59 Fenster schliessen drucken
Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/deutschland-und-
welt/politik/niedersachsen/54534002/gefluegelpest-nicht-sofort-bekaempft
Ausgabe: Neue Osnabrücker Zeitung
Veröffentlicht am: 27.05.2011
Geflügelpest nicht sofort bekämpft? hab/ra/fho Hannover
hab/ra/fho Hannover. Nach Erkenntnissen niedersächsischer Landespolitiker hat
Nordrhein-Westfalen den neuen Ausbruch der Geflügelpest erst mit erheblicher
Verzögerung aufgegriffen und so eine Ausbreitung auf Niedersachsen mit verursacht.
Agrarminister Gert Lindemann (CDU) sprach gestern gegenüber unserer Zeitung von
Hinweisen, wonach die Geflügelgrippe bereits seit rund drei Wochen im Raum Gütersloh
„schwelt“. Es sei aber offenkundig nicht energisch vorgegangen worden, sodass der
betroffene Zuchtbetrieb weiterhin Eintagesküken an andere Geflügelhalter geliefert habe.
Dadurch sei das Problem erheblich erschwert worden.
Der Glandorfer CDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer griff den nordrhein-westfälischen
Verbraucherminister Johannes Remmel (Grüne) frontal an. „Er hat drei Wochen nicht
informiert mit der Folge, dass vor zwei Wochen noch ein hiesiger Betrieb Küken aus
Gütersloh bezogen hat. So sieht grüne Politik aus: Wie schade ich meinem Nachbarn?“
Remmels Sprecher Wilhelm Deitermann wies die Anschuldigungen zurück. Auf Anfrage
unserer Zeitung sagte er, die Geflügelpest sei erst am Dienstagnachmittag aufgetaucht. Das
Kreisveterinäramt Gütersloh habe daraufhin umgehend das Ministerium und auch die
angrenzenden Landkreise informiert und Maßnahmen eingeleitet.
Ungeachtet des Streits wurde allseits Erleichterung darüber bekundet, dass es sich im jüngsten
Fall offenbar nicht um den aggressiven Vogelgrippen-Erreger H5N1 handelt, sondern um eine
mildere Variante. Nach Angaben des niedersächsischen Agrarministeriums ist auch noch
nicht klar, ob die Jungtiere, die noch am Tag ihrer Geburt zur weiteren Aufzucht an
Mastbetriebe geliefert werden, tatsächlich mit dem Virus infiziert sind. Sollte dies allerdings
der Fall sein, müssten alle 115000 nach Niedersachsen gelieferten Tiere getötet werden.
Das Veterinäramt in Osnabrück geht nach Darstellung von Landkreissprecher Burkhard
Riepenhoff nicht von einer akuten Gefährdung aus. Er wies auch auf einen stabilen Zustand
der in den letzten Wochen angelieferten Tiere hin. Die Masthähnchen hätten die mögliche
Infektion gut überstanden und seien mittlerweile gegen den Erreger resistent. Auch eine
Ansteckungsgefahr für weitere Bestände auf anderen Höfen sei nach zwei Wochen sehr
unwahrscheinlich.
Dennoch, so Riepenhoff, seien die beiden aus dem westfälischen Rietberg belieferten Betriebe
in Glandorf und Melle vorsorglich gesperrt worden. Solange diese Anordnung, die auch für
einen Hof im Kreis Nienburg gilt, in Kraft ist, darf von dort kein Geflügel verkauft werden
und niemand außer dem Hofpersonal und Veterinären die Ställe betreten.
Ergebnisse von Proben aus den Betrieben werden für heute erwartet.
erstellt am: 29.05.2011
URL: www.rp-online.de/panorama/deutschland/Weiterer-Betrieb-von-Gefluegelpest-
betroffen_aid_1003540.html
Schon fast 30.000 Tiere in NRW getötet
Weiterer Betrieb von Geflügelpest betroffen zuletzt aktualisiert: 29.05.2011 - 12:30
Gütersloh/Düsseldorf (RPO). Die Geflügelpest breitet sich in Nordrhein-Westfalen weiter
aus. Neben den etwa 6000 Puten eines Betriebs in Rheda-Wiedenbrück (Kreis
Gütersloh) müssen nun auch 3600 Legehennen in Rietberg getötet werden, wie die
Kreisverwaltung am Sonntag mitteilte.
Laboruntersuchungen hätten den Geflügelgrippe-Verdacht bestätigt. Noch am Sonntagmittag
soll mit der Tötung der Tiere begonnen werden. Zuvor waren bereits 20.000 Hühner eines
weiteren Legehennenbetriebs in Rietberg getötet worden.
Der politische Streit über die Tierseuche zwischen NRW und Niedersachsen geht unterdessen
weiter. Nachdem Niedersachsens Agrarminister Gert Lindemann (CDU) dem NRW-
Verbraucherministerium vorgeworfen hatte, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben, ging man
dort selbst in die Offensive. Ein Ministeriumssprecher wies die Vorwürfe zurück und betonte,
das NRW-Verbraucherministerium sei am Dienstag über den Fall informiert worden und habe
umgehend den Betrieb gesperrt.
"Davor gab es keine Hinweise auf eine 'schwelende' Ausbreitung der Erkrankung", sagte der
Sprecher. "Sollte allerdings Minister Lindemann bereits seit mehreren Wochen über Hinweise
oder Informationen über den Ausbruch der Vogelgrippe verfügen, fragen wir uns natürlich,
warum sich das Ministerium in Hannover nicht mit uns in Verbindung gesetzt hat."
Lindemann hatte kritisiert, dass die Sperrungen zu spät verfügt worden seien, obwohl es
Hinweise gegeben habe, dass die Pest bereits seit rund drei Wochen in Ostwestfalen schwele.
Dadurch hätten noch drei Betriebe in Niedersachsen insgesamt 115.000 Küken aus den
betroffenen Beständen in Nordrhein-Westfalen erhalten.
Mindener Tageblatt
27.05.2011
Die Vogelgrippe kehrt zurück
20000 Hühner auf Hof in Rietberg getötet
VON ANDREAS EICKHOFF UND SANDRA SPIEKER
Rietberg (nw). Der Verdacht hat sich bestätigt: Auf einem Hof in Rietberg-Bokel im Kreis
Gütersloh ist die Geflügelgrippe ausgebrochen. Aus Vorsorgegründen wurden alle 20000
Hühner des Betriebes getötet. Im Umkreis von einem Kilometer um den betroffenen Betrieb
wurden alle Geflügelhaltungen gesperrt.
Laut Kreissprecher Jan Focken weist alles darauf hin, dass es sich in diesem Fall um einen
milden Typus der Geflügelgrippe handele. Es sei nicht der aggressive Erreger (H5N1) der
Vogelgrippe, der vor rund fünf Jahren grassierte. Die Proben werden derzeit im Chemischen
und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Detmold sowie im Friedrich-Loeffler-Institut
überprüft. Die genauen Ergebnisse werden für heute Nachmittag erwartet.
"Eine Ansteckungsgefahr für den Menschen besteht aber nicht", so Focken. Der Betrieb
produziert Küken für Mastbetriebe. Auslöser für den Verdacht war ein Schnelltest. Der
Landwirt hatte eine erhöhte Sterblichkeit unter seinen Tieren festgestellt und die Behörden
alarmiert. Im Laufe des Tages kam die Bestätigung. "Wir haben sofort gehandelt und das war
richtig", sagt Jan Focken.
Hühner aus umliegenden Betrieben nicht ins Freie
Nach einem Auftreten des Vogelgrippe-Erregers im Kreis Cloppenburg ist der Fall in
Rietberg-Bokel bundesweit der zweite in diesem Jahr. Bei der letzten großen Welle sei der
Kreis Gütersloh von der Vogelgrippe verschont geblieben, so Focken. In den 13 umliegenden
kleineren Betrieben wurden die Hühner untersucht, aber nicht getötet. Die Tiere dürfen aber
derzeit nicht ins Freie.
Mit einem Großaufgebot rückten zuvor Veterinäre und die örtliche Feuerwehr auf dem Hof in
Rietberg-Bokel an. Auch der ABC-Zug des Kreises wurde alarmiert, die Spezialisten aus dem
Nordkreis sind speziell dafür geschult, atomare, biologische und chemische Unfälle zu
bearbeiten. In Rietberg wurden sie vor allem für die Dekontamination von Personen und
Fahrzeugen eingesetzt. Ein Fachunternehmen begann noch in der Nacht zu Donnerstag, die
Tiere zu schlachten. Dabei arbeiteten sich die Mitarbeiter in Schutzanzügen von Gebäude zu
Gebäude vor - für den Eigentümer ein schreckliches Szenario. In großen Abrollbehältern
wurden die Tiere alle vier Stunden zu einem Entsorgungsbetrieb in der Nähe von Osnabrück
gebracht.
Tierseuchenkasse kommt für direkte Schäden auf
Gerade erst - so scheint es - haben sich die Geflügelhalter von der Grippe-Welle vor vier
Jahren erholt, dann kam der Dioxin-Skandal, jetzt wieder die Vogelgrippe. Das bedeutet
große Schäden für die Betroffenen. "Die direkten Schäden bezahlt die Tierseuchen-Kasse",
erklärt Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer NRW. Dabei handele es sich um eine
Zwangsversicherung, die aber nur den gemeinen Wert ersetzt. "Was nicht erstattet wird, und
das ist oft der größere Betrag, ist der Verdienstausfall", so Rüb. Nach den vergangenen
Vogelgrippe- und Dioxinfällen hätten sich viele Geflügelhalter zusätzlich noch mit einer
Betriebsausfallversicherung abgesichert.
Der Kreis Gütersloh hat derweil eine Hotline für Geflügelhalter und besorgte Bürger
eingerichtet: Tel. 05241/85-1329 oder 05241/85-1332.
Dokumenten Information Copyright © Mindener Tageblatt 2011
Dokument erstellt am 26.05.2011 um 21:15:35 Uhr
NW News
28.05.2011
RIETBERG - UPDATE 22.01 UHR
Geflügelpest: Zahl der betroffenen Betriebe erhöht sich auf fünf
40.000 infizierte Tiere im Kreis Gütersloh
VON FRIEDERIKE EDLER UND ANDREAS EICKHOFF
Kreis Gütersloh. Die Geflügelpest breitet sich im Kreis Gütersloh immer schneller aus.
Nachdem am Donnerstag schon 20.000 Tiere gekeult werden mussten, wurden 9.600 weitere
Tiere am Wochenende getötet. In zwei weiteren Betrieben mit Legehennen bestätigten sich
unterdessen die Verdachtsfälle. Das Todesurteil für weitere 12.900 Tiere.
Um die Verbreitung der Tierseuche einzudämmen, verhängte der Kreis ein 72-stündiges
Geflügel-Beförderungsverbot, das bis einschließlich Dienstag 24 Uhr für die Gemeinde
Langenberg sowie die Städte Rietberg, Rheda-Wiedenbrück, Verl und Schloß Holte-
Stukenbrock gilt.
Weitere Tiere werden am Montag getötet
"Mit diesem sogenannten ’Stand-Stil’ soll vermieden werden, dass sich der Erreger durch
Handel weiter verbreitet", erläuterte Beate Balsliemke, Sprecherin des Kreises Gütersloh.
Geflügelhalter in dem betroffenen Gebiet müssen ihre Tiere (Hühner, Rebhühner, Fasane,
Truthühner, Perlhühner, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) in geschlossenen Ställen
halten.
Am Montag sollen die Tiere der beiden Legehennen-Betriebe getötet werden. "Sie gehen
sicher in die Keulung", so Balsliemke.
Über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Tierseuche ist mittlerweile auch ein heftiger
Streit zwischen NRW-Umwelt- und Verbraucherminister Johannes Remmel (Grüne) und dem
niedersächsischen Agrarminister Gert Lindemann (CDU) entbrannt. Lindemann wirft seinem
Kollegen vor, zu spät über die Tierseuche informiert worden zu sein. Es gebe Hinweise, dass
die Geflügelpest bereits seit drei Wochen in Ostwestfalen schwele. Ein Sprecher Remmels
betont dagegen, das NRW-Verbraucherministerium sei vergangenen Dienstag durch den
Kreis Gütersloh über den Geflügelpest-Fall informiert worden und habe umgehend erste
Maßnahmen angeordnet sowie den Betrieb gesperrt.
Transportverbot wird möglicherweise ausgeweitet
Der Kreis Gütersloh betont, dass die Transportverbotszone ausgeweitet werde, sollten sich
weitere Geflügelpest-Fälle in Randgebieten des betroffenen Gebietes ergeben. Mit der Tötung
der infizierten Tiere wurde eine niederländische Firma beauftragt. Die Entsorgung übernimmt
eine Firma im Landkreis Osnabrück, die die Tiere durch ein spezielles Verfahren verbrennt.
Ldw. Wochenblatt Westfalen-Lippe
AKTUELLES
Geflügelgrippe: Putenbestand wird getötet
Nachdem die Laboruntersuchung den Geflügelgrippe-Verdacht bestätigt hat, wird der
Bestand eines Putenmastbetriebs in Rheda-Wiedenbrück getötet.
Das Chemische Veterinäruntersuchungsamt in Detmold hatte die Proben des Betriebs
untersucht. Im Laufe des Samstags wurde gegen Mittag seitens der Abteilung Veterinärwesen
und Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh, Vertretern der Stadt Rheda-
Wiedenbrück und des Technischen Hilfswerks mit den Vorbereitungen begonnen. Durch die
Tötung der rund 5000 Tiere und die anschließende Desinfektion der Stallungen soll die
Geflügelgrippe soweit wie möglich eingedämmt werden, damit sie sich nicht weiter
ausbreitet.
Das Technische Hilfswerk (THW) baute auf dem Betrieb in Rheda-Wiedenbrück die
Desinfektionsschleuse für die Fahrzeuge auf, ein Unternehmen aus den Niederlanden ist mit
der Tötung der Tiere und der Reinigung sowie der Desinfektion der Stallungen beauftragt
worden.
Untersuchungen laufen
Zurzeit gibt es noch zwei weitere Verdachtsbetriebe: Legehennenbetriebe in Rietberg. In
diesen Betrieben sind ebenfalls am Samstag Proben genommen worden. Die Tierärzte der
Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung haben inzwischen Unterstützung
aus Nachbarkreisen erhalten.
Im Ein-Kilometerumkreis um den Putenmastbetrieb wurde eine Sperrzone errichtet. Die
Halter von Geflügel dürfen unter anderem keine Tiere aus ihren Betrieben herausbringen.
Auch deren Bestände werden untersucht. Die 13 Halter von Geflügel im Ein-
Kilometerumkreis des Legehennenbetriebs in Rietberg, wo die Geflügelgrippe als erstes
nachgewiesen wurde, müssen ihre Tiere in geschlossenen Ställen oder nach oben abgedeckten
Unterständen halten. In diesem Gebiet gilt eine zwischenzeitlich erlassene
"Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung".
In Verbindung stehende Meldungen:
Geflügelgrippe: Verbringungsverbot angeordnet
Geflügelgrippe: Niedrig ansteckende Form bestätigt
Geflügelgrippe: 3 weitere Betriebe betroffen
Geflügelgrippe: Verdacht hat sich bestätigt
Geflügelgrippe-Verdacht: 20.000 Hühner auf einem Hof getötet
Die Glocke 29.5.11 Lokalnachrichten » Kreis Gütersloh » Rietberg
Vogelgrippe: Drei weitere Verdachtsfälle
Rietberg-Westerwiehe/Bokel (gl). Nach dem Ausbruch der Geflügelgrippe in einem
Zuchtbetrieb in Bokel gibt es drei weitere Verdachtsfälle im Kreis Gütersloh. Dabei handelt
es sich nach „Glocke“-Informationen um einen Hof in Lintel und zwei in Westerwiehe.
In den drei Betrieben sind nach Angaben der Gütersloher Kreisverwaltung vermehrt Tiere mit
Symptomen aufgefunden worden, die auf die Geflügelgrippe hindeuten. Ein Indiz sei auch der
Rückgang der Legeleistung. Unter den drei seit Freitag betroffenen Höfen sind ein
Putenmastbetrieb und zwei Legehennenbetriebe. Die Höfe befinden sich außerhalb des Ein-
Kilometer-Radius’ um den Hof in Bokel, auf dem die Geflügelgrippe nachgewiesen worden
ist.
Laborergebnis aus Bokel liegt vor
Von dem Bokeler Legehennenhof liegt das endgültige Laborergebnis vor: Es handelt sich wie
angenommen um die leichte Form der Vogelgrippe (Low Pathogenic Avian Influenza). Das
teilte das Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) mit. In
dem Putenmastbetrieb wurde am Freitag eine Probe genommen. Ein erstes
Untersuchungsergebnis des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Ostwestfalen-Lippe
soll am Samstag vorliegen. In den anderen beiden Betrieben werden am Montag Proben
genommen.
Betriebe vorläufig gesperrt
Alle drei Betriebe sind vorläufig gesperrt worden. Keine Tiere dürfen heraus- oder
hineingebracht werden, teilt der Kreis mit. Die beiden Legehennenbetriebe haben zusammen
8000 Tiere, der Putenmastbetrieb 5000 Tiere. Darüber hinaus werden noch Betriebe
untersucht, die von dem Bokeler Legehennenhof Tiere erhalten haben. Innerhalb des Ein-
Kilometer-Radius’ um den Betrieb, auf dem die Geflügelgrippe zuerst nachgewiesen worden
war, gibt es 13 Geflügelbestände mit zusammen etwa 500 Tieren.
Hilfe aus den Nachbarkreisen
Am Freitagmorgen hat der Krisenstab des Kreises Gütersloh getagt. Sowohl die Abteilung
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung als auch die Feuerwehr benötigen
Unterstützung aus den Nachbarkreisen – die Tierärzte unter anderem bei den
Probenentnahmen, die Feuerwehr beim Betrieb der Desinfektionsschleusen.
Ursachenforschung geht weiter
Die Ursache für den Ausbruch der Geflügelgrippe ist nach wie vor unklar. Es handelt sich um
den zweiten Ausbruch in Deutschland innerhalb dieses Jahrs. Vor rund einem Vierteljahr kam
es zu einem Ausbruch der Geflügelgrippe im Raum Cloppenburg, vor rund vier Wochen
einen weiteren in Holland.
Einen Videofilm zum Vogelgrippe-Ausbruch in Bokel finden Sie hier:
http://www.youtube.com/watch?v=teTn95_3Rb8
AHLENER ZEITUNG 27.5.2011 Geflügelgrippe
Weitere Verdachtsfälle im Münsterland
Warendorf/Osnabrück/Rietberg/Rheda-Wiedenbrück - Die Geflügelgrippe ist möglicherweise
aus dem Kreis Gütersloh ins angrenzende Münsterland geschwappt: Nachdem in der Nacht
zum Donnerstag 20.000 Legehennen und Hähne auf einem Hof in Rietberg gekeult wurden,
gibt es zunächst drei weitere Verdachtsfälle.
„Und zwar außerhalb der Sperrzone von einem Kilometer-Radius um den Hof“, sagte der
Sprecher des Kreises Gütersloh. Betroffen seien ein Puten- und zwei Legehennen-Betriebe in
Rheda-Wiedenbrück und in Rietberg.
Die Überprüfung der Lieferwege von Küken aus dem gesperrten Rietberger Betrieb ergab,
dass auch an einen Geflügelhof im Kreis Warendorf geliefert worden war. Der wurde
„vorsorglich gesperrt“, berichtete ein Kreissprecher gestern. „Das heißt aber nur, dass von
hier im Moment keine Tiere rausgehen.“ Die Küken würden auf Geflügelgrippe untersucht,
zeigten aber keinerlei Krankheitssymptome. Bis die Ergebnisse vorlägen, die für Anfang der
Woche erwartet werden, gäbe es keine Sperrzone um den Betrieb.
Bei dem Ausbruch in Rietberg - dem insgesamt zweiten deutschen Fall in diesem Jahr -
handelt es sich offenbar nicht um den aggressiven H5N1-Erreger. Derzeit gehen Experten von
einem milden Typus aus. Eine Gefahr für den Menschen besteht nicht.
Auch im südlichen Landkreis Osnabrück sind zwei Höfe wegen des Verdachts auf
Geflügelgrippe vorsorglich gesperrt worden. Auch sie hatten vor zwei und zweieinhalb
Wochen Eintagsküken des Rietberger Züchters erhalten, wie der Landkreis Osnabrück
mitteilte.
Wie es generell zu solchen Ausbrüchen kommen kann, ist unklar. Bisweilen „reicht es schon,
wenn eine infizierte Ente über den Stall fliegt und etwas fallen lässt, das dann von der Lüftung
des Stalls angesaugt wird,“ erläuterte der Gütersloher Kreis-Sprecher. A und O sei, „früh und
konsequent zu reagieren, um eine Ausbreitung zu verhindern“, Für Landwirte sei die Keulung
des gesamten Tierbestands natürlich ein schwerer Schlag, „weil einem vorerst die
wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen wird.“ Allerdings gibt es eine so genannte
Tierseuchenkasse, die in solchen Fällen einspringt.
Der Kreis Gütersloh hat nun Unterstützung aus den Nachbarkreisen angefordert: von der
Feuerwehr, die für die Desinfektion möglicherweise betroffener Höfe zuständig ist, und von
den Veterinären, die infizierte Tiere auf Befall untersuchen.
Die Veterinäre des Landkreises Osnabrück geben allerdings vorsichtig Entwarnung, da die
Masthähnchen nach mehr als zwei Wochen keine Virenträger mehr sein könnten und nach
überstandener eventueller Infektion höchstens noch Antikörper nachweisbar seien. Seien
diese unbedenklich, könnten die Hähnchen später in den Handel gehen, erklärte Burkhard
Riepenhoff, Sprecher des Landkreises.
Um dazu weitere Erkenntnisse zu gewinnen, wurden gestern noch Proben genommen, die
umgehend nach Oldenburg zum Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (LAVES) geschickt worden sind. Mit Ergebnissen rechnen die
Experten am heutigen Samstag. Über das weitere Vorgehen soll dann entschieden werden.
Auch wenn es bislang keinen Grund zur Besorgnis gebe, könne nicht ausgeschlossen werden,
dass die Bestände doch gekeult werden müssten, sagte Riepenhoff.
VON JULIA GOTTSCHICK UND FRANK KLAUSMEYER
Cellesche Zeitung
"Kirche spielt in Celle wichtige Rolle"
Landesbischof Ralf Meister hat die Dimension des Geflügelschlachthofes in Wietze
kritisiert. Ein respektvoller Umgang mit Nutztieren sei dadurch nicht mehr gegeben,
sagte Meister bei seinem Antrittsbesuch in Celle.
CELLE. Ein enges Besuchsprogramm hat Landesbischof Ralf Meister bei seinem zweitägigen
Antrittsbesuch im Kirchenkreis Celle absolviert. Der Theologe sah sich kirchliche
Einrichtungen an, sprach mit Schülern, informierte sich über neueste Bohrtechnik beim
Unternehmen Baker Hughes und traf mit den Spitzen aus Politik, Verwaltung, Kunst und
Kultur zusammen. So bekam der 49 Jahre alte Nachfolger von Margot Käßmann in der
evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover einen Überblick über die gesellschaftliche
Vielfalt der Region. „Mein Eindruck ist, dass die Kirche eine wichtige Rolle in Celle spielt“,
resümierte Meister. „Sie ist mit ihrem diakonischen Angebot sehr gut aufgestellt.“ Die Frage
sei, wie es der Kirche gelinge, diese Stellung auch in Zukunft zu behalten.
Meister nahm auch an einer Informationsveranstaltung zum umstrittenen Geflügelschlachthof
in Wietze teil. Diesem Vorhaben steht der Landesbischof kritisch gegenüber. „Ich bin
überrascht über die Dimension, um die es dabei geht“, sagte er. Die reine industrielle
Vermarktung von Geschöpfen dürfe keine Option menschlichen Handelns sein. In Wietze soll
der größte Geflügelschlachtbetrieb Niedersachsens entstehen. Dem Vernehmen nach sollen
dort jährlich bis zu 134 Millionen Tiere geschlachtet werden.
Meister hält es für bedenklich, wenn man bei der Nutztierhaltung „Größenordnungen erreicht,
wo die Mitgeschöpflichkeit leidet, weil es der achtsame Umgang mit dem Subjekt Tier nicht
mehr zulässt“. Seine Kritik will der Landesbischof als Mahnung an die Landwirtschaft und
die Verbraucher verstanden wissen. Dass das Konsumentenverhalten einen Wandel bei der
Tierhaltung bewirken kann, machte Meister an dem Verbot der konventionellen Käftighaltung
von Legehennen in Deutschland deutlich. „Da hat sich etwas entwickelt, was ich
außerordentlich begrüße.“ Auf diesem Weg müsse man weitergehen. Grundsätzlich lehnt
Meister die Nutztierhaltung nicht ab. „Es ist eine Frage der Größenordnung.“
Positiv bewertete der Landesbischof die Bündelung kirchlicher Kompetenzen in Celle. Damit
bezog sich Meister einerseits auf das Kirchenamt in der Berlinstraße, das die Kirchenkreise
Celle, Soltau und Walsrode mit rund 160.000 evangelischen Christen verwaltet. Andererseits
lobte er das Haus der Diakonie in der Fritzenwiese, das mit dem markanten Kronenkreuz am
Fahrstuhlschacht auch ein sichtbares Zeichen kirchlichen Engagements setze. In der
Konzentration von Kräften sieht Meister eine Grundlage, wie sich die Landeskirche mit ihren
derzeit 56 Kirchenkreisen in den nächsten zehn bis 15 Jahren aufstellen müsse. „Das ist in
Celle in einer absolut überzeugenden Weise gelungen. Das funktioniert hier.“
Autor: Oliver Gatz, geschrieben am: 24.05.2011
Leipziger Volkszeitung
Eilenburg
Behörde genehmigt Pläne für Schweinemastanlage bei Krippehna Karin Rieck/Frank Pfütze
Zschepplin. Die Nachricht verbreitete sich nach der üblichen amtlichen Bekanntmachung in
dieser Zeitung am Freitag nicht nur in der Gemeinde Zschepplin wie ein Lauffeuer: Die
Kreisverwaltung hat den dänischen Investoren, die zwischen den Orten Zschepplin,
Krippehna und Steubeln eine Schweinemastanlage mit zirka 11 000 Mastplätzen errichten
wollen, für ihr Projekt die Genehmigung erteilt. Gegen die Pläne wehren sich Anwohner und
Bürger der Muldegemeinde seit Jahren vehement.
Allen voran Hans-Udo Weiland, sächsischer Landesvorsitzender des Bundes für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND). „Jetzt geht der Kampf gegen Umweltzerstörung und
Tierquälerei erst richtig los", kündigte der Steubelner eine Verschärfung der schon länger
andauernden Auseinandersetzungen mit der Kreisverwaltung in einer ersten Stellungnahme
an. Es würden nunmehr nicht nur alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausgeschöpft.
„Wir werden den Protest auch auf die Straße tragen, zu den Gülleabnehmern in der Region, zu
den Landverkäufern, zum Landratsamt nach Eilenburg und Torgau sowie vor die Haustür der
Investoren", die am Rand von Leipzig mit der Firma Schweinemast MHW GmbH ihren Sitz
haben. Welche konkreten Aktionen geplant sind, blieb zunächst offen. Weiland warf seinen
Kontrahenten vor, sie würden ungesetzlich handeln und sich damit außerhalb der Gesellschaft
stellen. „In eklatant rechtswidriger Weise hat sich das Landratsamt Nordsachsen über die von
Bürgern, ortsansässigen Unternehmen und dem BUND in Sachsen vorgebrachten rechtlichen
Argumente hinweggesetzt", so der Vorsitzende. „Selbst das verweigerte Einvernehmen der
Gemeinde Zschepplin wurde ohne zwingenden Grund ersetzt und damit der Bau der Anlage
überhaupt erst ermöglicht."
Im Landratsamt wird die Genehmigung verteidigt. Für Landrat Michael Czupalla (CDU)
nimmt ein langer Prozess „ein erfreuliches Ende. Ich begrüße die Ansiedlung und wünsche
dem Unternehmen alles Gute. Ich fordere aber auch, dass die Investoren informieren,
aufklären und so für Einklang mit ihren Nachbarn, mit den Bürgern sorgen. Wenn sich
Investoren ansiedeln ist das immer positiv zu betrachten, natürlich müssen solche Prozesse
immer im Konsens mit Mensch und Natur stehen", sagte Nordsachsens Landrat am Freitag
auf Anfrage dieser Zeitung. Auch für die Chefin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises, Uta Schladitz, geht die Ansiedlung nur im „gegenseitigen Miteinander" mit den
Anwohnern. „Die Ansiedlung ist ein positives Signal und Wertschöpfung für den Landkreis.
Gerade in der Landwirtschaft ist viel weggebrochen. Eine starke Landwirtschaft stärkt den
Landkreis."
Mehr lesen Sie in der Kreiszeitung am 14. Mai, Seite 22.
Merkur Online
Geflügel-Massenhaltung: Anwohner protestieren gegen Riesen-Stall
17.05.11|Lkr. Freising|29
München/Moos - Geflügel liegt im Trend: Immer mehr Landwirte wollen davon profitieren
und setzen auf Massenhaltung. Im Landkreis Freising soll jetzt ein Stall für 40.000 Hühner
gebaut werden. Entsetzte Anwohner versuchen, das zu verhindern.
Sie werden zu Tausenden in gewaltigen Brutmaschinen geboren. Die winzigen Küken wiegen
gut 40 Gramm, wenn sie aus dem Ei schlüpfen. Sie werden geimpft, in einen Lastwagen
verladen und zu ihrem Mastbetrieb gefahren. Dort verbringen sie ihr ganzes Leben. Es dauert
knapp 40 Tage.
Es ist ein enges Leben. Im Fachjargon spricht man von der „maximal erlaubten Besatzdichte“
der „Lebendmasse“. Im Klartext: Rund 23 Hühner teilen sich einen Quadratmeter Platz. So
erlaubt es der Gesetzgeber. Das nutzt dem Mastbetrieb, denn je weniger sich ein Huhn
bewegt, desto mehr Fett setzt es an. Nach nur fünf Wochen haben sie das 40-fache ihres
Gewichts zugelegt - und sind damit schlachtreif.
Züchter und Mastbetriebe haben aus der Tierhaltung eine hocheffiziente Maschine gemacht.
Die gesetzlichen Vorgaben hierzu stammen noch aus einer Zeit, als möglichst viel möglichst
billig produziert werden sollte, kritisiert der Bund Naturschutz (BN). Der Trend gehe zu
Ställen mit knapp unter 40 000 Hühnern. Denn alle Anlagen, die maximal 39 999 Tiere
mästen, werden ohne Öffentlichkeitsbeteiligung von den Behörden geprüft.
Genau so eine Anlage plant auch ein Landwirt in Moos bei Zolling (Kreis Freising). Vor
Ostern hat er den Antrag beim Landratsamt gestellt, jetzt prüft die Behörde. Noch bevor eine
Entscheidung gefallen ist, formiert sich Protest. Eine Interessengemeinschaft organisiert den
Widerstand. „Keine Hühnermastfabrik im Ampermoos“, fordern sie. „Im Akkord zur
Schlachtbank“, steht auf ihrer Internetseite. Sie fürchten, dass der aggressive Hühnerkot Luft,
Boden und Grundwasser mit Ammoniak, Antibiotika und Krankheitserregern verschmutzt.
Wenn das wirklich so wäre, rechtfertigt sich der Landwirt, „würde man das niemals
genehmigen“. Auch den Aufschrei der Tierschutzorganisationen kann er nicht nachvollziehen.
Rückendeckung bekommt der Bauer vom Bauernverband (BBV): „Wenn man die
automatisierte Produktion vor Ort verhindert, wandert sie in Länder wie Brasilien oder China
ab, wo überhaupt keine Tierschutz-Gesetze gelten“, warnt BBV-Kreisgeschäftsführer Gerhard
Stock. Eine andere Form der Haltung sei schlicht nicht konkurrenzfähig. Für ihn ist der
Widerstand bedenklich: „Obwohl sich der Landwirt im gesetzlichen Rahmen bewegt, wird er
nun öffentlich diffamiert“, mahnt Stock.
An dieser „Diffamierung“ will sich die BN-Landwirtschaftsexpertin Marion Ruppaner nicht
beteiligen. Sie kritisiert vor allem das „System Wiesenhof“: „Der Bauer ist nicht mehr
selbstständiger Unternehmer, sondern nur noch Lieferant für einen Industrie-Konzern.“
Wiesenhof verkaufe die Tiere, das Futter, die Impfstoffe - und hole anschließend die
gemästeten Hühner per Lastwagen ab. Die PHW-Gruppe, zu der auch Wiesenhof gehört, ist
der größte Geflügelzüchter Deutschlands. Jede Woche schlachtet das Unternehmen rund 4,5
Millionen Hähnchen. Auch der neue Mastbetrieb in Moos - sollte er denn gebaut werden -
würde an Wiesenhof liefern.
Die Anwohnerinitiative will das verhindern. Der Protest schlägt Wellen. Heute will der
Bayerische Rundfunk eine Podiumsdiskussion in Moos live in der Abendschau übertragen.
Die Entscheidung über eine Bau-Genehmigung liegt aber allein beim Landratsamt - und das
will nicht vor Juli ein Machtwort sprechen.
Der Zoff in Zolling ist kein Einzelfall. Auch in Ried, an der Grenze zwischen den
Landkreisen Aichach-Friedberg und Fürstenfeldbruck, gibt es derzeit Streit über einen
geplanten Stall. Auch hier sollen knapp 40 000 Hühner gemästet werden. Auch hier laufen die
Bürger Sturm. Rund 70 Gegner hielten Protestplakate bei einer Sitzung des Bauausschusses
hoch. Die Entscheidung wurde vertagt.
Thomas Schmidt
OV
Konsens bei den Tierhaltungsanlagen in Neuenkirchen-Vörden scheint möglich
Neuenkirchen/Vörden (kpl) - Landwirt Rainer Duffe aus Campemoor kann mit dem
Beschluss des Gemeinderates vom Dienstagabend zur planerischen Steuerung von
Tierhaltungsanlagen leben, sein Berufskollege Josef Schönfeld aus Nellinghof auch: Das
deutet darauf hin, dass es bei der Aufstellung von Plänen, wo zukünftig im
Gemeindegebiet Tierhaltungsanlagen entstehen dürfen, ein Konsens zwischen der Politik
und der Landwirtschaft erzielt werden kann.
Mehr steht am Donnerstag, 26. Mai, in der gedruckten Ausgabe der OV und im OV-
Epaper .
SVZ
Keine Eier aus Dreenhörn
25. Mai 2011 | 21:58 Uhr | von take
Eier über Eier: In Dreenhörn werden sie nicht gelegt.dpa
NEUSTADT-GLEWE - Die Mecklenburger Frischei Farm Dreenhörn Eins GmbH wird keine
Legehennenanlage in Dreenhörn bauen. Wie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und
Umwelt nun der Stadt Neustadt-Glewe mitteilte, habe der Antragsteller seinen Antrag
zurückgezogen. Die Mecklenburger Frischei Farm Dreenhörn Eins GmbH hatte geplant, in
der Nähe der Friedrichsmoorschen Allee auf gut 165 000 Qudratmetern eine Anlage für rund
39 400 Legehennen zu errichten.
"Welche Gründe letztlich genau zu dieser Rücknahme führten, ist uns nicht bekannt", sagt
Bürgermeister Arne Kröger. Neustadt-Glewes Stadtvertretung hatte im Februar das
gemeindliche Einvernehmen zu diesem Vorhaben erteilt, damit jedoch die Auflage
verbunden, dass der Investor die Kosten für den Ausbau der zur Anlage führenden Straße
übernehmen muss. Welche Kosten damit verbunden worden wären, sei, so Kröger, noch nicht
berechnet worden.
Das Forstamt Ludwigslust hatte außerdem angemerkt, dass die geplante Legehennenanlage im
Einzugsbereich der geplanten A 14 liegt. "Und im Planfeststellungsverfahren ist dort auch der
Bau einer Wildbrücke geplant", sagt Ludwigslusts Forstamtsleiter Dr. Holger Voß.
Taz
25.05.2011
Waldgesetze in Brasilien
Agrarlobby düpiert Präsidentin Roussef
Das brasilianische Abgeordnetenhaus stimmt für mehr Landwirtschaft und weniger
Waldschutz. Das ist ein herber Rückschlag für die Staatschefin. VON GERHARD DILGER
PORTO ALEGRE taz | Im Parlament von Brasília hat Präsidentin Dilma Rousseff in der
Nacht zum Mittwoch die erste bittere Niederlage seit ihrem Amtsantritt am 1. Januar erlitten:
Mit großer Mehrheit verabschiedeten die Abgeordneten im vierten Anlauf eine Novelle des
Waldgesetzes aus dem Jahr 1965. Nach einer zweijährigen Debatte wähnt die Agrarlobby eine
Lockerung mit einer weitreichenden Amnestie für Waldzerstörer nun zum Greifen nah. "Die
Botschaft ist klar: Wer das Gesetz nicht befolgt, hat einen Vorteil", sagte der
Grünenabgeordnete Sarney Filho.
Das Lavieren der Staatschefin zahlte sich nicht aus. Sie hatte mit dem Agrobusiness, das nicht
nur in der rechten Opposition, sondern auch im Mitte-links-Regierungslager und in der
Regierung prominent vertreten ist, einen halbherzigen Kompromiss aushandeln lassen.
Demnach dürfen sogenannte kleine Landeigentümer - die in manchen Amazonasgemeinden
bis zu 440 Hektar besitzen können - künftig weitgehend auf Schutzgebiete verzichten.
Die Novelle wurde mit 410 zu 63 Stimmen angenommen, auch mehr als die Hälfte der 80
Abgeordneten von Rousseffs Arbeiterpartei PT stimmten zu. Dann legten die Agrarier nach:
Die Schutzgebiete auf Bergkuppen, an Hügeln, Flussufern oder Quellgebieten sollen reduziert
und die Zuständigkeit dafür den Bundesstaaten übertragen werden, wo die Farmer noch mehr
zu sagen haben als auf Bundesebene. Die Agrarallianz, die vom kommunistischen
Berichterstatter Aldo Rebelo bis zu den Großgrundbesitzern auf den Oppositionsbänken
reicht, will erreichen, dass landesweit 420.000 Quadratkilometer bisheriger Schutzgebiete für
den Landbau freigegeben werden.
Präsidentin Roussef hatte im Wahlkampf 2010 gelobt, keine Amnestie für große
Umweltsünder zuzulassen. Vor zwei Wochen war es ihrer PT noch gelungen, einen Aufschub
der Abstimmung zu erreichen. Jetzt zogen nur noch die Minifraktionen der Grünen und der
freiheitlichen Sozialisten der PSoL mit, ebenso die Sozialisten der PSB. Rousseffs
gewichtigster Koalitionspartner, die Zentrumspartei PMDB, schlug sich hingegen geschlossen
auf die Seite der Opposition. "Es ist der größte Rückschritt in der Geschichte unserer
Umweltgesetzgebung", twitterte der Forstingenieur Tasso Azevedo.
Vor der Abstimmung empfing Rousseff mehrere frühere Umweltminister, die in einem
offenen Brief an sie appelliert hatten, die Pläne der Agrarlobby zu durchkreuzen. Ob die
Regierung die Novelle samt Zusatz nun im Senat nachbessern kann, ist aber fraglich. Als
letzter Schritt bliebe der Präsidentin, die auch um den guten Ruf Brasiliens fürchtet, nur noch
das Veto.
dradio.de http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/1450975/
UMWELT UND VERBRAUCHER
05.05.2011
Trendwende im Tierschutz Niedersachsen will Schnäbelkürzen bei Puten verbieten
Von Susanne Schrammar
Ausgerechnet in Niedersachsen, dem Bundesland mit den meisten
Massentierhaltungsbetrieben, bewegt sich etwas. Gert Lindemann, seit Januar neuer
Landwirtschaftsminister, will das Kürzen von Schnäbeln bei Puten verbieten.
Tierschützer hoffen nun auf noch weitere Schritte.
Ein Geflügelstall, wie es ihn in Niedersachsen viele gibt: Zigtausende Hühner oder Puten
drängeln auf dem Boden, zwischen ihnen ist kaum Platz. Keines der Tiere hat einen Schnabel,
wie die Natur ihn vorsieht: Er ist nicht mehr spitz, sondern leicht gerundet. Gleich am ersten
Tag, wenn die Küken geschlüpft sind, wird ihnen die Spitze des Schnabels mit einem
Infrarotlaser abgeschnitten. Das, sagt der Präsident des niedersächsischen Landesverbandes
der Geflügelwirtschaft, Wilhelm Hoffrogge, sei in Beständen nötig, in denen mehr als 50
Tiere zusammen leben. Sonst würden sie sich zu Tode picken.
"Es liegt an dem natürlichen Verhalten der Tiere, dass sie also ihre Artgenossen in der Weise
nicht mehr erkennen, ob es ein rangniederes Tier ist oder ein ranggleiches Tier oder ein
ranghöheres Tier ist und dann werden immer Rangkämpfe geführt. Und um diese
Rangkämpfe nicht ausarten zu lassen, deswegen nimmt man den Tieren die kleine
Schnabelspitze ab, damit keine Verletzungen auftreten können."
Schnäbelkürzen verstößt gegen das Tierschutzgesetz, doch Landwirte in Niedersachsen
konnten sich bisher großzügige Ausnahmegenehmigungen erteilen lassen. Damit soll bald
Schluss sein. Der neue niedersächsische Landwirtschaftsminister Gert Lindemann, CDU,
sieht in seinem kürzlich vorgelegten Tierschutzplan vor, bis 2015 die gängige Praxis verbieten
zu lassen. Dies fordern Tierschützer wie Maria Groß von der Arbeitsgemeinschaft für
artgerechte Nutztierhaltung schon seit Jahren. Im Schnabel, erklärt Groß, befände sich
nämlich ein für die Tiere wichtiges Tastorgan mit vielen Nerven.
"Wenn man die Schnabelspitze schneidet, kommt es nicht dem Abschneiden eines
abgestorbenen Gewebes gleich, wie bei dem Kürzen von Fingernägeln. Sowohl der
Augenblick des Schneidens ist für den Vogel sehr schmerzhaft, aber auch der verbleibende
Phantomschmerz behindert und beeinträchtigt den Vogel sein Leben lang."
Minister Lindemann fühlt sich stärker als seine Vorgänger, die teilweise direkte
Verbindungen in die Landwirtschaft hatten, den Verbrauchern verpflichtet und hat deshalb die
Trendwende im Tierschutz eingeläutet.
"Ich möchte, dass Landwirtschaft von Verbrauchern auch akzeptiert wird und das bedeutet,
dass dort, wo es Haltungsdefizite gibt, eben auch Veränderungen herbeigeführt werden."
Doch die Landwirtschaftsverbände sträuben sich. Zum einen fühlen sie sich in ihrer
Berufsehre gekränkt. Die Politik überdrehe und vergesse, dass die Landwirte im Tierschutz
auch in der Vergangenheit schon einiges getan hätten, sagte der niedersächsische
Landvolkpräsident Werner Hilse kürzlich auf einer Veranstaltung. Zum zweiten bezweifeln
sie, ob bis 2015 vom Schnäbelkürzen tatsächlich eine Abkehr erfolgen kann. Laut
Geflügelpräsident Hoffrogge wäre mit einem Verlust von bis zu 50 Prozent des Bestandes zu
rechnen, wenn die Tiere mit spitzen Schnäbeln gehalten würden.
"Das kann nicht im Sinne des Tierschutzes sein, deswegen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt
auf die Schnäbelbehandlung nicht zu verzichten."
Zwar wollen einige Landwirte, darunter auch Hoffrogge, einen Modellversuch der
Geflügelhaltung ohne Schnäbelkürzen durchführen, doch eine Umsetzung bis 2015 halten
viele Verbandsfunktionäre für nicht machbar. Entsprechende Züchtungen etwa bei Puten
würden um einiges länger dauern, heißt es. Auch ein weiterer Punkt des Lindemannschen
Tierschutzplanes, das Kupieren von Ferkelschwänzen zu verbieten, sei nicht umsetzbar.
Landvolkpräsident Hilse tat die Ankündigungen des Ministers gar als "Getöse" ab. Politprofi
Lindemann, der vor seinem Amtsantritt mehr als 20 Jahre im niedersächsischen und im
Bundeslandwirtschaftsminsterium tätig war, bleibt indes gelassen und gibt sich
durchsetzungsstark.
"Ja, wissen Sie, Lobbys äußern sich gelegentlich ja etwas pointiert und die Realität ist dann
meistens eine andere. Ich hab am Anfang gleich gesagt, es wird auch Gruppen geben, die sich
möglicherweise einem solchen Verfahren verweigern. Die sollen dann aber durchaus wissen,
dass das nicht das Ende des Verfahrens ist, sondern der Beginn, das Verfahren ohne ihre
Beteiligung fortzusetzen."
NDR
NDR 90,3 28.05.2011 08:40 Uhr
"Mir wurde klar, wie wenig ich weiß" von Jörn Straehler-Pohl
Genau vor einer Woche gab es hier in Hamburg die erste Krisen-Sitzung der Behörden
wegen des EHEC-Erregers. Inzwischen haben wir einen Toten zu beklagen, die Zahl der
Infizierten und Erkrankten steigt weiter, und die Wissenschaftler des Hygiene-Instituts
versuchen, die Wege des Keims zu ergründen. Jörn Straehler-Pohl berichtet seit Anfang
an über den Erreger und fragt sich, was die Angst vor EHEC für ihn bedeutet.
Heute Vormittag bin ich wieder auf dem Großneumarkt - wie an fast jedem Sonnabend, ich
wohne in der Nähe. Käse, Brot, Obst, vielleicht noch einmal Spargel. Eigentlich hielt ich mich
immer für einen halbwegs bewussten Verbraucher - trotz der gelegentlichen Fertig-Pizza und
dem Dosen-Bier dazu. Diese Woche wurde mir klar, wie wenig ich dann wohl doch über
Lebensmittel weiß.
Werden jetzt im Mai schon Tomaten in den Gewächshäusern rund um Hamburg angebaut und
geerntet? Oder Blattsalat? Oder Gurken? Was wächst überhaupt gerade in den
Gewächshäusern und auf den Feldern? Welche Lebensmittel genau werden gerade importiert,
welche kommen von hier? Nein, ich weiß es nicht.
Je größer die Produktion, desto größer das Risiko
Und eigentlich will ich auch gar nicht so viel wissen. Über die Massen-Produktion von
Lebensmitteln zum Beispiel. Natürlich: Schon immer sind Menschen an verkeimten oder
verseuchten Lebensmitteln erkrankt, häufig genug auch gestorben. Aber es ist eine Sache, ob
sich ein kleiner, regionaler Produzent nicht an Hygiene-Bestimmungen hält. Eine andere,
wenn es ein großer Erzeuger oder gar ein Massen-Produzent ist. Je größer die Produktion,
desto größer das potentielle Risiko - trotz aller Kontrollen.
Hamburg hat in der aktuellen EHEC-Krise vieles richtig gemacht. Eine Gesundheitssenatorin,
die keine Panik schürt, aber auch nicht verharmlost. Ein Hygiene-Institut, dessen Mitarbeiter
im nächsten Tatort auftreten könnten, weil sie die Nadel im Heuhaufen entdeckt haben. Ärzte,
Schwestern und Pfleger in den Krankenhäusern, die alles geben, um die Patienten zu heilen.
Würde der HSV so spielen, wie dort gearbeitet wird, er wäre Deutscher Meister.
Die ersten Erfolge dürfen nicht blind machen
Diese Hamburger Erfolge gegen EHEC dürfen aber nicht blind machen. Sondern die Krise
sollte genutzt werden, um grundsätzlich über die Produktion unserer Lebensmittel
nachzudenken. Denn das Problem liegt nicht nur in der spanischen Gurke - sondern offenbar
auch in der Massentierhaltung. Weil Rinder dort mit Antibiotika vollgepumpt werden, sind
die EHEC-Keime resistent gegen diese Arzneimittel. Und dies gilt nicht nur für EHEC-
Keime, sondern eine Vielzahl von Bakterien - schlechte Aussichten bei künftigen Krankheits-
Ausbrüchen.
Natürlich: Eigentlich sind das alles Dinge, die man nicht so genau wissen will. Ich mache, wie
viele, jetzt einen Bogen um Gurken, so wie wir beim Futtermittel-Dioxin-Skandal einen
Bogen um Hühner-Eier gemacht haben. Wir sollten es uns nicht mehr so einfach machen.
Vielleicht ist es naiv, eine Rückkehr zu einer stärker bäuerlichen Landwirtschaft zu fordern.
Aber vor 30 Jahren war es auch noch naiv, gegen Atomkraft auf die Straße zu gehen. Jetzt
aber gehe ich erst einmal auf den Wochenmarkt. So wie fast jedes Wochenende.
[ » ah nachrichten für die Landwirschaft » Bio » Bestandsgrößen ]
Dienstag, 31.05.2011
Bio | 28.05.2011
Sauenhaltung: Bestandsgrößen im Ökolandbau wachsen Grub - Während in Bayern der Großteil der Betriebe weniger als zehn Sauen hält, werden in
Nord- und Ostdeutschland Bestände mit 100 Zuchtsauen aufgebaut.
Während in Nord- und Ostdeutschland seit einigen Jahren auch im Ökolandbau große
Bestände mit 100 Zuchtsauen und mehr aufgebaut werden, halten in Bayern zwei Drittel der
Öko-Betriebe weniger als zehn Sauen. Es gibt hier bisher nur wenige Sauenhalter im
Vollerwerb. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Schweinefleisch aus ökologischer
Tierhaltung seit Jahren an. Vor diesem Hintergrund sehen die LfL und die Ökolandbau-
Fachberatung Handlungsbedarf, die ökologischen Schweinehalter mit Maßnahmen und
modellhaften Lösungen zu unterstützen. Hierzu organisierte die Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL) in Grub eine Fachtagung zu den aktuellen Herausforderungen in der
Sauenhaltung und Ferkelaufzucht im Ökologischen Landbau statt.
Wärmehaltung mit einfachen Maßnahmen verbessern
Die Referenten der LfL konnten eine Reihe von Maßnahmen aufzeigen, wie die
Wirtschaftlichkeit der Öko-Sauenhaltung erhöht werden kann. Projektkoordinatorin Dr.
Christina Jais und Miriam Abriel zeigten im Teilprojekt Haltung unter anderem, wie in
Ställen mit Auslauf die Wärmehaltung im Ferkelnest mit einfachen Maßnahmen verbessert
werden kann. Johannes Uhl und Josef Weiß untersuchten die ökonomischen Aspekte und
stellten anzustrebende Zielgrößen vor. So macht das bessere Drittel der Betriebe deutlich,
dass bei 40 Tagen Säugezeit 20 und mehr verkaufte Ferkel pro Sau und Jahr möglich sind.
Rationalisierungspotentiale in der Arbeitswirtschaft zeigten Stefanie Beyer und Dr. Bernhard
Haidn auf. Sie nannten Beispiele, wie das für den Ökolandbau typische Einstreuen
zeitsparender gestaltet werden kann. Einen tiergerechten Modellstall mit optimierten Räumen
und Funktionen stellten Frank Schneider und Jochen Simon vor. In seinem abschließenden
Statement fasste der Moderator, Öko-Berater Jürgen Herrle, den erreichten Forschungsstand
zusammen und wies auf die noch offenen Fragen hin. pd
Hamburger Abendblatt
31. Mai 2011, 06:00 Uhr
Tierschutz entzweit Regierung und Landwirte
Niedersachsens Ministerpräsident wirbt beim Landesbauerntag für strengere Regeln. Betriebe
fürchten um ihre Konkurrenzfähigkeit
Cloppenburg. Die Videoaufnahmen von Tierquälerei in der Putenzucht, die unlängst für breite
Empörung sorgten, haben offenbar auch die niedersächsische Landesregierung nachhaltig
beeindruckt. Beim Landesbauerntag in Cloppenburg signalisierten gestern sowohl
Ministerpräsident David McAllister als auch Landwirtschaftsminister Gert Lindemann (beide
CDU), dass es ihnen mit der geplanten Tierschutzoffensive ernst ist.
Wie schief deshalb der Haussegen zwischen CDU und Landvolk Niedersachsen derzeit hängt,
machte umgehend Landvolkchef Werner Hilse deutlich, der dem Ministerpräsidenten vorhielt,
er habe wohl den gesellschaftlichen "Mainstream im Nacken". Das Thema werde von Angst
gesteuert, bei den Verbrauchern von der Angst um Umwelt, Tierwohl und
Lebensmittelsicherheit und bei den Bauern von Angst um die Existenz ihrer Betriebe.
Der Regierungschef lobte die Agrarwirtschaft als Konjunkturlokomotive, aber er machte auch
klar, dass das Schnabelkürzen bei Puten und die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung nicht
zu seinen ethischen Maßstäben passen: "Es kann nicht darum gehen, die Tiere dem jeweiligen
Haltungssystem anzupassen, sondern es müssen die Haltungssysteme den Bedürfnissen der
Tiere angepasst werden." Und mit Blick auf die Kaufzurückhaltung der Konsumenten nach
dem Bekanntwerden der Putenquälerei, aber auch des Skandals um dioxinverseuchtes
Tierfutter warnte McAllister die Bauern: "Nutztierhaltung kann auf Dauer nur erfolgreich
betrieben werden, wenn sie gesellschaftlich akzeptiert ist und bleibt."
Landwirtschaftsminister Lindemann bot der Agrarbranche den geforderten Dialog über die
konkreten Schritte zu mehr Tierschutz an, ließ aber keinen Zweifel daran, dass es angesichts
der "hohen emotionalen Betroffenheit" der Verbraucher um konkrete Schritte geht, "um die
Akzeptanz der Verbraucher nicht zu verlieren".
Landvolkpräsident Hilse forderte dagegen "mehr Fakten und weniger Emotion in der
Tierschutzdiskussion". Mit dem "Kampfbegriff Massentierhaltung" werde versucht, die
Bauern in allen aktuellen Krisen wie jetzt auch bei den EHEC-Infektionen als Mittäter
abzustempeln: "Das sind Versuche, moderne Tierhaltung als verwerfliches und unmoralisches
Geschäft darzustellen." Hilse macht die Zustimmung zum Tierschutzplan abhängig von
"sinnvollen und praktikablen Regelungen" und auch davon, dass Niedersachsens Landwirte
gegenüber ausländischen Mitbewerbern nicht benachteiligt würden.
Die niedersächsische Landesregierung dagegen strebt eine Vorreiterrolle an, weil die
Landwirtschaft hier so wichtig ist wie sonst nirgendwo in Deutschland: In Niedersachsen
werden 20 Prozent aller Rinder, 30 Prozent aller Schweine und die Hälfte des Geflügels
gehalten. Die Branche beschäftigt rund 170 000 Menschen.(fert)
30. Mai 2011, 10:18 Uhr
Niedersachsen Landesregierung setzt auf Dialog mit den Landwirten abendblatt.de
Bei der Umsetzung des Tierschutzplans solle die Agrarwirtschaft konstruktiv mitwirken.
Viele Landwirte kritisieren den 38-Punkte-Plan.
Osnabrück. Bei der Umsetzung des neuen Tierschutzplans setzt die niedersächsische
Landesregierung auf einen Dialog mit den Landwirten. Die Agrarwirtschaft solle dabei
konstruktiv mitwirken, sagte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Gert Lindemann (CDU)
am Montag auf dem Landesbauerntag in Cloppenburg. „Nur eine Lösung, die praxistauglich
ist, kann den Tierschutz wirklich voranbringen.“ Ministerpräsident David McAllister (CDU)
betonte, der ländliche Raum sei das Rückgrat des Landes. Aber Nutztierhaltung könne auf
Dauer nur erfolgreich betrieben werden, wenn sie gesellschaftlich akzeptiert werde. Und jeder
Verstoß gegen Tierschutz schade letztlich dem Ruf der Landwirtschaft.
Landvolk Präsident Werner Hirse sagte zu dem 38-Punkte-Plan der Landesregierung, er hoffe,
dass darüber ergebnisoffen diskutiert werde. Er erwarte in der Tierschutzdiskussion weniger
Emotionen. Das Thema werde von Angst gesteuert, bei den Verbrauchern von der Angst um
Umwelt, Tierwohl und Lebensmittelsicherheit und bei den Bauern von Angst um die Zukunft
und Existenz ihrer Betriebe.
„Man fühlt sich an den Pranger gestellt“, sagt Landwirtin Clara Rolfes. Die junge Frau
arbeitet in einem Familienbetrieb mit Großeltern und Eltern – ein Hof mit 4500 Schweinen
und Ackerbau. „Moderne Stallgebäude haben Lüftung, Wasser, Licht“, sagt sie am Montag
und zeigt auf ein Transparent „Kein Platz. Kein Licht. Kein Leben. Stoppt Tierfabriken“. Der
Deutsche Tierschutzbund demonstrierte vor dem Landesbauerntag für artgerechte Tierhaltung
und den Erhalt bäuerlicher Strukturen. Wolfgang Apel, Präsident des Tierschutzbundes,
betonte, „es kann nicht so bleiben wie es ist“. Er forderte Lindemann auf, konsequent den
Weg zu mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung zu gehen.
Der 38-Punkte-Plan soll bis 2018 abgearbeitet sein. Erste Maßnahmen sollen bereits in diesem
Jahr greifen. Dazu zählen unter anderem Eingriffe an Nutztieren ohne Betäubung, wie das
Kastrieren männlicher Ferkel und das Kupieren der Schwänze bei Schweinen. „Ohne der
Diskussion vorweg zugreifen – für mich steht fest: Das Schnabelkürzen bei Puten und die
Kastration bei Ferkeln ohne Betäubung sind mit meinen ethischen Maßstäben nicht
vereinbar“, sagte McAllister.
Niedersachsen ist das Agrarland Nummer 1. Rund 2,6 Millionen Rinder, 8,2 Millionen
Schweine, 50 Millionen Hühner und 5,3 Millionen Puten werden gehalten. Rund um
Cloppenburg im Oldenburger Münsterland herrscht die größte Viehdichte. (dapd-nrd)
NDR
Stand: 30.05.2011 19:45 Uhr
Bauerntag: McAllister verteidigt Tierschutzplan
Ministerpräsident David McAllister (CDU) hat beim Landesbauerntag in Cloppenburg den
Tierschutzplan von Landwirtschaftsminister Gert Lindemann (CDU) verteidigt.
Niedersachsen stehe mit seiner Viehhaltung in hoher Verantwortung und unter besonderer
öffentlicher Beobachtung, sagte McAllister. "Jeder Verstoß gegen den Tierschutz, der
öffentlich diskutiert wird, schadet letztlich dem Ruf der Landwirtschaft", so der
Ministerpräsident. Er sprach sich für eine tiergerechte und ökonomisch erfolgreiche
Tierhaltung aus. Landvolk-Präsident Werner Hilse warnte vor wirtschaftlichen Nachteilen für
die heimische Viehwirtschaft durch strengere Tierschutzvorgaben. Man wolle den
Tierschutzplan nun "ergebnisoffen" diskutieren. Lindemann hatte seinen 38-Punkte-Plan Ende
April bekanntgemacht.
Diskussionen um Tierschutzplan
Der Tierschutzplan steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen auf dem Landesbauerntag
in Cloppenburg.
180-Grad-Wende ausgeschlossen
Lindemanns Plan sieht unter anderem vor, das Kürzen von Schnäbeln bei Geflügel bis 2018
zu beenden. Bis 2015 sollen Schweinehalter erproben, Ferkel nicht mehr ohne Betäubung zu
kastrieren. Hilse nannte die genannten Zeiträume "sehr ambitioniert". Aber das
Diskussionsangebot der Landesregierung wolle er gerne annehmen. "Wir nehmen sie beim
Wort", sagte der Präsident des Landvolkes. Es sei wichtig, einen Weg zu finden, "der uns in
Niedersachsen nicht ins Abseits bringt". Eine "180-Grad-Wende" im System, schloss
Lindemann aber erneut aus. Problematische Entwicklungen aber wolle er korrigieren.
Mehr Steuerungsmöglichkeiten für Landkreise
McAllister hatte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) einen Vorstoß auf Bundesebene
angekündigt, um die Errichtung von Massen-Tierställen einzuschränken. Landkreise mit
besonders hoher Tierdichte müssten mehr Möglichkeiten bekommen, die Ansiedelung von
Tierställen zu steuern. Dies soll nach den Plänen der Landesregierung über eine Änderung des
Bauplanungsrechts erreicht werden. Dazu gehöre auch die Frage, ob großgewerbliche Ställe
weiterhin bevorzugt werden, so McAllister. Die Grünen im Niedersächsischen Landtag
begrüßten den Vorstoß der Landesregierung. "Jetzt steht der Ministerpräsident im Wort",
sagte Fraktionsvize Christian Meyer in Hannover. Bislang hätten CDU und FDP sowohl im
Landtag wie auch auf Bundesebene immer gegen entsprechende Initiativen gestimmt.
NOZ
30.05.2011 | 22:00 Uhr
| 0 Gefällt mir | | |
Neue OZ: Kommentar zu Landesbauerntag in Cloppenburg/Tierschutz
Osnabrück (ots) - Weichenstellung unvermeidbar
Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister mag rhetorisch noch so geschickt sein. So
lobt er die Bauern artig für harte Arbeit, hebt die Landwirtschaft als Jobmotor für
Niedersachsen heraus. Tatsächlich hat er auf dem Landesbauerntag in Cloppenburg jedoch
keinen Zweifel daran gelassen, dass seine Regierung an den Tierschutz-Plänen festhält -
notfalls gegen den Widerstand der Bauern-Funktionäre.
Deren Strategie ist zwar insofern verständlich, als es unter den Landwirten wegen drohender
Einschnitte und Vorgaben für ihre Arbeit kräftig rumort. Der Landesbauernverband wird
jedoch nicht umhinkommen, Zugeständnisse zu machen, statt stur alles beim Alten lassen zu
wollen. Das gilt etwa für das Kupieren von Schweineschwänzen, das Stutzen von Schnäbeln
oder die Ferkelkastration ohne Betäubung. Verpassen die Verbände diese Weichenstellung,
geraten diejenigen noch mehr in Gefahr, deren Interessen sie vertreten.
Denn die Bauern sind in diesem Jahr gebeutelt wie schon lange nicht mehr. Auf eines können
die Landwirte nun ganz sicher verzichten: das Vertrauen der Verbraucher vollends zu
verlieren. Diese verhalten sich wegen des Dioxin-Skandals und der EHEC-Krise noch
kritischer gegenüber der Agrarwirtschaft. Einen Fehler sollten sie indes vermeiden: Bauern
pauschal als Übeltäter zu diffamieren.
Pressekontakt:
Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion
Landvolk Aktuelles aus Land und Forst Tierschutz muss sinnvoll und praktikabel sein
30. Mai 2011
L P D - Auf mehr Fakten und weniger Emotionen drängt Landvolk-Präsident Werner Hilse in
der Tierschutzdiskussion. „Handeln Sie da, wo es notwendig ist. Aber laufen Sie nicht
populistischen, täglich wechselnden Meinungen und Vorurteilen hinterher“, machte er auf
dem Landesbauerntag vor rund 1.000 Landwirten in Cloppenburg deutlich. Der
Tierschutzplan solle ergebnisoffen diskutiert werden, Änderungen müssten auf ihre
Tauglichkeit in der Praxis und auf ihre Umsetzbarkeit hin getestet werden. „Das Landvolk
bringt die fachliche Kompetenz des Berufsstandes in die Beratungen zum Tierschutzplan ein,
aber wir wollen Lösungen, die für die Tiere einen echten Nutzen bringen“, unterstrich Hilse.
Er verwahrte sich gegen Regeln, die in der Praxis keine Vorteile bewirken und erinnerte an
die leidvollen Erfahrungen, die mit dem Ausstieg aus der Käfighaltung verbunden waren. Die
deutschen und allen voran die niedersächsischen Landwirte hätten Marktanteile eingebüßt, die
Erzeugung wanderte ins Ausland ab, wo die Hühner weiter in Käfigen säßen. Diese Harakiri-
Aktion habe dem Tierschutz einen Bärendienst erwiesen. „Unsere Landwirte stehen hinter
dem Tierschutzplan, wenn er sinnvolle und praktikable Regelungen enthält und sie gegenüber
Mitbewerbern aus dem Ausland nicht benachteiligt werden“, verdeutlichte Hilse. Zugleich
dürfe das hohe Maß der Lebensmittelsicherheit nicht beeinträchtigt werden.
Der Kampfbegriff „Massentierhaltung“ müsse heute immer herhalten, wenn etwas nicht laufe,
sagte Hilse. In der Dioxinkrise, die den Tierhaltern in Niedersachsen einen großen Schaden
verursacht habe, seien die Landwirte letztlich zum Mittäter abgestempelt worden. Bei den
EHEC-Infektionen sei völlig zu Unrecht die Gülle ins Spiel gebracht worden. Hilse verwahrte
sich gegen diese Versuche, moderne Tierhaltung als verwerfliches und unmoralisches
Geschäft darzustellen, in dem die Politik aufräumen müsse. Die Folge seien häufig
Regelungen, die ein Wachstum der Betriebe nach sich zögen. Auf der anderen Seite werde
das Bild einer Agraridylle gezeichnet, dem die moderne und wirtschaftlich gesunde
Landwirtschaft nicht entsprechen könne. Hilse wünschte sich in den Zusammenhang für die
Betriebsleiter mehr Verlässlichkeit und Planungssicherheit.
Diese Konstanten vermisse der Berufsstand auch bei den Vorschlägen zur Novellierung des
Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG). Die Landwirtschaft habe den Wunsch der Gesellschaft
nach einem größeren Anteil erneuerbare Energien am Energiemix aufgegriffen. „Die
aktuellen Vorschläge im EEG aber favorisieren eindeutig Biogasanlagen in der Hand großer
Kapitalgesellschaften und beschneiden die Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen
Familienbetriebe“, kritisierte Hilse. Die Politik verkenne damit auch das Votum der
ländlichen Bevölkerung, die Biogasanlagen großen Stils kritisiere. In der Diskussion um die
Privilegierung landwirtschaftlicher Bauten erwartet der Berufsstand ein klares Bekenntnis zur
bestehenden Gesetzeslage. Es bestehe kein Bedarf für übergeordnete Restriktionen, die
Instrumente dazu seien auf kommunaler und lokaler Ebene gegeben und müssten dort
offensiv umgesetzt werden.
Hilse bezeichnete die Landwirtschaft als Wachstumsmotor der niedersächsischen Wirtschaft
und appellierte in dem Zusammenhang an die Verantwortung der Landesregierung. „Unsere
Landwirte sind so erfolgreich, weil sie das tun, was unsere Mitbürger von ihnen erwarten: Sie
erzeugen sichere, qualitativ hochwertige und für alle bezahlbare Nahrungsmittel!“ Diesen
Anspruch wollten die mehr als 40.000 landwirtschaftlichen Familien im Lande auch zukünftig
verantwortungsbewusst nachkommen. Sie könnten aber nur bestehen, wenn auch der Wunsch
nach noch mehr Tierschutz oder Ökologie ihre wirtschaftliche Existenz nicht aufs Spiel setze.
Begrüßungsrede Präsident Werner Hilse
NWZ
CLOPPENBURG, 31. Mai 2011
„Schnäbel-Stutzen tut nicht einmal weh“
Agrar Mehr als 1000 Landwirte auf Landesbauerntag in Münsterlandhalle –
Sachliche Diskussion
Ministerpräsident David McAllister (CDU, von links) begrüßte Werner Hilse, Präsident des
Landvolks, und Hubertus Berges, Vorsitzender des Kreislandvolks. BILD: Torsten von
Reeken
Landwirtschaftsminister Lindemann informierte über den 38-Punkte-Plan. Das
Kupieren von Schwänzen sei verboten.
von Reiner Kramer
Cloppenburg - Um das Image der Landwirtschaft ist es nicht gut bestellt. Darin waren sich die
Beteiligten der Podiumsdiskussion auf dem Landesbauerntag in der Münsterlandhalle in
Cloppenburg schnell einig. Ein Bild von einer Frau mit einem süßen Ferkel auf dem Arm
verzerre mehr das Bild, als dass es helfe aufzuklären, kritisierte ein Diskussionsteilnehmer.
„Wir können nicht jeden Menschen durch unsere Ställe führen“, entgegnete der Präsident des
Niedersächsischen Landvolks, Werner Hilse.
Das Thema Biogas bot Anlass zu einiger Diskussion: Auf etwa acht Prozent der Ackerflächen
im Lande werde derzeit Mais für die Biogas-Produktion angebaut, sagte Niedersachsens
Landwirtschaftsminister Gert Lindemann (CDU), zwölf Prozent sollten nicht überschritten
werden. Insofern gebe es noch Entwicklungspotenzial. Allerdings dürften Gebiete, die eh
schon stark mit Anlagen belastet seien – wie der Kreis Cloppenburg – nicht weiter belastet
werden. Hilse: „Wenn ich die Entwicklung der Biogas-Anlagen sehe, sehe in einigen Jahren
die ersten Stilllegungsprämien für Biogas-Anlagen. Das kann ja nicht gewollt sein.“ Das
Landwirtschaftsministerium spricht sich für einen einheitlichen gestaffelten Vergütungssatz
ohne Boni aus. Bevorteilt werden sollen künftig kleinere Anlagen bis 200 KW.
In der Kritik standen auch Teile des 38-Punkte-Programms von Landwirtschaftsminister
Lindemann, das zu mehr Tierschutz in der Massentierhaltung führen soll.
Das Schnäbel-Stutzen bei Legehennen, das Landvolk-Präsident Hilse verteidigte – „Das tut
nicht einmal weh“ –, will der Landwirtschaftsminister bis 2018 komplett „eindämmen“. Eine
Absage erteilte er dem aus Österreich stammenden Weg, nach dem Schnabel stutzende
Betriebe für die Schäden aufkommen, die in Betrieben entstehen, in denen nicht gestutzt wird.
Auf das Schnabelkürzen sollte komplett verzichtet werden.
Bis 2015 sollen Schweinehalter erproben, Ferkel nicht mehr ohne Betäubung zu kastrieren.
Das Kupieren von Schwänzen bei Ferkeln soll nach den Vorstellungen des
Landwirtschaftsministeriums künftig verboten werden. Ein Landwirt wandte ein, dass in
diesem Fall künftig die Ferkel mit kupierten Schwänzen aus dem europäischen Ausland oder
anderen Bundesländern nach Niedersachsen importiert werden könnten. Lindemann wies
darauf hin, dass das routinemäßige Schwänze-Kupieren EU-weit verboten sei.
Wenn 40 Prozent der Puten bei der Anlieferung am Schlachthof Fußballengeschwüre
aufwiesen, dann müssten diese Landwirte lernen, wie es auch anders funktioniere, begründete
Lindemann seinen Vorstoß in diesem Bereich. „Wir haben die ernsthafte Absicht, die 38
Punkte umzusetzen, aber in einer Art und Weise, die für Bauern verträglich ist.“
CLOPPENBURG, 31. Mai 2011
Akzeptanz für Tierhaltung schaffen
Landesbauerntag Ministerpräsident David McAllister plädiert in
Cloppenburg für 38-Punkte-Plan
Begleitet von Protesten machten sich (von links) Gert Lindemann, David McAllister und
Landvolk-Präsident Werner Hilse auf den Weg zum Landesbauerntag. BILD: Torsten von
Reeken
Der Politiker bezieht klar Stellung gegen Ferkelkastration und Schnäbelkürzen ohne
Betäubung. Die Landwirtschaft müsse in der Gesellschaft akzeptiert sein, sagte er.
Cloppenburg - Nur eine artgerechte Tierhaltung in Niedersachsen nützt der Landwirtschaft.
Das machte Ministerpräsident David McAllister am Montag beim Landesbauerntag in
Cloppenburg deutlich. Denn nur dann würden die Verbraucher auch weiterhin die Produkte
kaufen. Denn: „Jeder Verstoß gegen den Tierschutz, der öffentlich diskutiert wird, schadet
letztlich dem Ruf der Landwirtschaft“, sagte der Politiker vor rund 1000 Bauern und fügte
hinzu: „Nutztierhaltung kann auf Dauer nur erfolgreiche betrieben werden, wen sie
gesellschaftlich akzeptiert wird.“
Er verteidigte zudem den 38-Punkte-Plan zur Verbesserung des Tierschutzes von
Niedersachsens Landwirtschaftsminister Gert Lindemann und machte deutlich: „Für mich
steht fest: Das Schnabelkürzen bei Puten und die Kastration bei Ferkeln ohne Betäubung sind
mit meinen ethnischen Maßstäben nicht vereinbar.“ In dieselbe Kerbe schlug auch Gert
Lindemann: „Ich bin überzeugt, dass die heutige Gesellschaft es nicht mehr akzeptiert, wenn
Schmerzen verursachende Eingriffe an Nutztieren ohne Betäubung vorgenommen werden.“
Hier müssten Lösungswege gefunden werden: „Das bedeutet, dass wir Haltungsverfahren
entwickeln müssen, die auf solche Eingriffe verzichten können, oder zur Betäubung greifen
müssen, wo ein Eingriff unverzichtbar ist.“
Der 38-Punkte-Plan soll bis 2018 abgearbeitet sein, erste Maßnahmen schon früher umgesetzt
werden. Das Kastrieren ohne Betäubung wäre nur noch bis 2015 erlaubt.
Landvolk-Präsident Werner Hilse nannte die Zeitspanne von sieben Jahren „ambitioniert“.
Der Ministerpräsident setzt nicht nur wegen dieser Einschränkung aus dem Landvolk auf
Dialog: „Wir wollen den Weg gemeinsam gehen.“ Alle wichtigen Interessengruppen wie
Landwirtschaft, Tierschutzorganisationen, Kirchen, Verbraucherschutzverbände,
Wissenschaft und Einzelhandel sollen in die Umsetzung des Tierschutzplans einbezogen
werden, versprach McAllister.
Für Gesprächsstoff in der anschließenden Diskussion sorgte das Thema Biogas: Lindemann
informierte, dass sich sein Ministerium für eine höhere Vergütung von Strom aus kleineren
Anlagen bis 200 KW einsetze. Ferkeln routinemäßig die Schwänze zu kupieren sei EU-weit
bereits heute verboten, wandte er gegen Kritik aus dem Plenum ein.
Auf dem Vorplatz kam es zudem zu Protesten von Bauern und Tierschützern.
TOP AGRAR
McAllister und Lindemann plädieren für mehr Tierschutz
[31.05.2011]
Beim Landesbauerntag in Cloppenburg hat der niedersächsische Ministerpräsident David
McAllister (CDU) gestern mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung gefordert. Nur eine
artgerechte Tierhaltung in Niedersachsen nütze der Landwirtschaft. Nur dann würden die
Verbraucher auch weiterhin die Produkte kaufen.
Vor rund 1000 Landwirten machte McAllister deutlich, dass Nutztierhaltung auf Dauer nur
dann erfolgreich betrieben werden könne, wen sie gesellschaftlich akzeptiert werde. Jeder
Verstoß gegen den Tierschutz, der öffentlich diskutiert werde, schade letztlich dem Ruf der
Landwirtschaft.
Wie die Nordwestzeitung berichtet, verteidigte der Ministerpräsident zudem den 38-Punkte-
Plan zur Verbesserung des Tierschutzes von Niedersachsens Landwirtschaftsminister Gert
Lindemann: Mit seinen ethnischen Maßstäben sei das Schnabelkürzen bei Puten und die
Kastration bei Ferkeln ohne Betäubung nicht vereinbar. Auch Gert Lindemann zeigte sich
überzeugt, dass die heutige Gesellschaft es nicht mehr akzeptiere, wenn Schmerzen
verursachende Eingriffe an Nutztieren ohne Betäubung vorgenommen würden. Hier müssten
Lösungswege gefunden werden. So müssten Haltungsverfahren entwickelt werden, die auf
solche Eingriffe verzichten können, oder man müsse zur Betäubung greifen.
Landvolk-Präsident Werner Hilse nannte die Zeitspanne von sieben Jahren „ambitioniert“.
Der Ministerpräsident setzt nicht nur wegen dieser Einschränkung aus dem Landvolk auf
Dialog: „Wir wollen den Weg gemeinsam gehen.“ Alle wichtigen Interessengruppen wie
Landwirtschaft, Tierschutzorganisationen, Kirchen, Verbraucherschutzverbände,
Wissenschaft und Einzelhandel sollen in die Umsetzung des Tierschutzplans einbezogen
werden, versprach McAllister.
Münsterländische Tageszeitung
31.5.2011
„Die Politik muss bei uns nicht aufräumen“ Landesbauerntag in Cloppenburg Von
Angelika Hauke
Cloppenburg – Verschärfter Tier- und Naturschutz, Einschränkungen beim Stallbau:
Landwirte fühlen sich zunehmend in ihrer unternehmerischen Freiheit eingeengt und in der
Öffentlichkeit falsch dargestellt. Auf dem Landesbauerntag gestern in Cloppenburg forderten
sie die Politik deshalb auf, die Folgen von Neuerungen genau abzuwägen.
Nutztierhaltung allerdings kann auf Dauer nur wirtschaftlich erfolgreich betrieben werden,
wenn sie auch gesellschaftlich akzeptiert wird. Das machte der Niedersächsische
Ministerpräsident in Cloppenburg deutlich. Gleichzeitig stärkte David McAllister in seiner
Rede vor rund 1000 Zuhörern den Landwirten den Rücken. „Sie behaupten sich hervorragend
im immer schärfer werdenden Wettbewerb in der Welt“, sicherte er ihnen politische
Unterstützung zu.
Die hatte zuvor Landvolkpräsident Werner Hilse deutlich angemahnt. „Der Kampfbegriff
Massentierhaltung muss heute immer herhalten, wenn etwas nicht läuft.“ Bei den Ehec-
Infektionen werde zu Unrecht die Gülle in Spiel gebracht. Gleichzeitig verwahrte Hilse sich
gegen Versuche, moderne Tierhaltung als verwerfliches und unmoralische Geschäft
dazustellen, „in dem die Politik aufräumen“ müsse. Landvolkpräsident Hilse wiederum
erwartet von Politikern „mehr Fakten statt Emotionen.“ Tierschutz sei keine Frage der
Stallgröße. Und Landwirte keine verantwortungslosen Tierquäler.
Die Pläne der Landesregierung zur Tierhaltung standen im Mittelpunkt des
Landesbauerntages. Dem Deutschen Tierschutzbund gehen die Pläne nicht weit genug. Rund
50 Tierschützer protestierten vor der Münsterlandhalle.
<< zurück
Proplanta ® | 31.05.2011 |
Tier >>
Tierschutz
Landvolk Niedersachsen: Tierschutz muss sinnvoll und praktikabel sein
Hannover - Auf mehr Fakten und weniger Emotionen drängt Landvolk-
Präsident Werner Hilse in der Tierschutzdiskussion.
„Handeln Sie da, wo es notwendig ist. Aber laufen Sie nicht
populistischen, täglich wechselnden Meinungen und Vorurteilen
hinterher“, machte er auf dem Landesbauerntag vor rund 1.000
Landwirten in Cloppenburg deutlich. Der Tierschutzplan solle
ergebnisoffen diskutiert werden, Änderungen müssten auf ihre
Tauglichkeit in der Praxis und auf ihre Umsetzbarkeit hin getestet werden. „Das Landvolk
bringt die fachliche Kompetenz des Berufsstandes in die Beratungen zum Tierschutzplan ein,
aber wir wollen Lösungen, die für die Tiere einen echten Nutzen bringen“, unterstrich Hilse.
Er verwahrte sich gegen Regeln, die in der Praxis keine Vorteile bewirken und erinnerte an
die leidvollen Erfahrungen, die mit dem Ausstieg aus der Käfighaltung verbunden waren. Die
deutschen und allen voran die niedersächsischen Landwirte hätten Marktanteile eingebüßt,
die Erzeugung wanderte ins Ausland ab, wo die Hühner weiter in Käfigen säßen. Diese
Harakiri-Aktion habe dem Tierschutz einen Bärendienst erwiesen. „Unsere Landwirte stehen
hinter dem Tierschutzplan, wenn er sinnvolle und praktikable Regelungen enthält und sie
gegenüber Mitbewerbern aus dem Ausland nicht benachteiligt werden“, verdeutlichte Hilse.
Zugleich dürfe das hohe Maß der Lebensmittelsicherheit nicht beeinträchtigt werden.
Der Kampfbegriff „Massentierhaltung“ müsse heute immer herhalten, wenn etwas nicht
laufe, sagte Hilse. In der Dioxinkrise, die den Tierhaltern in Niedersachsen einen großen
Schaden verursacht habe, seien die Landwirte letztlich zum Mittäter abgestempelt worden.
Bei den EHEC-Infektionen sei völlig zu Unrecht die Gülle ins Spiel gebracht worden. Hilse
verwahrte sich gegen diese Versuche, moderne Tierhaltung als verwerfliches und
unmoralisches Geschäft darzustellen, in dem die Politik aufräumen müsse. Die Folge seien
häufig Regelungen, die ein Wachstum der Betriebe nach sich zögen. Auf der anderen Seite
werde das Bild einer Agraridylle gezeichnet, dem die moderne und wirtschaftlich gesunde
Landwirtschaft nicht entsprechen könne. Hilse wünschte sich in den Zusammenhang für die
Betriebsleiter mehr Verlässlichkeit und Planungssicherheit.
Diese Konstanten vermisse der Berufsstand auch bei den Vorschlägen zur Novellierung des
Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG). Die Landwirtschaft habe den Wunsch der
Gesellschaft nach einem größeren Anteil erneuerbare Energien am Energiemix aufgegriffen.
„Die aktuellen Vorschläge im EEG aber favorisieren eindeutig Biogasanlagen in der Hand
großer Kapitalgesellschaften und beschneiden die Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen
Familienbetriebe“, kritisierte Hilse.
Die Politik verkenne damit auch das Votum der ländlichen Bevölkerung, die Biogasanlagen
großen Stils kritisiere. In der Diskussion um die Privilegierung landwirtschaftlicher Bauten
erwartet der Berufsstand ein klares Bekenntnis zur bestehenden Gesetzeslage. Es bestehe kein
Bedarf für übergeordnete Restriktionen, die Instrumente dazu seien auf kommunaler und
lokaler Ebene gegeben und müssten dort offensiv umgesetzt werden.
Hilse bezeichnete die Landwirtschaft als Wachstumsmotor der niedersächsischen Wirtschaft
und appellierte in dem Zusammenhang an die Verantwortung der Landesregierung. „Unsere
Landwirte sind so erfolgreich, weil sie das tun, was unsere Mitbürger von ihnen erwarten: Sie
erzeugen sichere, qualitativ hochwertige und für alle bezahlbare Nahrungsmittel!“ Diesen
Anspruch wollten die mehr als 40.000 landwirtschaftlichen Familien im Lande auch
zukünftig verantwortungsbewusst nachkommen. Sie könnten aber nur bestehen, wenn auch
der Wunsch nach noch mehr Tierschutz oder Ökologie ihre wirtschaftliche Existenz nicht
aufs Spiel setze. (LPD)
Neue OZ online 01.06.2011, 15:10 Fenster schliessen drucken
Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/artikel/54563840/oeko-dirigismus-
nein-danke
Ausgabe: Neue Osnabrücker Zeitung
Veröffentlicht am: 30.05.2011
„Öko-Dirigismus? Nein danke!“ hab Hannover
Hannover. Im Interview mit unserer Zeitung äußert sich Ministerpräsident David
McAllister (CDU) zu aktuellen Fragen der Agrarpolitik.
Herr McAllister, Sie sind heute beim Landesbauerntag in Cloppenburg. Erwarten Sie eine
freundliche Aufnahme oder doch eher kritische Stimmungen wegen Juckepunkten wie
Tierschutz, Großmaststätten und Biogas?
Ich bin gern beim Bauerntag. Mir liegt die weiterhin positive Entwicklung der
niedersächsischen Landwirtschaft sehr am Herzen. Die Agrar- und Ernährungswirtschaft
sichert bei uns 250 000 Arbeitsplätze und ist nach der Automobilindustrie der zweitwichtigste
Wirtschaftsfaktor. Gerade wegen dieser stabilen Branche hat unser Bundesland auch besser
die Finanz- und Wirtschaftskrise gemeistert. Die Veredelungswirtschaft entpuppte sich dabei
als stärkster Wachstumsmotor – das zeigt, was wir an der Nutztierhaltung haben. Und was
kritische Entwicklungen in einigen Bereichen anbelangt, so ist es Ziel meiner Regierung,
Probleme möglichst einvernehmlich zu lösen.
Sind angesichts der positiven Entwicklung noch Maßnahmen wie Direktzahlungen und
Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) notwendig?
Auf jeden Fall. Wir haben die AFP-Mittel für dieses Jahr sogar von 40 auf 45 Millionen Euro
aufgestockt; investitionswillige Landwirte können jetzt schnell loslegen. Geschätzt wird, dass
die Landwirte in Niedersachsen in nächster Zeit für die Modernisierung ihrer Betriebe rund
eine Milliarde Euro ausgeben. Zu den Direktzahlungen der EU: Sie sind bei schwankenden
Agrarpreisen ein stabilisierender Faktor für die Einkünfte der Landwirte und auch künftig
unbedingt erforderlich. Wir werden uns entschieden für die landwirtschaftlichen
Direktzahlungen über 2013 hinaus einsetzen.
Zunehmend zum Konfliktfeld ist die Nutztierhaltung geworden. Fürchten Sie, dass die
gesellschaftliche Akzeptanz völlig verloren geht?
Zunächst einmal: Für jeden vernünftigen Landwirt ist das Wohlergehen der Tiere ein hohes
Gut. Und das nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern vor allem aus ethischen Gründen. Wir
wollen eine moderne, tiergerechte und ökonomisch erfolgreiche Tierhaltung. Dass dies geht,
beweisen Tausende niedersächsische Bauern Tag für Tag. Die Erzeugung tierischer
Lebensmittel ist Existenzgrundlage für den überwiegenden Teil unserer Landwirtschaft. Aber
es stimmt: Verbraucher erwarten heute, dass Lebensmittel sicher und gesundheitlich
unbedenklich sind. Wichtig ist ihnen außerdem, unter welchen Bedingungen für die Tiere
Fleisch produziert wird.
Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Wir brauchen eine Weiterentwicklung der bestehenden Tierschutzregelungen. Deshalb habe
ich Minister Lindemann gebeten, einen „Tierschutzplan Niedersachsen“ auszuarbeiten. Er hat
dazu ein 38-Punkte-Programm vorgelegt. Dieser Tierschutzplan wird bis 2018 konsequent
abgearbeitet. Für mich steht fest: Das Schnabelkürzen bei Puten oder die Kastration bei
Ferkeln ohne Betäubung sind mit meinen ethischen Maßstäben nicht vereinbar. Das muss und
wird sich ändern.
Aber dagegen regt sich Unmut von Tierhaltern...
Es kann nicht darum gehen, Tiere dem jeweiligen Haltungssystem anzupassen, sondern es
müssen die Haltungssysteme den Bedürfnissen der Tiere angepasst werden. Klar ist aber
auch: Unsere Tierschutzpolitik bleibt auf Dialog angelegt. Alle wichtigen Interessengruppen –
Landwirtschaft, Tierschutzorganisationen, Kirchen, Verbraucherschutzverbände,
Einzelhandel und Wissenschaft – werden in die Umsetzung des Tierschutzplans einbezogen.
Alle Beteiligten müssen erkennen: Nach den verschiedenen Skandalen der zurückliegenden
Monate liegt es im fundamentalen Interesse der Landwirtschaft, hier zu spürbaren
Verbesserungen zu kommen. Um zu gewährleisten, dass die Maßnahmen wissenschaftlich
fundiert und praktikabel ausgestaltet werden, haben wir im Tierschutzplan einen Zeitrahmen
von sieben Jahren gesetzt, in dem wir Schritt für Schritt die möglichen Verbesserungen
umsetzen wollen. So ist ausreichend Zeit, Pilotprojekte durchzuführen, sie auszuwerten und
die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Tierhaltung darf keinesfalls ins Ausland gedrängt
werden.
In Teilen Niedersachsens hat der Bau von Maststätten unvertretbare Formen angenommen.
Wie wollen Sie hier Abhilfe schaffen?
Manche Landkreise wie das Emsland sind dazu übergegangen, Genehmigungsverfahren zu
verschärfen, in-dem man Keimschutz- oder Brandschutzgutachten fordert. Ob dieses
Vorgehen allein geeignet sein wird, die Interessenkonflikte dauerhaft zu lösen, scheint
fraglich. Für die Landkreise mit besonders hoher Tierdichte sollten daher durch den Bund
verbesserte Steuerungsmöglichkeiten im Bauplanungsrecht geschaffen werden. Dazu gehört
auch die Frage, ob dort die Privilegierung für großgewerbliche Tierhaltungsanlagen
eingeschränkt wird. Das Landwirtschaftsministerium und das für Fragen des Baurechts
zuständige Sozialministerium erarbeiten dazu zurzeit einen konkreten Vorschlag. Mir ist
bewusst, wie sensibel das Thema ist. Wir werden darüber in den nächsten Wochen mit allen
Betroffenen noch intensiv diskutieren. Kleinere Ställe von bäuerlichen Familienbetrieben
hingegen müssen privilegiert bleiben. Darüber gibt es mit uns keine Diskussion.
Zündstoff gibt es auch beim Biogas. Wird Niedersachsens Initiative zu einer
Gesetzesänderung Erfolg haben?
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Bundesrats-Vorstoß Erfolg haben werden. In
manchen Regionen ist die „Vermaisung“ inzwischen so extrem, dass auch besonnene
Stimmen veränderte Rahmenbedingungen fordern. Wir wissen aber auch um die Bedeutung
der Biogasnutzung als Baustein der regenerativen Energieerzeugung. Biogas kann
bedarfsgerecht als Grundlast oder als Regelenergie Strom bereitstellen. Das ist wichtig vor
dem Hintergrund des geplanten Ausstiegs aus der Kernenergie. Wir brauchen einen
vernünftigen Kompromiss. Die Vergütungsstruktur sollte an die aktuellen Entwicklungen
angepasst werden. Der bisherige Bonus für nachwachsende Rohstoffe soll nach unseren
Vorstellungen in einen einheitlichen Vergütungssatz integriert werden. Das Gesamtniveau der
Vergütung würde dabei sinken. Und wir wollen fördern, dass Gülle und Bioabfälle für die
Wärmenutzung eingesetzt werden. Der Bestandsschutz für bereits getätigte Investitionen
muss allerdings im Interesse der landwirtschaftlichen Betriebe unbedingt gewahrt bleiben.
Es gibt verschiedene Initiativen, den Fleischverzehr zu bremsen. Muss unsere Gesellschaft,
wie es einmal die Grünen formuliert haben, vom „eingefleischten Lebensstil“ Abstand
nehmen?
Es mag ja gesund sein, hin und wieder mal auf ein Stück Fleisch am Mittag zu verzichten.
Aber ich würde nicht im Traum darauf kommen, den Menschen vorschreiben zu wollen, was
sie essen dürfen und was nicht! Überzeugungsarbeit ja – Öko-Dirigismus nein danke! Die
Deutschen sollten Fleisch essen, wie es ihnen passt, und nicht Claudia Roth um Erlaubnis
bitten.
Land & Forst
Landesbauerntag
31.05.2011 | 08:51
Tierschutz muss sinnvoll und praktikabel sein Cloppenburg - Auf mehr Fakten und weniger Emotionen drängt Landvolk-Präsident Werner
Hilse in der Tierschutzdiskussion. „Handeln Sie da, wo es notwendig ist. Aber laufen Sie
nicht populistischen, täglich wechselnden Meinungen und Vorurteilen hinterher“, machte er
auf dem Landesbauerntag vor rund 1.000 Landwirten in Cloppenburg deutlich.
Der Tierschutzplan solle ergebnisoffen diskutiert werden,
Änderungen müssten auf ihre Tauglichkeit in der Praxis und
auf ihre Umsetzbarkeit hin getestet werden. „Das Landvolk
bringt die fachliche Kompetenz des Berufsstandes in die
Beratungen zum Tierschutzplan ein, aber wir wollen
Lösungen, die für die Tiere einen echten Nutzen bringen“,
unterstrich Hilse. Er verwahrte sich gegen Regeln, die in der
Praxis keine Vorteile bewirken und erinnerte an die leidvollen
Erfahrungen, die mit dem Ausstieg aus der Käfighaltung verbunden waren.
Die deutschen und allen voran die niedersächsischen Landwirte hätten Marktanteile
eingebüßt, die Erzeugung wanderte ins Ausland ab, wo die Hühner weiter in Käfigen säßen.
Diese Harakiri-Aktion habe dem Tierschutz einen Bärendienst erwiesen. „Unsere Landwirte
stehen hinter dem Tierschutzplan, wenn er sinnvolle und praktikable Regelungen enthält und
sie gegenüber Mitbewerbern aus dem Ausland nicht benachteiligt werden“, verdeutlichte
Hilse. Zugleich dürfe das hohe Maß der Lebensmittelsicherheit nicht beeinträchtigt werden.
Der Kampfbegriff „Massentierhaltung“ müsse heute immer herhalten, wenn etwas nicht laufe,
sagte Hilse.
In der Dioxinkrise, die den Tierhaltern in Niedersachsen einen großen Schaden verursacht
habe, seien die Landwirte letztlich zum Mittäter abgestempelt worden. Bei den EHEC-
Infektionen sei völlig zu Unrecht die Gülle ins Spiel gebracht worden. Hilse verwahrte sich
gegen diese Versuche, moderne Tierhaltung als verwerfliches und unmoralisches Geschäft
darzustellen, in dem die Politik aufräumen müsse. Die Folge seien häufig Regelungen, die ein
Wachstum der Betriebe nach sich zögen. Auf der anderen Seite werde das Bild einer
Agraridylle gezeichnet, dem die moderne und wirtschaftlich gesunde Landwirtschaft nicht
entsprechen könne.
Hilse wünschte sich in den Zusammenhang für die Betriebsleiter mehr Verlässlichkeit und
Planungssicherheit. Diese Konstanten vermisse der Berufsstand auch bei den Vorschlägen zur
Novellierung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG). Die Landwirtschaft habe den
Wunsch der Gesellschaft nach einem größeren Anteil erneuerbare Energien am Energiemix
aufgegriffen. „Die aktuellen Vorschläge im EEG aber favorisieren eindeutig Biogasanlagen in
der Hand großer Kapitalgesellschaften und beschneiden die Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen
Familienbetriebe“, kritisierte Hilse. Die Politik verkenne damit auch das Votum der
ländlichen Bevölkerung, die Biogasanlagen großen Stils kritisiere.
In der Diskussion um die Privilegierung landwirtschaftlicher Bauten erwartet der Berufsstand
ein klares Bekenntnis zur bestehenden Gesetzeslage. Es bestehe kein Bedarf für
übergeordnete Restriktionen, die Instrumente dazu seien auf kommunaler und lokaler Ebene
gegeben und müssten dort offensiv umgesetzt werden. Hilse bezeichnete die Landwirtschaft
als Wachstumsmotor der niedersächsischen Wirtschaft und appellierte in dem Zusammenhang
an die Verantwortung der Landesregierung. „Unsere Landwirte sind so erfolgreich, weil sie
das tun, was unsere Mitbürger von ihnen erwarten: Sie erzeugen sichere, qualitativ
hochwertige und für alle bezahlbare Nahrungsmittel!“ Diesen Anspruch wollten die mehr als
40.000 landwirtschaftlichen Familien im Lande auch zukünftig verantwortungsbewusst
nachkommen. Sie könnten aber nur bestehen, wenn auch der Wunsch nach noch mehr
Tierschutz oder Ökologie ihre wirtschaftliche Existenz nicht aufs Spiel setze.
pd
Märkische Allgemeine 31.05.2011
LANDWIRTSCHAFT: Tierschutz kommt zuerst
Niedersachsen will den Bau von Großmastanlagen erschweren
POTSDAM - Sieben Jahre Zeit gibt sich das Land Niedersachsen, um die Bedingungen in der
Massentierhaltung zu verändern. Ministerpräsident David McAllister (CDU) wirbt für den
„Tierschutzplan Niedersachsen“, der künftig durch rechtliche und bauliche Veränderungen für
artgerechtere Haltung sorgen soll. Damit reagiert das Land auf vergangene
Lebensmittelskandale. Es liege im „fundamentalen Interesse der Landwirtschaft“, beim
Tierschutz zu spürbaren Verbesserungen zu kommen, sagt McAllister.
Ein elementarer Punkt wird sein, den Bau neuer Großmastanlagen zu erschweren – besonders
in Regionen, die bereits eine hohe Intensität an Massentierhaltung und somit auch
Gülleaufkommen aufweisen. Es gehe dabei vor allem um Projekte, „die Grenzen der
normalen Landwirtschaft sprengen“, so Gert Hahne, Sprecher des niedersächsischen
Landwirtschaftsministerium. Dies sei aber nicht gleichbedeutend mit einer Begrenzung der
Zahl der gehaltenen Tiere. „Wir sollten uns davor hüten, allein nach nackten Zahlen zu
gehen“, sagt Hahne. „Das hat weniger mit der Anzahl der Tiere zu tun als mit der Art und
Weise, wie sie gehalten werden.“
So sieht der Tierschutzplan vor, dass dem Schnabelkürzen von Puten oder der Kastration von
nicht betäubten Ferkeln Einhalt geboten werden. „Das muss und wird sich ändern“, so
McAllister. Genaue Strategien für die Umsetzung werden erst diskutiert. Niedersachsen, das
Land mit dem größten Agrarsektor Deutschlands, will mit seinem Projekt auch andere
Bundesländer zu einem Kurswechsel in der Tierhaltung animieren.
Für Brandenburg sieht Jens-Uwe Schade, Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, keinen
Nachbesserungsbedarf. „Am Ende ist die Tiergesundheit unser Maßstab.“ Diese zeige derzeit
keine großen Auffälligkeiten. Hinzu komme, dass die Landwirte strengen Richtlinien
unterliegen, was den Tierschutz anbelangt – werden diese nicht erfüllt, werden die Zuschüsse
seitens der Europäischen Union gekürzt. Zudem ließe sich die Situation Brandenburgs nicht
mit der Niedersachsens vergleichen: Nach der Wende wurden die meisten Großbetriebe
geschlossen – seit 1989 verringerten sich allein die Zahlen in der Schweinezucht von drei
Millionen auf zuletzt rund 770 000. Rechne man die Zahl des Großviehs in Brandenburg
gegen die vorhandene Fläche auf, so liege man weit unter der Zahl, die für Ökolandbau
notwendig wäre, erklärt Schade.
Darin liegt für Reinhard Jung das märkische Dilemma. „Aus fachlicher Sicht haben wir zu
wenig Tierhaltung“, so der Geschäftsführer des Bauernbundes Brandenburg. Er plädiert aber
nicht für mehr Mastanlagen. Diese seien eine hohe Umweltbelastung. „Wir brauchen mehr
Tierproduktion in der Hand ortsansässiger Landwirte.“
„Die Stoßrichtung Niedersachsens geht im Ansatz in die richtige Richtung“, sagt Grünen-
Fraktionschef Axel Vogel. Das neue Baurecht müsse aber in allen Landkreisen greifen, nicht
nur in solchen, die bereits hoch durch Massentierhaltung belastet sind. Er fordert, dass die
Landesregierung den niedersächsischen Vorschlag aufgreifen und entsprechend erweitern
soll. (Von Nadine Pensold)
Landwirtschaftliche Tierhaltung in Brandenburg
Eine große Umstellung erfuhr die Massentierhaltung Anfang 2010. Damals wurde
deutschlandweit die Käfighaltung von Legehennen verboten. Seither leben die Hennen
in Kleingruppen in sogenannten ausgestalteten Käfigen, die Sitzstangen, ein Nest und
Platz zum Scharren bieten.
Nach der Umstellung hat die Boden- und Freilandhaltung in Brandenburg stark
zugenommen. 2009 zählte das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg mehr als
2,7 Millionen Legehennen in der Mark.
14 der 27 Mastbetriebe halten die Tiere in Bodenhaltung.
Der Viehbestand bei Rindern lag 2009 bei knapp 600 000 Tieren, bei Schweinen
wurden 772 000 Tiere in Brandenburg gezählt.
Mit 1,4 Millionen Tonnen Milch gehört Brandenburg mit zu den größten
Milchproduzenten der Bundesrepublik. np
Dorf und Familie | 30.05.2011
Mach mit! Bauernverband ruft zu gemeinsamer Kampagne auf Berlin - Der Deutsche Bauernverband (DBV) ruft Interessierte zu gemeinsamer Kampagne
über die Leistungen der Bauernfamilien für die Gesellschaft auf.
Der Deutsche Bauernverband ruft die Land- und Agrarwirtschaft dazu auf, in einer
gemeinsamen Kampagne über die Leistungen der Bauernfamilien für die Gesellschaft und den
Nutzen der Agrarpolitik für die Menschen in Deutschland zu informieren. Hintergrund sind
die laufenden Verhandlungen der Europäischen Union zur Gemeinsamen Agrarpolitik nach
2013.
Vom 17. Juni bis zum 7. Juli 2011 werden die deutschen Bauern deutschlandweit mit zwei
Motiven auf Großplakaten in Städten und Gemeinden für das Anliegen der deutschen Land-
und Agrarwirtschaft werben, also rund um den Deutschen Bauerntag 2011 in Koblenz. dbv
Plakate können SIe hier bestellen: www.bauernverband.123plakat.de
Mehr zu den Leistungen der Bauernfamilien finden Sie unter www.die-deutschen-
bauern.de.
Auswählen
Landvolk Niedersachsen, Hannover,
Minister Gert Lindemann und Präsident Werner Hilse
top agrar
Schweinezyklus aus dem Rhythmus
[31.05.2011]
Durch die anhaltend hohen Futterkosten ist der Schweinezyklus seit zwei Jahren aus dem
Rhythmus geraten. Das machten Vertreter des Zentralverbands der Deutschen
Schweineproduktion (ZDS) auf ihrer Mitgliederversammlung vorige Woche in Templin
deutlich. Die Kosten blieben ohne den erforderlichen Ausgleich bei den Erlösen auf hohem
Niveau. Den Betrieben fehle die Erholungsphase, um ein angemessenes Familieneinkommen
zu erwirtschaften und um bis 2013 die auferlegten Investitionen für neue Tierschutzvorgaben
tätigen zu können. Angesichts der andauernden Trockenheit und absehbarer Ernteausfälle
sowie wegen des Flächenbedarfs für die Bioenergieerzeugung sei eine Entspannung der Lage
nicht absehbar. Der ZDS warnte vor einem drastischen Rückgang der Erzeugung und
appellierte an Schlachtung, Verarbeitung und Lebensmittelhandel, die Schweinehalter nicht
mit der außerordentlichen Kostenbelastung allein zu lassen. Der ZDS-Vorsitzende Helmut
Ehlen mahnte, ein Preisausgleich sei überfällig, um den Ausstieg vieler Betriebe noch
abzuwenden. (AgE)
Neue OZ online 01.06.2011, 01:13 Fenster schliessen drucken
Diesen Artikel finden Sie unter:
http://www.noz.de/lokales/54603916/landwirtschaftsminister-gert-lindemann-spricht-in-
surwold-ueber-die-zukunft-der-landwirtschaft
Ausgabe: Ems-Zeitung
Veröffentlicht am: 01.06.2011
Landwirtschaftsminister Gert Lindemann spricht in Surwold über die Zukunft der Landwirtschaft evkö Surwold
evkö Surwold. „Die Privilegierung der Landwirtschaft ist für uns unantastbar.“ Das hat
der niedersächsische Landwirtschaftsminister Gert Lindemann (CDU) am
Montagabend während der Bauernversammlung des CDU-Kreisverbandes Aschendorf-
Hümmling gesagt. Klar Stellung bezog er auch hinsichtlich des Tierschutzes in der
Landwirtschaft.
Der Minister sollte als Gastredner zum Thema „ Zukunftsentwicklung in der
Veredelungsregion Emsland“ sprechen. Doch bevor er dazu kam, nahm er zur aktuellen
EHEC-Problematik Stellung: „Die Verbraucher verzichten aus Vorsicht auf das Gemüse,
obwohl es nachweislich in Ordnung ist. Das ist ein Riesen-Dilemma, das mir große Sorgen
macht.“
Karl Voges, Geschäftsführer der Gartenbauzentrale, und Gerhard Schulz, Inhaber eines
Gartenbaubetriebes, appellierten an den Minister, etwas für die Branche zu unternehmen:
„Wir haben heute keine einzige Gurke verkauft. Sonst sind es etwa 500000 pro Tag. Wir
müssen jetzt 250 Tonnen Gurken vernichten, das bedeutet für uns einen Verlust von etwa
200000 Euro pro Tag“, so Voges. Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann kündigte
unterdessen an, sich für Entschädigungszahlungen für die Gartenbaubetriebe einsetzen zu
wollen.
In seinem Vortrag betonte Lindemann, dass die Zukunftsaussichten im Emsland weit besser
aussehen als in anderen Regionen Deutschlands. Gleichwohl müssten die Erzeuger auf die
Qualität ihrer Produkte setzen: „Auf die Kostenführerschaft können wir im internationalen
Wettbewerb nicht setzen. Aber wir können qualitativ hochwertige Produkte erzeugen. Die
Qualitätsführerschaft zu übernehmen sollte unser agrarpolitisches Ziel sein“, so der Minister.
Der Öko-Landwirtschaft erteilte Lindemann jedoch eine klare Absage. Bis 2050 würde der
Bedarf an Lebensmitteln um 70 Prozent steigen. Das sei mit ökologischer Landwirtschaft
nicht zu bewältigen.
Dennoch müsse in den kommenden Jahren im Hinblick auf den Klimawandel die Erzeugung
von Treibhausgasen reduziert und der Tierschutz verbessert werden. Dies seien die großen
Herausforderungen der Zukunft. Im Bezug auf den Tierschutz kritisierte der Minister die
Pläne der Grünen: „Wenn ich das, was die Grünen vorschlagen, umsetze, ist das die sicherste
Möglichkeit, die Landwirtschaft gegen die Wand zu fahren“, ist er sich sicher. Ziel müsse es
sein, einen Konsens zwischen „vernünftigen“ Tierschützern, Landwirten und der
Wissenschaft zu finden.
Bei der Privilegierung der Landwirtschaft sprach sich Lindemann für die Beibehaltung des
entsprechenden Paragrafen im Baugesetz aus. Gleichwohl soll in Zukunft den Landkreisen
und Gemeinden mehr Entscheidungskompetenz für die Steuerung von Stallneubauten
zukommen. Zudem plane das Landwirtschaftsministerium eine Meldepflicht, um die
Nährstofffrachten besser kontrollieren zu können. Zurzeit würden hier noch Verhandlungen
laufen. In der anschließenden Diskussion ging es vor allem um die „Vermaisung“ und darum,
ob die Einhaltung von Richtlinien ausreichend überprüft wird. Zu den Anfragen und
Vorwürfen nahmen Landrat Hermann Bröring, Gert Lindemann und der Vorsitzende des
emsländischen Landvolks Aschendorf-Hümmling, Bernd Schulte-Lohmöller, Stellung. Die
Botschaft an die Zuhörer: In Zukunft solle der Flächendruck entschärft und der Umgang von
Landwirten und Anwohnern sachlicher werden. Eine Absage erteilten alle beteiligten
Kapitalgesellschaften als Betreiber von Mastställen.
http://www.weser-kurier.de/Artikel/Region/Niedersachsen/384645/Buergerinitiative-gegen-
Agrarfirma.html
Anlieger fürchten Lärm und Gestank - 27.05.2011
Bürgerinitiative gegen Agrarfirma Von Christoph Starke
Bassum·Stuhr. Aus Furcht vor zusätzlichen Umweltbelastungen hat sich jetzt eine
Bürgerinitiative für Landschaftsschutz in Kätingen und Fahrenhorst gegründet. Sie setzt sich
dafür ein, dass die Gesellschaft für Abfall und Recycling (GAR) an der Kätinger Heide
weniger Abfall verarbeitet, außerdem will sie eine Ansiedlung der landwirtschaftlichen
Genossenschaft GS Agri verhindern. In der Gaststätte Waldeslust trafen sich rund 80 Bürger.
Sie forderten die Einrichtung eines Runden Tisches, an dem Betriebsvertreter, Anlieger und
Kommunalpolitiker sitzen sollen.
Die Bürger aus den Bassumer Ortschaften Kastendiek und Kätingen sowie aus dem Stuhrer
Ortsteil Fahrenhorst äußerten ihren Unmut über die GAR und GS Agri. "Wir befürchten
Staub, Lärm und Emissionen, außerdem Umweltbelastung, mehr Verkehr und eine
Wertminderung der Grundstücke", sagte Kirsten Frage zu einer möglichen Ansiedlung der
landwirtschaftlichen Genossenschaft.
Zur Recyclingfirma: Hier vermuten die Bürger, dass deren Produktion zur Belastung des
Grundwassers und des Bodens führen werde. Zudem beschweren sie sich über Geruchs- und
Lärmbelästigung und darüber, dass sich die Menge des zu verarbeitenden Abfalls um das
"Zehnfache" vergrößert hätte.
Der Fahrenhorster Jürgen Schierholz fordert deswegen den Rückbau der GAR-Anlage auf das
ursprüngliche Niveau, das laut Unternehmensangaben bei rund 4000 Tonnen Gelber-Sack-
Abfall jährlich liegt. Außerdem fordern er und andere Bürger Boden- und
Grundwasserkontrollen von unabhängigen Institutionen. Schierholz glaubt nicht, dass das
staatliche Gewerbeaufsichtsamt, das für solche Prüfungen zuständig ist, das gewährleistet. Die
Bürgerinitiative könne allerdings nicht so ohne Weiteres klagen, so Schierholz. Dazu müsse
sich die Initiative einem Verband anschließen - zum Beispiel dem BUND (Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland).
AgrarZeitung
5. November 2010
Beef Report vergleicht Produktionssysteme
Die Kosten der Rindfleischproduktion in der EU und so genannten Niedriglohnländern wie
Brasilien oder Argentinien gleichen sich weiter an. Dies ist eines von vielen Ergebnissen des
aktuellen Beef Reports des Netzwerkes agri benchmark, einem weltweiten Zusammenschluss
von Agrarökonomen.
Die Kosten für die Produktion von Rindfleisch sind in Niedrigkostenländern wie Brasilien
und Argentinien nach wie vor deutlich geringer als in Hochkostenländern wie der EU, heißt es
in dem Bericht. Die Unterschiede haben sich in den letzten Jahren aber verringert. Ein
weiteres Ergebnis der Studie ist, dass hohe Kosten zwar häufig mit hohen Erlösen
einhergehen. Diese aber nicht zwangsläufig mit hohen Gewinnen verknüpft sein müssen. Die
verschiedenen Produktionssysteme hätten zwar unterschiedliche Kostenstrukturen, aber
keines der Produktionssysteme sei den anderen grundsätzlich überlegen. Feedlots, große
Mastanlagen in Übersee, die jährlich tausende von Rindern mit überwiegend zugekauftem
Futter mästen, seien zwar enorm produktiv, weisen aber auch deutliche
Gewinnschwankungen im Zeitablauf auf, so der Report
Das vom Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) und der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) koordinierte Netzwerk bewertet die Rahmenbedingungen und treibenden
Kräfte der Rindfleisch- und Schafproduktion. Es umfasst nach eigenen Angaben mehr als 20
Länder und repräsentiert damit rund 75 Prozent der weltweiten Produktion und des Handels
mit Rindfleisch. Der Beef Report 2010 kann bestellt werden. Er kostet 25 €. (kbo)
NORDKURIER
Artikel vom 01.06.2011
Backhaus will 15 Euro Mindestlohn in der Landwirtschaft
Schwerin (dpa). Agrarminister Till Backhaus (SPD)
plädiert für Mindestlöhne in der Landwirtschaft. "Ein
Mitarbeiter, der Tiere betreut oder hochwertige
Maschinen bedient, sollte mindestens 15 Euro in der
Stunde verdienen", sagte der Minister bei der
Vorstellung des Agrarberichtes in Schwerin.
Er habe im Kabinett Zustimmung gefunden, dieses
Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Die Löhne in
der Landwirtschaft lägen um 30 bis 35 Prozent unter
den Löhnen anderer Branchen. "Das muss mindestens
obendrauf gelegt werden", forderte Backhaus. Mit 15
785 Euro im Schnitt hätten die Beschäftigten in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft die
niedrigsten Bruttolöhne in Mecklenburg-Vorpommern. "Aus meiner Sicht kann das so nicht
weitergehen", sagte Backhaus.
Die Landwirte erhielten jährlich 470 Millionen Euro Beihilfen aus Steuergeldern. Da müssten
sie ihren Mitarbeitern ausreichende Löhne zahlen. So wenig zu zahlen, das werde den
Landwirte müssen heute moderne
Technik
bedienen können. Foto: dpa
Betrieben auf die Füße fallen, wenn sie Fachkräfte suchten, meinte er. Zudem kündigte er an,
dass die Betriebe künftig für die öffentlichen Gelder mehr öffentliche Leistungen, etwa im
Natur-, Umwelt- oder Trinkwasserschutz, erbringen müssten. Als Gründe für die geringen
Löhne nannte Backhaus, dass die Bauern finanziell stark belastet seien. Sie hätten seit der
Wende 2,5 Milliarden Euro in die Betriebe und 1,6 Milliarden in Grund und Boden investiert.
Backhaus nannte es den "Kardinalfehler der deutschen Einheit", dass die Betriebe gezwungen
worden seien, die Flächen zu erwerben anstatt zu pachten. Ein zweiter Grund sei, dass zu
wenig Tiere gehalten würden. Mit Ackerbau seien im Jahr etwa 1000 Euro je Hektar zu
verdienen, mit Rindern, Hühnern oder Schweinen 3000 Euro. Laut Agrarbericht hatte die
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns 2010 einen Anteil von 2,7
Prozent an der Wirtschaftsleistung des Landes.
Das sei im Bundesvergleich der höchste Wert. Die Arbeitsproduktivität erreiche mit 31 262
Euro je Erwerbstätigen gut ein Drittel (35,9 Prozent) mehr als im bundesweiten Durchschnitt
der Landwirtschaft. Das liege an den großen Strukturen, sagte Backhaus. Auf 100 Hektar
kommen im Land laut Bericht 1,3 Arbeitskräfte, in den alten Ländern seien es 3,8. 2010 seien
in der Landwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns 19 266 Menschen beschäftigt gewesen,
fast 10 Prozent weniger als 2007. Die Zahl der Agrarbetriebe im Nordosten ist laut Bericht
um rund 700 auf 4725 gesunken. Der Rückgang sei vor allem auf die Aufgabe von
Nebenerwerbsbetrieben zurückzuführen, aber auch darauf, dass Betriebe unter fünf Hektar
keine statistische Auskunftspflicht mehr hätten. Der Agrarbericht 2011 umfasst laut
Ministerium erstmals einen Zeitraum von zwei Jahren (2009/10). Früher wurde er jährlich
vorgelegt.
NDR
NDR 1 Radio MV Stand: 01.06.2011 20:55 Uhr
Bauern protestieren gegen Mindestlohn-Idee
Ein Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde ist nach
Ansicht der Bauern nicht finanzierbar. Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern sind
gegen die Einführung eines Mindestlohns in der Landwirtschaft von 15 Euro pro Stunde. Der
Vorschlag von Agrarminister Till Backhaus (SPD) ist nach Angaben des Bauernpräsidenten
Rainer Tietböhl nicht finanzierbar. Die Forderung von 15 Euro pro Stunde sei weit
übertrieben. Viele erboste Anrufe von Landwirten seien beim Bauernverband eingegangen,
sagte Tietböhl gegenüber NDR 1 Radio MV.
Zwar hätten die Landwirte die Krise der vergangenen Jahre überstanden, in denen die Preise
für ihre Erzeugnisse in den Keller gerutscht waren. Jetzt müssten die Verluste aber erst einmal
ausgeglichen werde, so Tietböhl weiter. Weil auch noch die Preise für Futter, Saat, Dünger
und Diesel gestiegen sind, dauere der Prozess vermutlich einige Jahre. Der Bauernpräsident
forderte den Minister auf, sich aus der Tarifhoheit heraus zu halten. Denn die wirtschaftlich
gesunden Betriebe würden ihren hoch qualifizierten Mitarbeitern aufgrund des
Fachkräftemangels in der Landwirtschaft gute Löhne zahlen.
Branchenbeschäftigte bekommen niedrigste Bruttolöhne
Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Backhaus (SPD) hatte sich für
Mindestlöhne in der Landwirtschaft ausgesprochen. "Ein Mitarbeiter, der Tiere betreut oder
hochwertige Maschinen bedient, sollte mindestens 15 Euro in der Stunde verdienen", sagte
der Minister am Dienstag bei der Vorstellung des Agrarberichtes in Schwerin.
Die Löhne in der Landwirtschaft lägen um 30 bis 35 Prozent unter denen anderer Branchen,
sagte Backhaus. Mit 15.785 Euro im Schnitt hätten die Beschäftigten in der Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft die niedrigsten Bruttolöhne in Mecklenburg-Vorpommern. "Aus meiner
Sicht kann das so nicht weitergehen", sagte Backhaus. Die Landwirte erhielten jährlich 470
Millionen Euro Beihilfen aus Steuergeldern. Da müssten sie ihren Mitarbeitern ausreichende
Löhne zahlen.
Im Kabinett habe er mit seinem Plädoyer für Mindestlöhne im Agrarsektor Zustimmung
gefunden, auch von Wirtschaftsminister Jürgen Seidel (CDU). Insgesamt habe die
Agrarwirtschaft in den vergangenen zwei Jahren bewiesen, dass sie robust sei. Trotz
Finanzkrise und starker Preisschwankungen am Markt sei sie ein stabiler Wirtschaftszweig.
Kritik aus der CDU
Die agrarpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Beate Schlupp, bezeichnete
Backhaus' Forderung nach Mindestlöhnen als Überbietungswettbewerb und unseriös. "Für
uns steht fest, dass Löhne und Gehälter nicht vom Staat festgesetzt werden sollen, sondern in
Tarifverhandlungen zu vereinbaren sind. Wir achten die Tarifautonomie des Grundgesetzes.
Für die Landwirtschaft gibt es tarifvertragliche Regelungen, die eine nach Qualifikation und
Aufgabenprofil gestaffelte Vergütung sichern."
Backhaus hadert mit Finanzministerium
Unzufrieden ist Backhaus mit dem Bundesfinanzministerium. Das hat die Vorschläge
Mecklenburg-Vorpommerns und Sachsen-Anhalts zur Übernahme der restlichen
bundeseigenen BVVG-Flächen abgelehnt. Die beiden Länder wollten die Flächen kaufen, um
den Boden nach der Übernahme zeitlich gestreckt selbst zu privatisieren. Dabei sei es den
Ländern nicht um Höchstpreise gegangen, sondern um die Sicherung von Arbeitsplätzen im
ländlichen Raum.
SVZ 1.6.2011 "Krieg auf dem Dorf muss aufhören"
01. Juni 2011 | 15:54 Uhr | von Ilja Baatz
Mehrere der zahlreichen Besucher äußerten ihre Meinung mit scharfen Worten. Ilja Baatz
Die Frage "Kommen Sie aus Deutschland?" eines Besuchers und allgemeines Gelächter
erntete Silvia Ey, Referentin für Tierhaltung im Landesbauernverband, am Montagabend auf
ihre Äußerung, dass auch im landwirtschaftlichen Bereich Gesetze vor Inkrafttreten ebenfalls
im Sinne von Kritikern "genau geprüft" werden und alle in einem Rechtsstaat leben. Zu
vergleichbaren Situationen kam es bei Redebeiträgen mehrerer Podiumsmitglieder.
Irgendwann sah zum Beispiel Silvia Ey keine andere Möglichkeit mehr, als folgende Worte
ins Spiel zu bringen: "Noch suche ich mir aus, von wem ich beleidigt werde." Fortschritt
könne es nur geben, wenn man miteinander redet, Argumente austauscht und nicht
übereinander herfällt.
Vom Gegenteil zeichnete sich über weite Strecken angesichts sehr gereizter Stimmung eine
vom Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen organisierte Veranstaltung im Wangeliner
Garten aus, an der neben Ey auch Gabriele von Fuchs von der Bürgerinitiative gegen
Broilermastanlagen in Gallin-Kuppentin, der agrarpolitische Sprecher der Grünen im
Bundestag, Friedrich Ostendorff, Bio-Landwirt Dirk Saggau, Onno Andresen, Betriebsberater
für landwirtschaftliche Betriebe, und Dr. Jürgen Buchwald, Abteilungsleiter
Landwirtschaft/Agrarstruktur im Schweriner Landwirtschaftsministerium, teilnahmen. Motto:
"Bauernhöfe statt Agrarfabriken".
Vor einer Woche - so Gabriele von Fuchs - sei die Erweiterung der einen Mastanlage in ihrer
Heimatgemeinde um gut 100 000 Tiere genehmigt worden. Angesichts der im Raum
stehenden Planung, derzufolge eine weitere Anlage für 300 000 Hähnchen errichtet werden
soll (wir berichteten), stehe die Zukunft der nur 500 Einwohner zählenden Kommune auf dem
Spiel: "Unsere frühere Annahme, Rechtsstaat beinhaltet, dass die Meinung des Einzelnen
etwas zählt, haben wir tief begraben. Von denjenigen, die Gesetze und Vorschriften
ausarbeiten, verlangt man ein mehrjähriges Studium, das sie befähigt. Wir hingegen haben
Glück, wenn wir die fürvier Wochen öffentlich ausliegenden Unterlagen bekommen und dann
in kürzester Zeit zwei dicke Ordner durcharbeiten müssen, um eine Stellungnahme zu
formulieren. Es ist gewollt, dass der Bürger kein demokratisches Mitspracherecht mehr hat.
Das ist Hohn, blanker Zynismus!"
Einzelne Anlagen, so Dr. Buchwald, genehmige nicht das Landwirtschafts-, sondern das
Wirtschaftsministerium, wenngleich beide miteinander in Verbindung stehen. Fördermittel
bekomme nicht derjenige, der die höchste Pacht zahlt, sondern wer am meisten investiere, für
die "höchste Wertschöpfung in der Region" sorge. "Ganz vorn liegen zum Beispiel der Anbau
von Gemüse und die Zahl geschaffener Arbeitsplätze", so der Abteilungsleiter. "Letztlich
entscheidet aber der Landwirt, welche Richtung er einschlägt."
Ostendorff bezeichnete Till Backhaus als "einen der quirligsten Landwirtschaftsminister" in
Deutschland und nannte das von ihm vertretene Leitbild "nicht falsch", doch es könne mit
Tourismuszielen kollidieren. Einer exportorientierten Landwirtschaft müsse man eine Absage
erteilen: "Wir können nicht auf Dauer billiger sein als alle anderen. Somit wird es auch keine
Kostenführerschaft unserer Hähnchen geben. Auf jeden Fall muss der Krieg auf dem Dorf
aufhören!" Ökologie und Landwirtschaft müssten nebeneinander existieren können. Dem
entgegnen die Kritiker, dass "Agrarfabriken" nichts mehr mit herkömmlicher Landwirtschaft
zu tun haben. "Wir brauchen Landwirtschaft, aber nicht die, die unsere Lebensgrundlage
zerstört", sagt zum Beispiel Einwohner Paul Beck. "Massentierhaltung ist ein Herd für
Krankheitserreger, die man nur mit Medikamenten behandeln kann. Da sind neue Krankheiten
kein Wunder. Wir werden durch eine Mafia kaputtgespielt und in zehn oder 20 Jahren wächst
auf unseren Äckern nichts mehr."
Der Landesbauernverband vertrete über seine Mitglieder Ey zufolge 70 Prozent der
ökologisch wie konventionell bewirtschafteten Flächen. Jeder Landwirt müsse nicht nur
deutsche, sondern auch europäische Gesetze beachten, wobei die einheimischen strenger als
die anderer Länder seien: "So, wie Sie niemandem unterstellen, dass er bei Rot über die
Kreuzung fährt, können Sie nicht sagen, dass bei uns Gesetze nicht eingehalten werden.
Zudem ist der Tierschutz im Grundgesetz verankert."
Letzteres veranlasste einen Besucher zu der wütenden Aussage, dass in jedem Jahr
hunderttausende Broiler vor der Schlachtung im Stall verenden und "wie Dreck beiseite
geschoben" werden, was jedoch niemand erwähne: "Das ist der Tierschutz, Frau Ey! Und es
ist alles irrelevant, was der Bürger will. Es sind Gesetze, zu denen Menschen nicht befragt
werden. Dass Herr Backhaus gentechnisch veränderte Pflanzen nicht mehr als die für die
Ernährung sichersten bezeichnet, ist ein Fortschritt. Dafür fördert er jetzt Maiswüsten für den
Betrieb von Biogasanlagen - tolle Lebensqualität!"
Allseitig Anerkennung fand die durch Saggau vertretene Öko-Landwirtschaft. Er beklagte die
noch oft geringe Akzeptanz von herkömmlich wirtschaftenden Kollegen, was sich langsam
bessere, doch oft werde die Alternative, von der man durchaus leben könne, schnell "im Dorf
verrissen". Dr. Buchwald zufolge sei der Anteil an ökologisch betriebener Landwirtschaft mit
zehn Prozent in Mecklenburg-Vorpommern viel höher als in anderen Bundesländern, was
auch dem in Schwerin dafür aufgelegten Förderprogramm mit einem Volumen von 15
Millionen Euro zu verdanken sei.
Während ein Tierhalter den juristisch verankerten Tierschutz hoch bewerte, erscheine er dem
Bürger oft nicht hoch genug, meint Sibille Ey. Zu den Besuchern sagte sie: "Das emotionale
Empfinden ist bei jedem anders, aber auch die Vorschriften waren noch vor 20 Jahren
deutlich andere. Dass es sich verändert hat, haben auch Menschen wie Sie durch ihren Einsatz
bewirkt."
AGRIHOLLAND
25/05/2011
Brand in pluimveestal in Lienden kost 10.000 kippen het leven Naar schatting 10.000 kippen hebben in de avond van 24 mei een brand in een pluimveestal in
het Gelderse Lienden niet overleefd. Er zijn geen mensen gewond geraakt. De brandweer
werd kort na half zeven gealarmeerd. De brand sloeg over naar een rietgedekte woning
vlakbij. Een tweede huis en en tweede stal met duizenden kippen kon de brandweer redden.
Er is enige asbest vrijgekomen, maar dat bleef beperkt en leverde geen gevaar voor de
omgeving op. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een ventilator in de de
stal, zo meldt de politie Gelderland Zuid.
bron: De Gelderlander, 25/05/11
Copyright ©2011 AgriHolland B.V.
NTV Online ,Montag, 30. Mai 2011 "Antibiotika säckeweise verabreicht"Gesetze sind weiße Salbe
Immer mehr Antibiotika drohen als sichere Therapiemöglichkeit auszufallen, weil Bakterien
unempfindlich werden. Das Robert Koch-Institut spricht von einer "Waffe, die zunehmend
stumpf geworden ist." Schuld daran ist die ausufernde Verordnung dieser Medikamente. Für
den wissenschaftlichen Berater der Tierrechteorganisation PETA, Edmund Haferbeck, steht
fest, dass auch der Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung wesentlichen Anteil an
der Entwicklung trägt.
n-tv.de: Nach Angaben des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI) haben im Jahr
2009 mehr als 18 Millionen gesetzlich Versicherte Antibiotika geschluckt. Im Schnitt
bekam jeder Patient zweieinhalb Antibiotika-Packungen verordnet, Privatrezepte nicht
mitgerechnet. Gibt es ähnliche Statistiken, die den Einsatz von Antibiotika in der
Tiermast belegen?
Edmund Haferbeck: Leider kann ich nicht mir aktuellen Werten glänzen. Fest steht aber
bereits seit Jahren, dass der Einsatz von Antibiotika weltweit zu über 50 Prozent in die
Tiermast geht. Und der Trend ist nicht etwa rückläufig, wie uns staatliche Stellen klarmachen
wollen. Obgleich seit 2005/06 als Leistungsförderer in der Tiermast verboten, steigt der
Verbrauch von Antibiotika in den großen Betrieben weiter. Die industrielle Massentierhaltung
ist für die Pharma-Industrie einer der wichtigsten Märkte weltweit. Mittlerweile belegen auch
Studien, dass die in der Tierhaltung eingesetzten Antibiotika durch die Nahrungskette beim
Menschen angelangt sind. Der Mensch steht demzufolge unter ständigem Antibiotikaeinfluss.
Ist der Einsatz von Antibiotika die einzige Möglichkeit, Tierkrankheiten zu bekämpfen?
Nein, nicht die einzige, aber die billigste Maßnahme. Antibiotika werden in der Tierhaltung
eingesetzt, um selbstverständliche bakterielle Infektionen, die sonst ständig grassieren
würden, einzudämmen und zu bekämpfen. Das geht nicht am einzelnen Tier, das setzt man
über den gesamten Bestand hinweg ein. Und man macht es regelmäßig, auch wenn die
Keimbelastung noch gar nicht den Sprung zur Krankheit überschritten hat.
Werden die Tiere geimpft oder gelangt die Arznei über das Futter zum Einsatz?
Stroh lernen die Tiere in der Massenhaltung nicht mehr kennen.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Antibiotika werden zumeist über das Trinkwasser verabreicht. So soll die Schwelle der
bakteriellen Belastung heruntergedrückt werden, um nicht wachstumshemmend zu wirken.
Belastete Tiere wachsen langsamer als solche, die ihre eigenen Energien zur Bekämpfung von
Bakterien einsetzen müssen. Wir sprechen hier von einem leistungsfördernden Prinzip.
… das, wie Sie eingangs sagten, seit 2005 verboten ist.
Die Antibiotika werden den Tieren einfach über das Trinkwasser zugeführt. Wir reden hierbei
nicht von Trinkgefäßen, sondern von den Zuleitungen. Dafür sind die Anlagen in den
modernen Stallungen bereits bautechnisch ausgelegt. Bei Beständen von tausenden wird kein
Tier mehr einzelnen behandelt. All bekommen die gleiche Betreuung – die gleiche schlechte
Betreuung.
Hat denn das Tier die Medikamente bereits verarbeitet, bevor es in den
Nahrungskreislauf des Menschen gelangt?
Nein, die Karenzzeiten von der letzten Antibiotika-Eingabe bis zur Schlachtung werden
selbstverständlich nicht eingehalten. Das würde den gestaffelten Wachstumsverlauf in der
Anlage gefährden. Das wird auch deshalb nicht eingehalten, weil nie etwas eingehalten wird
in der industriellen Mast. Da können Sie so viele Gesetze erlassen, wie Sie wollen.
Schaut niemand den Produzenten auf die Finger?
Hin und wieder werden solche Skandale von uns aufgedeckt. Wenn wir unangemeldet in
diese Betriebe gehen, dann finden wir kiloweise, ja säckeweise reine Antibiotika wie
beispielsweise Aviapen vor. Im Grunde werden die Tiere vom ersten Tag an mit Antibiotika
vollgepumpt. Und das geht so bis zum Schlachtende. Kontrollen staatlicher Behörden führen
zu nichts. Auf dem Lande gibt es ein feines Informationsnetz, das über bevorstehende
Besuche informiert. Für die Bestandstierärzte ist es das große Geschäft, wenn sie ihre Mittel
verkaufen können. Im Grunde genommen tun sie nicht einmal was Verbotenes, denn sie
handeln aus therapeutischer Sicht. Irgendein krankes Schwein, Huhn oder Pute wird sich
immer finden, um den Breitbandeinsatz der Medikamente zu rechtfertigen.
Wer kontrolliert die Tierärzte?
Dr. Edmund Haferbeck.
(Foto: PETA)
Niemand. Da gibt es keine höhere Stelle oder Behörde, bei der sie über den Einkauf ihrer
Medikamente Rechenschaft ablegen müssen. Diese Leute haben allein auf Grund ihres
ärztlichen Status' die Möglichkeit, ohne Einschränkungen solche Antibiotika einzukaufen und
an ihre Landwirte weiterzureichen. Der Einsatz der Medikamente wird in der
Massentierhaltung auch nicht mehr unter tierärztlicher Betreuung vorgenommen. Wenn Sie
mich fragen, würde ich sagen, dass die wirklich vielen und auch guten Gesetze, die wir in
Deutschland haben, vor allem eine "weiße Salbe" für die Verbraucher sind. Die Menschen
können so das Märchen der Lebensmittelsicherheit besser schlucken.
Ich bin bislang davon ausgegangen, dass man hier in Deutschland durch ein fein
gesponnenes Kontrollnetz die Tierproduktion im Griff hat. Nun höre ich von Ihnen,
dass es scheinbar einen systematischen Betrug gibt.
So ist es schon immer, ich kann da nichts schönreden. Ich beobachte das Geschehen seit 30
Jahren. Mein Spezialgebiet als Agrarwissenschaftler ist die Tierproduktion und ich kann
Ihnen sagen, dass man in Deutschland nichts, was mit Nutztierhaltung zu tun hat, im Griff hat.
Ich rede sogar von organisierter Kriminalität. Hier geht es um weltweit agierende Konzerne,
denen es völlig egal ist, was mit ihren Tieren passiert. Sie betrachten sie als Ware, die
funktionieren muss. Da geht es um Profite, um 15 Prozent, die aus den Tieren herausgeholt
geholt werden müssen. Und da ist es völlig egal, auf welche Weise der Profit erzielt wird.
Was kann der Verbraucher tun?
Erst einmal kein Fleisch mehr. Damit würde man auch sich selbst etwas Gutes tun. Fangen
wir aber eine Stufe darunter an, heißt die klare Botschaft: Man kauft kein Fleisch beim
Discounter. Man kann nicht für 1,99 ein Hähnchen kaufen und glauben, man nimmt ein
Lebensmittel zu sich. Wenn Fleisch sein soll, dann nur Bio oder Fachgeschäft. Das
Kostenargument darf nicht länger gelten. Natürlich muss ein gesund gewachsenes Stück
Fleisch aus artgerechter Haltung teurer sein als eins aus der industriellen Produktion. Wenn
man darüber schimpft, dass das so teuer ist, soll man eben gar kein Fleisch kaufen. Wenn
mittlerweise selbst der Boulevard die vegetarische Küche entdeckt, Bestseller zu dieser
Thematik in den Buchläden zu haben sind, dann sollte das deutlich machen, wie weit das
Problem bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Mit Edmund Haferbeck sprach Peter Poprawa