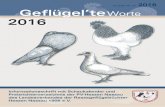Wenn Worte fehlen. Integration von Klängen in der palliativen ...
Wenn die Worte fehlen
Transcript of Wenn die Worte fehlen
SprachstörungSprechstörungKommunikationSprechmotorikEmpathie
KEYWORDS
Eine Aphasie ist eine Störung des
Sprachsystems, eine Dysarthrie eine
Störung des Sprechablaufs.
Aphasie und Dysarthrie
Wenn die Worte fehlenAphasie und Dysarthrie sind die beiden häufigsten logopädischen Störungsbilder, die nach einem Schlaganfall auftreten können. Im pflegerischen und kommunikativen Umgang mit diesen Patienten sind der Respekt und das Bemühen, den anderen zu verstehen, das Wichtigste. Dabei ist alles erlaubt, was hilft.
weil uns die Begriffe fehlen, wir sprechen die Wörter falsch aus, sind uns ihrer Bedeutung nicht ganz sicher, machen Fehler in der Grammatik und wir verstehen vieles nicht, was uns gesagt wird oder was wir lesen. Mit geringen Fremdsprachenkenntnissen können wir daher auch nur unzureichend schreiben. Je weniger ich eine Fremdsprache beherrsche, desto mehr ver-suche ich, mir den Sinn des Gesagten aus dem Ge-sprächskontext, aus Tonfall, Mimik und Gestik meines Gesprächspartners zusammen zu reimen. Das heißt, je schwerer die aphasische Störung ist, desto verlorener und hilfloser fühle ich mich in einer Ge-sprächssituation. Missverständnisse häufen sich.
Aphasiesyndrome unterscheidenAphasien werden auf Grund ihrer unterschiedlichen Symptomatik in verschiedene Syndrome eingeteilt.Globale Aphasie. Als schwerste Beeinträchtigung gilt die Globale Aphasie. Sie zählt zu den unflüssigen Aphasien. Patienten mit einer globalen Aphasie fällt das Sprechen sehr schwer, sie können sich oft nur mit einzelnen Wörtern oder in kurzen Floskeln ausdrü-cken. Manchmal produzieren sie sogar nur noch Sprachautomatismen (z.B. immer wiederkehrende Silbenfolgen wie „de de de“ oder Wörter und Floskeln, die nicht in den Gesprächskontext passen). Sie ver-stehen Sprache sehr schlecht und erschließen sich den Sinn des Gesagten aus der Situation sowie aus der Mimik, Gestik und aus dem Tonfall des Gegen-übers. Häufig leiden die Patienten gleichzeitig unter einer rechtsseitigen Hemiparese.Broca Aphasie. Die Broca Aphasie, ebenfalls eine un-flüssige Aphasie, ist geprägt durch schwere gramma-tikalische Auffälligkeiten. Oft sprechen die Patienten im sogenannten Telegrammstil, z.B. Frau Teller wa-schen. Broca Aphasiker ringen um Worte und man spürt ihre große Sprachanstrengung. Das Sprachver-ständnis ist unterschiedlich stark gestört. Auch diese Patienten haben oft eine rechtsseitige, meist armbe-tonte Hemiparese.Wernicke Aphasie. Die Wernicke Aphasie gehört zu den flüssigen Aphasien. Die Patienten sprechen viel und dennoch sind sie inhaltlich oft nicht zu verstehen, weil Sätze zu lang und Satzteile unsystematisch an-
Nach Schlaganfall, Tumoren, Schädel-Hirn-Traumen oder infolge von Erkrankungen wie M. Parkinson, Multipler Sklerose, Amyotro-
pher Lateralsklerose oder Chorea Huntington treten häufig Aphasien und/oder Dysarthrien auf. Dabei ist es ein großer Unterschied, ob ein Patient unter einer Sprachstörung (Aphasie) oder unter einer Sprechstörung (Dysarthrie) leidet.
Aphasie – das System Sprache ist gestörtEin Aphasiker leidet unter einer Störung in seinem Sprachsystem. Er hat immer eine Sprachverständnis-störung, auch wenn sie im ersten Moment nicht auf-fällt. Ein Aphasiker ist ein erwachsener Mensch mit Erfahrung, Weltwissen, Intelligenz und Beobach-tungsgabe. Das hilft ihm, sein Gegenüber zu verstehen und Verstehensdefizite auszugleichen. Über die Ein-schätzung der Situation, über Mimik, Gestik und Tonfall erschließt er sich, worum es im Gespräch geht. Für eine gelingende Kommunikation sind diese Pa-rameter daher wichtig. Die gesprochene Sprache des Aphasikers ist in unterschiedlicher Weise gestört. Ihm fallen Worte nicht ein oder er benutzt unpassende oder nicht ganz richtig ausgesprochene Worte. Manchmal ist seine Grammatik fehlerhaft oder er kann sich nur mit einzelnen Wörtern verständigen und gar keine Sätze mehr sprechen.
Bei einer Aphasie können alle Bereiche der Sprache beeinträchtigt sein: Lautstruktur (Phonologie), Wort-schatz (Lexikon), Wortbedeutung (Semantik) und Satzbau (Syntax, Grammatik). Sowohl die rezeptiven (Sprachverständnis) als auch die expressiven (Sprach-produktion) Fähigkeiten können betroffen sein. Somit können das Sprechen und Verstehen der Lautsprache oder das Lesen und Verstehen geschriebener Sprache erschwert und je nach Schweregrad der Beeinträch-tigung sogar kaum noch möglich sein. Auch das Rechnen kann betroffen sein.
Aphasie – so fühlt sich das anWie kann ich mich in eine solche Sprachstörung hi-neinversetzen? Die Situation ist vergleichbar mit der, wenn wir eine Fremdsprache nur bruchstückhaft beherrschen. Wir können vieles nicht ausdrücken, D
OI:
10.1
007/
s000
58-0
13-1
079-
z
26
PflegeKolleg Schlaganfall
Heilberufe / Das Pflegemagazin 2013; 65 (10)
Eine Aphasie fühlt sich an wie eine bruchstückhaft beherrschte Fremdsprache.
einander gereiht und miteinander verschränkt wer-den, so dass man als Zuhörer nicht folgen kann. Es gibt leichte phonematische Paraphasien z.B. Taffee statt Kaffee und so stark veränderte Wörter, dass man den Inhalt nicht mehr erkennen kann (Neologismen). Im schlimmsten Fall ist die gesamte Sprachproduk-tion unverständlich (Jargon-Aphasie). Der Patient hat dabei jedoch das Empfinden, dass er verständlich spricht und reagiert ungehalten, wenn man ihn nicht versteht. Seine meist erheblichen Sprachverständnis-störungen führen zu vielen Missverständnissen.Amnestische Aphasie. Diese ebenfalls als flüssig be-zeichnete Aphasie ist die leichteste Beeinträchtigung der Sprache. Die Patienten haben Wortfindungsstö-rungen infolge derer sie ihre Sätze abbrechen, weil sie nicht auf das Wort kommen, das sie sagen möch-ten. Gelegentlich treten phonematische Paraphasien z.B. Tose statt Rose oder semantische Paraphasien z.B. Katze statt Hund auf. Bei komplexen Sachverhal-ten und schnellem Themenwechsel haben auch die-se Patienten mit Sprachverständnisstörungen zu kämpfen. Hemiparesen kommen in Verbindung mit einer amnestischen Aphasie eher selten vor.
Der Syndromansatz ist in der medizinischen No-menklatur immer noch sehr verbreitet auch wenn man heute eher zur Einteilung in flüssige und unflüs-sige Aphasien neigt. Als veraltet gelten die Bezeich-nungen motorische und sensorische Aphasie. Gele-gentlich wurde früher eine Dysarthrie auch als mo-torische Aphasie bezeichnet.
Dysarthrie – das System Sprechen ist gestörtEin Dysarthriker kann alles sagen. Aber er kann nicht deutlich sprechen. Zur Not kann er sich – wenn er nicht durch eine Lähmung daran gehindert ist, den Stift zu führen – schriftlich verständlich machen. Er kann lesen und verstehen. Ein Aphasiker kann das, was er nicht sagen kann, in den meisten Fällen auch nicht aufschreiben.
Bei einer Dysarthrie sind die Steuerung und die Ausführung von Sprechbewegungen gestört. Dies bedeutet, dass Sprechmotorik, Sprechmelodie (Pro-sodie), Sprechrhythmus, Stimme und Atmung beein-trächtigt sein können. Die Betroffenen haben keine Sprachstörung, sondern eine Sprechstörung: sie kön-nen normal verstehen, schreiben und lesen.
Dysarthrien können auch gleichzeitig mit einer Aphasie auftreten, dann sind neben der Sprechmo-torik, der Stimme und der Atmung auch die Bereiche Sprachverständnis und Sprachproduktion betroffen.
Dysarthrie – so fühlt sich das anWie kann ich mich in diese Sprechstörung hinein-versetzen? Das Sprechen fühlt sich an, als habe ich die Kontrolle über meine Steuerung verloren. Wir kennen das nach einer lokalen Betäubung im Mund-bereich. Wir wollen deutlich sprechen, aber unsere
Aussprache ist ganz verwaschen, weil die Muskulatur schlaff von der Betäubung ist. Auch wenn wir betrun-ken sind, sind wir nicht Herr über unsere Artikula-tion. Wir sprechen unsicher, schwerfällig oder lallen sogar. Bei einem Dysarthriker kann zusätzlich zur undeutlichen Artikulation aber auch noch die Sprech-geschwindigkeit und die Stimme verändert sein. Vielleicht spricht der Patient viel zu schnell und ist dadurch nicht zu verstehen, vielleicht viel zu langsam und schwerfällig. Der Stimmklang kann eine andere Klangfärbung annehmen, rau sein, tiefer oder höher. Andere erkennen mich nicht mehr an meiner Stim-me. Die Kommunikation ist dadurch beeinträchtigt, dass mein Gegenüber mich oft nicht versteht, nach-fragt und ich alles doppelt und dreifach sagen muss. Ich werde oft ungehalten deswegen.
Dysarthrien unterscheidenDysarthrien werden häufig nach ihrem Erscheinungs-bild eingeteilt.Spastische Dysarthrie. Dysarthriker mit spastischen Lähmungen sprechen mit gepresster, rauer Stimme, das Gesprochene klingt kloßig und nasal. Ihre Sprech-weise ist monoton, verlangsamt und weist vermehr-te Sprechpausen auf. Es kann sich anhören, als sei der Patient betrunken.Schlaffe Dysarthrie. Patienten mit einer schlaffen Dysarthrie sprechen leise, monoton und verlangsamt. Die Stimme kann rau, nasal und verhaucht klingen. Oft ist die Sprechmuskulatur geschwächt und ermüd-bar. Es kann eine Stimmbandlähmung oder eine
Bei einer Dysarthrie ist der Betroffene nicht mehr Herr seiner Artikulation.
Respekt und das ehrliche Bemühen, den anderen trotz seiner Sprachstörung zu ver-stehen, ist bei einer Sprachstörung das wichtigste. Ermutigung, Anerkennung und Aufmerksamkeit bringen sprachliches Bemühen voran.
© iS
tock
_Thi
nkst
ock
27Heilberufe / Das Pflegemagazin 2013; 65 (10)
Lähmung des Zungen- und Lippenmuskels vorliegen (Hypoglossus- oder Facialisparese). Rigid-hypokinetische Dysarthrie. Patienten mit fort-geschrittener Parkinson Erkrankung leiden an einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie. Sie sprechen sehr leise, monoton, undeutlich und dabei oft zu schnell, sodass der Zuhörer häufig nachfragen muss.Dyskinetische Dysarthrie. Unter diesem Begriff wer-den unterschiedliche Formen unwillkürlicher Mus-kelaktivation wie Chorea, Dystonie, Atheose und Tics zusammen gefasst. Das Sprechen ist dabei oft durch unwillkürliche Unterbrechungen des Redeflusses, abrupte Veränderungen von Stimmqualität, Tonhöhe oder Lautstärke und verlangsamte, zweitweise „ex-plosive“ Artikulation gekennzeichnet.Ataktische Dysarthrie. Diese Form fällt durch eine wechselnd gepresst, rauh und behaucht klingende Stimme auf. Tonhöhe und Lautstärke fluktuieren, die Stimme kann zittern. Auch die Artikulation ist inter-mittierend „explosiv“. Der Sprechrhythmus ist skan-dierend. Meist sprechen die Patienten verlangsamt und mit Sprechpausen. Alle Patienten, die unter einer Dysarthrie leiden, können lesen, schreiben und ver-stehen. Die Kommunikation ist lediglich durch die schlechte Verständlichkeit des Patienten erschwert.
Kommunikation mit dem PatientenDas wichtigste im kommunikativen Miteinander ist der Respekt voreinander und das ehrliche Bemühen, den anderen trotz seiner Sprachstörung zu verstehen. Dabei hilft alles, was dem Patienten das Gefühl gibt, hier ist jemand, der daran interessiert ist, was ich sa-gen will. Ermutigung, Anerkennung und Aufmerk-samkeit bringen sprachliches Bemühen voran.Kommunikationsförderndes Verhalten. Jedes gute Gespräch erfordert Blickkontakt, Zugewandtheit und die volle Aufmerksamkeit. Ein Patient mit einer neu-rologischen Erkrankung braucht zusätzlich eine ru-hige und entspannte Atmosphäre Und: der Patient benötigt ausreichend Zeit, um sich mitteilen zu kön-nen. Sprechen Sie mit ihm natürlich, nicht überdeut-lich und auf keinen Fall zu laut. Vermeiden Sie kom-plexe Sätze, aber sprechen Sie auch nicht im Tele-grammstil. Fragen Sie den Patienten, ob er sprachliche Hilfen wünscht. Oder ob sie ihm mit fehlenden Be-griffen helfen dürfen, damit der Fluss der Kommu-nikation erhalten bleibt. Bitte verbessern Sie den Patienten nicht. Ein Gespräch ist keine Lernsituation. Der Inhalt des Gesprächs ist das wichtigste, nicht die Form des Gesagten. Alles ist erlaubt, was das gegen-seitige Verstehen voran bringt. Geben Sie besonders beim Aphasiker ihre sprachliche Information auf verschiedenen Ebenen. Sprechen Sie, schreiben Sie auch auf, zeichnen Sie, weisen Sie mit der Hand auf die Dinge, die Sie meinen. Nutzen Sie unterschiedliche Kanäle der Verständigung und unterstützen Sie das Gesagte mit Gestik und Mimik.
Kommunikationshemmendes Verhalten. Nebenge-räusche, laufendes Radio oder Fernsehen können von neurologischen Patienten nur schwer ausgeblendet werden. Auch andere Gespräche im Raum stören die Kommunikation. Es fällt ihnen dann besonders schwer, sich auf ihr Sprechen zu konzentrieren. Zu viele Gesprächspartner überfordern ihn. Auch zu schnelle Themenwechsel können manchmal nicht erfasst werden.
Zeitdruck erzeugt Anspannung beim Patienten. Das führt dazu, dass sein Sprechen und das Verstehen schlechter werden. Jede Art von Druck verschlechtert die Leistung. Wenn Sie als Gesprächspartner abge-lenkt sind, mit den Gedanken schon woanders und dabei auch keinen Blickkontakt halten, erschwert das die Kommunikation.
Sprechen Sie nicht zu laut mit dem Patienten. Wir tendieren dazu, unsere Lautstärke zu erhöhen, wenn wir merken, dass uns ein Mensch nicht versteht. Hier hilft aber nur Nachfragen, mehrfaches Erklären, viel-leicht zusätzliches Aufschreiben. Es liegt nicht an der Lautstärke. Rückversichern Sie sich immer wieder, ob Sie den Patienten richtig verstanden haben. Neh-men Sie dem Patienten nicht zu schnell das Wort aus dem Mund, fragen Sie ihn, welche Unterstützung ihm recht ist und was ihm gut tut.
In der Kommunikation ist die Abgrenzung der Aphasie als Sprachstörung von Sprechstörungen wie der Dysarthrie wichtig, Allerdings können Sprach- und Sprechstörung auch gemeinsam auftreten.
Der Inhalt des Gesprächs ist das
wichtigste, nicht die Form des Gesagten.
Anna LancelleLogopädin und Dipl.-Psychologin Hohenzollerndamm 111, 14199 Berlin [email protected]
▶ Ein Aphasiker leidet unter einer Störung in seinem Sprachsystem. Beeinträchtigt können alle Bereiche der Sprache sein: Lautstruktur, Wortschatz, Wort-bedeutung, Syntax und Grammatik. Das kann so-wohl das Sprachverständnis als auch die Sprach-produktion betreffen.
▶ Ein Dysarthriker kann normal verstehen, schreiben und lesen. Er kann alles sagen, aber er kann nicht deutlich sprechen und ist schlecht zu verstehen. Das macht ihn oft ungehalten.
▶ Das wichtigste im kommunikativen Miteinander ist der emphatische Respekt vor dem Patienten und das ehrliche Bemühen, ihn trotz seiner Sprachstörung zu verstehen.
FA Z IT FÜ R D I E PFLEG E
28
PflegeKolleg Schlaganfall
Heilberufe / Das Pflegemagazin 2013; 65 (10)