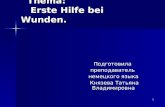Wunden immer steril versorgen
Click here to load reader
Transcript of Wunden immer steril versorgen

Lokale und syste-mische InfektionWundkeimeEntzündungs-zeichenWundreinigung und -spülungWundauflagen
KEYWORDS
Jede Wundinspektion bietet Keimen die Mög-
lichkeit, in die Wunde einzudringen.
Wundinfektionen therapieren
Wunden immer steril versorgenEs gibt verschiedene Einflussfaktoren und Übergangsstadien, die die Entstehung einer Wundinfektion begünstigen. Kommt es zu einer kritischen Kolonisation, dem Übergangs-stadium zur lokalen Wundinfektion, liegt bereits eine erhöhte bakterielle Besiedlung durch vermehrungsfähige Keime vor. Was ist dann zu tun?
Lokale Infektionen, die im Einzelfall zu einer systemischen Infektion (Sepsis) führen können, sind die häufigste Komplikation bei der Wund-
heilung. Denn dann geht die Keimbesiedlung auf den Wirt über und löst eine immunologische Reak-tion aus. Meist liegt ein bakterielles, manchmal auch ein mykotisches Wachstum vor. Typische Wundkei-me sind Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeru-ginosa und Enterobakterien sowie Problemkeime wie Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) oder multiresistente gramnegative Erreger (MRGN). Eine Wundheilung ist erst nach Beseiti-gung der Infektion möglich.
Hygienevorschriften immer beachtenGrundsätzlich ist die Beachtung, Einhaltung und Umsetzung der Hygienevorschriften die berufliche Pflicht des medizinischen und pflegerischen Perso-nals. Die Gesundheitsrisiken sind mit Hilfe von an-gemessenen Maßnahmen, auf ein unvermeidbares Restrisiko zu reduzieren. Das gilt natürlich auch bei der Versorgung von Wunden. Die Tatsache, dass eine Wunde niemals steril ist, bedeutet keine Rechtferti-gung für das Einbringen zusätzlicher Keime durch
unsterile, kontaminierte Materialien. Daher ist eine Wunde grundsätzlich steril, d.h. mit sterilen Instru-menten, Kompressen und Wundauflagen, zu versor-gen, da eine Keimbesiedlung die Heilung stört bezie-hungsweise unmöglich macht. Folgende hygienische Grundsätze müssen beim Verbandwechsel eingehal-ten werden:
▶ Haare zurück binden ▶ Verzicht auf Schmuck/Uhr am Handgelenk sowie auf lange und lackierte bzw. künstliche Fingernägel
▶ Ablegen von langärmeligen Jacken und Kitteln vor dem Verbandwechsel
▶ Schutzkleidung anlegen: Einmalschürze ist in der Regel ausreichend (nach jedem Patientenkontakt wechseln); bei speziellen Wunden, wie hochgradi-gen Verbrennungen oder MRSA-Besiedlungen, sind umfassendere Schutzmaßnahmen erforderlich, z.B. Anziehen von langen, langärmeligen und bei Bedarf wasserabweisenden Schutzkitteln, Anlage eines Mund- und Nasenschutzes, ggf. Tragen einer Schutzhaube
▶ Mund- und Nasenschutz ist selbstverständlich bei Erkältungen
▶ Hygienische Händedesinfektion jeweils vor An- und nach Ablegen der Einmalhandschuhe
Lokale Wundinfektion, die kurz davor ist, in eine systemische Infektion überzugehen.
Lokale Wundinfektion. Die Wundumgebung ist ge-reizt – die Katze hatte an der Wunde geleckt.
12
PflegeKolleg Infektionen vermeiden
Heilberufe / Das P� egemagazin 2014; 66 (5)
DO
I: 10
.100
7/s0
0058
-014
-055
9-0
© K
erst
in P
rotz

Anzeichen einer infektgefährdeten WundeEin Risikofaktor für die Entstehung einer Wundin-fektion kann die Wundlokalisation sein. Insbesonde-re bei stuhl- und urininkontinenten Patienten, die Wunden im Sakralbereich haben, besteht aufgrund von Ausscheidungen, die die Versorgungen unter-wandern können, ein erhöhtes Infektionsrisiko.
Auch die Umgebungsfaktoren bedeuten eine Ge-fährdung. In der ambulanten Pflege zählen beispiels-weise Haustiere dazu. Sie sollten während des Ver-bandwechsels entweder aus dem Zimmer oder in ihren Käfig gebracht werden. Ein Hund oder eine Katze, die während des Verbandwechsels am Versor-ger oder Patienten hoch- oder vielleicht sogar auf das Bett springen und an der Wunde lecken, sind ein großer Risikofaktor. Auch die Sauberkeit der Woh-nung kann Einfluss auf die Entstehung einer Wund-infektion haben, ebenso wie mangelhafte persönliche Hygiene des Patienten.
Das gilt auch für das Pflegepersonal, wenn bei-spielsweise keine Händehygiene durchgeführt oder unsteril gearbeitet wird. Dazu gehört das ordnungs-gemäße Lagern der Materialien, in wischdesinfizier-baren Kunststoffboxen mit Deckel. Auch bestimmte (Begleit-)Erkrankungen bedeuten ein Risiko. Hierzu gehören zum Beispiel Patienten mit Diabetes mellitus, geschwächter Immunabwehr oder Patienten in Pal-liativsituation. Auch Verbrennungswunden, Tumor-exulzerationen oder diabetische Fußulzera besitzen ein hohes Infektionsrisiko. Folgende Entzündungs-zeichen sind bekannt:
▶ Kardinalsymptome: rubor, calor, dolor, functio laesa, tumor
▶ Verzögerte bzw. stagnierende Wundheilung ▶ Hohe Exsudatmengen, ggf. trübes/eitrig-zähes (ggf. blutiges) Exsudat
▶ Übler, unangenehmer Geruch ▶ Bröckeliges, leicht blutendes Granulationsgewebe ▶ Abzess, ggf. Fieber, Cellulitis, Leukos > 15.000 ▶ Taschenbildung
▶ Vergrößerung/Zersetzung der Wunde ▶ Erythem und Verhärtung ▶ Ödem
Behandlung infizierter WundenDer bloße Nachweis von Bakterien aus einer Wunde erlaubt keine Prognose für den Heilungsverlauf. Eine mikrobiologische Untersuchung ist nur aussagekräf-tig, wenn ihr Ergebnis eine therapeutische Konse-quenz hat, zum Beispiel Antibiotikagabe bei syste-mischer Wundinfektion. Deshalb ist vorab zu klären, warum ein Abstrich durchgeführt werden soll.
Abstriche sind aus der Wundtiefe vor antiseptischer Reinigung oder Verwendung von konservierten Spül-lösungen mit Octenidin oder Polihexanid zu entneh-men und zwar erst nach einer mechanischen Wundreinigung. So soll vermieden werden, dass neben dem eigentlichen Wundkeim noch eine Viel-zahl an Oberflächenkeimen aufgenommen wird. Bei dieser Reinigung geht es weniger um das Entfernen von Bakterien als von Substanzen und Stoffen, die eine mikrobiologische Analytik erschweren können. Eine zeitgemäße Technik ist der Essener Wundkrei-sel, bei dem der bakteriologische Abstrich in Spiral-form von außen nach innen über die gesamte Wund-oberfläche geführt wird. Der Abstrichträger wird dabei gedreht und jeweils leicht angedrückt, um von allen Seiten eine optimale Benetzung zu erhalten. Durch diese Technik werden möglichst viele der vor-liegenden Bakterien in der Wunde erfasst.
Bei diagnostizierter systemischer Infektion ist eine systemische Antibiotikumgabe nach Antibiogram-mauswertung mit Resistenzbestimmung zu überden-ken.
Lokalantibiotika zur Wundbehandlung gelten nach übereinstimmenden Empfehlungen vieler medizi-nischer Fachgesellschaften und der Konsensuserklä-rung zur Wundantiseptik inzwischen als obsolet, da sie zu einer Resistenzbildung sowie zu lokalen Un-verträglichkeiten und Allergien führen.
Biochirugische Wundreinin-gung mit Lar-ven im Biobag.
Einsatz einer feuchten Wundauflage aus Zellulose mit Polihexanid (PHMB).
Auch Wundarten wie Verbrennungswunden, Tumorexulzerationen oder diabetische Fuß-ulzera besitzen ein hohes Infektionsrisiko.
Lokalantibiotika zur Wundbehandlung gelten als obsolet.
13Heilberufe / Das P� egemagazin 2014; 66 (5)
© K
erst
in P
rotz

Wundreinigung und -spülungDa Nekrosen, Biofilm, Beläge, Abfallstoffe, Verband-rückstände und überschüssiges Exsudat die Wund-beurteilung erschweren, können sich darunter unbe-obachtet Infektionen ausbilden. Erst nach einer ent-sprechenden Wundreinigung – mechanisch, chirur-gisch oder biochirurgisch – sowie einer Spülung ist eine ergebnisorientierte lokale Wundtherapie mög-lich.
Bei infizierten Wunden ist bei jedem Verbandwech-sel eine Spülung mit zeitgemäßen Lokalantiseptika empfehlenswert. Antiseptika sind für den befristeten Einsatz für die Behandlung kritisch kolonisierter und infizierter Wunden indiziert und ergänzen den rein mechanischen Effekt der Wundspülung durch ihre antiseptische Wirkung, d.h. Erreger werden nicht nur ausgespült, sondern auch abgetötet. Allerdings ist die jeweilige Einwirkzeit zu beachten, z.B. Octenidin 1–2 Minuten, Polihexanid 10–20 Minuten.
Antiseptika wirken bakterizid oder bakteriosta-tisch, fungizid oder fungistatisch sowie viruzid. Sie dienen der Infektionsbekämpfung und kommen nur solange zum Einsatz, bis eine Infektsanierung abge-schlossen ist. Zeitgemäße Produkte basieren auf Octe-nidin (Octenisept®: 0,1% Octenidin mit 2% Pheno-xyethanol) oder Polihexanid (z.B. Serasept®: 0,04 % Polihexanid). Ihr Einsatz bedingt eine klare Indika-tionsstellung. Cave: Octenisept® darf nicht unter Druck in Wundhöhlen eingebracht werden und muss jederzeit gut abfließen können, z.B. über eine Drai-nage oder Lasche.
Neben den Antiseptika gibt es auch noch konser-vierte Wundspüllösungen, die beispielsweise durch den Zusatz von antiseptischen Substanzen, meist Polihexanid oder Octenidin, konserviert worden sind. Cave: Wenn Polihexanid oder Octenidin nur als kon-servierender Stoff deklariert sind, also als Zusatz der Spüllösungen gelten, handelt es sich lediglich um Medizinprodukte. Trotz dieser antiseptischen Zusät-ze sind dies nur Spüllösungen zur mechanischen Wundreinigung und keine Antiseptika. Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kommen ent-sprechend zeitgemäße Antiseptika zum Einsatz.
Zur Wundspülung dürfen nur sterile Lösungen verwendet werden. Leitungswasser ist immer keim-belastet. Zudem ist ein Ausduschen der Wunde auf-grund verkeimter Duschköpfe oder Ablagerungen, wie Biofilmen in den Rohrsystemen, risikobehaftet. Alternativ kann gefiltertes Leitungswasser durch ei-nen endständigen Wasserfilter mit 0,2µm Porengrö-ße genutzt werden. Diese Filter sind derzeit nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen erstattungs-fähig. Ein Antrag auf Erstattung kann in Einzelfällen erfolgreich sein.
Wundbäder sind ebenfalls nicht mehr zeitgemäß, da sie diverse hygienische Risiken bergen. Keime, Eiter und Wundexsudat können in der Wanne nicht
WOUNDS AT RISK
Der W.A.R. Score erleichtert die Einschätzung von Risikowunden
Risikoklasse 1: 1 Punkt pro Risikodefinition (Mehrfachnennungen möglich)
Risikodefinitionen Punkte
Erworbene immunsuppressive Erkrankung, z.B. Diabetes mellitus
Erworbener Immundefekt durch medikamentöse Therapie wie Ciclosporin, Methotrexat, Glukokortikoide, Antikörper
Erkrankungen mit soliden Tumoren
Hämatologische Systemerkrankung
Postchirurgische Wundheilungsstörung, welche zu (ungeplanter) Sekundär-heilung führt
Durch Lokalisation besonders keimbelastete Wunden, z.B. Perineum, Geni-tale
Problematische, hygienische Bedingungen durch soziales oder berufliches Umfeld, z.B. Landwirt, LKW-Fahrer
Lebensalter des Patienten > 80 Jahre
Geringes Lebensalter des Patienten: Frühgeborene, Babys, Kleinkinder
Bestandsdauer der Wunde > 1 Jahr
Wundgröße > 10 cm²
Chronische Wunden aller Kausalitäten mit einer Tiefe > 1,5 cm
Stationärer Langzeitaufenthalt des Patienten > 3 Wochen
Gesamtpunkte
Risikoklasse 2: 2 Punkte pro Risikodefinition (Mehrfachnennungen möglich)
Risikodefinitionen Punkte
Schwere erworbene Immundefekte, z.B. HIV-Infektion
Stark verschmutzte Akutwunden
Biss-, Stich- und Schusswunden zwischen 1,5 und 3,5 cm Tiefe
Gesamtpunkte
Risikoklasse 3: 3 Punkte pro Risikodefinition (Mehrfachnennungen möglich)
Risikodefinitionen Punkte
Verbrennungswunden mit Beteiligung von > 15% KOF (Körperoberfläche)
Wunden, welche eine direkte Verbindung zu Organen oder Funktionsstruk-turen aufweisen, z.B. auch Gelenke bzw. körperfremdes Material enthalten
Schwere angeborene Immundefekte wie z.B. Agammaglobulinämie, Schwe-re kombinierte Immundefekte (SCID) etc.
Biss-, Stich- und Schusswunden > 3,5 cm Tiefe
Gesamtpunkte
Gesamtergebnis aller Punkte
Ergebnis Interpretation:Ein Score ≥ 3 Punkte bedeutet aus klinischer Sicht das Vorliegen einer infektionsgefähr-deten Wunde und bedingt somit die Anwendung lokaler Antiseptika.
(Dissemond J, Assadian O, Gerber V, et al. Einstufung von Risikowunden (Wounds at Risk; W.A.R. Score) und deren antimikrobielle Behandlung mit Polihexanid – eine praxisnahe Expertenempfeh-lung. WundManagement 2011; 2:76-85)
14
PflegeKolleg Infektionen vermeiden
Heilberufe / Das P� egemagazin 2014; 66 (5)

Heilberufe / Das P� egemagazin 2014; 66 (5) 15
abfließen und gelangen immer wieder an die Wunde, wodurch eine zusätzliche In-fektionsgefahr und Keimverschleppung entsteht.
Lokale WundbehandlungNach der Wundreinigung und antisep-tischen Spülung erfolgt die Auswahl der adäquaten Wundauflagen. Für die An-wendung auf kritisch kolonisierten und infizierten Wunden stehen silberhaltige Wundauflagen, hydrophobe Wundaufla-gen oder Wundauflagen mit Polihexanid zur Auswahl.
Silber hat ein breites Wirkspektrum ge-genüber grampositiven und gramnega-tiven Bakterien sowie Pilzen. Viele silber-haltige Wundauflagen geben elementares Silber an die Wunde ab oder setzen bei Kontakt mit Wundexsudat Silberionen frei. Diese lagern sich an die Zellwand der Bakterien an und dringen in die Mikro-organismen ein. Sie stören deren Zell-funktion und beeinträchtigen die Zelltei-lung durch Behinderung der DNA-Repli-kation. Einige silberhaltige Wundauflagen enthalten lediglich gebundenes Silber; die Wirkung tritt katalytisch beim Durch-dringen der Keime ein. Die Produkte unterscheiden sich je nach Hersteller be-züglich des Silbergehalts, der freigesetzten Menge, Aufbau und Zusammensetzung sowie Indikation und Kontraindikation. Die Angaben sind der Packungsbeilage zu entnehmen. Mischungen mit anderen Wirkstoffen (z.B. Jod, Octenisept®) sind nur im Rahmen der Herstellerangaben erlaubt.
Hydrophobe Wundauflagen binden die ebenfalls hydrophoben Wundbakterien (z.B. Staphylococcus aureus, Pseudomo-nas aeruginosa, MRSA) und Pilze an den unlöslich aufgedampften Wirkstoff Dial-kylcarbamoylchlorid (DACC). So werden bei jedem Verbandwechsel Keime aus der Wunde entfernt und die Bakterienmenge nach und nach reduziert.
Wundauflagen mit Polihexanid nutzen dessen antiseptische Wirkung, um Bak-terien und Pilze abzutöten. Der Einsatz all dieser Wundauflagen bedarf einer kla-ren Indikationsstellung (infizierte/ kri-tisch kolonisierte Wunde) und ist nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen keine
Dauerlösung. Nach 14tägiger Anwendung sollte die Therapie vom behandelnden Arzt in Absprache mit der Pflegenkraft/dem pflegerischen Wundexperten über-prüft und angepasst werden. Innerhalb dieser Zeitspanne ist die Keimreduktion gegebenenfalls so weit vorangeschritten, dass auf eine andere Versorgung umge-stellt werden kann.
▶ Die häufigste Komplikation bei der Wundheilung ist die lokale Infektion, die im Einzelfall zu einer Sepsis führen kann.
▶ Bei einer Sepsis ist eine systemische Antibiotikumgabe zu überdenken. Lo-kalantibiotika zur Wundbehandlung gelten als obsolet.
▶ Bei infizierten Wunden ist bei jedem Verbandwechsel eine Spülung mit Lo-kalantiseptika empfehlenswert.
▶ Nach der Wundreinigung und antisep-tischen Spülung wird eine adäquate Wundauflage gewählt. Ihr Einsatz be-darf der klaren Indikationsstellung: in-fizierte oder kritisch kolonisierte Wun-de.
FA Z IT FÜ R D I E PFLEG E
Kerstin ProtzKrankenschwester, Referen-tin für Wundversorgungkon-zepte, Projektmanagerin Wundforschung am CWC-Comprehensive Wound Cen-ter im Universitätsklinikum Hamburg-EppendorfVorstandsmitglied Wundzen- trum Hamburg e.V.Bachstr. 75, 22083 [email protected]
Anz
eige