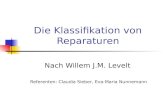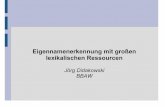Zur Klassifikation des lexikalischen Bedeutungswandels · PDF fileDie durch Innovation und...
Click here to load reader
-
Upload
hoangthuan -
Category
Documents
-
view
216 -
download
2
Transcript of Zur Klassifikation des lexikalischen Bedeutungswandels · PDF fileDie durch Innovation und...

Thomas Heim
Zur Klassifikation des lexikalischen Bedeutungswandels
Studienarbeit
Dokument Nr. V48948http://www.grin.com/ISBN 978-3-638-45515-2
9 783638 455152

LMU München
Institut für Romanische Philologie
Wintersemester 2001/2002
PS Linguistische Theorieansätze und Sprachbeschreibung
Zur Klassifikation des lexikalischen Bedeutungswandels
eingereicht von:
Thomas Heim

2
Gliederung
1. Einleitung
2. Zur Klassifikation lexikalischen Bedeutungswandels
2.1. Was ist Bedeutungswandel?
2.2. Der Prozess der semantischen Innovation und Lexikalisierung
2.3. Typen des Bedeutungswandels
2.3.1. Metapher
2.3.2. Metonymie
2.3.3. Auto-konverser Bedeutungswandel
2.3.4. Kohyponymischer Bedeutungswandel
2.3.5. Generalisierung
2.3.6. Spezialisierung
2.3.7. Lexikalische Absorption
2.3.8. Volksetymologischer Bedeutungswandel
2.3.9. Kontrastbasierter Bedeutungswandel: Antiphrasis und Auto-Antonymie
2.3.10. Analogischer Bedeutungswandel
2.3.11. Intensivierung und Deintensivierung
2.4. Motive für den lexikalischen Bedeutungswandel
2.5. Nutzen der Merkmals- und Prototypensemantik für die Beschreibung
semantischen Wandels
3. Zusammenfassung der Ergebnisse
4. Bibliografie
3
3
3
4
5
5
6
8
8
9
9
10
11
11
12
12
13
14
14
16

3
1. Einleitung
« Les mots n’ont plus le même sens qu’autrefois. »1
Mit diese Feststellung weist ein nostalgischer Polizist in Raymond Queneaus Roman Zazie
dans le métro lapidar darauf hin, dass die Bedeutung von Wörtern sich im Laufe der Zeit nicht
selten ändert. Die Beschreibung eines derartigen lexikalischen Bedeutungswandels ist ein Ziel
der historischen Semantik, die ihre Anfänge im 19. Jahrhundert hatte. Nach einer Hochblüte
um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert fand die historische Semantik ihren vorläufigen
Abschluss im Werk Stephen Ullmanns.2 In dieser Epoche steht die Klassifikation des
Bedeutungswandels nach rhetorischen und/oder psychologischen Kriterien im Vordergrund.
Im ausgehenden 20. Jahrhundert fallen die Arbeiten von Andreas Blank auf, an die sich die
folgenden Ausführungen vorwiegend anlehnen.
Nach einer kurzen Klärung des Begriffs „Bedeutungswandel“ möchte ich auf den Prozess der
semantischen Innovation und Lexikalisierung sowie auf die verschiedenen Typen von
Bedeutungswandel eingehen, um danach Motive für den Bedeutungswandel aufzuzeigen.
Abschließend soll der Nutzen der Merkmals- und Prototypensemantik für die Beschreibung
semantischen Wandels kurz angeschnitten werden.
2. Zur Klassifikation lexikalischen Bedeutungswandels
2.1. Was ist Bedeutungswandel?
Allgemein kann unter Bedeutungswandel die Veränderung der Bedeutung eines Wortes im
Verlauf seiner sprachgeschichtlichen Entwicklung verstanden werden. Bedeutungswandel ist
also ein diachronischer Begriff.
Blank weist darauf hin, dass der Begriff des Bedeutungswandels ungenau sei:
Es verändert sich nämlich nicht eine Bedeutung eines Wortes, sondern [...] zu der oder den vorhandenen Bedeutungen [kommt] eine weitere hinzu und wird lexikalisiert [innovativer Bedeutungswandel/semantische Innovation] oder eine der lexikalisierten Bedeutungen wird ungebräuchlich und fällt weg [reduktiver Bedeutungswandel].3
1 Queneau 1981, 105. 2 Ullmann 1963 [11951] u. a. 3 Blank 2001, 70.

4
Das kann bedeuten, dass eine Lexie, die nur noch eine einzige Bedeutung hatte, durch
reduktiven Bedeutungswandel komplett „ausstirbt“. Andererseits werden durch Innovation
auch neue Konzepte versprachlicht und lexikalisiert.
2.2. Der Prozess der semantischen Innovation und Lexikalisierung
Als erster Schritt im Prozess des Bedeutungswandels steht die semantische Innovation im
Diskurs eines einzelnen Sprechers oder einer Sprechergruppe. Wird diese Innovation von
anderen Sprechern übernommen (Gefallen, kommunikativer Gewinn), so kann es zur
Lexikalisierung der Innovation kommen. Das betreffende Lexem erhält eine weitere
Bedeutung. Erreicht die Innovation die gemeinsprachliche Ebene einer Einzelsprache, wird
sie zur Sprachregel.4
Am Beispiel von engl. mouse wird der Prozess der Innovation deutlich:
Der Erfinder [des graphischen Zeigegerätes für Computer] assoziierte auf der Basis bestimmter ähnlicher perzeptueller Merkmale zu dem Konzept GRAPHISCHES ZEIGEGERÄT das Konzept MAUS [...]. Die eigentliche Innovation bestand dann in der Übertragung des Zeichenausdrucks engl. mouse auf das in assoziative Relation gebrachte Konzept [...]: Dies ist die Versprachlichung des neuen Konzepts. Zur Lexikalisierung kam es, als diese offenbar erfolgversprechende Innovation im Zuge der Vermarktung popularisiert wurde und sich tatsächlich innerhalb der Sprachgemeinschaft habitualisierte; engl. mouse hat seither beide Bedeutungen, ‘Nagetier’ und ‘graph. Zeigegerät für Computer’.5
Innovation und Lexikalisierung erfolgen idealtypisch in drei Schritten :
Auf Grund einer perzeptuellen Similarität erfolgt eine Assoziation; „ce sont les champs
associatifs qui fourniront la matière première de l’innovation.“6 Die Übertragung des
Zeichenausdrucks auf das in assoziative Relation gebrachte Konzept liefert die Innovation,
also die „Versprachlichung“ des neuen Konzepts. Durch eine popularisierte und
habitualisierte Innovation kommt es im dritten Schritt zur Lexikalisierung.
Die dominanten Assoziationsrelationen sind hierbei die metaphorische Similarität (Metapher)
sowie die konzeptuelle Kontiguität (Metonymie). Alle weiteren Assoziationsrelationen sind
aber möglich.7
4 Cf. Blank 2001, 71. 5 Blank 2001, 72. Ullmann (1963) unterteilt in logische Klassifizierung (Bedeutungsverengung, -erweiterung, -verschiebung), evaluative Klassifizierung (Bedeutungsverschlechterung, -verbesserung) und funktionelle Klassifizierung (Übertragung des signifiant auf Grund der Similarität bzw. der Kontiguität der signifiés; Übertragung des signifié auf Grund der Similarität bzw. der Kontiguität der signifiants). 6 Ullmann 1975, 276. 7 Cf. Blank 2001, 43f.

5
Die durch Innovation und Lexikalisierung gewonnene neue Bedeutung koexistiert für einen
mehr oder weniger längeren Zeitraum mit der älteren (Polysemie).
2.3. Typen des Bedeutungswandels
Folgende Klassifizierungen von Bedeutungswandel schlägt Blank vor:8
2.3.1. Metapher
Ullmann bezeichnet die Metapher als „comparaison en raccourci“.9 Dieser etwas vagen
Beschreibung muss hinzugefügt werden, dass die Metapher die Ersetzung darstellt einer
„primären semantischen Texteinheit durch eine sekundäre, die zu jener in eine Abbild- oder
Ähnlichkeitsrelation gesetzt wird“.10 Typische Beispiele sind Tiermetaphern (Lambert est un
cochon), synästhetische Metaphern (Übertragungen von einem Bereich der
Sinneswahrnehmung in einen anderen, z.B. in couleurs criardes, voix sombre) und so
genannte anthropomorphe Metaphern (Übertragung aus der menschlichen Domäne, besonders
der menschlichen Körperteile, in die verschiedensten nicht-menschlichen Domänen, z.B. le
pied de table, l’œil du marteau; un gratte-ciel).11
In der kognitiven Linguistik wird die Metapher nicht als ein rein linguistisches Phänomen
gesehen, sondern in erster Linie als ein grundlegender kognitiver Prozess, mit dem wir die
Welt erfassen, unser Weltwissen organisieren und mit Hilfe von Sprache beschreibbar
machen können. Metaphern sind nicht nur „schmückendes Beiwerk“ der Sprache, sondern
allgegenwärtig und durchdringen alle Bereiche der Sprache.12 Sie sind nur häufig so tief in der
Kognition verankert und ein derart unverzichtbarer Bestandteil unseres Sprachgebrauchs
geworden, dass wir uns ihrer meist gar nicht mehr bewusst sind.13
Die innovative Metapher ist nun mehr als der zitierte „verkürzte Vergleich“: Sie entsteht aus
der Interaktion zwischen der Ausgangsbedeutung und einem dazu in einem gewissen
Widerspruch stehenden Kontext.14
„Die innovative Bildung einer Metapher setzt eine kreative Konzeptualisierung voraus: Wir
müssen etwas als etwas anderes sehen und dann als dieses andere versprachlichen.“15
8 Blank 2001, 74-95; 105. Die von Ullmann (1963: 188-230) präsentierte Einteilung der Klassifikationstypen in die Gruppen logisch-rhetorischer, genetischer, eklektischer und empirischer Typ wird hier nicht übernommen. 9 Ullmann 1975, 277. 10 Plett 1989, 79. 11 Cf. Ullmann 1975, 277-284. 12 Cf. Lakoff/Johnson 1980: Metaphors We Live By. 13 Cf. Blank 2001, 74f.

6
Kommt es zu einer Lexikalisierung, so können wir die Metapher verstehen, ohne auf den
Kontext Bezug zu nehmen.
Das psychologisch-assoziative Grundprinzip der Metaphernschöpfung beschreibt Blank wie
folgt:
Ein Konzept (oder ein konkreter Referent) wird mit einem Wort bezeichnet, dessen angestammtes Konzept einem ganz anderen Bereich unseres Weltwissens angehört. Der innovierende Sprecher rückt dabei eine meist periphere, perzeptuelle oder funktionelle oder auch nur (inter)subjektiv empfundene Similarität der beiden Konzeptbereiche ins Rampenlicht. Der dabei stattfindende Vorgang wird in Anlehnung an die Gestaltpsychologie auch als „Kippeffekt“ [...], oder, in der Kognitiven Linguistik, als „domain mapping“ [...] bezeichnet.16
Selten sind wir jedoch wirklich innovativ: Wir schaffen eine neue Metapher meist auf der
Basis eines schon eingeführten Bildfeldes. Solche prägnanten Bildfelder werden
Konzeptmetaphern genannt. Diese Metaphernverbänden speisen ihre Zieldomäne aus einer
bestimmten Quelldomäne. Hierzu ein Beispiel:
(1) fr. „cette cinquième semaine qui a été et qui reste votre cheval de bataille“ ‘diese fünfte [Urlaubs]woche, die Ihr Schlachtross war und bleibt’17
Das Konzept POLITISCHE AUSEINANDERSETZUNG dient hier als Bildempfänger
(Zieldomäne), das Konzept KRIEG als Bildspender (Quelldomäne).
„Für die semantische Innovation und ihre Lexikalisierung sind solche konzeptuellen
Metaphern von großer Relevanz, denn wenn eine bestimmte Quelldomäne bereits in einer
Sprachgemeinschaft usuell ist, kann man ohne größeres Risiko neue Metaphern aus ihr
schöpfen.“18 Zu beachten ist, dass Konzeptmetaphern kulturabhängige, erlernte Phänomene
sind.
Durch Metaphern wird der zu versprachlichende Sachverhalt also oft als ein ganz anderer
konzeptualisiert.19
2.3.2. Metonymie
Der entscheidende Unterschied zwischen Metapher und Metonymie ist, dass bei letzterer kein
Transfer von einer kognitiven Domäne in eine andere stattfindet, sondern auf eine objektiv
bestehende Verbindung zwischen zwei gemeinsam auftretenden, sachlich „unmittelbar
14 Black 1983. 15 Blank 2001, 75. 16 Blank 2001, 75. 17 Ludwig 1988, 109f., zit. n. Blank 2001, 76. 18 Blank 2001, 76. 18 Cf. dazu auch Blank 2001, 77f.: „Besonderheiten metaphorischer Verben und Präpositionen“. 19 Cf. dazu auch Blank 2001, 77f.: „Besonderheiten metaphorischer Verben und Präpositionen“.

7
benachbarten“ Phänomenen unseres Weltwissens abgehoben wird. Als Ergebnis steht das eine
für das andere Phänomen. Metonymien basieren also nicht auf einer Ähnlichkeitsbeziehung,
sondern auf Kontiguität. Die betroffenen Phänomene oder Entitäten sind Teile derselben
Situation oder derselben konzeptuellen Struktur.
Gestalttheoretisch kann der metonymische Prozess als Figur-Grund-Effekt verstanden
werden:
(2) asp. pregón ‘Bote’ > ‘Botschaft’ (HANDELNDER – GEGENSTAND DER HANDLUNG)
Zunächst ist das bereits versprachlichte Konzept, also z.B. der BOTE, die Figur, die sich auf dem Hintergrund der von ihm zu überbringenden BOTSCHAFT profiliert. Wichtig ist, dass das Konzept BOTSCHAFT in dem entsprechenden Frame immer schon präsent ist und dass die beiden Konzepte in unserem Weltwissen bereits durch eine prägnante Kontiguität verbunden sind. Im metonymischen Prozess kehrt sich die ursprüngliche konzeptuelle Struktur nun um und die BOTSCHAFT wird zur Figur und sodann ebenfalls mit prégon versprachlicht (Koch 1999a; 2000 [...]).20
„Die Metonymie als sprachliches Verfahren holt eine solche kognitiv bereits verankerte
Figur-Grund-Struktur gewissermaßen an die ‘Oberfläche’.“21
Konzeptmetonymien
„Konkrete lexikalische Metonymien sind in [...] ‚Konzeptmetonymien’ eingebunden, die den
möglichen Typen von Kontiguitätsrelationen zwischen Konzepten in Frames entsprechen,
also z.B. [...] URSACHE – FOLGE [...].“22
Daneben existieren konkretere Konzeptmetonymien, die oft auf bestimmte Diskurskontexte
beschränkt bleiben, wie z.B. ZU OPERIERENDES ORGAN – PATIENT: Liegt die Galle schon
auf dem OP-Tisch?
Blank stellt zusammenfassend fest, dass alle Konzeptmetonymien offensichtlich
„ausnahmslos entweder auf kopräsente oder sukzessive Kontiguitätsrelationen zurückgeführt
werden können“.23
Synekdoche
Die Synekdoche als Sonderfall der Metonymie beinhaltet Teil-für-Ganzes (pars pro toto)
Relationen oder Ganzes-für-Teil (totum pro parte) Relationen. „La différence est purement
d’ordre logique: dans la métonymie, les deux sens sont coordonnés, tandis que dans la
20 Blank 2001, 79. Blank (2001, 122) erklärt Frame unter Rückgriff auf Minsky, der sich auf die Struktur des menschlichen mentalen Lexikons bezieht: „Minsky versteht unter Frame ‚a data structure for representing a stereotyped situation’, die aus dem Gedächtnis ausgewählt wird, wenn man in die entsprechende Situation gerät.“ 21 Ebd. 22 Blank 2001, 80.

8
synecdoque, il y a subordination entre eux.“24 Es handelt sich um eine „diachronische
Ausprägungen der Meronymie-Relation“25:
(3) TEIL – GANZES: fr. baiser ‘küssen’ > ‘den Liebesakt vollziehen’ (4) GANZES - TEIL: sp. quebrada ‘Schlucht’ > ‘Bach’26
Es liegt eine Beziehung zwischen kontigen Elementen vor, die wir in der Welt tatsächlich als
zusammengehörig erfahren.
2.3.3. Auto-konverser Bedeutungswandel
Die Auto-Konverse ist ein Sonderfall der Metonymie und ein nur relativ seltener Fall von
Bedeutungswandel. Sie beruht auf konzeptueller Kontiguität, d.h. die beiden Elemente der
Konversion sind räumlich, zeitlich oder logisch spiegelbildlich aufeinander bezogen.
Die Autokonverse hat ihre psychologische Grundlage in einer reziproken Aufeinanderbezogenheit von Teilaspekten innerhalb eines Frames. Bei verbalen Frames handelt es sich dabei um die meist als Aktanten realisierten Partizipanten der Verbalhandlung. Man kann daher auch von einer „inneren Metonymie“ sprechen.27
Der auto-konverse Bedeutungswandel lässt sich als Perspektivwechsel beschreiben: Das
bisherige Grundkonzept wird zur Figur, das bisherige Figurkonzept tritt in den Hintergrund.28
Dieser Fall liegt z.B. bei fr. louer ‘vermieten’ > ‘mieten’ vor oder bei einigen Gefühlsverben,
z.B. spätlt. inodiare ‘jdn. hassen’ > ‘jdn. ärgern (= Hass verursachen)’ (> fr. ennuyer).29
2.3.4. Kohyponymischer Bedeutungswandel
Diese Übertragung zwischen zwei Kohyponymen läuft auf der Grundlage der
kotaxonomischen Similarität ab, d.h. beide Konzepte gehören demselben Sachfeld an und die
entsprechenden lexikalischen Einheiten sind Kohyponyme eines gemeinsamen Hyperonyms.
(5) sp. tigre ‘Tiger’ > am.sp. (teilw.) ‘Jaguar’ (6) fr. chevreuil ‘Reh(bock)’ > kanad.fr. ‘Hirsch’
Die kohyponymische Übertragung ist als ad-hoc-Bildung sicher sehr häufig [...], als lexikalisiertes Phänomen kommt sie fast nur bei Tieren und Pflanzen vor und hängt häufig damit zusammen, dass Menschen aus einer Lebenswelt in eine andere kommen, also gewissermaßen den Frame wechseln. In der „neuen“ Welt übertragen die Sprecher dann
23 Blank 2001, 80. 24 Ullmann 1975, 286. 25 Blank 2001, 81. 26 Zit. n. Blank 2001, 81. 27 Blank 2001, 81. 28 Koch 2000. 29 Blank 2001, 84f.

9
ihre gewohnten Bezeichnungen auf ähnlich aussehende Tiere und Pflanzen. Der Hintergrund ist natürlich Sprachökonomie.30
2.3.5. Generalisierung
Bei der Generalisierung „ist die Zielbedeutung Hyperonym der Ausgangsbedeutung.“31
Diachronisch betrachtet, „stellt man häufig fest, dass das ursprünglich mit dem Prototyp einer
Kategorie verbundene Sprachzeichen auf die gesamte Kategorie übertragen wurde:“32
Fr. arriver und it. arrivare ‘ankommen’ gehen auf die enger gefasste Bedeutung des vlt.
Prototyps *adripare ‘am Ufer ankommen’ zurück. Die Zielbedeutung umfasst also nicht mehr
nur auf dem Seeweg, sondern überall und mit jedem Beförderungsmittel ‘ankommen’. Der
dominante Prototyp wirkt hier als „Expansionszentrum“33, von dem aus die Sprachzeichen
allmählich auf alle weiteren Mitglieder der Kategorie übertragen werden. „Der diachronische
Prozess der Generalisierung beruht also auf der Similarität der Mitglieder einer Kategorie
untereinander und insbesondere in Bezug auf den Prototypen dieser Kategorie. Als Ergebnis
dieses Prozesses kommen wir jedoch zu einem Oberbegriff, sodass wir den Prozess selbst als
taxonomische Überordnung [...] beschreiben können.“34
2.3.6. Spezialisierung
Bei der Spezialisierung verhält es sich genau umgekehrt:
Hier wird das mit einer übergeordneten Kategorie verbundene Zeichen beständig nur zur Bezeichnung eines Prototypen dieser Kategorie verwendet, bis sich schließlich neben der ursprünglichen Bedeutung eine speziellere lexikalisiert, welche die ursprüngliche dann oft verdrängt. Der Prototyp ist hier [...] das kognitive „Attraktionszentrum“:35
(7) lt. potionem ‘Trank’ > fr. poison ‘Gift’ (8) ae. steorfan ‘sterben’ > ne. starve ‘verhungern’ (9) lt. homo ‘Mensch’ > fr. homme, it. uomo, sp. hombre ‘Mann’
„In patriarchalischen Gesellschaften gilt der Mann als ‘Mensch schlechthin’, ja oft sind in
solchen Gesellschaften, wenn von ‘Menschen’ die Rede ist, nur Männer anwesend oder nur
Männer gemeint.“36
Die Bedeutung des Wortes wird also spezifischer und inhaltsreicher.
30 Blank 2001, 86. 31 Blank 2001, 87. 32 Ebd. 33 Sperber 1965. 34 Blank 2001, 87f. 35 Blank 2001, 88. 36 Ebd.

10
„Diachronisch spielt hier wieder die Similarität der beteiligten Konzepte eine Rolle,
synchronisch bleibt die taxonomische Relation. Den Prozess selbst können wir als
taxonomische Unterordnung beschreiben.“37
2.3.7. Lexikalische Absorption
Je häufiger Komposita und lexikalisierte Syntagmen verwendet werden, „desto störender wird
die lexikalische Komplexität, und zwar vor allem dann, wenn der Frame eindeutig gesetzt
ist:“38 Wenn in einer deutschen Kneipe Weizenbier bestellt wird, ist –bier eigentlich
redundant, weil aus dem Kontext hervorgeht, dass es sich um Bier handelt. In dieser Situation
reduzieren die Sprecher den Wortkörper und bestellen „ein Weizen“.
Der kognitive Hintergrund dieses Wandels ist also die häufige Verwendung der komplexen Lexie in einem bestimmten Frame oder Redekontext, wobei bestimmte durch die komplexe Lexie transportierte semantische Informationen durch den Kontext selbst schon mitgebracht werden [...]: lexikalische Redundanz wird abgebaut.39
Die assoziative Basis des Bedeutungswandels bildet die „Kontiguität zwischen einer
einfachen und einer komplexen Lexie, deren Teil die einfache ist[.]“40 Weizen ist als Wort
Teil der komplexen Lexie Weizenbier. Es besteht eine lexikalische Teil-Ganzes-Relation.
„Die semantische Innovation besteht nun darin, dass der Zeichenausdruck der einfachen Lexie
(also z.B. [Weizen]) auf die entsprechende komplexe Lexie (also hier [Weizenbier])
übertragen wird. Als Ergebnis der Übertragung wird [Weizen] polysem und bedeutet dann
‘Weizenbier’ und ‘[Weizen (Getreide)]’. [...] Die wirkende Assoziation ist hier also die
Kontiguität zwischen der komplexen Lexie [Weizenbier] und dem an der Fügung beteiligten
Lexem [Weizen]. Dieses Lexem absorbiert nun gewissermaßen die Bedeutung der komplexen
Lexie und erhält dadurch selbst eine weitere Bedeutung. Der Bedeutungswandel trifft also
nicht die komplexe Lexie, sondern die einfache. Insofern kennzeichnet der Terminus ‚Ellipse’
diesen Typ des Bedeutungswandels nicht zutreffend: Wir sprechen stattdessen von
‚lexikalischer Absorption’.“41
Dieser Typ ist nach der Metonymie und der Metapher einer der häufigsten Formen des
Bedeutungswandels, was vor allem durch den Beitrag zur Ökonomie des Wortschatzes erklärt
werden kann.
37 Blank 2001, 88. 38 Blank 2001, 89. 39 Ebd. 40 Ebd. 41 Blank 2001, 89f.

11
2.3.8. Volksetymologischer Bedeutungswandel
Wir ein Lexem oder Lexembestandteil nicht (mehr) verstanden, so wird dieses/er häufig durch
eine lautliche Umgestaltung unter – etymologisch falscher – Anlehnung an ein klangähnliches
Wort volkstümlich verdeutlicht. Dieser Prozess wird als Reanalyse-Phänomen bezeichnet:
„Ein Wort wird aufgrund einer formalen lautlichen Similarität auf dieses ähnliche Wort oder
als einen Fügung von lautlich ähnlichen Wörtern interpretiert. In allen Fällen widerspricht
diese Reanalyse der eigentlichen Etymologie des betreffenden Wortes:“42
(10) frühnfr. cussin ‘Stechmücke’ > cousin (Einfluss von cousin ‘Vetter’) (11) prov. balar > asp. balar ‘tanzen’ > bailar (Einfluss von bailar ‘schwanken’)
Diese Beispiele zeigen keinen Bedeutungswandel im strengen Sinn, auch wenn das Ergebnis
einem Bedeutungswandel entspricht. „Die konzeptuelle Kontiguität (seltener auch
Similaritätsrelation) kann aber im Kontext mit der formalen Similarität auch einen echten
Bedeutungswandel bei dem volksetymologisch reanalysierten Wort auslösen:“43
(12) fr. forain ‘auswärtig’ > ‘zum Markt gehörig’ (Einfluss von foire ‘Markt’, ‘Messe’) (13) mhd. vrîthof ‘eingefriedeter Raum um die Kirche, der als Begräbnisstätte dient’ > nhd. Friedhof ‘Begräbnisstätte’ (Einfluss von vride ‘Friede’) (14) fr. jour ouvrable ‘Werktag’ > ‘Öffnungstag’
In diesen Beispielen besteht „neben der lautlichen Similarität eine Weltwissensbeziehung:
Markthändler kommen von auswärts, [...] auf dem eingefriedeten Kirchhof sollen die Toten
ihren Frieden finden.“44
Oft wird durch Volksetymologie eine bessere Integrierung umgedeuteter Wörter und somit
eine erhöhte Ökonomie des Wortschatzes bewirkt, da die Formenvielfalt und die Zahl
unmotivierter Wörter reduziert wird.45
2.3.9. Kontrastbasierter Bedeutungswandel:
Antiphrasis und Auto-Antonymie
Der Bedeutungswandel auf der Basis von kotaxonomischem bzw. antiphrastischem Kontrast46
ist sehr selten, kommt aber in Gestalt von ad-hoc-Bildungen im aktuellen Diskurs – meist zum
Ausdruck von Ironie oder als Euphemismus – sehr häufig vor.
42 Blank 2001, 91. 43 Ebd. 44 Blank 2001, 92.

12
Der antiphrastischen Bedeutungswandel beruht auf einem „salienten Gegensatz im
Weltwissen oder bei den Konnotationen:“47
(15) afr. Oste ‘Gast’ > Geisel (16) fr. bel(l)ette, sp. comadreja nit. donnola ‘Gevatterin’ > ‘Wiesel’
„Beim selteneren zweiten Typ von kontrastbasiertem Bedeutungswandel steht die neue
Bedeutung in direkter Antonymie zur alten; wir können also, analog zur Auto-Konverse, von
Auto-Antonymie sprechen:“
(17) lt. sacer ‘heilig, geheiligt’ > ‘verflucht’ (fr. sacré) (18) engl. bad ‘schlecht’ > engl. (slang) ‘gut, hervorragend’
2.3.10. Analogischer Bedeutungswandel
Bei dieser Art des Bedeutungswandels handelt es sich um „die Kopie der Polysemie eines
Lexems bei einem anderen, wobei die ältere Bedeutung des ‘kopierenden’ Lexems in [einer
lexikalischen Relation] zum ‘kopierten’ Lexem steht.“48
(19) engl. hardly ‘hart’ > ‘schwierig’
Dieser Typ findet sich vor allem im Substandard (cf. dt. Kohle → Kies → Schotter), kann
aber auch standardsprachlich werden.49
2.3.11. Intensivierung und Deintensivierung
Expressive und euphemistische Bezeichnungen unterliegen [...] durch häufigen Gebrauch einer gewissen Abnutzung, sodass sie im Laufe der Zeit zum einfachen Normalwort für den jeweiligen Sachverhalt werden. Wenn eine euphemistische Markierung verloren geht, können wir von Intensivierung oder Bedeutungsverstärkung sprechen, da der abschwächende verhüllende Charakter wegfällt; wenn ein expressiv oder drastisch markiertes Wort zum Normalwort wird, so handelt es sich bei diesem Prozess um eine Deintensivierung oder Bedeutungsabschwächung.50
Einige Beispiele:51
(20) fr. décéder ‘weggehen’ > [Metapher] ‘sterben (euphemistisch’ > [Intensivierung] ‘sterben’
(21) lt. infirmus ‘schwach’ > [Metonymie] ‘krank (euphemistisch)’ > [Intensivierung] afr. enferm, sp. enfermo ‘krank’, it. infermo ‘sehr krank’
45 Cf. Blank 2001, 92. 46 Cf. Blank 2001, 43f. 47 Blank 2001, 92f. 48 Blank 2001, 93. 49 Cf. Blank 2001, 93f. 50 Blank 2001, 94. 51 Zit. n. Blank 2001, 94f.

13
(22) lt. perna ‘Hinterkeule’ > [Metapher] sp. pierna ‘Bein (expressiv)’ > [Deintensivierung] ‘Bein’
Intensivierung und Deintensivierung sind Sekundärprozesse des Bedeutungswandels, insofern ihnen in den meisten Fällen ein anderer (metaphorischer, metonymischer etc.) Bedeutungswandel vorausgeht, bei dem eine abtönend-euphemistisch oder eine drastisch-expressiv markierte Bedeutung entstanden ist.52
2.4. Motive für den lexikalischen Bedeutungswandel
Die Durchsetzung einer Bedeutung im Sprachsystem kann ein langer Prozess mit mehreren
Etappen sein. Man unterscheidet in diesem Zusammenhang die okkasionelle Bedeutung in der
parole von der usuellen Bedeutung in der langue.53
Beeinflusst bzw. ausgelöst wird der Bedeutungswandel durch folgende Faktoren:54 Ein
konkreter Bedarf an Bedeutungswandel kann bestehen, wenn im Wortschatz keine passende
Bezeichnung für einen neu auftauchenden Referenten vorhanden ist (engl. mouse ‘kleines
Nagetier’ > ‘grafisches Zeigegerät für Computer’). Hinzu kommen außersprachliche
Faktoren, wie die Veränderung des Referenten (dîner ‘Mittagessen’ > ‘Abendessen’) oder das
Wissen über den Referenten. Eine gewisse Rolle spielt auch, dass sich Gruppen durch ihre
Sprache sozial identifizieren und dass die Veränderungen einer Gruppensprache in den
Standard eingehen können. Häufig werden abstrakte oder „fern liegende“ Konzepte „über die
Hervorhebung einer Similarität zu einem Konzept, das uns ‘näherliegt’ [sic], konzeptualisiert
und dann metaphorisch versprachlicht“55. Ein soziokultureller Wandel kann sich auch in der
Sprache abzeichnen und eine Veränderung der Bedeutung eines Lexems bewirken (z.B.
machte ein Wandel des römischen Rechtssystems die lateinische Unterscheidung zwischen
Verwandtschaft mütterlicher- und väterlicherseits obsolet). Das Streben der Sprecher nach
möglichst geringem kommunikativem Aufwand bei möglichst großem kommunikativen
Effekt (Ökonomieprinzip) bewirkt, dass in enger Frame-Relation stehende Konzepte sich
wandeln und lexikalische Irregularität oder Komplexität verringert wird. Schließlich kann die
emotionale Markierung eines Konzeptes einen Bedeutungswandel bewirken; das jeweilige
Konzept kann verhüllend-euphemistisch oder drastisch-expressiv versprachlicht werden.
52 Blank 2001, 95. 53 Cf. Ullmann 1963, 165-168. Ullmann bspw. sieht den Bedeutungswandel in drei Etappen: Stufe der parole, Zwischenstufe, Stufe der langue. 54 Cf. Blank 2001, 95-100; Ullmann 1963, 170-185. 55 Blank 2001, 96.

14
2.5. Nutzen der Merkmals- und Prototypensemantik für die Beschreibung semantischen Wandels
In der Summe ist die Prototypensemantik eine „Mehr-oder-Weniger-Semantik“, die mit ihrem
ganzheitlichen Ansatz der Kategorisierung im Alltag und insgesamt der psychologischen
Realität deutlich mehr entspricht als die traditionelle Merkmals- (bzw. „Alles-oder-Nichts“-)
Semantik in der strukturalistisch geprägten Lexikologie. Das mindert allerdings nicht die
Nützlichkeit der Merkmalssemantik bei der Beschreibung und dem Vergleich von
Wortbedeutungen und deren Wandel, insbesondere in der Herausarbeitung semantischer
Strukturen wie Wortfeldern oder Sinnrelationen. Und selbst als Theorie der mentalen
Repräsentation von Bedeutung muss die Merkmalssemantik nicht aufgegeben werden: Auch
die Prototypensemantik, ob in der Standardversion oder der jüngeren, auf Familienähnlichkeit
abstellenden Version, kann ja nicht auf den Abgleich von Merkmalen verzichten. Prototypen
und Merkmalssemantik ergänzen sich also letztlich, indem die Merkmalssemantik eine
solidere psychologische Grundlage erhält.56
3. Zusammenfassung der Ergebnisse
Bedeutungswandel wird zumeist als das Hinzukommen einer neuen Bedeutung bei einem
Zeichen verstanden (innovativer Bedeutungswandel), aber auch der Wegfall einer Bedeutung
bei einem Wort sollte hinzugerechnet werden (reduktiver Bedeutungswandel). Bei der
Klassifikation des Bedeutungswandels unterscheidet man Erweiterung, Verengung und
Verschiebung der Bedeutung, genauer der Extension eines Wortes. In einer möglichen
Verlaufsform kann zwischen der semantischen Innovation, verschiedenen Stufen der
Habitualisierung (Usualisierung als Diskursregel, Lexikalisierung als Sprachregel) und
verschiedenen Möglichkeiten eines Abbaus einer Bedeutung („Aussterben“, Homonymie)
unterschieden werden. Zu jedem Bedeutungswandel tragen grundsätzlich drei Aspekte bei:
eine ihn auslösende sprachliche oder außersprachliche Ursache, eine den Wandel
ermöglichende Assoziation und ein sprachliches Verfahren. Bei den Assoziationsprinzipien,
auf Grund derer ein Zeichen eine neue Bedeutung erhält, muss neben den Prinzipien der
Similarität und Kontiguität auch der Kontrast berücksichtigt werden, auch wenn er beim
Bedeutungswandel keine dominante Rolle spielt. Die verschiedenen Typen des
56 Cf. Koch 1996; Kleiber 1990.

15
Bedeutungswandels sind Metapher, Metonymie, Auto-Konverse, Kohyponymie,
Generaliseriung, Spezialisierung, lexikalische Absorption, volksetymologischer
Bedeutungswandel, Antiphrasis, Auto-Antonymie, Analogie, Intensivierung und
Deintensivierung. Als mögliche Motive für den lexikalischen Bedeutungswandel kommen in
Frage: Versprachlichung eines neuen Konzepts, abstraktes oder fernliegendes Konzept, sozio-
kultureller Wandel, enge konzeptuelle oder sachliche Verbindung, lexikalische Irregularität
sowie emotionale Markierung eines Konzepts. Hinter diesen Motiven steht das Streben der
Sprecher nach möglichst effektiver Kommunikation. Zur Beschreibung des semantischen
Wandels können sowohl die Merkmals- als auch die Prototypensemantik nützlich sein,
letztere aber vor allem in ihrer erweiterten Form.

16
4. Bibliographie
BLACK, Max (1983): „Die Metapher“, in: Haverkamp, Anselm (Hrsg.), Theorie der Metapher, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 55-79. BLANK, Andreas (2001): Einführung in die lexikalische Semantik für Romanisten, Tübingen: Niemeyer (= Romanistische Arbeitshefte 45). BUßMANN, Hadumod (21990): Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart: Kröner.
GLÜCK, Helmut (Hrsg.) (22000): Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart/Weimar: Metzler.
KLEIBER, Georges (1990): La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical, Paris: Presses Universitaires de France.
KOCH, Peter (1996): „La sémantique du prototype – sémasiologie ou onomasiologie?“, in: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 106, 223-240.
KOCH, Peter (1998a): „Prototypikalität: konzeptuell – grammatisch – linguistisch“, in: Figge, Udo L./Klein, Franz-Josef/Martínez Moreno, Annette (Hrsg.), Grammatische Strukturen und grammatischer Wandel im Französischen: Festschrift für Klaus Hunnius zum 65. Geburtstag, Bonn: Romanistischer Verlag (= Abhandlungen zur Sprache und Literatur 117), 281-308.
KOCH, Peter (1999a): “Frame and Contiguity: On the Cognitive Bases of Metonymy and Certain Types of Word Formation”, in: Panther, Klaus-Uwe/Radden, Günter (Hrsg.), Metonomy in Language and Thought, Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
KOCH, Peter (2000): “Metonomy: Unity in Diversity”, in: Eckardt, Regine/v. Heusinger, Klaus (Hrsg.): Meaning Change – Meaning Variation, Konstanz: FB Sprachwissenschaft. (http://www.ling.uni-konstanz.de/pages/publ/abstracts/ap106.html)
LAKOFF, George / JOHNSON, Mark (1980): Metaphors We Live By, Chicago: UCP.
LUDWIG, Ralph (1988): Korpus: Texte des gesprochenen Französisch. Materialien I, Tübingen: Narr.
LYONS, John (1980): Semantik. Band I, München: Beck.
PLETT, Heinrich F. (71989): Einführung in die rhetorische Textanalyse, Hamburg: Buske.
QUENEAU, Raymond [1959] (1981): Zazie dans le métro, Paris: Gallimard.
SCHWARZE, Christoph (2001): Introduction à la sémantique lexicale, Tübingen: Narr.
SPERBER, Hans (21965): Einführung in die Bedeutungslehre, Bonn: Schroeder.
ULLMANN, Stephen (31963): The Principles of Semantics, Glasgow/Oxford: Blackwell.
ULLMANN, Stephen (51975): Précis de sémantique française, Bern: Francke.