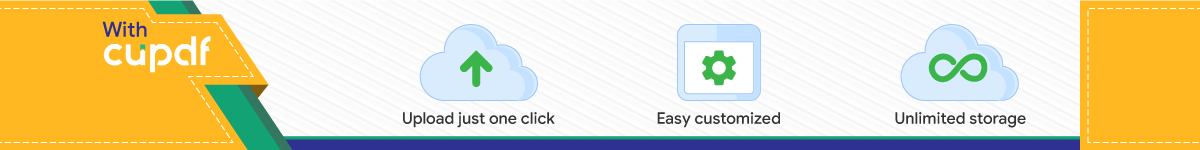

SEITE 12 · FREITAG, 13. SEPTEMBER 2013 · NR. 213 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGDie Ordnung der Wirtschaft
Finanzpolitik und die Währungsintegrati-on durchaus braucht, muss nicht immerden Bedürfnissen der Vielfalt eur
Quel
le: W
erne
r Abe
lshau
ser /
F.A.
Z.-K
arte
Jaec
k
Rheinischer Kapitalismus
EuropäischeWirtschaftskulturen
Transformationsländer
Anglo-Amerikanischer Kapitalismus
Mediterraner Kapitalismus
Balkan
Türkei
500 km
Als sich 1950 sechs europäi-sche Staaten auf den Wegmachten, ihre WirtschaftMarkt für Markt zusam-menzuführen, hatten sieein supranationales Euro-
pa vor Augen. Die Montanunion ausFrankreich, Westdeutschland, Italien undden Beneluxstaaten bot sich dafür als Ein-stieg an. Lediglich Deutschland musste innennenswertem Umfang Souveränität andie Europäische Gemeinschaft für Kohleund Stahl abtreten. Alle anderen Mitglie-der verfügten entweder über nur geringeschwerindustrielle Marktmacht oder streb-ten sie – wie Frankreich – erst an. Aberauch den Deutschen fiel es leicht, sich derHohen Behörde in Luxemburg unterzuord-nen, stand man doch immer noch unterBesatzungsstatut und war weit davon ent-fernt, souverän über die Zukunft seinerMontanwirtschaft zu entscheiden. Dochschon am Rüstungsmarkt, den die sechsparallel zur Montanunion ins Visier nah-men, scheiterte der supranationale An-spruch. Die Europäische Verteidigungsge-meinschaft und die in sie eingeschlossenePolitische Gemeinschaft kollidierten 1954mit der Souveränität Frankreichs, dasnicht darauf verzichten wollte, Atom-macht zu werden.
Bei der Gründung der EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft, die 1957 zu ei-ner Relance Européenne führte, stand Su-pranationalität nicht mehr zur Debatte.Die sechs schlossen eine Vertragsgemein-schaft souveräner Staaten, deren Zielnicht die Überwindung, sondern die Über-lebensfähigkeit der beteiligten National-staaten war. An diesem Status hat sich bis
heute – für 27 Mitglieder der Europäi-schen Union – nichts Wesentliches geän-dert, wie das Bundesverfassungsgerichtnicht aufhört zu betonen. Dennoch habendie Bannerträger der Europäischen Inte-gration von Anfang an nichts unversuchtgelassen, die Karte des funktionalen, in ge-wisser Weise subversiven Föderalismus zuspielen, der, von ersten, kleinen Schrittenausgehend, schließlich zum Ziel der ge-samteuropäischen Souveränität gelangenwürde. Sie rechtfertigten diese Salamitak-tik der, Europapolitik mit der Zwangsläu-figkeit technologischer Entwicklungspro-zesse und der Logik des Marktes: Strebennach wirtschaftlicher Modernisierungmusste nach Überzeugung der europäi-schen „Eliten“ früher oder später auch po-litisch zum Einheitsstaat führen. Das Ver-trauen auf die Zwangsläufigkeit wirt-schaftlich-technokratischer Integrations-prozesse wurde somit zur politischen Le-benslüge der Gemeinschaft, die sich wieein roter Faden durch die Vorstellungs-welt der europäischen Politik zieht. Diesgilt in hohem Maße auch für die Europäi-sche Währungsunion.
In der Modellwelt des „optimalen Wäh-rungsraumes“ schienen zunächst alle wirt-schaftlichen Voraussetzungen gegeben,um die Währungsunion zum Motor einersupranationalen Umformung der europäi-schen Vertragsgemeinschaft zu machen.Die Euroländer verfügen über hohe Flexi-bilität und Mobilität der Arbeits- und Gü-termärkte. Auch ihre Integration in denWelthandel, der Offenheitsgrad, lässt we-nig zu wünschen übrig. Bliebe nur nochder Appell an die Bereitschaft der Mit-gliedstaaten, einige wenige Regeln einzu-halten, die für den Zusammenhalt desWährungsraumes unabdingbar sind. Die-se im Vertrag von Maastricht festgelegtenKriterien setzten freilich kollektive Menta-litäten der Euroländer voraus, die sie befä-higten, Staat und Gesellschaft so zu organi-sieren, dass diese Regeln auch eingehaltenwerden konnten. Zwar war von Anfang anklar, dass der gemeinsame Währungsraumsehr unterschiedliche, oft über lange histo-rische Zeiträume gewachsene kollektiveMentalitäten einschloss, doch zweifeltendie Verfechter einer europäischen Ein-heitswährung keinen Augenblick daran,dass sich allgemeinverbindliche Standardsfür Budgetdefizit, Verschuldungsquotientoder Inflationsrate unter dem Druck derKapitalmärkte ganz selbstverständlichdurchsetzen würden. In der Vorstellungs-welt zwangsläufiger Integrationsprozesseschien die soziale und politische Kompe-tenz, gemeinsam gesetzte Regeln auch ein-zuhalten, zu einer bloßen Willensfrage po-litischer Disziplin zu schrumpfen.
Spätestens 2010, als die schwelendeBankenkrise das Problem wachsenderStaatsverschuldung zahlreicher Eurolän-der akut werden ließ und sich die Refinan-zierung auf den Kapitalmärkten immerschwieriger gestaltete, trat die Instabilitätdes Euroraumes offen zutage. Unter-schiedliche kollektive Mentalitäten ließensich offensichtlich nicht problemlos in dieschöne Modellwelt eines „optimalen Wäh-rungsraumes“ integrieren. Gleichzeitigmehrten sich die Anzeichen, dass derschwierige Umgang seiner Mitglieder mitden Maastricht-Kriterien auch noch ande-re Gründe hatte. Neben der Zähigkeit kol-lektiver Mentalitäten kollidieren auch un-terschiedliche wirtschaftskulturelle Vor-aussetzungen im gemeinsamen Währungs-raum mit dem Versuch der „Euroretter“,die Währungsunion durch eine noch strik-tere Vereinheitlichung von Regeln undwirtschaftspolitischer Intervention zu dis-ziplinieren.
Tatsächlich erfordert die Stabilisierungdes Europäischen Währungssystems (mitoder ohne Einheitswährung) nicht eineeinheitliche, sondern ganz unterschiedli-che Strategien von Wirtschafts- und Fi-nanzpolitik. Europa umfasst nämlichmehrere historisch gewachsene Wirt-schaftskulturen, in denen jeweils eigeneDenk- und Handlungsweisen (Institutio-nen) die Märkte bestimmen und derenWirtschaft auf sehr verschiedene Weise or-ganisiert ist. Eine Strategie zur wirtschaft-lichen Integration Europas muss daherstärker als in der Vergangenheit dieser Be-sonderheit Rechnung tragen, wenn sieden einmal erreichten Stand konsolidie-ren und gleichzeitig von dieser Vielfaltkomparativer Wettbewerbsvorteile in derWeltwirtschaft profitieren will.
Voraussetzung dazu wäre die Verge-meinschaftung jener produktiven Ord-
nungspolitik, die die Nationalstaaten bis-her schon mit Erfolg eingesetzt haben,um die spezifische Wettbewerbsfähigkeitihres jeweiligen Produktionsregimes zuverbessern. Damit sind Strategien staatli-cher Rahmen- und Regelsetzung gemeint,die der Gestaltung des sozialen Systemsder Produktion dienen – in der Absicht,Wettbewerbsvorteile durch funktionieren-de Institutionen zu erzielen. Wie unter-schiedlich produktive Ordnungspolitik inEuropa ausfallen müsste, zeigt alleinschon die Verschiedenartigkeit der sozia-len Produktionssysteme wie zum Beispieldes Bankensystems, der Berufsausbil-dung oder der Arbeitsbeziehungen. Wäh-rend die deutsche Produktionsweise dernachindustriellen Maßschneiderei „gedul-diges“ Kapital voraussetzt, ist der briti-sche Kapitalmarkt auf Risikokapital ange-wiesen. Eine Wirtschaftskultur, die aufder regionalen Verbundwirtschaft kleinerund mittlerer Unternehmen beruht,braucht Kreditinstitute, die diesem Mus-ter Rechnung tragen, wie die deutschenSparkassen und Genossenschaftsbanken.Andere wiederum stützen ihr „Geschäfts-modell“ vorzugsweise auf Investmentban-ken, die den Markt für innovative Finanz-produkte beherrschen.
Die kontrastreichen Eigenheiten deseuropäischen Wirtschafts- und Sozialsys-tems vollständig aufzulisten ist sicher einhoffnungsloses Unterfangen. Aus derNähe betrachtet, löst sich der Europäi-sche Wirtschaftsraum in ebenso viele Va-rianten des Kapitalismus auf, wie es dorthistorisch verschiedenartige Wege in dieModerne gibt. Diese Entstehungsge-schichte unterscheidet den EuropäischenWirtschaftsraum insbesondere von demder Vereinigten Staaten, erlaubt es aberauch, die Unterschiede zwischen den eu-ropäischen Wirtschaftskulturen wenigs-tens in groben Zügen zu beschreiben undihre jeweiligen komparativen Wettbe-werbsvorteile auf dem Weltmarkt heraus-zuarbeiten. Im Wesentlichen sind es vierWirtschaftskulturen, die so den Auftritt
der europäischen Wirtschaft in der Welt-wirtschaft bestimmen.
Der angelsächsische Kapitalismus er-fuhr seine wesentliche Prägung im Zeital-ter des weltweiten Merkantilismus undwurde stark von den arationalen Gewohn-heiten protestantischer Minderheiten be-einflusst: Akkumuliert, akkumuliert, dasist Moses und die Propheten! Schon im 19.Jahrhundert hat Großbritannien seinerfrüh ausgeprägten industriellen Wirt-schaftskultur den Rücken gekehrt, umsich auf den Kapitalmärkten rentablerenAnlageformen zuzuwenden. Dem Nieder-gang der britischen Wirtschaft im 20. Jahr-hundert war dann die Verschmelzung mit
der amerikanischen Kapitalmarktkulturgeschuldet, die in den achtziger Jahrenendgültig ihren globalen Siegeszug antrat.Ohne dass Großbritannien selbst dem Eu-roraum angehört, lässt sich die anglo-ame-rikanische Wirtschaftskultur daher alszentraler Akteur nicht wegdenken.
Das europäische Kerngebiet schritt aufanderen Wegen in die Moderne. Sie führ-ten kreuz und quer durch den Kontinent,und es gibt wenige Regionen, die nicht ir-gendwann an diesem Weg lagen. Der fran-zösische Autor Michel Albert hat die Wirt-schaftskultur, die daraus entstanden ist,„capitalisme rhénane“, Rheinischen Ka-pitalismus, genannt. Er meinte damit ei-nen historisch gewachsenen Wirtschafts-raum, der von Skandinavien bis Nordita-lien und von der Seine bis an die Oderreicht. Das Itinerar seiner Entstehungsge-schichte beginnt spätestens auf der West-Ost-Transferstraße der Hansezeit, die denflandrischen Tuchstapel im Westen mitden Rohstoffmärkten von Nowgorod amIlmensee verband und deren Einzugsbe-reich von Skandinavien bis nach Westfa-len reichte. Es setzt sich fort auf jenenquer durch Europa ziehenden Entwick-lungsachsen von Brügge nach Genua undvon Antwerpen nach Venedig, auf denenzunächst die Messen der Champagne,dann die oberdeutschen „Industrierevie-re“ um Augsburg und Nürnberg zu Kno-tenpunkten institutioneller Innovationender Moderne wurden. In der Hansezeitwaren es vor allem die Ausbreitung derautonomen Stadtwirtschaft als exportfähi-ges Muster moderner Wirtschaftsverfas-sung, der Zunft als genossenschaftlicheOrganisationsform innovativer gewerbli-cher Institutionen und die Bündelung ei-ner Vielzahl privilegierter Rechtsnormenzu Spielregeln, die den vieldeutigen, aberdoch auf lange Zeit höchst effizienten In-halt des hansischen Herrschaftsrahmens,(Hanseatic Governance) ausmachten. Da-nach rückten immer mehr die institutio-nellen Innovationen auf dem Gebiet desKreditwesens, der gewerblichen Großor-ganisation, der renditeorientierten Unter-nehmung und der rationalen Wirtschafts-gesinnung – also die Grundlagen des Ka-pitalismus – in den Vordergrund. Es fällt
in der Tat schwer, die gewerblichen Inno-vationen dieser vom Erzbergbau, der Me-tallverarbeitung und der Textilindustriegeprägten Produktionslandschaft in insti-tutioneller, organisatorischer und techni-scher Hinsicht gedanklich von den Errun-genschaften der Industriellen Revolutionin England abzusetzen, auch wenn vieleihrer sichtbaren Resultate in den Wirrendes Dreißigjährigen Krieges in dieser Re-gion wieder untergegangen sind. Heuteverkörpert der Rheinische Kapitalismusden starken Kern des Euroraumes undverleiht ihm ein hohes Maß wirtschafts-kultureller Geschlossenheit. Als dichteLandschaft freiwillig akzeptierter „Spiel-regeln“ steht seine Wirtschaftskultur gera-dezu im idealtypischen Gegensatz zurIdeologie der Marktwirtschaft der unsicht-baren Hand, wie sie seit dem 18. Jahrhun-dert in England Gültigkeit hat.
Kennzeichen der im Süden Europasvorherrschenden Wirtschaftskultur sindeine distanzierte Haltung der wirtschaft-lichen Akteure zum Staat, ihre gering aus-geprägte Fähigkeit, Sozialkapital zu bil-den und zu nutzen, sowie eine der agra-risch-tertiären Produktionsweise geschul-dete Tradition weicher Währungen. Esist sicher kein Zufall, dass alle Länderdes Mediterranen Kapitalismus (aberauch der Balkanstaat Griechenland) im20. Jahrhundert gründliche Erfahrungenmit faschistischen Bewegungen machenmussten, die angetreten waren, das offen-kundige Defizit an staatlicher und gesell-schaftlicher Wirksamkeit durch autoritä-re Ordnung zu kompensieren. Wie tief-greifend und langwierig die Ursachen die-ses Defizits sind und wie scharf die Ab-grenzung zum Rheinischen Kapitalismusausfällt, lässt sich an der Geschichte derwirtschaftskulturellen Spaltung Italiensin nuce zeigen. Während im Süden seitdem 12. Jahrhundert ein effektiver aufFeudalismus gegründeter bürokratisch-autokratischer Staat herrscht, den dieNormannen errichtet und andere fremdeMächte fortgeführt haben, entstehengleichzeitig im Norden autonome, selbst-verwaltete Stadtrepubliken, deren Bür-ger sich am Gemeinwohl orientieren –und aufs engste „rheinisch“ verlinkt sind.Auch dort, wo sie ihre Selbständigkeitspäter verlieren, bewahren sie die Fähig-keit, Sozialkapital zu akkumulieren undwettbewerbsfähige Institutionen hervor-zubringen. Wie tief dieser wirtschaftskul-turelle Graben auch heute – mehr als 150Jahre nach Gründung des italienischenNationalstaates – noch klafft, bringtVera Zamagni auf den Punkt: „Es ist einegefährliche Illusion zu glauben, dass derMezzogiorno mit seinen historisch ge-wachsenen politischen, wirtschaftlichenund sozialen Strukturen von außen verän-dert werden kann.“ Die in Bologna leh-rende Wirtschaftsprofessorin weiß, dasseine solche wirtschaftskulturelle Revolu-tion viel Zeit erfordert, zumal der bisherzurückgelegte Weg „keineswegs kürzergewesen ist – und noch dazu ergebnis-los“. Damit soll nicht unterstellt werden,der Süden Italiens und die übrigen Län-der des Mediterranen Kapitalismus hät-ten keine eigene Wirtschaftskultur. Siehaben eine andere – mit komparativen in-stitutionellen Vorteilen durch stabilenwirtschaftlichen Familismus, auf denDienstleistungsmärkten und, was die Ibe-rische Halbinsel angeht, durch ein welt-
weites Netzwerk von Handelsbeziehun-gen. Hier müsste produktive Ordnungspo-litik ansetzen, die den derzeit beklagens-werten Zustand der mediterranen Wirt-schaft überwinden wollte.
Die wirtschaftskulturelle OrientierungEuropas ist noch keineswegs abgeschlos-sen. Dies gilt vor allem für die Transforma-tionsstaaten im Osten, die dabei sind, an ei-genen Traditionen anzuknüpfen oder dieinstitutionelle Verfassung anderer Wirt-schaftskulturen zu übernehmen. LangeZeit lag in diesem Kulturkampf, der nachdem Zusammenbruch des Ostblocks ein-setzte, die liberale Marktwirtschaft anglo-amerikanischen Zuschnitts weit vorn, weilsich der Dynamik ihrer Kapitalmärktekaum jemand entziehen konnte. In jüngs-ter Zeit hat aber die rheinische Wirt-schaftskultur etwa im Baltikum oder inden aus der k. u. k. Doppelmonarchie her-vorgegangenen mitteleuropäischen Staa-ten deutlich an Einfluss gewonnen, sodass der Ausgang noch offen ist.
Es geht dabei nicht darum, dass sich dieüberlegene Wirtschaftskultur am Endedurchsetzt. Wirtschaftskulturen kennenkeine hierarchische Ordnung. Entschei-dend sind allein ihre Eignung im Wettbe-werb auf konkreten Weltmärkten und dieFunktionsfähigkeit ihrer Institutionen.
Solange der wirtschaftliche Integrati-onsprozess mit der Errichtung und Vollen-dung eines einheitlichen europäischenBinnenmarktes gleichzusetzen war, mach-te eine Strategie der Harmonisierungdurchaus Sinn. Sie ließ sich mit dem ord-nungspolitischen Instrument der Durch-setzung gleicher Wettbewerbsbedingun-gen auf übersichtliche und vertraglich ko-difizierte Weise realisieren. Jetzt da derBinnenmarkt vollendet ist und zufrieden-stellend funktioniert, stellen sich der euro-päischen Politik komplexere Aufgaben.
Eine einheitliche Ordnungspolitik, wiesie ein europäisches Währungssystem fürdie Kapitalmärkte, die Finanzpolitik unddie Währungsintegration durchausbraucht, muss nicht immer den Bedürfnis-sen der Vielfalt europäischer Wirtschafts-kulturen entsprechen. Spannungen und In-stabilität im gemeinsamen Währungs-raum sind zwangsläufige Folgen. Einewirksame Strategie der Integration musssich deshalb der komparativen institutio-nellen Vorteile der betroffenen Wirt-schaftskulturen immer bewusst sein undmit produktiver Ordnungspolitik ihre Stär-ken hervorheben.
Der Brüsseler Apparat wäre in seinerjetzigen Verfassung gewiss überfordert,eine derart komplexe wirtschaftspoliti-sche Strategie zu exekutieren. Dazu fehlenihm rechtliche und sachliche Vorausset-zungen. Hier ist vielmehr die Kompetenzder Mitgliedstaaten gefragt. Was die EUaber braucht, sind Regeln, die Einheit inder Vielfalt zulassen, und ein Währungs-system, das damit kompatibel ist.
Vier Wirtschafts-kulturen bestimmenden Auftritt der euro-päischen Wirtschaftin der Weltwirtschaft.
Werner Abels-hauser (68) istForschungspro-fessor für Histo-rische Sozial-wissenschaftder UniversitätBielefeld, Mit-glied des Insti-tuts für Wissen-
schafts- und Technikforschungund Mitgründer des Bielefeld Insti-tute for Global Society Studies. Inden achtziger Jahren war der re-nommierte WirtschaftshistorikerDirektor des Bochumer Institutszur Erforschung der europäischenArbeiterbewegung. Er leitet denWissenschaftlichen Beirat derHans-Böckler-Stiftung des Deut-schen Gewerkschaftsbundes undsitzt in der Historikerkommission,die seit zwei Jahren die Geschich-te des Bundeswirtschaftsministeri-ums aufarbeitet. (hig.)
Foto
Chr
istia
nTh
iel
UnterschiedlicheMentalitäten ließen sichnicht problemlos in dieModellwelt des „opti-malen Währungsraums“integrieren.
Es geht dabeinicht darum, dasssich die überlegeneWirtschaftskulturam Ende durchsetzt.
Der Autor
Werner Abelshauser
Die EUbraucht Regeln,die Einheit inVielfalt zulassen
FAZ-f6ÄWYZd
Eine einheitliche Ordnungs-politik, wie sie ein europäischesWährungssystem für dieKapitalmärkte, die Finanzpolitikund die Währungsintegration durch-aus braucht, muss nicht immerden Bedürfnissen der Vielfalteuropäischer Wirtschaftskulturenentsprechen. Spannungen undInstabilität im gemeinsamenWährungsraum sind zwangsläufigeFolgen.
Top Related