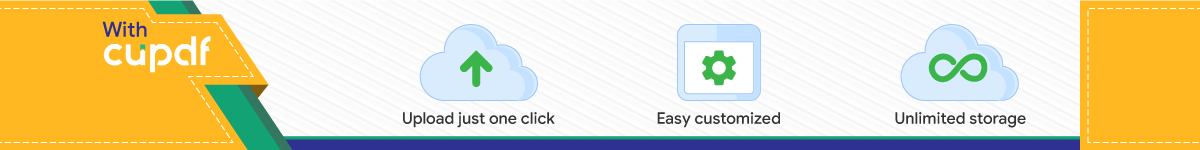

„Österreich ist fürUnternehmen einegute Heimat“Für Unternehmen gebe es
niedrige Steuern und sozialen
Frieden, sagt AK-Direktor Muhm.
VON JAKOB ZIRM
Die Presse: Ist Österreich ein unter-
nehmerfreundliches Land?
Werner Muhm: Ja, ich halte Öster-reich für unternehmerfreundlich.Etwa, wenn man sich die Steuer-struktur ansieht. Auch die Sozial-partnerschaft, die immer füreinen Interessenausgleich sorgt,oder die nun ausgedehnte For-schungsprämie zeigt, dass dieUnternehmen in Österreich einegute Heimat haben.
Woher kommt dann die Kritik der
Unternehmerschaft an hoher Steuer-
belastung und hohen Lohnneben-
kosten?
Der Faktor Arbeit ist im interna-tionalen Vergleich sehr hoch be-lastet, das stimmt. Der Grund da-für ist, dass etwa die Familien-oder die Wohnbauförderung Teilder Lohnnebenkosten ist, obwohlsie mit der betrieblichen Sphäregar nichts zu tun hat. Wir habendas auch immer kritisiert. Die Un-ternehmenssteuern sind jedochsehr günstig. So wurde etwa dieKörperschaftsteuer gesenkt, wäh-rend sich die Gewinne deutlichnach oben entwickelten. Da wirdzum Teil ungerechtfertigt gejam-mert.
Wie erklären Sie sich dann, dass in
Österreich laut internationalen Stu-
dien wenig Unternehmen gegründet
werden?
Wir haben zwar niedrigere Grün-dungsraten als in anderen Län-dern, dafür sind die Unterneh-men meist auch lebensfähiger.Ich glaube daher nicht, dass sichdie niedrige Gründungsrate aufdie gesamtwirtschaftliche Situa-tion negativ auswirkt.
Gibt es Ihrer Meinung nach die Scheu
vor dem Risiko, die den Österreichern
in den Studien attestiert wird?
Ich sehe das nicht. Das tragendeSystem der heimischen Wirtschaftsind ja erfolgreiche Klein- undMittelunternehmen. Diese sindder Öffentlichkeit weniger be-kannt, weil sie meist nicht imKonsumentengeschäft tätig sind.Aber woher ist beispielsweise dieTechnik gekommen, die jetzt dieBergarbeiter in Chile gerettet hat?Aus Österreich. Heimische Fir-men sind in vielen BereichenWeltmarktführer, man kennt sienur nicht. Ich glaube nicht, dassalle Österreicher nur Beamte seinwollen. Sonst hätte es diese dyna-mische Wachstumsentwicklungder letzten 20 Jahre nicht gegeben.
Ist Unternehmer für Sie ein positiv
besetztes Wort?
Ich fühle mich der solidarischenLeistungsgesellschaft verbunden.Und in einer solchen bedarf esauch Unternehmer. Wenn es dienicht gäbe, dann gäbe es vielesnicht. Ich habe mit ihnen keinProblem.
Zur PersonWerner Muhmist seit 2001
Direktor der
Wiener
Arbeiter-
kammer. Der
60-Jährige trat bereits nach
seinem BWL-Studium in die
Arbeitnehmervertretung ein und
unterbrach seine AK-Karriere nur
durch ein Gastspiel beim ÖGB.
Muhm gilt als wichtiger Berater
von Bundeskanzler Werner
Faymann. [ Bruckberger ]
2 AUFBRÜCHE DIENSTAG, 2. NOVEMBER 2010DIEPRESSE.COM
Die Presse
Schafe stehen gerne mitten im Rudel und müssen daher keine Entscheidungen treffen. Wölfe leben wesentlich selbstständiger. Dafür tragen sie auch das Risiko, manchmal nichts zu
Von SchafenundWölfenEssay. Österreich mag seine Unternehmer ohnehin nichtbesonders. Jetzt aber geht es der Selbstständigkeit als Haltung
endgültig an den Kragen. Eine Besorgnis.
VON FRANZ HIRSCHMUGL
Schafe gelten nicht gerade alssehr selbstständig. Sie stehengern mitten im Rudel, lassen
sich vom Chef namens Hirten-hund von dort nach da schicken,und müssen deshalb auch keineEntscheidungen fällen. Und sievermeiden um Gottes willen jedeForm von Risiko. Dafür gibt esmeistens was Gutes zum Futtern.
Wölfe hingegen sind aktiv, gernallein, wenn es wirtschaftlich gese-hen von Vorteil ist, auch im Rudelanzutreffen, entscheiden blitz-schnell, sind hervorragende Jägerund lange nicht so blutrünstig, wieuns die Brüder Grimm weisma-chen wollten. Die Lust am Unter-nehmen führt manchmal dazu,dass sie tagelang nichts zu beißenkriegen. So ist halt das Leben inder freien Wildbahn. Nicht ganzrisikolos.
Ein Land voller SchafeEin Blick in eines der größtenStudentenheime des Landes zeigt,dass Österreich drauf und dran ist,ein Land mit vielen braven Schäf-chen zu werden.
„Wir schließen mittlerweile 70Prozent unserer Verträge mit denEltern ab“, sagt ein Betreiber von1600 Studentenzimmern. Tendenzsteigend. Die Mama kommt frei-tags putzen. Sollte das Lamperl amNachtkästchen ausfallen, ruft derHerr Papa an. Manchmal sogarder Anwalt. Auch sonst ist es sehrbeschaulich geworden: War dieHeimbar in den Siebzigern sieben-mal die Woche mehr oder minderdurchgehend geöffnet, so mühtman sich jetzt alle zwei Wochenab, wenigstens einen Abend langden Nachwuchs aus der Reserverespektive den Zimmern zu lo-cken.
Gemeinsame Aktivitäten?Kaum. Widerstand? Null. Ausland?Lieber nicht. „Vor 20 Jahren nochist jeder Student für sich selbst zu-ständig gewesen, kaum jemandhätte sich von den Eltern umsor-gen lassen. Heute haben wirMühe, jene Eltern abzuwehren, dieeinen Zweitschlüssel verlangen“,sagt der Studentengastgeber.
Resümee: Zu viel Selbststän-digkeit ist dem Nachwuchs vonheute ein Gräuel.
Dabei hat der Linzer Markt-forscher Werner Beutelmayer neu-lich festgestellt, dass 68 Prozentder befragten Eltern angeben, dassSelbstständigkeit für sie das wich-
tigste Erziehungsziel sei. Und dassdas auch so gelebt werde. Seinenicht ganz unhaarsträubende Be-gründung: 21 Prozent der 14-jähri-gen Österreicher entscheiden ganzallein, welcher Computer gekauftwird. Und 47 Prozent der Kindernehmen starken Einfluss auf dieAuswahl des Urlaubsortes. Na,wenn das so ist.
Im richtigen Leben, jenseitsvon Fragebögen, macht sich diedie „Ich bin ein braves Schäfchen“-Haltung durchaus schon in denUnternehmen bemerkbar. Ein ober-österreichischer Industrieller, glo-bal aufgestellt, hatte sein Schlüssel-erlebnis, als er eine Nachwuchs-hoffnung in die amerikanische Fi-liale seines Unternehmens schi-cken wollte: „,Das wird schwer‘, ha-ben meine Leute gesagt. ,Wer setztsich denn in ein amerikanischesBüro, klein, fensterlos, simpel ein-gerichtet?‘ ,Moment‘, sag ich, ,ichbin mit 25 in London zu viert imCubical gesessen, fensterlos. Wirhaben 14 Stunden am Tag gearbei-tet und im Übrigen überhauptnicht darüber nachgedacht.‘ DieAntwort: ,Ja, die Jugend von heuteist schon anspruchsvoller.‘“
Dem Komfort geopfert?Wird die Selbstständigkeit auf demAltar des Komforts geopfert? Sindjene Eltern schuld, die ihre Kindernicht in die Welt schicken, son-dern viel zu lange am Gängelbandhaben wollen? Sind es die Väter,die ihren halbwüchsigen Söhnenin der Fußballkabine die Schien-beindeckel montieren? Sind esjeneMütter, die der Lehrerin erklä-ren, dass ihr hochbegabtes Mäderlvor dem Rest der Klasse, sprichden einfachen Geistern, geschütztwerden müsse? (PS: Rund ein Drit-tel der Eltern einer herkömmli-chen Volksschulklasse hegt mitt-
lerweile den Genieverdacht gegen-über dem eigenen Nesthäkchen.)
Es stimmt schon: Bisher hattensich die Menschen aller Generatio-nen gewünscht, dass es den Nach-kommen besser gehen sollte alseinem selbst. Wir hingegen sind dieerste Generation, die hofft, dass esden Nachkommen nicht schlechter
als uns selbst gehen möge. Offen-sichtlich haben wir die Welt klima-,ressourcen- oder armutsmäßig nichtsehr nett behandelt. Das daraus re-sultierende schlechte Gewissenführt wohl dazu, dass wir unserenKindern alles supernett machenwollen. Und richten es so ein, dassdie lieben Kleinen, auch wenn siegerade 19 Jahre alt geworden sind,möglichst wenig selbst in Angriffnehmen sollen. Und müssen. Der„Prinz von Zamunda“ ist in derösterreichischen Durchschnittsfa-milie angekommen.
Und dennoch, an dieser Stelleein großes Aber: Denn in Öster-reich machen beileibe nicht nurdie Eltern Jagd auf die Selbststän-digkeit. Diese Jagdgesellschaft hatviele Mitglieder. Und alle Teilneh-mer haben gute Gründe mitzuma-chen. Bevor wir uns ihrer in loserReihenfolge annehmen, fordernwir aber noch einen wissenschaft-lichen Beleg für die These, dass dieSelbstständigkeit als Haltung inÖsterreich über kurz oder langaussterben wird. Und dass es dannunglaublich viele Schafe, aber
kaum noch Wölfe geben wird. Unddass damit in weiterer Folge derWirtschaft zwar jede Menge ge-neigter Mitarbeiter zur Verfügungstehen werden, aber es an Unter-nehmernmangeln wird.
Als Zeugen der Besorgnis rufenwir die Wissenschaftler des steiri-schen Joanneum auf, die als öster-reichischer Beitrag am „Global En-trepreneurship Monitor“ mitarbei-ten. Die Studie weist aus, dass ge-rade einmal 2,5 Prozent der Er-wachsenen hierzulande als Unter-nehmensgründer tätig werden.Das heißt umgekehrt, dass 39 von40 Österreichern die Sicherheitder Anstellung der unternehmeri-schen Freiheit in jedem Fall vor-ziehen. Damit nimmt Österreichunter den 42 untersuchten Län-dern den letzten Rang ein.
Hohe „Risiko-Aversion“Der wichtigste Grund, so die Auto-ren, liege „an den vorherrschen-den soziokulturellen Normen“.Konkret sprechen sie in erster Ins-tanz „die allgemein in Österreichvorherrschende Risiko-Aversionan“. Gepaart mit einem im inter-nationalen Vergleich geringenMaß an Eigeninitiative, Selbststän-digkeit und Entschlossenheit bildedies einen relevanten hemmendenFaktor der unternehmerischen Ak-tivität. In solchen Momenten er-scheinen die Ergebnisse der öster-reichischen Schüler beim PISA-Test und auch jene der heimischenFußball-Nationalelf dann auchnicht mehr so schlimm.
Wundern sollten wir uns nicht.In einem Land, in dem der Staats-funk namens Ö3 ab Dienstagfrühdas kommende Wochenende alsRettung von der Arbeits-woche herbeisehnt, müssendie Menschen doch irgend-wann glauben, dass Arbeit
„Wie Unternehmen
funktionieren – dass Umsatz
nicht gleich Gewinn ist –,
steht nicht auf der
schulischen Agenda.“

„Wer in Österreichscheitert, gilt alsVersager“Hohe Lohnnebenkosten belasten
dieWettbewerbsfähigkeit, sagt
DiTech-Chefin Izdebska.
VON JAKOB ZIRM
Die Presse: Ist Österreich ein unter-
nehmerfreundliches Land?
Aleksandra Izdebska: Dazu habeich eine ambivalenteMeinung. Soist Österreich ein sicheres Land.Es gibt eine hohe Rechtssicher-heit, und man muss nicht fürch-ten, dass plötzlich jemand Geldverlangt, weil es sonst „Probleme“gibt. Das ist nicht überall so. Zu-sätzlich gibt es viele Menschenmit guter Ausbildung. Aber es gibtauch negative Punkte: etwa diehohen Lohnnebenkosten. DieNettolöhne sind ja mit anderenLändern vergleichbar. Wenn manein Serviceunternehmen betreibt,bei dem man viele Mitarbeiterbraucht, ist es fast unmöglich,wettbewerbsfähig zu sein.
Ist das der Grund, warum es in Rela-
tion zu anderen Ländern wenig
Unternehmensgründungen gibt?
Es ist ein Grund. Hinzu kommtdie soziale Tradition in Öster-reich. Die Versorgung der Men-schen ist auf jeden Fall gewähr-leistet. Wenn man keine Arbeitfindet, muss man nicht zwangs-läufig selbst eine schaffen. In an-deren Ländern wie in den USA istdas nicht so. Dort sind die Men-schen gezwungen, Unternehmerzu werden, wenn sie keinen Ar-beitsplatz finden. Außerdem ist esals Jungunternehmer schwierig,Geld zu erhalten. MeinMann undich waren vor zwölf Jahren aufden privaten Kredit eines Be-kannten angewiesen. Den Ban-ken war unsere Idee zu unsicher.
Welche Rolle spielt die Scheu vor
dem Risiko?
Unternehmerschaft ist mit ho-hem Risiko verbunden. Wennman in Österreich scheitert, istdas eine persönliche Niederlage.Auch in der Gesellschaft wirdman als Versager abgestempelt.Im angloamerikanischen Raumsieht man das eher als Chance,etwas daraus zu lernen.
Warum haben Sie und Ihr Mann ein
Unternehmen gegründet?
Wir kommen beide aus Unter-nehmerfamilien. Wir hatten da-her nie Angst vor der Unterneh-merschaft. Für uns war es schonals Kind ganz normal, dass manbeim Abendessen darüber redet,wie viele Kunden man hat undwie viel verkauft wurde und wieman das Geschäft besser machenkann. Das war für uns beidenichts Neues. Das war ein Vorteil.
Haben Sie Ihren Entschluss je bereut?
Nein, auf keinen Fall. Natürlich istman mit dem Kopf immer beimUnternehmen. Dank der neuenTechnik kann man das aber auchim Urlaub am Strand machen. ImGegenzug habe ich viele Freihei-ten. Und ich arbeite nur mit Men-schen, die ich wirklichmag.
Zur PersonAleksandraIzdebska kam1992 als
16-Jährige mit
ihren Eltern
aus Polen
nach Österreich. 1999 gründete
sie mit ihrem Mann Damian
Izdebski den Computer-
fachmarkt DiTech. Heute hat das
Unternehmen 16 Standorte in
Österreich, beschäftigt rund 270
Mitarbeiter und erzielte zuletzt
73,8 Millionen Euro Umsatz. [ DiTech ]
AUFBRÜCHE 3DIENSTAG, 2. NOVEMBER 2010DIEPRESSE.COMDie Presse
beißen zu haben. [ Corbis ]
eine leidvolle Unterbrechung ihrerFreizeit ist und selbstständigesDenken des kapitalistischen Teu-fels ist.
Ähnliche Befürchtungen leitennatürlich auch unser Schulsystem.Der durchschnittliche Maturantweiß zwar, dass man im australi-schen Perth von Schwerindustrieleben kann und dass im bulgari-schen Plovdiv Rosenöl produziertwird. Wie Unternehmen funktio-nieren, dass Umsatz nicht gleichGewinn ist, dass und wie manSteuern zahlt – das hingegen istnicht Gegenstand der schulischenAgenda.
Wirtschaftskunde mit WandtafelnMachen wir reinen Tisch: Wernach wie vor „Geografie- undWirt-schaftskunde“ mit Wandtafeln undSchaubildern unterrichtet, dermacht das absichtlich. Wir zitierenaus einem Statusbericht: „Ergänztwird der Wirtschaftskundeunter-richt im Praktischen, etwa mit derverbindlichen Übung Berufsorien-
tierung.“ Welches Jahr schreibenwir denn eigentlich?
Und so passiert Folgendes:Weil wir Österreicher gern gutessen, haben wir folgerichtig Knö-delakademien eingerichtet; weilwir gern und gut Löcher in Bergegraben, betreiben wir die Höheretechnische Lehranstalt. Und natür-lich braucht ein Land, dessenIdentität mit Abfahrtssiegen ge-nährt wird, Skigymnasien. Nicht zuvergessen die Handelsakademien,die sich um die Ausbildung vonBuchhaltern kümmern. Von Men-schen also, die „im System arbei-ten“. Dagegen ist nichts einzuwen-den – wir brauchten nur ganz drin-gend Ausbildungsstätten, aus de-nen Menschen hervorgehen, die„an Systemen arbeiten“ können.
Systemisch spannend ist dabeidie Frage, die man sich immer stel-len sollte, wenn absurde Missver-hältnisse besonders lange anhal-ten: Wer zieht denn einen Nutzenaus der Tatsache, dass Wirtschaft,Selbstständigkeit oder gar Risikoan Österreichs Schulen nicht ein-mal ein Randthema ist? Richtig:die Bürokratie.
Allein der öffentliche Dienstbeschäftigt rund 650.000 Men-schen. Von staats- und anders-nahen Institutionen gar nicht zusprechen. Die „Privatwirtschaft“,wie unsere Politiker gern in einemWort ihren Zugang zum Unterneh-mertum offenlegen, darf auf kei-nen Fall mit zu viel Nachwuchsversorgt werden. Die dramatische„Verschulung“ vieler Studienrich-tungen an unseren Universitätendurch den europäischen Bologna-Prozess ist dabei eine willkom-mene Hilfe. Fahrenheit 451 in Rot-Weiß-nix-Rot.
Was sagt den eigentlich dieWirtschaftskammer dazu? GanzBürokratie, aber doch unterneh-mensnah, bietet man jungen Leu-ten einen „Unternehmerführer-schein“ an. In ein paar wenigenStunden wird willigen Schülernbeigebracht, wie lustig das Unter-nehmensleben ist. „Wie werde ichJosef Zotter?“ im Schnellsiederkurssozusagen. Das ist ungefähr so, alswürde man versuchen, ÖsterreichsMedaillenbilanz bei den Olympi-schen Sommerspielen mit einemverstärkten Angebot an Frei-schwimmerkursen zu verbessern.
Währenddessen hat eine Reihevon amerikanischen Bundesstaa-ten als Reaktion auf die Krise einenverpflichtenden Wirtschaftsunter-richt eingeführt. Den Schülernwerden wirtschaftliche Grundla-gen vermittelt. „Newsweek“ hat indiesem Zusammenhang die päda-gogischen Konzepte auf beidenSeiten des Atlantiks verglichen. Er-gebnis: In europäischen Lehrbü-chern werden freie Märkte gernmit Ausbeutung gleichgesetzt. Jun-ge Amerikaner hingegen sollen dieMarktwirtschaft als Chance begrei-fen. Das macht einen Unterschied.Wenn sich in den Staaten jemandeinen Porsche kauft, denkt sich
sein Nachbar: Nächstes Jahr willich auch einen haben. Hierortsdenkt sich der Nachbar: NächstesJahr kann sich der die Leasingratenfür das Auto ohnehin nicht mehrleisten.
Apropos Ausbeutung: Solangedie Gewerkschaften den Eindruckhaben, dass sie das Gegenteil vonWirtschaft und nicht ein für das so-ziale Controlling zuständiger Teilderselben sind, wollen wir sie hierstrafweise nicht erwähnen.
Rekorde relativieren sichWerfen wir stattdessen einen Blickauf die jährlich publizierten Grün-derzahlen. Würden die stimmen,müsste Österreich von Unterneh-men nur so strotzen. Beim genaue-ren Hinschauen aber relativierensich die alljährlichen Rekordmel-dungen ziemlich schnell. Zumeinen stehen laut Statistik Austriaden 28.800 Neugründungen im-merhin 25.800 Unternehmens-schließungen gegenüber. Außer-dem sind die überwiegende Zahlder Neugründungen sogenannteEPU: Ein-Personen-Unternehmen.
Masseure, Pfleger, Designer.Und -innen. In Wien zum Beispiel84 Prozent. DerWirtschaftskammerist anzurechnen, dass sie jenenMenschen, die sich zur Gründungeines Unternehmens entschlossenhaben, effizient hilft. Aber dass esso weit kommt, dass jemand inÖsterreich selbstständig oder garunternehmerisch wird, dafür fühltsich niemand zuständig.
Ganz im Gegenteil. Bleiben wirnoch ein wenig in Wien. Gut undgern die Hälfte der volkswirtschaft-lichen Leistung der Stadt unterliegteinem etatistischen Einfluss.Einerseits wird da fröhlich alimen-tiert, andererseits werden durchAuftragsvergaben Abhängigkeitengeschaffen. Wer traut sich, mutig
Stellung zu beziehen, wenn seinUnternehmen an öffentlichen Auf-trägen hängt? Auch so wird Selbst-ständigkeit Stück für Stück abge-baut.
Egal, könnte man sagen. Sollteman aber nicht. Denn imWorst-Case-Szenario wird Öster-reichs Wirtschaft der wichtigsteRohstoff ausgehen – die hellenKöpfe. In fünf Jahren kommenerstmals weniger Junge in den Ar-beitsmarkt, als Ältere in den Ruhe-stand gehen. Diese wenigen Jun-gen werden anspruchsvoller seinund größten Wert auf Work-Life-Balance legen (auch um den Preis,weniger zu verdienen). Die Unter-nehmen müssen wohl mit kreati-ven Jobbeschreibungen, mit flexib-len Verträgen, mit Sabbaticals,kurz mit mehr Freiheiten für dieMitarbeiter reagieren. Die aberwerden, zu Schäfchen erzogen,freundlich nicken, die Freiheitenaber mangels Selbstständigkeitnicht nutzen können.
Wir lernen daraus: Schäfchen-zählen taugt nur als Einschlaf-übung.
Was ist also zu tun? Gibt eseinen Hoffnungsschimmer für dieSelbstständigkeit? Es wird an denUnternehmern liegen, das „Aben-teuer Wirtschaft“ in die Schulen zubringen. Und wenn nicht gleichin alle, so doch in einige wenige.Wenn ohnehin viele Schulen ange-sichts fallender Schülerzahlen umihre Existenzberechtigung kämp-fen, müssten doch ein paar Wirt-schaftsgymnasien machbar sein.Zur Not von unternehmerischenMenschen initiiert. Am besten miteinem Unterrichtsgegenstand, derso ähnlich wie „Risiko- und Ent-scheidungskunde“ heißt.
Beugehaft für Ö3-RedakteureHilfreich wäre auch, die Politiker-gehälter an die Selbstständigen-quote zu koppeln (in Zusammen-hang mit einem PISA-Test für Un-ternehmertum) oder auch Ö3-Re-dakteure mit Beugehaft für wirt-schaftsfeindliche Einwürfe zu be-drohen.
Bis dorthin bleibt wohl nur derAufruf an p. t. Elternschaft: Gebteuren Kindern eine Chance – in-dem ihr ihnen so früh wie möglichso viel Verantwortung wie möglichüberträgt. Schickt sie ins Ausland(und nicht nur Studenten, sondernauch die jungen Facharbeiter). EinSemester im Cubical kann ihr Le-ben verändern.
Mehr können wir für Öster-reich imMoment nicht tun.
Zur PersonFranz Hirschmuglstartete seine
Laufbahn 1979 bei
der „Kleinen
Zeitung“. Zehn
Jahre arbeitete
der 1960 Geborene als Journalist, bis
er im „zweiten Bildungsweg“ Werber
wird. 1991 gründet er die Agentur
Peter & der Hirsch. Kunden sind unter
anderem die Caritas oder Billa.
Österreichweit bekannt werden die
beiden Pinguine für die Österreich-
Werbung.
Seine „Allergie gegen die
Oberflächlichkeit der Werbe-
industrie“ führt dazu, dass er sich mit
der Marke – der „emotionalen
Ausformung der Strategie“ – intensiv
beschäftigt. Daher ist er auch als
Berater am Institut für Marken-
entwicklung Graz tätig.
Mit dem Thema Unternehmerschaft
beschäftigte er sich zuletzt im
Rahmen der Studie „Was wir gerade
lernen – Unternehmertum in
bewölkten Zeiten“. [ Big Shot ]
„Wer die Sicherheitder Freiheit vorzieht,
ist zuRecht ein Sklave.“
Aristoteles
Top Related