12bbs_06.pdf
Transcript of 12bbs_06.pdf

6 Kalkulation und Bauausführung der Talbrücke Albrechtsgrabenim Zuge der BAB A 71
Dipl.-Ing. Manfred Becker, Dipl.-Ing. Rainer MartinGERDUM u. BREUER, Kassel
6.1 Teil 1: Technische Angebotsbearbeitung der Talbrücke Albrechtsgraben
6.1.1 Allgemeines
Im Zuge der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit ist eine neue Autobahn zwischen dem thüringischenErfurt und dem bayrischen Schweinfurt geplant, die Thüringer-Wald-Autobahn. Sie bindet die RegionSuhl, Meiningen an das deutsche Autobahnnetz an.
In der Nähe von Suhl kreuzt die Trasse das Tal des Albrechtsgrabens sowie die L 2630 zwischen denGemeinden Mäbendorf und Albrechts, was den Neubau der Talbrücke Albrechtsgraben erforderlichmachte.
Im Bereich des Bogens ist eine maximal ca. 110 m breite Naturschutzfläche zu überqueren, wo kei-ne Pfeiler, Stützungen bzw. Rüstungen möglich sind. Diese Forderung, des freizuhaltenden Raumes,wurde vor Submission auf ca. 15 m minimiert.
6.1.2 Verwaltungsentwurf
Als Überbauquerschnitt ist ein RQ 26 vorgesehen, bei dem beide Richtungsfahrbahnen auf einem eintei-ligen Querschnitt geführt werden. Der Überbauquerschnitt ist ein einzelliger Hohlkasten in Stahlverbund-Bauweise mit äußeren und inneren Druckstützen-Abstrebungen. Die Fahrbahnplatte ist an fünf Punk-ten in Brückenquerrichtung unterstützt: neben den zwei Stegen des Stahltroges von zwei äußeren undeinem mittleren Stahlverbund-Längsträger. Die Längsträger werden im Abstand von 5 m von den Ab-strebungen sowie einem außenliegenden Zugband gehalten (Bild 6.1).
Da fast die ganze Brücke von Richtung Suhl kommend beim Queren einzusehen ist, stand in der Ent-wurfsphase schon sehr früh fest, daß die architektonische Gestaltung der Brücke von großer Wichtigkeitist. Bei der vorliegenden Topographie des Tales kam eigentlich nur eine Bogenbrücke in Frage.
So entstand eine 770 m lange Talbrücke mit Stützweiten bis 70 m als 14-feldriges Bauwerk mit einerBogenunterstützung im mittleren Drittel der Brücke mit beidseitig anschließenden Pfeilern. Der Bogenhat eine Scheitelhöhe von ca. 75 m und eine Basis von 170 m. Pfeiler und Bogen haben in Brücken-querrichtung eine Abmessung von 8,80 m. Die Pfeilerbreite in Brückenlängsrichtung variiert zwischen2,50 m und 3,50 m. Der Bogen hat eine Stärke von 3,25 m am Kämpfer und 2,00 m am Scheitel. Pfeilerund Bogen wurden als massive Querschnitte ausgeschrieben. Der Festpunkt der Brücke wurde in diePfeilerachsen 90 und 100 gelegt.
Die Gründung der Brücke erfolgt als Flachgründung in dem anstehenden Fels mit teilweisem Bodener-satz aus Magerbeton, wobei die Widerlager auf Vorschüttungen gegründet werden.
101

Bild 6.1: Ansicht und Überbauquerschnitt
Nebenangebote
Durch die örtlichen Gegebenheiten und der gewählten Gestaltung mit dem Bogen in etwa der Brücken-mitte wurden die Stützweiten bei jedem Nebenangebot beibehalten. Die massiven Unterbauten mit denriesigen Betonmassen gaben jedoch Anlaß, über eine Veränderung nachzudenken.
Durch die Verringerung der Naturschutzfläche auf ca. 15 m wurde die Bogenherstellung auf Gerüstkalkuliert und nicht mittels Freivorbau.
Das Lagerungssystem wurde generell verändert, so daß der Festpunkt der Brücke im Bogenscheitel derAchse 70 lag. Hierdurch reduzierten sich die Lagerwege ganz erheblich und es ermöglichte sich, diePressenstellflächen vor und hinter dem Lager anzuordnen.
Weiterhin wurde beim Überbau das Zugband innenliegend mittig in der Fahrbahnplatte angeordnet.
Im Gegensatz zu den außenliegenden Zugbändern, die in den Systemknoten über Kopfbolzen nur mitVersatz angeschlossen werden konnten, werden die innenliegenden Zugbänder über Stehbleche ver-satzlos in den Systemlinien der Längsträger und Druckstreben angeschlossen. Darüber hinaus bietetder Beton natürlich einen hervorragenden Korrosionsschutz.
Im Grundriß verläuft die Gradiente entlang einer Klothoide. Bedingt durch das Herstellungsverfahren(Einschub des Stahltroges) müssen die Unterbauten und der Stahltrog auf einem Ersatzkreis liegen.Um die Abweichungen zwischen dem Trog und der Fahrbahnplatte zu minimieren, wird der Trog vonbeiden Seiten auf zwei verschiedenen Ersatzkreisen eingeschoben und zwischen den Achsen 80 und 90miteinander verbunden.
102

Als zusätzliche Maßnahme werden die letzten ca. 50 m des östlichen Überbaues auf einer Klothoideverschoben.
Nebenangebot 1
Leicht veränderter Stahlverbundquerschnitt (Bild 6.2) mit innenliegendem Zugband bei geändertemLagerungssystem und angepaßtem Unterbau. Herstellung des Bogens auf Lehrgerüst.
Bild 6.2: Regelquerschnitt des Nebenangebot 1
Nebenangebot 2
Offener Stahlverbundquerschnitt als 2-stegiger Plattenbalken mit I-Trägern.
Nebenangebot 3
Doppelverbundquerschnitt mit externer Vorspannung, bei dem wesentliche Merkmale des VE übernom-men sind. Bei dem Haupttragwerk wird jedoch auch im Untergurt eine Stahlverbundlösung, kombiniertmit externer Vorspannung, gewählt.
Wie im Verwaltungsentwurf wird die Fahrbahnplatte in ihrer Tragfunktion möglichst unabhängig vondem Haupttragwerk ausgebildet. Dazu gehört eine Herstellung des Brückenquerschnittes in zwei Pha-sen. In der ersten Phase wird ein Teilquerschnitt aus Stahlstegen, Stahlobergurt und einem Untergurt ausStahlverbund im Taktschiebeverfahren hergestellt. Beim Schieben wird eine geringe Vorspannung ausSpanngliedern mit Verbund oder auch aus externen Spanngliedern aufgebracht. Nach dem Erreichender Endlage beim Taktschieben werden die Querscheiben in den Lagerachsen und die aussteifendenK-Scheiben in den Feldern ergänzt und externe Spannglieder eingezogen und sukzessive mit dem Be-tonieren der Fahrbahnplatte gespannt.
Eine bereichsweise Auswechselung der Fahrbahnplatte ist wie beim VE möglich. Die Änderungen desvorliegenden Sonderentwurfes betreffen nur den Untergurt und die Querscheiben, die Fahrbahnplatteist nicht betroffen. Es muß wie beim VE ein temporärer horizontaler Verband zwischen den Hauptträ-gerobergurten eingezogen werden. Der vertikale Verband im Kasten wird durch die Anordnung vonBetonquerscheiben in K-Form in den Feldern ersetzt. Diese haben einen Abstand von ca. 15 m und
103

Bild 6.3: Regelquerschnitte des Nebenangebot 2
werden mit den Stegen durch Dübel im Stegblech verbunden. Sie dienen gleichzeitig zur Verankerungund Umlenkung der externen Spannglieder.
Der größere Abstand ist möglich, weil der Querschnitt durch die 8 m breite Betonbodenplatte sehr vielsteifer ist als der Kasten mit einer Bodenplatte aus Stahl.
Gegenüber dem Ausschreibungsentwurf hat der Sonderentwurf den Vorteil, daß der Beton im Untergurtdie Druckkräfte am wirtschaftlichsten abtragen kann und gleichzeitig die Vorspannung zu einer Redu-zierung der Kräfte im Obergurt und zu einer Verringerung der Querkräfte führt. Der erhöhte Längsdruckin den Stegen aus der Vorspannung ist dem gegenüber untergeordnet. Mit der gewählten Spannglied-führung durch Überlappung in den Feldmitten wird der Längsdruck überwiegend wieder durch dasEigengewicht kompensioniert. Konstruktiv ergeben sich für die Führung der externen Vorspannunggünstige Verhältnisse in dem breiten Kasten.
Das Haupttragwerk wird vom Widerlager aus im Taktschiebeverfahren gefertigt.
Beim Schieben wird auf Hilfsstützen verzichtet. Es wird ein Vorbauschnabel von ca. 30 m Länge einge-setzt. Die Stahlteile für die Fahrbahnplatte wie Rohrstreben, Zugbänder und Längsträger können schonin der Fertigungsanlage montiert und mit verschoben werden.
Alternativvorschlag 1
Hier wurde für den Bogen ein zweizelliger Hohlquerschnitt konzipiert mit 30 cm starken Wänden,wobei die äußeren Abmessungen beibehalten wurden. Ein Ausbau zur Begehung des Bogens mittels
104

Bild 6.4: Regelquerschnitte des Nebenangebot 3
Podesten und Treppen wurde vorgesehen. Die Herstellung erfolgt ebenfalls auf Lehrgerüst in Teilab-schnitten von ca. 10 m.
6.1.2.1 Alternativvorschläge 2 bis 4
Bei diesen Alternativen wurden verschiedene Stützenquerschnitte angeboten. Zum einen ein Hohlpfei-ler mit Wandstärken von 30 cm und beibehaltenen äußeren Abmessungen, einschl. dem erforderlichenAusbau und zum anderen zwei Varianten eines veränderten Vollpfeilers.
6.1.3 Beauftragung
Nach der Submission vom 22.09.99 erhielt die Bietergemeinschaft GERDUM u. BREUER/LonardiEnde November 1999, innerhalb der Zuschlagsfrist, den mündlichen Auftrag für folgende Nebenange-bote:
• NA 1 Modifizierter Überbauquerschnitt mit geändertem Lagerungssystem
• AV1 Zweizelliger Hohlbogenquerschnittt mit Herstellung auf Lehrgerüst
• AV2 Pfeilervariante Hohlpfeiler
105

Bild 6.5: Bogen als zweizelliger Hohlkasten
• AV6 Geänderte Entwässerungsleitung
Die Auftragssumme betrug ca. 54,5 Mio. DM, wobei der Verwaltungsentwurf mit 58,5 Mio. DM ab-schloß.
6.1.4 Schlussbetrachtung
Die Ausarbeitung der Nebenangebote erfolgte exklusiv und in enger Zusammenarbeit mit dem Inge-nieurbüro Kinkel + Partner in Neu-Isenburg, das auch die technische Bearbeitung durchgeführt hat.
Zu der Bedeutung von Sonderentwürfen im Brückenbau noch einige Anmerkungen aus der Sicht einerBaufirma:
Ein großer Teil der Brücken wird auf Sonderentwürfe vergeben und da Sonderentwürfe nur beauftragtwerden, wenn sie billiger (Preis) und besser (gleichwertig) als die Ausschreibungsentwürfe sind, habensie eine große volkswirtschaftliche Bedeutung.
Bei der Ausarbeitung eines Ausschreibungsentwurfes werden verschiedene Varianten preislich ver-glichen um ein Optimum zu erreichen. Das können wir bei der Erstellung eines Sonderentwurfes inenger Absprache zwischen Entwerfer und Kalkulator viel besser. Wir haben die aktuellen Preise zurVerfügung und können auf die Auswertung ähnlicher Projekte sowohl bezüglich der Konstruktion, alsauch der Herstellungsabläufe und der Kostenzurückgreifen. Außerdem werden die Entwürfe auf dievorhandenen Geräte der Firma abgestellt. Sonderentwürfe ergeben auch bessere Konstruktionen, weil
106

Bild 6.6: Querschnittsbild AV 2, AV 3, AV4
107

durch die Rückkoppelung aus ausgeführten Projekten bewährte Lösungen gewählt werden, die Risikenvermieden.
Verstärkt durch die neue Vergabeordnung entsteht oft der Eindruck bei den ausschreibenden Stellen,dass Sonderentwürfe als lästig empfunden werden und ihr Vorteil nicht gewürdigt wird. Durch unnöti-ge Sonderentwurfsbedingungen, durch die nicht sachgemäße Anwendung der „Vergleichbarkeit“ oderdurch die überholte Formulierung „nur Mengenreduzierung“ werden gute Lösungen verhindert.
Mein Dank gilt den hier zuständigen Herren der DEGES, die beim Albrechtsgraben eine sachgerechteund faire Bewertung der Sonderentwürfe durchführten.
6.2 Teil 2: Bauausführung der Talbrücke Albrechtsgraben
Nach der schriftlichen Auftragsvergabe durch die DEGES am 15.12.99 an die ArbeitsgemeinschaftTalbrücke Albrechtsgraben, wurde noch im Dezember 1999 mit der techn. Bearbeitung durch das In-genieurbüro Kinkel + Partner, Neu-Isenburg, begonnen.
Bereits zum Baubeginn, im Februar 2000, war das Baufeld gerodet und die eindrucksvolle Hanglageauf der Ost- und Westseite freigelegt (Bild 6.7 a).
Mit dem Beginn der Betonarbeiten der Pfeilerfundamente im April 2000 (Bild 6.7 b), Fertigung derPfeiler ab Mai 2000 (Bild 6.7 c) und dem Ziel Fertigstellung der gesamten Unterbauten einschließlichBogen bis Jahresende 2000 (Bild 6.7 d) hatte sich das Team GERDUM u. BREUER/Kinkel + Partnereiner gewaltigen Bauaufgabe gestellt.
Die Umsetzung dieser Ziele war aufgrund der von DEGES gegebenen zeitlichen Vorgaben erforderlichund ich kann vorwegnehmend berichten, daß uns dies – auch durch die hervorragende und verständnis-volle Zusammenarbeit mit dem Prüfingenieur, Herrn Prof. Curbach, Nürnberg – gelungen ist.
Parallel zur technischen Bearbeitung der Unterbauten begann das Ing.-Büro IWS, Dr. Schrade, Idstein,im Auftrag von Kinkel und Partner, mit der technischen Bearbeitung des Stahlüberbaues.
Die Ausführung der Stahlbauarbeiten für den einzelligen Verbundquerschnitt durch unseren ARGE-Partner, der Fa. Lonardi aus Verona, Italien, sollte ab Oktober/November 2000 auf der Baustelle begin-nen, hierzu später einige Einzelheiten.
Zunächst möchte ich auf den Bauablauf und die Herstellungsverfahren von Pfeiler und Bogen nähereingehen.
6.2.1 Die Pfeilerherstellung
Durch den einzelligen Stahl-Verbund-Überbauquerschnitt erhielt die Talbrücke Albrechtsgraben ledig-lich eine Pfeilerreihe in Brückenquerrichtung. Dadurch bedingt, haben die Pfeiler mit 8,8 m x 3,20 mgewaltige Abmessungen erhalten.
Die begehbaren Hohlpfeiler mit 30 cm Wandstärke, Zwischenpodesten im Abstand von 5 m und Höhenvon etwa 17 bis 65 m wurden in 5 m Schüsse aufgeteilt.
Herzustellen waren 66 Stück Pfeilerschüsse, 10 Stück Pfeileranfänger zwischen 2,60 m und 5,96 msowie 10 Stück Pfeilerköpfe mit einer Gesamthöhe von 4,60 m, die jeweils in zwei Betonierabschnittenvon 2,50 m und 2,10 m aufgeteilt wurden.
108

(a) Baubeginn, Februar 2000 (b) Betonarbeiten der Pfeilerfundamente,April 2000
(c) Fertigung der Pfeiler, Mai 2000 (d) fertiggestellter Bogen, Ende 2000
Bild 6.7: Talbrücke Albrechtsgraben Bauausführung
109

Bild 6.8: Kämpfer – Baugrube, Achse 90
Die 76 Stück Pfeilerschüsse und Pfeilerköpfe wurden mit 2 Stück kranumsetzbaren Kletterschalungender Fa. DOKA hergestellt. Die Massen eines Pfeilerschusses setzen sich in etwa wie folgt zusammen:
Innen- und Außenschalung: 181 m2
Beton: 34,5 m3
Bewehrung: i. M. 4,0 t
Fertigteilpodeste: 22 m2
Es ist uns gelungen, einen solchen Pfeilerschuß im Tagesrhythmus mit jeder Schalungseinheit herzu-stellen.
Dies war allerdings nur möglich, weil wir den Bewehrungseinbau für einen kompletten Schuß aufweniger als 2 Stunden reduzieren konnten.
Die Bewehrung wurde in 4 Körben, für jede Wand einzeln, am Pfeilerfuß vorgeflochten und einzeln indie vorbereitete Schalung eingehoben.
Arbeitsablauf (Bild 6.9):
• Ausbau der Innenschalung
• Einbau der Fertigteilpodeste
• Außenschalung abfahren und hochsetzen
• Bewehrung einheben
• Innenschalung einbauen
• Betonieren
110

(a) Umsetzen der Außenschalung (b) Einbau der Bewehrung
(c) Einbau der Innenschalung (d) Betonieren des Pfeilerschusses
Bild 6.9: Talbrücke Albrechtsgraben Bauausführung
111

Durch diese Vorgehensweise ist es uns gelungen, die gesamten Pfeiler in der Zeit von Mai bis Oktober2000 herzustellen.
Bild 6.10: Unterbauten, September 2000
6.2.2 Die Bogenherstellung
Mit dem zweizelligen Stahlbetonhohlbogen und einer Spannweite von 167,35 m reiht sich die TalbrückeAlbrechtsgraben an 3. Stelle der größten Betonbogenbauwerke in Deutschland ein (Tabelle 6.1).
Der Bogen der Talbrücke Albrechtsgraben ist damit der größte Stahlbetonbogen Deutschlands in Lehr-gerüstbauweise, dessen Herstellung für unser Team eine ganz besondere Herausforderung darstellte.
Konzeption des Bogen-Herstellungsverfahren, Traggerüst- und Schalungskonzepte wurden genaustensaufeinander abgestimmt. Der zweizellige Hohlquerschnitt mit Steg-, Boden- und Deckenstärken von30 cm folgt geometrisch der Ansicht einer quadratischen Parabel und im Grundriß einem Kreisbogenmit einem Radius von 3.000 m.
In Querrichtung ist der Querschnitt konstant. Mit 8,80 m Breite genauso breit wie die Pfeiler. Die Kon-struktionshöhe in Längsrichtung verändert sich linear von 3,25 m Höhe an den Kämpfern auf 2,0 mHöhe im Scheitel.
Die Herausforderung für Arbeitsvorbereitung und Bauleitung lag insbesondere darin, die Arbeiten amTraggerüst, Schalungsbau, Bewehrung mit Betoneinbau so aufeinander abzustimmen, daß zum einenalle Beteiligten kontinuierlich und ungehindert arbeiten konnten, eine Taktfertigung erreicht und ter-mingerecht gebaut wird. Die Bogenlänge von 216,2 m haben wir in 20 Betonierabschnitte von 10 mLänge, zwei Anfänger mit 5,40 m und 5,80 m Länge sowie das Schlußstück von 5,0 m Länge aufgeteilt.Bogenherstellung und Traggerüstaufbau liefen parallel.
Das stählerne Traggerüst bestehend aus Fachwerktürmen, Fuß- und Jochträgern sowie Gerüstträgernaus Walzprofilen und Fachwerkkonstruktionen teilt sich in sieben Achsen auf. Insgesamt wurden 1.500 tGerüstmaterial in Anspruch genommen. Die Gründung erfolgte als Flachgründung im anstehendenFels und als Bohrpfahlgründung in der Talaue. Die Gerüsttürme waren sowohl in Längs- als auch inQuerrichtung gegen auftretende Horizontalkräfte nicht abgespannt. Traggerüst und betonierte Bogen-abschnitte bildeten eine Einheit. Das Gerüst übernahm die Betonierlasten, der Beton übernahm die
112

Bild 6.11: Systemdarstellung Traggerüst und Bogenabschnitte
Bild 6.12: Traggerüstgründung in der Talaue
113

Tabelle 6.1: Bogenbrücken in Deutschland
Bauwerk Bogen- Spannweite
Höhe über Talgrund
Herstellverfahren
Talbrücke Wilde Gera im Zuge der A 71
252 m 110 m Freivorbau mit Abspannung - Hohlbogen -
Kylltalbrücke im Zuge der A 60 bei Bittburg/Wittlich
223 m 92 m Freivorbau mit Abspannung - Massivbogen -
Talbrücke Albrechtsgraben im Zuge A 71 bei Suhl
167,35 m 70 m Traggerüst - Hohlbogen -
Maintalbrücke Veitshöchheim im Zuge der NBS, H-WÜ bei Würzburg
162 m 24 m Freivorbau mit Abspannung - Massivbogen -
Aussteifung des Gerüstes. Hierzu wurden die einzelnen Traggerüstabschnitte am bereits fertiggestell-ten Bogenabschnitten angespannt. Lediglich das erste Traggerüstfeld im Bereich der Kämpfer wurdemit 4 Stück Spannstählen∅ 36 mm an den Kämpferfundamenten angespannt.
Bild 6.13: Lehrgerüstträger mit aufgebauterÜberhöhung
Bild 6.14: Montage der letzten Lehrgerüstträger
Die Parabelform einschließlich Durchbiegungsüberhöhung wurden als Holzkonstruktionen am Bodenauf die Lehrgerüstträger montiert und feldweise als Trägerpaare mit Turmdrehkranen auf die Jochträgeraufgelegt.
Bild 6.15: Systemdarstellung, Traggerüst- und Bogenherstellung
114

Diese Verfahrensweise, Traggerüst und Bogen gleichzeitig herzustellen oder anders ausgedrückt – mitdem Bogen bereits beginnen zu können, bevor das Traggerüst fertiggestellt/geschlossen ist – hatte füruns mehrere Vorteile:
• die Bauzeit wurde erheblich reduziert
• kontinuierlicher Arbeitsablauf für Gerüst- und Betonbauer
• Schalungsanlieferung und Schalungsendmontage in kleineren Einheiten direkt vor dem Arbeitseinsatz
Aufbau
Aussenschalung
Einbau
Trogbewehrung
Betonieren
Trog
Einbau
Deckelbewehrung
Betonieren
Deckel
Fertiger
Schuss
Bild 6.16: Fertigungsprinzip Bogen
Jeder Bogenabschnitt wurde in zwei Betonierabschnitten hergestellt. Zuerst Bodenplatte und alle dreiStege, danach die Deckenplatte.
Das Schalungskonzept wurde gemeinsam von GuB und DOKA entwickelt. Der Bauablauf verlangteeinen hohen Vorfertigungsgrad der Schalung und Anlieferung just in time.
Die größten Probleme entstanden mit der Zugänglichkeit der Arbeitsbereiche und hier besonders in denersten Schüssen. Der Bogen hat eine Anfangsneigung von etwa 56,3° also nicht mehr senkrecht undnoch nicht flach.
Es wurde wie folgt vorgegangen:
Die Bodenschalung ist als Großflächenelement von 12,0 m Länge und 2,50 m Breite belegt mit geho-belter Brettschalung angeliefert worden.
Diese Elemente wurden auf der Baustelle mit Montagekonsolen versehen, so daß sie wie Treppenstufenauf dem Traggerüst aufgelegt und befestigt werden konnten.
Die Bodenelemente sind jeweils auf Länge der Gerüstfelder vormontiert worden. Die Stegaußenscha-
115

Bild 6.17: Montage der Bodenschalung Bild 6.18: Einschalung und Betonieren der Boden-platte und Stege
lung ist als Top-50-Schalelement von 2,50 m Länge und einer Höhe von 3,25 m ebenfalls belegt mitgehobelter Brettschalung angeliefert worden. Diese Außenschalungselemente wurden mit von uns ent-wickelten Abstellböcken und mit auf die jeweilige Neigung des Bogens anpassungsfähigen Konsolge-rüsten ausgestattet und elementweise auf der Bodenschalung abgesetzt und befestigt. Die Innenscha-lungselemente sowohl für den Mittelsteg als auch für die Außenstege wurden als Kantholzelementevorgefertigt angeliefert, hatten Fußbohlen und wurden höhenmäßig von Abschnitt zu Abschnitt an-gepaßt. Die Deckelschalung der Bodenplatte ist in Elementen von 3,50 m Länge und 1,25 m Breiteangeliefert und örtlich mit Betonierkonsolen versehen worden. Die Elemente wurden während des Be-toniervorganges verlegt und mit der Unterkonstruktion verspannt.
Für die innere Deckelschalung kamen vier Deckentische zum Einsatz. Diese bekamen ihre Auflagerungan eigens von Doka entwickelten, an den Stegen angebrachten Konsolen. Die Konsolen übernahmenzum einen die Betonierlasten, enthielten zum anderen ein Absenkmechanismus und auf integriertenRollen konnte der Tisch mit Winden in die nächste Betonierstellung gefahren werden.
Die äußere Deckelschalung wurde ebenfalls als Großflächenelement vorgefertigt angeliefert. DerenLänge erstreckte sich über die gesamte Bogenbreite mit etwa 9,0 m Länge. Die Elemente wurden auf1,25 m Breite gebaut, mit Betonierkonsolen versehen und während dem Betonieren elementweise ver-legt. Vorgehalten wurden insgesamt 3.200 m2 Schalung. Die Bewehrung für die beiden Bogenanfän-gerschüsse wurde örtlich in der vorbereiteten Schalung verlegt.
Die Bewehrung aller 20 Stück 10 m Abschnitte ist komplett vorgefertigt worden. Die Bewehrung fürdie Bodenplatte als ein Korb mit 8,70 m Breite, 10 m Länge und 20 cm Stärke.
Die Bewehrung der Stege haben wir ebenfalls mit Traversen als jeweils eine Korbeinheit eingehoben.So ist es uns gelungen, zwei komplette Bogenschüsse je Woche im Takt zu fertigen.
116

Bild 6.19: Bewehrung und Einschalung Bodenplatte + Stege
Bild 6.20: Komplette Einschalung Betonierab-schnitt 1
Bild 6.21: Deckentisch des Bogendeckels
117

Bild 6.22: Einbau der Stegbewehrung Bild 6.23: Äußere Deckelschalung
Am jeweils vorlaufenden Abschnitt Bodenplatte und Stege und im nachlaufenden Abschnitt je eineDeckenplatte Für die Bogenherstellung haben wir insgesamt 5 Monate gebraucht. Der erste Anfänger
Bild 6.24: Bogenherstellung und Traggerüst im Ok-tober 2000
Bild 6.25: Letzter Beton zum Lückenschluß des Bogen-deckels im Dezember 2000
wurde am 10.08.2000 betoniert, der letzte Beton zum Bogenschluß wurde von unserem kompetentenFachpersonal am 05.12.2000 eingebaut.
Zur Demontage des Lehrgerüstes haben wir dieses dann komplett um etwa 9,0 m quer verschoben(Bild 6.26) und konnten so die Bodenschalung sowie die einzelnen Gerüsteinheiten mit zwei Turm-drehkranen abbauen.
6.2.3 Der Überbau
Wie bereits erwähnt wurden die Stahlbauarbeiten für den Verbundquerschnitt von unserem ItalienischenARGE-Partner, der Firma Lonardi, aus der Nähe von Verona, gefertigt und montiert.
118

Bild 6.26: Bogen mit querverschobenem Traggerüst
Der Stahltrog hat eine Höhe von 4,12 m und eine Breite bis zu den äußeren Längsträgern von 11,30 m.Dieser Querschnitt (Bild 6.27) ist zum Transport über die Alpen per Eisenbahn in sechs Segmente
Bild 6.27: Regelquerschnitt
aufgeteilt worden.
Angeliefert wurden diese sechs Elemente, mit Längen bis 20 m, sowie die inneren Verbände, die äuße-ren Schrägstreben und Längsträger zum Bahnhof Zella Mehlis, von dort ging es per LKW weiter zurBaustelle.
Der Stahltrog ist im Taktschiebeverfahren, eingeschoben worden. Wegen der komplizierten Geometriewurden zwei Taktstationen, hinter den Widerlagern, aufgebaut. Geschoben wurde in zwei verschiede-nen Ersatzkreisen.
In den, hinter den Taktanlagen eingerichteten, sogenannte Vorfertigungen wurden die Stahlelementein größeren Querschnittseinheiten vormontiert, zur Taktstation transportiert und dort zum Gesamtquer-schnitt zusammengebaut. Insgesamt wurden (47×6= 282 Stück) Querschnittselemente und 400 Quer-schnittsverbände mit insgesamt etwa 5500 t Gesamtgewicht montiert.
119

Bild 6.28: Taktvorfertigung, Taktanlage mit Montagehalle und Stahltrog der Takt 1 und 2
Die Taktanlagen hatten Längen von je 100 m, die dann jeweils in 3 Verschubphasen mittels Winden-technik vorgeschoben wurden. Insgesamt gab es je Taktanlage 4 Verschübe von 85 – 102,5 m Länge.Der Vorschub erfolgte in einer ca. 85 cm überhöhten Lage. Der Lückenschluß erfolgte in Brückenmitte.Der Ausbau der Taktschiebelager, Einbau der Originallager und Absenkung in die Endhöhe wurde über3 Achse beginnend vom Widerlager Achse 150 und endend am Widerlager Achse 10 ausgeführt.
Die Herstellung der etwa 35 cm starken Fahrbahnplatte, mit 6 cm starken Vouten oberhalb der 5 Längs-träger wird zur Zeit umgesetzt. Auch hier wird von beiden Widerlagern aus Richtung Brückenmitte, imPilgerschrittverfahren, gearbeitet. Insgesamt sind 37 Abschnitte zu betonieren.
Die eingesetzten Schälwagen bestehend aus 4 sogenannten Deckentischen und 2 äußeren Kragarm-schalwagen, wurden von GERDUM u. BREUER entwickelt. Die Schalwägen sind alle unter der Fahr-bahnplatte montiert, lassen sich von dort bedienen und verschieben, so daß die Fahrbahnplatte ohnejegliche Durchdringung betoniert und bearbeitet werden kann.
6.2.4 Am Bau Beteiligte
Ich möchte mich bei allen „am Bau Beteiligten“ bedanken. Bei unseren Mitarbeitern, die bisher dafürgesorgt haben, daß wir ohne größere Unfälle das Bauwerk errichten konnten, unseren Partnern wieder Firma LGB für die Erstellung des Traggerüstes, der Firma Bickardt Bau für die Erdarbeiten, demIngenieurbüro Kinkel u. Partner für die Technische Bearbeitung um nur ein paar zu nennen, der Bau-überwachung von EHS und LEH für die gute Zusammenarbeit und nicht zuletzt den Mitarbeitern derDEGES, die uns bei der Abwicklung des Bauvorhabens unterstützt haben.
120

121

122
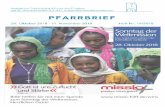





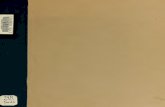





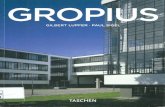

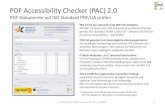

![BIOPHYSIK Physik der Zelladhäsionbiophys/PDF/PJ2015.pdf · 4).) ((), (+ (– – [()() ] , / / . (), () ...](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5d56f76688c99392138b6b93/biophysik-physik-der-zelladhaesion-biophyspdfpj2015pdf-4-.jpg)


