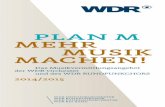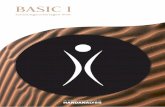âDas gewisse Mehr an Grundlagenforschungâ
Transcript of âDas gewisse Mehr an Grundlagenforschungâ

schung – in Jahren denken. Wir wol-len dort „dicke Bretter“ bohren und die Ergebnisse mittel- und langfristig auch kommerziell nutzen.
Program Management Board entscheidet über Forschung
� Nachrichten: Wer entscheidet denn, woran und worüber geforscht wird?
Leitner: Dafür gibt es das Program Management Board, das sich aus Ver-tretern der beteiligten Partner, RWTH Aachen, Bayer Material Science und Bayer Technology Services, zusam-mensetzt. Es definiert und koordiniert die Themen am CAT. Das Gremium entscheidet im Konsens, kein Partner
� Nachrichten aus der Chemie: Herr Leitner, sie sind wissenschaftlicher Lei-ter des Katalysezentrums CAT. Was ver-sprechen Sie sich als Hochschulprofes-sor von dem Gemeinschaftsprojekt – sind Sie jetzt ein Bayer-Mann?
Walter Leitner: Nein, auf keinen Fall. Wir versprechen uns von dem Projekt zum einen eine effiziente Schnittstelle zur Industrie, so dass sich Grundlagenforschung schnell in Anwendungen umsetzen lässt. Zum anderen soll es um Fragen gehen, die einerseits einen industriellen Hinter-grund und andererseits einen Grund-lagenforschungscharakter haben. Die Interaktion ist bisher positiv: Jeder er-kennt an, dass die andere Seite ihre Freiheiten braucht. Auch unsere In-dustriepartner im CAT, also Bayer Ma-terial Science und Bayer Technology Services, wollen nicht, dass wir nur die verlängerte Werkbank des Unter-nehmens sind.
Nachrichten: Wenn Sie, Herr Gürt-ler als Leiter des Katalyseprogramms bei Bayer Material Science, keine ver-längerte Werkbank suchen, welchen Mehrwert bringt dann das CAT?
Christoph Gürtler: Eindeutig Grundlagen. Wir wollen niemanden vereinnahmen sondern versprechen uns Antworten auf knifflige und auch aufwendige Fragen der Katalysefor-schung. Das sind Projekte, die man nicht einfach in vier, fünf Monaten abarbeiten kann, sondern bei denen wir – ähnlich der universitären For-
Seit Anfang des Jahres arbeiten die RWTH Aachen und Bayer im Katalysezentrum CAT
in Aachen zusammen. Die Nachrichten aus der Chemie sprachen mit Walter Leitner und
Christoph Gürtler über Forschung an der Schnittstelle von Akademia und Industrie.
Grundlagenforschung“
„Das gewisse Mehr an
�Katalyse�
kann von den anderen beiden über-stimmt werden.
Nachrichten: Und wie definieren sie die Forschungsprojekte?
Gürtler: Die Forschungsprojekte setzen an einer bestehenden Methode an. In den meisten Fällen wurde diese im akademischen Bereich entwickelt. Ziel ist dann die Weiterentwicklung im Bezug auf ein konkretes Molekül oder eine polymere Substanz, die tat-sächlich gebraucht wird und sich ver-kaufen lässt. Das heißt nicht, dass je-des Projekt automatisch kommerzia-lisiert wird – die Möglichkeit, etwas Marktreifes daraus zu machen, sollte aber immer gegeben sein. Das klingt im ersten Moment selbstverständlich. Genau daran hapert es aber oft.
Leitner: Die Definition von For-schungsthemen ist ein dualer Pro-zess. Auf der einen Seite kommen die Fragen vom Industriepartner: „Wir haben dieses Problem. Habt ihr eine Lösung?“ Auf der anderen Seite schlagen wir methodische Ansätze vor und sagen: „Wir haben gerade diese Methode oder Reaktion oder diesen Katalysator entwickelt. Kann Euch das helfen?“ Schließlich ent-scheidet das Management Board, wel-che Vorschläge die größte Schnitt-menge aufweisen.
Nachrichten: In der Pressemittei-lung zum Start des CAT heißt es mutig: „Angedacht ist die Entwicklung gänz-lich neuer katalytischer Systeme.“ Was ist denn darunter zu verstehen?
Walter Leitner: „Es ist unsere Intention, dass
die Atmosphäre im CAT sehr akademisch ist.“
(Fotos: Christian Remenyi)
Nachrichten aus der Chemie | 56 | Juli I August 2008 | www.gdch.de/nachrichten
756

Gürtler: Ein Punkt ist die Oxidati-onschemie: Wir haben neue oxidati-onskatalytische Systeme für Interme-diate bei Kunststoffen im Auge. Und ich denke, diese Cokatalysatoren rechtfertigen durchaus den vollmun-digen Ausdruck „gänzlich neu“. Wir wollen mit CAT tatsächlich Probleme lösen, die bis jetzt nicht lösbar waren.
Leitner: Die Aktivierung von Koh-lendioxid ist ein weiteres Thema – der Einbau von Kohlendioxid entweder in Grundbausteine oder direkt in po-lymere Materialien. Dieses Thema be-schäftigt sowohl das Institut als auch mich persönlich seit vielen Jahren.
Postdocs für eine akademische Forschung
� Nachrichten: Welche Wissenschaft-ler dürfen am CAT forschen?
Leitner: Wir gehen davon aus, dass etwa 15 Postdocs hier arbeiten werden – momentan haben wir sieben an Bord. Wir erhalten Bewerbungen von Wissenschaftlern aus aller Welt.
Nachrichten: Kommen die Postdocs schon mit eigenen Projekten?
Leitner: Die Mitarbeiter bekom-men von uns zwar ein generelles The-ma vorgegeben, können aber selbst-verständlich dann ihre eigenen Vor-stellungen einbringen. Das ist auch der Grund, warum wir als Mitarbeiter Postdocs einstellen – das sind junge Leute mit neuen Ideen.
Nachrichten: Die Mitarbeiter be-kommen einen Vertrag über fünf Jahre, die gesamte Laufzeit des Projekts?
Leitner: Nein. In der Regel ist es ein Jahr mit der Option auf Verlänge-rung. Der Postdoc sollte ein Karriere-schritt sein, um für ein, zwei Jahre Er-fahrungen zu sammeln. Deshalb wäre es nicht gut, die Leute bis zu fünf Jah-re zu halten, sondern es wird genau die gleiche Fluktuation wie in einem akademischen Arbeitskreis geben. Es ist unsere Intention, dass die Atmo-sphäre im CAT sehr akademisch ist.
Gürtler: Sicher wird es aka-demisch in den Labors zugehen. Wir werden aber auch versuchen mit La-bormitarbeitern, also Technikern, Kontinuität hineinzubringen. Ein La-boratorium ohne technische Mit-arbeiter arbeitet mäßig effizient. Wir
Gürtler: Es gibt die Möglichkeit, Infrastruktur in Leverkusen zu nut-zen. Und wir werden technische Ein-richtungen aus Leverkusen hierher transportieren – etwa Hochdurchsatz-Devices. Wir halten das für essenziell und stellen sie zur Verfügung, um ein gewisses Maß an Screening-Möglich-keiten zu haben.
Leitner: Hier kommt die Synergie zum Tragen. Wir werden einerseits die Infrastruktur des Instituts für Technische und Makromolekulare Chemie an der RWTH Aachen stär-ken, andererseits die Infrastruktur des Instituts öffnen – und wir haben hier am Institut eine hervorragende Infra-struktur. So können wir die finanziel-len Mittel weitgehend für die Projekt-arbeit verwenden.
Nachrichten: Können auch andere Hochschulmitarbeitern die Infrastruk-tur des CAT nutzen?
Gürtler: Ja, wir haben uns aus-drücklich dafür entschieden. Sowohl wir als auch die Hochschule sollen vom jeweils anderen profitieren.
Start in die Industriekarriere?
� Nachrichten: Für die Mitarbeiter des CAT bietet sich wohl auch eine Kar-riere bei Bayer Material Science an.
Gürtler: Was sich anbietet und was wir nachdrücklich unterstützen, ist der Austausch mit der Industrie. Die Mitarbeiter werden viel stärker und häufiger mit Industrieforschern in Kontakt kommen, als es in einem universitären Labor möglich ist. Ob die Arbeitsweise jenseits des akademi-schen Labors etwas für ihn ist, muss der jeweilige Mitarbeiter selbst ent-scheiden. Ich möchte nicht ausschlie-ßen, dass der eine oder andere seinen Weg nach Leverkusen findet.
Nachrichten: Aber das CAT ist kein gezieltes Recruiting?
Gürtler: Ich interpretiere es eher als Chance für alle Beteiligten.
Leitner: Viele Bewerber sagen: „Ich weiß noch nicht sicher, ob ich eine akademische oder eine indus-trielle Laufbahn anstrebe. Ich habe jetzt promoviert, kenne nur die Uni-versität. Das hat mir gut gefallen, aber ich weiß nicht, ob das das rich-tige für mich ist.“ Und so ist das CAT
Christoph Gürtler: „Die Mitarbeiter des CAT
werden viel stärker und häufiger mit Indus-
trieforschern in Kontakt kommen, als es in
einem universitären Labor möglich ist.“
wollen so versuchen, neben dem – sa-gen wir mal akademischem Freiraum – ein gewisses Maß an Geschwindig-keit in die Forschungen zu bringen. Nachrichten: Zehn Millionen Euro stecken im CAT. Wie setzt sich diese Summe zusammen?
Leitner: 1,7 Millionen kamen vom Land Nordrhein-Westfalen. Dieses Geld ging in Umbau und Gestaltung der Laboratorien.
Gürtler: Wir waren übrigens sehr erfreut, wie schnell das Land Nord-rhein-Westfalen reagiert hat. Es ist wirklich erstaunlich, wie rasch das Laboratorium für das CAT eingerich-tet wurde – in nur sieben Monaten. Es hat sich einiges getan in der For-schungsverwaltung. Alle Achtung!
Leitner: Auch die RWTH als Uni-versität hat gezeigt, dass sie in der La-ge ist, ein solches Experiment anzu-packen. Eine Million Euro stellt sie zur Verfügung – zur Ausstattung des Labors sowie für Forschung und Per-sonal. Die restlichen 7,3 Millionen steuern Bayer Material Science und Bayer Technology Services bei.
Nachrichten: Knapp zwei Millio-nen Euro für Umbau und Ausstattung sind bereits weg, es bleiben also acht Millionen übrig. Auf fünf Jahre verteilt, sind das etwa 1,6 Millionen pro Jahr. 15 Postdocs kosten ja auch einiges, da-zu die laufenden Kosten – es bleibt also gar nicht mehr so viel übrig für größe-re Anschaffungen, etwa Geräte?
Nachrichten aus der Chemie | 56 | Juli l August 2008 | www.gdch.de/nachrichten
Katalysezentrum Aachen �Magazin� 757

Nachrichten: Waren andere Koope-rationen wie das Katalyselabor Carla der BASF und der Universität Heidel-berg dabei ein Vorbild?
Gürtler: Wir haben diese Frage tatsächlich schon zu einem Zeitpunkt evaluiert, als Carla noch nicht eröffnet war und wir davon noch gar nichts wussten. Am Ende haben wir uns dann auf dieses Modell, wie es jetzt im CAT und auch bei Carla betrieben wird, geeinigt, weil wir glauben, dass es insgesamt die beste Lösung für alle Beteiligten ist. Uns ist klar: Es ist ein Experiment. Wir versuchen das beste aus beiden Welten in diesem Labora-torium zu vereinigen.
Nachrichten: Forschungskoopera -ti on en zwischen Industrie und Aka-demia in eigenen Laboren liegen im Trend. Auch Evonik und Sasol haben solche Kooperationen.
Gürtler: Das ist richtig. Der Grund ist: Wenn man wie früher ein paar verstreute Kooperationen an mehreren Universitäten hat, gestal-tet sich die Kommunikation sowohl in Richtung der Hochschule, als auch in Richtung Unternehmen schwierig. Der Ansatz neuartiger Kooperationen wie dem CAT ist es, Fragen zu bündeln, ähnliche Metho-den darauf anzuwenden und sowohl in die Universität als auch ins Unter-nehmen für die richtige Kommuni-kation zu sorgen.
Leitner: Es ist ein allgemeiner Trend, die Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und Anwen-dung auszugestalten – nicht nur in der Chemie, sondern allgemein. Wir haben unzählige Beispiele von her-vorragender Grundlagenforschung und auf der anderen Seite eine erfolg-reiche Industrie. Aber die Umset-zung hat in der Vergangenheit nicht immer optimal funktioniert. Deshalb sucht man nach neuen Modellen.
Nachrichten: Was können Sie als RWTH von dem Projektpartner lernen?
Leitner: Ich glaube nicht, dass es um methodisches Lernen geht. Es geht eher darum zu erfahren, was die relevanten Fragen für die Indus-trie sind. Auch Lehre und Ausbil-dung erhalten durch dieses Zentrum Impulse.
Christian Remenyi, Aachen
sein unser Forscher im Werk ver-schwindet. Um den Kontakt sicher zu stellen, ist es deshalb sinnvoll, dass je-mand ständig vor Ort ist – Thomas Müller von Bayer Material Science wird dafür zuständig sein. Was reakti-onstechnische Fragen angeht, unter-stützt ihn Aurel Wolf von Bayer Tech-nology Services.
Leitner: Diese personelle Verflech-tung hilft beiden Seiten, den Wert der Koordination von Forschung und die Herangehensweise im Laboralltag im-mer wieder abzugleichen.
Fünf Jahre Probezeit
� Nachrichten: Das CAT ist auf fünf Jahre angelegt. Carl Bosch hat einmal gesagt: „Große Projekte brauchen zehn Jahre um fabrikreif zu werden.“ Sind fünf Jahre nicht zu kurz?
Leitner: Heute sind fünf Jahre für ein Industrieunternehmen ein lan-ger Zeitraum. Es wäre vermessen zu erwarten, dass wir nach fünf Jahren x Prozesse entwickelt haben. Fünf Jahre sind aber sinnvoll, um dieses Experiment zu evaluieren. Es ist ver-nünftig, dass Projekte ein definiertes Ende haben und man dann entschei-det, wie weiter vorgegangen wird.
Nachrichten: Eine Kooperation in der Art des CAT ist für Bayer ein rela-tiv neues Projekt. Was war der An-lass?
Gürtler: Der Innovationsgedanke ist wieder stärker in die Köpfe der Entscheider gedrungen. Wir haben erkannt, dass ein gewisses Mehr an Grundlagenforschung wichtig ist.
eine Riesenchance, da man hier im akademischen Umfeld bleibt, was auch im Hinblick auf Publikationen von Interesse ist. Außerdem be-kommt der Mitarbeiter am CAT Ein-blick in die industrielle Denkweise und die Abläufe der industriellen Forschung.
Nachrichten: Wie sieht es mit der anderen Richtung aus? Werden Bayer-Leute zeitweilig hier im CAT arbeiten?
Gürtler: Ja. Das ist ganz wichtig. Nachrichten: Und vielleicht kom-
men sie ja auf den akademischen Ge-schmack ...
Gürtler: Das ist durchaus mög-lich. Auch hier in Aachen ist ja das Institut für Technische und Makro-molekulare Chemie lange Zeit von einem Forscher geführt worden, der vorher bei Shell arbeitete – Wilhelm Keim. Ausschließen wollen wir ei-nen Wechsel nicht. Wobei wir unse-re Mitarbeiter nicht ausdrücklich dazu auffordern ...
Nachrichten: Sollen Mitarbeiter des CAT auch Verpflichtungen in der Lehre übernehmen?
Leitner: Das ist angedacht – die CAT-Mitarbeiter sollen nicht von der Hochschule abgekoppelt werden. Sie forschen im Hochschulumfeld und sollen deshalb auch entsprechend in die Lehre integriert sein.
Nachrichten: Gibt es am CAT so etwas wie einen Laborleiter?
Gürtler: Das CAT ist kein typi-sches Industrielabor. Wir verlassen das Werksgelände für Grundlagen und müssen deshalb darauf achten, dass das CAT nicht aus dem Bewusst-
Walter Leitner (Mitte) und Christoph Gürtler (rechts) mit Nachrichten-Redakteur Christian
Remenyi in einem Labor des Katalysezentrums.
�Magazin� Katalysezentrum Aachen 758
Nachrichten aus der Chemie | 56 | Juli I August 2008 | www.gdch.de/nachrichten