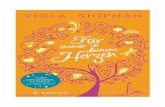Das Buch - bilder.buecher.de · Johanna Lindsey wächst auf Hawaii auf. Sie heiratet nach der...
Transcript of Das Buch - bilder.buecher.de · Johanna Lindsey wächst auf Hawaii auf. Sie heiratet nach der...
Das BuchDie Waise Danny hat keinerlei Erinnerung an ihre Familie.Seit sie denken kann, lebt sie als Junge verkleidet in denStraßen Londons, wo sie sich als Taschendiebin durchschlägt.Der Wendepunkt in ihrem Leben kommt in Gestalt einesebenso arroganten wie attraktiven Frauenhelden, dem reichenJeremy Malory. Er ist auf der Suche nach einem geschicktenLangfinger, der seinem Freund Perry aus einer höchst unan-genehmen Verlegenheit heraushelfen kann. Seine Wahl fälltauf Danny. Der Plan geht auf. Doch da entdeckt Jeremy zuseiner großen Verblüffung, dass es sich bei dem gerissenenTaschendieb um eine äußerst verführerische junge Dame handelt.
Die AutorinJohanna Lindsey wächst auf Hawaii auf. Sie heiratet nach derHighschool und hat bereits zwei kleine Kinder zu versorgen,als sie sich zum Schreiben gedrängt fühlt.1976 veröffentlichtsie ihren ersten Roman. In den folgenden zwölf Jahren verfaßtsie 17 weitere, die in über 12 Sprachen übersetzt wurden.Inzwischen hat sie drei Kinder und schreibt jeden Tag 10 bis16 Stunden an ihren historischen Liebesromanen. JohannaLindsey lebt mit ihrer Familie auf Hawaii.Fast alle ihre Romane sind im Wilhelm Heyne Verlag erschie-nen, unter anderem: Wogen der Leidenschaft – Verheißung desGlücks – Wildes Herz – Stern der Leidenschaft – Herz im Sturm – EinLächeln der Liebe – Ein Dorn im Herzen – Ein Lächeln der Liebe –Stürmische Begegnung
JOHANNA LINDSEY
Zärtlicher Räuber
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Katrin Marburger
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Umwelthinweis:Dieses Buch wurde auf
chlor- und säurefreiem Papier gedruckt.
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 06/2006Copyright © 2004 by Johanna Lindsey
Copyright © 2005 der deutschen Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: Victor Gadino via Agentur Schlück GmbHUmschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad AiblingDruck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
www.heyne.de
Titel der Originalausgabe»A LOVING SCOUNDREL«
erschien 2004 bei Atria Books, New York
Printed in Germany 2008
4. Auflage
ISBN: 978-3-453-49013-0
5
Prolog
Der Regen spülte weder den Gestank noch die Hitzefort, vielmehr schien er beides noch schlimmer zu
machen. In der engen Gasse türmte sich der Müll auf –Schachteln, verdorbene Lebensmittel, Kisten, zerbro-chenes Geschirr, eben alles, was weggeworfen wurde,weil niemand es noch haben wollte. Die Frau und dasMädchen waren in eine der größeren Kisten am Randdes Haufens gekrochen, um sich zu verstecken. Das Mäd-chen wusste nicht, warum sie sich verstecken mussten,doch es spürte die Angst der Frau.
Diese Angst war immer da gewesen, im Gesichtsaus-druck der Frau, in ihrer Stimme, in der zitternden Hand,mit der sie die des Mädchens nahm und es von einerGasse in die andere zerrte, stets in der Nacht, niemals amTage, wenn sie anderen Leuten begegnen konnten.
»Miss Jane« solle das Mädchen sie nennen, hatte dieFrau gesagt. Die Kleine dachte, sie hätte den Namen derFrau eigentlich wissen müssen, aber das tat sie nicht. Siewusste auch nicht, wie sie selbst hieß. Die Frau nanntesie »Danny-Schätzchen«, also war das wohl ihr Name.
Miss Jane war nicht ihre Mutter. Danny hatte gefragtund zur Antwort bekommen: »Ich bin deine Amme.«Sie hatte nie daran gedacht zu fragen, was eine Ammewar, denn aus dem Tonfall der Frau hatte sie entnom-men, dass sie es wissen musste. Miss Jane war von An-fang an bei ihr gewesen, das heißt, solange sie zurückden-
ken konnte – das waren allerdings nur ein paar Tage. Alssie aufgewacht war, hatte sie neben der Frau in einerähnlichen Gasse wie dieser gelegen, und sie waren beideblutbesudelt gewesen. Seitdem waren sie ständig durchimmer neue Gassen gerannt und hatten sich wieder undwieder versteckt.
Das meiste Blut war von Miss Jane gewesen. In ihrerBrust hatte ein Messer gesteckt, und sie hatte noch ver-schiedene andere Wunden gehabt, da mehr als einmalauf sie eingestochen worden war. Es war ihr gelungen,das Messer selbst herauszuziehen, nachdem sie aufge-wacht war. Aber sie hatte ihre Wunden nicht gepflegt.Ihre einzige Sorge war gewesen, wie es dem Mädchenging und wie sie das Blut am Hinterkopf der Kleinen stil-len sollte – und dass sie schleunigst von dem Platz ver-schwanden, an dem sie aufgewacht waren.
»Warum verstecken wir uns?«, hatte Danny einmalgefragt, als offensichtlich war, was sie taten.
»Damit er dich nicht findet.«»Wer?«»Ich weiß es nicht, Kind. Ich dachte, er wäre ein Dieb,
der bei dem Einbruch wahllos alle Anwesenden umge-bracht hat, um keine Zeugen zu hinterlassen. Inzwischenbin ich mir allerdings nicht mehr so sicher. Er war zu ent-schlossen und zu sehr darauf aus, dich zu finden. Aber ichhabe dich in Sicherheit gebracht und passe auch weiterauf dich auf. Er wird dir nichts mehr tun, das versprecheich dir.«
»Ich weiß gar nichts mehr davon, dass er mir wehge-tan hat.«
»Deine Erinnerungen werden wiederkommen, Danny-Schätzchen, da mach dir mal keine Sorgen. Aber hof-
6
7
fentlich nicht allzu bald. Es ist wirklich ein Segen, dass duerst einmal von nichts mehr weißt.«
Danny störte sich nicht daran, dass sie nicht mehrwusste, was vor dem Blut geschehen war. Sie war auchnoch zu klein, um sich Sorgen zu machen, wie es nunweitergehen sollte. Ihre Bedürfnisse waren unmittelba-rer: Sie hatte Hunger, es war ungemütlich, und Miss Janewar noch immer nicht aus dem Schlaf erwacht.
Ihre Amme hatte anscheinend gedacht, sie würdenin den Bergen von Müll um sie herum etwas Nützlichesfinden, aber bisher war sie zu schwach gewesen, umnachzusehen. Mitten in der Nacht waren sie in die Kistegekrabbelt, und Miss Jane hatte den ganzen Tag durch-geschlafen.
Jetzt war wieder Nacht, und sie schlief immer noch.Danny hatte sie geschüttelt, aber Miss Jane hatte sichnicht gerührt. Sie war ganz kalt und steif. Danny wusstenicht, was das bedeutete, nämlich, dass sie tot war unddass es daher auch so fürchterlich stank.
Schließlich kroch Danny aus der Kiste, damit der Re-gen etwas von dem getrockneten Blut abwusch. Sie fandes nicht schön, schmutzig zu sein, und schloss daraus,dass sie nicht daran gewöhnt war. Es war komisch, so ein-fache Dinge zu wissen, aber keine Erinnerungen zu ha-ben, um das Wissen zu untermauern.
Danny beschloss, dass sie ebenso gut den Müll durch-suchen konnte, wie Miss Jane es vorgehabt hatte, auchwenn sie nicht genau wusste, wonach sie Ausschau hal-ten sollte und was man »nützlich« nennen sollte. AmEnde hatte sie ein paar Sachen aufgelesen, die sie inte-ressant fand – eine dreckige Flickenpuppe, der ein Armfehlte, einen Männerhut, der ihre Augen vor dem Re-
gen schützen würde, einen angestoßenen Teller, vondem sie essen konnten, und den fehlenden Arm derPuppe.
Miss Jane hatte einen Ring, den sie gestern getragenhatte, gegen etwas zu essen eingetauscht. Es war das ein-zige Mal gewesen, dass sie sich bei Tage hinausgewagthatte, eingehüllt in ihr Umhängetuch, um die schlimms-ten Blutflecken zu verbergen.
Danny wusste nicht genau, ob Miss Jane noch mehrRinge hatte, die man versetzen konnte; sie hatte nichtdaran gedacht nachzusehen. Sie hatte bei dieser Gele-genheit zum letzten Mal etwas gegessen. In dem Müll la-gen auch verdorbene Lebensmittel, aber obwohl Dannyhungrig war, ließ sie die Finger davon. Nicht, weil sie ge-wusst hätte, dass sie nicht gut waren, sondern weil siekeine Vorstellung davon hatte, was es hieß, verzweifeltzu sein, und dieses Zeug roch widerlich.
Wahrscheinlich wäre sie irgendwann verhungert,während sie in der Kiste neben der toten Miss Jane kau-erte und geduldig darauf wartete, dass die Amme auf-wachte. Doch in der Nacht hörte sie, wie noch jemanddraußen im Müll herumwühlte, und stieß auf eine jungeFrau. Eigentlich war es ein Mädchen von höchstenszwölf Jahren, aber da es so viel größer war als sie, ordneteDanny es zunächst den Erwachsenen zu.
Entsprechend respektvoll und ein wenig zögerndsprach sie es an: »Guten Abend, Madam.«
Sie hatte das Mädchen erschreckt. »Was machst’n dubei dem Regen hier draußen, Schätzchen?«
»Woher wissen Sie, wie ich heiße?«»Hä?«»So heiße ich. Dannischätzchen.«
8
9
Gekicher. »Ziemlich sicher nur die Hälfte davon,Kleine. Wohnst du hier in der Gegend?«
»Nein, ich glaube nicht.«»Wo ist deine Mama?«»Ich glaube, ich habe keine mehr«, musste Danny ein-
gestehen.»Und deine Leute? Deine Familie? So eine hübsche
Kleine lassen die doch nicht allein draußen rumlaufen.Wer ist bei dir?«
»Miss Jane.«»Na siehst du«, sagte das Mädchen strahlend. »Und
wo ist die hingegangen?«Als Danny auf die Kiste hinter sich zeigte, runzelte das
Mädchen skeptisch die Stirn. Trotzdem schaute sie nach,kroch dann in die Kiste hinein, um genauer hinzusehen.Danny wollte lieber nicht noch einmal in die Kiste krab-beln und blieb draußen. Bei dem Müll roch es viel besser.
Als das Mädchen zurückkam, atmete es tief durch undschauderte. Dann beugte es sich zu Danny hinunter undlächelte sie schwach an. »Armes Ding du. Hattest du au-ßer ihr keinen?«
»Sie war bei mir, als ich aufgewacht bin. Wir warenbeide verletzt. Sie sagte, der Schmerz in meinem Kopfhat meine Erinnerungen weggenommen, aber sie werdeneines Tages wiederkommen. Seitdem haben wir uns im-mer versteckt, damit der Mann, der uns verletzt hat, unsnicht findet.«
»Oje, was für ein Jammer. Ich kann dich mit nachHause nehmen, schätze ich. Aber ein richtiges Zuhauseist das nicht; nur ein paar Kinder wie du, die keinen mehrhaben, der sich um sie kümmert. Wir schlagen uns haltdurch, so gut wir können. Alle schaffen ihr Geld zum Le-
ben ran, sogar die Kleinsten, die so sind wie du. Die Jungsals Taschendiebe, die Mädels auch, bis sie alt genug sind,ihr Geld auf’m Rücken zu verdienen. Mach ich auchbald, wenn’s nach dem verdammten Dagger geht.«
Die letzten Worte hatte sie so angewidert hervorge-spien, dass Danny nachfragte: »Ist das eine schlimme Ar-beit?«
»Die allerschlimmste, Kleine. Kriegst die Pocken da-von und musst jung sterben, aber was kümmert das Dag-ger, solange die Kohle reinkommt.«
»Dann möchte ich diese Arbeit nicht machen. Ichbleibe hier, vielen Dank.«
»Aber du kannst nicht …«, begann das Mädchen, ver-besserte sich jedoch: »Hör mal, ich hab eine Idee.Wünschte, ich hätte das auch machen können, aber dakannte ich das noch nicht, was ich jetzt mache. Für michist es zu spät, aber für dich nicht – nicht wenn sie den-ken, du bist ein Junge.«
»Aber ich bin ein Mädchen.«»Klar, Schätzchen, aber wir können dir ein Paar Ho-
sen beschaffen, dir die Haare kurz schneiden, und …«Das Mädchen kicherte. »Wir brauchen ihnen nicht malsagen, was du bist. Wenn sie dich in Hosen sehen, den-ken sie gleich, du bist ein Junge. Ist wie ein Spiel, wir tunso als ob. Macht bestimmt Spaß, wirst schon sehen. Unddann kannst du selbst entscheiden, was für eine Arbeitdu machen willst, wenn du größer bist, anstatt gesagt zukriegen, es gibt nur eine Arbeit für dich, weil du einMädchen bist. Na, wie hört sich das an? Willst du’s ver-suchen?«
»Ich glaube nicht, dass ich schon mal ›wir tun so alsob‹ gespielt habe, aber ich will es gern lernen, Madam.«
10
Das Mädchen verdrehte die Augen. »Du redest viel zuvornehm, Danny. Kannst du nicht anders?«
Danny wollte gerade erneut »Ich glaube nicht« sagen,schüttelte aber stattdessen verlegen den Kopf.
»Dann sag überhaupt nichts, bis du so reden kannstwie ich, klar? Damit du nicht durch deine Sprache auf-fällst. Keine Angst, ich bring dir das schon bei.«
»Kann Miss Jane mit uns kommen, wenn es ihr bessergeht?«
Das Mädchen seufzte. »Sie ist tot. Zu schwer verletzt,so wie’s aussieht. Ist wohl verblutet. Ich hab sie mit demgroßen Tuch zugedeckt – nicht weinen. Hast doch jetztmich; ich kümmer mich um dich.«
13
Kapitel 1
Jeremy Malory war schon früher in zwielichtigen Spelun-ken gewesen, aber diese war vermutlich die schlimmste
von allen. Kein Wunder, sie lag ja auch am Rand deswohl übelsten Armenviertels von London, das fest in derHand von Dieben, Halsabschneidern, Freudenmädchenund wilden Horden von Waisenkindern war, die auf derStraße lebten und zweifellos zu Londons nächster Ver-brechergeneration heranwuchsen.
Jeremy wagte sich nicht weiter in diesen Stadtteil hi-nein, da ihn seine Familie sonst vermutlich nicht wie-dersehen würde. Doch die Schänke stand absichtlichganz am Rand jener Mördergrube, damit nichts ahnendeGäste dort ein paar Gläser tranken und sich die Taschenausrauben ließen oder, wenn sie töricht genug waren, einZimmer für die Nacht mieteten, wo ihnen dann alles ge-stohlen wurde, sogar die Kleider.
Jeremy hatte für ein Zimmer bezahlt. Und nicht nurdas, er war auch sehr großzügig mit seinem Geld umge-gangen, hatte den wenigen Gästen in der Schänke eineRunde ausgegeben und überzeugend den Betrunkenengespielt. Auf diese Weise hatte er absichtlich den Bo-den dafür bereitet, dass jemand ausgeraubt wurde –nämlich er selbst. Doch genau aus diesem Grunde wa-ren er und sein Freund Percy auch hier – um einen Diebzu schnappen.
Zu Jeremys Erstaunen hielt Percy Adlen ausnahms-
weise einmal den Mund. Normalerweise redete er wie einBuch und war noch dazu ziemlich zerstreut. Dass er aufdiesem ungewöhnlichen Ausflug meist schwieg, zeigte,wie nervös er war. Verständlicherweise. Jeremy mochtesich ja in dieser Umgebung wie zu Hause fühlen – immer-hin war er in einer Schänke geboren und aufgewachsen,bis sein Vater ihn als Sechzehnjährigen zufällig aufgele-sen hatte. Percy dagegen gehörte zur gehobenen Gesell-schaft.
Jeremy hatte Percy mehr oder weniger geerbt, als diebeiden besten Freunde Percys – Nicholas Eden und Je-remys Cousin Derek Malory – zahm geworden waren undsich unter das Ehejoch gebeugt hatten. Derek hatte Je-remy unter seine Fittiche genommen, als Jeremy undsein Vater James nach dem Ende der langen Entfrem-dung zwischen James und seiner Familie nach Londonzurückgekehrt waren. Daher war es nur natürlich, dassPercy nun in Jeremy den engsten Verbündeten für Un-ternehmungen der weniger zahmen Art sah.
Jeremy hatte nichts dagegen. Nachdem sie acht Jahrelang gemeinsam durch dick und dünn gegangen waren,mochte er Percy mittlerweile richtig gern. Wenn demnicht so gewesen wäre, hätte er sich gewiss nicht freiwil-lig bereit erklärt, ihn aus seiner jüngsten Verlegenheit zuretten. Am vergangenen Wochenende hatte Percy sichnämlich auf einer mehrtägigen Gesellschaft im Hausevon Lord Crandle beim Glücksspiel gehörig schröpfenlassen, und zwar von einem Zockerfreund des Hausherrn.Er hatte dreitausend Pfund verloren, dazu seine Kutscheund nicht nur ein Familienerbstück, sondern gleich zwei.Er war so sturzbetrunken gewesen, dass er sich nicht ein-mal mehr daran erinnern konnte, bis sich am nächsten
14
15
Tag einer der anderen Gäste seiner erbarmte und ihmalles erzählte.
Percy war am Boden zerstört gewesen, und das aus gu-tem Grund. Das Geld und die Kutsche zu verlieren ge-schah ihm nur recht; warum ließ er sich auch so leichtübertölpeln? Mit den beiden Ringen war es jedoch etwasganz anderes. Der eine war so alt, dass er seiner Familieals Siegelring diente, und der andere, wegen seiner Edel-steine sehr wertvoll, befand sich schon in der fünftenGeneration im Besitz von Percys Familie. Percy hätte imTraum nicht daran gedacht, die Stücke beim Spiel alsEinsatz zu verwenden. Er musste gezwungen, angesta-chelt oder auf andere Weise dazu verleitet worden sein,sie in den Topf zu werfen.
Das Ganze gehörte nun Lord John Heddings, und Per-cy war außer sich gewesen, als Heddings sich weigerte,ihm die Ringe wieder zu verkaufen. Geld brauchte derLord nicht, die Kutsche ebenso wenig. Die Ringe muss-ten jedoch wahre Trophäen für ihn gewesen sein, einZeugnis seines Geschicks beim Glücksspiel. Oder viel-mehr seines Geschicks beim Betrügen, doch das konnteJeremy kaum beweisen; er war ja nicht dabei gewesen.
Hätte Heddings auch nur einen Funken Anstand imLeib gehabt, so hätte er Percy ins Bett geschickt, anstattihn weiter zum Trinken aufzufordern und zuzulassen, dasser die Ringe einsetzte. Zumindest hätte er Percy dieRinge später zurückkaufen lassen. Percy war sogar bereitgewesen, mehr als ihren eigentlichen Wert zu bezahlen;arm war er schließlich nicht, da er nach dem Tod seinesVaters bereits sein Erbe erhalten hatte.
Doch Heddings scherte sich nicht um Anstand. Viel-mehr war er über Percys Beharrlichkeit verärgert gewesen
und zuletzt wirklich unangenehm geworden – wenn Percyihn nicht bald in Ruhe lasse, werde er körperlichen Scha-den nehmen. Das hatte Jeremy so aufgebracht, dass erdiese Alternative vorgeschlagen hatte. Immerhin war Per-cy überzeugt davon, dass seine Mutter ihn enterben würde,wenn sie von der Sache erfuhr, und so hatte er es seit je-nem Vorfall vermieden, ihr zu begegnen, damit sie nichtmerkte, dass die beiden Ringe an seinen Fingern fehlten.
Seit sie sich vor zwei Stunden in ihr Zimmer über derSchänke zurückgezogen hatten, waren bereits drei Schur-ken erschienen, die versucht hatten, sie auszurauben.Alle waren jedoch Stümper gewesen, und nach dem Letz-ten der drei wollte Percy schon die Hoffnung aufgeben,dass sie einen Dieb für ihren Plan finden würden. Jeremywar zuversichtlicher. Drei Versuche in so kurzer Zeit be-deuteten, dass im Laufe der Nacht noch weitere folgenwürden.
Erneut öffnete sich die Tür. Im Zimmer brannte keinLicht, ebenso wenig wie draußen im Korridor. Wenn die-ser neue Dieb irgendetwas taugte, würde er auch keinesbrauchen, denn er hätte lange genug gewartet, um seineAugen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Schritte, ein we-nig zu laut. Ein Streichholz flammte auf.
Jeremy seufzte und erhob sich behände von dem Stuhlneben der Tür, wo er Wache hielt. Dabei machte er we-niger Geräusche als der Dieb beim Betreten des Raumes.Plötzlich tauchte er vor der Nase des Gauners auf, einHüne von einem Mann, nun ja, zumindest im Vergleichzu dem kleinen Halunken. Aber auf jeden Fall war ergroß genug, um dem Gassenjungen einen Heidenschreckeinzujagen, sodass er Hals über Kopf auf dem gleichenWeg verschwand, auf dem er gekommen war.
16
17
Jeremy knallte die Tür hinter dem Jungen zu. Er gabnicht auf; schließlich war die Nacht noch jung, und dieDiebe waren noch nicht verzweifelt. Wenn es sein muss-te, würde er einfach einen von ihnen festhalten, bis sieihm ihren besten Mann brachten.
Percy dagegen kapitulierte. Er saß auf dem Bett undlehnte sich mit dem Rücken an die Wand – beim bloßenGedanken daran, unter diese Decken zu kriechen, hatteer sich geschüttelt. Jeremy hatte jedoch darauf bestan-den, dass er sich hinlegte, um zumindest den Eindruck zuerwecken, er schliefe. »Es muss doch einen einfacherenWeg geben, einen Dieb anzuheuern«, beklagte er sich.»Gibt es kein Büro, das welche vermittelt?«
Jeremy musste sich das Lachen verbeißen. »Geduld,alter Junge. Ich habe dich gewarnt, es würde die ganzeNacht dauern.«
»Ich hätte es doch deinem Vater stecken sollen«, brum-melte Percy.
»Was hast du gesagt?«»Nichts, mein Lieber, gar nichts.«Jeremy schüttelte den Kopf, sagte aber nichts mehr.
Man konnte es Percy nicht verübeln, dass er sich fragte,ob Jeremy tatsächlich allein mit diesem Schlamasselfertig werden konnte. Immerhin war er neun Jahre jün-ger als Percy, und da dieser so ein Wirrkopf war undkein Geheimnis für sich behalten konnte, hatte ihm nie-mand erzählt, wie Jeremy in Wirklichkeit aufgewachsenwar.
Der Tatsache, dass er während der ersten sechzehnJahre seines Lebens in einer Schänke gelebt und gearbei-tet hatte, verdankte Jeremy einige überraschende Fähig-keiten. Er konnte solche Mengen von Hochprozentigem
vertragen, dass er seine Freunde unter den Tisch trank,bis sie vollkommen hinüber waren, während er selbstvergleichsweise nüchtern blieb. Bei Prügeleien konnteer, wenn es sein musste, ziemlich heimtückisch werden.Und er hatte einen scharfen Blick dafür, ob eine Dro-hung ernst gemeint oder bloß heiße Luft war.
Seine unkonventionelle Erziehung war freilich nichtdamit beendet gewesen, dass sein Vater von seiner Exis-tenz erfuhr und ihn bei sich aufnahm. Nein, damals warJames Malory noch immer von seiner großen Familie ent-fremdet und führte in der Karibik das sorglose Leben ei-nes Piraten oder eines »Gentleman-Piraten«, wie er sichlieber nannte. James’ bunt zusammengewürfelte Mann-schaft hatte sich Jeremys angenommen und ihm weitereDinge beigebracht, von denen ein Junge in seinem Altereigentlich nichts wissen sollte.
Von alledem hatte Percy keine Ahnung. Er hatte stetsnur das Oberflächliche zu Gesicht bekommen, dencharmanten Lausbuben, der heute, mit fünfundzwanzig,nicht mehr so lausbübisch, aber immer noch charmantwar und so gut aussah, dass er keinen Raum betretenkonnte, ohne dass sämtliche anwesenden Damen sichein kleines bisschen in ihn verliebten. Abgesehen vonden Frauen in seiner eigenen Familie, die ihn lediglichvergötterten.
Jeremy sah seinem Onkel Anthony ähnlich, und jeder,der ihm zum ersten Mal begegnete und beide kannte,hätte geschworen, dass er eher Tonys als James’ Sohnwar. Wie sein Onkel war Jeremy groß und breitschultrigund hatte eine schlanke Taille, schmale Hüften undlange Beine. Beiden gemeinsam waren zudem ein breiterMund und ein ausgeprägtes, arrogantes Kinn sowie eine
18
19
stolze Hakennase, ein dunkler Teint und dichtes pech-schwarzes Haar.
Das Eindrucksvollste an Jeremy war jedoch ein Augen-paar, wie es nur wenige Malorys hatten: strahlend blauunter schweren Lidern, leicht schräg gestellt, was ihm ei-nen Hauch von Exotik verlieh, eingerahmt von schwar-zen Wimpern und markanten Brauen. Zigeuneraugen,wurde immer wieder gemunkelt, geerbt von seiner Ur-großmutter Anastasia Stephanoff, in deren Adern, wiedie Familie erst im vergangenen Jahr herausgefundenhatte, tatsächlich zur Hälfte Zigeunerblut geflossen war.Christopher Malory, der Erste Marquis von Haverston,war so hingerissen von ihr gewesen, dass er sie bereits amzweiten Tag ihrer Bekanntschaft geheiratet hatte. Außerder Familie würde jedoch niemals jemand von dieser Sa-che erfahren.
Es war verständlich, warum Percy lieber Jeremys Vatereingeweiht hätte. War nicht sein bester Freund Derekstets schnurstracks zu James marschiert, wenn er Prob-leme der pikanteren Sorte hatte? Percy ahnte zwar nichtsvon James’ Zeit als Pirat, doch wer hätte nicht gewusst,dass James Malory zu den berüchtigtsten WüstlingenLondons gezählt hatte, bevor er zur See gefahren war,und dass damals wie heute kaum einer es wagte, ihm dieStirn zu bieten, ob im Boxring oder auf dem Duellplatz?
Percy war wieder aufs Bett gesunken, um den Schla-fenden zu mimen. Nachdem er sich brummelnd eineWeile hin- und hergeworfen hatte, verhielt er sich größ-tenteils ruhig, während sie auf den nächsten Eindring-ling warteten.
Jeremy überlegte, ob er Percy sagen sollte, dass dieseAngelegenheit so bald nicht geregelt würde, wenn er sei-
nen Vater hinzuzöge. James Malory war nämlich nur ei-nen Tag, nachdem er Jeremy ein neues Stadthaus ge-schenkt hatte, eilends zu seinem Bruder Jason nach Ha-verston gereist. Jeremy war sich ziemlich sicher, dass seinVater sich nur deshalb für ein, zwei Wochen aufs Landbegeben hatte, weil er fürchtete, dass Jeremy ihn sonstzum Möbelkaufen mitschleifen würde.
Beinahe wäre Jeremy entgangen, dass sich ein Schat-ten durch den Raum zum Bett hinüberstahl. Diesmalhatte er weder das Öffnen noch das Schließen der Türbemerkt; keinen Mucks hatte er gehört. Wenn die Be-wohner dieses Zimmers tatsächlich geschlafen hätten,wie ja anzunehmen war, wären sie durch diesen Ein-dringling sicherlich nicht aufgewacht.
Jeremy lächelte in sich hinein, bevor er ein Streich-holz anzündete und damit über die Kerze auf dem Tischstrich, den er neben seinen Stuhl gestellt hatte. Augen-blicklich starrte der Dieb ihn an. Jeremy hatte sich an-sonsten nicht gerührt und saß ganz entspannt an seinemPlatz. Der Dieb hatte ja keine Ahnung, wie schnell ersich im Notfall bewegen konnte, um ein Entkommen desHalunken zu verhindern. Dieser machte jedoch keiner-lei Anstalten zu fliehen; er war so überrascht, weil manihn erwischt hatte, dass er wie angewurzelt stehen blieb.
»Na, so was.« Percy hob den Kopf. »Haben wir end-lich Glück?«
»Ich würde sagen, ja«, erwiderte Jeremy. »Habe ihnüberhaupt nicht gehört. Das ist unser Mann oder unserJunge, je nachdem.«
Allmählich erholte sich der Dieb von seinem Erstau-nen, und was er hörte, schien ihm nicht sonderlich zu ge-fallen, wenn man danach ging, wie misstrauisch plötz-
20
21
lich die Augen zusammenkniff. Jeremy ging jedoch nichtweiter darauf ein, sondern hielt zunächst danach Aus-schau, ob der Dieb eine Waffe trug. Er konnte keine ent-decken. Seine eigenen Waffen hatte Jeremy natürlich inden Jackentaschen verborgen, auf jeder Seite eine Pis-tole; dass er bei dem Dieb keine sah, bedeutete alsonicht, dass er wirklich keine hatte.
Der Bursche war viel größer als die anderen Schurken,die versucht hatten, sie auszurauben. Er war ein richtigerSchlaks, aber seinen glatten Wangen nach zu urteilennicht älter als fünfzehn oder sechzehn. AschblondesHaar, so hell, dass es mehr weiß als blond schimmerte,mit kurz geschnittenen Naturlocken. Ein verbeulterHut, der seit ein paar Jahrhunderten aus der Mode war.Der dunkelgrüne Samtrock eines Gentleman war zwei-fellos gestohlen und sah so schmuddelig aus, als hätte derJunge oft darin geschlafen. Darunter lugten ein ehemalsweißes Hemd mit Rüschen am Hals und schwarze Hosenmit langen Beinen hervor. Schuhe trug der Burschekeine. Ganz schön gewieft – kein Wunder, dass er bislangkein Geräusch verursacht hatte.
Für einen Dieb war er ziemlich auffällig, doch das lagvermutlich daran, dass er ein so gut aussehender Jungewar. Und er hatte sich eindeutig von seiner Überra-schung erholt. Jeremy wusste auf die Sekunde genau,wann er losstürzen würde, sodass er vor dem Burschen ander Tür war und sich mit verschränkten Armen dagegenlehnte.
Lässig lächelte er den Jungen an. »Du willst dochnicht etwa schon gehen, mein Lieber? Du hast unserenVorschlag noch nicht gehört.«
Dem Dieb blieb erneut der Mund offen stehen. Das
mochte an Jeremys Lächeln liegen, wahrscheinlicheraber daran, wie schnell dieser als Erster an der Tür gewe-sen war. Diesmal fiel das sogar Percy auf, der sich be-klagte: »Verflucht, er gafft dich an wie sonst die Weiber.Wir brauchen einen Mann und kein Kind!«
»Das Alter spielt keine Rolle, mein Bester«, entgeg-nete Jeremy. »Auf Geschicklichkeit kommt es an; inwelcher Verpackung diese steckt, ist kaum von Belang.«
Nun errötete der Junge, der offenbar beleidigt war, undmit einem finsteren Blick zu Percy hinüber sprach er zumersten Mal. »Hab noch nie so einen hübschen Lackaffengesehen, das ist alles.«
Beim Wort »hübsch« musste Percy lachen; Jeremy da-gegen fand das gar nicht komisch. Der Letzte, der ihnhübsch genannt hatte, war dafür ein paar Zähne losge-worden.
»Das musst du gerade sagen; du siehst doch aus wie einMädchen«, konterte er.
»Ja, das tut er wirklich«, pflichtete Percy ihm bei. »Dusolltest dir ein paar Haare auf den Wangen wachsen las-sen, zumindest bis deine Stimme ein, zwei Oktaven tie-fer wird.«
Wieder wurde der Junge rot und brummelte undeut-lich: »Da kommt halt nichts – noch nicht. Bin erst fünf-zehn, glaub ich jedenfalls. Nur groß für mein Alter.«
Jeremy hätte vielleicht Mitleid für den Jungen emp-funden, denn sein »glaub ich jedenfalls« deutete daraufhin, dass er nicht wusste, in welchem Jahr er geborenwar. Das war in der Regel bei Waisenkindern der Fall.Doch noch zwei andere Dinge waren ihm gleichzeitigaufgefallen. Die Stimme des Jungen hatte zunächst hellgeklungen und war dann in eine tiefere Tonlage gekippt,
22
23
als steckte er gerade in der peinlichen Phase des Stimm-bruchs. Jeremy glaubte allerdings nicht, dass die Stimmevon allein nach unten gerutscht war; dazu hatte derWechsel zu künstlich geklungen.
Das Zweite, das ihm bei näherem Hinsehen auffiel,war, dass der Bursche nicht nur gut aussah, sondern eineechte Schönheit war. Das Gleiche hätte man nun auchüber Jeremy sagen können, als er in diesem Alter gewe-sen war, nur dass er dabei männlich gewirkt hatte, dieserJunge dagegen eindeutig mädchenhafte Züge trug. Diezarten Wangen, die üppigen Lippen, das kecke Näs-chen – und noch einiges mehr. Das Kinn war zu schwachausgeprägt, der Hals zu schlank, sogar die Körperhaltungwar allzu verräterisch, zumindest für einen Mann, der dieFrauen so gut kannte wie Jeremy.
Dennoch hätte Jeremy womöglich nicht seine Schlüssedaraus gezogen, zumindest nicht sofort, wenn sich nichtseine Stiefmutter ebenso verkleidet hätte, als sie seinemVater zum ersten Mal begegnet war. Sie hatte unbedingtnach Amerika zurückkehren wollen, und die einzige Mög-lichkeit dazu schien damals zu sein, sich als James’ Kabi-nenjunge zu verdingen. Natürlich hatte James von An-fang an gewusst, dass sie kein Junge war, und so wie er eserzählte, hatte er einen Heidenspaß daran gehabt, zumSchein auf ihr Spiel einzugehen.
In diesem Fall konnte Jeremy sich jedoch auch täu-schen; das war zumindest nicht völlig auszuschließen.Andererseits irrte er sich selten, wenn es um Frauenging.
Nun, es bestand keine Veranlassung, die Kleine bloß-zustellen. Welchen Grund sie auch immer hatte, ihr Ge-schlecht zu verbergen, es ging nur sie etwas an. Jeremy
UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE
Johanna Lindsey
Zärtlicher RäuberRoman
Taschenbuch, Broschur, 448 Seiten, 12,0 x 18,7 cmISBN: 978-3-453-49013-0
Heyne
Erscheinungstermin: Mai 2006
Die hübsche Danny hat ihr ganzes Leben als gerissene Taschendiebin in den dunkelsten EckenLondons verbracht. Als sie gemeinsam mit dem attraktiven Edelmann Jeremy Malory denperfekten Coup landet, verliebt sie sich sofort in ihn.