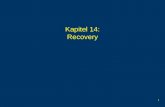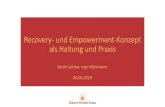Das Recovery-Konzept
-
Upload
michael-schulz -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Das Recovery-Konzept

25
D „Schon wieder so ein englischer Begriff “ – so möchte man ausru-
fen. „Brauchen wir den denn wirklich?“ Dabei treffen wir auch hier wieder auf ein Problem, das wir häufig bei Anglizismen haben: Es gelingt oft nicht wirklich, ein deutsches Wort zu finden, das mit dem englischen Begriff inhaltlich deckungs-gleich ist. Im Wörterbuch stehen zu Recovery etwa die folgenden Überset-zungen: Erholung, Besserung, Genesung, Gesundung, Bergung, Rettung oder auch Wieder finden.
Recovery in der Psychiatrie meint aber mehr und steht für eine gewandelte Blick-weise auf den Patienten. Betroffene neh-men in dem Recovery-Konzept eine bedeutende, eine aktive Rolle ein. Reco-very meint die Entwicklung des Patienten aus einer beschränkten Patientenrolle heraus, hin zu einem selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben.
Der Patient als ExperteMenschen, die mit einer schweren psy-chischen Krankheit leben, wissen meist, dass wesentliche Ressourcen zur Über-windung der Krankheit beziehungsweise zu einem erfüllten Leben mit der Krank-heit in ihrer eigenen Person zu suchen sind. Das Hilfesystem kann nur eine stüt-zende Funktion übernehmen. Der Exper-te ist der Patient. Die Recovery-Bewe-gung möchte die Stimme der Betroffenen stärken und den Helfenden verdeutlichen, wie wichtig es ist, das subjektive Erleben der Patienten zu berücksichtigen. Dieser Richtungswechsel hat vor allem in der Schizophrenie weit reichende Folgen. Bisher galt Schizophrenie als unheilbar,
Das Recovery-KonzeptPsychische Krankheiten sind heilbar E Die Anhänger des Recovery-Konzeptes gehen davon aus, dass psychische Erkrankungen heilbar sind. Daher beschäftigt dieser Begriff seit einiger Zeit die deutsche psychiatrische Fachöffentlichkeit und folgt damit einer inter-nationalen Entwicklung. Doch: Was verbirgt sich hinter „Recovery“?
einhergehend mit einer fortschreitenden Verschlechterung und der weit verbrei-teten Meinung, dass eine Unterbringung der Betroffenen in Kliniken, Wohnhei-men oder anderen Betreuungsformen unausweichlich und für die Patienten das Beste sei. Dieser Mythos der Unheilbar-keit hält sich bis heute, obwohl es dafür keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Aber wie konnte so ein Mythos über-haupt entstehen?
Grund dafür dürfte der beschränkte Blickwinkel berühmter Psychiater des vergangenen Jahrhunderts sein, die an großen psychiatrischen Anstalten be-schäftigt waren und dort vornehmlich die Patienten beobachten konnten, deren Krankheitsverläufe besonders schwer waren und die keinen Platz in der Gesell-schaft mehr hatten. Das diese Form der Krankheitsentwicklung aber nur bei einem kleinen Teil der Patienten zu beob-achten ist, blieb lange Zeit unerkannt. Bis heute stellt die Diagnose Schizophrenie für die betroffenen Patienten und deren Angehörige in den meisten Fällen einen Schock dar. Hoffnungslosigkeit, Einsam-keit, Scham und gebrochene Biografien sind häufig die Folge. Der nicht begrün-dete und damit falsche Unheilbarkeits-mythos untergräbt so die Kräfte, die für die Gesundheit arbeiten.
Dem Leben Sinn gebenDer Recovery-Ansatz verfolgt das Ziel, dass der betroffene Mensch ein sinn-erfülltes und nicht notwendigerweise ein symptomfreies Leben führt. In diesem Zusammenhang kommt neben medika-mentösen Therapien den nichtmedika-Fo
tos:
Fot
olia
.com
/Elis
abet
h Ra
wal
d; P
hoto
case
; Fot
olia
.com
/Kar
sten
Sar
etz;
pho
toca
se/B
etty
80D
OI:
10.1
007/
s005
8-00
9-06
54-y
Es gibt immer mehr Menschen, die an
psychischen Erkran-kungen oder psy-
chischen Phäno-menen leiden. Das
spüren nicht nur die Mitarbeiter psychiat-
rischer Einrich-tungen. Diese Ent-
wicklung beeinflusst auch den Umgang mit betroffenenen Patienten in soma-
tischen Kranken-häusern oder
ambulanten Pflege-diensten, die wegen
anderer Grunder-krankungen behan-
delt werden bezie-hungsweise den Um-gang mit Bewohnern
in Altenpflegeein-richtungen.
Themen: 1. Depression2. Sucht3. Suizid4. Aggression und Gewalt 5. Compliance 6. Recovery
P S YC H I S C H E P H Ä N O M E N E T E I L 6 PFLEGE PRAXIS
4 P S YC H I S C H E P H Ä N O M E N E4 Teil 6
6 | 2009 Heilberufe

26
mentösen Behandlungsmöglichkeiten eine bedeutende Rolle zu. Die Reco-very-Bewegung geht davon aus, dass es niemals möglich ist, genaue Prognosen über den weiteren Verlauf einer Erkran-kung anzustellen und auch bei schweren Verläufen eine Heilung immer möglich sein kann. Ein Ansatz der Recovery-Forschung ist es, Krankheitsverläufe zu untersuchen und zu klären, was dem Menschen geholfen hat, die Krankheit zu überwinden beziehungsweise die Lebensqualität zu steigern.
Bedeutung für die PraxisHandelt es sich bei dem Konzept also um eine, wenngleich interessante, für den Alltag aber relativ unbeutende Diskussion unter Wissenschaftlern und Betroffenen-verbänden? Oder geht mit dem Ansatz von Recovery auch eine Veränderung der pflegerischen Praxis einher?
Für Pflegende, egal ob sie in der häus-lichen Pflege, auf einer internistischen Station oder in einer stationären psychi-atrischen Einrichtung arbeiten, ergeben sich durch die hier nur kurz umrissenen Inhalte im Kontakt mit psychisch kran-ken Menschen deutliche Veränderungen. Zu den wesentlichen Aspekten gehört, dass es vor allem Aufgabe der Pflege ist, die Hoffnung auf Gesundung nicht auf-zugeben. Gerade wenn es Betroffenen und Angehörigen nicht mehr gelingt, an eine Besserung zu glauben, ist es von großer Bedeutung, dass die Pflege stell-
vertretend für sie Hoffnung trägt. Gleich-zeitig gilt es, dem subjektiven Erleben der Betroffenen deutlich mehr Beachtung zu schenken. Das bedeutet im Alltag zum Beispiel, dass wir uns nicht nur dafür interessieren, welche Nebenwirkungen der Patient in der Folge von Medikamen-teneinnahmen hat, sondern auch, welche er mehr und welche er als weniger belas-tend empfindet. Und: Wir lassen die Betroffenen definieren, was für sie Ge-sundheit und Lebensqualität bedeutet. So legen nicht wir als Professionelle fest, dass Gesundung für einen Menschen bedeutet, dass er wieder als Lehrer arbeiten kann. Vielleicht hat die betroffene Person ja eher das Ziel, sich aus dem belastenden Schul-dienst herauszuziehen und so überfor-dernde und krankmachende Situationen zu verhindern?
Gefragt ist also eine kooperative Zusam-menarbeit zwischen Professionellen und Betroffenen mit dem Ziel, ein Arbeits-bündnis zu schließen und Wege zu finden, wie man die Selbstpflegefähigkeit und die Verantwortung der Betroffenen stärken kann. Unsere wichtigste Aufgabe als Pfle-gende ist es also, Hoffnung auf Besserung und Genesung zu erhalten („Holder of Hope“) und die psychische Widerstands-kraft der Patienten zu stärken.
Welche Techniken helfen uns?Es gibt Techniken, die uns bei der Erreichung dieses Ziels helfen. Wichtig ist zunächst einmal, dass wir als Per-son spürbar sind und uns nicht hinter unserer Rolle verschanzen und nach Möglichkeiten der Abgrenzung suchen. Zudem sollten wir unsere eigenen psy-chischen Beeinträchtigungen reflektie-ren und somit Ähnlichkeiten zwischen uns und dem Betroffenen erkennen. Innerhalb des Teams sollten psychische Krisen kein Tabu sein. Im Kontakt mit dem Betroffenen ist es notwendig, wirk-lich mitfühlende Begegnung zuzulassen. Dazu gehört, dass wir uns nicht nur für die Symptome des Patienten, sondern auch für sein Leben interessieren.
„Recovery“, so der Berliner Arzt und Gesundheitswissenschaftler Stefan Wein-
PFLEGE PRAXIS P S YC H I S C H E P H Ä N O M E N E T E I L 6
mann, „ist nur erreichbar, wenn Reco-very als möglich erachtet wird – mit oder ohne Medikamente“.
Erfahrungen Erkrankter nutzenAuch auf der strukturellen Ebene können Elemente in unsere tägliche Arbeit ein-gebaut werden, die eine stärkere Berück-sichtigung des Recovery-Konzeptes zulassen. Dazu gehört zum Beispiel die Einführung von Behandlungsvereinba-rungen, in denen Betroffene bereits in gesunden Phasen festlegen können, wie sie behandelt werden möchten. Eine wei-tere Möglichkeit ist, psychoseerfahrene Personen in die Versorgung einzubezie-hen. Im englischsprachigen Raum hat man bereits mehr Erfahrung mit diesem Konzept, in Deutschland erleben wir jetzt erste Ansätze zu dem so genann-ten „Ex-In – Experienced Involvement“. Dieser Ansatz geht davon aus, dass Men-schen, die psychische Krisen durchlebt haben, über einen reichen Schatz an Erfahrungen verfügen und so zu einem erweiterten Verständnis psychischer Erkrankung sowie genesungsfördernder Faktoren beitragen können. Im Rahmen eines solchen Projektes in Bremen erklär-te eine Person, die selbst bereits in der Klinik aufgrund einer psychotischen Epi-sode behandelt wurde, Gesundheits- und Krankenpflegeschülern, welche wahn-haften Erlebnisse sie auf dem Klinikge-lände hatte und was bestimmte Gegen-stände auf dem Klinikgelände in ihrer kranken Phase für sie bedeutet haben. Das ist nur ein Beispiel, wie es gelingen kann, Verständnis der Professionellen für die subjektive Seite der Erkrankung zu gewinnen und die Lebenswelt der Betrof-fenen zu stärken. z
E Dr. rer. medic. Michael SchulzE Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie in BethelRemterweg 69/71, 33617 Bielefeld
E Email: [email protected]
Heilberufe 6 | 2009
Recovery – Das Ende der Unheilbarkeit Psychiatrie-Verlag Bonn, 2007ISBN 978-3-88414-421-324,90 €
4 BUCH-TIPP!