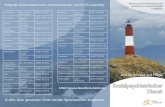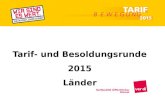Dienst und Leistung
-
Upload
christoph-schneider -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of Dienst und Leistung
Unternehmen haben Ziele undLeitbilder. Für den eingetra-genen Verein „DFG“ formu-
liert Paragraph 1 Satz 1 der Satzungbeides zugleich: „Die Deutsche Forschungsgemeinschaft dient derWissenschaft in allen ihren Zweigendurch die finanzielle Unterstützungvon Forschungsaufgaben und durchdie Förderung der Zusammenarbeitunter den Forschern.“ In einem an-deren Paragraphen steht, dass dasPräsidium „verantwortlich für dieFührung der laufenden Geschäfte“ist und sich zu deren Erledigung derGeschäftsstelle „bedient“. Mit an-deren Worten, das Kollegialorganbestimmt die Richtung und hat dieVerantwortung, und die Adminis-tration führt aus. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist eineSelbstverwaltungsorganisation, unddie Verwaltung dient der Wissen-schaft.
In diesen wenigen Bestimmun-gen sind die wichtigsten Prämissenfür die Arbeit der Geschäftsstellezusammengefasst. Was für die DFGzutrifft, gilt auch für die Geschäfts-stelle; denn sie ist es in aller Regel,die für die DFG handelt.
Ganz zu Anfang: Die DFG isteine Dienstleistungsorganisation.Die „finanzielle Unterstützung“ istfür „Forschungsaufgaben“ be-stimmt, die nicht die DFG festlegt,sondern die beteiligten Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaftlerfür sich selbst. Also Anträge, nichtAufträge. In der Geschäftsstelleder DFG lernt man dadurch rasch,dass erkenntnisorientierte For-schung und nutzenorientierte For-schung keine Gegensätze, sondernkomplementäre Aspekte der einenWissenschaft sind und dass allerhetorischen Konstruktionen sol-chen Gegensatzes („curiosity dri-ven“ oder gar „blue skies“), wieder forschungspolitische Utilita-rismus sie in Serie produziert, hohlund falsch sind. Es ist gut, das bei-zeiten zu lernen.
Die Dienstleistung besteht nichtnur in der Bereitstellung der Mittel,sondern auch – und heutzutage vorallem – in der sachgerechten Aus-wahl ihrer Empfänger im Wettbe-werb. Adressat ist die „Wissen-schaft in allen ihren Zweigen“. Dasverpflichtet die Geschäftsstelle zur
Gewährleistung fairer Wettbe-werbsbedingungen für alle Diszipli-nen und Arbeitsfelder und zur Aus-wahl der unterstützten Projektenach den jeweils geeigneten Quali-tätskriterien.
Der Wettbewerb ist in den ver-gangenen Jahrzehnten sehr vielhärter geworden. Vor 30, auch wohlnoch vor 20 Jahren, verschickte dieDFG einige hundert Ablehnungenpro Jahr. Heute sind es viele tau-send. Beim wichtigsten Förderin-strument, der Projektförderung imNormalverfahren („Sachbeihilfe“),hatte 2003 und 2004 erstmals weni-ger als die Hälfte aller Anträge Er-folg. Von Januar bis Oktober 2005waren es 50,1 Prozent. Das machtFairness besonders wichtig. Zujedem Antrag sucht die Geschäfts-stelle im ersten Arbeitsgang Gut-achter, die dem Projekt und dendaran Beteiligten in ihrer wissen-schaftlichen Individualität gerechtwerden können und wollen. Siesucht sie in Deutschland wie – inden letzten Jahren immer öfter – imAusland. Können fordert Kompe-tenz und Neutralität, Wollen fordertVerfügbarkeit und Motivation. Dasalles schreibt sich rasch, aber in dertäglichen Arbeit ist nichts davon tri-vial. Es fordert in der Geschäftsstel-le nicht nur kognitive Fähigkeiten(die Projekte verstehen, ein Urteilfällen, die Beteiligten und die Gut-achter kennen) und administrativeKompetenz, sondern auch Überzeu-gungskraft, Ausdauer und Lernbe-reitschaft, sein Urteil zu revidieren.
Im Entscheidungsprozess, dersich auf die Gutachten stützt, sinddie wichtigsten Partner der Ge-schäftsstelle die Fachkollegien undder Hauptausschuss sowie seineAusschüsse für Sonderforschungs-bereiche und Graduiertenkollegs.Die Fachkollegien sind nach derSatzung für die Qualität der Bewer-tung aller Anträge verantwortlich.Sie sichern die Qualität des Begut-achtungsprozesses, und sie leitenaus den Gutachten Entscheidungs-vorschläge zur Förderung ab. Inaller Regel entwirft die Geschäfts-stelle diese, wie sie überhaupt dengesamten Weg eines Vorhabens sozu begleiten hat, als läge die Ver-antwortung allein bei ihr. Dass dieVerantwortung letztlich bei Kollegi-
alorganen des Vereins DFG liegt,mindert weder die Bedeutung derArbeit der Geschäftsstelle für dasErgebnis noch die dafür erforder-liche Qualifikation. (Wer fragt,warum eine solche Aussage aufge-schrieben werden muss, fragt mitRecht. Aber es war ein Rechnungs-hof, der das Argument gebrauchte,die Mitarbeiter der Deutschen For-schungsgemeinschaft entschiedenja nicht selbst; ergo würden sie zuhoch eingestuft.)
Im November 2005 haben Mit-glieder von Präsidium und Senatmit den Sprechern der Ende 2003gewählten Fachkollegien gemein-sam getagt. „Wege zu einer bestpractice“ standen auf der Tages-ordnung. Vorbehalte gegen denGrundsatz der Auswahl der Gut-achter durch die Geschäftsstelle,wie sie in der Vorbereitung der Sat-zungsreform geäußert worden sind,wurden nicht mehr laut. Für dieFachkollegien war der Konsenswichtig, dass der auf die Gutachtengestützte Vergleich größerer Kohor-
2
forschung 3-4/2005
Der Kommentar
3
ten von Anträgen mit dem Ziel derAuswahl der besten nur gemein-sam, in Rede und Gegenrede undauf der Grundlage homogener In-formation gelingen kann.
Der Wettbewerb um die „finan-zielle Unterstützung“ der DFG istnicht nur intensiver geworden.Auch der Kreis der Teilnehmer hatsich erweitert. Zu den Wissenschaft-lerinnen und Wissenschaftlern alsden Subjekten der Forschung sinddie Universitäten und Forschungs-institute hinzugekommen.
Das erste Förderinstrument, dieSonderforschungsbereiche,das sich an die Universitäten
als Institutionen wandte, hat derWissenschaftsrat für die DFG konzi-piert, damit sie die Universitäten beider Verbesserung ihres wissen-schaftlichen Profils und ihrer Wett-bewerbsfähigkeit unterstützenkönnte. Das war begleitet von derAbsicht, der DFG zu mehr Geld fürdie Universitäten zu verhelfen.
Analog sind die Graduiertenkollegsseit 1990, die Forschungszentrenseit 2000 und nun die Programmeder so genannten Exzellenzinitiati-ve der DFG jeweils mit neuen, zu-sätzlichen Mitteln zugewachsen,die freilich für die neuen Program-me zunächst zweckgebunden sind.Dass der Anteil des Normalverfah-rens am Gesamthaushalt der DFGzurückgegangen ist, beruht nichtauf einer Reduzierung der Mitteldafür, sondern auf neuem Geld fürneue Aufgaben.
Aus der Erweiterung des Kreisesder Teilnehmer am Wettbewerbhaben sich neue Dimensionen derPartnerschaft zwischen der DFG alsFörderer und den Institutionen derWissenschaft ergeben. Deren Pfle-ge und Entwicklung ist eine derwichtigen Aufgaben der AbteilungIII „Programm- und Infrastruktur-förderung“ in der Geschäftsstelle,ähnlich wie die Spannweite in derAbteilung II „Fachliche Angelegen-heiten“ von Einzelvorhaben bis zurEntwicklung ganzer Disziplinen
reichen kann. Mit den Programmender Exzellenzinitiative hat nicht nurder Umfang der Verantwortung,sondern auch die Dichte der Zu-sammenarbeit bei ihrer Wahrneh-mung in der Geschäftsstelle eineneue Dimension erreicht.
Ende 2005 hat die DFG rund 750Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,davon etwas mehr als 175 im so ge-nannten höheren Dienst. Was (ab-gesehen von einer hervorragendenfachlichen Qualifikation) verlangtder Dienst an der Wissenschaft vonihnen? Was können sie – sozusagenals Gegenleistung – von ihm erwar-ten?
Dienst an der Wissenschaft ver-langt in der DFG den Einsatzder ganzen Person, ein wa-
ches Interesse für die Forschungund die Menschen. Er verlangt eineFähigkeit aktiv zuzuhören, die Em-pathie, Diskretion, common senseund unverrückbare Loyalität zurDFG miteinander verbindet – zurDFG als Institution aller Wissen-schaften und aller ihrer Träger inallen Institutionen der Forschung(jedenfalls in Deutschland). Nurwer glaubwürdig allen Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaft-lern unparteiisch als Zuhörer, Rat-geber, Übersetzer und – wo nötig –Tröster zur Verfügung steht, kanndas Vertrauen in die InstitutionDFG (und ihre Geschäftsstelle) be-wahren, auf dem ihre Wirksamkeitberuht. Das Vertrauen von Wissen-schaft und Politik in die DFG ist diewichtigste Gegenleistung für dieQualität ihrer Arbeit. Bund undLänder hätten ihr nicht die Aufgabeanvertraut, in einem Kraftakt ohneVorbild die besten Universitäten inDeutschland für das 21. Jahrhun-dert endlich vorzubereiten, wennsie dieses Vertrauen nicht hätte. Eswill täglich neu erworben sein.
Dr. Christoph Schneider
Christoph Schneider, langjähriger Abtei-lungsleiter „Fachliche Angelegenheiten derForschungsförderung“ in der DFG-Geschäfts-stelle, ist zum 30. November 2005 in den Ru-hestand getreten (siehe auch Seite 38).
Dr. Christoph Schneider
Dienstund Leistung Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstütztdie Wissenschaft „in allen ihren Zweigen“.Das verpflichtet ihre Geschäftsstelle zu fairem Wett-bewerb für alle Disziplinen und zu einer Auswahl derunterstützten Projekte nach Qualität