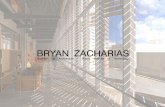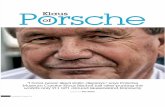Eine zweite Zacharias-Dekretale an Bischof Theodor von Pavia?
Transcript of Eine zweite Zacharias-Dekretale an Bischof Theodor von Pavia?

Miszellen
Eine zweite Zacharias-Dekretale an Bischof Theodor von Pavia?
Codex Verona, Bibl. Capitolare LXIII (61), überliefert ein bislang unediertes Exzerptkapitel aus einem Antwortbrief, das seiner Rubrik zufolge einer Dekretale des Papstes Zacharias an Bi-schof Theodor von Pavia entnommen sein soll (aber nicht aus JE 2306 stammt); es befasst sich mit dem Problem jener verschleierten virgines, die dennoch eine Ehe eingehen. Das Stück, hier nun ediert und analysiert, dürfte echt sein.
Codex Verona, Bibl. Capitolare LXIII (61), transmits an excerptchapter taken from a letter, which - by its rubric - stems apparently from a decretal of Pope Zechariah directed to bishop Theodore of Pavia. This chapter has, however, no relation to JE 2306. The chapter deals with the problems of those veiled virgines who would nevertheless enter into a marriage. This text, which is edited and analyzed in this contribution, should be authentic.
Im Jahr 721 versammelte Papst Gregor II. in Rom eine Synode1), deren Bera-tungsergebnisse sich vor allem als eine Auflistung von Heiratsverboten darstellen: mit den Witwen von Priestern und Diakonen sowie mit Nonnen2), mit Schwäge-rin, Stiefmutter und Schwiegertochter3), mit Nichte und Kusine4) und ganz generell mit einer Frau aus der (definitorisch nicht näher eingegrenzten) eigenen cognatio oder der ehemaligen Ehefrau eines Kognaten5), sowie schließlich mit der Taufpa-
') M i g n e PL 67, Sp. 341-346. Von L o t h a r Voge l , Bayern und Rom im frühen achten Jahrhundert, Über die römischen Synodalakten von 721 und das päpstliche Kapitular von 716 zur Einrichtung einer bayerischen Kirchenprovinz, in: Zeitschrift fur Bayerische Landesgeschichte 63 (2000) S. 357^114, hier S. 359-369, sind diese Synodalakten von 721 letzthin zu einer Fälschung aus der Zeit zwischen 760 und 774 erklärt worden, erarbeitet aus den verlorenen und nur im Liber Pontificalis bezeugten Akten einer Synode von 731 und den erhaltenen Synodalakten von Rom 743, beide unter Gregor III. Vogels Argumente sind eher dünn; und die Rezeption der Ehegesetz-gebung Gregors II. im langobardischen Recht bereits 723 (vgl. dazu unten), aie mit seinen Thesen kaum vereinbar ist, wird von ihm überhaupt nicht angesprochen und ist offenkundig wohl übersehen worden.
2) cc. 1-3, M i g n e PL 67, Sp. 343. - Zum Heiratsverbot für Witwen von Priestern und Diakonen vgl. J o s e p h F r e i s e n , Geschichte des kanonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossenliteratur, Paderborn 21893, S. 747f.; zum Heiratsverbot nach Ab-legung eines Gelübdes oder eines als Keuschheitsversprechen zu deutenden formalen Aktes vgl. ebd. S. 676-696.
3) cc. 5 und 7, M i g n e PL 67, Sp. 343. - Zur Schwägerschaft (aff ini tas) als Ehe-hindernis vgl. F r e i s e n (o.Anm. 2) S.439-449.
4) cc. 6 und 8, M i g n e PL 67, Sp. 343. - Zur Blutsverwandtschaft als Ehehinder-nis vgl. F r e i s e n (o.Anm. 2) S. 371-439.
5) Gemeint gewesen sein dürfte die Verwandtschaft, so weit sie nach römischer Definition reichte, also bis zum sechsten bzw. siebten Grad nach der sog. .römischen'
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

R. Pokorny, Eine zweite Zacharias-Dekretale 299
tin6) - erstmals im lateinischen Westen somit auch bei Vorliegen geistlicher Ver-wandtschaft.
Im Jahr 723 promulgierte im benachbarten Langobardenreich König Liutprand (712-744) eine Novelle zum Edictus Rothari, deren Einleitungskapitel einzelne der römischen Konzilsbestimmungen variiert wieder aufnehmen: ein Heiratsverbot für Frauen, die den Schleier genommen hatten bzw. von ihren Eltern Gott geweiht wor-den waren7), das neue Eheverbot aufgrund geistlicher Verwandtschaft mit der eigenen Taufpatin (und nunmehr auch mit der eigenen Patentochter sowie eines Patenkindes mit einem leiblichen Kind)8) sowie schließlich ein Heiratsverbot mit der Witwe eines Vetters ersten (und nunmehr auch zweiten) Grades9). Zugleich wurde eine ältere Be-stimmung des Edictus Rothari über ein Eheverbot mit Stiefmutter, Stieftochter und cognata10) wieder aufgenommen und das Erbrecht von Kindern aus derartigen Ehen ausgeschlossen11)· Der inhaltliche Zusammenhang mit der neuen römischen Ehege-setzgebung ist allein schon deshalb nicht zu übersehen, weil Liutprand selbst zu sei-nem Eheverbot mit cognata, Stiefmutter und Stieftocher quia et cánones sic habent anmerkt12) und er sein Verbot der Ehe mit der Schwägerin auf eine briefliche Mahnung
Zählweise, mindestens also bis zu Vetter und Cousine zweiten Grades als Ehepartner (drei Gradus/Schritte hinauf bis zu den gemeinsamen Urgroßeltern und drei weitere Schritte wieder hinab bis zum Ehepartner: die sog. 3/3-Ehe der neueren Forschungs-terminologie). Oder maximal eben auch bis zu den 3/4-Ehen (denn die römischrecht-lichen Quellen sind terminologisch selten ganz eindeutig hinsichtlich der Frage, ob der siebte Grad nun inklusiv oder exklusiv gemeint ist). Zur Diskussion, wie Rom (721) in dieser Frage zu verstehen ist, vgl. zuletzt Kar l Ubi , Inzestverbot und Ge-setzgebung, Die Konstruktion eines Verbrechens (300-1100) (= Millenium-Studien 20), Berlin 2008, S.236f.
6) c. 4, M igne PL 67, Sp. 343. - Zur geistlichen Verwandtschaft als Ehehindernis vgl. F re i sen (o. Anm. 2) S. 509-512; Joseph H. Lynch, Godparents and Kinship in Early Medieval Europe, Princeton 1986, hier S. 234—242 zu Gregor II., Liutprand und Zacharias; Ubi , Inzestverbot (o. Anm. 5) S. 236.
7) c. 1, ed. F r i ed r i ch B l u h m e , MGH LL4, 1868, S. 122f.-Als Sanktion wird der Einzug des gesamten Vermögens einer ehemaligen Sanctimonialis zugunsten der Staatskasse festgesetzt; der zustimmende Muntwalt der Frau und der Ehemann ha-ben WergeldzahTungen an den königlichen Fiskus zu leisten, der nicht zustimmende Muntwalt erhält die Hälfte der Wergeldzahlung seitens des Ehemanns (aber keines-wegs etwa auch die Hälfte des eingezogenen Vermögens der Sanctimonialis).
' ) c. 5, MGH LL 4, S. 124. - Entsprechende Ehepaare verlieren ihr Vermögen; eventuell vorhandene Kinder aus derartigen Ehen bleiben von der Erbfolge ausge-schlossen; das Vermögen fällt an die Verwandtschaft (sofern vorhanden), anderenfalls an den königlichen Fiskus.
9) c. 4, MGH LL 4, S. 123f.: relieta de consubrino aut insubrino (wenn denn letz-terer der Vetter zweiten Grades ist). - Wie in c. 5 verlieren entsprechende Ehepaare ihr Vermögen; eventuell vorhandene Kinder aus derartigen Ehen bleiben von der Erb-folge ausgeschlossen; das Vermögen fällt an die Verwandtschaft (sofern vorhanden), andernfalls an den königlichen Fiskus.
,0) Edictus Rothari c. 185, MGH LL 4, S. 44. ") c. 3, MGH LL4, S. 123. Liutprand Bestimmung erweitert das Heiratsverbot des
Edictus Rothari mit Stiefmutter, Stieftochter und cognata (der Begriff dort bezogen nur auf die Ehefrau des verstorbenen Bruders) auch auf die Schwester der Ehefrau. Das Erbe bei Zuwiderhandeln geht nunmehr, anders als noch im Edictus Rothari, an die Verwandtschaft bzw. (bei deren Fehlen) an den königlichen Fiskus. - C. 2 zuvor hatte ein Verbot der Raubehen aus dem im Edictus Rothari folgenden Kapitel (c. 186), MGH LL 4, S. 44, lediglich hinsichtlich der finanziellen Bußleistungen modifiziert.
,2) c. 3, MGH LL4, S. 123,20-21.
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

300 Miszellen
des papa urbis Romae, qui in omni mundo caput ecclesiarum Dei et sacerdotum estl3), zurückführt.
Man würde gerne Detaillierteres wissen über diese auffallig schnelle Rezeption der römischen Konzilsbestimmungen von 721 im Langobardenreich, zumal angesichts der politischen Gegensätze zum Papsttum aufgrund von Liutprands Expansionspoli-tik gegen den verbliebenen byzantinisch-römischen Territorialbesitz in Italien. Doch viel mehr als die königliche Novelle von 723 hat man nicht in Händen: Synodalak-ten, Briefe oder ähnliches sind so gut wie gar nicht überkommen; und auch unter den Adressaten kirchenrechtlicher Responsen und Briefgutachten der Päpste des 8. Jahr-hunderts in die germanischen Königreiche ist das näherliegende Langobardenreich so gut wie gar nicht repräsentiert.
Nur ein einziges Schreiben dieser Art zu Problemen der inneren Christianisierung und der Kirchenorganisation unter Jaffés Regestennummera ist an einen Bischof des Langobardenreiches gerichtet gewesen: die Dekretale JE 2306 Papst Zacharias' (741-752) an Theodor von Pavia, den Bischof der langobardischen Residenzstadt14). Hier geht es in der Tat wie 721 und 723 um Eherechtliches: Theodor hatte Richtlinien er-beten, die Heirat zwischen leiblichen und geistlichen Kindern des gleichen Vaters/ Taufpaten betreffend, sodann zu dem Problem, ob Kinder aus derartigen unerlaubten Ehen juristisch überhaupt als fähig gelten sollten, ihrerseits eine Ehe einzugehen (nach Auskunft des Papstes: ja), und schließlich um die in Rom 721 offengelassene und 723 in Pavia äußerst eng gefasste Definition, bis zu welchem Verwandtschaftsgrad eigent-lich eine cognatio vorliege, die als Ehehindernis zu gelten habe (sibyllinische Ant-wort: soweit wie miteinander als verwandt bekannt). Die Echtheit dieses Schreibens ist verschiedentlich angezweifelt worden, allerdings ohne wirklich durchschlagende Verdachtsgründe15).
13) c. 4, MGH LL 4, S. 124,5-6. 14) Ph i l i pp J a f f é , Regesta Pontificum Romanorum, hg. von Samuel Löwen-
f e l d / F e r d i n a n d K a l t e n b r u n n e r / P a u l Ewa ld , Bd. 1,2Leipzig 1885: JE 2306, ed. Wi lhe lm G u n d l a c h , MGH Epp. 3, 1892, S. 709-711. Vgl. auch Paul F r ido -lin Kehr , Regesta Romanorum pontificum. Italia Pontificia 6/1, Berlin 1913, S. 174 Nr. 3. - Zu Theodor, dessen Pontifikat durch keinerlei urkundliche, erzählende oder epigraphische Quellen näher eingrenzbar ist, vgl. Fede le Sav io , Gli antichi vesco-vi d'Italia, dalle origini al 1300. La Lombardia 2/2, Bergamo 1932, S. 378-381, und Erwin H o f f , Pavia und seine Bischöfe im Mittelalter, Beiträge zur Geschichte der Bischöfe von Pavia unter besonderer Berücksichtigung ihrer politischen Stellung, I. Epoche: Età Imperiale, Von den Anfangen des Bistums bis 1100, Pavia 1943, S. 3f. mitAnm. 41-51 auf S. 11-14.
15) Zur älteren Diskussion vgl. weiterführend Kehr (o. Anm. 14); ohne Vorbehalte als echt eingeschätzt auch bei Ubi , Inzestverbot (o. Anm. 5) S. 255f. Radikale Zwei-fel hat zwischenzeitlich H o f f , Pavia (o. Anm. 14) S. 3f. und S. 11-16 formuliert, in-dem er die Gleichzeitigkeit der Pontifikate des Zacharias (741-752) und Theodors von Pavia in Frage stellte. Er verlegt S. 4 die Sedenzzeit Theodors vielmehr in den Zeitraum etwa der Jahre 770-785 und begründet dies folgendermaßen: Lasse man die Dekretale des Zacharias einmal beiseite, so verbleibe als Quellenbasis nur Theodors überkommene Position in den ältesten Paveser Bischofskatalogen, die ihm einen Pon-tifikat von 15 Jahren zusprechen (Hoff S. 13 Anm. 47), sowie sein Epitaph (zu die-sem vgl. unten). Hingegen lassen die Quellen für Bischof Petrus I., der im Paveser Bi-schofskatalog als der unmittelbare Vorgänger Theodors geführt wird, immerhin vage eine Datierung in die Zeit König Liutprands (712-744) zu (Belege H o f f S. 11 Anm. 41). Hoff setzt den Pontifikat Petrus' I. daher annäherungsweise in den Zeitraum der
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

R. Pokorny, Eine zweite Zacharias-Dekretale 301
Zacharias' Dekretale JE 2306 scheint bemerkenswert spät überliefert: Eine erste Zitation (des Einleitungsabschnittes) findet sich in einem Brief Gunzos von Novara an Atto von Vercelli (924-960)16); für die Gesamtfassung musste die kritische Edition in den Epistolae Langobardicae der MGH von 1892 aber noch auf Mansis Erstdruck nach einem Burchard-Codex17) zurückgreifen. Inzwischen ist der Brief als Zusatztext in fünf Codices des Dekrets Burchards von Worms18) sowie verkürzt auch in zentralen
Jahre 723-733. Auch für Bischof Hieronymus, den unmittelbaren Nachfolger Theo-dors gemäß dem Bischofskatalog, liegt mit den Akten der römischen Synode des Jah-res 769 ein gesichertes Datum vor: Sie sind unterzeichnet von einem Archipresby-ter Theodor und einem Diakon Petrus, durch die Hieronymus sich in Rom hatte ver-treten lassen, ed. Alber t W e r m i n g h o f f , MGH Conc. 2/1, 1906, S. 75,22-23, und Hof f S. 12 Anm. 43. Über die Gesamtdauer des Pontifikats des Hieronymus machen die Bischofskataloge keine Angaben. - Zwischen dem Jahr 769, in dem bereits Hie-ronymus amtierte, und der Zeit König Liutprands wäre also ohne Weiteres Raum für einen fünfzehnjährigen Pontifikat des Theodor, der sich (zumindest partiell) mit dem des Papstes Zacharias überschnitten hätte. Es wirkt daher zunächst ganz unmotiviert, wenn Hoff die überlieferte Namensabfolge der Paveser Bischofslisten für unhaltbar erklärt und den Hieronymus (der immer nach Theodor folgt), mit einem hypothetisch langen Pontifikat (etwa 737-770) direkt auf Petrus I. folgen lässt und vor Theodor einordnet (Hoff S. 11 f. Anm. 43). Hoffs Zweifel an den überkommenen Bischofslis-ten stützen sich auf eine bestimmte Grabinschrift innerhalb einer Reihe abschriftlich aus Pavia überlieferter Epitaphien für Bischöfe des 8. und 9. Jh. (Hoff S. 13f. Anm. 50). Dieser spezielle Epitaph, gedruckt bei Sav io , Antichi vescovi (o.Anm. 14) S. 380f., bzw. von Erns t Dümmle r , MGH Poetae 1, 1881, S. lOlf., ist von einem namentlich nicht genannten Verstorbenen für sich selbst verfasst worden, der sich als Schüler des Bischofs Petrus bezeichnet und der unter König Desiderius (757-774) die Stadt habe verlassen müssen, dem Carolus rex magnus nach langem Exil aber schließlich die Rückkehr ermöglicht habe (also wohl nach 774). Dem Text nach dürf-te er zunächst wohl Archidiakon und dann Bischof von Pavia gewesen sein. Den Ver-storbenen, dem dieser Epitaph gesetzt ist, identifiziert Hoff (durchaus in der Tradition älterer Lokalforschung) mit dem Bischof Theodor, dem Nachfolger des Petrus in den Bischofskatalogen, und folgert auf der Basis dieser Annahme dann konsequent: Wenn Theodor (deijenige, dem dieser Epitaph gesetzt worden war) von Desiderius ins Exil gezwungen worden sei und erst 774 habe zurückkehren können, wenn ihm ein fünf-zehnjähriger Pontifikat zugeschrieben werde und wenn für 769 mit Hieronymus noch ein anderer Bischof von Pavia belegt sei, so könne Theodor nicht der direkte Nachfol-ger seines unter Liutprand amtierenden Vorgängers Petrus gewesen sein. Sein Ponti-fikat sei vielmehr nach dem des Hieronymus anzusetzen. - Hoffs Zirkelschluss liegt auf der Hand: Wäre in dem betreffenden Epitaph der Name ,Theodor' genannt, so wä-ren Hoffs Folgerungen in der Tat unabweisbar. Der Epitaph ist jedoch anonym. Die ältere Forschung hatte den namenlosen, ein hohes Kirchenamt bekleidenden Kleriker aufgrund der betonten Hervorhebung seines Schülerverhältnisses zu Bischof Petrus I. mit dessen Nachfolger Theodor identifiziert. Doch Bischof Petrus I. mag manchen Schüler gehabt haben, nicht unbedingt nur seinen unmittelbaren Amtsnachfolger. Wa-rum sollte es sich z. B. nicht um die Grabinschrift für den nachweislich zur Zeit des Desiderius amtierenden Bischof Hieronymus handeln, den Nachfolger Theodors ge-mäß den Bischofskatalogen?
,6) Migne PL 134, Sp. l l l f . , hier 112 Α-C (nur bis Christo, MGH Epp. 3 S. 711,2); Neuedition durch George A. Wi l lhauck , The Letters of Atto, Bishop of Vercelli: Text, Translation and Commentary, phil. Diss. Tufts University, maschinen-schriftlich 1984, S. 69,10-70,35.
17) Mans i 12, Sp. 354f. Die Textvorlage dürfte der Burchard-Codex aus Lucca ge-wesen sein, zu ihm vgl. Anm. 18.
18) Parma, Bibl. Palatina 3777, s. XI1, fol. 264'-265r; Modena, Bibl. Capitolare O. II. 15, s. XI2, fol. 83v; Lucca, Bibl. Capitolare 124, s. XI4'4, fol. 85va; Pistoia, Archi-
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

302 Miszellen
italienischen Sammlungen der Gregorianischen Reform, bei Ivo von Chartres und bei Gratian nachzuweisen19); zumindest in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts hat er offensichtlich also breit kursiert. Doch die bislang älteste fassbare Gesamtüberliefe-rung des Textes hat man übersehen: Codex Verona, Biblioteca Capitolare LXIII (61) aus dem 10. Jahrhundert20).
Die Veroneser Handschrift enthält kanonistisches Material in einer Kombina-tion ganz eigenen Zuschnitts, zu der sich Parallelüberlieferungen nicht nachweisen lassen21). Der Codex ist in den letzten Jahren für editionsvorbereitende Studien zu verschiedenen Einzeltexten herangezogen worden; zur Gänze analysiert und beschrie-ben ist er noch nicht. Und eine kleine Überraschung birgt er immerhin doch noch:
vio Capitolare del Duomo C 125, s. XII"4, fol. 195'; Vatikan, Barb. lat. 1450, s. XI, fol. 165'.
") Anselm von Lucca, Collectio canonum X 27, ed. F r i ed r i ch Thaner , Ansel-mi episcopi Lucensis Collectio canonum una cum collectione minore 1, Innsbruck 1906, S. 494f. (nur bis Christo, MGH Epp. 3 S. 711,2); Gregor von S.Grisogono, Polycarpus VI 4,29 (unediert), vgl. Uwe Hors t , Die Kanonessammlung Polycarpus des Gregor von S. Grisogono, Quellen und Tendenzen (= MGH Hilfsmittel 5), Mün-chen 1980, S. 226 und 174 (bis?); Bonizo von Sutri, Liber de vita Christiana, IX 75-76, ed. Erns t Pe re i s , Berlin 1930, S. 303 (nur bis serve bone mit weitergeführtem Bibelzitat, MGH Epp. 3 S. 711,13); Ivo von Chartres, Dekret I 307, M i e n e PL 161, Sp. 133f., und Ivo von Chartres, Panormia VI 128, ebd. Sp. 1278 (jeweils nur bis de-viare, MGH Epp. 3 S. 711,9); Gratian, Dekret C. 30 q. 3 c. 2, ed. Emil F r i e d b e r g , Decretum magistri Gratiani (= Corpus iuris canonici 1), Leipzig 1879, Sp. llOOf. (nur bis lucreris, MGH Epp. 3 S. 711,2). Älter (sofern nicht ein Nachtrag) ist wohl die Teilüberlieferung bis Christo (MGH Epp. 3 S. 711,2) als Schlusstext im Codex Flo-renz, Bibl. Medicea Laurenziana, Aedil. 82, s. IX3'4, einer Sonderform der Collectio Vaticana, vgl. A n g e l o Mar ia Band in i , Bibliotheca Leopoldina Laurentiana 1, Florenz 1791, S. 115.
20) Hier fol. 75v-76r. Die Textrezension ist nicht besonders gut und trägt zur Klä-rung an jenen Stellen nichts bei, die sich bei der Rekonstruktion des Archetyps, wie aus MGH Epp. 3 S. 709-711 ersichtlich, als problematisch erweisen.
21) s. X; 98 Blätter; vor und nach fol. 97 Blattverlust; die ersten zwölf und das letz-te Blatt (dieses ursprünglich leer; Federproben) sind partiell weggebrochen bzw. un-leserlich blass oder auch nachgedunkelt; Schriftheimat Oberitalien (?); Bibliotheks-heimat Verona (?). Von Si lv ia March i (Hg.), I Manoscritti della Biblioteca Capi-tolare di Verona. Catalogo descrittivo redatto da don Antonio Spagnolo, Verona 1996, S. 121-124 ist eine sehr kleinteilige, im Zeitraum 1894-1916 erarbeitete Inhaltsüber-sicht über den Codex herausgegeben worden (die an der entscheidenden Stelle fol. 75-76' zu sehr raffend den hier analysierten und edierten Text dann doch unkennt-lich macht); Paul F o u r n i e r / G a b r i e l Le Bras , Histoire des collections canoni-ques en occident depuis les Fausses Décretales jusqu'au Décret de Gratien 1 (= Bib-liothèque d'Histoire du Droit 4—5), Paris 1931, S. 340f. haben in ihrer Kurzübersicht als charakteristische Stücke im Codex lediglich die Epitome einer Kanonessammlung der historischen Ordnung fol. 16'-38v hervorgehoben (zu ihr vgl. Anm. 32) sowie den Kanon einer Mailänder Synode des 8. Jh. fol. 72' (zu ihm vgl. Anm. 33); ansonsten sei der Inhalt der Handschrift ohne Bedeutung. Bei Lo t te Kéry, Canonical Collec-tions of the Early Middle Ages (ca. 400-1140), A Bibliographical Guide to the Ma-nuscripts and Literature (= History of Medieval Canon Law), Washington/D.C. 1999, findet sich S. 191 nur eine sehr nichtssagende 14-Zeilen-Charakterisierung der im Co-dex enthaltenen Sammlung und S. 77 außerdem eine Erwähnung der Hibernensis-Ex-zerptreihe in ihm (zu ihr vgl. Anm. 34). Zur Hs. vgl. auch G iovann i Onga ro , Col-tura e scuola calligrafica veronese del secolo Xo (= Memorie del Reale Istituto Vene-to di Scienze, Lettere ed Arti 29/7), Venedig 1925, S. 23 und 58f., der den Codex dem Scriptorium von Verona in der Mitte des 10. Jh. zuordnet.
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

R. Pokorny, Eine zweite Zacharias-Dekretale 303
einen Auszug aus einem bislang unbekannten zweiten Antwortschreiben des Zacharias an Theodor von Pavia.
Der Text ist im Anhang ediert22); es handelt sich um einen für kanonistische Zwecke offenbar bereits vorbearbeiteten Auszug: Etwas ungeschickt ist zu Beginn Theodors Anfrage, die im päpstlichen Schreiben referiert gewesen sein muss, zu einer Art aus-fuhrlicher Rubrik zusammengefasst23), erst dann folgt im Originalwortlaut die Antwort des Papstes. Inhaltlich geht es um virgines, die ohne Kenntnis bzw. Beteiligung eines Bischofs oder Priesters auf Veranlassung ihrer Eltern oder aus eigenem Entschluss den Schleier genommen, diesen Schleier später aber wieder abgelegt und geheiratet hat-ten. Dies klingt vertraut; es ist das Thema des ersten Kapitels der Novelle Liutprands von 723. Zacharias' Stellungnahme steht auch hier in der Kontinuität päpstlicher und kirchlicher Entscheidungen zu diesem Problem24): Derartiges dürfe nicht geschehen; Theodor möge dagegen predigen und entsprechende Eheschließungen zu verhindern suchen; vor allem aber möge er anmahnen und sicherstellen, dass Selbstverschleie-rungen ohne Beteiligung kirchlicher Amtsträger in Zukunft unterblieben. Sollten die verschleierten virgines sich von der Heirat dennoch nicht abhalten lassen, so sei Ihnen eine strenge Buße aufzuerlegen. Damit endet der Bescheid in seiner erhaltenen Teil-überlieferung auch schon. Der Rubrik zufolge hatte Theodor zumindest noch ein wei-teres Thema angeschnitten: Wie man sich kirchlicherseits zu den vermögensrechtlich überaus harten Sanktionen stellen solle, die das Langobardenrecht - also Liutprands Novelle - in derartigen Fällen für die Betroffenen vorsehe. Theodor scheint dem eher ablehnend gegenübergestanden haben. Die Stellungnahme des Papstes kennen wir nicht.
Im Veroneser Auszugskapitel selbst sind keinerlei Namensangaben enthalten; die Zuweisung an Papst Zacharias leitet sich allein von der Inskription her, die der Schrei-ber des 10. Jahrhunderts dem Kapitel in diesem Codex (bzw. sein Vorgänger in der Vorlage) beigegeben hat. Inwieweit diese Herkunftsangabe als vertrauenswürdig gel-ten darf, ist somit die entscheidende Frage; zumal in unmittelbarer Nachbarschaft im Codex das altbekannte Schreiben JE 2306 des Zacharias an Theodor enthalten ist, das einem Redaktor leicht die Anregung für die von ihm gewählte Inskription zu einem anonym vorgefundenen oder selbstverfertigten Kanon hätte liefern können25).
22) Unten S.307f. 23) Die beiden ersten Sätze, die in der Edition unten S. 307 Z. 2-6 durch einen Ab-
satz vom folgenden abgetrennt sind, sind vor allem deswegen als Werk eines Rubri-kators und nicht als Originalwortlaut des Briefes selbst aufzufassen, weil sie beide, unverbunden nebeneinanderstehend, nur Sachverhalte benennen, jedoch keine Folge-rungen ziehen, keine Argumente ableiten, keine Entscheidungen mitteilen o.ä.
2f) Vgl. Anm. 2 und 7. 25) An sich ist .Zacharias' als Verlegenheitsinskription oder Tarnkappe für Falsifi-
kate im Frühmittelalter sonst ausgesprochen selten verwendet worden; die wenigen einschlägigen Texte hat [August Nürnbe rge r ] , Die Decretalen des heil. Zachanas, in: Der Katholik, Zeitschrift für katholische Wissenschaft und kirchliches Leben 62, N. F. 48 (1882) S. 63-76, hier S. 69-76, zusammengestellt und abgedruckt (Nrr. 4, 5 und 2 auch ediert M igne PL 89, Sp. 959f.; Nr. 4 ist ein Exzerpt aus Burchard, De-kret XIX 5). Interessant, weil vielleicht alt, ist darunter lediglich Nr. 3, die sog.,Dicta Zachariae papae', ebenfalls zu Fragen des Eherechts, die in zwei Codices des frühen 11. Jh. zu fassen sind: im Vaticanus lat. 1343 (aus Pavia stammend!) fol. 169v-170r
(zur Hs. vgl. S tephan K u t t n e r / R e i n h a r d Elze , A Catalogue of Canon and Ro-man Law Manuscripts in the Vatican Library 1 = Studi e testi 322, Città del Vaticano
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

304 Miszellen
Doch Verdachtsmomente wollen sich nicht recht aufweisen lassen: Das Textgenre als solches ist in der Inskription zweifellos richtig bestimmt; es liegt tatsächlich ein Ausschnitt aus einem größeren Ganzen, aus einem Brief, vor. Denn man müsste einem Fälscher schon eine ausgesprochen raffinierte Vorgehensweise unterstellen, wollte man postulieren, er habe eigens einen Leerverweis wie den in Z. 14 eingearbeitet, um einem von ihm erfundenen Einzel-Dictum den Anschein eines Exzerptes zu verleihen, und er habe zum gleichen Zweck auch eine Rubrik fabriziert, die in ihrem zweiten Teil in Bezug auf das Einzel-Dictum sonderbar funktionslos anmutet. Als Adressat lässt sich mit ziemlicher Sicherheit ein Bischof erschließen, denn nur diesem stand die Auferlegung schwerer Buße in manifesten Fällen zu; nur diesem kann im fraglichen Zeitraum auch ein Auftrag zur Verkündigung einer kirchenrechtlichen Norm durch Predigt erteilt worden sein. Es muss sich um einen Bischof aus dem Geltungsbereich des langobardischen Rechts gehandelt haben, denn nur aus diesem Raum ergibt eine Anfrage Sinn, die sich auf die lex der viri domini Longobardi bezogen hat - eine For-mulierung, die zudem auf einen Nicht-Langobarden als Schreiber der in der Rubrik re-ferierten Anfrage hinzudeuten scheint (z. B. also auf einen Bischof namens Theodor). Die angesprochene Gesetzesnovelle ist zudem die gleiche, zu der Theodor von Pavia schon einmal eine Anfrage an Zacharias gerichtet hatte; und auch in Sprachduktus und Stil harmonisiert der Kanon durchaus mit JE 2306. Der Aussteller des Schreibens redet den Fragesteller als frater an und belehrt ihn zugleich. Nichts spräche dagegen, den Sprecher mit einem der Päpste des 8. Jahrhunderts, den Empfänger mit einem nicht-langobardischen Bischof aus einer Diözese innerhalb des Langobardenreichs gleichzusetzen.
Auch die Veroneser Handschrift als gesamte bietet in ihrer Zusammensetzung und in ihrem Umgang speziell mit den Inskriptionen wenig Anlass zu Skepsis26). Paläo-graphisch aus dem 10. Jahrhundert stammend27), stellt sie doch wohl bereits eine Ab-schrift einer älteren Handschrift eher aus dem mittleren oder ausgehenden 9. Jahr-hundert dar, denn die jüngste enthaltene Texteinheit ist eine Auszugsreihe aus den pseudoisidorischen Dekretalen (die in ihrer A2-Kurzversion bereits in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in Oberitalien weit verbreitet waren), während alle an-deren etwas umfangreicheren Texte noch aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts
1986, S. 86-94), und im Codex Florenz, Biblioteca Medicea-Laurenziana Plut. LXV cod. 35, fol. 2V. Sie sind ediert nach der vatikanischen Hs. durch [Nürnberger ] , De-cretalen S. 72f., und nach dem Florentiner Codex durch Ange lo Mar ia B a n d i n i , Catalogus codicum latinorum Bibliotecae Mediceae Laurentianae 2, Florenz 1775, Sp. 753f. (beide Editionen geben ihre Textvorlage nicht ganz korrekt wieder). Im va-tikanischen Codex ist am Schluss ein Bußbuchkapitel angehängt, das leicht verkürzt Paenitentiale Merseburgense b c. 8 entspricht, ed. R a y m u n d K o t t j e , Paenitentia-lia minora Franciae et Italiae saeculi VIII-IX (= Corpus Christianorum, Series Latina 156), Turnhout 1994, S. 173 oder dem mit ihm verwandten Paenitentiale Huberten-se c. 51, ebd. S. 113. - F re i s en , Eherecht (o. Anm. 2) S. 384f. Anm. 36 hat die Dicta „wegen der sonderbaren Sprache und der Symbolik" als Fälschung eingeschätzt, und zwar als Fälschung eventuell noch des 8. Jh. (ebd. S. 386 Anm. 39), und in der Tat ist ihre Argumentation etwas eigenartig.
26) Die einzige Fehlzuweisung in den Inskriptionen ist das fol. 72v mit richtiger Kapitelnummer aufgenommene römischrechtlicne Kapitel aus der Epitome Iuliani als Sinodus Romanus. Zu ihm vgl. Anm. 34.
27) Vgl. Anm. 21.
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

R. Pokorny, Eine zweite Zacharias-Dekretale 305
stammen (dürften): ein zumeist dem Jahr 802 zugewiesener und relativ verbreite-ter Text aus dem Bereich der karolingischen Kapitulariengesetzgebung28), drei mit der Taufumfrage Karls d. Gr. vom Jahr 811 in Zusammenhang stehende Taufexpo-sitiones29), das Beda-Egbert'sche Bußbuch in seiner Redaktionsform als Paenitentia-le additivum30), das um 830 entstandene Paenitentiale Halitgars von Cambrai3 ') und vielleicht auch eine Kurzform der Collectio Dionysio-Hadriana mit den römischen Synoden von 826 und 743 als Anhang32). Mit einem Exzerptkapitel aus den Akten
28) fol. 88v-89v: Zuletzt Ghaerbald von Lüttich zugeschrieben und als Bischofska-pitular eingeschätzt und ediert durch P e t e r B r o m m e r , MGH Capit. episc. 1, 1984, S. 3-21 (zur Hs. hier S. 13); zuvor als ,Capitula a sacerdotibus proposita' ediert und einer Reichsversammlung des Jahres 802 zugewiesen, ed. A l f r e d B o r e t i u s , MGH Capit. 1, 1883, S. 105-107. Die Zuschreibung an Ghaerbald ist wohl ein Irrtum, vgl. R u d o l f P o k o r n y , MGH Capit. episc. 4, 2005, S. 93-96.
29) Nämlich [erstens] fol. 89v—91r: Magnus von Sens und Suffragane, Taufexpo-sitio an Karl d. Gr. (hier anonym, ohne die ,Praefatio' an Karl), M i g n e PL 102, Sp. 981-984; kritische Neuedition (nach fünf Hss., ohne Kenntnis dieses Codex) durch S u s a n A. K e e f e , An unknown Response from the archiépiscopal Province of Sens to Charlemagne's circulatory Inquiry of Baptism, in: Revue Bénédictine 96 (1986) S. 48-93, hier S. 56-60; und erneut (nach drei Hss., ohne Kenntnis des Codex) d i e s . , Water and the Word, Baptism and the Education of the Clergy in the Carolingian Empire, 2 Bde. Notre-Dame/Indiana 2002, hier 2 S. 265-271 (Text 15). Textbeginn S. 57,1 bzw. S. 266,6 mit Baptismum wie auch in der einzigen Keefe bekannten ita-lienischen Hs., Florenz, Bibl. Medicea Laurenziana, San Marco 669 s. XIII. - [Zwei-tens] fol. 91-91": Alcuin, Taufexpositio,Primo paganus' (hier anonym, ohne Adresse und Einleitungsabschnitt), ed. E r n s t D ü m m l e r , MGH Epp. 4, 1895, S. 202,14-203,6; kritische Neuedition durch K e e f e , Water 2 S. 238-245 (Text 9, ohne Kenntnis dieses Codex). Am Ende folgt jener Schlusszusatz Videtis - doctrinis, der nach K e e -f e 2 S. 245, Variantenapparat zu Z. 7, neben der verlorenen Vorlage einer Edition von Cordesius ebenfalls nur in Florenz, San Marco 669 auftritt. - [Drittens] fol. 91v-92v: Eine dritte, anonyme und bislang offenbar gänzlich unbekannte Taufexpositio, begin-nend: Caticuminum ideo fieri primum creaimus, ut repulsa cecitatem cordis ..., nicht enthalten unter den bei K e e f e , Water, edierten 61 Texten.
30) Fol. 92v-96v: Paenitentiale additivum Ps.-Bedae Egberti, durch Blattverlust un-vollständig abbrechend. Vgl. R e i n h o l d H a g g e n m ü l l e r , Die Überlieferung der Beda und Egbert zugeschriebenen Bußbücher (= Europäische Hochschulschriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 461), Frankfurt 1992, zur Hs. hier S. 11 Of. und232f.
31) Fol. 38v-72r: Halitgar von Cambrai, Paenitentiale, M i g n e PL 105, Sp. 651-705/710 bzw. H e r m a n n J o s e f S c h m i t z , Die Bussbücher und das kanonische Bussverfahren, Düsseldorf 1898, S.252-300; vgl. R a y m u n d K o t t j e , Die Buß-bücher Halitgars von Cambrai und des Hrabanus Maurus, Ihre Überlieferung und ihre Quellen (= Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 8), Ber-lin 1980, zur Hs. hier S. 76f. und S. 107-110. Offenbar besteht keine engere textge-schichtliche Verwandtschaft mit dem Codex Mailand, Bibl. Ambrosiana, Trotti 440; zu diesem vgl. Anm. 32.
32) Fol. 16r-38v: Eine Sammlung historischer Ordnung mit (z.T. gekürzten) Kon-zilskanones und Dekretalen auf der Basis der Collectio Dionysiana, deren Prolog einen pontifex Floripertus (von ?) als Auftraggeber nennt. Nach Nicaea (325) ist der Liber ecclesiasticorum dogmatum eingefügt, ed. C u t h b e r t H. T u r n e r , The Liber ecclesiasticorum dogmatum attributed to Gennadius, The Journal of Theologi-cal Studies 7 (1906) S. 78-99. Dann folgt sofort Serdica (343), also vorgezogen vor Ancyra (314). Die Sammlung schließt fol. 35-36 v mit der Notitia librorum apocry-phorum ab, ed. E r n s t von D o b s c h ü t z , Das Decretum Gelasianum de libris re-cipiendis et non recipiendis (= Texte und Untersuchungen zur Geschichte der alt-christlichen Literatur 38/4), Leipzig 1912, zur Hs. S. 174. Dann folgen fol. 36v-
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

306 Miszellen
einer ansonsten unbekannten Mailänder Synode des 8. Jahrhunderts33) überliefert der Codex zudem ein weiteres Unikat aus dem gleichen zeitlichen und geographischen Umfeld wie eventuelle Dekretalen an Bischof Theodor von Pavia. Und dass statt der Gesamttexte z. T. lediglich Exzerpte geboten werden, erklärt sich ganz einfach da-raus, dass der Kompilator sich eben unter bestimmten inhaltlichen Fragestellungen kleine Florilegien autoritativer Entscheidungen zusammengestellt hatte34) - so auch
38r noch Rom (826) unter Eugen II. (Forma minor), ed. A lbe r t W e r m i n g h o f f , MGH Conc. 2/2, 1908, S. 559-583 mit Benutzung der Hs., und schließlich fol. 38'-38" Rom (743) unter Zacharias (Forma minor), ed. de rs . , MGH Conc. 2/1, 1906, S. 30-32 ohne Benutzung der Hs.. Die gleiche Sammlung ist überliefert im Codex Mailand, Bibl. Ambrosiana, Trotti 440, s. XII, pag. 1-99, den K o t t j e , Bußbücher (o.Anm. 31) S.34f. beschreibt; dass es sich um die gleiche Sammlung handelt, die auch im Veroneser Codex auftritt, hat Kottje bei dessen Beschreibung offenbar nicht bemerkt.
33) Fol. 72r unter der Inskription Kap. XI. ex sinodo Mediolanensi facta per dominum Letum archiepiscopum (belegt 745-759), ed. A c h i l l e Ra t t i , Un ve-scovo ed un concilio di Milano sconosciuti o quasi, in: Rendiconti del Rea-le Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Ser. II, 33, Mailand 1900, S. 945-953, hier S. 953, nach dieser Hs. und nach Mailand, Bibl. Ambrosiana I. 145 inf., s. XII, fol 68v; Neuedition durch Gio rg io P i c a s s o , Si quis nefandum crimen ... (Amb. 2.375), un canone penitenziale milanese dell'alto medioevo, in: Con-tributi dell'Istituto di storia medioevale 3, hg. von P ie ro Zerb i (= Pubblica-zioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, Scienze storiche 12), Milano 1975, S.213-222, hier S.216; Neudruck in: G io rg io P i ca s so , Sacri cánones et monastica regula, Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale (= Biblioteca Erudita 27), Mailand 2006, S. 149-159, hier S. 152. - Auch gegen dieses Stück könnte man einen Fälschungsverdacht erheben. Doch was hätte sich ein Fälscher von einer Zuschreibung gerade an einen nahezu unbekannten Mai-länder Erzbischof an autoritativem Gewicht für einen selbstfabrizierten Kanon versprechen sollen?
M) So fol. l r-15v eine patristische Exzerptreihe; fol. 78r-88r eine Exzerptreihe aus der Collectio Hibernensis: I 1 (+ Zusätze), 3, 8a, 9ab, 10a-e+g-p, 11-14, 16-22a; II lab (+ Zusätze), 2, 4-10, 11 a-d+Zusatz+e-g, 12-27; III 1-2, 4-5; IV 1, 4; V 1; VIII 1-2; X; XI 2-6; XII, 1, 2a, 3-10, 12-15; XIII 1, 3a, 4, ed. H e r m a n n Was-s e r s c h i e b e n , Die irische Kanonessammlung, Leipzig 1885, S. 3-39; und zuvor fol. 72r-78v schließlich eine Sektion vermischter Einzel-Kanones zunächst zum An-klageverfahren gegen Kleriker; dann zu Jungfrauenraub und Heiratsverboten (na-hezu alle mit korrekten Inskriptionen, falls nicht anders vermerkt). In ihr sind u. a. enthalten der Einzelkanon aus einer Mailänder Synode unter Letus (vgl. Anm. 33), der Brief JE 2306 des Zacharias an Theodor von Pavia (vgl. Anm. 14) und das hier edierte Fragment aus einem zweiten Brief des Zacharias an diesen mit drei weiteren Kanones über die sich selbst verschleiernden virgines (vgl. Anm. 35), einige weni-ge Exzerpte aus Pseudoisidor und aus dem Briefregister Gregors I., fol. 72v die Ka-nones c. 205,1 und 205,5-6 aus der Concordia canonum des Cresconius, ed. K laus Z e c h i e l - E c k e s , Die Concordia canonum des Cresconius. Studien und Edition, 2 Bde. (= Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte 5), Frankfurt etc. 1992, hier 2 S. 688 und 690 (als Rezeption dort übersehen), sowie fol. 72" unter der fal-schen Inskription Sinodus Romanus LH Juliani Epitome Const. CXV c. 52 (c. 478), erster Teil bis puniatur, ed. Gus tav Haene l , Iuliani Epitome latina Novellarum Iustiniani, Leipzig 1873, S. 159, hier wohl direkt benutzt und nicht über die Excerp-ta Bobbiensia c. 49, erster Teil, ed. Car lo Guido Mor, Bobbio, Pavia e gli .Ex-cerpta Bobiensia', in: Contributi alla storia dell'Università di Pavia, Pavia 1925, S. 99. Fol. 9T folgt im Übrigen vereinzelt und ohne Inskription außer einem XXII noch einmal ein Kapitel aus der Juliani Epitome: CXV c. 32 (c. 458), ed. Haene l S. 154f.
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

R. Pokorny, Eine zweite Zacharias-Dekretale 307
zu den sich selbst verschleiernden und dann doch wieder in den Ehestand überwech-selnden virgines15).
Fazit somit: Der Zuschreibung des Veroneser Kapitels an Papst Zacharias wird man eine ziemlich hohe Glaubwürdigkeit zubilligen können. Man darf das Veroneser Ex-zerpt somit zur Aufnahme unter die Nummern eines zukünftigen ,definitiven' Jaffé vorschlagen.
Ed i t i on : Verona LXIII (61), s . X . , fol.75 r 'v
Papst Zacharias erteilt Bischof Theodor von Pavia (um 740/50?) auf Anfrage hin Auskünfte zum Kirchenrecht, von denen sich lediglich ein Textausschnitt zu virgines erhalten hat, die selbständig den Schleier genommen, diesen dann aber wieder ab-gelegt und geheiratet hatten.
Ex decretis Zacharie pape urbis Romç Theodore Ticinensis civitatis episcopo. De feminis, quae absque sacerdote a parentibus vel a semetipsis monachicç religio-
nis habitu accepto minime in eo persévérant, sed carnis desideria sequentes maritos ducunt. Et quia viri domini") Langobardi in sua lege statueront, ut et dividantur etiam
s et compositiob) non modica ab eis exigatur36), sed domini praeceptum est dicentis: Non37) iudicabis bis in idipsum.
Etenim38) de virginibus sacris, frater karissime, iam nosti, quod praecipiunt cáno-nes, et ita peragere stude. Nam de his feminis, quae a sacerdotibus non sunt velatç, sed a suis parentibus vel a semetipsis indutç sunt monachicum habitum39) et postmodum
io eo relieto voluntatem carnis secutç sunt, quantum vales, propter dominum instantis-sime praedica, ut nequaquam tale piaculum fiat; easque a copula dividere decerta; et salutaribus monitis omnes instruere atque obtestare festina, ut nullus de cetero sine
•) domini (ausgeschrieben) im Schreibvorgang korrigiert aus ursprünglichem dm i (m zu o verbessert; der erste m-Schaft aus / verbessert) V.
b) compositio] i2 nachgetragen V.
35) Hierzu sind aufeinanderfolgend fol. 74Γ-75Γ vier Texte zusammengestellt: Gre-gor I., JE 1495 (vollständig), Reg. VIII8, ed. Paul Ewa ld /Ludo Har tmann , MGH Epp. 2, 1892-1899, S. 10f.; dann Gregor I., Dialogi III 26 (Quodam vero tempore ... absentibus iudicaret), M igne PL 77, Sp. 281 B-C; sodann das hier analysierte und edierte Brieffragment des Zacharias an TTieodor von Pavia; und schließlich Rom (826) c. 29 (Forma uberior), ed. Alber t W e r m i n g h o f f , MGH Conc. 2/2, 1908, S.579.
36) Gemeint ist vermutlich c. 1 der Novelle Liutprands aus seinem 11. Regierungs-jahr (= 723), ed. F r i ed r i ch B luhme , MGH LL4, 1868, S. 122f.; zum entsprechen-den Kapitel vgl. oben S. 299.
3?) Vgl. Nah. 1, 9, hier in der Versio antiqua. Ähnlich ζ. B. auch in Cánones apos-tolorum c. 25, ed. Cu thbe r t H a m i l t o n Turner , Ecclesiae occidentalis monumen-ta iuris antiquissima 1, Oxford 1899-1939, S. 18.
38) In der Handschrift befindet sich an dieser Stelle kein Absatz; der gesamte Text ist durchlaufend geschrieben; nur die Inskription ist durch Maiuskeln und Rubrum abgehoben.
) Vgl. Friaul (796/97) c. \ \ . ob continentiae signum nigram vestem quasi religio-sam, sicut antiquus mos fuit in his regionibus ..., ed. Alber t W e r m i n g h o f f , MGH Conc. 2/1, 1906, S. 193,26-27.
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM

308 Miszellen
antistitis Dei ecclesiç consulti! hoc agere audeat. Et quod plura scribamus, dum et egregium apostolum habes docentem, ut superius40) scripsimus. De his sacris virgi nibus, quas autem minime dividere valueris, districtam in eis penitentiam impone, ut is de neglecto et de taciturnitate in die Christi [non] cogaris reddere rationem. Nam te praedicante, si audierint, salvi erunt, et minus41) ne ipsi in42) peccato suo morientur, tu vero salvasti animam tuam.
München Rudo l f P o k o r n y
40) Vermutlich Verweis auf ein Zitat im verlorenen Einleitungsteil des Schreibens. 41) Die Satzkonstruktion an dieser Stelle offenbar verderbt, ne eventuell zu ve zu
emedieren? 42) Ezech. 3, 19-20.
Brought to you by | University of VirginiaAuthenticated | 128.143.23.241
Download Date | 6/18/14 3:18 PM