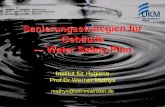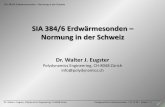Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
Transcript of Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.

147© 2013 Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin · geotechnik 36 (2013), Heft 3
Der Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br. zeigt in deutli-cher Weise Gefährdungen auf, die bei stockwerksübergreifendenErdwärmesonden-Bohrungen mit Potenzialunterschieden der an-getroffenen Grundwasserstockwerke auftreten können. DurchGrundwasserströmung kam es im Ringraum der Erdwärmeson-den-Bohrungen zu einem Austrag von Abdichtungsmaterial. Diesführte in einer oder mehreren Ringraumabdichtungen zum Miss-lingen der erforderlichen Stockwerkstrennung. Wasserzutritte inehemals trockene, quell- und schwellfähige Gebirgsabschnitteverursachten das „Gipskeuperquellen“. Diese Wasserzutrittekonnten durch schadensbegrenzende Maßnahmen (Nachver-pressung der Erdwärmesonden, Dauerabsenkung des Druckwas-serspiegels) unterbunden werden. In quellfähiges Gebirge einge-drungenes Wasser lässt sich jedoch weder mit hydraulischennoch anderen Maßnahmen rückgewinnen. Von daher werden dieGeländehebungen so lange andauern, bis das eingedrungeneWasser durch den Quell-/Schwellprozess restlos aufgezehrt ist.Die eingeleiteten schadensbegrenzenden Maßnahmen zeigten Erfolg. Dadurch konnten die maximalen Hebungsgeschwindigkei-ten von anfangs 11 mm/Monat auf derzeit ca. 3,5 mm/Monat redu-ziert werden. Die Hebungsmessungen seit Herbst 2012 deutendarauf hin, dass die bisher zu beobachtende lineare Prozessver-langsamung nicht unverändert anhält. Durch eine Modellierungwurde deutlich, dass die Pumpmaßnahme zur Vermeidung vonerneutem Auftrieb und weiteren Quellvorgängen fortgeführt wer-den muss.
Investigation and remediation strategies for the damaging eventcaused by failed borehole heat exchanger drillings in Staufen i. Br. The effects of failed borehole heat exchanger drillings in theGerman town Staufen i. Br. show distinctly the hazards, whichcan arise from borehole heat exchanger drillings spanning multigroundwater storeys with potential difference of the penetratedgroundwater storeys. Groundwater flow induced the discharge ofannular sealing in the annulus of the borehole heat exchangerdrilling. Under the encountered hydrological boundary conditions,this caused the failure of the required separation of the ground-water storeys in one or more annular sealing. Water influx in previously dry, swellable geological layers caused the so-called„Gipskeuperquellen“ (swelling of the gypsum-containing UpperTriassic Grabfeld formation). This water influx could be sup-pressed by damage-limiting measures (post-grouting of the bore-hole heat exchanger, permanent groundwater lowering). It is notpossible to reclaim water that ingressed into swellable geologicallayers neither by hydraulic nor by other measures. Thus, theground heave will continue until the ingressed water is complete-ly exhausted by the swelling process. The initiated damage-limit-ing measures succeed. As a result, the maximum heave rate has
decelerated from 11 mm/month at the beginning to currently approximately 3.5 mm/month. Since autumn 2012, the groundheave measurements indicate, that the linear deceleration of theprocess observed until now does not continue unchanged. Bymodelling it became clear, that the groundwater pumping has tobe continued to avoid more uplift and further swell processes. Experiences from the case Staufen i. Br. show impressively, thata thorough pre-investigation immediately followed by the initia-tion of defensive/control measures are absolutely necessary in case of damaging events caused by failed borehole heat exchanger drillings.
1 Veranlassung
Die Stadt Staufen i. Br. hatte das Ziel, ihr denkmalge-schütztes renoviertes Rathaus mit Erdwärmetechnologiezu heizen und zu kühlen. Hierzu wurden im September2007 Bohrungen für sieben Erdwärmesonden (EWS 1 bisEWS 7) ausgeführt. Sie lösten Prozesse aus, die zu den seitEnde 2007 zunehmenden Schäden an Gebäuden und In-frastruktur im historischen Altstadtbereich führten.
Das Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt fürGeologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB), erhielt von derLandesregierung Baden-Württemberg mit Kabinettsbe-schluss vom 12.01.2009 den Auftrag, die geologischen Ur-sachen der Schadensvorgänge in Staufen i. Br. zu unter -suchen und Möglichkeiten für schadensbegrenzende Maß-nahmen aufzuzeigen. Die bislang durchgeführten Unter-suchungen und die daraus gewonnenen Erkenntnissewerden im vorliegenden Bericht zusammengefasst.
Die Ingenieurgruppe Geotechnik (IGG), Kirchzar-ten, wurde von der Stadt Staufen i. Br. beauftragt, die fürdie Erkundung der Ursachen der Hebungen erforderli-chen Maßnahmen zu planen und geotechnisch zu beglei-ten, ein geomechanisches Modell zur Beschreibung desQuellvorgangs im Untergrund zu erstellen und Sanie-rungsmaßnahmen auszuarbeiten.
Das Stadtgebiet von Staufen i. Br. liegt geologischund geomorphologisch am Ostrand des südlichen Ober-rheingrabens in der Sulzburg-Staufener Vorbergzone(Bild 1) [1]. Sie wird im Osten durch die Schwarzwald-randverwerfung (Hauptverwerfung) vom kristallinenSchwarzwald (Paragneise mit Gangporphyren) getrennt.Westlich geht die überschotterte randliche Vorbergzonein die äußere Grabenzone und die Grabenrandscholleüber [2] [3].
Fachthemen
Erkundung und Sanierungsstrategien imErdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
Clemens RuchGunther Wirsing
DOI: 10.1002/gete.201300005

2 Arbeitshypothese
Nach dem Auftreten der ersten Gebäudeschäden bereitsim Herbst 2007 wurden im Rahmen des Beweisverfahrensder Stadt Staufen i. Br. verschiedene Voruntersuchungenzu deren Ursachen durchgeführt. Sie beinhalteten:− geodätische Geländevermessungen seit Anfang 2008, − detaillierte geologische Auswertungen der Bohrrückstell-
proben der EWS-Bohrungen 1, 2 und 3 durch das LGRB.Die Proben ermöglichten die stratigrafische Einstufungder erbohrten Schichtenfolge. Außerdem wurden Gipsund Anhydrit führende Gebirgsabschnitte identifiziert.
− Temperaturprofilmessungen in allen EWS seit Juni2008. In den Temperaturprofilen fielen Abschnitte ohneTemperaturgradienten sowie insbesondere im mittlerenTeufenabschnitt (zwischen ca. 55 und etwa 90 m u. GOK)eine markante, asymmetrische, positive Temperaturano-malie auf.
Auf der Grundlage dieser Befunde hat das LGRB zur Kon-zeption der Untersuchungen die nachstehende Arbeits -hypothese aufgestellt:
148
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
− Die Gebäudeschäden werden durch Hebungen des Un-tergrunds verursacht.
− Für die Hebungen verantwortlich sind Schichten derGipskeuper-Formation mit darin eingelagerten Sulfatführenden Abschnitten (Anhydrit) und quellfähigenTonmineralen (insbesondere Corrensit). Die schnell ein-setzenden Hebungen werden somit mit hoher Wahr-scheinlichkeit auf das sogenannte „Gipskeuperquellen“zurückgeführt.
− Die räumliche Nähe wie die zeitliche Abhängigkeit dereingetretenen Hebungen legen einen Zusammenhangmit den EWS-Bohrungen 1 bis 7 nahe.
− Das Temperaturprofil in der EWS 7 deutet auf einenAufstieg von gespanntem Grundwasser aus tieferenSchichten der Erfurt-Formation (Unterkeuper) über eineundichte Ringraumverfüllung sowie auf exotherme Pro-zesse hin. Die Formationsnamen haben sich nach [4] ge-ändert. Im Folgenden werden die neuen Formations -namen verwendet und die frühere Bezeichnung inKlammern mit aufgeführt.
− Die Quellungsvorgänge in der Grabfeld-Formation(Gipskeuper-Formation) werden aktiviert, wenn Wasserin vormals „trockene“ quellfähige Abschnitte der Grab-feld-Formation (Gipskeuper-Formation) eindringt.
Bild 1. Geologische Karte von Staufen i. Br. und Umge-bung, Ausschnitt aus [3] (die Lage des Erdwärmesondenfeldszwischen dem Rathaus und dem Bauamt der Stadt Staufeni. Br. ist mit einem roten Kreis markiert, vgl. Bild 2)Fig. 1. Geological map of Staufen i. Br. and surroundingareas, detail from [3] (the red circle indicates the location ofthe borehole heat exchanger field between the town hall andthe building authority of the town Staufen i. Br., cf. Fig. 2)
Bild 2. Lageplan mit Eintrag der Erdwärmesonden EWS 1bis EWS 7, der Erkundungsbohrungen EKB 1 und EKB 2(2009) sowie der Brunnenbohrung BB 3 (2012)Fig. 2. Map showing the location of the borehole heat exchangers EWS 1 to EWS 7, the exploration drillings EKB 1and EKB 2 (2009) and the well drilling BB 3 (2012)

149
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
Das „Gipskeuperquellen“ umfasst ein schnell eintretendesQuellen von quellfähigen Tonmineralen und eine Um-wandlung von Anhydrit in Gips [5]. Beide Prozesse sindmit einer Volumenzunahme verbunden. Es war daherwichtig zu klären, auf welche Weise das Wasser zutritt, woder in Quellung befindliche Gebirgsabschnitt liegt, wie eszu einer flächenhaften Ausbreitung des Wassers im Quel-lungsbereich kommt, wie sich die Hebungsfigur entwickeltund wie dieser Prozess schadensbegrenzend beeinflusstwerden kann.
3 Erkundungsmaßnahmen
Zur Überprüfung der Arbeitshypothese sowie als Grundla-ge zur Bewertung von Sanierungs- bzw. Sicherungsmaß-nahmen war es erforderlich, den Untergrund im Bereichder Rathausgasse, dem zentralen Bereich der Hebung, geo-wissenschaftlich umfassend zu erkunden. In Bild 2 sinddie Lagepunkte der sieben Erdwärmesonden EWS 1 bisEWS 7 sowie der später ausgeführten Bohrungen EKB 1,EKB 2 und BB 3 dargestellt.
3.1 Erkundungsbohrungen
Die geologische Erkundung der Untergrundverhältnisseim Bereich des EWS-Felds der EWS 1 bis EWS 7 erfolgteüberwiegend im Zeitraum vom 02.03. bis 30.10.2009. Mitder 18,20 m tiefen Erkundungsbohrung EKB 1 und der163,00 m tiefen Erkundungsbohrung EKB 2 konnte ein
belastbarer geologischer, mineralogischer und hydrogeolo-gischer Datensatz gewonnen und die Arbeitshypotheseüberprüft werden. Dem lagen u. a. umfangreiche Labor-analysen zugrunde (Bild 3). Die Differenzierung von Gipsund Anhydrit erfolgte mittels Röntgen-Pulver-Diffraktome-trie- (RDA) sowie Röntgen-Fluoreszenz-Analysen (RFA).Die geologische Profilaufnahme erbrachte, dass bei einemlateralen Abstand von knapp 10 m zwischen der Erkun-dungsbohrung EKB 1 und der nächstgelegenen Erdwär-mesonde EWS 1 eine tektonische Störung die geologischeProfilfolge um ca. 120 Höhenmeter versetzt, wobei dieEKB 1 auf der Hochscholle liegt (Bild 4).
Im Zuge der späteren Maßnahmen (s. u.) wurde zwi-schen dem 04.11.2011 und dem 29.03.2012 die BohrungBB 3 mit einer Tiefe von 122,20 m in der Kirchstraße ab-geteuft und als Brunnen ausgebaut. Die Bohrung erfolgteüberwiegend im Vollbohrverfahren, nur in bestimmtenBohrabschnitten wurde auf ein Kern gewinnendes Bohr-verfahren umgestellt. Unterhalb des Oberen Gipsspiegelswurde in EKB 2 und BB 3 im gesamten Sulfatgebirge aus-schließlich mit inhibierter Bohrspülung gearbeitet, um Lö-sungsvorgänge und weitere Gipskeuperquellung zu ver-hindern. Im Bereich einzelner Grundwasserhorizonte so-wie im Quellungsbereich der Grabfeld-Formation (Gips-keuper-Formation) wurde das Bohrloch der EKB 2 mitvier und die BB 3 mit drei Stand-/Sperrrohren teleskopiertausgebaut.
In den beiden tiefen Bohrungen wurden geometri-sche Größen wie Inklination und Azimut, Kaliber sowie
Bild 3. Gliederung der Erkundungsbohrung EKB 2 in Homogenbereiche (Mittelwerte ausgewählter bodenphysikalischer undmineralogischer Analysenergebnisse; GAR-Zone = Gipsauslaugungszone, QTM = quellfähige Tonminerale, n.n. = nicht nach-weisbar)Fig. 3. Classification of the exploration drilling EKB 2 into homogenous areas (mean values of selected soil mechanical andmineralogical analytical results; GAR-Zone = gypsum leaching zone, QTM = swellable clay minerals, n.n. = below limit ofdetection)

Struktur der Bohrlochwandung (Schichtung, Klüftung, je-weils mit Orientierung) ermittelt. Des Weiteren wurdenProfile der natürlichen Gammastrahlung, Temperatur,elektrischen Leitfähigkeit, Zutrittsbereiche sowie die verti-kale Strömungsgeschwindigkeit des Wassers gemessen.
3.2 Geologische Schichtenfolge
In der Erkundungsbohrung EKB 2 wurde die für dasEWS-Feld typische Schichtabfolge erbohrt. Sie reicht un-ter gering mächtiger, quartärer Überdeckung von derStuttgart-Formation (Schilfsandstein-Formation) über dieGrabfeld-Formation (Gipskeuper-Formation) und die Er-furt-Formation (Unterkeuper) bis in die Obere Hauptmu-schelkalk-Formation. Die Obere Auslaugungszone mitGipskarst in der Grabfeld-Formation (Gipskeuper-Forma-tion) wurde zwischen 22,40 und 28,60 m u. GOK ange-troffen. Darunter folgt der Sulfat führende Gebirgsab-schnitt mit dem Oberen Gipsspiegel bei 28,60 m u. GOK,dem Oberen Anhydritspiegel bei 61,50 m u. GOK, demUnteren Anhydritspiegel bei 126,10 m u. GOK und demUnteren Gipsspiegel bei 141,70 m u. GOK.
Die in der BB 3 angetroffene Schichtenfolge ent-spricht unter Berücksichtigung des Schichteinfallens von45 bis 50° nach Nordnordwesten der mit der EKB 2 verifi-zierten Abfolge im Bereich des EWS-Felds. Schichtlage-rungsbedingt fehlt in der BB 3 die Stuttgart-Formation(Schilfsandstein-Formation). Der Obere Gipsspiegel wur-de in BB 3 bei 18,50 m u. GOK, der Obere Anhydritspiegelbei 73,50 m u. GOK festgelegt. Der Untere Anhydritspiegelliegt bei 105,75 m u. GOK, der Untere Gipsspiegel bei112,10 m u. GOK. Der Sulfat führende Gebirgsabschnittwird von Gipsauslaugungsgesteinen über- und unterlagert.
In der Erkundungsbohrung EKB 2 wurde der Tiefen-abschnitt zwischen 61,50 und 99,50 m u. GOK als der im
150
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
Quellungsprozess befindliche Gebirgsabschnitt identifi-ziert. Er lässt sich anhand der Bohrkerne makroskopischnicht eindeutig bzw. nur sehr undeutlich erkennen. SeineIdentifikation ist vielmehr nur in der Gesamtschau unterEinbezug indirekter und direkter Anzeichen (Bohrloch-wandausbrüche, Temperaturanomalien in den EWS,Bohrkernverformung, polyedrischer Zerfall der Bohrker-ne, rezente Gipsbildung nach Dünnschliffanalyse, erhöh-ter Wassergehalt) möglich. In Quellung befindet sich dieZone zwischen Oberem Anhydritspiegel und Anhydrit-kern, die einen Wassergehalt von 3 % aufweist. DieserWassergehalt ist etwa doppelt so hoch wie der in dem da-runter liegenden, nicht quellenden Anhydritbereich. DerQuellungsbereich zeichnet sich auch durch den höchstenAnteil an quellfähigen Tonmineralen (im WesentlichenCorrensit) aus. Neben einem Hinweis auf etwaige Wasser-zutritte über undichte EWS-Ringräume könnte dies auchauf primär höhere, mobile Porenwasseranteile in tonrei-cheren Abschnitten zurückgeführt werden.
Es wurden über 190 Bohrkernproben hinsichtlich ih-rer mineralogischen Zusammensetzung und gesteinsphysi-kalischer Kennwerte analysiert (Labor LGRB) und dieBohrungen anhand dieser Ergebnisse in Homogenberei-che gegliedert.
Der geologische Schnitt (Bild 4) zeigt den im Bereichdes EWS-Felds erkundeten und anhand der geologischenKarte extrapolierten Untergrundaufbau von der Rathaus-gasse im Nordwesten bis zum kristallinen Festgesteinsrah-men im Südosten.
3.3 Grundwasserstockwerke undGrundwasserbeschaffenheit
Im Zuge der Bohrarbeiten der EKB 1 und EKB 2 wurdenvier hydraulisch, hydrochemisch und isotopenhydrolo-
Bild 4. Schematischer geologischer Schnitt zwischen Rathausgasse (Staufen-Sulzburger Vorbergzone) und Rotem Berg (kristallines Grundgebirge)Fig. 4. Schematic geological profile between Rathausgasse (Staufen-Sulzburg foothill area) and Roter Berg (crystalline base-ment)

151
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
gisch voneinander getrennte Grundwasserstockwerke an-getroffen (Bild 5). Die hydrochemischen Parameter wur-den im Labor des LGRB, die isotopenhydrologischen Pa-rameter im Labor der Fa. Hydroisotop, Schweitenkirchen,bestimmt. Mit 3,30 m u. GOK liegt der Ruhewasserstandim Gipskarst in der Grabfeld-Formation (Gipskeuper-For-mation; km1) ca. 1,70 m unter dem der Stuttgart-Formati-on (Schilfsandstein-Formation; km2, 1,60 m u. GOK). Dasartesisch gespannte Grundwasser in der Oberen Haupt-muschelkalk-Formation (2,10 m ü. GOK) hat ein um0,30 m höheres Ruhepotenzial als das der Erfurt-Formati-on (Unterkeuper; ku 1,80 m ü. GOK).
Hydrochemisch handelt es sich bei den Wässern ausder Stuttgart-Formation (Schilfsandstein-Formation) umnormal erdalkalische, überwiegend sulfatische Wässer (Ty-pisierung nach [6]), das Wasser aus der Erfurt-Formation(Unterkeuper) ist normal erdalkalisch, überwiegend sulfa-tisch, das aus der Oberen Hauptmuschelkalk-Formationnormal erdalkalisch, überwiegend hydrogenkarbonatisch.In den elektrischen Leitfähigkeiten als Maß für den Lö-sungsinhalt unterscheiden sich die Grundwässer deutlich.In der Stuttgart-Formation (Schilfsandstein-Formation)wurden Leitfähigkeiten von 1.860 bis 2.370 µS/cm, imGipskarst in der Grabfeld-Formation (Gipskeuper-Forma-
Bild 5. Übersichtsdarstellung der isotopenhydrologischen Untersuchungsergebnisse in der Erkundungsbohrung EKB 2 (Ana-lysen aus dem Jahr 2009); mo: Oberer Muschelkalk, ku: Erfurt-Formation (Unterkeuper), km1: Grabfeld-Formation (Gips-keuper-Formation), km2: Stuttgart-Formation (Schilfsandstein-Formation), q: QuartärFig. 5. Overview of the results from isotope-hydrological investigations from exploration drilling EKB 2 (analyses from theyear 2009); mo: Upper Muschelkalk (upper Middle Jurassic), ku: Erfurt formation (lower Upper Triassic), km1: Grabfeld for-mation (middle Upper Triassic), km2: Stuttgart formation (middle Upper Triassic), q: Quaternary

152
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
tion) von 2.750 bis 2.810 µS/cm, in der Erfurt-Formation(Unterkeuper) von 1.210 µS/cm und in der Oberen Haupt-muschelkalk-Formation von ca. 715 µS/cm gemessen(Analysen aus dem Jahr 2009 [7]). Im Vergleich dazu lie-gen die elektrischen Leitfähigkeiten der Grundwässer ausden überlagernden quartären Neumagenschottern deut-lich niedriger (ca. 140 bis 490 µS/cm).
Die isotopenhydrologische Beschaffenheit derGrundwässer aus der EKB 2 ist in Bild 5 zusammenfas-send dargestellt (Analysen aus dem Jahr 2009). Die Wäs-ser aus dem Gipskarst der Grabfeld-Formation (Gipskeu-per-Formation), der Erfurt-Formation (Unterkeuper) undder Oberen Hauptmuschelkalk-Formation waren frei vonTritium und somit älter als 50 Jahre [8]. Der geringe Triti-umgehalt des Wassers aus der Stuttgart-Formation (Schilf-sandstein-Formation) entspricht einem Jungwasseranteilvon max. 10 %. Er ist möglicherweise auf Umläufigkeitenhinter der während der Bohrarbeiten eingestellten Hilfs-verrohrung zurückzuführen. Unter der Annahme, dass dieGrundwässer einem Einkomponentensystem entspre-chen, keine wesentlichen Überprägungen durch Karbonat-fällung erfolgten und der 14C-Anfangsgehalt 70 % modernentspricht [8], lassen sich aus den 14C-Gehalten folgendeGrundwasseralter abschätzen: Stuttgart- und Grabfeld-Formation (Schilfsandstein- und Gipskeuper-Formation):2.000 bis 5.000 Jahre, Erfurt-Formation (Unterkeuper):7.000 bis 10.000 Jahre, Obere Hauptmuschelkalk-Forma -tion: 10.000 bis 14.000 Jahre. Somit nimmt das Alter derGrundwässer mit der Tiefe zu.
Die unterschiedlichen hydraulischen Potenziale unddie jeweils voneinander abweichenden, eigenständigen,hydrochemischen und isotopenhydrologischen Signatu-ren belegen eine eindeutige Stockwerkstrennung derGrundwasservorkommen (Bild 5).
3.4 Untersuchungen in den Erdwärmesonden
Zur Beurteilung infrage kommender Varianten zur nach-träglichen Abdichtung der EWS ist die Kenntnis der Raum-lage ihrer Bohrspuren unabdingbare Voraussetzung. Hier-für wurde vom LGRB die Entwicklung einer kombinierten,zweiachsigen Inklinations-/Azimut-Messsonde in Auftraggegeben, mit der die Raumlageuntersuchungen selbst inden durch den Quellhebungsprozess stark deformiertenSondenschläuchen vorgenommen werden konnten.
Die EWS-Bohrungen EWS 1 bis 7 weichen in ihrerRaumlagerichtung stark nach Südosten ab (im tiefsten Ab-schnitt bis 40° aus der Vertikalen, Bild 6). Diese Bohrab-weichung erklärt sich daraus, dass sich das vergleichswei-se flexible Bohrgestänge nach Verlassen der Verrohrungmit dem Bohrmeißel senkrecht auf die Schichtflächen ein-stellt. Bei den EWS-Bohrungen EWS 6 und 7 beträgt derhorizontale Abstand zwischen Bohransatzpunkt und Boh-rendpunkt ca. 20 m, bei den übrigen Sonden wurden Ab-weichungen von Ansatz- und Endpunkt um 15 m gemes-sen. Die in der Rathausgasse angesetzte EWS 7 unterfährtdas benachbarte Wohngebäude und endet unter derKirchstraße.
Ein eindeutiger Beleg für die Abweichungen der Son-den ergibt sich aus der Tatsache, dass beim Abteufen derEKB 2 zufällig die EWS 5 zwischen 117,50 und 118,10 mu. GOK zentral angebohrt wurde (Bild 7).
Bild 6. Grundrissdarstellung der EWS-Bohrspuren (Azimut-/Inklinometermessung)Fig. 6. Plan view of the borehole heat exchanger drilling traces by the LGRB (measurement of azimuth/inclination)
Bild 7. Angebohrte EWS 5 mit Ringraumverfüllung undSondenschlauch (links), Bohrkern der EKB 2 von 117,50 bis118,10 m u. GOK Fig. 7. Drill core from exploration drilling EKB 2 from117,50 to 118,10 m below ground level, tapped borehole heatexchanger EWS 5 with annular sealing and probe hose (left)

153
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
Parallel zur Messung der Raumlage erfolgten in denEWS Untersuchungen zur zeitlichen und räumlichen Tem-peraturentwicklung (Bild 8). Die Temperaturprofile derEWS lassen sich in drei charakteristische Abschnitte un-tergliedern: der obere Abschnitt (0 bis 14 m u. GOK) mitjahreszeitlichem Schwankungsbereich bzw. zwischen 14und ca. 55 m u. GOK mit langjährigen Temperatureinflüs-sen durch städtische Bebauung und Grundwasserfluss imGipskarst, der mittlere Abschnitt (zwischen ca. 55 und ca.90 m u. GOK) mit charakteristischer Temperaturanomalieund der untere (ab 90 m u. GOK), durch den geothermi-schen Gradienten und eine kleinere Temperaturanomalieim Bereich der Dunkelroten Mergel (DRM-Anomalie inBild 8) bestimmte Abschnitt.
Die charakteristischen Temperaturanomalien in denEWS liegen in Anhydrit (und quellfähige Tonminerale)führendem Gebirge im Bereich des Mittleren Gipshori-zonts der Grabfeld-Formation (Gipskeuper-Formation).Sie werden auf die exotherme Reaktion bei der Umwand-lung von Anhydrit in Gips zurückgeführt. Die Tempera -turanomalie ist in der EWS 7 am stärksten ausgeprägt undnimmt mit zunehmender Entfernung zur EWS 7 ab.
3.5 Untergrundmodell
Der Untergrund im Bereich des EWS-Felds in der Altstadtvon Staufen i. Br. besteht aus einem engständigen Mosaikvon Gebirgsschollen, die durch tektonische Störungenversetzt und begrenzt sind. Die Störungen streichenhauptsächlich in Nordost-Südwest-Richtung und senk-recht dazu in Nordwest-Südost-Richtung. Nach Auswer-tung aller bisher zur Verfügung stehenden Informationenliegt das Sondenfeld im Bereich einer kleinräumig geglie-derten Grabenscholle, die durch Schichtverbiegungenund parallel zur Hauptverwerfung Nordost-Südwest strei-chende Störungen begrenzt ist. An die Grabenschollegrenzen im Südosten und Nordwesten Hochschollen ausErfurt-Formation (Unterkeuper)/Oberer Hauptmuschel-kalk-Formation an. Aufgrund der hydraulisch weitgehend„dichten“ Störungen im Anhydrit führenden Gebirge derGrabenscholle gab es vor den EWS-Bohrungen keine na-türlichen Wegsamkeiten, über die gespanntes Grundwas-ser aus tieferen Stockwerken zu den quellfähigen Ge-steinsbereichen in der Grabfeld-Formation (Gipskeuper-Formation) gelangen konnte. Nur so war es möglich, dassin dieser tektonisch stark überprägten Situation der Vor-bergzone in der Grabfeld-Formation (Gipskeuper-Formati-on) Anhydrit über geologisch lange Zeiträume erhaltenbleiben konnte und nicht bereits früher mit Grundwasserin Kontakt kam. Nach dem Abteufen der EWS-Bohrungenkam es infolge von Wasserzutritten im westlichen Teil derGrabenscholle im Abschnitt zwischen Oberem Anhydrit-spiegel und Anhydritkern zu Quellungsprozessen, im östli-chen Teil treten diese nicht auf.
In der Gesamtschau führen alle Einzelergebnisse bei-der Erkundungsbohrungen EKB 1 und EKB 2, der zusätz-lichen Brunnenbohrung BB 3 und der durchgeführten Be-gleituntersuchungen zu einer widerspruchsfreien Verifizie-rung der Arbeitshypothese. Die Untersuchungsergebnissesind in den beiden Sachstandsberichten des LGRB [7] [9]und auf dessen Internetseiten www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/home/schadensfall_staufen_bericht veröffentlicht.
Die im Quellungsbereich nachgewiesenen Grund-wasserbewegungen sind ein wesentlicher Schlüssel zumgesamten Prozessverständnis. Nur dadurch ist im Zusam-menhang mit den tektonischen Verhältnissen am Stand-ort ein flächenhafter Nachschub von Grundwasser mög-lich, das über undichte Ringräume einer oder mehrererEWS aufsteigen kann. Hauber et al. [10] sehen den Um-fang des Wasserzutritts als entscheidend für den Fortgangvon Ton- und Anhydritquellen an. Dabei ziehen Tonmine-rale aufgrund ihrer Untersättigung und dadurch vorhan-denen Saugspannung Wasser an und führen durch osmo-tisches Quellen zu einer ersten Auflockerung, welche Was-serzutritt, Anhydritlösung und Gipsbildung ermöglicht.Der im Mittleren Gipshorizont am Standort nachgewiese-nen engen Wechselfolge zwischen Ton- und dünnen An-hydritlagen kommt zur Erklärung der sehr raschen Scha-densentwicklung große Bedeutung zu.
4 Bisherige Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
Wie die geologischen Untersuchungen im EWS-Feld erga-ben, war in den quellfähigen Gesteinsschichten der Grab-feld-Formation (Gipskeuper-Formation) noch genügend
Bild 8. Ruhetemperaturprofile in den ErdwärmesondenEWS 1 bis 7 (Juni 2008); DRM-Anomalie: Dunkelrote Mergel-AnomalieFig. 8. Temperature profiles in the non-operating boreholeheat exchangers EWS 1 to 7 (June 2008); DRM-Anomalie:anomaly caused by Dunkelrote Mergel subformation

Quellpotenzial vorhanden, um den Quellhebungsprozessüber lange Zeit aufrechtzuerhalten. Daher wurden im Zu-ge der geologischen Erkundung sowie der Untersuchun-gen an den EWS verschiedene Möglichkeiten geprüft, denQuellhebungsprozess schadensbegrenzend zu beeinflus-sen. Vordringlichstes Ziel dabei war es, einen weiteren Zu-fluss von Grundwasser in den in Quellung befindlichenGebirgsabschnitt zu verhindern. In einer Bewertungsma-trix wurden in Abstimmung mit zahlreichen externen Be-ratern folgende Maßnahmen geprüft und beurteilt:− gesteuertes Überbohren der EWS,− wasserdichte Umschließung des EWS-Felds, − Vereisung der EWS,− Nachverpressungen der EWS-Bohrungen, − bergmännische Maßnahmen von einem Schacht aus, − Gebirgsabdichtungen durch Injektionen, − Einbau spezieller Druckpolster, − hydraulische Maßnahmen wie Potenzialerhöhung im
Anhydritbereich unter Eingabe inhibierter Lösungen, − Potenzialabsenkung der Grundwässer in der Erfurt-For-
mation (Unterkeuper)/der Oberen Hauptmuschelkalk-Formation.
Dabei wurden diejenigen Maßnahmen ausgeschlossen,die ein zu hohes Ausführungsrisiko aufwiesen oder die inder Endbewertung letztlich als nicht realisierbar erkanntwurden. Um einen weiteren Zufluss von Grundwasser inden in Quellung befindlichen Gebirgsbereich der Grab-feld-Formation (Gipskeuper-Formation) zu verhindern,wurden bzw. werden folgende Maßnahmen durchge-führt:− hydraulischer Abwehrbetrieb: Dauerpumpmaßnahme in
der zum Brunnen ausgebauten ErkundungsbohrungEKB 2 und der Brunnenbohrung BB 3,
− Nachverpressung: nachträgliche technische Abdichtungder Ringräume der EWS-Bohrungen EWS 1 bis 7.
4.1 Hydraulischer Abwehrbetrieb
Seit September 2009 erfolgt aus der Erfurt-Formation (Un-terkeuper) und der Oberen Hauptmuschelkalk-Formationzwischen 145,20 und 163,00 m u. GOK (Endtiefe) alsBrunnen ausgebauten Bohrung EKB 2 ein hydraulischerAbwehrbetrieb. Diese Maßnahme dient neben der nach-träglichen, technischen Abdichtung (Nachverpressung)der EWS-Bohrungen EWS 1 bis 7 (Abschnitt 4.2) dazu,den Druckwasserspiegel des Grundwassers in der Erfurt-Formation (Unterkeuper) und in der Oberen Hauptmu-schelkalk-Formation dauerhaft unter 130 m u. GOK abzu-senken. Somit wird ein weiterer Zutritt von Grundwasserin den quellfähigen Gebirgsbereich der Grabfeld-Forma -tion (Gipskeuper-Formation) unterbunden. Ab dem01.03.2011 erfolgt − abgesehen von kurzzeitigen, tech-nisch bedingten Unterbrechungen − ein gemeinsamerPumpbetrieb in der EKB 2 und der in der Erfurt-Forma -tion (Unterkeuper) ausgebauten Brunnenbohrung BB 3.
Der Brunnen BB 3 in der Kirchstraße wurde zur Ver-besserung der Absenkung des Grundwasserspiegels, derOptimierung der Förderrate aus beiden Brunnen und zurErhöhung der Ausfallsicherheit konzipiert. Unterstützendzu den nachträglichen Injektionsmaßnahmen der unzurei-chend abgedichteten Ringräume der EWS dient der ge-
154
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
meinsame Abwehrbetrieb aus EKB 2 und BB 3 dazu, dasPotenzial des Grundwassers aus der Erfurt-Formation(Unterkeuper) und untergeordnet aus dem oberen Ab-schnitt der Oberen Hauptmuschelkalk-Formation imEWS-Feld bis unter den quellfähigen Gebirgsabschnitt ab-zusenken.
Durch die Überlagerung der beiden Absenkbereichewurde der Druckwasserspiegel in der EKB 2 anfänglichauf 131 m u. GOK und später auf 139 m u. GOK, in derBB 3 anfänglich auf 102 m u. GOK und später auf ca.110 m u. GOK abgesenkt. Der Pumpbetrieb wird durch einMonitoring mit Online-Zugriff und automatisiertemWarnsystem kontinuierlich überwacht (s. Abschnitt 6).
Die Grundwasserdruckverhältnisse im Umfeld derdauerhaft betriebenen EKB 2 und BB 3 wurden mit einemstark schematisierten, hydraulischen Prinzipmodell fürstationäre Verhältnisse numerisch simuliert. Danach führtdie Überlagerung der beiden Absenktrichter der EKB 2und der BB 3 im Bereich zwischen den beiden Entnahme-stellen dazu, dass der Druckwasserspiegel im Sondenfeldunter den derzeit in Quellung befindlichen Gebirgsab-schnitt abgesenkt wird. Dies gilt auch für den Bereich derEWS 2, die im Abschnitt zwischen 140 und 105 m u. GOKverstürzt ist, sodass sie nicht mehr für eine nachträglicheRingraumabdichtung aus den perforierten EWS-Schläu-chen heraus zugänglich war. Der Betrieb nur einer der bei-den Entnahmestellen würde nicht zu dem gewünschtenAbsenkziel führen.
4.2 Nachverpressung der Erdwärmesondenringräume
Als weitere Sicherungsmaßnahme wurden zwischen No-vember 2009 und Februar 2010 die Ringräume der EWS 1bis 7 in einem eigens entwickelten Verfahren nachver-presst [7]. Dabei wurden die größten Injektionsaufnahmenin EWS 7 beobachtet, bei der unterhalb des in Quellungbefindlichen Gebirgsabschnitts ca. 1.000 l und oberhalbdavon über 6.000 l Injektions-Spezialzement verpresstwurden (Bild 9). Der Verbleib des Injektionsguts konnteüber die Messung der Hydratationswärme in den Nach-barschläuchen derselben Erdwärmesonde nachvollzogenwerden (Bild 10).
Die sehr hohe Zementaufnahme im oberen Ab-schnitt belegt Verlustmengen im Bereich des Gipskarsts[7]. In diesem Tiefenabschnitt (zwischen ca. 26 und 32 mu. GOK) wurden auch beim Bohren der Erkundungsboh-rung EKB 2 und der Brunnenbohrung BB 3 Spülungsver-luste und Hohlräume festgestellt.
Nach den vorliegenden Messergebnissen und Beob-achtungen wird davon ausgegangen, dass mit der Injektiondes unteren Abschnitts der EWS 7 der nahezu offene Ring -raum und damit der wichtigste Wassernachschub in denQuellhebungsbereich verschlossen werden konnte.
5 Entwicklung der Hebungsfigur
Die in Staufen i. Br. ab Ende 2007 beobachteten Gelände-hebungen werden seit Anfang 2008 flächenhaft geodätischvermessen. Von Hebungen betroffen ist ein elliptischerBereich, dessen große Halbachse eine Nordost-Südwest-(280 m) und dessen kleine Halbachse eine Nordwest-Süd-ost-Orientierung (180 m) aufweist (Bild 11).

155
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
Die Hebungsfigur hat bereits seit Juni 2008 weitge-hend ortsfest ihre markante elliptische Ausbildung ange-nommen und sich seitdem nicht vergrößert. Geometri-sche Veränderungen der Hebungsfigur [11] wurden nichtbeobachtet. Die Hebungsfigur wird maßgeblich durch dastektonische Schollenmosaik und die Schichtlagerung be-
stimmt. Die Hebung erfolgt überwiegend senkrecht zurSchichtung, sodass sich der Quellhebungsvorgang starkanisotrop verhält. Entsprechend dem vorhandenenSchichteinfallen liegt das Hebungszentrum an der Gelän-deoberfläche nicht senkrecht über dem in Quellung be-findlichen Gebirgsbereich, sondern es ist nach Nordwes-
Bild 9. Übersichtsgrafik zu den Injektionsaufnahmemengen in den EWS 1 bis 7Fig. 9. Overview of the volume of injected material in the borehole heat exchangers EWS 1 to 7
Bild 10. Temperaturprofile in EWS 7 vor (schwarz) und nach der RingrauminjektionFig. 10. Temperature profile in borehole heat exchanger EWS 7 before (black) and after annulus grouting

ten versetzt. Ferner wirkt sich der zwischen 61,50 und99,50 m u. GOK liegende Quellungskörper an der Gelän-deoberfläche in einer wesentlich größeren Hebungsfiguraus.
Bei allen flächenhaft ausgewerteten Geländeverfor-mungen ist nur die messtechnisch weitaus präziser bestimmbare Vertikalkomponente berücksichtigt. Der He-bungsprozess ist jedoch noch von einer Horizontalkom-ponente begleitet, dessen genaues Ausmaß anhand radial-symmetrisch über das Altstadtgebiet orientierter Messstre-cken ermittelt wird. Diese Untersuchungen sind nochnicht abgeschlossen. Die hinsichtlich der erzielbaren Genauigkeiten, etwas weniger präzise, jährliche Auswer-tung der Lageverschiebung amtlicher Katasterpunkte desLandratsamts Breisgau-Hochschwarzwald, zuletzt vom11.09.2012, erbrachte nordwestlich des HebungszentrumsHorizontalverschiebungen zwischen 18 und 34 cm nachNordwest und südöstlich davon Horizontalverschiebun-gen zwischen 8 und 9 cm nach Südost. Dazwischen wurdean einem Katasterpunkt keine signifikante Horizontalver-schiebung gemessen.
Die Hebungsfiguren sind bis November 2012 fortge-schrieben. Die im Laufe der Messungen gewonnenen Er-fahrungen bei der Interpretation der Messergebnisse zei-gen, dass die hoch genauen, geodätischen Höhenmessun-gen von saisonalen Prozessen (frostbedingte zusätzlicheHebung im Winter, austrocknungsbedingte Schrumpfset-zung im Sommer) überlagert sein können. Entnahmebe-dingte Setzungen [11] finden nicht statt. Die maximale He-bungsgeschwindigkeit lag anfangs bei rd. 11 mm/Monatund hat sich im Hebungszentrum zwischenzeitlich (No-
156
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
vember 2012) über viele Monate hinweg annähernd linearauf ca. 3,5 mm/Monat reduziert. In den letzten Monatenist eine Verflachung des Geschwindigkeitsrückgangs zuverzeichnen.
Die Messungen belegen für den Zeitraum von Mai2008 bis November 2012 einen absoluten Hebungsbetragvon insgesamt 38 cm im Bereich der Rathausgasse (Mess-punkt 42). Hinzu kommt ein weiterer Betrag von einigenZentimetern für den Zeitraum von September 2007 (Ab-schluss der EWS-Bohrarbeiten) bis Mai 2008.
Die bislang gemessenen Hebungsfiguren belegen dieWirksamkeit der eingeleiteten Abwehrmaßnahmen (hy-draulischer Abwehrbetrieb, Nachverpressung der EWS).Durch sie konnte verhindert werden, dass weiteres Grund-wasser in den quellfähigen Gebirgsabschnitt aufsteigt.Dies zeigen die gemessene Reduzierung der Hebungsge-schwindigkeit sowie die wiederholt durchgeführten Ruhe-temperaturprofile in den EWS, wonach die Temperatura-nomalie im Untergrund nicht weiter zunimmt.
6 Monitoring
Begleitend zum Dauerabsenkbetrieb werden die Entnah-meraten und Absenkbeträge (Bild 12) sowie die Vor-Ort-Parameter Leitfähigkeit und Temperatur in den Entnah-mebrunnen kontinuierlich aufgezeichnet (durchgezogeneLinien in Bild 13). Diese Messungen werden durch regel-mäßige Probenahmen für hydrochemische (Dreiecke undRechtecke in Bild 13) und isotopenhydrologische Analytikergänzt. Das Monitoring dient der Überwachung der er-forderlichen Absenkziele, der Funktionsfähigkeit der in-
Bild 11. Entwicklung der Hebungsfigur im Zeitraum zwischen Einleitung der schadensbegrenzenden Maßnahmen von September 2009 bis November 2012Fig. 11. Heave development in the period between initiation of the damage-limiting measures from September 2009 to November 2012

157
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
stallierten Pumpen sowie der hydrochemischen und isoto-penhydrologischen Beschaffenheit des geförderten Was-sers, insbesondere im Hinblick auf dessen Lösungsinhalt.
Der Grundwasserspiegel in der EKB 2 wurde seit Ab-schluss der Ausbauarbeiten im September 2009 bis zumgemeinsamen Pumpbetrieb aus der EKB 2 und der BB 3auf ca. 125 bis 128 m u. GOK abgesenkt. Die Entnahme-rate lag anfänglich bei ca. 1,4 l/s und erreichte nach derDurchführung hydraulischer Tests und von Installations-arbeiten im Oktober 2010 die technisch maximal mög -liche Entnahmerate von 2,35 l/s. Damit ging eine Ab -senkung von bis zu 128 m u. GOK einher.
Zu Beginn des gemeinsamen Dauerabsenkbetriebsaus beiden Entnahmestellen (01.03.2011) wurden aus derEKB 2 weiterhin 2,2 bis 2,3 l/s und aus dem BrunnenBB 3 3,8 l/s entnommen. Im Laufe der Wasserhaltungs-maßnahme konnte unter Einhaltung bzw. geringfügigerTieferlegung der technisch erzielbaren, maximalen Absen-kung (135 bis 139 m u. GOK in der EKB 2 und 105 bis110 m u. GOK in der BB 3) die Entnahmerate bis Februar2013 in der EKB 2 auf 1,85 l/s und in der BB 3 auf 2,55 l/s
reduziert werden. Somit nimmt die gemeinsame Entnah-merate nicht weiter zu [11], sondern sie verringerte sich imLaufe der vergangenen zwei Jahre von anfänglich ca. 6 l/sauf derzeit 4,6 l/s um ca. 25 %. Die Entwicklung ist inBild 12 dargestellt. Die kleineren Sprünge in den Wasser-standsganglinien sind durch geringfügige Drosselung derPumprate bzw. Installations- und Wartungsarbeiten be-dingt. Starke Entnahmeratenschwankungen sind aufPumpenstillstände während Installationsarbeiten bzw.blitzschlagbedingtem Stromausfall zurückzuführen.
Die elektrische Leitfähigkeit in der BB 3 war AnfangMärz 2011 aufgrund des Einflusses der Bohrspülung nochstark erhöht (Bild 13). Von Ende Juni 2011 bis Februar2012 war die Leitfähigkeit in beiden Brunnen im Rahmender Messgenauigkeit annähernd konstant. Dabei lag sieanfänglich im Grundwasser der EKB 2 immer um bis zuca. 20 µS/cm über dem Wert der BB 3. Danach nahm dieLeitfähigkeit in der EKB 2 kontinuierlich ab, in der BB 3blieb sie nahezu unverändert.
Aufgrund der über den langen Pumpzeitraum ver-gleichsweise konstanten Grundwasserbeschaffenheit so-
Bild 12. Entnahmeraten (oben) und Grundwasserstände (unten) in den beiden Entnahmebrunnen EKB 2 und BB 3 seitdem 01.03.2011 (Tagesmittelwerte)Fig. 12. Groundwater withdrawal rate (top) and groundwater level (bottom) in the two drillings EKB 2 and BB 3 since01.03.2011 (daily mean values)

wie der hohen Dauerergiebigkeit des Grundwasservor-kommens ist von einem größeren Einzugsgebiet der Ent-nahmebrunnen auszugehen. Allerdings deutet sich immittlerweile nahezu dreieinhalbjährigen Zeitraum derWasserhaltung ein leicht nachlassendes Grundwasserdar-gebot an, das mit einer geringen Veränderung des Grund-wasserchemismus einhergeht, insbesondere in der EKB 2.Aus der EKB 2 wird ein Mischwasser aus der Erfurt-For-mation (Unterkeuper) und der Oberen Hauptmuschel-kalk-Formation gefördert. Die integrative Interpretationaller hydrochemischen und isotopenhydrologischen Un-tersuchungsergebnisse legt die Vermutung nahe, dass derAnteil an gefördertem Muschelkalkwasser leicht zu- undder Anteil von Grundwasser aus der Erfurt-Formation(Unterkeuper) entsprechend abnimmt. Im BB 3, der nurbis in die Erfurt-Formation (Unterkeuper) reicht, zeichnetsich dies nicht ab.
Wie die unter natürlichen Bedingungen artesisch ge-spannten Grundwasserverhältnisse in der Erfurt-Forma -tion (Unterkeuper) und der Oberen Hauptmuschelkalk-Formation belegen, ist von einem orografisch höher gelegenen Einzugsgebiet auszugehen. Hierfür kommeninsbesondere die höher gelegenen Muschelkalk- undBuntsandsteinflächen in Betracht, die in der Staufen-Sulz-burger Vorbergzone ausstreichen, sowie das östlich an-schließende Grundgebirge. Das Grundwasser im Mu-schelkalk und Buntsandstein folgt dem nordnordwestli-chen Schichteinfallen und gelangt somit in den Einzugs-bereich der Pumpmaßnahme. Möglicherweise wirkenzudem Klüfte in der tektonisch stark beanspruchten Vor-bergzone als weitere Wasserwegsamkeiten. Demzufolge istnicht auszuschließen, dass mit anhaltender Pumpdauer ei-ne Jungwasserkomponente aus dem weiteren, östlich desBrunnens liegenden Einzugsgebiets zutritt. Eine Tendenzhierzu deutet sich in der EKB 2 mit leicht angestiege-nem Tritium-Gehalt des Grundwassers (Analyse vom13.12.2013: 2,7 ± 0,6 TU) und ebenfalls leicht zunehmen-den 14C-Gehalten (Analyse vom 13.12.2012: 24,6 ± 1,5 %-
158
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
modern, frühere Analysen zwischen 04.11.2010 und14.05.2011: 20,5 bis 21,1 %-modern) an.
Eine durch den Dauerpumpbetrieb aus dem tief lie-genden Grundwasserleiter der Erfurt-Formation (Unter-keuper)/Obere Hauptmuschelkalk-Formation verursachtezusätzliche Erdfallgefahr [11] ist in Anbetracht der ver-gleichsweise geringen ausgetragenen Sulfatfracht nicht zuerwarten. Umgekehrt ist seit langem bekannt, dass im Alt-stadtgebiet von Staufen i. Br. aufgrund der allgemeinenBaugrundsituation (unterschiedlich setzungsfähige Deck-bzw. Verwitterungsschichten, auslaugungsbedingte Hohl-räume im oberflächennahen Gipskarst, Auffüllungen etc.)allfällige Schadensbilder, insbesondere Setzungserschei-nungen, grundsätzlich zu erwarten und auch tatsächlicheingetreten sind.
7 Geomechanische Modellierung
Auf Grundlage der vorliegenden geologischen Erkun-dungsergebnisse ist es gelungen, in einem vertikalen, zwei-dimensionalen, geomechanischen Finite-Element-Modelldie an der Geländeoberfläche gemessenen Hebungsbeträ-ge zu plausibilisieren [12] [13]. Der Modellierung lagenQuellversuche an Pulver- und natürlichen Proben zur Be-stimmung der Quellparameter für das Stoffgesetz sowieParametervariationen auch aus anderen Fallstudien (z. B.Freudensteintunnel [14]) zugrunde.
Durch Wasserzutritte über undichte Ringräume ei-ner oder mehrerer EWS sind vormals weitgehend ungesät-tigte Gebirgsabschnitte unter Auftrieb geraten. Durch dieDauerabwehrmaßnahme konnte dies dauerhaft unterbun-den werden. Mit dem geomechanischen Modell konntendie Geometrie der Hebungen, die gemessenen horizonta-len Verschiebungen sowie die zeitliche Entwicklung desHebungsverlaufs in Korrelation mit den eingeleiteten Ab-wehrmaßnahmen gut nachvollzogen werden.
Die Ergebnisse der geomechanischen Modellierungwerden an anderer Stelle vorgestellt.
Bild 13. Elektrische Leitfähigkeiten der Grundwässer aus der EKB 2 und der BB 3Fig. 13. Electric conductivity of the groundwater from exploration drilling EKB 2 and well drilling BB 3

159
C. Ruch/G. Wirsing · Erkundung und Sanierungsstrategien im Erdwärmesonden-Schadensfall Staufen i. Br.
geotechnik 36 (2013), Heft 3
8 Ausblick
Die im EWS-Schadensfall Staufen eingeleiteten, schadens-begrenzenden Maßnahmen (Nachverpressung der EWS,Dauerabsenkung des Druckwasserspiegels) zeigen Erfolg,was sich in einer Reduzierung der bisher beobachtetenHebungsgeschwindigkeiten niederschlägt. In quellfähigesGebirge eingedrungenes Wasser lässt sich jedoch wedermit hydraulischen noch anderen Maßnahmen rückgewin-nen. Von daher werden die Geländehebungen so lange an-dauern, bis das eingedrungene Wasser durch den Quell-/Schwellprozess restlos aufgezehrt ist. Aufgrund der Viel-zahl der unbekannten Randbedingungen ist eine zeitlichePrognose hierzu nicht möglich.
Die Erfahrungen im Falle Staufen zeigen eindrück-lich, dass bei EWS-Schadensfällen grundsätzlich einesorgfältige Vorerkundung und unverzüglich danach einge-leitete Abwehrmaßnahmen zwingend erforderlich sind.
Literatur
[1] Genser, H.: Geologischer Abriß über die Vorbergzone dessüdöstlichen Oberrheingebietes. In: Mäckel, R., Metz, B.(Hrsg.): Schwarzwald und Oberrheintiefland. Eine Einführungin das Exkursionsgebiet um Freiburg im Breisgau. FreiburgerGeographische Hefte, H. 36 (1992), S. 25−55.
[2] LGRB: Vorläufige Geologische Karte von Baden-Württem-berg, 1:25.000, Bl. 8112 Staufen im Breisgau, Beih., Freiburg i. Br.: LGRB, 1992.
[3] Groschopf, R., Kessler, G., Leiber, J., Maus, H., Ohmert, W.,Schreiner, A., Wimmenauer, W., mit Beitr. von Albiez, G., Hütt-ner, R., Wendt, O.: Geologische Karte von Baden-Württemberg1:50.000 − Erläuterungen Freiburg i. Br. und Umgebung. Frei-burg i. Br.: Geologisches Landesamt Baden-Württemberg,1996.
[4] Etzold, A., Schweizer, V.: Der Keuper in Baden-Württemberg.In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.) − Stratigra-phie von Deutschland IV − Keuper, Cour. Forsch.-Inst. Sen-ckenberg, 253 (2005), S. 214−244.
[5] Henke, K. F., Kaiser, W., Beiche, H.: Verhalten von Tunnel-bauwerken in quellfähigen Schichten des Gipskeupers. Ber. 2.Nat. Tag. Ing.-Geol. Fellbach (1979), S. 135−142.
[6] Furtak, H., Langguth, H. R.: Zur hydrochemischen Kenn-zeichnung von Grundwässern und Grundwassertypen mittelsKennzahlen. Mem. IAH-Congress 1965, VII (1967), S. 86−95.
[7] LGRB: Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geolo-gie, Bergbau und Rohstoffe − Geologische Untersuchungenvon Baugrundhebungen im Bereich des Erdwärmesondenfel-des beim Rathaus in der historischen Altstadt von Staufeni. Br., Sachstandsbericht, Az.: 94-4763//10-563, 01.03.2010.Freiburg i. Br.: LGRB 2010. www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/home/schadensfall_staufen_bericht
[8] Moser, H., Rauert, W.: Lehrbuch der Hydrogeologie. Band 8.Isotopenmethoden in der Hydrogeologie. Stuttgart: Borntrae-ger, 1980.
[9] LGRB: Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geolo-gie, Bergbau und Rohstoffe. Zweiter Sachstandsbericht zu denseit dem 01.03.2010 erfolgten Untersuchungen im Bereich desErdwärmesondenfeldes beim Rathaus in der historischen Altstadt von Staufen i. Br., Zweiter Sachstandsbericht, Az.: 94-4763//12-2487, 01.06.2012. Freiburg i. Br.: LGRB, 2012.
[10] Hauber, L., Jordan, P., Madsen, F., Nüesch, R., Vögtli, B.:Tonminerale und Sulfate als Ursache für druckhaftes Verhal-ten von Gesteinen. Bern: Eidgenössisches Departement fürUmwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation/Bundesamtfür Strassen, 2005.
[11] Sass, I., Burbaum, U.: Geothermische Bohrungen in Stau-fen im Breisgau: Schadensursachen und Perspektiven. geo-technik 35 (2012), H. 3, S. 198−205.
[12] Wechselwirkung − Numerische Geotechnik GmbH: Scha-densfall Staufen im Breisgau. Zweiter Bericht zu den Berech-nungen der zeitlichen Entwicklung der Hebungsprozesse.Stuttgart, 2012 [unveröffentlicht].
[13] Ingenieurgruppe Geotechnik: Zweiter GeotechnischerSachstandsbericht zu den geomechanischen Untersuchungenvon Hebungen im Altstadtbereich von Staufen im Breisgauund Abwehrmaßnahmen. Kirchzarten, 2012 [unveröffentlicht].
[14] Wahlen, R., Wittke, E. W.: Kalibrierung der felsmechani-schen Kennwerte für Tunnelbauten in quellfähigem Gebirge.geotechnik 32 (2009), H. 4, S. 226−233.
Danksagung
Für die fachliche Diskussion und die Erstellung von Abbil-dungen danken wir Frau Ch. Hunkler, Herrn Dr. D. Ehret,Herrn A. Koch und Herrn Dr. H.-M. Möbus (alle LGRB).
AutorenDr. Clemens RuchRegierungspräsidium FreiburgAbteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und BergbauRef. 95 – LandesingenieurgeologieAlbertstraße 5 79104 Freiburg i. [email protected]
Dr. Gunther WirsingRegierungspräsidium FreiburgAbteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und BergbauRef. 94 – Landeshydrogeologie und -geothermieAlbertstraße 5 79104 Freiburg i. Br.
Eingereicht zur Begutachtung: 8. März 2013Überarbeitet: 19. April 2013Angenommen zur Publikation: 19. April 2013