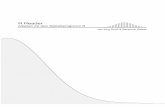HealthundSozialpsychiatrie - springer.com · Plewnia, J. Di Pauli, M. Prapotnik, O. Peters, J....
Transcript of HealthundSozialpsychiatrie - springer.com · Plewnia, J. Di Pauli, M. Prapotnik, O. Peters, J....

23/3
Postv
ertrieb
sstück
–En
tgelt
beza
hlt–B20
695F–Du
stri-V
erlag
Dr.K
arlF
eistle
–Ba
juwaren
ring4–D-
8204
1De
isenh
ofen
–Ob
erha
ching
ISSN 0948-6259
Psychiatrie, Psychotherapie, Public MentalHealth und SozialpsychiatrieWissenschaftliches Organ derpro mente austria, ÖAG, ÖGBE, ÖGKJP, ÖSG
Tiefe Hirn-Stimulation
MCI & Depression
Körperliche Aktivität & Psyche
Rückfallraten nach EKT
Aktive Sterbehilfe
Psychoedukation
Nahtoderlebnisse & Suizidversuch
Alzheimer & Übersäuerung des Gehirns
This journal is indexed in Current Contents / Science Citation Index /MEDLINE / Clinical Practice and EMBASE/Excerpta MedicalAbstract Journals and PSYNDEX

309
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistlehttp://www.durstri.de
ISSN 0948-6259
I
Psychiatrie, Psycho-therapie, Public MentalHealth und Sozial-psychiatrie
ZeitungsgründerFranz Gestenbrand, Innsbruck
Hartmann Hinterhuber, Innsbruck
Kornelius Kryspin-Exner †
RedaktionHartmann Hinterhuber, Innsbruck
Ullrich Meise, Innsbruck
Wissenschaftliches Organ• pro mente austria Dachverband der Sozialpsy- chiatrischen Gesellschaften• Österreichische Alzheimer Gesellschaft• Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen• Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend- psychiatrie• Österreichische Schizophreniegesellschaft
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistlehttp//:www.dustri.de
ISSN 0948-6259
Band 23Nummer 3 – 2009
EditorialNeue Indikationen und ethische Implikationen der tiefen Hirn-Stimu-lationH. Hinterhuber
ÜbersichtZusammenhang zwischen Mild Cognitive Impairment (MCI) und DepressionM. Defrancesco, J. Marksteiner,E. A. Deisenhammer, H. Hinterhuber, E. M. Weiss
Körperliche Aktivität bei Menschen mit schweren psychischen Erkran-kungen: Stand der Forschung und praktische EmpfehlungenM. Kopp
OriginalarbeitRückfallraten innerhalb von 6 Mo-naten nach erfolgreicher EKTEine naturalistische prospektive Fremd- und Selbstbeurteilungs-analyseG. Rehor, A. Conca, W. Schlotter, R. Vonthein, S. Bork, R. Bode, M. Hüll, C. Plewnia, J. Di Pauli, M. Prapotnik, O. Peters, J. Peters, G. W. Eschweiler
Die Nähe zum medizinischen Be-ruf und die Einstellung zur aktiven SterbehilfeK. Ritter, E. Etzersdorfer, Th. Stompe
Psychoedukative und bewältigungs-orientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnenCh. Haller, K. Andres, A. Hofer, M. Hummer, S. Gutweniger, G. Kemmler, M. Pfammatter, U. Meise
FallberichtSind Nahtoderlebnisse nach Suizid-versuchen bedeutsam für die wei-tere Suizidrisikoeinschätzung? K. Kralovec, M. Plöderl, U. Aistleiner, C. Fartacek, R. Fartacek
BerichtSpielt die Übersäuerung im Gehirn eine zentrale Rolle bei Alzheimer?M. Pirchl, Ch. Humpel
In MemoriamPrivat Doz. Prim. Dr. Egon Michael Haberfellner
Volume 23Number 3 – 2009
EditorialDeep brain stimulation – new indica-tions and ethical implicationsH. Hinterhuber
ReviewAssociation of Mild Cognitive Im-pairment (MCI) and depressionM. Defrancesco, J. Marksteiner,E. A. Deisenhammer, H. Hinterhuber, E. M. Weiss
Physical activity in persons with se-vere mental illness: research-based clinical recommendationsM. Kopp
OriginalRelapse rate within 6 months after successful ECT: A naturalistic pro-spective peer- and self-assessment analysisG. Rehor, A. Conca, W. Schlotter, R. Vonthein, S. Bork, R. Bode, M. Hüll, C. Plewnia, J. Di Pauli, M. Prapotnik, O. Peters, J. Peters, G. W. Eschweiler
The closeness to medical profes-sion and the attitude towards eu-thanasiaK. Ritter, E. Etzersdorfer, Th. Stompe
Psycho-educational coping-orien-ted group therapy for schizophrenia patientsCh. Haller, K. Andres, A. Hofer, M. Hummer, S. Gutweniger, G. Kemmler, M. Pfammatter, U. Meise
Case ReportAre near-death experiences fol-lowing attempted suicide important for suicide risk assessment?K. Kralovec, M. Plöderl, U. Aistleiner, C. Fartacek, R. Fartacek
ReportDoes acidosis in brain play a role in Alzheimers disease? M. Pirchl, Ch. Humpel
139
144
151
164
157
174
184
187
193

III
Psychiatrie, Psycho-therapie, Public MentalHealth und Sozial-psychiatrie
ZeitungsgründerFranz Gestenbrand, Innsbruck
Hartmann Hinterhuber, Innsbruck
Kornelius Kryspin-Exner †
RedaktionHartmann Hinterhuber, Innsbruck
Ullrich Meise, Innsbruck
Johannes Wancata, Wien
Wissenschaftliches Organ• pro mente austria Dachverband der Sozialpsy- chiatrischen Gesellschaften• Österreichische Alzheimer Gesellschaft• Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen• Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend- psychiatrie• Österreichische Schizophreniegesellschaft
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistlehttp//:www.dustri.de
ISSN 0948-6259
RedaktionsadresseUniv.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Telefon: +43-512-504-24284, Fax: +43-512-504-23628, Email: [email protected]
Produktion in Lizenz durch VIP-Verlag Integrative Psychiatrie InnsbruckAnton-Rauch-Straße 8 c, A-6020 Innsbruck, Email: [email protected] – Tel. +43 (0) 664 / 38 19 488
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, Postfach 1351, © 2009 Jörg Feistle.D-82032 München-Deisenhofen, Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle.Tel. +49 (0) 89 61 38 61-0, Telefax +49 (0) 89 6 13 54 12 ISSN 0948-6259Email: [email protected]
Regulary indexed in Current Contents/Science Citation Index/MEDLINE/Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX
Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentlichung durch den Verlag geht das Verlagsrecht für alle Sprachen und Länder ein-schließlich des Rechts der photomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfäl-tigung an den Verlag über.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Han-delsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die-ser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften. Für Angaben über Do-sierungsanweisungen und Applikationsformen wird vom Verlag keine Gewähr übernommen. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Die Neuro-psychiatrie erscheint vierteljährlich.
Bezugspreis jährlich € 84,–. Preis des Einzel-heftes € 23,– zusätzlich € 6,– Versandgebühr, inkl. Mehrwertsteuer. Einbanddecken sind lie-ferbar. Bezug durch jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht eine Abbe-stellung bis 4 Wochen vor Jahresende erfolgt.
ZeitungsgründerFranz Gerstenbrand, InnsbruckHartmann Hinterhuber, InnsbruckKornelius Kryspin-Exner †
HerausgeberHartmann Hinterhuber, InnsbruckUllrich Meise, Innsbruck (geschäftsführend)Johannes Wancata, Wien
Wissenschaftlicher BeiratHans Förstl, MünchenAndreas Heinz, BerlinWulf Rössler, Zürich
Christian Bancher, HornErnst Berger, WienKarl Dantendorfer, WienMax Friedrich, WienArmand Hausmann, InnsbruckHans Rittmannsberger, LinzChristian Simhandl, NeunkirchenReinhold Schmidt, GrazWerner Schöny, Linz
Erweiterter wissen-schaftlicher BeiratJosef Aldenhoff, KielMichaela Amering, WienJules Angst, ZürichWilfried Biebl, Innsbruck
Peter Falkai, GöttingenWolfgang Gaebel, DüsseldorfVerena Günther, InnsbruckReinhard Haller, FrastanzUlrich Hegerl, LeipzigIsabella Heuser, BerlinFlorian Holsboer, MünchenChristian Humpel, InnsbruckKurt Jellinger, WienHans Peter Kapfhammer, GrazSiegfried Kasper, WienHeinz Katschnig, WienIlse Kryspin-Exner, WienWolfgang Maier, BonnKarl Mann, MannheimJosef Marksteiner, KlagenfurtHans-Jürgen Möller, MünchenHeidi Möller, KasselThomas Penzel, BerlinWalter Pieringer, GrazAnita Riecher-Rössler, BaselPeter Riederer, WürzburgWolfgang Rutz, UppsalaHans-Joachim Salize, MannheimAlois Saria, InnsbruckNorman Sartorius, GenfHeinrich Sauer, JenaGerhard Schüssler, InnsbruckJosef Schwitzer, BrixenIngrid Sibitz, WienGernot Sonneck, WienMarianne Springer-Kremser, WienThomas Stompe, WienGabriela Stoppe, BaselHubert Sulzenbacher, InnsbruckHans Georg Zapotoczky, Graz

IV
Psychiatrie, Psycho-therapie, Public MentalHealth und Sozial-psychiatrie
ZeitungsgründerFranz Gestenbrand, Innsbruck
Hartmann Hinterhuber, Innsbruck
Kornelius Kryspin-Exner †
RedaktionHartmann Hinterhuber, Innsbruck
Ullrich Meise, Innsbruck
Johannes Wancata, Wien
Wissenschaftliches Organ• pro mente austria Dachverband der Sozialpsy- chiatrischen Gesellschaften• Österreichische Alzheimer Gesellschaft• Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen• Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend- psychiatrie• Österreichische Schizophreniegesellschaft
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistlehttp//:www.dustri.de
ISSN 0948-6259
Hinweise für AutorInnen:Sämtliche Manuskripte unterliegen der wissenschaftlichen und redaktionellen Begutachtung durch Schriftleitung und Reviewer.
Allgemeines:Bitte die Texte unformatiert im Flattersatz (Ausnahme: Überschrift und Zwischenüberschriften, Hervorhebungen) und keine Trennungen verwenden! Manuskripte – verfasst im Word – sind am besten per Email an die Redaktion (Adresse siehe unten) zu übermitteln. Sie können auch elektronisch auf CD oder Diskette an die Redaktionsadresse gesandt werden. Die Zahl der Abbildungen und Tabellen sollte sich auf maximal 5 beschränken.
Manuskriptgestaltung:• Länge der Arbeiten: - Übersichtsarbeiten: bis ca. 50.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Originalarbeiten: bis ca. 35.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Kasuistiken, Berichte, Editorials: bis ca. 12.000 Zeichen inkl. Leerzeichen
• Titelseite: (erste Manuskriptseite) - Titel der Arbeit: - Namen der Autoren (vollständiger Vorname vorangestellt) - Klinik(en) oder Institution(en), an denen die Autoren tätig sind - Anschrift des federführenden Autors (inkl. Email-Adresse)
• Zusammenfassung: (zweite Manuskriptseite) - Sollte 15 Schreibmaschinenzeilen nicht übersteigen - Gliederung nach: Anliegen; Methode; Ergebnisse; Schlussfolgerungen; - Schlüsselwörter (mindestens 3) gesondert angeben
• Titel und Abstract in englischer Sprache (3. Manuskriptseite) - Kann ausführlicher als die deutsche Zusammenfassung sein - Gliederung nach: Objective; Methods; Results; Conclusions - Keywords: (mindestens 3) gesondert angeben
• Text: (ab 4. Manuskriptseite) Für wissenschaftliche Texte Gliederung wenn möglich in Einleitung, Material und Methode, Er-
gebnisse, Diskussion, evtl. Schlussfolgerungen, evtl. Danksagung, evtl. Interessenskonflikt
• Literaturverzeichnis: (mit eigener Manuskriptseite beginnen)- Literaturangaben sollen auf etwas 20 grundlegende Werke und Übersichtsarbeiten be-
schränkt werden. Das Literaturverzeichnis soll nach Autoren alphabetisch geordnet werden und fortlaufend mit arabischen Zahlen, die in [eckige Klammern] gestellt sind, nummeriert sein.
- Im Text die Verweiszahlen in [eckiger Klammer] an der entsprechenden Stelle einfügen. Beispiele: Arbeiten,dieinZeitschriftenerschienensind:
[1] Rittmannsberger H., Sonnleitner W., Kölbl J., Schöny W.: Plan und Wirklichkeit in der psychiatrischen Versorgung. Ergebnisse der Linzer Wohnplatzerhebung. Neuropsychiatr 15, 5-9 (2001). (Abkürzung Neuropsychiatr)
Bücher:[2] Hinterhuber H., Fleischhacker W.: Lehrbuch der Psychiatrie. Thieme, Stuttgart 1997.
Beiträge in Büchern:[3] Albers M.: Kosten und Nutzen der tagesklinischen Behandlung. In: Eikelmann B., Reker
T., Albers M.: Die psychiatrische Tagesklinik. Thieme, Stuttgart 1999.
• Abbildungen und Tabellen: (jeweils auf eigener Manuskriptseite- Jede Abbildung und jede Tabelle sollte mit einer kurzen Legende versehen sein.- Verwendete Abkürzungen und Zeichen sollten erklärt werden.- Die Platzierung von Abbildungen und Tabellen sollte im Text durch eine Anmerkung markiert
werden („etwa hier Abbildung 1 einfügen“).- Abbildungen und Grafiken sollten als separate Dateien gespeichert werden und nicht
in den Text eingebunden werden!- Folgende Dateiformate können verwendet werden: Für Farb-/Graustufenabbildungen:
.tiff, .jpg, (Auflösung: 300 dpi); für Grafiken/Strichabbildungen (Auflösung: 800 dpi)
Ethische Aspekte:Vergewissern Sie sich bitte, dass bei allen Untersuchungen, in die Patienten involviert sind, die Grundsätze der zuständigen Ethikkommissionen oder der Deklarationen von Helsinki 1975 (1983) beachtet worden sind. Besteht ein Interessenskonflikt gemäß den Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors, muss dieser gesondert am Ende des Artikels ausgewiesen werden.
Korrekturabzüge:Nach Anfertigung des Satzes erhält der verantwortliche Autor einen Fahnenabzug des Artikels elektronisch als pdf-Datei übermittelt. Die auf Druckfehler und sachliche Fehler durchgesehenen Korrekturfahnen sollten auf dem Postweg an die Verlagsadresse zurückgesandt werden.
Manuskript-Einreichung:Ausserhalb von Österreich:Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Email: [email protected]
Innerhalb von Österreich:Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, Universitätsklinik für Psychiatrie,Medizinische Universität Wien, Währingergürtel 18-20, A-1090 Wien, Email: [email protected]

Deep brain stimulation- new indications and ethical implica-tions
Im Dezember 1986 führte der Neurochirurg Benabid und der Neurologe Pollak in Grenoble erstmals eine "Tiefe HirnStimulation" bei einem Patienten mit Tremor durch: Dieser fand durch eine Thalamotomie eine deutliche Linderung des Tremors in der kontralateralen Extremität. Die bekannten Risiken einer beidseitigen Thalamotomie verboten einen zweiten neurochirurgischen Eingriff. Für die genannten Forscher bot sich nun die Implantation eines Neurostimulationssystems im gegen überliegenden Thalamus als weniger riskante Alternative an. Der Eingriff erbrachte den gewünschten Erfolg.
In der Zwischenzeit ist die tiefe HirnStimulation des Nucleus subtha lamicus ein bewährtes Ver fah ren zur Therapie motorischer Fluk tuationen und Dyskinesien bei fortgeschrittenem Morbus Parkinson; Patien ten mit schweren Dystonien hilft eine PallidumStimulation, solchen mit therapieresistenten Tremor syndromen die bereits erwähnte Thalamusstimulation.
Weltweit scheinen bereits mehr als 40.000 Patienten mit tiefer HirnSti
mulation therapiert worden zu sein. In Deutschland werden in rund 30 Kliniken jährlich etwa 400 "Hirnschrittmacher" implantiert.
Die tiefe HirnStimulation zählt heute zu den erfolgversprechenden Techniken der Neuromodulation. Thomas Schläpfer [17] definiert "Neuromodulation" als "die Beeinflussung einer durch Krankheit veränderten Aktivität von Nervenzellverbänden und neuronalen Netzwerken durch technische Stimu lationssysteme mit dem Ziel einer therapeutischen Wirkung … Bei ihr wird eine dünne Elektrode in ge nau definierte Stellen des Gehirns implantiert, von denen bekannt ist, dass ihre krankhaft veränderte Nervenzellaktivität gewissen klinischen Symp tomen (wie z. B. der Tremor bei der Parkinson'schen Erkrankung oder psychiatrischen Symptomen) zu Grunde liegt."
Die krankhaft veränderte Aktivität des betreffenden Hirnareals wird durch hochfrequente elektrische Im pulse mit veränderbarer Frequenz, Polarität, Amplitude und Pulsweite beeinflusst bzw. moduliert. Die Elektrode ist mit einem elektrischen Impulsgenerator verbunden, der wie ein Herzschrittmacher unter der Clavicula implantiert wurde.
Diese Methode hat in der Neurologie die Therapie von Bewegungsstörungen revolutioniert: In der Neurologie ist die tiefe HirnStimulation in der Tat besonders bei Bewegungsstörun
gen ein bereits gut etabliertes Verfahren.
Im Unterschied zu neurologischen Erkrankungen stellt die tiefe HirnStimulation bei psychiatrischen Stö rungen ein neues, noch wenig erforschtes, reversibles neuro chirur gisches Vorgehen dar: Die derzeitigen Erfahrungen mit der tiefen HirnStimulation belegen, dass diese Technik sowohl motorische als auch kognitive und emotionale Wirkungen zu entfalten in der Lage ist. Das Potenzial der THS ist auch bei psychiatrischen Erkrankungen vielversprechend, be son ders wenn die Störung mit um schriebenen Dysfunktionen von neuro nalen Netzwerken verursacht wird und diese medikamentös nicht entsprechend beeinflussbar sind.
Welche Anwendungsgebiete werden heute in der Psychiatrie diskutiert?
2005 veröffentlichen Helen Mayberg und Mitarbeiter [9] die Ergebnisse der THS bei 6 an therapieresistenter chronischer Depression leidenden Patien ten. Die Stimulation erfolgte bila teral in der weißen Substanz unter dem subgenualen cingulären Cortex [BrodmannArea 25]. Diese Region ist bekanntlich bei behandlungsresistenter Depression überaktiv. Bei 5 Patienten konnte nach 2 Monaten chronischer Stimulation eine Besserung beobachtet werden, bei 4 Pati
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
Neue Indikationen und ethische Implikationen der tiefen Hirn-Stimulation
Hartmann Hinterhuber
Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Department für
Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Innsbruck
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 139–143 Editorial Editorial

Hinterhuber 140
enten blieb die Besserung auch nach weiteren 4 Mo naten bestehen.
Th. Schläpfer publizierte mit seiner Gruppe [15] auch eine Verbesserung anhedonischer und depressiver Symptome bei 3 Patienten, deren Nucleus accumbens stimuliert worden war.
Bei schwersten therapieresistenten Zwangsstörungen wurde im vorderen Schenkel der inneren Kapsel stimuliert, um hyperaktive dopaminerge neuro nale Regelkreise zu beeinflussen: Diese Zielregion wurde aufgrund der Erfahrungen bei ablativen neurochirurgischen Interventionen und der Ergebnisse funktioneller bildgebender Verfahren gewählt.[5] In kleinen, placebokontrollierten Studien mit einer CrossOverPhase konnte die Wirksamkeit dieses Verfahrens bei schweren Zwangsstörungen nicht nur akut, sondern auch nach einer Katamnesezeit von 21 Monaten demonstriert werden. Kasuistiken schreiben auch der Stimulation des Nucleus subthalamicus, des ventralen Nucleus caudatus und des Nucleus accumbens positive klinische Aspekte zu.
Zeigt die THS bei schweren, therapieresistenten Zwangsstörungen (5) und auch bei affektiven Psychosen [8,14,15] vielversprechende Ergebnisse, sind die bisher publizierten Fallzahlen immer noch sehr klein. Neben den Zwangskranken scheinen TourettePatienten von der Stimulation verschiedener subkortikaler Kernge biete am besten zu profitieren. [11,22] Belegen erste methodisch gut durchgeführte Studien an kleinen Patientengruppen mit chronifizierten Zwangsstörungen und depressiven Erkrankungen in der Tat die Effektivität der tiefen HirnStimulation, ist deren Erfolg jedoch nicht konsistent: Einige Patienten geben bei entsprechender Stimulation keine Verbesserung ihrer quälenden Symptomatik an. Die NonResponse wird derzeit noch kon troversiell diskutiert.
Bezüglich der THS bei schizophrenen Patienten liegen derzeit nur wenige Fallberichte vor. Die Arbeitsgruppe um G. Winterer in Düsseldorf [1,24] fand aber, dass die tiefe HirnStimulation im Globus Pallidus internus bei chronisch schizophrenen Patienten mit tardiven Dyskinesien gut toleriert wird und erfolgversprechend zu sein scheint. Invasive Eingriffe sind aber gerade bei an Schizophrenie erkrankten Menschen unter ethischen Aspekten historisch schwer belastet. Darauf wird noch Bezug genommen werden.Potenzielle Anwendungsgebiete könnten auch die NegativSymptome bzw. die kognitiven Defizite bei schizophrenen Patienten darstellen: Das pathophysiologische Korrelat dieser Symptomatik findet sich in einem präfrontalen Synchronisierungsdefizit im ThetaFrequenzbereich mit einem Maximum im Anterioren Cingulären Cortex (ACC). Die genannte Düsseldorfer Arbeitsgruppe bereitet derzeit eine THSStudie mit dem Ziel vor, diese Symptomatik über eine ThetaSynchronisierung im ACC zu verbessern. [1,24]
Erste bemerkenswerte kasuistische Berichte bestätigen eine Beeinflussung süchtigen Verhaltens durch die Stimulation des Nucleus accumbens. Auch B. Bogerts (Magdeburg) findet Hinweise für eine Indikation der tiefen HirnStimulation bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. [2,3]
Zusammenfassend kann heute festgehalten werden:Bei extremen Ausprägungen von therapie refraktären Zwangsstörungen und vereinzelt auch bei depressiven Erkrankungen kann die THS als Alternative zu ablativen neuro chirurgischen Operationen gesehen werden: Der Vorteil der THS ist die Reversibilität, die mögliche individuelle Anpassung der Stimulationsparameter um einen optimalen therapeutischen Affekt bei minimalen Nebenwirkungen zu er möglichen. Auch sind placebokontrollierte Studien durchführbar.
Der Wirkmechanismus der tiefen HirnStimulation ist noch nicht bekannt; es wird vermutet, dass chronische hochfrequente Stimulation mit 130 bis 185 Hz spannungsabhängige neuronale Ionenkanäle inaktiviert und auf diesem Weg die neuronale Transmission beeinflussen kann. Das Ergebnis wäre somit eine "funktionelle Läsion" ähnlich einer ablativen neurochirurgischen Operation.
Als Nebenwirkungen der THS werden einerseits jene beschrieben, die auf Grund der chirurgischen Implantation auftreten, andererseits jene, die durch die Stimulation selbst ausgelöst werden. [16,17]− Die Häufigkeit von Blutungen
durch elektrodenbedingte Verletzung von Blutgefäßen beträgt 1 bis 5 %.
− Die Häufigkeit von epileptischen Anfällen wird mit 1 bis 3 % beschrieben.
− Bei 2 bis 25 % treten vor allem oberflächliche Infektionen auf.
Stimulationsabhängige Nebenwirkungen sind in der Regel passager und können durch eine Änderung der Stimulationsparameter korrigiert werden. Beschrieben sind Parästhesien, Muskelkontraktionen, Dysarthrie, Doppelbilder sowie Veränderung der Stimmungslage, des Gedächtnisses und der kognitiven Parameter.
Darüber hinaus sind bei nicht richtiger Platzierung der Elektroden noch weitere Nebenwirkungen wie Sprachstörungen, Störungen der Augenbewegungen und eine Verschlechterung der Beweglichkeit beschrieben worden.
Neben dem Narkose und OPRisiko treten Nebenwirkungen in Abhängigkeit des Zielortes auf. Okun et al. [13] beschrieben das Auslösen von Lachen und Euphorie bei THS im Rahmen einer Zwangsstörung, Shapira et al. [19] beobachteten bei der selben Indikationsstellung Panik, Angst und vegetative Symptome. VisserVandewalle

Neue Indikationen und ethische Implikationen der tiefen HirnStimulation 141
et al. [22] beobachteten bei einem Patienten mit TouretteSyndrom Sedation und Sexualstörungen. Bandini et al. [2] sowie Witjas et al. [25] beobachteten bei ParkinsonPatienten, die im Nucleus subthalamicus stimuliert worden sind, eine Beeinflussung ihres pathologischen Spielverhaltens, Schneider und Mitarbeiter [18] ebenfalls bei ParkinsonPatienten eine Stimmungsaufhellung sowie eine Verbesserung des emotionalen Gedächtnisses. Lozano et al. [6,7] stimulierten bei einem krankhaft fettsüchtigem Patienten den Hypothalamus, dieser beschrieb daraufhin DéjàvuErlebnisse. Nach 3 Wochen Stimulation schnitt er bei Gedächtnistests aber deutlich besser ab als vor der Behandlung.
M. Ulla et al. [21] beschrieben bei einem stimulierten Parkinsonpatienten ein auf ein Jahr begrenztes manisches Verhalten mit inadäquat gehobener Stimmung, abnormer Antriebssteigerung und Kritiklosigkeit.
Unter den Kriterien der evidenzbasierten Medizin [16,17] ist zu sagen, dass zur THS als antidepressive Behandlungsmethode nur die erwähnte Studie mit 6 Patienten und einige wenige kasuistische Mitteilungen vorliegen (niedrige Evidenz, Grad 5). Bei Zwangsstörungen sind nur wenige placebokontrollierte Studien mit geringen Fallzahlen sowie kasuistische Darstellungen publiziert (niedrige Evidenz, Grad 5).
Die tiefe HirnStimulation wurde bisher bei nicht mehr als ca. 100 psychiatrischen Patienten angewandt, die Wirksamkeit wurde bisher vorwiegend – wie erwähnt – bei Patienten mit Zwangsstörungen und therapierefraktären Depressionen untersucht.Angeboten wird die tiefe HirnStimulation zur Behandlung schwerer, therapieresistenter Depression an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bonn (Prof. Dr. Thomas E. Schläpfer) in Verbindung mit der Klinik für Stereotaxie und Funktioneller Neurochirurgie der Universität zu
Köln (Prof. Dr. Volker Sturm) und an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Charité Zentrum für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie in Berlin (Prof. Dr. Malek Bajbouj).
Langzeiteffekte der THS bei psychiatrischen Erkrankungen sind bisher nicht bekannt. Bei der Frage der Anwendung ist besondere Sorgfalt geboten. Christiane Woopen vom Kölner Institut für Geschichte und Ethik der Medizin (26) fasst dies folgendermaßen zusammen: "Die NutzenRisikoAbwägungen sind extrem individuell zu treffen, da wir nicht nur von Eingriffen in einzelne körperliche Funktionen sprechen, sondern von Eingriffen in die Persönlichkeit."
Der Ort der Anwendung, die invasive Methodik mit einem potenziell schweren Nebenwirkungsprofil einerseits und die Komplexität der erzielten Wirkung und die damit verbundenen neuen Erkenntnis und Behandlungsmöglichkeiten andererseits fordern sowohl bei Forschungsvorhaben als auch bei der klinischen Anwendung der THS die rigorose Berücksichtigung ethischer Fragestellungen. An der Basis dieser ethischen Überlegungen steht einmal unser grundsätzliches Verständnis von Gesundheit und Lebensqualität, zum anderen die Berücksichtigung der personalen Identität.
Der deutsche nationale Ethikrat [10] hat im Jahr 2006 eine Diskussion über Neuroimplantate geführt. Bedenken und skeptische Reaktionen gegenüber der Informations und Kommunikationstechnologie betreffen vor allem folgende Fragen:• Führt der Einsatz von Neuroim
plantaten zu psychischen Veränderungen?
• Wissen wir noch, wer wir sind, wenn Kommunikations und Informationselektronik Funktionen unseres Gehirns und Nervensystems unterstützt oder ersetzt?
• Können dadurch unser Erkennen, Wahrnehmen und Handeln kontrolliert oder gar manipuliert werden?
Insgesamt ist die generelle Diskussion bezüglich der IKT für die speziellen Fragestellungen bezüglich der tiefen Hirnstimulation wenig hilfreich, da unter diesen Technologien auch Instrumente zur Manipulation und Überwachung von Individuen oder Gruppen subsumiert werden. Für die vielen entweder im ZNS oder peripher eingepflanzten Implantate stellen sich in Abhängigkeit von den Anwendungszielen vielfältige, aber unterschiedliche ethische Fragen.
EveMarie Engels [10] formuliert dies folgendermaßen: "Die Verwendung von Neuroimplantaten und anderen Informations und Kommunikationsimplantaten stellt also eine Gradwanderung dar zwischen einer legitimen oder gar gebotenen medizinischen Anwendung zum Wohle von Kranken und dem Missbrauch dieser Technik, die aus uns im Extremfall ferngesteuerte Roboter machen kann..."
Was die THS betrifft, wurde im Sinne der Selbstbestimmung als vorteilhaft angesehen, dass diese Methode reversibel ist und der Generator jederzeit abgeschaltet werden kann. Auch wenn dieser therapeutische Eingriff rückgängig gemacht und der Impulsgeber wieder entfernt werden kann und somit der Patient wieder in jene Psychopathologie zurückfällt, die vor dem Eingriff bestanden hat, muss aber bedacht werden, dass durch die stereotaktische Implantation der Elektrode auch irreversible Störungen wie blutungsbedingte Nervenzellausfälle möglich sind.
Die Beurteilung der tiefen HirnStimulation muss immer die ideen und kulturgeschichtlichen sowie sozialhistorischen Aspekte berücksichtigen, die in der Vergangenheit den Umgang mit experimentellen psychiatrischen Therapien definiert haben. Die THS

Hinterhuber 142
wird in der Tat von nicht wenigen Psychiatern und interessierten Laien in eine Beziehung zur Psychochirurgie des frühen 20. Jahrhunderts gebracht. Diesbezüglich schreibt aber Heiner Fangerau [4] zurecht, dass die derzeitige ethische Diskussion weniger von den Erfahrungen mit der Psychochirurgie dominiert wird, sondern vielmehr den gesellschaftlichen Umgang mit psychisch Kranken, besonders während der NS-Zeit reflektiert.
Bezüglich der ethischen Aspekte fordert Georg Winterer [24] die Berücksichtigung folgender Punkte:1. den historischen Hintergrund der
nationalsozialistischen Verbrechen an psychisch Kranken und Behinderten im Rahmen der sogenannten EuthanasieProgramme sowie
2. jenen der Psychochirurgie zu berücksichtigen;
3. den Respekt der freien Entscheidung der Patienten uneingeschränkt zu akzeptieren;
4. spezifische Krankheitsmerkmale zu bedenken, die eine Psychose triggern bzw. zu einer nachhaltigen psychischen Traumatisierung führen können;
5. besondere Standards bei der Diagnostik und beim Einschluss in die Studie bzw. bei der Erstellung des Studienprotokolls zu erfüllen;
6. die strikte wissenschaftliche Fundierung des Studiendesigns einzuhalten;
7. externe Supervision der beteiligten Studienärzte und regelmäßige Patientengespräche durch studienunabhängige externe Ärzte zu garantieren.
Tief im Menschen verwurzelt ist und bleibt das Unbehagen, durch ein technischchirurgisches Verfahren die Stimmungslage und das Verhalten des Menschen zu beeinflussen. Besonders problematisch erscheint für viele eine mögliche künftige Indikationserweiterung. Ist die Nutzung der tiefen HirnStimulation zur Verbesserung des geistigen Leistungsvermögens
(Neuroenhancement) denkbar? Kann die THS als krankheitsbezogene Therapie klar von einer gewünschten, krankheitsunabhängigen Steigerung von Funktionen abgegrenzt werden? Wie kann die Möglichkeit einer externen Manipulation des Stimulators ausgeschalten werden?
R. Capurro, Mitglied des European Group on Ethics, betont das ethische Konzept der Unversehrtheit des menschlichen Körpers. Zur Freiheit der Forschung in der Medizin sagt er [10] "Das ethische Konzept der Unversehrtheit des menschlichen Körpers sollte nicht als Hemmnis für den Fortschritt in Wissenschaft und Technik, sondern als ein Schutzwall gegen den potentiellen Missbrauch dieses Fortschrittes betrachtet werden."
M. Tatagiba, Direktor der Neurochirurgischen Klinik in Tübingen, appelliert zur Wachsamkeit bei der Anwendung der THS, da durch entsprechende Stimulationen des Gehirns auch Verhaltensänderungen des betreffenden Menschen und Veränderungen seiner Persönlichkeit möglich sind: "Umso mehr muss man vorsichtig sein und aufpassen!" [10].
Abschließend kann somit festgehalten werden: Die Implantation einer Elektrode zur tiefen HirnStimulation ist dann ethisch zu rechtfertigen, wenn kein weniger invasives Verfahren zur Verwirklichung des Therapiezieles existiert. Bei geschäftsunfähigen Personen ist die THS nur im Einklang mit den Übereinkommen des Europarates über Menschenrechte und Biomedizin anzuwenden.
Die Indikationsstellung zur THS muss rigorose Kriterien erfüllen. In diesen Prozess ist auch die lokale Ethikkommission einzubinden. Auch sollte die Durchführung der THS bei psychiatrischen Erkrankungen auf wenige (europäische) Zentren beschränkt bleiben. Sicherzustellen ist genauso ein fairer Zugang zu dieser therapeutischen Methode. Die Indikationsstel
lung muss nach gesundheitlichen Kriterien, nicht nach der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung des Patienten erfolgen.
Literatur
[1] Arends M, Winterer G. Tiefe Hirnstimulation bei Schizophrenie Ein neues Forschungsprojekt. Der Nervenarzt Suppl 4, S470, 2008.
[2] Bandini F, Primavera A, Pizzorno M et al. Using STN DBS and medication reduction as a strategy to treat pathological gambling in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2007 Aug;13(6):36971.
[3] Bogerts B. Tiefe Hirnstimulation bei Abhängigkeitserkrankungen Hinweise für eine mögliche neue Indikation. Mitteilung DGPPNKongress Berlin 2008.
[4] Fangerau H. Zukunft ohne Herkunft? Die historische Dimension ethischer Dilemmata in der tiefen Hirnstimulation. Der Nervenarzt Suppl 4, S471, 2008.
[5] Greenberg BD, Malone DA, Friehs GM, Rezai AR, Kubu CS, Malloy PF, Salloway SP, Okun MS, Goodman WK, Rasmussen SA: Threeyear outcomes in deep brain stimulation for highly resistant obsessivecompulsive disorder. Neuropsychopharmacology 2006; 31: 2394
[6] Hamani C, McAndrews MP, Cohn M, Oh M, Zumsteg D, Shapiro CM, Wennberg RA, Lozano AM. Memory enhancement induced by hypothalamic/fornix deep brain stimulation. Ann Neurol 2008 Jan;63(1):119123
[7] Kuhn J. Die Anwendung der tiefen Hirnstimulation bei psychiatrischen Erkrankungen ein Überblick. Der Nervenarzt Suppl 4, S471, 2008.
[8] Lozano AM, Mayberg H, Giacobbe P, Hamani C, Craddock C, Kennedy SH. Subcallosal Cingulate Gyrus Deep Brain Stimulation for TreatmentResistant Depression. Biol Psychiatry 2008;64(6):461467.
[9] Mayberg HS, Lozano AM, Voon V, Mc Mayberg HS, Lozano AM, Voon V, McNeely HE, Seminowicz D, Hamani C, Schwalb JM, Kennedy SH. Deep Brain Stimulation for TreatmentResistant Depression. Neuron 2005; 45: 651660.
[10] Nationaler Ethikrat: Forum Bioethik Neuroimplantate: Stimulus oder Steuerung?, 25.1.2006. http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/pdf/Wortprotokoll_FB_20060125.pdf
[11] Neuner I, Schneider F. Tiefe Hirnstimulation bei psychischen Erkrankungen. Indikation in Einzelfällen bei Depressionen, Zwangsstörungen, TouretteSyn

Neue Indikationen und ethische Implikationen der tiefen HirnStimulation 143
drom und tardiven Dyskinesien. psychoneuro 2007; 33 (78): 297303.
[12] Nuttin B, Gybels J, Cosyns P, Gabriel L, Meyerson B, Andréewitch S, Rasmussen S, Greenberg B, Friehs G, Rezai AR, Montgomery E, Malone D, Fins JJ. Deep Brain Stimulation for Psychiatric Disorders. Neurosurgery 2002; 51: 519.
[13] Okun MS, Mann G, Foote KD et al. Deep brain stimulation in the internal capsule and nucleus accumbens region: responses observed during active and sham programming. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78(3): 310–314.
[14] Schlaepfer TE, Lieb K. Deep Brain Stimulation for Treatment Refractory Depression. Lancet 2005b; 366: 14201422.
[15] Schlaepfer TE, Cohen M�, Frick C, Ko Schlaepfer TE, Cohen M�, Frick C, Kosel M, Brodesser D, Axmacher N, Joe AJ, Kreft M, Lenartz D, Sturm V. Deep Brain Stimulation to Reward Circuitry Alleviates Anhedonia in Refractory Major Depression. Neuropsychopharmacology 2007; doi: 10. 1038/sj.npp.1301408.
[16] Schlaepfer T.: Hirnstimulationsverfahren bei Therapieresistenz. Der Nervenarzt 2007 Suppl. 3, 78: 575584.
[17] Schlaepfer T.: Stimulationsverfahren in der Psychiatrie. Die Psychiatrie 2008 5: 237243.
[18] Schneider F, Habel U, Volkmann J et al. Deep brain stimulation of the subDeep brain stimulation of the subthalamic nucleus enhances emotional processing in Parkinson disease. Arch Gen Psychiatry 2003; 60 (3): 296–302.
[19] Shapira NA, Okun MS, Wint D et al. Panic and fear induced by deep brain stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 410–12.
[20] Tiefe Hirnstimulation verbessert das Gedächtnis. Hoffnung auf neuen Behandlungsansatz gegen Alzheimer. http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=080130010
[21] Ulla M. et al: Manic behaviour induced by deepbrain stimulation in Parkinson's disease: evidence of substantia nigra implication?, In: Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2006; 77: S. 13631366
[22] VisserVandewalle V, Temel Y, Boon P et al. Chronic bilateral thalamic stimulation: a new therapeutic approach in intractable Tourette syndrome. Report of three cases. J Neurosurg 2003; 99: 1094–1100.
[23] Volkmann J. Tiefe Hirnstimulation. psychoneuro 2007; 33 (78): 271
[24] Winterer G. Tiefenhirnstimulation bei Schizophrenie Ethische Aspekte. Der Nervenarzt Suppl 4, S471, 2008.
[25] Witjas T, Baunez C, Henry JM et al. Addictions in Parkinson’s disease: impact of subthalamic nucleus deep brain stimulation. Mov Disord 2005; 20(8): 1052–1055.
[26] Woopen C. Ethische Fragen im Zusammenhang mit tiefer Hirnstimulation. Der Nervenarzt Suppl 4, S471S472, 2008.
Univ.Prof. Dr. Hartmann HinterhuberUniversitätsklinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Department für Psychiatrie und Psychotherapie; Medizinische Universität Innsbruckhartmann.hinterhuber@imed.ac.at

Schlüsselwörter:
Mild Cognitive Impairment – Depression
– Demenz
Keywords:
Mild Cognitive Impairment – depression
– dementia
Zusammenhang zwischen Mild Cognitive Impairment und De-pressionHintergrund: In dem vorliegenden Artikel soll der Zusammenhang zwischen Depression und dem Krankheitsbild des Mild Cognitive Impairment (MCI) in einem umfassenden Überblick der Publikationen der letzten Jahre behandelt werden. Methoden: Durchsicht der Publikationen zum Thema MCI und depressive Erkrankungen im Alter der letzten Jahre aus der PubMed – Datenbank. Ergebnisse: Aus den Ergebnissen früherer Studien geht nicht klar hervor, ob Depression bei MCI eine Folge der kognitiven Defizite darstellt oder ursächlich an den Defiziten beteiligt ist. Die Vergleichbarkeit der verschiedenen Studienergebnisse ist besonders dadurch eingeschränkt, dass für MCI wie für Depression nach wie vor unterschied
liche Diagnosekriterien sowie Untersuchungsinstrumenten angewandt werden. Schlussfolgerung: MCI und Depression im Alter stehen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang, wobei das gemeinsame Auftreten prognostisch ungünstige Auswirkungen auf beide Erkrankungen hat.
Association of Mild Cognitive Im-pairment (MCI) and depression.Objective: Mild Cognitive Impairment is a heterogeneous entity. Incidence and prevalence of MCI are highly dependent on the diagnostic criteria applied. Geriatric depression is more frequently associated with cognitive deficits and somatic complaints than depression in younger age. Consequently, depressive symptoms in the elderly are often misinterpreted and not treated adequately. The aim of this review is to point out possible explanations for the high incidence of depression in patients with MCI and to compare prior studies who worked on this interrelation. Methods: We review the existing literature on the relationship between MCI and depression. Results: There is no consensus on the question whether depression is the consequence or the cause for cognitive impairment in older people. The comparability of prior studies which dealt with the relationship between depression and
MCI is limited due to the use of different diagnostic criteria and depression scales. Conclusion: It can be concluded that there is an association between MCI and depression which leads to a worse clinical outcome of depression and maybe a faster progression of cognitive decline.
In den westlichen Ländern ist es durch die Verlängerung der Lebenserwartung zu einer Zunahme der dementiellen Erkrankungen des höheren Lebensalters gekommen. Dieser Umstand findet auch Niederschlag in fachinternen Diskussionen [3, 35,37]. In Österreich sind zirka 200.000 Personen von der Alzheimer Demenz betroffen. Der Früherkennung einer Demenz kommt eine entscheidende Bedeutung zu, da sich damit die Möglichkeit eines frühzeitigen Therapiebeginns bietet, mit dem Ziel, den neurodegenerativen Prozess zu verlangsamen oder gar aufzuhalten. Leichte kognitive Störungen, die noch nicht die Kriterien einer Demenz erfüllen, werden unter dem Begriff Mild Cognitive Impairment (MCI ) subsummiert und können mittels neuropsychologischer Testungen objektiv erfasst werden. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass eine altersbedingte abnehmende Gedächtnisleistung nicht automatisch mit einer beginnenden Demenz gleichzusetzen ist. Zusätzliche Schw
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
Zusammenhang zwischen Mild Cognitive Impairment (MCI) und Depression
Michaela Defrancesco1, Josef Marksteiner2, E. A. Deisenhammer1,
Hartmann Hinterhuber1 und Elisabeth M. Weiss1
1 Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Department für
Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Innsbruck2 Landeskrankenhaus Klagenfurt, Abt. für Psychiatrie und Psychotherapie
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 144–150 Übersicht Review

Zusammenhang zwischen Mild Cognitive Impairment (MCI) und Depression 145
ierigkeiten in der Abgrenzung von altersbedingten Störungen ergeben sich durch depressive Erkrankungen, die im höheren Lebensalter vermehrt auftreten, und die häufig ebenfalls mit leichten kognitiven Einbußen einhergehen [40]. In dem vorliegenden Artikel soll der Zusammenhang zwischen Depression und dem Krankheitsbild des Mild Cognitive Impaiment (MCI) in einem umfassenden Überblick der Publikationen der letzten Jahre behandelt werden. Das erste Kapitel setzt sich mit Depression im Alter sowie dem Bild MCI auseinander, für das bis heute keine einheitlichen und allgemein anerkannten Diagnosekriterien vorliegen [36]. Der 2. Teil des Artikels beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Depression und MCI.
Methodik
Für diesen Artikel wurden einige der Wichtigsten Studienergebnisse der im PubMed publizierten Literatur seit 1991 zusammengefasst. Die Internetrecherchen umfassten englische sowie deutsche Artikel zu den Themen MCI und Depression sowie deren Diagnostik, Epidemiologie und Therapie. Bei der Pub.Med Suche wurden unter anderem die Schlüsselworte MCI, Depression, Alzheimer´s disease sowie geriatric depression verwendet.
Mild Cognitive Impairment (MCI)
Das MCI wird von vielen Autoren als Übergangsstadium zwischen gesundem Altern und einem dementiellen Syndrom und somit als prädementielles Stadium angesehen [16, 33]. Es ist unbestritten, dass die Diagnose MCI mit einem erhöhten Risiko, an einer Demenz zu erkranken, einhergeht [34]. Die Inzidenz sowie Prävalenz des MCI ist jedoch nach wie vor stark von den angewandten Diagnosekriterien sowie Klassifikationssystemen
abhängig [11]. Im DSM IV [38] findet man das Konzept des MCI unter „leichte kognitive Störung“ definiert. Hierunter wird eine Beeinträchtigung von zumindest zwei kognitiven Funktionen verstanden, welche nicht unbedingt das Gedächtnis betreffen müssen. Diese Defizite müssen einerseits vom Patienten sowie einer Bezugsperson berichtet werden und dürfen andererseits durch keine andere, z.B. organische, Ursache bedingt sein. In den Diagnosekriterien der ICD10 [13] kann die „leichte kognitive Beeinträchtigung“ bereits bei einer Einschränkung in nur einem Leistungsbereich gestellt werden. In beiden Klassifikationssystemen ist festgelegt, dass beim Vorliegen eines MCI die Alltagsfunktionen nicht beeinträchtigt sind und die Kriterien einer Demenz nicht erfüllt werden. Um die Diagnose MCI zu stellen, sind Kurztests wie der Mini Mental Status Test [17] sicherlich aufgrund der geringen Sensitivität nicht ausreichend [23]. Empfehlenswert sind ausführliche Tests zur Prüfung der Gedächtnisleistung, der Exekutivfunktionen sowie die Überprüfung von Aufmerksamkeit, VisuoKonstruktion, Sprache und Sprach assoziierten Funktionen. Wenn die diagnostischen Kriterien eines MCI erfüllt sind, sollten die betroffenen Patienten im Abstand von 612 Monaten neuropsychologisch sowie mit bildgebenden Verfahren kontrolliert werden, um eine Konversion zur Demenz so früh als möglich erkennen zu können.
Depressive Störungen im Alter
Während die Diagnose MCI bis heute nicht eindeutig definiert ist und somit immer wieder zu diagnostischen Schwierigkeiten in der Praxis führt, liegen für die verschiedenen depressiven Störungen genaue im DSMIV sowie ICD10 beschriebene Diagnosekriterien vor. Nach den Kriterien des ICD10 können die Affektiven Störungen einerseits in depressive
Episoden bzw. rezidivierende depressive Störungen, und andererseits in anhaltende affektive Störungen eingeteilt werden. Eine weitere Gruppe stellen die „anderen affektiven Störungen“ dar. Im DSMIV werden depressive Störungen in drei Subgruppen unterteilt: 1. die Major Depression, 2. die Dysthyme Störung und 3. die nicht näher bezeichnete Störung. Beim alten Menschen jedoch kann eine depressive Störung hinsichtlich der Ausprägung von psychischen, kognitiven und somatischen Symptomen vom klassischen Bild abweichen. Besonders somatische Symptome, Schlafstörungen und Störungen der Konzentration sowie der Aufmerksamkeit können im Vergleich zu subjektiv geschilderter depressiver Stimmungslage stärker ausgeprägt sein. Durch die atypische Symptomatik wird geriatrische Depression häufig nicht erkannt und die Patienten folglich nicht einer antidepressiven Therapie zugeführt, was für die betroffenen Patienten mit einer erhöhten Morbidität, Mortalität sowie einer verminderten Lebensqualität verbunden ist [7,21,28]. Die American Association for Geriatric Psychiatry hat aus diesem Grund eigene Diagnosekriterien für Depression bei Alzheimer Demenz entwickelt.
In Tabelle 1 sind die Diagnosekriterien der Depression bei Alzheimer Demenz aufgelistet:

Defrancesco et al. 146
A. Drei oder mehr der folgenden Symptome welche während der letzten zwei Wochen aufgetreten sind und eine Veränderung des früheren Funktionslevels darstellen. Entweder Punkt 1 oder Punkt 2 müssen vorhanden sein
1. Klinisch signifikant ausgeprägte depressive Stimmung
2. Verminderter positiver Affekt oder Freude als Reaktion auf sozialen Kontakt oder übliche Aktivitäten
3. Soziale Isolation oder sozialer Rückzug
4. Gestörter Appetit
5. Gestörter Schlaf
6. Psychomotorische Verlangsamung oder Agitiertheit
7. Reizbarkeit
8. Energieverlust
9. Gefühl der Wertlosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder unangemessenen Schuldgefühlen
10. Immer wiederkehrende Gedanken an Tod oder Idealisierung, Planung oder Versuche von Suizid
B. Erfüllung der Kriterien der Alzheimer Demenz
C. Depressive Symptome verursachen klinisch signifikanten Distress oder Funktionseinschränkungen
D. Die Symptome treten nicht nur während einer depressiven Episode oder eines Deliriums auf
E. Die Symptome werden nicht durch den direkten physiologischen Effekt von Substanzen verursacht(Medikamente, Alkohol oder Drogenmissbrauch)
F. Die Symptome können nicht besser durch einen anderen Faktor erklärt werden
Spezifisch wenn:
Gemeinsamer Beginn: Beginn vor oder mit den Symptomen der Alzheimer Demenz
Späterer Beginn: Symptome treten nach Beginn der Alzheimer Demenz auf
Spezifisch wenn gemeinsames Auftreten mit:
Einer Psychose der Alzheimer Demenz
Anderem spezifischen Verhaltensstörungen oder Symptomen
Affektive Erkrankung in der Vergangenheit
Tabelle 1: Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease [32], übersetzt aus dem Englischen von Michaela Defrancesco)

Zusammenhang zwischen Mild Cognitive Impairment (MCI) und Depression 147
Neben speziell für alte Menschen adaptierten Diagnosekriterien haben sich auf Altersdepression sensitive ScreeningInstrumente, wie die Geriatric Depression Skale (GDS) als diagnostisch hilfreich erwiesen [41]. Die Vorteile dieser Skalen liegen in ihrer leichten und schnellen Anwendung auch für nicht im Fachgebiet der Psychiatrie tätige Ärzte wie beispielsweise Hausärzte, welche häufig erste Anlaufstelle für depressionsbedingte Beschwerden alter Menschen sind [12]. Leider vermindert sich die Sensitivität wie auch die Spezifität dieser DepressionsFragebögen beim Vorliegen von kognitiven Beeinträchtigungen [29].
Zusammenhang zwischen de-pressiven Störungen und kogniti-ven Beeinträchtigungen
Hinsichtlich Prävalenz sowie sozioökonomischer Bedeutung zählen demenzielle Erkrankungen und depressive Störungen zu den bedeutendsten Erkrankungen des Alters [39]. Eine Unterscheidung zwischen vorübergehender kognitiver Beeinträchtigung aufgrund von depressiven Störungen und einem prädementiellen Syndrom kann sich jedoch im Querschnitt als durchaus schwierig erweisen. Dabei lassen sich folgende Kombinationsmöglichkeiten unterscheiden:• Die kognitiven Beeinträchtigun
gen treten im Rahmen von depressiven Episoden, organisch bedingten Depressionen oder depressiven Anpassungsstörungen auf.
Auch Altersdepressionen gehen häufig mit leichten kognitiven Einbußen, wie Defiziten in Aufmerksamkeits und Gedächtnisleistungen [25] aber auch einer Reduktion in der Geschwindigkeit der Prozessierung von neuen Informationen einher [31].
• Komorbidität von MCI und depressiven Erkrankungen: Gerade beim Fortschreiten der de
mentiellen Symptomatik konnte gezeigt werden, dass ein hoher Prozentsatz (2040%) der mit Alzheimer Demenz diagnostizierten Patienten zusätzlich an einer Depression litten [10]. Auch bei Patienten, die an MCI leiden zeigte sich eine hohe Prävalenz von Depressionen [11, 24]. Des Weiteren konnten in den letzten Jahren Studien Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Depressionen bei älteren Patienten und der zukünftigen Entwicklung einer Demenzerkrankung aufzeigen[5].
• Depressive Anpassungsstörungen als Reaktion auf subjektiv wahrgenommene kognitive Defizite.
Der Zusammenhang zwischen Depression und der Diagnose MCI wird in der Literatur nach wie vor sehr kontrovers gesehen und ein Konsens bezüglich der Frage, ob Depression ein Risikofaktor, ein Symptom oder die Folge von MCI darstellt, konnte bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erreicht werden. Einige Studien konnten nachweisen, dass das gleichzeitige Vorhandensein von MCI und Depression das Risiko steigert, an einer Demenz zu erkranken [24] bzw. dass depressive Patienten mit MCI schneller eine Demenz entwickeln als nicht depressive Patienten [30]. Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse von Dufouil et al.[14],die zeigten, dass eine hohe Assoziation zwischen Depression und kognitiven Defiziten besteht, depressive Störungen aber keinen Risikofaktor für die Entwicklung eines MCI oder einer Demenz darstellten. In einer Studie von Adler [1] an depressiven Patienten über 60 Jahren konnte kein signifikanter negativer Einfluss von Depression auf kognitive Leistungen gefunden werden. Einschränkend muss jedoch festgestellt werden, dass in dieser Studie lediglich 18 Personen mit einer Komorbidität von MCI und Depression untersucht wurden. Des
Weiteren war die gewählte followup Zeitspanne von 6 Monaten im Vergleich zu anderen Studien sehr kurz bemessen. Geda et al. [19] untersuchten eine Kohorte von 840 gesunden älteren Probanden. Nach einem followup von 3.5 Jahren hatten 17% der untersuchten Probanden eine depressive Störung entwickelt. Von diesen 17% zeigten 13.3% das Bild eines MCI während von den nicht depressiven Probanden lediglich 4.9% ein MCI entwickelten. Die Ergebnisse zeigten, dass Depression das Risiko der normal alternden Bevölkerung mehr als verdoppelt, an MCI zu erkranken. Der Schweregrad der Depression hatte in dieser Studie keinen Einfluss auf die Entwicklung eines MCI. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine weitere Studie, die aufzeigen konnte, dass Faktoren wie Traurigkeit, Konzentrationsstörungen, pessimistisches Denken sowie Mattigkeit (erhoben mit der Montgomery Asberg Depression Rating Skale) bei über 89% der untersuchten älteren Patienten vorhanden waren. Unabhängig vom Schweregrad der Depression waren funktionelle Einschränkungen sowie eine verschlechterte Lebensqualität mit depressiven Symptomen assoziiert [18].
Ein umfassender Review von Jorm et al. [22] ergab, dass die drei wahrscheinlichsten Hypothesen zum Zusammenhang von Depression und demenziellen Erkrankungen die Folgenden sind:• Depression kann ein frühes
Symptom demenzieller Erkrankungen sein
• Depression kann die Manifestation von demenziellen Erkrankungen beschleunigen
• Depression kann durch eine Steigerung des Glucokortikoidspiegels den Hippocampus schädigen und in der Folge zu einer verminderten Gedächtnisleistung führen

Defrancesco et al. 148
Neben nierenAchse führen [43]. Etwa 4070 % der Patienten mit depressiven Störungen weisen neben einem Hyperkortisolismus einen pathologischer Dexamethason Sup pres sionstest auf [4]. Lupien et al. [26] konnte zeigen, dass erhöhte Kortisolspiegel mit einem verminderten Hippokampusvolumen sowie Gedächtnisdefiziten einher-gehen.
Hypothese B: Gemeinsame Risi-kofaktoren für MCI und De-pressionEmpfindliche Genvarianten und anderer Risikofaktoren wie z.B. Hyperkortisolismus, können unabhängig voneinander Depression sowie MCI verursachen. Insbesonders vaskuläre Erkrankungen wie Hypertonie, Myokardinfarkt sowie die vaskuläre Demenz weisen hohe Prävalenzraten von Depression auf [2]. Der derzeitige Wissensstand über die Ätiologie von Depression wie auch MCI zeigt allerdings keine signifikanten Überschneidungen von Risikofaktoren dieser beiden Erkrankungen [22].
Hypothese C: Die Depression stellt eine frühe Manifestation des präklinischen MCI dar, oder ist eine frühe Reaktion auf ein be ginnendes MCI.Dieser Theorie zufolge ist Depression lediglich die Folge vom subjektiven Wahrnehmen beginnender kognitiver Einschränkungen ohne nachweisbare neuropathologische Ursachen [7].
Hypothese D: Die Depression ist nur dann ein Risikofaktor für MCI, wenn empfindliche Genvarianten oder andere Risikofaktoren vor-handen sind.Laut dieser Theorie spielt die Depression lediglich als verstärkender Kofaktor in der Entstehung des MCI eine Rolle.Für diese Hypothese spricht, dass depressive Symptome bei älteren Menschen vermehrt bereits in der präklinischen Phase der Alzheimer
ein MCI zu entwickeln, mit der Anzahl von bestehenden depressiven Symptomen [6].Das Erkrankungsalter beim Auftreten von Depressionen scheint einen Einfluss auf das Ausmaß der neurokognitiven Beeinträchtigung zu haben. Besonders die lateonset depression weist mehr kognitive wie auch neuroradiologische Veränderungen sowie einen höheren Grad der Funktionseinschränkung der Betroffenen im Vergleich zur earlyonset depression auf [2]. Des Weiteren können bei Patienten mit depressiven Störungen Verän
de rungen der HypothalamusHypophysen Nebennierenachse gefunden werden [20]. Bei Depression kann häufig eine erhöhte Sekretionsrate von Kortikosteroiden gefunden werden [42], vermutlich bedingt durch eine Erhöhung bzw. Fehlfunktion der Glukokortikoid – Rezeptoren, die zu einem gestörten feedback Mechanismus in der HypothalamusHypophysen
Jorm et al. folgerten aus den Ergebnissen seines Reviews, dass ein Zusammenhang zwischen Depression und demenziellen Erkrankungen mit Sicherheit besteht, seine Ursachen jedoch multikausal zu sehen sind.Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Geda et al. [19], welche die in Tabelle 2 dargestellten vier grundlegenden Theorien zum Thema Depression und MCI veröffentlichten.
Hypothesen über den Zusammenhang von Depression und MCI nach Geda et al. [19]
MCI: Mild Cognitive Impairment
Hypothese A: Depression als Risi-ko faktor für die Entwicklung de-menzieller ErkankungenDas Auftreten von Depression im Alter kann die Progression sowie Konversion in eine Demenz beeinflussen [18]. Bei älteren Menschen ohne kognitive Funktionsstörung steigt das Risiko,
Tabelle 2: Hypothesen über den Zusammenhang von Depression und MCI

Zusammenhang zwischen Mild Cognitive Impairment (MCI) und Depression 149
Demenz gefunden werden können [8]. Das Auftreten der Depression als Kofaktor in der Entstehung des MCI kann aufgrund der Ergebnisse früherer Studien weder eindeutig bestätigt noch ausgeschlossen wer den. Es geht jedoch aus früheren Daten deutlich hervor, dass demenzielle Erkrankungen zu einem hohen Prozentsatz mit depressiven Störungen bei alten Menschen einhergehen [27].Da der pathologische Prozess der Alzheimer Demenz nach Annahme vieler Autoren bereits lange vor den klinischen Symptomen beginnt [15], beschäftigten sich viele Studien der letzten Jahre mit der Erforschung von genetischen Varianten [9] sowie Biomarkern [12], welche in der Pathogenese demenzieller Erkrankungen involviert sein könnten.
Zusammenfassung
Aus den Ergebnissen bisherigen Studien lässt sich zusammenfassend feststellen, dass MCI einen wichtigen Prädiktor für demenzielle Erkrankungen darstellt und in vielen Fällen in eine Demenz übergeht. Des Weiteren liegen ausreichend Studienergebnisse vor, die kognitive Defizite bei geriatrischer Depression beschreiben. Welche Rolle depressive Störungen des Alters in der Pathogenese von demenziellen Erkran kungen spielt, ist bislang nicht hinreichend geklärt. Weitere Studien sind notwendig, die sich mit der Frage auseinander setzen, ob Depressionen einen Risikofaktor, ein Symptom oder die Folge von MCI darstellen.Auch wenn in den vergangenen Jahren viele Studien veröffentlich wurden, welche sich mit MCI und dem Vorkommen von Depression bei älteren Menschen beschäftigt haben, sind die kausalen Zusammenhänge dieser beiden Erkrankungen nach wie vor nicht hinreichend geklärt. Trotz der hohen Komorbidität von Depression
und kognitiver Beeinträchtigung im Alter, sollten jedoch beide Entitäten als auch unabhängig voneinander vorkommende Diagnosen gesehen werden. Es ist sicherlich besonders bei älteren Menschen mit MCI von großer Wichtigkeit, Depression früh zu diagnostizieren und zu therapieren, anstatt depressive Stimmung im Alter als tolerierbare Nebenerscheinung des normalen Alterungsprozesses zu sehen.
Literatur
[1] Adler, G.; Chwalek, K.; Jajcevic, A. Sixmonth course of mild cognitive impairment and affective symptoms in latelife depression. European Psychiatry 19: 502505; (2004).
[2] Alexopoulos, G. S. Role of executive function in latelife depression. Journal of Clinical Psychiatry 64: 1823; (2003).
[3] Alf C., Bancher C., Benke T., Konsensusstatement „Demenz“ der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft ,Update 2006 Neuropsychiatrie: 20, 221–231(2006)
[4] Arana GW, Baldessarini RJ, and Orn-steen M: The Dexamethasone Suppression Test for Diagnosis and Prognosis in Psychiatry Commentary and Review. Archives of General Psychiatry 42:11931204, (1985).
[5] Artero S, Ancelin ML, Portet F, Dupuy A, Berr C, Dartigues JF, Tzourio C, Rouaud O, Poncet M, Pasquier F, Au-riacombe S, Touchon J, Ritchie K. Risk profiles for mild cognitive impairment and progression to dementia are gender specific. J Neurol Neurosurg Psychiatry. [Epub ahead of print] (2008).
[6] Barnes, D. E.; Alexopoulos, G. S.; Lopez, O. L.; Williamson, J. D.; Yaffe, K. Depressive symptoms, vascular disease, and mild cognitive impairment Findings from the cardiovascular health study. Archives of General Psychiatry 63: 273280; (2006).
[7] Bassuk, S. S.; Berkman, L. F.; Wypij, D. Depressive symptomatology and incident cognitive decline in an elderly community sample. Archives of General Psychiatry 55: 10731081; (1998).
[8] Berger, A. K.; Fratiglioni, L.; Forsell, Y.; Winblad, B.; Backman, L. The occurrence of depressive symptoms in the preclinical phase of AD A populationbased study. Neurology 53: 19982002; (1999).
[9] Bird TD. Genetic factors in Alzheimer's disease. N Engl J Med.;352(9):8624; (2005).
[10] Birrer, R. B.; Vemuri, S. P. Depression in later life: A diagnostic and therapeutic challenge. American Family Physician 69: 23752382; (2004).
[11] Busse, A.; Bischkopf, J.; Riedel-Heller, S. G.; Angermeyer, M. C. Mild cognitive impairment: prevalence and incidence according to different diagnostic criteria Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). British Journal of Psychiatry 182: 449454; (2003).
[12] Clark CM, Davatzikos C, Borthakur A, Newberg A, Leight S, Lee VMY, and Trojanowski JQ: Biomarkers for early detection of Alzheimer pathology. Neurosignals 16:1118, (2008).
[13] Dilling H, Mombour W, Schmid MH et al. Weltgesundheitsorganisation: Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD−10. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber, (1994).
[14] Dufouil, C.; Dartigues, J. F.; Fuhrer, R. Depressive Symptoms in French Elderly An UrbanRural Comparison. Revue Epidemiologie et de Sante Publique 43: 308315; (1995).
[15] Ferri, C. P.; Prince, M.; Brayne, C.; Brodaty, H.; Fratiglioni, L.; Ganguli, M.; Hall, K.; Hasegawa, K.; Hendrie, H.; Huang, Y. Q.; Jorm, A.; Mathers, C.; Menezes, P. R.; Rimmer, E.; Scazufca, M. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 366: 21122117; (2005).
[16] Flicker, C.; Ferris, S. H.; Reisberg, B. Mild Cognitive Impairment in the Elderly Predictors of Dementia. Neurology 41: 10061009; (1991).
[17] Folstein, M. F.; Folstein, S. E.; Mchugh, P. R. MiniMental State Practical Method for Grading Cognitive State of Patients for Clinician. Journal of Psychiatric Research 12: 189198; (1975).
[18] Gabryelewiez, T.; Styczynska, M.; Luczy-wek, E.; Barczak, A.; Pfeffer, A.; Andro-siuk, W.; Chodakowska-Zebrowska, M.; Wasiak, B.; Peplonska, B.; Barcikowska, M. The rate of conversion of mild cognitive impairment to dementia: predictive role of depression. International Journal of Geriatric Psychiatry 22: 563567; (2007).
[19] Geda, Y. E.; Knopman, D. S.; Mrazek, D. A.; Jicha, G. A.; Smith, G. E.; Negash, S.; Boeve, B. F.; Ivnik, R. J.; Petersen, R. C.; Pankratz, V. S.; Rocca, W. A. Depression, apolipoprotein E genotype, and the incidence of mild cognitive impairment A prospective cohort study. Archives of Neurology 63: 435440; (2006).
[20] Holsboer F: Stress, hypercortisolism and corticosteroid receptors in depression: implicatons for therapy. Journal of Affective Disorders 62:7791, (2001).

Defrancesco et al. 150
[21] Hybels, C. F.; Blazer, D. G. Epidemiology of latelife mental disorders. Clinics in Geriatric Medicine 19: 663; (2003).
[22] Jorm, A. F. History of depression as a risk factor for dementia: an updated re-view. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 35: 776781; (2001).
[23] Kukull, W. A.; Larson, E. B.; Teri, L.; Bowen, J.; Mccormick, W.; Pfanschmidt, M. L. The MiniMentalStateExamination Score and the ClinicalDiagnosis of Dementia. Journal of Clinical Epidemiology 47: 10611067; (1994).
[24] Lebowitz, B. D.; Pearson, J. L.; Schnei-der, L. S.; Reynolds, C. F.; Alexopoulos, G. S.; Bruce, M. L.; Conwell, Y.; Katz, I. R.; Meyers, B. S.; Morrison, M. F.; Mossey, J.; Niederehe, G.; Parmelee, P. Diagnosis and treatment of depression in late life Consensus statement update. Journal of the American Medical Association 278: 11861190; (1997).
[25] Lockwood, K. A.; Alexopoulos, G. S.; Kakuma, T.; Van Gorp, W. G. Subtypes of cognitive impairment in depressed older adults. American Journal of Geriatric Psychiatry 8: 201208; (2000).
[26] Lupien, S. J.; de Leon, M.; de Santi, S.; Convit, A.; Tarshish, C.; Thakur, M.; Mcewen, B. S.; Hauger, R. L.; Meaney, M. J. Cortisol levels during human aging predict hippocampal atrophy and memory deficits. Nature Neuroscience 1: 6973; (1998).
[27] Lyketsos, C. G.; Lopez, O.; Jones, B.; Fitzpatrick, A. L.; Breitner, J.; DeKo-sky, S. Prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia and mild cognitive impairment Results from the Cardiovascular Health Study. Journal of the American Medical Association 288: 14751483; (2002).
[28] Malaguarnera, M.; Ferri, R.; Bella, R.; Alagona, G.; Carnemolla, A.; Pennisi, G. Homocysteine, vitamin B12 and folate in vascular dementia and in Alzheimer disease. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 42: 10321035; (2004).
[29] McGivney SA, Mulvihill M, and Taylor B: Validating the Gds Depression Screen in the NursingHome. Journal of the
American Geriatrics Society 42:490492, (1994).
[30] Modrego, P. J.; Ferrandez, J. Depression in patients with mild cognitive impairment increases the risk of developing dementia of Alzheimer type A prospective cohort study. Archives of Neurology 61: 12901293; (2004).
[31] Nebes, R. D.; Butters, M. A.; Mulsant, B. H.; Pollock, B. G.; Zmuda, M. D.; Houck, P. R.; Reynolds, C. F. Decreased working memory and processing speed mediate cognitive impairment in geriatric depression. Psychological Medicine 30: 679691; (2000).
[32] Olin, J. T.; Schneider, L. S.; Katz, I. R.; Meyers, B. S.; Alexopoulos, G. S.; Breitner, J. C.; Bruce, M. L.; Caine, E. D.; Cummings, J. L.; Devanand, D. P.; Krishnan, K. R. R.; Lyketsos, C. G.; Lyness, J. M.; Rabins, P. V.; Reynolds, C. F.; Rovner, B. W.; Steffens, D. C.; Tariot, P. N.; Lebowitz, B. D. Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease. American Journal of Geriatric Psychiatry 10: 125128; (2002).
[33] Petersen, R. C.; Doody, R.; Kurz, A.; Mohs, R. C.; Morris, J. C.; Rabins, P. V.; Ritchie, K.; Rossor, M.; Thal, L.; Win-blad, B. Current concepts in mild cognitive impairment. Archives of Neurology 58: 19851992; (2001).
[34] Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, and Kokmen E: Mild cognitive impairment Clinical characterization and outcome. Archives of Neurology 56:303308, (1999).
[35] Ransmayr G, Katzenschlager R, Dal-Bianco P, Wenning G, Bancher Ch, Jell-inger K, Schmidt R, Poewe W, Konsensus – Statement: Lewy – Körperchen Demenz und ihre differentialdiagnostische Abgrenzung von der Alzheimer´schen Erkrankung. Neuropsychiatrie: 21, 6374, (2007)
[36] Ritchie, K.; Artero, S.; Touchon, J. Classification criteria for mild cognitive impairment A populationbased validation study. Neurology 56: 3742; (2001).
[37] Schmid R., Assem-Hilger E, Benke Th, Dal-Bianco P, Delazer M, Ladurner G,
Jellinger K, Marksteiner J, Ransmayer G, Schmidt H, Stögmann E, Wancata j, Geschlechtsspezifische Unterschiede der Alzheimer – Demenz. Neuropsychiatrie: 22, 115, (2008)
[38] Saß H. Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen. Wittchen HU, Zaudig M. (Hogrefe Verlag). (1994).
[39] Stoppe, G. Chief psychiatric problems in old age. (Internist). (2000).
[40] Stoppe G and Staedt J: Early Diagnostic Differentiation Between Primary Degenerative Dementia and Primary Depressive Syndromes in the Elderly A Contribution to Pseudodementia Discussion. Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 61:172182, (1993).
[41] Wancata J, Alexandrovic R, Marquart B, Weiss M, and Friedrich F: Shows the Geriatric Depression Scale (GDS) among the elderly a higher screening accuracy than other screening instruments? Neuropsychiatrie 20:240249, (2006).
[42] Wolkowitz, O. M.; Reus, V. I.; Wein-gartner, H.; Thompson, K.; Breier, A.; Doran, A.; Rubinow, D.; Pickar, D. Cognitive Effects of Corticosteroids. American Journal of Psychiatry 147: 12971303; (1990).
[43] Young, A. H. Antiglucocoticoid treatments for depression. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 40: 402405; (2006).
Elisabeth M. Weiss, Priv. Doz. Dr. rer. nat. Dr. med.Univ.Klinik für Allgemeine Psychiatrie und SozialpsychiatrieMedizinische Universität Innsbruckelisabeth.weiss@imed.ac.at

Schlüsselwörter:
psychische Erkrankungen – körperliche
Aktivität
Key words:
severe mental illness – physical activity
Körperliche Aktivität bei Men-schen mit schweren psychischen Erkrankungen: Stand der Forsc-hung und praktische Empfehlun-genIn der Fachliteratur finden sich alarmierende Hinweise auf eine deutlich reduzierte Lebenserwartung von psychiatrischen Patienten und damit verknüpft die Forderung nach verbesserten Strategien zum Management kardiovaskulärer und behavioraler Risikofaktoren. Durch die Integration von körperlicher Aktivität in die Behandlung von Patienten mit schweren psychischen Beeinträchtigungen kann eine Verbesserung des somatischen Zustandsbildes dieser Patientengruppe erreicht werden; positive Auswirkungen in den Bereichen psychischer und sozialer Befindlichkeit könnten erwünschte Begleiterscheinungen dieser Strategie sein. In der klinischen Routine, vor allem in der Rehabilitation scheint durch
eine gezielte Behandlungsplanung im Rahmen eines biopsychosozial ausgerichteten, verantwortlichen ‚case managements’ ein Potential zu liegen, das durch eine enge Kooperation von Psychiatrie und Gesundheitspsychologie optimiert werden könnte.
Physical activity in persons with se-vere mental illness: research-based clinical recommendationsRecent data show alarming reduction of lifeexpectancy in patients with severe mental illness; due to these findings strategies to reduce cardiovascular and behavioural risk factors are needed. Integrating physical activity programs into psychiatric services can improve physical health outcomes of patients with serious mental illness and may produce improvements in psychological and social outcomes. Thus, recoveryoriented treatment strategies may benefit from a biopsychosocial approach and a case management concept including concepts derived from psychiatry and health psychology.
Verkürzte Lebenserwartung psychiatrischer Patienten und mögliche Ursachen
In der Fachliteratur findet in den vergangenen Jahren zunehmend mehr die deutlich reduzierte Lebenserwartung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen Beachtung (Fleischhacker, 2008, Newcomer, 2007). Derzeit gibt es vor allem Nachweise für die Diagnosegruppen Schizophrenie und affektive Störungen. In den vereinigten Staaten von Amerika ist bei Patienten mit schwerer psychischer Erkrankung, die im öffentlichen Gesundheitswesen behandelt werden, von einer um ca. 30% verkürzten Lebenserwartung auszugehen (Colton, 2006). Neuere Daten belegen, dass die Ursachen für ein vorzeitiges Ableben bei dieser Patientengruppe nicht ausschließlich als krankheitsimmanentes Gesundheitsrisiko zu erachten sind; in einer britischen Studie lässt sich das erhöhte Risiko für psychiatrische Patienten an einer kardiovaskulären Erkrankung oder an einem Schlaganfall zu versterben nicht ausreichend durch die psychopharmakologische Medikation, durch soziale Vereinsamung und Rauchen erklären (Osborn, 2007). In der Diskussion über relevante Behandlungs und Forschungsstrategien wird eine vermehrte Kooperation der verschiedenen Disziplinen, die in die
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
Körperliche Aktivität bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen: Stand der Forschung und praktische Empfehlungen
Martin Kopp
Department für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Innsbruck
Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Fachbereich Klinische-
und Gesundheitspsychologie
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 151–156 Übersicht Review

Kopp 152
Behandlung psychiatrischer Patienten integriert sind, angeregt (Fleischhacker, 2008).
Änderung des Gesundheitsverhaltens bei psy chia trischen Patienten
Neben Veränderungen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und einer Verbesserung der interdisziplinären medizinischen Betreuung sollten bereits bewährte allgemeinpräventive Strategien zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens von psychiatrischen Patienten überprüft werden; insbesondere scheint für die Gruppe der psychiatrischen Patienten neben der regelmäßigen Erfassung kardiovaskulärer Risikofaktoren und einem Monitoring der antipsychotischen Medikation eine Ausrichtung der Forschungsaufmerksamkeit auf das Ernährungs und Bewegungsverhalten erforderlich (Osborn, 2007). Im Rahmen der Verbesserung des Gesundheitsverhaltens bei psychiatrischen Patienten ist der Bereich der körperlichen Aktivität als besonders relevant einzustufen: einerseits gibt es von den jeweiligen kardiologischen Gesellschaften (zB Österreichischer Herzfonds, British Heart Foundation) Übereinstimmung, dass eine Erhöhung der körperlichen Aktivität das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen reduzieren kann, andererseits gibt es eine Reihe von Daten, die auf eine Besserung der psychischen Befindlichkeit durch körperliche Aktivität verweisen.
Physiologische Auswirkungen körperlicher Aktivität
Im Vergleich zu körperlich aktiven Menschen haben Menschen mit unzureichender Bewegung ein deutlich erhöhtes Risiko für das Auftreten von Diabetes, koronaren Herzerkrankungen, Bluthochdruck und viele andere
chronische Erkrankungen. Die positiven Auswirkungen von Lebensstilveränderungen, einschließlich Ernährung und Bewegung wurde in vielen klinischen Versuchsanordnungen nachgewiesen; eines der eindrucksvollsten Ergebnisse lieferte die Diabetes Präventionsstudie von Knowler et al (2002), die mit mehr als 3000 Teilnehmern ein intensives Diät und Bewegungsprogramm mit einer Standardbehandlung und einer Gruppe mit medikamentöser Diabetesprophylaxe (Metformin) miteinander verglichen; es zeigte sich eine mehr als 60%ige Reduktion des Diabetesrisiko in der DiätBewegungsgruppe, ein Effekt, der mehr als doppelt so stark wie die Medikation war; die Ergebnisse waren derart überzeugend, dass die DatenmonitoringKommission eine vorzeitige Beendigung der Versuchsanordnung beschloss. Ähnlich beeindruckend zeigten sich Studien zur kardiovaskulären Prophylaxe; selbst in Risikogruppen zeigte sich über eine Intervention zur Erhöhung der körperlichen Aktivität eine nahezu 60% Reduktion gemessen an Herzattacken, stationären Aufnahmen und Todesfällen (Belardinelle, 1999). Körperliche Aktivität spielt auch für die Bereiche Gewichtsreduktion und Übergewichtsvermeidung in der Allgemeinbevölkerung eine wesentliche Rolle; eine Argumentation für die Förderung körperlicher Aktivität ist, dass übergewichtige sporttreibende Menschen in einem besseren Gesundheitszustand sein dürften als nicht körperlich aktive Menschen ohne Übergewicht (Blair, 1999).
Auswirkungen körper licher Aktivität bei psychischen Erkrankungen
Die überzeugendsten Befunde bezüglich einer Verbesserung der psychischen Befindlichkeit in einer klinischen Population kommen aus der klinischen Depressionsforschung. Zwei Metaanalysen berichten von
durchschnittlichen Effektstärken von .72 (Craft, 1998) und 1.1 (Lawlor, 2001) für sportliche Aktivität im Vergleich zu unbehandelten Patienten; beide Metaanalysen zeigten ähnliche Effekte wie psychotherapeutische Interventionen. Interessanterweise wurde in einer Metaanalyse berichtet, dass der Effekt sportlicher Aktivität bei mittel bis schwergradig depressiven Individuen größer war als bei mild bis mäßig depressiven (Craft, 1998). Weniger eindeutige aber ebenfalls positive Effekte wurden für generalisierte Angstsyndrome, Phobien, Panikattacken und Belastungsstörungen beschrieben (O’Conner, 2000).Verbesserungen der psychischen Befindlichkeit in den Bereichen Lebensqualität und emotionales Wohlbefinden bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen wurden mehrfach berichtet (Faulkner, 1999, Hutchinson 1999, Skrinar, 1992), wobei in einem Review von Faulkner (1999) kritisiert wurde, dass zu wenig experimentelle klinische Versuchsanordnungen zur Objektivierung der Veränderungen durchgeführt wurden. In einer Überblicksarbeit (Faulkner, 1999) zum Nutzen sportlicher Aktivität für schizophrene Patienten wurde gefolgert, dass vor allem sekundäre Symptome wie Depression, niedriger Selbstwert und sozialer Rückzug durch sportliche Aktivität verbessert werden können; für manche Patienten scheint sich auch eine Linderung der Positivsymptomatik durch sportliche Aktivität einzustellen. Vor allem im Bereich der sozialen Reintegration psychiatrischer Patienten scheint eine wesentliche Verbesserungsmöglichkeit der Befindlichkeit durch sportliche Aktivität zu liegen; hier scheint es ein Potential zu geben, das zu einer erhöhten Zufriedenheit mit der Behandlung und zu mehr Compliance bezüglich der Medikation führen kann (Richardson, 2005).

Körperliche Aktivität bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen 153
Verbreitung körperlicher Ak tivität bei schweren psychischen Erkrankungen
Menschen mit psychischer Erkrankung sind signifikant weniger körperlich aktiv als die Allgemeinbevölkerung (Brown, 1999, Davidson, 2001, Elmslie, 2001). Die Daten von Brown (1999) zeigen, dass von 140 Schizophreniepatienten nur 15% der Frauen und 19% der Männer innerhalb der vorausgehenden Woche moderat körperlich aktiv waren, was deutlich unter dem Aktivitätsniveau der Allgemeinbevölkerung liegt. Im Vergleich des körperlichen Aktivitätsgrades von schwer psychisch erkrankten Menschen zu einer gesunden Kontrollstichprobe, zeigte sich eine dreifach höhere körperliche Aktivitätsrate in der gesunden Stichprobe (Davidson, 2001). Eine eher bewegungsarme Lebensweise, ungesunde Ernährung und medikamenteninduzierte Gewichtszunahme ließe eine deutlich erhöhte Adipositasprävalenz bei psychisch schwer kranken Menschen erwarten; auf Basis der vorhandenen Daten kann diese Erwartung jedoch nicht eindeutig bestätigt werden. Wovon derzeit auszugehen ist, ist eine Adipositasprävalenz, die zumindest mit der Allgemeinbevölkerung vergleichbar ist. Kombiniert mit einem erhöhten Risiko für übergewichtsassoziierte Folgeerkrankungen wie Diabetes bei Menschen, die eine antipsychotische Medikation einnehmen (Kurzthaler, 2001) ist die Situation als alarmierend einzustufen (Richardson, 2005). Zur Vermeidung von medikamentöser NonCompliance infolge einer befürchteten Gewichtszunahme und zur Reduktion des kardiovakulären Risikos bei adipösen psychiatrischen Patienten sind auf Basis der gegenwärtigen Literatur jedenfalls ernährungs und sportbezogene Interventionen in die Behandlung zu integrieren (Consensus Report, 2004).
Planung effizienter körperlicher Aktivitätsprogramme
Den Richtlinien des American College of Sports Medicine (ACSM) folgend sollte ein minimales sportliches Aktivitätsprogramm zumindest 3 Sporteinheiten pro Woche für die Dauer von 20 bis 60 Minuten beinhalten. Eine Alternative zu derartig strukturierten Ansätzen besteht in der gezielten Erhöhung von körperlicher Aktivität im Alltag durch Lebensstilmodifikationen. Ein konkreter Vorschlag dazu findet sich im Surgeon General’s report (USDHHS, 1996) mit der Empfehlung von einem Minimum von 30 Minuten moderater körperlicher Aktivität (zB schnelles Gehen), die an den meisten – wenn nicht allen Tagen der Woche stattfinden sollte.
Supervidiertes Sportprogramm oder lebensstilbezogene Interven-tionen
Für die Entscheidung, ob ein strukturiertes Sportprogramm oder eine Lebensstilmodifikation Hauptziel der sportbezogenen Intervention für psychiatrische Patienten sein soll, sind mehrere Faktoren abzuwägen. Während strukturierte Aktivitätsprogramme den Vorteil bergen, dass sie sichere und dem Leistungsvermögen angepasste Trainingsintensitäten in einem supervidierten Setting ermöglichen, bleiben die Nachteile erhöhter Kosten für Personal, Räumlichkeiten und Ausstattung. Die Ergebnisse einiger Studien in der Allgemeinbevölkerung sprechen dafür, dass durch Lebensstilmodifikationen nachhaltigere Ergebnisse erzielt werden können als durch strukturierte Aktivitätsgruppen (Richardson, 2005). Für Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen scheint während einer stationären Behandlung insbesondere einer Rehabilitationsbehandlung ein strukturiertes Sportprogramm zielführend; Patienten in ambulanter Betreuung dürften eher von einer Integration
von mehr körperlicher Aktivität in den Alltag profitieren, zumal das regelmäßige Aufsuchen einer teilweise weiter entfernten Einrichtung zum Zwecke sportlicher Aktivität häufig auf Ablehnung stößt. Im optimalen Fall wird der Ablauf eines strukturierten Sportprogrammes im Rahmen einer stationären Betreuung dahingehend ausgerichtet werden, dass es Patienten nach Entlassung leicht fällt, diese Aktivitäten in den Alltag zu übernehmen. Ein häufig unterschätztes Potential liegt im allgemein beliebten Gehen oder ‚walking’, egal ob mit oder ohne Stöcken (‚nordic walking’) zumal diese Sportart für die Gruppe psychiatrischer Patienten die Anforderungen von hoher Sicherheit, niedrigen Kosten sowie örtlicher und zeitlicher Flexibilität optimal gewährleistet. Ebenfalls kostengünstig und anerkannt sind Aktivitätsvideos und Gymnastikgruppen (‚aerobic’) mit moderater Intensität.
Individuelle Abstimmung
Grundsätzlich lässt sich bei Interventionen zur Steigerung der körperlichen Aktivität die Aussage vertreten: je individueller abgestimmt das Programm angeboten wird, desto höher die Erfolgsquote – Berücksichtigung sollten jedenfalls Variablen wie Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status, kultureller Hintergrund, Gesundheitszustand und körperliche Verfassung sowie mögliche Hinderungsgründe finden (Carless, 2008). Weiters scheinen Interventionen, die zusätzlich Informationsmaterialen in gedruckter Form oder computerunterstützt anbieten, effektiver als reine ‚facetoface Interventionen’ (Smith, 2000). Bezüglich der Intensität scheinen Sportarten wie Laufen, Fußball oder Aerobicgruppen weniger erfolgreich als Interventionen, die auf eine moderate sportliche Aktivität wie ‚Walken’ abzielen. Verhaltenstheoretisch gestützte Vorgehensweisen, die neben Zielsetzung und Selbstkontrolle auch Faktoren wie soziale

Kopp 154
Unterstützung und Verhaltensänderungen in kleinen Teilschritten beinhalten dürften ebenfalls erfolgreicher sein als allgemeine Informationsprogramme (Dishman, 1996). Ob die Einbindung in Sportprogramme im Einzel oder Gruppensetting erfolgen sollte, wird meist schon durch die Kostenfrage beantwortet; speziell bei Programmen für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen scheint jedoch eine sehr individuelle Betreuung innerhalb der Gruppe mit klarer Zielkontrolle und Eingehen auf potentielle Barrieren ein wesentlicher Erfolgsschlüssel für die weitere Ausübung bzw. Steigerung der sportlichen Aktivität.
Selbststeuerung und Selbstwirk-samkeit
Im Rahmen von verhaltensbezogenen Interventionen wird viel Augenmerk auf das Setzen und Erreichen von Zielen gelegt; bei der Bewertung von Menge und Intensität körperlicher Intensität treten häufig Einschätzungsfehler auf. In einem Verhaltensänderungsprogramm zur Steigerung der körperlichen Aktivität sollte deshalb zur Selbstkontrolle der Patienten ein Tagebuchsystem (zum Ausfüllen oder Weblogin) und/oder ein elektronisches Monitoringsystem zur Erfassung der Herzfrequenz und/oder der zurückgelegten Kilometer angeboten werden.Neben diesen technischen Hilfsmitteln, die in Summe als leicht bedienbar und kostengünstig einzustufen sind, stellen Mangel an Wissen und Erfahrung, Misstrauen, Motivationsdefizite und unrealistische Erwartungen Gefährdungsfaktoren im Rahmen von körperlichen Aktivierungsprogrammen dar. Eine genaue Vorinformation und die klare Ausrichtung auf eine sehr langsame Steigerung der körperlichen Fitness scheint für die Beibehaltung des neuen Verhaltensmusters einen wesentlichen Erfolgsfaktor darzustellen. Die Gestaltung der körperlichen Aktivität zur Errei
chung unmittelbarer positiver körperlicher Auswirkungen wie angenehme Müdigkeit im Gegensatz zu Erschöpfung scheint ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor zu sein, Überbelastung sollte vermieden werden (Richardson, 2005). Naturgemäß spielen Übungsleiter in der Beginnphase dieses Prozesses eine Schlüsselrolle – einen wesentlichen Punkt zur Erhöhung körperlicher Aktivität bei psychisch erkrankten Menschen scheint die Hilfestellung in der Überwindung von Schamgefühlen bezüglich des eigenen Körpers darzustellen. Selbstwert und Selbstwirksamkeit dürften in einem supportiv geleiteten sportlichen Aktivitätsprogramm als wichtige Mediatorvariablen fungieren.
Sicherheit und Beteiligung
In Hochrisikopopulationen bestehen aufgrund befürchteter kardiovaskulärer Komplikationen häufig Bedenken körperliche Aktivierungsprogramme zu implementieren. Obwohl relativ sicher kann auch bei moderater sportlicher Aktivierung wie zB ‚Walken’ durch vorweg bestehende Einschränkungen eine Verschlechterung des körperlichen Zustandsbildes eintreten. In der angloamerikanischen Literatur wird der Physical Activity Readiness Questionnaire (PARQ) empfohlen, ein einfaches Fragebogeninstrument, das bei bejahenden Antworten vor Aufnahme von sportlicher Aktivität eine ärztliche Stellungnahme vorsieht.Neben kardiovaskulären Ereignissen stellen Muskel und Gelenksverletzungen das größte Risiko bei der Ausübung sportlicher Aktivität dar; dieses Risiko kann durch richtige Instruktion (Aufwärm, Auskühlphase, Dehnungsübungen) und richtige Kleidung (zB richtiges Schuhwerk) deutlich minimiert werden. Trotz möglicher Nebenwirkungen verschiedener Psychopharmaka, die die Bereitschaft zur körperlichen Aktivität reduzieren können, gibt es keine Hinweise auf schwere Komplikatio
nen durch Kombination sportlicher Aktivität und psychotroper Medikation (Richardson, 2005).In der Allgemeinbevölkerung zeigt sich bei Interventionen zur Steigerung der sportlichen Aktivität eine Ausfallsquote von mehr als der Hälfte der Teilnehmer nach ca. 6 Monaten (Dishman, 1996); natürlich wäre es vermessen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen eine verbesserte Quote zu erwarten, da zusätzliche limitierende Faktoren wie Verschlechterung der Symptomatik oder Anreiseprobleme zu kalkulieren sind. Interessanterweise scheinen Patienten jedoch häufig sportliche Aktivität als wichtigen Baustein ihrer Behandlung zu schätzen was die Vermutung aufwirft, dass bei entsprechenden Angeboten eine Abbruchsquote erreicht werden könnte, die in etwa mit jener der gesunden Bevölkerung vergleichbar wäre (Richardson, 2005). Besonders empfehlenswert scheinen hier Ansätze, die nach einem Start in einem mehrwöchigen supervidierten Programm mit ‚Auffrischungstreffen’ nach vorgegebenen Zeitabständen (zB 3, 6 und 12 Monate) arbeiten.
Integration körperlicher Aktivitätsprogramme in psychiatrische Behandlungssettings
Eine der wesentlichsten Herausforderungen der modernen Psychiatrie besteht in der sinnvollen Koordination der Behandlungsstrategien der verschiedenen Anbieter (Meise, 2006). In diese Behandlungskoordination sollte körperliche Aktivität als ein wesentlicher Baustein integriert werden, eine Delegation an andere Einrichtungen, die für nichtpsychiatrische Patienten in der allgemeinen Gesundheitsvorsorge zuständig sind, scheint nur bedingt zielführend. Generell scheint es für die Zukunft nicht zuletzt aufgrund der eingangs erwähnten erschreckenden Zahlen in Bezug auf kardiovaskuläre und so

Körperliche Aktivität bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen 155
mit mehrheitlich verhaltensbezogene Risikofaktoren erforderlich, dass für die Behandlung psychiatrischer Patienten ein verantwortliches ‚casemanagement – Konzept’ eingeführt wird, welches neben den psychischen und sozialen Faktoren auch stärker auf die körperliche Gesundheitsvorsorge, erhaltung und –wiederherstellung fokussiert (Hinterhuber, 2008). Im Rahmen dieses Modells sollten die behandlungsführenden Ärzte und Psychologen die Verantwortung für die somatischen Aspekte der Behandlung übernehmen. Dabei könnte ein wesentlicher Erfolgsfaktor in einem Schulterschluss von Psychiatrie und Gesundheitspsychologie liegen; bewährte Konzepte der Verhaltensänderung (zB Aizen, 2006) im Bereich der Gesundheitsvorsorge für die Allgemeinbevölkerung wie beispielsweise Raucherentwöhnung, Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, Steigerung der körperlichen Aktivität können mit kleinen Anpassungen auf die Gruppe von Menschen mit psychischen Erkrankungen übertragen werden; ein entscheidender Faktor ist die Bereitschaft zur Umsetzung dieser Strategien durch das in der psychiatrischen Behandlung tätige Personal. Um diesen Faktor positiv zu beeinflussen sollten für Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen vermehrt Informationsveranstaltungen abgehalten und Informationsmaterial zum Nutzen körperlicher Aktivität für ihre Patienten bereitgestellt werden. Nicht zuletzt sind kontrollierte klinische Versuchsanordnungen zur Erfassung der tatsächlichen unmittelbaren und längerfristigen Effekte einer gesteigerten körperlichen Aktivität bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen dringend erforderlich.
Literatur
Aijzen, I. The theory of planned behaviour. Retrieved from http://www.people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html (2006)
Belardinelli R, Georgiou D, Cianci G, et al: Randomized, controlled trial of longterm moderate exercise training in chronic heart failure: effects on functional capacity, quality of life, and clinical outcome. Circulation 99:1173–1182, 1999
Blair SN, Brodney S: Effects of physical inactivity and obesity on morbidity and mortality: current evidence and research issues. Medicine and Science in Sports and Exercise 31:S646–662, 1999
Blair SN: Evidence for success of exercise in weight loss and control. Annals of Internal Medicine 119:702–706, 1993
Brown S, Birtwistle J, Roe L, et al: The unhealthy lifestyle of people with schizophrenia. Psychological Medicine 29:697–701, 1999
Carless D, Douglas K. Narrative, identity and mental health: How men with serious mental illness restory their lives through sport and exercise. Psychology of Sport and Exercise, 9 (5) 2008, 576594.
Colditz GA, Coakley E: Weight, weight gain, activity, and major illnesses: the Nurses’ Health Study. International Journal of Sports Medicine 18(suppl 3):S162–S170, 1997
Colton CW, Manderscheid RW. Congruencies in increased mortality rates, years of potential life lost and causes of death among public mental health clients in eight states. Prev Chronic Dis 2006 Apr;3(2): A42
Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Diabetes Care 27:596–601, 2004
Craft LL, Landers DM: The effect of exercise on clinical depression and depression resulting from mental illness: a metaanalysis. Journal of Sport and Exercise Psychology 20:339–357, 1998
Davidson S, Judd F, Jolley D, et al: Cardiovascular risk factors for people with mental illness. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 35:196–202, 2001
Dishman RK, Buckworth J: Increasing physical activity: a quantitative synthesis. Medicine and Science in Sports and Exercise 28:706–719, 1996
Elmslie JL, Mann JI, Silverstone JT, et al: Determinants of overweight and obesity in patients with bipolar disorder. Journal of Clinical Psychiatry 62:486–491, 2001
Faulkner G, Biddle S: Exercise as an adjunct treatment for schizophrenia: a review of the literature. Journal of Mental Health 8:441–457, 1999
Fleischhacker WW, CetkovichBakmas M, De Hert M, Hennekens CH, Lambert M,
Leucht S, Maj M, McIntyre RS, Naber D, Newcomer JW, Olfson M, Osby U, Sartorius N, Lieberman JA. Comorbid somatic illnesses in patients with severe mental disorders: clinical, policy, and research challenges. J Clin Psychiatry. 2008 Apr; 69(4):5149
Haapanen N, Miilunpalo S, Vuori I, et al: Association of leisure time physical activity with the risk of coronary heart disease, hypertension, and diabetes in middleaged men and women. International Journal of Epidemiology 26:739–747, 1997
Hayashi T, Tsumura K, Suematsu C, et al: Walking to work and the risk for hypertension in men: the Osaka Health Survey. Annals of Internal Medicine 131:21–26, 1999
Hinterhuber H, Meise U. Keine moderne Psychiatrie ohne Sozialpsychiatrie. Neuropsychiatrie 22 (3): 148 – 152, 2008.
Hu FB, Stampfer MJ, Solomon C, et al: Physical activity and risk for cardiovascular events in diabetic women. Annals of Internal Medicine 134:96–105, 2001
Hutchinson DS, Skrinar GS, Cross C: The role of improved physical fitness in rehabilitation and recovery. Psychiatric Rehabilitation Journal 22:355–359, 1999
Iwane M, Arita M, Tomimoto S, et al: Walking 10,000 steps/day or more reduces blood pressure and sympathetic nerve activity in mild essential hypertension. Hypertension Research 23:573–580, 2000
Knowler WC, BarrettConnor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA, Nathan DM; Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002 Feb 7;346(6):393403
Kokkinos PF, Narayan P, Colleran JA, et al: Effects of regular exercise on blood pressure and left ventricular hypertrophy in AfricanAmerican men with severe hypertension. New England Journal of Medicine 333:1462–1467, 1995
Kurzthaler I, Fleischhacker WW: The clinical implications of weight gain in schizophrenia. Journal of Clinical Psychiatry 62 (7): 3237, 2001
Lawlor DA, Hopker SW: The effectiveness of exercise as an intervention in the management of depression: systematic review and metaregression analysis of randomised controlled trials. British Medical Journal 322:763–767, 2001
Manson JE, Greenland P, LaCroix AZ, et al: Walking compared with vigorous exercise for the prevention of cardiovascular events in women. New England Journal of Medicine 347:716–725, 2002
Meise U, Sulzenbacher H, Eder B, Klug G, Schöny W, Wancata J. Psychische Gesundheitsversorgung in Österreich. Neuropsychiatrie 20: 174 – 185, 2006

Kopp 156
Moreau KL, Degarmo R, Langley J, et al: Increasing daily walking lowers blood pressure in postmenopausal women. Medicine and Science in Sports and Exercise 33: 1825–1831, 2001
Newcomer JW, Hennekens CH. Severe Mental Illness and Risk of Cardiovascular Disease. JAMA, October 17, 2007—Vol 298, No. 15
O’Conner PJ, Raglin JS, Martinsen EW: Physical activity, anxiety, and anxiety disorders. International Journal of Sport Psychology 31:136–155, 2000
Osborn DP, Levy G, Nazareth I, Petersen I, Islam A, King MB. Relative risk of cardiovascular and cancer mortality in people with severe mental illness from the United Kingdom’s general practice research database. Arch Gen Psychiatry; 64:242249, 2007.
Owens JF, Matthews KA, Raikkonen K, et al: It is never too late: change in physical activity fosters change in cardiovascular risk factors in middleaged women. Preventive Cardiology 6:22–28, 2003
Pan �R, Li GW, Hu YH, et al: Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance: the Da Qing IGT and Diabetes Study. Diabetes Care 20:537–544, 1997
Richardson CR, Faulkner G, McDevitt J et al. Integrating physical activity into mental health services for persons with severe mental illness. Psychiatric Services, 56 (3): 324331 (2005).
Skrinar GS, Unger KV, Hutchinson DS, et al: Effects of exercise training in young adults with psychiatric disabilities. Canadian Journal of Rehabilitation 5:151–157, 1992
Smith BJ, Bauman AE, Bull FC, et al: Promoting physical activity in general practice: a controlled trial of written advice and information materials. British Journal of Sports Medicine 34:262–267, 2000
Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, et al: Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New England Journal of Medicine 344:1343–1350, 2001
US Department of Health and Human Services: Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996
Ussher M, Stanbury L, Cheeseman V, Faulkner G. Physical activity preferences and perceived barriers to activity among
persons with severe mental illness in the United Kingdom. Psychiatr Serv. 2007 Mar;58(3):4058.
Williams PT: Physical fitness and activity as separate heart disease risk factors: a metaanalysis. Medicine and Science in Sports and Exercise 33:754–761, 2001
Martin Kopp, Univ.Doz. Dr.Klinische Psychologie undGesundheitspsychologieUniv.Klinik für Allgemeine Psychiatrie und SozialpsychiatrieDepartment für Psychiatrie und PsychotherapieMedizinische Universität InnsbruckMartin.Kopp@imed.ac.at

Schlüsselwörter:
EKT (Elektrokonvusionstherapie) – Erh-
altungs EKT – Rezidivprophylaxe – Patien-
teneinstellung – Lithium
Key words:
ECT (electroconvulsive therapy) – mainte-
nance treatment – patients attitude – lithi-
um – continuation ect
Rückfallraten innerhalb von 6 Monaten nach erfolgreicher EKT – Eine naturalistische prospektive Fremd- und Selbstbeurteilungsan-alyseAnliegen: Die hohe Rezidivrate von bis zu 100% nach einer erfolgreichen Elektrokonvulsions Therapie (EKT) stellen eine große Herausforderung für Psychiater und Patienten dar. Ziel der Multizenterstudie war wie der Verlauf nach einer erfolgreichen
AkutEKT Serie bei Patienten mit einer Majoren Depression war.Methode: 84 Patienten wurden in einer randomisierten doppelblind geführten Studie auf Unterschiede im Ergebnis bei unterschiedlicher Elektrodenplatzierung bei einer AkutEKT untersucht. Auf diesen Daten basierend untersucht diese follow up Studie den naturalistischen Verlauf der Patienten nach der Akut EKT Phase zwischen dem 5. und 7. Monat. Es wurden die Patienten selbst nach deren Erleben, dem subjektiven Erfolg, deren Nachbehandlung und den Ängsten bei der EKT Behandlung gefragt. Ebenso wurden die Patienten durch einen Rater fremdbeurteilt. Ergebnisse: 82,1% (69/84) der Patientenfragebögen und 83,3% (70/84) der Fremdbeurteilungsbögen wurden retourniert. Die meisten der Patienten 98% (68/69) hatten mindestens ein Antidepressivum als Medikation. Lithium wurde nur in 29% (20/69) der Fälle verschrieben. 35% (7/20) mit Lithium und 57% (16/28) ohne Lithium erlitten einen Rückfall innerhalb der ersten 6 Monate, im Median im 2,5 Monat. Nur ein Zentrum bot die ErhaltungsEKT an, welche 8,3% (7/84) der Patienten erhielten. Für 52,2% der Patienten ist die EKT eine
hilfreiche Therapie und 49,3% würden die Therapie weiterempfehlen. 59,4% wünschen sich eine bessere Aufklärung über die EKT Therapie und 21,4% der Patienten empfinden die EKT als erschreckend. Schluss-folgerungen: Die Resultate zeigen eine hohe Rezidivrate und unterstreichen die Notwendigkeit einer Rezidivprophylaxe mit Lithium welche so früh als möglich begonnen werden sollte. Hinsichtlich des subjektiven Empfindens fühlen sich die Patienten mangelhaft über die EKT Behandlung aufgeklärt und jeder vierte empfindet die EKT als erschreckend.
Relapse rate within 6 months after successful ECT: A naturalistic pro-spective peer- and self-assessment analysisBackground: Up to 100% relapse rate after successful electroconvulsive therapy (ECT) poses a challenge for patients and psychiatrists. The aim of the study was to evaluate the outcome of patients affected by major depression after the successful course of acute ECT. Methods: 84 patients recruited in a randomized double blind multicenter study designed to inves
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
Rückfallraten innerhalb von 6 Monaten nach erfolgreicher EKTEine naturalistische prospektive Fremd- und Selbstbeurteilungsanalyse
G. Rehor1, A. Conca1*, W. Schlotter2, R. Vonthein3, S. Bork2, R. Bode4, M. Hüll5, C.
Plewnia2, J. Di Pauli1, M. Prapotnik1, O. Peters4, J. Peters5 und G.W. Eschweiler2
1 Landesklinik Rankweil2 Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen3 Institut für Medizinische Biometrie Universität Tübingen4 Psychiatrische Klinik Ludwigsburg5 Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Freiburg
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 157–163 Original Original
* der Autor hat wie der Erstautor im gleichen Maß an der Veröffentlichung der Studie beigetragen.

Rehor et al. 158
tigate the optimal stimulation placement in acute ECT had a follow up under naturalistic conditions between the 5th and 7th month. Outcome, maintenance therapy and patients` attitude were evaluated with semi structured questionnaires by patients and the study raters. Results: 82.14% (68/84) questionnaires of the patients and 83.3% (70/84) of the rater were returned. 98% of the patients had at least one antidepressant; only in 23% (20/68) lithium was prescribed. 35% (7/20) of the patients with lithium and 57% (16/28) without lithium had a relapse within the first 6 months (OR 0.6) in a median of 2.5 months. Only one institution offered maintenance ECT in 8.3% (7/84) patients. For 52.2% of the patients ECT was a helpful treatment an 49.3% would recommend the therapy to their relatives. The vast majority (59.4%) wishes a better information about the ECT and 21.4% feel frightening about the therapy. Conclusions: The results show a high relapse rate and highlight the meaning of maintenance medication especially for a lithium combination therapy, as stated before. In regard to the subjective sensation the patients claim a better education about the ECT and anyway one of four patients feel frightening about the therapy.
Einleitung
Die elektrokonvulsive Therapie (syn. Elektrokrampftherapie) als effizienteste Therapie der Majoren Depression [1,2] wird meist bei affektiv und psychotisch erkrankten Patienten angewendet, nachdem Behandlungen mit Psychopharmaka keinen Erfolg gebracht haben [3]. Die hohen Rückfallraten nach einer wirksamen Index EKT Serie sind weiterhin eine große Herausforderung [4]. Man spricht von einem Rückfall (neudeutsch Relapse) in der gleichen Episode, wenn dieser innerhalb von 6 Monaten auftritt, ansonsten vom Auftreten einer neuen Episode einer Majoren Depression.
Große Unterschiede gibt es in den Daten zur Effizienz von therapieresistenten Patienten zwischen Interventionsstudien und Verlaufsbeobachtungen bei Respondern (Besserung um mehr als 50% in der depressiven Fremdbeurteilung, meist HAMD [5] und Remittern (meist HAMD < 8 Punkte). Prudic et al. berichten 1996 [6] bei depressiven Studienpatienten und 2004 [7] in einer naturalistischen Studie Remissionsraten von 69 bis 91% sowie Rezidive bei diesen initial auf EKT remittierten Patienten von 29 bis 53%. Bei stationär behandelten Patienten lagen die durch initiale EKT induzierten Remissionsraten bei 30,3 bis 40,6% sowie die Rezidivrate unter Remittern bei 63,3%. Diese Spannbreite ist wahrscheinlich durch ungleiche Komorbidität (v.a. Persönlichkeitsstörung), Episodendauer und Therapieresistenz begründet [6].In einer eigenen Übersichtsarbeit von 18 Studien (Fallserien, prospektive und retrospektive z. T. unkontrollierte Studien), aus den Jahren 1954 bis 2001 mit insgesamt 1334 Patienten konnten Unterschiede im Erfolg der medikamentösen Behandlung zwischen randomisiert kontrollierten Patienten und gezielt klinisch zugewiesenen Patienten gezeigt werden [8]. Die Dauer der Studien lag bei 1 bis 60 Monaten (im Median bei 11,6 Monaten) und bezog sich vor allem auf die ersten 6 Monate nach der erfolgreichen Index EKT Serie.Die Rückfallrate bei alleiniger Placebo Gabe lag bei randomisierten Patienten bei 85% [4], die der gezielt zugewiesenen Patienten bei 60%. Wenn die Patienten Trizyklische Antidepressiva (TCA) erhalten hatten, lag die Rezidivrate bei randomisierten Patienten bei 60% und die gezielt zugewiesener Patienten bei 40%, aber bei 100% bei gezielt zugewiesenen Patienten mit psychotischen Symptomen. Wenn TCA mit Lithium kombiniert wurden, zeigten sich in 40% der Fälle Rezidive [4]. Lithium mit Benzodiazepine kombiniert ergaben bei 20% der gezielt zugewiesenen Fälle Rezidive.
Für die klinische Praxis wäre es wertvoll zu wissen, welche Erhaltungstherapie der Patient nach der Index EKT erhält und wie hoch die Rezidivraten liegen, und welche Gründe es dafür gibt. Basierend auf der publizierten multizentrischen EKT Studie [9], in der in einer 3 wöchigen randomisiert kontrollierten Untersuchung zwei verschiedene Stimulationsformen der EKT (bifrontal und rechts unilateral) bei pharmakoresistenten Patienten mit Majorer Depression in Deutschland (Tübingen, Freiburg, Ludwigsburg) und Österreich (Rankweil) verglichen wurde, wurde in einer naturalistischen prospektiven follow up Studie nach der dreiwöchigen Akutphase [22] der weitere Verlauf dieser Patienten in den nächsten 57 Monate untersucht.
Material und Methoden
Randomisierung und die kurzfristigen Effekte von maximal 6 unilateralen oder 6 bifrontalen EKTs sind bereits in der Originalarbeit beschrieben [9]. Es handelte sich um eine Kurzpulsstimulation (0,5 ms, 0,9 A, 3070 Hz) in Ethomidatnarkose und Muskelrelaxierung mit Succinylcholinnarkose. Anschließend war die weitere Behandlung der Patienten den behandelnden Psychiatern vor ort freigestellt. Die Patienten wurden meist mit der ursprünglichen EKTform weiterbehandelt, wobei wegen mangelndem Ansprechen bei 10 Patienten auf eine bitemporale EKT gewechselt wurde, weil deren Wirksamkeit am besten belegt ist [4,10,11].Die Pläne für die gesamte Studie wurden bei den zuständigen lokalen Ethikkommissionen eingereicht und zugelassen. Von den Patienten wurde nach ausführlicher Aufklärung vor der IndexEKT die schriftliche Einwilligung zu Randomisierung und Verwendung der Daten eingeholt.Bei der follow up Befragung wurden 2 verschiedene Fragebögen, ein

Rückfallraten innerhalb von 6 Monaten nach erfolgreicher EKT 159
Patientenfragebogen und ein Raterfragebogen, ausgewertet, die 57 Monate nach der IndexEKT den Patienten und per Post zugeschickt worden waren. Beim Patientenfragebogen wurden dem Patienten Fragen zum Themenkomplex Erleben, subjektiver Erfolg der EKT Behandlung, Ängste, Nebenwirkungen und zur Nachbehandlung gestellt (insgesamt 12 Fragen basierend auf Folkerts) [12].Die Fremdbeurteilung am Ende der gesamten EKTSerie erfolgte durch denselben Rater, der auch in der ersten Phase der Studie den Patienten evaluiert hatte. Das Ergebnis wurde nach der CGISkala (clinical global impression) [13] und teilweise nach der Hamilton Skala [5] beurteilt. Dabei wurden nach Response, dem subjektiven allgemeinen Wohlbefinden, eventuellen stationären Wiederaufnahmen, der Medikamenteneinnahme, der Psychotherapie und der Therapieform im Allgemeinen gefragt.
Ergebnisse
Der Rücklauf der Patientenfragebögen betrug 82 % (69/84) und die der Raterfragebögen lag bei 83 % (70/84).Die Auswertung der 70 Fragebögen ergab, dass einschließlich der sechs prospektiv kontrolliert durchgeführten EKT im Durchschnitt noch 9,1 (1 bis 33) Stimulationen durchgeführt worden sind. Eingeschlossen waren auch 8 Patienten, die sich einer ErhaltungsEKT unterzogen. Bei 7 Patienten wurde keine weitere EKT durchgeführt. Die Aufteilung hinsichtlich der Elektrodenplatzierung war die Folgende. Bei 32 Patienten erfolgte sie rechts unilateral durchschnittlich 7,7 EKTSitzungen (2 bis 20), bei 34 Patienten bifrontal durchschnittlich 7,4 EKTSitzungen (1 bis 15) und bei 8 Patienten bitemporal durchschnittlich 8 EKTSitzungen (1 bis 20). Die Response laut CGI
am Ende der EKTSerie ergab, dass 19/68 Patienten (30 %) remittierten, 39/68 (54 %) teilremittiert,10 (15 %) unverändert blieben und keiner sich verschlechtert.Nach erfolgter 6. EKT Stimulation blieben die Patienten im Schnitt 5,94 Wochen (0 bis 26 Wochen) stationär.Bei 23 Patienten (46 % der gültigen Werte) kam es durchschnittlich 11,5 Wochen (0 bis 31 Wochen) nach Abschluß der Akutbehandlung zu einem Rückfall. Unter diesen Patienten waren 7 mit Lithium und 16 ohne Lithium behandelt worden, was einer odds ratio von 0,6 entspricht. 25 Patienten (50 %) hatten keinen Rückfall und 2 (4 %) waren non responder.Eine stationäre Wiederaufnahme in einer Psychiatrischen Klinik war bei 11 Patienten (16%) notwendig. 59 Patienten (84%) mussten nicht wieder aufgenommen werden.Eine manische Phase trat bei einem Patienten mit bipolarer Störung 12 Wochen nach der 6. EKT auf.Im Rahmen der medikamentösen Er haltungsTherapie bekamen 98% (68/69) der Patienten mindestens ein Antidepressivum, 68% (47/69) mindestens zwei Antidepressiva, 33% (23/69) mindestens drei Antidepressiva und immerhin 9% (6/69) erhielten vier Antidepressiva.Mit einer Lithiumtherapie wurde im Schnitt 4,8 Wochen (0 bis 27 Wochen) nach der EKT begonnen, wobei in 3/22 Fällen schon vor der EKT damit begonnen wurde. Die Dauer betrug 16,4 Wochen (3 bis 26 Wochen) Wochen. Das Lithium wurde in 3 Fällen wegen Unverträglichkeit abgesetzt. In diesen und einem weiteren Fall traten Nebenwirkungen wie Tremor, Gewichtzunahme und Müdigkeit auf. Keine Nebenwirkungen gaben 18/22 Patienten (82 %) an. Bei 10 Patienten (46 %) wurde Lithium in Kombination zu anderen Medikamenten verabreicht.Andere Stimmungsstabilisierer, wie Valproinsäure (5 Fälle), Lamotrigin (4 Fälle) und Carbamazepin (2 Fälle), erhielten die Patienten durchschnittlich 11,6 Wochen (1 bis 31 Wochen)
nach der EKT Behandlung für eine Dauer von 18,6 Wochen (3 bis 31 Wochen). Die Frage nach ihrem Wohlergehen 6 Monate nach der EKT beantworteten 69 Patienten in ihren Fragebögen, davon 7 (10 %) mit „sehr schlecht“, 13 (19 %) mit „schlecht“, 25 (36 %) mit „mäßig“, 22 (33 %) mit „gut“ und 2 (3 %) mit „sehr gut“.Hinsichtlich der Frage, in welcher Weise die EKT ihnen geholfen hat, gaben 38 Patienten (55 %) an, dass ihre Stimmung gebessert wurde, 26 Patienten (38 %) dass ihr Antrieb gebessert wurde, 22 (32 %) dass ihre innere Unruhe zurückging, 22 Patienten (32 %) dass ihre lebensverneinenden Gedanken zurücktraten, 18 Patienten (26 %) dass die EKT sie unangenehme und quälende Gedanken vergessen ließ, 17 Patienten (24 %) dass sie nicht wussten, ob ihnen die EKT geholfen habe, 16 Patienten (23 %) dass ihre Angst zurückging,16 Patienten (23 %) dass sie wieder Gefühle empfinden konnten, und 7 Patienten (10 %) dass die EKT ihnen nicht geholfen hatte. Ein gutes Drittel der Patienten (37,7% (26/69)) gab an, dass ihnen die EKT bis zum aktuellen Untersuchungszeitpunkt geholfen habe. 7,1% (5/69) berichteten über eine anhaltende Besserung von mehr als 3 Monate, 14,3% (10/69) über weniger als 3 Monate, 10,1% (7/69) über nur wenige Tage, 2,9% (2/69) dass die Wirkung sofort wieder nachgelassen hat, und 20% (14/69) gaben an, dass es sich nicht sagen lässt.Im Schnitt wurden 10,8 (225) EKT Behandlungen (inklusive ErhaltungsEKT) durchgeführt. 49% (N=34) der Patienten gaben an, dass ein möglicher Rückfall in 1,97 (05) Monaten nach der EKT erfolgte.Welche Sorgen und Bedenken die Patienten vor einer erneuten EKT Behandlung hatten und in welcher Wertigkeit sie zueinander stehen, wurde ebenfalls erfragt (siehe Tabelle 1, 2 und 3).Eine Frage bezog sich auf das Vorwissen der Patienten bezüglich der

Rehor et al. 160
Elektrokrampftherapie und woher die Patienten ihr Wissen hatten. Acht von zehn Patienten (79,7% (N=55)) sagten, dass sie keine Berichte über die EKT aus den Medien (Fernsehen, Zeitung) kannten. Vorinformiert aus Zeitung, Fernseher, Bücher und Internet waren 20,3% (N=14). Von einer EKT Behandlung hatten 53,6% (N=37) noch nie im ihrem Leben gehört, 30,4% (N=21) hatten schon einmal etwas über die EKT gehört und 2,9% (N=2) wussten es nicht mehr.In Tabelle 4 sind die einzelnen Fragen, welche an die Patienten gerichtet waren mit Prozentangaben aufgelistet.Das subjektive Erleben der EKT wurde mit 13 spezifischen Fragenstellungen erfasst [12, 14]. Die Auswertung in Tabelle 4 zeigt, dass fast die Hälfte (45%, N=31) der Patienten mit einer erneuten EKT Behandlung einverstanden wären. Dass die EKT eine hilfreiche Therapie sei bejahten 52% (N=36) und verneinten 28% (N=19). Dass die EKT mit Nebenwirkungen verbunden ist, gaben 48% (N=33) an. Für 25% (N=17) hatte die EKT keine Nebenwirkungen und der Rest machte keine Angaben. Fast ausgeglichen war die Antwort, ob die Wirkung der
Wirkung der Elektrokrampftherapie auf Ihr Gedächtnis? stimmt stimmt nicht weiß nicht
Mein Gedächtnis ist seit der Elektrokrampftherapie besser. 20,3 % (14) 49,3 % (34) 11,6 % (8)
Es war seit der Elektrokrampftherapie schlechter. 36,2 % (25) 37,7 % (26) 7,2 % (5)
Es war erst nach der Elektrokrampftherapie besser, ist dann wieder schlechter geworden. 10,1 % (7) 55,1 % (38) 13,0 % (9)
Es ist nach der Elektrokrampftherapie erst schlechter, dann aber wieder besser geworden. 31,9 % (22) 39,1 % (27) 11,6 % (8)
Verändert hat sich insbesondere die Erinnerung an länger Zurückliegendes. 30,4 % (21) 37,7 % (26) 11,6 % (8)
Verändert hat sich eher meine Merkfähigkeit für Neues. 40,6 % (28) 31,9 % (22) 13,0 % (9)
Die Elektrokrampftherapie hat keinen Einfluss auf mein Gedächtnis gehabt. 20,3 % (20) 55,1 % (38) 8,7 % (6)
Tabelle 1: Fragen an die Patienten bezüglich den Wirkungen auf ihr Gedächtnis
Welche unangenehmen Wirkungen hatte die Elektrokrampftherapie bei Ihnen?
Kopfschmerzen 39,10% (N=27)
Müdigkeit 30,40% (N=21)
Gedächtnisstörungen 49,30% (N=34)
Übelkeit 17,40% (N=12)
Muskelschmerzen 20,30% (N=14)
Schwindelgefühle 20,30% (N=14)
Tabelle 2: Nebenwirkungen der EKT
Wie unangenehm war die EKT verglichen mit dem, was Sie vorher erwartet oder befürchtet haben?
schlimmer weniger schlimm wie erwartet
überhaupt nicht unan
genehm
weiss nicht mehr
10,1 % (N = 7)
24,6 % ( N = 17)
15,9 % (N = 11)
29,0 % (N = 20)
10,1 % (N = 7)
Tabelle 3

Rückfallraten innerhalb von 6 Monaten nach erfolgreicher EKT 161
EKT anhält. Für jeden vierten 26% (N=18) war die Wirkung zwar im Moment vorhanden, hielt aber nicht lange an. Ein Drittel (33% N=23) war der Meinung die EKT Wirkung würde länger andauern und 29% (N=20) wussten es nicht mehr.51% (N=35) verneinten die Frage, ob die EKT eine erschreckende Therapie sei. Für mehr Aufklärung über die EKT sprechen sich 60% (N=41) aus, 19% (N=13) fühlten sich ausreichend aufgeklärt. Fast die Hälfte 45% (N=31) gab an, dass ihnen die EKT mehr geholfen habe als Medikamente. 26% (N=18) waren der Meinung, dass Medikamente ihnen mehr geholfen habe als die EKT. Vor einer erneuten EKT Behandlung hatten 32% (N=22) Angst. 16% (N=11) meinten die Bezeichnung Elektroschock wäre besser als Elektrokrampftherapie, während knapp die Hälfte 49% (N=34) die Bezeichnung Elektrokrampftherapie als zutreffend finden. Dass die EKT schlimmer sei als ein Gang zum Zahnarzt verneinten 42% (N=29). Für 45% hilft die EKT mehr, als sie schadet, nur für
15% (N=10) war es umgekehrt. Dass die EKT den Patienten gefügiger machen soll, verneinten 57% (N=39) und 25% (N=17) wußten es nicht. Nur 7% (N=5) waren der Meinung, dass die EKT die Patienten gefügiger machen soll. Für eine Weiterempfehlung an Verwandte, falls dies notwendig wäre, sind 49% (N=34) dafür und 18% dagegen.
Diskussion
Die vorliegenden Daten aus der Kurzzeitstudie von Eschweiler et al. [9] zeigen, dass nach 6 EKT Behandlungen nur 15% der 84 Patienten remittierten, aber 26% respondierten. In unserer daran anschließenden Beobachtung erhielten die Patienten im Durchschnitt noch weitere 9,1 EKT Behandlungen und die Response, welche nach dem Abschluß der EKT Serie durch die verblindeten Rater erhoben wurde, ergab eine Remission von 28% und Teilremission von 54%. Die relativ niedrige Remissi
onsrate entspricht den Angaben von Prudic et al.[7], dass Patienten welche eine ausgeprägte, definierte Pharmakoresistenz besitzen, eine deutlich geringere Ansprechrate auf EKT Behandlungen aufweisen. Die Resistenz auf Antidepressiva wurde nicht nach etablierten Skalen (z.B. ATHF) [15] erhoben, sondern als Einnahme von zwei Antidepressiva unterschiedlicher Substanzklassen über jeweils mindestens 3 Wochen in ausreichend hoher Dosis definiert. In Übereinstimmung mit den Daten von Sackeim et al [15] konnten wir zeigen dass die sensible Phase für eine Rückfallperiode innerhalb der ersten 11,5 Wochen mit punctum maximum in den ersten 2 Monaten war. Von den 23 Patienten, welche einen Rückfall erlitten, hatten 16 Patienten kein Lithium erhalten. Die Dauer der Lithiumgabe war im Durchschnitt ebenfalls gering bei 16,4 Wochen und nur 59,4% der mit Lithium therapierten Patienten waren im therapeutischen Bereich. In Kombination zu anderen Medikamenten wurde Lithium bei 45,7% der Patienten eingesetzt.
13. Welchen Aussagen über die Elektrokrampftherapie (EKT) würden Sie zustimmen? stimmt stimmt
nicht weiß nicht
13 a Ich selber wäre mit einer erneuten EKT einverstanden. 44.9% 24.6% 21.7%
13 b EKT ist eine hilfreiche Therapie. 52.2% 10.1% 27.5%
13 c EKT ist mit Nebenwirkungen verbunden. 47.8% 24.6% 21.7%
13 d EKT hilft zwar im Moment, aber die Wirkung hält nicht lange an. 26.1% 33.3% 29.0%
13 e EKT ist eine erschreckende Therapie. 21.7% 50.7% 15.9%
13 f Mehr Aufklärung über die EKT wäre sinnvoll. 59.4% 18.8% 10.1%
13 g EKT hat mir mehr geholfen als Medikamente. 44.9% 26.1% 18.8%
13 h Ich hätte Angst vor einer erneuten EKT. 31.9% 43.5% 14.5%
13 i Elektroschock wäre der bessere Name für die Behandlung. 15.9% 49.3% 24.6%
13 j Falls notwendig würde ich auch meine Verwandten zu einer EKT raten. 49.3% 18.8% 21.7%
13 k Die EKT ist nicht schlimmer als ein Gang zum Zahnarzt. 42.0% 33.3% 14.5%
13 l EKT hilft mehr als sie schadet. 44.9% 14.5% 21.7%
13 m Die EKT soll Patienten gefügiger machen. 7.2% 56.5% 24.6%
Tabelle 4: 13 Fragen an die Patienten über die EKT Therapie

Rehor et al. 162
Auffallend war, dass die Lithium Verschreibung erst spät (im Schnitt 4,8 Wochen nach Beendigung der EKT) und somit erst in der vulnerablen Phase oder sogar gar nicht erfolgte, obwohl Lithium als besonders wirksames Medikament gilt [16]. Also scheint eine frühzeitige Verschreibung von Lithium während der Akutphase angezeigt zu sein. Neben diesem bedeutenden Wirksamkeitsprofil erfüllt Lithium auch die entsprechenden Kriterien für ein hohes Sicherheitsprofil [17]. Fast jeder Patient (98%) erhielt mindestens ein Antidepressivum. Dagegen war eine Vielzahl der Patienten mit Kombinationen von Antidepressiva therapiert worden. 68% erhielten mindestens zwei Antidepressiva und 33% mindestens drei. 9% der Patienten erhielten sogar eine Kombination von vier Antidepressiva, obwohl zur Sicherheit und Effizienz solcher Kombinationen wenig bis gar keine Evidenz vorliegt. Erst neulich konnten zumindest in kontrollierten klinischen Studien einige Daten dazu gewonnen werden [18]. Bei 14% der Patienten waren Antikonvulsiva als Stimmungsstabilisierer mit den Antdepressiva kombiniert worden. Auch hier zeigt sich eine deutlich verzögerte und in der Dauer allzu kurze Verschreibung. Erst 11,6 Wochen nach der EKT Behandlung erfolgte eine Therapie für 18,6 Wochen, was aber auch als möglicher Hinweis einer mangelnden Compliance interpretiert werden kann. Nur 7 der 84 Patienten erhielten eine ErhaltungsEKT, welche ausschließlich im österreichischen Zentrum angeboten wurde, davon blieben 5 über den Beobachtungszeitraum stabil. Hier bestätigt sich auch die unterschätzte Möglichkeit diese Therapieform anzuwenden, welche für mitteleuropäische Verhältnisse typisch erscheint. Dies hat wahrscheinlich auch mit sozioökonomischen Limitierungen wie Anfahrtszeiten, Vergütungen, Akzeptanz, etc. zu tun [19]. Große Übereinstimmung in Fremd und Selbstbeurteilung zeigten sich sowohl bei der Rückfallrate als auch bei
der durchschnittlichen Zeit bis zum Rückfall (durchschnittlich 1,97 Monate). Bezüglich Wirksamkeit meinten 55% der Patienten, dass die EKT die Stimmung deutlich gebessert hat. Besonders erwähnenswert ist, dass in nur 10% der Fälle die EKT laut Patientenmeinung überhaupt nicht geholfen hätte. Allerdings muss gesagt werden, dass jeder vierte nicht sagen konnte ob ihm die EKT geholfen hat oder nicht. Angst und mangelnde Information spielten ebenfalls eine große Rolle. Knapp mehr als die Hälfte der Patienten waren sehr oder etwas ängstlich (51%).In diesem Zusammenhang kann man auch die insgesamt mangelnde Information über die EKT Behandlung sehen, denn ebenfalls mehr als die Hälfte (54%) hatten noch nie zuvor über die Behandlungsmethode gehört. Dies konnten auch Tang et al. [20] und Virit et al. [21] in verschiedenen Kulturkreisen in ihren Arbeiten über die Erfahrungen und Zufriedenheit von Patienten und ihren Angehörigen bei einer EKT Behandlung zeigen. Ein Zusammenhang, ob ängstliche Patienten auch vermehrt den Wunsch nach mehr Aufklärung hatten, konnte nicht gefunden werden. Sehr wohl aber bei Patienten mit mäßigem Ansprechen bzw. schlechter Response. Hier fühlten sich 24 (35%) Patienten schlecht aufgeklärt und 20 Patienten hatten Angst vor einer erneuten EKT. Ob auch ein mangelnde und möglicherweise tendenziöse Information vonseiten der Behandler eine Rolle spielt, muß hinterfragt werden (Hofer & Conca in Vorbereitung).Analog zu den publizierten Voruntersuchungen [22,23,24] wurde die Akzeptanz und retrospektive Bewertung der EKT erfasst: Durch unsere Befragung konnten die Ängste der Patienten vor einer erneuten EKT Behandlung identifiziert werden. So war die Angst vor den Nebenwirkungen und bleibenden Schäden am größten. Die Furcht vor der Narkose spielte hingegen keine Rolle, was auch Koopowitz et al. [25] in ihrer Befragung feststellen konnten. In den Erlebnisfragebögen der
Patienten zeigte sich eindeutig das Gefühl der mangelnden Aufklärung, da fast 60% der Patienten eine bessere Aufklärung wünschen. Fast die Hälfte der Patienten sagten, dass ihnen die EKT mehr geholfen habe als Medikamente und dass die Therapie an sich mehr helfe als schade. Mehr als die Hälfte würden die EKT ihren Verwandten empfehlen. Erwähnenswert ist, dass nur eine kleine Minderheit von 7% der Patienten meint, dass die EKT dazu da ist, um die Patienten gefügiger zu machen. Hier scheint das negative Image aus den 70Jahren der Gefügigmachung durch EKT, wie im Film von Milos Forman vermittelt wurde, überwunden. Dass sich so viele Patienten ängstlich vor einer EKT Behandlung fühlen und die Information über die Behandlung mangelhaft ist, bringt für die behandelnden Ärzte eine Verantwortung mit sich, sowohl die Patienten als auch die Angehörigen umfassend aufzuklären und deren Ängste ernstzunehmen. Diese Erkenntnis wird auch durch die Ergebnisse der Arbeit Johnstone [26] unterstützt, in der Patienten über ihre EKT Erlebnisse befragt, angaben vor der EKT Angst zu haben und sich zu schämen. Auch Gefühle der Hilflosigkeit und der Wertlosigkeit wurden genannt. Einige fühlten sich sogar missbraucht und angegriffen. Diese Ergebnisse könnten Folgen für die EKT Therapie in der Praxis haben.Vor allem die Wirkung der EKT auf das Gedächtnis muss hervorgehoben werden. 40% sahen sich subjektiv in ihrer Merkfähigkeit nach der EKT eingeschränkt, wenn auch Schell 2006 [14] zeigen konnte, dass dies vor allem die Patienten mit anhaltenden depressiven Symptomen waren. Während der Behandlung ist sehr auf die Nebenwirkungen wie Kopfweh zu achten und zu therapieren, da dies die Patienten als besonders störend empfanden. Zusammenfassend ist die EKT in Kombination mit psychotropen Medikamenten (einschließlich Lithium) ein sicheres Verfahren, wie die geringen NW zeigte. Die Rückfallrate lag ähnlich oder sogar kleiner

Rückfallraten innerhalb von 6 Monaten nach erfolgreicher EKT 163
als in den neueren Studien [27,28, 29]. Die Akzeptanz der EKT ist ähnlich hoch wie in den Tübinger [14] und Münsteraner Vorstudien [12]. Obwohl aufgrund des Studiencharakters initial sehr ausführlich über die EKT aufgeklärt wurde, berichten die Patienten im Nachhinein über Informationsbedarf, was die behandelnden Ärzte berücksichtigen sollten. Dass die Hälfte eine EKT Ihren Verwandten empfehlen und noch einmal eine EKT machen würden, während weniger als ein Viertel beides ablehnen, verdeutlich die hohe Akzeptanz und den Benefit der Behandlung, auch wenn die kognitiven Effekte weiterhin ein Manko der EKT bleiben.
Literatur
[1] Geddes, J. & UK ECT Review Group: Efficacy and safety of elecroconvulsive therapy in depressive disorders: a systematic review and metaanalysis. Lancet 36, 799808 (2003).
[2] Kho KH., van Vreeswijk MF., Simpson S., Zwinderman AH.: A metaanalysis of electroconvulsive therapy efficacy in depression. J ECT 19, 139147 (2003).
[3] Bundesärtzekammer: Stellungnahme zur Elektrokrampftherapie (EKT) als psychiatrische Behandlungsmaßnahme. Deutsches Ärzteblatt 100, 141143 (2003).
[4] Sackeim HA., Prudic J., Devanand DP., Nobler MS., Lisnaby SH., Peyser S., Greenberg R., Rifas SL., Sackheim HA.: A prospective, randomised, doubleblind comparison of bilateral and right unilateral ECT at different stimulus intensities. Arch Gen Psychiatry 57, 425434 (2000).
[5] Hamilton, M.: A arting scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 23, 5662 (1960).
[6] Prudic J., Haskett RF., Mulsant B., Malone KM., Pettinati HM., Stephens S., Greenberg R., Rifas SL., Sackheim HA.: Resistance to Antidepressant Medications and ShortTerm Clinical Response to ECT. Am J Psychiatry 153, 985992 (1996).
[7] Prudic J., Olfson M., Marcus SC., Fuller RB., Sackeim HA.: Effectiveness of electroconvulsive therapy in community settings. Biol Psychiatry 55, 301312 (2004).
[8] Conca A., Eschweiler G., Vonthein R., Wild B., Bork S., Huell M., Bartels M., Schlotter W., Di Pauli J.: Rückfallraten
innerhalb 6 Monaten nach erfolgreicher EKT. Nervenarzt 76, 5959 (2005).
[9] Eschweiler GW., Vonthein R., Bode R., Huell M., Conca A., Peters O., MendeLechler S., Peters J., Klecha D., Prapotnik M., DiPauli J., Wild B., Plewina C., Bartels M., Schlotter W.: Clinical efficacy and cognitive side effects of bifrontal versus right unilateral electroconvulsive therapy (ECT): a shortterm randomised controlled trial in pharmacoresistant major depression. J Affect Disord 101, 149157 (2007).
[10] Kellner CH., Knapp RG., Petrides G., Rummans TA., Husain MM., Rasmussen K., Mueller M., Bernstein HJ., O‘Connor K., Smith G., Biggs M., Bailine SH., Malur C., Yim E., McClintock S., Sampson S., Fink M.: Continuation electroconvulsive therapy vs pharmacotherapy for relapse prevention in major depression: a multisite study from the Consortium for Research in Electroconvulsive Therapy (CORE). Arch Gen Psychiatry 63, 13371344 (2006).
[11] American Psychiatric Association. The practice of ECT: recommendations for treatment, training and privileging. 2nd edition. Washington DC: American Psychiatric Press 2001.
[12] Folkerts, Steinhoff Verlag 1999.[13] Beneke M., Rasmus W.: “Clinical Global
Impressions“ (ECDEU): some critical comments. Pharmacopsychiatry 25, 171176 (1992).
[14] Schell Caroline Franziska: Elektrokrampftherapie in Tübingen –eine retrospective Untersuchung der Jahre 2000 bis 2002 Inaugural Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin; Tübingen 2006
[15] Sackeim HA., Haskett RF., Mulsant BH., Thase ME., Mann JJ., Pettinati HM., Greenberg RM., Crowe RR., Cooper TB., Prudic J.: Continuation pharmacotherapy in the prevention of relapse following electroconvulsive therapy. JAMA 285, 12991307 (2001).
[16] Tohen M., Greil W., Calabrese JR., Sachs GS., Yatham LN., Oerlinghausen BM., Koukopoulos A., Cassano GB., Grunze H., Licht RW., Dell‘Osso L., Evans AR., Risser R., Baker RW., Crane H., Dossenbach MR., Bowden CL.: Olanzapine versus lithium in the maintenance treatment of bipolar disorder: a 12month, randomized, doubleblind, controlled clinical trial. Am J Psychiatry 162, 12811290 (2005).
[17] Burgess S., Geddes J., Hawton K., Townsend E., Jamison K., Goodwin G.: Lithium for maintenance treatment of mood disorders. Cochrane Database Syst Rev 3 (2001).
[18] Gaynes BN., Rush AJ., Trivedi MH., Wisniewski SR., Spencer D., Fava M.: The STAR*D study: treating depression
in the real world. Cleve Clin J Med 75, 5766 (2008).
[19] Frederikse M., Petrides G., Kellner C.: Continuation and maintenance electroconvulsive therapy for the treatment of depressive illness: a response to the National Institute for Clinical Excellence report. J ECT 22, 1317 (2006).
[20] Tang WK., Ungvari GS., Chan GW.: Patients‘ and their relatives‘ knowledge of, experience with, attitude toward, and satisfaction with electroconvulsive therapy in Hong Kong, China. J ECT 18, 207212 (2002).
[21] Virit O., Ayar D., Savas HA., Yumru M., Selek S.: Patients´ and their relatives´ attitudes toward electroconvulsive therapy in bipolar disorder. J ECT 23, 255259 (2007).
[22] Freeman CP., Kendell RE.: ECT: Patients´experiences and attitudes. Br J Psychiatry 137, 816 (1980).
[23] Benbow SM.: Patients´ Views on Electroconvulsive Therapy on Completion of a Course of Treatment. Convuls Ther 4, 146152 (1988).
[24] Folkerts HW., Michael N., Tolle R., Schonauer K., Mücke S., SchulzeMönking H.: Electroconvulsive therapy vs. Paroxetine in treatmentresistant depression a randomized study. Acta Psychiatr Scand 96, 332342 (1996).
[25] Koopowitz LF., ChurHansen A., Reid S., Blashki M.: The subjective experience of patients who received electroconvulsive therapy. Aust N Z J Psychiatry 37, 4954 (2003).
[26] Johnstone L.: Adverse psychological effects of ECT. Journal of Mental Health 8, 6985 (1999).
[27] Sackeim HA., Roose SP., Lavori P�. Determining the duration of antidepressant treatment: application of signal detection methodology and the need for duration adaptive designs (DAD). Biol Psychiatry 59, 483492 (2006)
[28] Tew JD Jr., Mulsant BH., Halskett RF., Joan P., Begley AE., Sackeim HA.: Relapse during continuation pharmacotherapy after acute response to ECT: a comparison of usual care versus protocolized treatment. Ann Clin Psychiatry 19, 14 (2007).
[29] Odeberg H., RodriguezSilva B., Salander P., Martensson B.: Individualized Continuation Electroconvulsive Therapy and Medication as a Bridge to Relapse Prevention After An Index Course of Electroconvulsive Therapy in Severe Mood Disorders: A Naturalistic 3Year Cohort Study. J ECT 24, 183190 (2008).
Dr. Gerald RehorObere Venserstr. 19A6773 [email protected]

Schlüsselwörter:
Einstellung zur aktiven Sterbehilfe – medi-
zinische Laien – Medizinstudenten – Ärzte
– Österreich
Key words:
attitudes towards euthanasia – medicals
lays – medical students – physicians
– Austria
Die Nähe zum medizinischen Be-ruf und die Einstellung zur aktiven SterbehilfeWie in den meisten europäischen Ländern wird nach Anlassfällen auch in Österreich der mediale Ruf nach der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe laut. Im Gegensatz zu den meisten europäischen und nordamerikanischen Ländern basiert diese Diskussion allerdings nicht auf empirischer Grundlage, da für Österreich keine Daten zu diesem Thema vorliegen. Um diese Informationslücke zu schließen, wurden in einer Befragung die Einstellung zur aktiven Sterbehilfe von (a) medizinischen Laien, (b) Medizinstudenten aus dem vorklinischen und dem klinischen Abschnitt und (c) Fachärzten für Psychiatrie, Chirurgie und Innere Medizin erhoben. Es zeigte sich, dass mit zunehmender Nähe zum medizinischen
Beruf die aktive Sterbehilfe verstärkt abgelehnt wird. Auch in der Gruppe der Fachärzte distanzierten sich am stärksten die Internisten, die im Falle einer Legalisierung am direktesten in Entscheidungs und Durchführungsprozesse involviert wären.
The closeness to medical profession and the attitude towards euthana-siaPeriodically debates on the legalization of active euthanasia are conducted in the Austrian media. In contrast to most European and North American countries, these debates are not based on local empirical data, because until now no studies on respective attitudes and values exist. In this study notion towards active euthanasia of (1) medical lays, (2) medical students and medical specialists in psychiatry, surgery and internal medicine are explored by means of a semistructured questionnaire. We found that increasing closeness to the medical profession is associated with an increasing refusal of active euthanasia. Among the medical specialists, specialists in internal medicine, who, after the legalization, would be most involved in decisionmaking processes as well as in the execution of active euthanasia, showed the greatest reservation concerning this question.
„Obwohl sie per Gesetz noch verbo-ten ist, wird die aktive Sterbehilfe in Österreich immer offener diskutiert. Tatsächlich kommt sie öfter vor als bekannt – die Grenzen sind fließend. Gibt es ein Menschenrecht auf einen selbstbestimmten Tod?“ (profil 2008; 25: 7986)
Einführung
Die Fortschritte bei der Entwicklung lebensverlängernder medizinischer Technologien, stellen bisher übliche Formen des Umgangs mit dem Lebensende radikal in Frage.* Immer häufiger werden kritische Stimmen gegen die Entscheidungsmacht des Arztes laut, auch in aussichtslosen medizinischen Situationen lebensverlängernde Maßnahmen zu setzen. Wie am Beispiel des Zitates aus einem jüngst erschienen Artikels aus der Wochenzeitschrift profil ersichtlich, findet auch in den österreichischen Medien eine Debatte über die aktive Sterbehilfe (Euthanasie), die in Europäischen Ländern wie der Schweiz, Belgien und den Niederlanden letztlich zu einer Liberalisierung der Gesetzgebung geführt hat [12].
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
Die Nähe zum medizinischen Beruf und die Einstellung zur aktiven Sterbehilfe
Kristina Ritter1, Elmar Etzersdorfer2 und Thomas Stompe3
1 Neurologisches Zentrum Rosenhügel Wien2 Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Furtenbachkrankenhaus, Stuttgart3 Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Wien
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 164–173 Original Original
* Wegen der leichteren Lesbarkeit wurde bei den Substantiven die männliche Form gewählt, es sind jedoch durchweg beide Geschlechter angesprochen.

Die Nähe zum medizinischen Beruf und die Einstellung zur aktiven Sterbehilfe 165
Definitionen
In der Debatten über Sterbehilfe werden häufig Begriffe unscharf verwendet. Zu unterscheiden ist zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe bedeutet eine absichtlich gesetzte Maßnahme zur Herbeiführung des Todes, passive Sterbehilfe hingegen das Unterlassen (Nichtaufnahme oder Abbruch) medizinischer Maßnahmen („Sterbenlassen“). Darüber hinaus ist zu unterscheiden zwischen direkter und indi-rekter Sterbehilfe [1]. Direkte Sterbehilfe bedeutet gleich der aktiven Sterbehilfe das aktive Herbeiführen des Todes, auch wenn dies zum Abkürzen eines qualvollen Sterbeprozesses erfolgt. Indirekte Sterbehilfe liegt vor, wenn durch die Linderung von Schmerzen eine Verkürzung der Lebensdauer als Nebenwirkung in Kauf genommen wird. Darüber hinaus können verschiedene Stufen der Freiwilligkeit differenziert werden: Unter freiwilliger Sterbehilfe versteht man daher das vom Patienten gewünschte Töten oder Sterbenlassen. Bei aktiver freiwilliger Sterbehilfe spricht man auch von Tötung auf Verlangen. Sterbehilfe erfolgt dagegen unfreiwillig, wenn sie gegen den Willen des Patienten geschieht. Eine nichtfreiwillige Sterbehilfe liegt dann vor, wenn der Betroffene nicht fähig ist, sich sachgemäß zu äußern (Neugeborene, geistig zurückgebliebene oder demente Patienten). Im allgemeinen Sprachgebrauch am häufigsten wird der Begriff Euthanasie (zu griechisch euthanasía »schöner Tod«) synonym mit Sterbehilfe im Allgemeinen verwendet. Dieses Handlungsfeld wurde von der Legislative in verschiedenen Staaten unterschiedlich gesetzlich normiert.Aktive direkte Sterbehilfe war und ist in Österreich verboten. Im Gegensatz zur medialen Präsenz steht eine Legalisierung der Euthanasie nach der von sämtlichen im Nationalrat vertretenen Parteien bekräftigten Überzeugung in Österreich zurzeit nicht zur Diskussion.
Ethische Aspekte zur Sterbehilfe
Die Debatte zur (passiven und aktiven) Sterbehilfe kann auf eine lange Geschichte zurückblicken [27]. Zahlreiche Argumente für und wider wurden diskutiert, von denen nur einige hervorgehoben werden sollen:
Argumente von Befürwortern der aktiven Sterbehilfe
Man könne das Verbot der aktiven Sterbehilfe als einen Widerspruch zur Duldung der passiven Sterbehilfe auffassen, zumal auch das Abschalten lebenserhaltender Geräte eine aktive Handlung darstelle, die den Tod des Patienten herbeiführen wolle. Der Tod sei keine bloße zufällige Begleiterscheinung der passiven Sterbehilfe, sondern eine notwendige Bedingung für deren Erfolg. Auch die indirekte Sterbehilfe erfolge aktiv und zielgerichtet, da durch die Verabreichung eines Medikaments, das in hoher Dosierung letal ist, der Tod des Patienten willentlich in Kauf genommen würde. Die Grenze zwischen passiver, indirekter und aktiver Sterbehilfe sei unscharf. Mangels einer klaren begrifflichen Unterscheidbarkeit zwischen Handeln und Unterlassen könne auf dieser begrifflichen Basis keine moralische Ungleichbehandlung begründet werden [4]. Darüber hinaus sei die aktive Sterbehilfe humaner als passive Sterbehilfe, da sie kürzer und schmerzlos sei. Der australische Philosoph Peter Singer zieht aus der begrifflichen und damit auch moralischen Ununterscheidbarkeit zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe die Konsequenz: „Wenn es zwischen Töten und Sterbenlassen keinen moralischen Unterschied gibt, dann sollte die ‚aktive Euthanasie’ ebenfalls als unter bestimmten Umständen menschlich angemessen akzeptiert werden.“ [24]. Weiters solle aktive Sterbehilfe sowieso nur angewendet werden, wenn der Betroffene es explizit wolle und er aus seiner
Sicht zu dem Schluss käme, dass sein Leben nicht mehr lebenswert wäre [26].
Argumente von Gegnern der akti-ven Sterbehilfe
Bei der passiven Sterbehilfe sterbe der Patient aufgrund des natürlichen Krankheitsverlaufs, bei der aktiven Sterbehilfe sei der Eingriff des Arztes die Ursache für den Tod des Patienten. Bei der passiven Sterbehilfe sterbe der Patient also auf natürliche, bei der aktiven Sterbehilfe auf unnatürliche Weise. Im ersten Fall könne er noch mehrere Tage leben, in diesem Zeitraum könne die eingeleitete Sterbehilfe wieder rückgängig gemacht werden, im letzteren Fall sterbe er sofort. Von den Gegnern der aktiven, freiwilligen Sterbehilfe wird zudem bezweifelt, ob der Sterbewunsch wirklich in jedem Fall freiwillig und rational genannt werden könne, da er doch durch die Krankheit bedingt sei. Häufig würde von unheilbar Kranken der Wunsch zu sterben geäußert, um ihren Angehörigen nicht länger zur Last zu fallen. Es sei daher unkorrekt, von einem rein subjektiven „Wert des Lebens“ sprechen, der nicht auch aus der Fremdperspektive dritter Personen begründet wäre. Außerdem sollte nach Meinung der Gegner der aktiven Sterbehilfe angesichts der geschichtlichen Erfahrungen mit den nationalsozialistischen Euthanasieprogrammen klar sein, dass bei der Entscheidung über die Zulassung der aktiven Sterbehilfe die Relevanz zentraler Wertehaltungen zur Disposition stünde.
Dass die Diskussion um die medizinische Ethik am Lebensende in der Ärzteschaft einen wachsenden Stellenwert einnimmt, zeigt eine europäische Studie in sechs Ländern [17]. Der Anteil von Sterbefällen, denen „EndoflifeEntscheidungen“ vorausgehen liegt zwischen 23% (Italien) und 51% (Schweiz). Ärzte stehen in einem Spannungsfeld verschiedener

Ritter, Etzersdorfer, Stompe 166
ethischer Ansprüche, aber auch zwischen Allmachts und Ohnmachtsgefühlen. Wie der ethische Entscheidungsspielraum genutzt wird, hängt ganz wesentlich von der eigenen Wertehaltungen zur aktiven Strebehilfe ab. Diese Wertehaltung spiegelt in Teilaspekten den Stellenwert wieder, welchen das menschliche Leben in einer bestimmten geschichtlichen und gesellschaftlichen Situation hat. In einer im Jahr 2000 in Deutschland durchgeführten Befragung befürworteten etwa 81% der Bundesbürger Sterbehilfe bei unheilbar Kranken [8]. Eine Repräsentativumfrage an 1957 Personen ergab, dass 10,7% indirekte Sterbehilfe, 8,8% passive Sterbehilfe und 7,5% aktive Sterbehilfe als Aufgabe des Arztes ansahen. Für sich selbst würden 26,1% passive Sterbehilfe, 21,1% aktive Sterbehilfe, 13,1% indirekte Sterbehilfe und 6,2% Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen [22]. In den USA befürworteten 65% der Befragten aktive Sterbehilfe für Patienten im terminalen Stadium, die unter schweren Schmerzen leiden [11].Bei Ärzten fanden sich in verschiedenen Ländern deutliche Unterschiede in der Einstellung zur Frage der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe: In den USA [2,5,6,9,10], Kanada [25] und in Australien [3,16,22,24] fand die Idee der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe zumeist mehr Unterstützung als in Europa [7,9,14,18,19]. Das Medizinstudium ist eine sensible Phase für die Aneignung von Fähigkeiten zur ethischen Reflexion von Problemen im Umgang mit Tod und Sterben. Hier sollte der Grundstein für ethischen Basiskompetenzen gelegt werden [21]. In den vorliegenden Untersuchungen zeigten Medizinstudenten eine höhere Akzeptanz für Sterbehilfe als Ärzte [5,12,15,21]. Im Gegensatz zu den meisten westlichen Staaten gibt es aus Österreich bis dato keinerlei empirische Daten zur Einstellung zur Sterbehilfe.Für die hier vorliegende Untersuchung stellten wir die Hypothese auf, dass die Einstellung der Ärzteschaft
einerseits die Haltung des soziokulturellen Umfeldes widerspiegelt und andererseits ein Produkt der fachspezifischen Sozialisation durch das Medizinstudium und der ärztliche Tätigkeit ist.
Die für unsere Studie maßgeblichen Fragestellungen lauteten daher:• Wie ist die Haltung der öster
reichischen Bevölkerung zur Sterbehilfe?
• Verändert das Medizinstudium die Haltung zur aktiven Sterbehilfe?
• Unterscheiden sich die Einstellungen von Ärzten verschiedener Fachrichtungen voneinander?
Material und Methode
Um zu untersuchen, welchen Einfluss die Nähe zum medizinischen System auf die Einstellung zur aktiven Sterbehilfe hat, wurden vier Personengruppen in die Studie eingeschlossen:(a) Personen aus nichtmedizinischen Berufssparten (kurz „medizinische Laien“)Nach dem Zufallsprinzip wurden 200 Personen aus dem Telefonbuch Wien ausgewählt. Nach einer telefonischen Kontaktaufnahme wurden die Fragebögen per Post zugestellt. Der Rücklauf betrug, vermutlich wegen der brisanten Thematik, allerdings nur 39,5%. (b) Medizinstudenten aus dem vorklinischen StudienabschnittIm vorklinischen Studienabschnitt, der in Österreich ungefähr 2 Jahre dauert, haben die Studenten kaum Begegnungen mit Schwerkranken oder Sterbenden. (c) Medizinstudenten aus dem klinischen StudienabschnittIn diesem Abschnitt machen Medizinstudenten erste direkte Erfahrungen mit schwer kranken oder sterbenden Patienten. Die Fragebögen wurden im Rahmen von Kursen und Praktika an die Studenten verteilt.
(d) FachärzteBefragt wurden Fachärzte für Psychiatrie, Chirurgie und Innerer Medizin, tätig im Allgemeinen Krankenhaus Wien. Diese drei Fachrichtungen wurden ausgewählt, da deren Vertreter in unterschiedlichem Ausmaß mit unheilbarer Krankheit und Tod konfrontiert sind.
Der ursprüngliche Studienplan sah vor, dass jeweils 100 „medizinische Laien“, 100 Studenten aus dem vorklinischen und 100 Studenten aus dem klinischen Abschnitt sowie 100 Fachärzte in die Untersuchung eingeschlossen werden sollten. Aufgrund des niedrigen Rücklaufs war die Zahl der medizinischen Laien kleiner als geplant. Für die Befragung verwendeten wir den von Etzersdorfer und Ritter an der Universitätsklinik für Tiefenpsychologie und Psychotherapie Wien entworfenen Fragebogen „Einstellung zur aktiven Sterbehilfe“. Der Fragebogen, der von den Befragten selbständig ausgefüllt wird, ist in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt enthält Fragen über Alter, Geschlecht, Ausbildungsstatus, Berufstätigkeit, Familienstand und Religion. Im zweiten Abschnitt wird das Untersuchungsziel erläutert, darüber hinaus werden Begriffe wie aktive, indirekte, passive, willentliche und unfreiwillige Sterbehilfe definiert. Der dritte Abschnitt enthält 24 geschlossene Fragen zu Fällen von freiwilliger und unfreiwilliger aktiver Sterbehilfe mit 102 Antwortmöglichkeiten. Die vertrauliche Auswertung der Fragebögen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken wurde zugesichert. 372 Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt.
Statistisch ausgewertet wurden folgende Problemstellungen:(1) Die allgemeine Haltung zur aktiven Sterbehilfe: „Aktive Strebehilfe als Recht des Menschen“, „Legalisierung der aktiven Sterbehilfe“ und „Einforderung von aktiven Sterbehilfe für sich selbst in bestimmten Situationen“,

Die Nähe zum medizinischen Beruf und die Einstellung zur aktiven Sterbehilfe 167
(2) unter welchen Bedingungen der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe für andere bzw. für sich selbst gerechtfertigt ist, (3) wer die Entscheidung über die Durchführung der aktiven Sterbehilfe treffen sollte, (4) mit welchen Gefahren die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe verbunden sein könnte.
Ergebnisse
Die von uns befragte Personengruppe umfasste 79 medizinische Laien (36 Männer, 33 Frauen; Altersmedian: 40 Jahre; Range: 2070 Jahre), 90 Medizinstudenten der Universität Wien aus dem vorklinischen Studienabschnitt (33 Männer, 57 Frauen; Altersmedian: 23 Jahre; Range: 18 – 33 Jahre) und 100 Medizinstudenten aus dem klinischen Studienabschnitt (39 Männer, 61 Frauen; Altersmedian: 25 Jahre; Range; 22 – 36 Jahre). Weiters wurde der Fragebogen von 38 Psychiater (18 Männer, 20 Frauen; Altersmedian: 41,5 Jahre; Range 31 – 60 Jahre), 31 Chirurgen (23 Männer, 8 Frauen; Altersmedian: 34 Jahre, Ran
ge: 29 – 59 Jahre) und 34 Internisten (15 Männer, 19 Frauen; Altersmedian: 40 Jahre; Range: 32 61 Jahre), die im Allgemeinen Krankenhaus Wien beschäftigt waren, ausgefüllt. Durch zwei Fragen versuchten wir die allgemeine Einstellung zur Sterbehilfe zu erfassen. Auf allgemeine ethischphilosophische Wertehaltungen zielten die Fragen, ob ein Mensch in gewissen Fällen das Recht auf aktive Sterbehilfe hätte und ob die aktive Sterbehilfe legalisiert werden solle. Konkret auf die eigene Person bezogen wurde gefragt, ob man sich vorstellen könnte, für sich selbst in manchen Fällen Sterbehilfe einzufordern. Bei allen drei Fragen ergaben sich hochsignifikante Verteilungsunterschiede zwischen den 6 Gruppen: Mit zunehmender beruflicher Nähe zu schwerkranken und sterbenden Patienten wird eine eher ablehnende Haltung zur aktiven Sterbehilfe eingenommen, was sich am deutlichsten bei den Internisten zeigt (Tabelle 1). Obwohl die Ärzte der aktiven Sterbehilfe mehrheitlich ablehnend gegenüber standen wären sie allerdings eher als die übrigen Befragten bereit, diese nach einer Legalisierung durchzuführen.
Zwischen den Kollektiven bestand ein durchaus erheblicher Altersunterschied. Das Durchschnittsalter der medizinischen Laien betrug 41,4 Jahre, der vorklinischen Studenten 21,6 Jahre. Es musste daher ausgeschlossen werden, dass die unterschiedlichen Haltungen einen Generationsunterschied und weniger den Effekt der Nähe und Distanz zum medizinischen System wiedergeben. Um den Einfluss des Alters zu überprüfen, wurden Spearman Korrelationen zwischen dem Alter der Probanden und den Items zu den allgemeinen Einstellungen zur aktiven Sterbehilfe berechnet (Tabelle 2).
In keiner der Gruppen fand sich eine statistisch signifikante positive oder negative Korrelation zwischen Alter und den Einstellungen zur aktiven Sterbehilfe, obwohl der Altersunterschied innerhalb der einzelnen Gruppen – bei den medizinischen Laien von 20 bis 70 Jahre – oft ganz erheblich war. Um die Einsicht in die Wertehaltungen zu vertiefen, wurde gefragt, unter welchen Lebensumständen die Gewährung aktiver Sterbehilfe für andere und für sich selbst vorstellbar
Laien(N=79)
Vorklinische Studenten
(N=90)
Klinische Studenten(N=100)
Psychiater(N=38)
Chirurgen(N=31)
Internisten(N=34)
p
Der Mensch hat in bestimmten Situationen das Recht auf aktive Sterbehilfe
2,82 ± 0,9 2,60 ± 0,9 2,50 ± 1,0 2,19 ± 0,8 2,27 ± 1,0 1,59 ± 0,8 ,000
Aktive Sterbehilfe soll in manchen Fällen legalisiert werden
2,70 ± 0,8 2,65 ± 0,9 2,44 ± 1,0 2,29 ± 1,0 2,81 ± 1,0 1,71 ± 0,8 ,000
Wäre ich Arzt, so wäre ich bereit, in bestimmten Fällen aktive Sterbehilfe durchzuführen
2,63 ± 0,9 2,81 ± 0,9 2,89 ± 1,0 3,24 ± 0,8 2,55 ± 1,0 3,53 ± 0,7 ,000
Ich würde in bestimmten Fällen für mich aktive Sterbehilfe einfordern
2,37 ± 0,9 2,19 ± 0,9 2,11 ± 1,0 1,76 ± 0,8 2,45 ± 1,0 1,47 ± 0,7 ,000
Tabelle 1: Meinung von medizinischen Laien, Medizinstudenten und Fachärzten für Psychiatrie, Interne Medizin und Chirurgie zur Sterbehilfe (1 = nein; 2 = eher nein; 3 = eher ja; 4 = ja)
KruskalWallis OneWay ANOVA

Ritter, Etzersdorfer, Stompe 168
Laien(N=79)
Vorklinische Studenten
(N=90)
Klinische Studenten (N=100)
Psychiater(N=38)
Chirurgen(N=31)
Internisten(N=34)
Der Mensch hat in bestimmten Situationen das Recht auf aktiveSterbehilfe
,049 ,004 ,005 -,216 -,103 -,188
Aktive Sterbehilfe soll in manchen Fällen legalisiert werden
,017 ,036 ,066 ,183 -,293 ,142
Wäre ich Arzt, so wäre ich bereit, in bestimmten Fällen aktive Sterbehilfe durchzuführen
-,065 -,007 -,115 ,101 -,051 ,229
Ich würde in bestimmten Fällen für mich aktive Sterbehilfe einfordern
,017 -,013 ,001 -,116 ,264 ,264
Tabelle 2: Korrelationskoeffizienten von Alter und den Ansichten von medizinischen Laien, Medizinstudenten und Fachärzten für Psychiatrie, Interne Medizin und Chirurgie zur Sterbehilfe (1 = nein; 2 = eher nein; 3 = eher ja; 4 = ja)
Spearman Korrelation
BedingungLaien
(N=79)
Vorklinische Studenten
(N=90)
Klinische Studenten (N=100)
Psychiater(N=38)
Chirurgen(N=31)
Internisten(N=34) p
Für Andere
Unbehandelbare chronische Schmerzen
65,2% 49,4% 50,0% 55,6% 56,0% 29,6% ,049
Unheilbar krank 62,5% 56,6% 48,1% 48,1% 54,2% 18,5% ,006
Alt und immobil 33,3% 14,1% 24,7% 22,2% 26,9% 3,2% ,016
Von Pflege abhängig 40,6% 26,5% 26,8% 22,2% 20,8% 24,1% ,086
Körperlich schwerst behindert 23,3% 20,5% 23,7% 44,4% 36,0% 14,8% ,086
Geistig schwerst behindert 3,4% 1,3% 10,8% 7,4% 4,2% -- ,079
Für die eigene Person
Unbehandelbare chronische Schmerzen
74,2% 63,9% 57,2% 70,4% 37,0% 8,3% ,023
Unheilbar krank 67,2% 54,2% 50,6% 55,6% 54,2% 18,5% ,003
Alt und immobil 36,5% 35,3% 32,5% 74,1% 37,5% 15,4% ,001
Von Pflege abhängig 65,6% 47,0% 42,7% 74,1% 50,0% 44,8% ,014
Körperlich schwerst behindert 33,3% 33,7% 38,6% 48,1% 56,0% 33,3% ,300
Geistig schwerst behindert 31,0% 32,1% 32,4% 9,2% 9,7% 16,7% ,228
Tabelle 3: Bedingungen, unter denen eine aktive Sterbehilfe für Patienten und für die eigene Person vorstellbar wäre
Chi2 Test, Fischer’s exakter Test

Die Nähe zum medizinischen Beruf und die Einstellung zur aktiven Sterbehilfe 169
wäre. Dabei wurden sechs verschiedene Situationen vorgegeben (Tabelle 3).
Bei nahezu allen der vorgegebenen Möglichkeiten waren die medizinischen Laien am großzügigsten in der Gewährung der aktiven Sterbehilfe, gefolgt von den beiden Studentengruppen. Für mehr als der Hälfte der Befragten schien der Wunsch von Kranken mit chronischen, unbehandelbaren Schmerzen nach aktiver Sterbehilfe nachvollziehbar zu sein, wobei sich auch hier die Internisten durch eine betont ablehnende Haltung von den anderen Gruppen abhoben. Mit ähnlich großem Verständnis kann der Wunsch von unheilbar
Kranken nach einem aktiv herbeigeführten Tod rechnen, wobei sich auch hier von den Laien zu den Fachärzten hin eine kontinuierliche Abnahme der Zustimmung fand. Für die Todeswünsche von alten und immobil gewordenen Menschen konnten vor allem die medizinischen Laien Verständnis aufbringen, die Medizinstudenten glichen in ihrem Antwortverhalten eher den Ärzten. Die Problematik der Pflegeabhängigkeit wurde von allen Gruppen ähnlich bewertet. Körperliche und vor allem geistige Behinderung wurden in wesentlich geringerem Ausmaß als ausreichende Bedingung für die Leistung aktiver Sterbehilfe akzeptiert.
Alle Befragten würden in der gleichen Situation häufiger aktive Sterbehilfe für sich selbst in Anspruch nehmen. Besonders auffällig war das Gefälle zwischen Inanspruchnahme und Gewährung bei der Vorstellungen, von Pflege abhängig zu sein und körperlich oder geistig schwerst behindert zu sein. Die Internisten unterschieden sich einmal mehr von den anderen Fachärzten, da unbehandelbare Schmerzen, unheilbare Krankheit und Immobilität seltener einen Grund darstellten, für sich selbst aktive Sterbehilfe zu beanspruchen. Um die Konsistenz der Wertehaltungen besser beurteilen zu können, wurden für jede der Gruppen Korrelationen zwischen Inanspruchnahme
BedingungLaien
(N=79)
Vorklinische Studenten
(N=90)
Klinische Studenten (N=100)
Psychiater(N=38)
Chirurgen(N=31)
Internisten(N=34)
Unbehandelbare chronische Schmerzen
,81*** ,49*** ,76*** ,73*** ,51** ,85***
Unheilbar krank ,83*** ,44** ,81*** ,27 ,76*** ,50*
Alt und immobil ,93*** ,34** ,63*** ,32 ,47* ,45*
Von Pflege abhängig ,60*** ,47** ,59*** ,32 ,46* ,51*
Körperlich schwerst behindert ,78*** ,33** ,65*** ,63*** .59** ,67***
Geistig schwerst behindert ,28* ,08 ,50*** ,43 ,47* --
Tabelle 4: Korrelationskoeffizienten der Bedingungen, unter denen eine aktive Sterbehilfe für Patienten und für die eigene Person vorstellbar wäre
Spearman Korrelationen; * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001
Laien(N=79)
Vorklinische Studenten
(N=90)
Klinische Studenten (N=100)
Psychiater(N=38)
Chirurgen(N=31)
Internisten(N=34)
Patient 47 (59,5%) 22 (24,5%) 37 (37%) 11 (28,9%) 11 (35,5%) 13 (37,5%)
Angehörige -- 1 (1,1%) -- -- -- --
Behandelnder Arzt -- -- -- 2 (5,3%) -- --
Ärzteteam 3 (3,8%) -- 1 (1%) 1 (2,6%) 1 (3,3%) 4 (12,9%)
Sterbehilfeteam 29 (36,7%) 67 (74,4%) 62 (62%) 24 (63,2%) 19 (61,2%) 17 (49,6%)
Tabelle 5: Wer soll die Entscheidung über die Durchführung der aktiven Sterbehilfe treffen?

Ritter, Etzersdorfer, Stompe 170
und Gewährung der aktiven Sterbehilfe berechnet (Tabelle 4).
Medizinischen Laien und Medizinstudenten erwiesen sich als deutlich konsistenter als die Ärzte. Bei den Psychiatern war die Diskrepanz zwischen Inanspruchnahme und Befürwortung am größten. Bei der Frage, wer über die Durchführung der aktiven Sterbehilfe entscheiden sollte, waren fünf Antwortmöglichkeiten vorgegeben: (a) der Patient selbst, (b) die Angehörigen, (c) der behandelnde Arzt, (d) ein Ärzteteam, (e) ein multiprofessionelles Sterbehilfeteam, zusammengesetzt aus Ärzten, Psychologen, Pflegepersonen und Seelsorgern (Tabelle 5).
Am deutlichsten pochten die medizinischen Laien auf das Selbstbestimmungsrecht des Patienten (59,3%).
Bereits bei den Studenten im 1. Abschnitt waren nur mehr 24,5% der Ansicht, dass der Kranke die Entscheidung alleine treffen sollte. Lediglich ein Student im klinischen Abschnitt war der Ansicht, dass man den Angehörigen die Entscheidung überlassen sollte. Die große Mehrzahl der Studenten und der Fachärzte votierte für eine möglichst breite Entscheidungsbasis („Sterbehilfeteam“). Immerhin meinten 12,9% der Internisten, dass die Entscheidungskompetenz bei den Ärzten bleiben sollte („Ärzteteams“). Lediglich zwei Psychiater gaben an, dass die Verantwortung in die Hände des behandelnden Arztes gelegt werden sollte.
Die Gefahren, die sich aus der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe ergeben könnten, wurden unterschiedlich bewertet (Tabelle 6).
Vor allem Studenten im klinischen Abschnitt und Psychiater befürchteten, dass durch die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe das ArztPatienten Verhältnis in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Die Gefahr, dass die Ungeduld gegenüber dem Leiden wächst, wurde von allen Gruppen relativ gleichmäßig als hoch eingeschätzt. Mit Ausnahme der Chirurgen meinten alle Befragten, dass wahrscheinlich der moralische Druck auf Kranke größer werden würde, Zustimmung zur Sterbehilfe zu erteilen. Die Ärzte, und hier vor allem die Internisten, befürchteten, dass auch der Druck auf die Ärzte steigen könnte, gegen ihren Willen aktiv Patienten zu töten. Die Gefahr, dass volkswirtschaftliche Erwägungen einen großen Einfluss auf die Durchführung der Sterbehilfe nehmen könnten, wird von allen Gruppen am geringsten eingeschätzt.
Laien(N=79)
Vorklinische Studenten
(N=90)
Klinische Studenten(N=100)
Psychiater(N=38)
Chirurgen(N=31)
Internisten(N=34) p
Vertrauen zu Ärzten wird in Mitleidenschaft gezogen
2,22 ± 0,9 2,42 ± 0,8 2,89 ± 0,8 2,79 ± 0,8 2,42 ± 0,9 2,50 ± 0,9 ,020
Ungeduld gegenüber dem Leiden wächst
2,63 ± 0,9 2,75 ± 0,8 2,75 ± 0,8 2,82 ± 0,8 2,58 ± 1,0 3,09 ± 0,9 ,141
Kranken könnte vorgeworfen werden, dass sie der Sterbehilfe nicht zustimmen
2,16 ± 1,1 2,12 ± 1,0 2,01 ± 1,0 2,37 ± 0,9 1,77 ± 1,0 2,06 ± 1,0 ,172
Der moralische Druck auf Kranke, der aktiven Sterbehilfe zuzustimmen, würde wachsen
2,63 ± 1,0 2,68 ± 0,9 2,46 ± 0,9 2,68 ± 0,7 2,06 ± 0,8 2,61 ± 0,9 ,021
Die Ärzte könnten gegen ihren Willen unter Druck gesetzt werden, die aktive Sterbehilfe durchzuführen
2,13 ± 1,2 2,47 ± 0,9 2,68 ± 1,0 2,97 ± 0,9 2,76 ± 1,0 3,21 ± 1,1 ,008
Volkswirtschaftliche Motive könnten bestimmend werden
2,10 ± 0,7 2,10 ± 0,6 2,07 ± 0,6 1,92 ± 0,6 2,16 ± 0,6 2,00 ± 0,8 ,638
Tabelle 6: Negative Konsequenzen, die sich durch die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe ergeben könnten (1 = nein; 2 = eher nein; 3 = eher ja; 4 = ja)
KruskalWallis OneWay ANOVA

Die Nähe zum medizinischen Beruf und die Einstellung zur aktiven Sterbehilfe 171
Diskussion
Die zentrale Fragestellung der vorliegenden war, ob und in welche Richtung das Medizinstudium, die Konfrontation mit menschlichem Leid und unheilbaren Erkrankungen, sowie ob die berufliche Erfahrung die Wertehaltungen zu diesem Problemkreis verändern. Es handelt sich dabei um die erste, explorative, allerdings nichtrepräsentative Untersuchung in Österreich, die ein momentanes Meinungsbild zum Thema der aktiven Sterbehilfe wiedergibt. Befragt wurden medizinische Laien, Medizinstudenten aus dem vorklinischen und klinischen Abschnitt und Fachärzte aus den Bereichen Psychiatrie, Chirurgie und Innerer Medizin. Diese drei medizinischen Fachbereiche wurden aus zwei Gründen ausgewählt: (a) wegen der unterschiedlichen professionellen Nähe zu Sterben und Tod. Dabei gingen wir von der Annahme aus, dass Internisten am intensivsten in Sterbeprozesse involviert sind, Psychiater am wenigsten damit konfrontiert sind und Chirurgen eine Zwischenstellung einnehmen; (b) die unterschiedliche Involvierung in Entscheidungsprozesse über die Durchführung der aktiven Sterbehilfe im Falle einer Legalisierung. Auch hiervon wären die Internisten wohl am meisten betroffen, gefolgt von den Psychiatern, die zu Fragen nach der Geschäftsfähigkeit des Kranken, aber auch für die Klärung der Frage, ob ein Patient nur aufgrund einer psychischen Erkrankung auf aktive Sterbehilfe drängt, Stellung nehmen müssten. Die medizinischen Laien beharrten auf dem Recht des Einzelnen auf Sterbehilfe und damit verbunden auf die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe (Tabelle 1). Der Kranke soll bei unheilbaren Erkrankungen und unbehandelbaren Leidenszuständen selbst über den Zeitpunkt der Beendigung seiner Leiden entscheiden können. Wenn sie sich allerdings in die Rolle des Arztes versetzen sollten, der aktiv die Sterbehilfe durchzuführen hätte, war die Bereitschaft hingegen
niedrig, selbst Verantwortung dafür zu übernehmen. Hier waren die Ärzte eher bereit, nach einer Legalisierung auch die Verantwortung über die Durchführung zu übernehmen. Bei jeder dieser Fragen nahmen die Medizinstudenten eine Zwischenstellung ein, wobei das Meinungsbild der Studenten im ersten Studienabschnitt größere Ähnlichkeiten mit dem der medizinischen Laien hatte, im klinischen Abschnitt sich dagegen den Einstellungen der Fachärzte annäherte (Tabelle 2). Bereits im ersten Abschnitt lehnten die Medizinstudenten stärker als die medizinischen Laien die Legalisierung ab, ein Befund, der sich ähnlich in Deutschland fand [22]. Nach einer Legalisierung wären die fortgeschrittenen Studenten jedoch häufiger bereit, im Rahmen der zukünftigen ärztlichen Tätigkeit aktiv Sterbehilfe zu leisten.Mit zunehmender Nähe zum ärztlichen Beruf sank das Bedürfnis, für sich selbst aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Dies kann als Hinweis dafür interpretiert werden, dass die Ablehnung der aktiven Herbeiführung des Todes nicht nur Resultat einer positiven oder negativen ärztlichen Entscheidungsmacht ist, sondern dass sich durch die Ausbildung und durch die direkte Begegnung mit Leiden und Sterben ein Wandel bestimmter ethischer Grundhaltungen vollzieht. Einige Einwände gegen diese Schlussfolgerungen, die sich aus der Zusammensetzung unseres Samples ergeben, konnten wir teilweise entkräften: der Einwand, dass Menschen, die den ärztlichen Beruf wählen, von vornherein andere Wertehierarchien als die Allgemeinbevölkerung aufweisen, scheint durch die Tatsache widerlegt, dass Medizinstudenten in ihrer Haltung zur Sterbehilfe eine Zwischenstellung zwischen medizinischen Laien und Ärzten einnehmen (Tabelle 1). Ein weiterer möglicher Einwand ist, dass der große Altersunterschied zwischen der Gruppe der Laien und den Studenten eine solche Schlussfolgerung gar nicht zulässt, dass die
unterschiedlichen Wertehaltungen Resultat eines Altersbias sind. Innerhalb der beiden Gruppen mit einem breiten Altersrange (Laien und Fachärzte) zeigte sich jedoch kein Zusammenhang von Einstellung und Alter der Befragten (Tabelle 2). Ein Jahrsgangskohorteneffekte erscheint ebenfalls unwahrscheinlich, da sich zwischen den Laien und den Fachärzte zwar kein signifikanter Altersunterschied findet, die Meinungen zur aktiven Sterbehilfe aber weit auseinander gehen (Tabelle 2). Vorsichtig lässt sich daher postulieren, dass die unterschiedlichen Einstellungen der von uns befragten Personen zur aktiven Sterbehilfe tatsächlich auf die unterschiedliche Nähe zum medizinischen System beruhen. Die größere alltagspraktische Distanz der medizinischen Laien, aber auch der vorklinischen Studenten zur Krankheits und Todesproblematik geht dabei mit einer relativ starken Bejahung der aktiven Sterbehilfe einher. Diese Befürwortung scheint aber im Wesentlichen auf abstrakten Ideen und auf Ängsten, im Falle einer Erkrankung Leidenszuständen hilflos ausgeliefert zu sein, zu beruhen. Die konkrete berufliche Konfrontation führt zu einer Veränderung dieser Wertehaltungen, die aktive Sterbehilfe erfährt eine zunehmende Ablehnung. Einerseits bekommen die Studenten im klinischen Abschnitt bereits öfter Einblick in die Möglichkeiten Schmerzen mit palliativ-medizinischen Methoden suffizient zu behandeln, andererseits sind fortgeschrittene Studenten und Ärzte natürlich stärker mit dem ethischen Problem konfrontiert, dass im Fall einer zukünftigen Legalisierung der aktiven Sterbehilfe die medizinische Profession auch ganz konkret für die Durchführung verantwortlich wäre.Ein differenzierteres Bild bietet sich, wenn man über die allgemeine Haltung zur aktiven Sterbehilfe hinaus detaillierter Fragen zu umschriebenen Leidenszuständen stellt (Tabelle 3). Auch hier sind die medizinischen Laien die stärksten Befürworter der aktiven Sterbehilfe. Mit dem größ

Ritter, Etzersdorfer, Stompe 172
ten Verständnis für den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe können in allen Gruppen unheilbar Kranke und Personen, die an unbehandelbaren Schmerzen leiden, rechnen. Nur ein sehr geringer Prozentsatz der Befragten sieht in schwerer geistige Behinderung einen Anlassfall, ein Thema, das auch in der politischen und medialen Sterbehilfedebatte nicht zur Disposition steht. Signifikante Gruppenunterschiede fanden sich bei der Frage nach Gewährung der aktiven Sterbehilfe bei unheilbar Kranken, unbehandelbaren Schmerzen und bei alten, immobilen Patienten. Auch in diesem Punkt zeichneten sich die Internisten einmal mehr durch starke Ablehnung aus. Ein interessantes Bild ergab sich, als dieselben Fragen in Bezug auf die eigene Person gestellt wurden. Während bei den allgemein gehaltenen Fragen aktive Sterbehilfe häufiger befürwortet als selbst beansprucht wurde, so ist nun das Bild komplexer. Wie in den meisten übrigen Bereichen zeigten auch hier die Internisten die größte Zurückhaltung, während von allen Gruppen die medizinischen Laien am häufigsten für sich das Recht auf eine autonome Entscheidung über den Todeszeitpunkt in Anspruch nehmen würden. Auffällig war allerdings eine klare Diskrepanz in der Bewertung von schwersten körperlichen oder geistigen Behinderungen: Während alle Gruppen eine schwere Behinderung nicht als ausreichende Bedingung für die Genehmigung und Durchführung der aktiven Sterbehilfe bei anderen Personen ansahen, war der Wunsch einer Inanspruchnahme bei einer eigenen Betroffenheit wesentlich größer. Um zu eruieren, ob sich einzelne Gruppen durch besondere Inkonsequenz auszeichnen, berechneten wir die Korrelationen zwischen Befürwortung und Inanspruchnahme (Tabelle 4). Der kompakteste Zusammenhang zeigte sich durchgängig bei unheilbaren Schmerzzuständen. Laien und Medizinstudenten, die in der Praxis am wenigsten in medizinische Entschei
dungsprozesse involviert sind, waren in diesem Punkt konsequenter als die befragten Fachärzte. Die Psychiater zeigten die niedrigste Korrelation von Fremd und Selbstbefürwortung. Eine mögliche Erklärung wäre, dass Psychiater zwar mit teilweise psychisch schwer kranken Patienten zu tun haben, langsames und qualvolles Sterben und damit auch die Gewährung aktiver Sterbehilfe aber nicht im selben Ausmaß wie bei den beiden anderen Fachrichtungen problematisiert wird. Die Frage, wer denn nun die Entscheidung über die Durchführung einer aktiven Sterbehilfe treffen solle, führte neuerlich zu einer Polarisierung (Tabelle 5). Während medizinische Laien in der Frage der aktiven Sterbehilfe die individuellen Selbstbestimmungsrechte des Einzelnen gefährdet sehen und die Entscheidungsgewalt des Kranken hervorgehoben wird, scheint der professionelle Umgang mit unheilbarer Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Agonie, Sterben und Tod das Bedürfnis zu steigern, die Verantwortung für die Gewährung der aktiven Sterbehilfe auf eine multiprofessionellen Basis zu stellen.Negative Konsequenzen der Legalisierung der Sterbehilfe werden von Fachärzten stärker hervorgehoben (Tabelle 6). Die Fachärzte gehen generell davon aus, dass die Qualität des ArztPatienten Verhältnisses leiden wird, eine Annahme, die von den Laien nicht geteilt wird. Die Internisten, die von einer Gesetzesänderung am stärksten betroffen wären, befürchten vor allem eine wachsende Ungeduld gegenüber dem Leiden und vermuten, dass sich der Druck zur Durchführung auf den behandelnden Arzt erhöhen könnte. Die Sorge, dass aus volkswirtschaftlichen Erwägungen Druck auf Arzt und Patienten entstehen könnte, spielt bei allen sechs Gruppen eine vergleichsweise geringe Rolle.Unsere Daten zeigen, dass zwischen Ärzten und Laien deutliche Unterschiede in der Einstellung zur aktiven Sterbehilfe bestehen, ein Ergebnis,
das verstärkt in die öffentliche Diskussion eingebracht werden sollte. Personen, die dem medizinischen System fern stehen, befürworten häufig aktive Sterbehilfe. Hier dürften Ängste im Falle einer eigenen schweren Erkrankung Leidenszuständen und Schmerzen hilflos ausgeliefert zu sein, eine wichtige Rolle spielen. Mit zunehmender Nähe zum medizinischen Berufsalltag entwickeln sich deutliche Vorbehalte gegenüber der aktiven Sterbehilfe. Unklar bleibt allerdings, ob diese Haltung das Ergebnis reflektierter ethischer Überlegungen ist oder ob die Begegnung mit dem Sterben eigene (unbewusste) Ängste aktiviert. Qualitative Tiefeninterviews sind erforderlich, um diese Frage klären zu können.
Literatur
[1] Aigner G.: Das österreichische Patientenverfügungsgesetz (PatVG). J Neurol Neurochir Psychiatr 4, 2933 (2007).
[2] Bachman J.G., Alcser K.H., Doukas D.J., Lichtenstein R.L., Corning A.D., Brody H.: Attitudes of Michigan physicians and the public toward legalizing physicianassisted suicide and voluntary euthanasia. N Engl J Med 334,303339 (1996).
[3] Baume P., O'Malley E.: Euthanasia: attitudes and practices of medical practitioners. Med J Aust 161,142144 (1994)
[4] Beauchamp T.L., Childress J.F.: Principles of biomedical ethics. 4th edition. Oxford University Press, Oxford 1994.
[5] Caralis P.V., Hammond J.S.: Attitudes of medical students, housestaff, and faculty physicians toward euthanasia and termination of lifesustaining treatment. Crit Care Med 20, 683690.(1992).
[6] Cohen J.S., Fihn S.D., Boyko E.J., Jonsen A.R., Wood R.W.: Attitudes toward assisted suicide and euthanasia among physicians in Washington State. N Engl J Med 331, 8994 (1994).
[7] Csef H., Heindl B.: Einstellungen zur Sterbehilfe bei deutschen Ärzten. Eine repräsentative Befragung im Ärztlichen Kreisverband Würzburg. Dtsch Med Wochenschr 123, 15011506 (1998).
[8] Dehmel S.: Sterbehilfe sollte erlaubt sein. Humanes Leben – Humanes Sterben 20, A7657A7658 (2000).
[9] Di Mola G., Borsellino P., Brunelli C., Gallucci M., Gamba A., Lusignani M., Regazzo C., Santosuosso A., Tamburini

Die Nähe zum medizinischen Beruf und die Einstellung zur aktiven Sterbehilfe 173
M., Toscani F. Attitudes toward euthanasia of physician members of the Italian Society for Palliative Care. Ann Oncol 7, 907911 (1996).
[10] Duberstein P.R., Conwell Y., Cox C., Podgorski C.A., Glazer R.S., Caine E.D.: Attitudes toward selfdetermined death: a survey of primary care physicians. J Am Geriatr Soc 43, 395400 (1995).
[11] Genuis S.J., Genuis S.K., Chang W.C.: Public attitudes toward the right to die. Can Med Assoc J 150, 701708 (1994).
[12] Hinterhuber H., Meise U.: Gedanken zu den SterbehilfeBestrebungen in europäischen Ländern. Neuropsychiatrie 22, 277282 (2008).
[13] Kaldjian L.C., Jekel J.F., Bernene J.L., Rosenthal G.E., VaughanSarrazin M., Duffy T.P., Karlsson M., Strang P., Milberg A.: Attitudes toward euthanasia among Swedish medical students. Palliat Med 21, 615622 (2007).
[14] Kinsella T.D., Verhoef M.J.: Determinants of Canadian physicians' opinions about legalized physicianassisted suicide: a national survey. Ann R Coll Physicians Surg Can 32, 211215 (1999).
[15] Kirschner R., Elkeles T.: Handlungsmuster und Einstellungen von Ärzten zur Sterbehilfe. Psychomed 8/4, 223232 (1996).
[16] Kucinskas A., Lenoir S., Levin A., Orzalesi M., Persson J., Rebagliato M., Reid M., Laken D.E., Dowd S.B. Allied health students' attitudes toward euthanasia. J Allied Health 27, 213220 (1998).
[17] Kuhse H., Singer P., Baume P., Clark M., Rickard M. Endoflife decisions in Australian medical practice. Med J Aust 166,191196 (1997).
[18] Lofmark R., Nilstun T., Cartwright C., Fischer S., van der Heide A., Mortier F., Norup M., Simonato L., OnwuteakaPhilipsen B.D.: Physicians' experience with endoflife decisionmaking: survey in 6 European countries and Australia. BMC Med 12, 4 (2008).
[19] MüllerBusch H.C., Oduncu F.S., Woskanjan S., Klaschik E.: Attitudes on euthanasia, physicianassisted suicide and terminal sedation—a survey of the members of the German Association for Palliative Medicine. Med Health Care Philos 7, 333339 (2004).
[20] OnwuteakaPhilipsen B.D., Fisher S., Cartwright C., Deliens L., Miccinesi G., Norup M., Nilstun T., van der Heide A., van der Wal G., European EndofLife Consortium: Endoflife decision making in Europe and Australia: a physician survey. Arch Intern Med 24, 921929 (2006).
[21] RamírezRivera J., Cruz J., JaumeAnselmi F.: Euthanasia, assisted suicide and endoflife care: attitudes of students, residents and attending physicians. P R Health Sci J 25, 325329 (2006).
[22] Schröder C., Pollaschek M., Schmutzer G., Brosig B.: Ärztliche Sterbehilfe – Meinungsbilder von Medizinstudenten und Allgemeinbevölkerung im Vergleich Z Med Psychol 16, 105113 (2007).
[23] Schröder C., Schmutzer G., Klaiberg A., Brähler E.: Ärztliche Sterbehilfe im Spannungsfeld zwischen Zustimmung zur Freigabe und persönlicher Inanspruchnahme Ergebnisse einer repräsentativen Befragung der deutschen Bevölkerung. Psychother Psych Med 53, 334343 (2003).
[24] Singer P.: Praktische Ethik. Reclam, Stuttgart 1990.
[25] Steinberg M.A., Cartwright C.M., MacDonald S.M., Najman J.M., Williams G.M.: Selfdetermination in terminal care. A comparison of GP and community members' responses. Aust Fam Physician 26, 703707 (1997).
[26] Verhoef M.J., Kinsella T.D.: Alberta Euthanasia Survey: 3year followup. CMAJ 155, 885890 (1996).
[27] Zoglauer T.: Tödliche Konflikte. Moralisches Handeln zwischen Leben und Tod. Omega, Stuttgart 2007
Dr. med. Dr. phil. Kristina RitterNeurologisches Zentrum Rosenhü[email protected]

Schlüsselwörter:
Psychiatrie – Psychotherapie – Schizo-
phrenie – schizoaffektive Störung – be-
wältigungsorientierte Therapie
Key words:
psychiatry – psychotherapy – schizophre-
nia – schizo-affective disorder – coping-
oriented therapy
Psychoedukative und bewälti-gungsorientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnenAnliegen: Es sollte evaluiert werden, in wieweit Patienten mit Schizophrenie oder einer schizoaffektiven Erkrankung von einem psychoedukativen, bewältigungsorientierten Therapieprogramm profitieren können.Methode: Für die Evaluation wurde ein kontrolliertes prospektives Studiendesign herangezogen. Zum Einsatz kam in der Experimentalgruppe das “Therapiemanual zur Psychoedukation und Krankheitsbewältigung” (PKB), das neben gezielter Information über die Erkrankung und die Pharmakotherapie Strategien vermittelt, wie Frühwarnsignale erkannt und der Umgang mit ihnen erlernt werden können. Darüber hinaus werden auch Aspekte zu „gesundem“ Verhalten
behandelt. Als Kontrollgruppe diente eine Patientengruppe mit supportiven Gesprächen bzw. eine Gruppe mit dem Schwerpunkt der Arbeitsrehabilitation. Um die Effekte der PKB zu evaluieren, wurden der psychopathologische Status, wissensbezogene sowie soziale Variablen zu verschiedenen Messzeitpunkten (vor der Therapie, nach Therapieende, 12 Monate nach Therapieende) erhoben. Als abhängige Variablen dienten der Wissensstand über die Erkrankung, Rehospitalisierungen, soziale Integration und Bewältigungsstrategien. Ergebnisse: 82 Patienten nahmen an der Studie teil. Sowohl in der Experimentalgruppe als auch in der Kontrollgruppe wurde eine signifikante Verbesserung des Allgemeinzustandes und der Psychopathologie beobachtet. Die Ergebnisse der Gruppen unterschieden sich insofern, dass in der Experimentalgruppe weniger Rehospitalisierungen im ersten Jahr nach Studienende vermerkt wurden und die Teilnehmer sich anderer Copingstrategien bedienten (signifikant weniger depressive Krankheitsverarbeitung und Bagatellisierung). Schlussfol-gerungen: In der Behandlung von Schizophrenie können unterschiedliche Interventionen wirksam sein. Fragestellungen, welche Patienten von welcher Art der therapeutischen bzw. rehabilitativen Intervention profitieren können, sollten weiterhin Gegenstand intensiver Forschung sein.
Psycho-educational coping-orien-ted group therapy for schizophre-nia patients Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of a psychoeducational, copingoriented therapy programme for patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. Method: Controlled, prospective study design. In the experimental group the Therapy Manual for Psychoeducation and Coping with Illness (PKB) was used, providing targeted information on the illness, medical treatment, prodromal symptoms, and health behaviour. Controls participated in supportive dialogues or in an occupational rehabilitation programme. Psychopathology, rehospitalisations, knowledge, functional outcome and coping strategies were assessed before, directly after and 12 months post therapy. Results: 82 patients participated. In both groups (experimental, control) a significant improvement in psychopathology and general functioning level were observed. Specific advantages for patients of the experimental group were limited to a few aspects, including rehospitalisations in the first year and certain coping strategies. Conclusi-on: In the treatment of schizophrenia different forms of psychosocial intervention (experimantal, control) can be effective. Identification of subgroups profiting specially from certain types of intervention should be subject of future research.
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnen
Christina Haller1, Karl Andres2, Alex Hofer1, Martina Hummer1, Sarah Gutweniger1,
Georg Kemmler1, Mario Pfammatter2 und Ullrich Meise1
1 Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie Innsbruck,
Department für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Innsbruck2 Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD), Sozial- und Gemeindepsychiatrie Bern
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 174–183 Original Original

Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnen 175
1. Einleitung
Auch bei guter Compliance und antipsychotischer Medikation liegt die Rückfallsrate von Patienten mit Schizophrenie zwischen 20 und 30% pro Jahr und ein Teil der Betroffenen leiden konstant an positiven und negativen Symptomen [40], weiters zeigen die Patienten vermehrt ungünstiges Gesundheitsverhalten [35]. Im Wissen dieser Problematik sind speziell diejenigen therapeutischen Ansätze wichtig, welche die Krankheitsbewältigung von Patienten verbessern. Besonders der Psychoedukation und der kognitiven Verhaltenstherapie kommt dabei ein großer Stellenwert zu, auch um die sich heute darbietenden Möglichkeiten der Selbstbefähigung und Selbstermächtigung im Sinne von Empowerment [23] und Recovery [38] zu unterstützen.In der Psychoedukation wird vor allem Information zur Krankheit, zur Erkennung von Frühwarnsignalen und zur Symptombewältigung vermittelt. Es gibt einige Manuale über die Durchführung der Psychoedukation [19,46,8,25,37,11]. Diese Intervention kann in Kombination mit Antipsychotika zu einer signifikanten Reduktion der Rückfallsrate [21,33], verglichen mit ausschließlich medikamentöser Behandlung, führen. Kognitiv- verhaltenstherapeutischen Interventionen haben v.a. eine Modifikation der dysfunktionalen Krankheitswahrnehmung (Selbststigmatisierung des Patienten) und Verbesserung der Krankheitsbewältigung zum Ziel.Diese Form der Verhaltenstherapie basiert auf der Annahme, dass Symptome mit verzerrten Erklärungsmustern, Fehlattributionen und einem dysfunktionalen Selbst einhergehen (zu letzterem siehe auch [45]) . Die Intervention soll diese ungünstige Wahrnehmung bzw. Entwicklung korrigieren und dabei eine Reduktion der psychopathologischen Symptome [27,42,43,44,39,14,34,13,17,32,6] aber auch eine Verbesserung im Umgang mit der Krankheit herbeiführen
[41,48,26,47] sowie die Selbststigmatisierung vermindern und den Selbstwert heben [18].Bechdolf et al. [9,10] fanden beim Vergleich der kognitiv- verhaltens-therapeutische Interventionen und Psychoedukation heraus, dass beide Interventionsformen zu klinisch relevanter Verbesserung führten. Im FollowUp wurde ersichtlich, dass Patienten die kognitiv- verhaltensthe-rapeutische Interventionen erhielten, signifikant weniger rehospitalisiert wurden, als Patienten die Psychoedukation bekamen.Eine Kombination von Psychoedukation mit Medikation, kognitiver Verhaltenstherapie und Beratung einer Bezugsperson erreichte eine klinisch relevante Reduktion der Rehospitalisierungen [12].Die diesen Therapien zugrunde liegenden Wirkmechanismen wurden bis dato nicht ausreichend erforscht. Fries et al. [16] untersuchten die Kombination von Psychoedukation und Bewältigungsorientierter Therapie (PKB) bei Patienten mit schizophrenen Störungen. Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass therapeutische Beziehung, Gruppenzusammengehörigkeit, Einstellung zur Gruppe und die Mitarbeit wichtige Indikatoren für den Effekt der Intervention darstellen .Während sich die meisten bisher durchgeführten Studien mit jeweils nur einer der beiden Interventionen Psychoedukation oder Verhaltenstherapie befassten, soll in der vorliegenden Studie untersucht werden, ob eine Kombination dieser beiden Therapieformen einen besseren Effekt erzielt. Weiters sollen Patienten mit Schizophrenie durch einen längeren Behandlungszeitraum zu einem langfristig verbesserten Umgang mit ihrer Krankheit und zu konstruktiver Krankheitsbewältigung befähigt werden [5,36].
Die vorliegende Studie erforscht untersucht eine größere Stichprobe als vorangegangene Studien, die sich mit PKB befassten [16,4].
Die folgenden Hypothesen bei schizophrenen und schizoaffektiven Patienten sollen genauer untersucht werden: 1. Bewältigungsorientierte Therapie
(PKB) reduziert die Psychopathologie der Patienten (Positiv und Negativsymptomatik) und verbessert das allgemeine Funktionsniveau.
2. PKB reduziert die Rehospitalisierungsrate der Patienten auf psychiatrischen Stationen.
3. PKB verbessert das Wissen der Patienten über die Krankheit und die Behandlung davon
4. PKB verändert Bewältigungsstra te gien (Attribution, Krankheits konzept und Krankheits verarbeitung) der Patienten positiv.
5. PKB verbessert die soziale Situation der Patientengruppe (Wohnsituation, Beschäftigung und Beziehungen).
Alle Hypothesen sollten sowohl im Zeitvergleich innerhalb der Grup pe wie auch im Vergleich zur Kontrollgruppe geprüft werden.
2. Material und Methode
2.1. Untersuchungs-Design
Zwei Zentren nahmen an der Studie teil: die Universitären Psychiatrischen Dienste in Bern und die Universitätsklinik für Psychiatrie in Innsbruck. Vor Studienbeginn wurde die Einwilligung aller dafür zuständigen Ethikkomitees eingeholt. Die Untersuchung wurde als Längsschnittsstudie mit folgenden Messzeitpunkten konzipiert: t1 zu Beginn der Therapie, t2 am Ende der Therapie, t3 ein Jahr nach Therapieende. Die ursprüngliche Intention, die Patienten den Bedingungen zufällig zuzuteilen, konnte nur in Bern realisiert werden. In Innsbruck war dies aus praktischen Gründen nicht möglich, da zu viele Patienten sich weigerten, an einer Studie

Haller et al. 176
teilzunehmen, in der sie mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit der Kontrollgruppe zugeteilt würden. Deshalb mussten wir eine Alternativlösung finden und entschlossen uns die Kontrollgruppe aus einer ambulanten Institution zu rekrutieren.
2.2. Behandlungen
Die Patienten der Experimentalgruppe wurden mit dem “Therapiemanual zur Psychoedukation und Krankheitsbewältigung” (PKB) [5], bestehend aus 26 Sitzungen mit folgenden Inhalten, behandelt:• Einführung in die Gruppenthera
pie (Stressverarbeitung)• Informationsvermittlung des funk-
tionalen Krankheitskonzepts (biopsychosozialer Ansatz; Behandlungsmöglichkeiten; Rückfallvermeidung)
• Bewältigung von Stressoren (Iden-tifikation und Einordnen nach Belastungsgrad; Problemlösen und soziale Kompetenz)
• Gesundheitsverhalten (angenehme Situationen; Verbesserung der Genussfähigkeit und der Lebensqualität; Entspannungsverfahren)
Die Dauer des PKB betrug 46 Monate, mit ein bis zwei 90minütigen Sitzungen pro Woche.Zu Beginn des Projekts wurden für die Behandler (Ärzte und Psychologen) Interratertrainings abgehalten, um die Diagnose Kriterien für Schizophrenie und schizoaffektive Störungen sowie für die anhaltende Restsymptomatik zu adjustieren und somit eine möglichst hohe Interraterreliabilität zu erreichen.Die Patienten der Kontrollgruppe wurden in Bern mit supportiven Gesprächen und Problemlösen behandelt. Diese Therapieform, die bereits vor Studienbeginn auf der Station implementiert war, wurde von Mitgliedern des Pflegeteams durchgeführt.
In Innsbruck nahmen die Patienten der Kontrollgruppe an einer Arbeitsrehabilitation in einer Werkstätte teil, (Behandler u.a. Psychologen und Sozialarbeiter), in der schizophrene und schizoaffektive Patienten mehrere Monate mitarbeiteten und dort zweimal in der Woche an einer Gruppe teilnahmen, in der Allfälliges sowie die Befindlichkeit besprochen wurde. Alle Gruppen wurden offen geführt, so dass neue Patienten zu Beginn der einzelnen Therapiemodule aufgenommen werden konnten und damit den klinischen Notwendigkeiten Rechnung getragen wurde.
2.3. Stichprobenauswahl
Es wurden zunächst 132 PatientInnen mit den Diagnosen Schizophrenie bzw. schizoaffektive Störung in die Studie eingeschlossen (Experimentalgruppe 64, Kontrollgruppe 68). Sie wurden während des stationären Aufenthalts oder aus der Nachsorgeambulanz für Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis rekrutiert. Alle aufgenommenen PatientInnen erfüllten die folgenden Einschlusskriterien: (1) Diagnose einer schizophrenen oder schizoaffektiven Störung nach ICD10 (IDCL [22]); (2) aktueller BPRS- Score ≥20[31]; (3) ein oder mehrere stationäre Aufenthalte; (4) Remission der akuten Episode; (5) keine relevante Komorbidität (Substanzmissbrauch, geistige Zurückgebliebenheit, sensorische Schäden, organische Hirnstörung, ernste körperliche oder andere geistige Krankheit); (6) Alter zwischen 18 und 55 Jahren. Von den 132 eingeschlosse nen Pa tien ten konnten nur 82 (Experimentalgruppe 44, Kontroll gruppe 38) in der statistischen Auswertung berücksichtigt werden. Die übrigen 50 Patienten (37,9%) mussten aus folgenden Gründen ausgeschlossen werden: Nichterscheinen zum ersten oder zweiten Sitzungstermin, Abbruch der
Behandlung nach weniger als 5 Sitzungen, Ablehnung des Ausfüllens der Testbatterie, Suizid (in diesem Fall bestand kein erkennbarer Zusammenhang zur Intervention).
2.4. Erhobene Daten und Be-schreibung der Testbatterie
Die primären Beurteilungskriterien waren die Rehospitalisierungsrate, psychopathologische Symptomatik und Bewältigungsstrategien. Darüber hinaus wurden soziodemographische Variablen (Alter, Geschlecht, Schulbildung, etc.) sowie Informationen über die Krankheitsdauer und Medikation erfasst.
Im einzelnen wurden folgende Erhebungsinstrumente eingesetzt:• Brief Psychiatric Rating Scale
(BPRS, [31]) zur Erfassung von psychosetypischen Symptomen (Angst/Depression, Anergie, Denkstörung, Aktivierung, Feindseligkeit, Misstrauen); Interraterreliabilität für den Gesamtwert zwischen .87 und .97.
• Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS, [2] ) zur Erfassung der “Negativsymptomatik” wie Affektverflachung, Alogie oder Anhedonie, etc.; Interraterreliabilität .69 bis .93; internale Konsistenz .63 bis .84 [2]
• Global Assessment Scale (GAS, [15]) zur Einschätzung der allgemeinen psychischen Angepasstheit (“overall severity of psychiatric disturbance”) des Patienten. Interraterreliabilität: IntraClass Koeffizient von .61 bis .91.
• Modifizierter Fragebogen zur Erfassung des Wissenstandes über die Krankheit [7]. Die Autoren empfehlen das Einsetzten des Inventars zur Erfolgskontrolle für Informationsprogramme bei SchizophreniepatientInnen; Angaben zur Reliabilität und Validität liegen keine vor.
• Krankheitskonzeptskala (KK-Skala, [28], zur Erfassung der

Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnen 177
Meinungen und Erklärungen eines Menschen hinsichtlich Störungen seines Gesundheitszustandes. Interne Konsistenz .59 bis .88; Retestreliabilität .73 bis .80; ausreichende Validität.
• Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (FKVLIS, [30]): erfasst die Prozesse, um bestehende oder erwartete Belastungen in Zusammenhang mit Krankheit emotional, kognitiv oder aktional zu meistern. Reliabilität und Validität laut Testautor zufriedenstellend.
• Modifizierte Form des Social Interview Schedule (SIS, [20]), zur Einschätzung der Situation bezüglich der sozialen Rollen und Lebensbereiche einer Person, deren Zurechtkommen mit den daraus resultierenden Anforderungen sowie der subjektiven Lebenszufriedenheit. Interraterkorrelation der Originalfassung .15 bis 1.00; Retestreliabilität .64 bis .90.
2.5. Statistische Methoden
Die Subskalen der psychologischen Testinstrumente (FKV, KK) wurden
entsprechend der Richtlinien der Herausgeber berechnet. Um die Anzahl der Zielvariablen zu reduzieren, wurden die 12 Items der Social Intervention Schedule (SIS) zu 4 Subskalen zusammengefasst. Diese Zuordnung wurde mit Hilfe einer Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse mit VarimaxRotation; vier Faktoren mit Eigenwert >1, 63.7 % Varianzaufklärung) und unter Beachtung inhaltlicher Aspekte vorgenommen. Sie ergab die Subskalen Arbeitsfähigkeit einschließlich des Grades der Eigenständigkeit, Gestaltung von Sozialkontakten, Zufriedenheit mit der Arbeit und dem Grad der Eigenständigkeit sowie Zufriedenheit mit den Sozialkontakten.Die Vergleichbarkeit der beiden Behandlungsgruppen (PKB, Kontrollgruppe) hinsichtlich der Patientencharakteristika wurde je nach Variablentyp mit dem MannWhitney UTest bzw. dem ChiquadratTest untersucht, ebenso die Vergleichbarkeit der beiden Untergruppen der Kontrollgruppe.Die Auswertung der Zielvariablen im zeitlichen Verlauf erfolgte mittels Varianzanalyse mit Messwiederholungen. Für die Analyse von
Unterschieden zwischen den drei Behandlungsgruppen im Zeitverlauf wurde die Wechselwirkung zwischen Behandlung und Zeit herangezogen. Zeitliche Veränderungen innerhalb der Behandlungsgruppen wurden mittels Varianzanalyse (ANOVA) mit Messwiederholungen und anschließenden paarweisen tTests untersucht, wobei letztere nur dann durchgeführt wurden, wenn die ANOVA zu einem statistisch signifikanten Ergebnis geführt hatte. Alle statistischen Tests wurden auf einem Signifikanzniveau von α=0.05 durchgeführt.
3. Ergebnisse
PatientencharakteristikaTabelle 1 zeigt die wichtigsten soziodemografischen und klinischen Patientencharakteristika. Es fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Experimental und Kontrollgruppe hinsichtlich Alter, Geschlecht, Schulausbildung (in Jahren), Krankheitsdauer und Hospitalisierungstagen.
Tabelle 1: Patientencharakteristika
a Keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe
VariablenExperimentalgruppe
n = 44Kontrollgruppe
n = 38
Geschlecht männlich 77 % (34) 61 % (23)
weiblich 23 % (10) 39 % (15)
Alter MW ± SD 31.0 ± 7.3 33.1 ± 9.1
Schulbildung MW ± SD 10.2 ± 1.9 9.5 ± 1.2
Krankheitsdauer (Monate) MW ± SD 70.5 ± 68.1 98.5 ± 99.7
Hospitalisierungsdauer (Tage) MW ± SD 237 ± 383 247 ± 304
Diagnose Schizophrenie 88 % (39) 77 % (29)
Schizoaffektive Störung 12 % ( 5) 23 % ( 9)

Haller et al. 178
* p<
0,05
, **
p<0
,01
im V
ergl
eich
zu
t1 (V
ergl
eich
e in
nerh
alb
der G
rupp
en)
# p<
0,05
im V
ergl
eich
zu
t2 (V
ergl
eich
e in
nerh
alb
der G
rupp
en)
a Fe
hlen
de W
erte
wur
den
mitt
els d
er L
astO
bser
vatio
nC
arrie
dFo
rwar
d (L
OC
F) M
etho
de e
rset
zt. D
ies b
etra
f 9 P
atie
nten
in je
der d
er b
eide
n G
rupp
en.
b Ve
rgle
iche
zw
isch
en t2
und
t3 w
urde
n w
egge
lass
en, d
a de
r Effe
kt d
es F
akto
rs "
Zeit"
und
der
Wec
hsel
wirk
ung
"Gru
ppe"
x "
Zeit"
nie
stat
istis
che
Sign
ifika
nz e
rrei
chte
c
d.f.
= F
reih
eits
grad
e (d
egre
es o
f fre
edom
), w
obei
die
Zah
l vor
dem
Kom
ma
die
Zähl
erfr
eihe
itsgr
ade,
die
Zah
l nac
h de
m K
omm
a di
e N
enne
rfre
ihei
tsgr
ade
im F
Tes
t ang
ibt
d n
.s. b
edeu
tet h
ier i
mm
er: p
> 0
,1
Var
iabl
enM
essz
eitp
unkt
Exp
erim
enta
lgru
ppe
(n =
44)
Kon
trol
lgru
ppe
(n =
38)
Stat
isti
k (A
NO
VA
mit
Mes
swie
derh
olun
gen)
Mes
szei
tpun
kte
bF
akto
r "Z
eit"
Inte
rakt
ion
"Gru
ppe"
x "
Zei
t"
MW
± S
DM
W ±
SD
F
d
.f.c
pF
d
.f.c
p
BPR
Sal
le (
t1,t2
,t3)
26,2
2
,78
<0,
001
0,34
2
,78
n
.s.d
t1 B
asel
ine
36,6
± 8
,738
,1 ±
10,
5
t2 E
nde
der
Inte
rven
tion
29
,5 ±
7,2
**
31,8
±
9,4*
*t1
vs.
t249
,2
1,7
9 <
0,00
10,
55
1,7
9
n.s
.
t3 e
in J
ahr
nach
der
Inve
rven
tion a
29
,4 ±
8,3
**
32,6
± 1
2,6*
*t1
vs.
t330
,7
1,7
9 <
0,00
10,
52
1,7
9
n.s
.
SAN
Sal
le (
t1,t2
,t3)
17,5
2
,79
<0,
001
2,17
2
,79
n
.s.
t1 B
asel
ine
26,8
± 1
5,4
26,7
± 1
6,3
t2 E
nde
der
Inte
rven
tion
21
,2 ±
13,
9**
19
,5 ±
14,
2**
t1 v
s. t2
26,5
1
,80
<0,
001
0,71
1
,80
n
.s.
t3 e
in J
ahr
nach
der
Inve
rven
tion a
1
7,2
± 1
3,6*
*,# 2
1,4
± 1
8,8*
t1 v
s. t3
27,4
1
,80
<0,
001
1,40
1
,80
n
.s.
GA
Sal
le (
t1,t2
,t3)
17,7
2
,79
<0,
001
0,67
2
,79
n
.s.
t1 B
asel
ine
54,7
± 1
2,8
55,3
± 1
2,4
t2 E
nde
der
Inte
rven
tion
62
,7 ±
16,
6**
61
,9 ±
11,
9**
t1 v
s. t2
31,0
1
,80
<0,
001
0,29
1
,80
n
.s.
t3 E
in J
ahr
nach
der
Inte
rven
tion a
64
,8 ±
15,
9**
61
,8 ±
14,
0**
t1 v
s. t3
27,5
1
,80
<0,
001
1,30
1
,80
n
.s.
Tabe
lle 2
: B
PRS,
SA
NS
und
GA
S im
zei
tlich
en V
erla
uf

Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnen 179
Schweizer und österreichische Kon-troll gruppenDie zwei Kontrollgruppen (Innsbruck: N=15, Bern: N=23) zeigten in den meisten Patientencharakteristika keine signifikanten Unterschiede. Allerdings waren die Patienten der Innsbrucker Kontrollgruppe signifikant älter als diejenigen aus Bern (Mittelwert 36,6 vs. 30,8 Jahre, p=0,025) und hatten infolge dessen auch eine längere Krankheitsdauer (11,3 vs. 6,3 Jahre, p=0,014). Weiters hatten die Innsbrucker Patienten höhere Ausgangswerte im GAF (59,8 vs. 52,3, p=0,031). Im zeitlichen Verlauf fand sich für keine der untersuchten Zielvariablen eine signifikante Wechselwirkung zwischen Kontrollgruppe (Innsbruck vs. Bern) und Zeit. Daher erschien es gerechtfertigt, die beiden Kontrollgruppen für alle weiteren Analysen zusammenzufassen.
Psychopathologie und psychische Angepasstheit (Hypothese 1)In Tabelle 2 ist der Schweregrad der Erkrankung (BPRS, SANS) der beiden Gruppen (Experimental und Kontrollbedingung) im zeitlichen Verlauf dargestellt. Zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung t1 zeigten sich zwischen den Gruppen keine signifikanten Unterschiede. Nach der Intervention (t2) konnte in der Experimentalgruppe, aber auch in der Kontrollgruppe eine signifikante Verbesserung in der Psychopathologie (BPRS), eine signifikante Verringerung der Ne gativ-symptomatik (SANS) sowie eine signifikante Verbesserung im allgemeinen psychischen Angepasstheit (GAS) beobachtet werden, die auch noch ein Jahr nach der Intervention (t3) fortbestand. Vergleicht man die Verbesserungen zwischen beiden Gruppen, so finden sich keine signifikanten Unterschiede.
Rehospitalisierung (Hypothese 2)Bezüglich der Variable Rehospitalisierung zeigten die Teilnehmer der Experimentalgruppe im ersten Jahr Ta
belle
3:
Wis
sen
über
die
Kra
nkhe
it im
zei
tlich
en V
erla
uf
** p
<0,0
1 im
Ver
glei
ch z
u t1
(Ver
glei
ch in
nerh
alb
der G
rupp
e)
# p<
0,05
im
Ver
glei
ch z
u t2
(Ver
glei
ch in
nerh
alb
der G
rupp
e)a
Fehl
ende
Wer
te w
urde
n m
ittel
s der
Las
tObs
erva
tion
Car
ried
Forw
ard
(LO
CF)
Met
hode
ers
etzt
b
d.f.
= Fr
eihe
itsgr
ade
(deg
rees
of f
reed
om):
die
Zahl
vor
dem
Kom
ma
gibt
die
Zäh
lerf
reih
eits
grad
e, d
ie Z
ahl n
ach
dem
Kom
ma
die
Nen
nerf
rei h
eits
grad
e im
FT
est a
nc
n.s.
(nic
ht si
gnifi
kant
) bed
eute
t hie
r im
mer
: p >
0,1
Var
iabl
enM
essz
eitp
unkt
Exp
erim
enta
lgru
ppe
(n =
44)
Kon
trol
lgru
ppe
(n =
38)
Stat
isti
k (A
NO
VA
mit
Mes
swie
derh
olun
gen)
Mes
szei
tpun
kte
Fak
tor
“Zei
t”In
tera
ktio
n “G
rupp
e”x
“Zei
t”
MW
± S
DM
W ±
SD
F
d
.f.b
pF
d
.f.b
p
Wis
sen
alle
(t1
,t2,t3
)1,
97
2,79
n
.s.c
4,7
6
2,7
9
0,01
1
(Ges
amts
core
)t1
Bas
elin
e71
.5 ±
10.
4 68
.2 ±
10.
2t1
vs.
t23,
01
1,80
0,
087
5,0
4
1,8
0
0,02
8
t2 E
nde
der
Inte
rven
tion
74.
5 ±
12.
4**
67.6
± 1
1.0
t2 v
s. t3
0,44
1,8
0
n.s
.c 6
,31
1
,80
0,
014
t3 E
in J
ahr
nach
der
Inte
rven
tion a
73.1
± 1
3.4
69.
8 ±
10.
8#t1
vs.
t33,
88
1,80
0,
052
0,14
1
,80
n
.s.c

Haller et al. 180
nach der Psychoedukation signifikant bessere Ergebnisse als die Vergleichsgruppe (Rehospitalisierungsraten von 43,2 % gegenüber 65,8% ; p=0,048). Im zweiten Jahr nivellierte sich dieser Unterschied wieder. Die kumulierte Dauer der Rehospitalisierungen im ersten Jahr nach der Intervention betrug in der Experimentalgruppe bezogen auf alle Patienten 23,8 ± 65,5 Tage (Mittelwert ± Standardabweichung), bezogen auf rehospitalisierte Patienten 55,1 ± 65,1 Tage; in der Kontrollgruppe waren die entsprechenden Werte 28,7 ± 60,5 Tage bzw. 43,6 ± 70,5 Tage (rehospitalisierte Patienten). Dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant, und das gleiche galt auch für die Dauern der stationären Aufnahmen im zweiten Jahr. Wissen über Krankheit und Behand-lung (Hypothese 3)Tabelle 3 zeigt die Veränderung des Wissensstandes über die Krankheit im Zeitverlauf. Dieser nahm in der Experimentalgruppe vom Beginn der Intervention (t1) bis zum Ende der Intervention (t2) signifikant zu. Bis zum Zeitpunkt t3 nahm der Wissensstand allerdings wieder etwas ab (der Mittelwert war höher als zum Messzeitpunkt 1, jedoch ohne statistische Signifikanz). In der Kontrollgruppe nahm das Wissen erst zum Zeitpunkt t3 signifikant zu. Dieser Gruppenunterschied erreichte auch im direkten Vergleich der Gruppen statistische Signifikanz (signifikante Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit): zwischen den Zeitpunkten t1 und t2 war der Anstieg im Wissensscore in der Experimentalgruppe signifikant größer als in der Kontrollgruppe, zwischen den Zeitpunkten t2 und t3 war der Zuwachs an Wissen hingegen in der Kontrollgruppe signifikant größer als in der Experimentalgruppe.
Krankheitskonzept und Krankheits-verarbeitung: (Hypothese 4)Im subjektiven Krankheitskonzept (Skalen: „Arztvertrauen“, „Medikamentenvertrauen“, „Negativerwar
tung“, „eigene Schuldzuweisung“, „Zufallskontrolle“, „Anfälligkeit“ und „Idiosynkratische Annahmen“) der Gruppenteilnehmer ergaben sich über den Zeitraum der Untersuchung keine nennenswerten Änderungen. Auch fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Experimental und Kontrollgruppe.Was die Krankheitsverarbeitung anbelangt, ergaben sich in zwei Skalen jedoch signifikante Unterschiede: in der Experimentalgruppe nahmen die Werte der Skala der „depressiven Krankheitsverarbeitung“ und der Skala „Bagatellisieren und Wunschdenken“ von t1 bis t3 signifikant ab (p=0.016 bzw. p=0.030), in der Kontrollgruppe blieben sie nahezu unverändert. Im Fall der depressiven Verarbeitung erreichte auch die Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit (t1 vs. t3) statistische Signifikanz (p=0.030), bei „Bagatellisieren und Wunschdenken“ ergab sich nur eine Tendenz (p=0.080). Bei keiner der anderen Subskalen zeigten sich signifikante Gruppenunterschiede oder signifikante Veränderungen über die Zeit.
Soziale Rollen und Lebensbereiche: (Hypothese5)In beiden Gruppen stieg das Funktionsniveau im Bereich Arbeit/ Wohnen an (t1 vs. t2: p<0.001, t2 vs. t3: p<0.001, Varianzanalyse mit Messwiederholungen); dies betraf die Einzelbereiche Wohnen und Arbeit gleichermaßen (jeweils p<0.03 für t1 vs. t2 und p<0.001 für t2 vs. t3). Für die Subskala "soziales Funktionsniveau" (Kontakte, Freizeitaktivitäten) war insgesamt keine signifikante Veränderung über die Zeit feststellbar. Jedoch fand sich für einen Teilbereich, nämlich die Kontakte zu Freunden, ein signifikanter Anstieg im Zeitverlauf (t1 vs. t3, für beide Gruppen zusammen p=0.013). Bei keiner der genannten Variablen gab es signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
Hinsichtlich der Zufriedenheit mit den einzelnen Bereichen zeigen sich weder signifikante Veränderungen im Zeitverlauf noch signifikante Gruppenunterschiede.
4. Diskussion
In der vorliegenden Studie sollte ein Therapiemanual zur Psychoedukation und Krankheitsbewältigung (PKB) für Patienten mit schizophrenen Störungen auf seine Effektivität hin überprüft werden. Als Kontrollgruppe dienten eine supportive Gesprächsgruppe mit freier Wahl des Gesprächsthemas durch die Teilnehmer und eine Gruppe der Arbeitsrehabilitation. Der neue Aspekt der Studie bestand darin zu untersuchen, ob eine Kombination von Bewältigungsorientierter Therapie und Psychoedukation einen besseren Effekt als andere Interventionen erzielen kann. Weiters sollten Patienten mit Schizophrenie durch einen längeren Behandlungszeitraum als in früheren Studien zu einem verbesserten Umgang mit ihrer Krankheit und zu konstruktiver Krankheitsbewältigung befähigt werden.Tatsächlich ging die psychoedukative und therapeutisch angeleitete Intervention der Experimentalgruppe mit signifikanten Verbesserungen in einer Vielzahl der erhobenen Bereiche einher: im psychopathologischen Status (BPRS, SANS), in der generellen psychischen Angepasstheit (GAF), im Wissensstand über die Erkrankung und die Behandlung, in der Krankheitsverarbeitung sowie im Funktionsniveau in den Bereichen Arbeit und Wohnen. Ähnliche Effekte wurden jedoch auch in der Kontrollgruppe beobachtet. Nur für wenige Outcomevariablen konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen beobachtet werden.Die signifikante Verbesserung der Positiv und Negativsymptomatik sowie der signifikante Anstieg der psychischen Angepasstheit der Patienten

Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnen 181
in der Experimentalgruppe und in den Kontrollgruppen steht teilweise im Einklang mit den Ergebnissen der Literatur, während manche Studien zu abweichenden Ergebnissen kamen.So fanden auch Sensky et al. [39] in einer ähnlichen Studie sowohl in der Experimentalgruppe mit CTB als auch in der Kontrollgruppe mit supportiven Gesprächen einen Rückgang der Positiv und Negativsymptomatik sowie der depressiven Symptome im Verlauf der Therapie; jedoch zeigte sich anschließend eine weitere signifikante Verbesserung dieser Symptome beim FollowUp nach 9 Monaten in der Experimentalgruppe, nicht dagegen in der Kontrollgruppe. Tarrier et al. [42] beobachteten einen signifikanten Rückgang der Positivsymptome bei Patienten mit Schizophrenie nach CBT im Vergleich zu allgemeiner Beratung und Routinebehandlung. Jedoch wurden beim FollowUp [44] keine Unterschiede zwischen der CBTGruppe und der Kontrollgruppe mit allgemeiner Beratung festgestellt. Diese beiden Gruppen zeigten aber signifikant bessere Ergebnisse als die Gruppe mit Routinebehandlung.In der vorliegenden Studie scheint es nun, dass verschiedene psychosoziale Interventionen in der Behandlung von Schizophrenie zu einer Verbesserung des Krankheitsbildes beitragen können. Es ist möglich, dass die Patienten schon vom strukturierten Tagesablauf, der Gelegenheit, Menschen mit ähnlicher Problematik zu treffen und entgegengebrachter Aufmerksamkeit (diese 3 Komponenten gab es in jeder Gruppe) profitierten.Die Patienten der Experimentalgruppe wiesen im ersten Jahr signifikant weniger Rehospitalisierungen auf, wie auch Herz et al. [21] mit Psychoedukation und Rückfallsprophylaxe und Hornung et al. [24] mit einer Kombination von Psychoedukation, Problemlösung und Familienberatung in ihren Studien feststellten. In der vorliegenden Studie war die Reduktion der Rehospitalisierungen im zweiten Jahr nicht mehr zu beobachten,
wie auch bei Tarrier et al. [41]. Die Intervention hatte also anscheinend einen gewissen protektiven Charakter, der aber zeitlich begrenzt war. In der Experimentalgruppe stieg der Wissensstand über die Erkrankung direkt nach der Intervention signifikant an. Diese kurzfristige Steigerung wurde in der Kontrollgruppe nicht beobachtet. Auch Merinder et al. [29] kamen nach der psychoedukativen Intervention und Andres et al. [3] nach Anwendung des PKB zu diesem Ergebnis. Der „Wissensvorsprung“ in der vorliegenden Experimentalgruppe hielt sich allerdings nicht bis ein Jahr nach der Intervention. Hier müsste man vielleicht nach einiger Zeit noch mal ein Informationsprogramm zur Krankheit im Sinne von „booster sessions“ anbieten. Überraschenderweise nahm in der Kontrollgruppe das Wissen über die Krankheit zwischen Therapieende (t2) und Nachuntersuchung (t3) signifikant zu. Möglicherweise informierten sich einige der Teilnehmer dieser Gruppe aus eigener Motivation über die Krankheit. Es wäre auch möglich, dass die Vorgabe des Wissenstests sie dazu animiert hatte.Was das Krankheitskonzept anbelangt, schien die Informationsvermittlung keine deutliche Wirkung erzielen zu können. Auch Andres et al. [3] kamen zu diesem Ergebnis. Neben dem „objektiven“ Wissen scheint also in den Patienten weiterhin ein „persönliches“ Krankheitskonzept bestehen zu bleiben. Die Krankheitsverarbeitung war der einzige Parameter, in dem sich signifikante Unterschiede zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe zeigten, die bis zum Zeitpunkt t3 anhielten: Patienten der ersteren Gruppe verarbeiteten die Krankheit am Ende der Messungen signifikant weniger depressiv, gegensätzlich zu Andres et al. [3] , die hier keine Gruppenunterschiede zwischen PKB und Kontrollgruppe feststellten. Tendenziell neigten die Patienten der Experimentalgruppe in der vorliegenden Studie auch zu weniger Ba
gatellisierung und Wunschdenken als Patienten in der Kontrollgruppe. Was die sozialen Rollen und Lebensbereiche anbelangt, gab es ebenfalls in beiden Gruppen positive Effekte. So zeigten die Patienten nach Abschluss der Intervention und auch ein Jahr später signifikant mehr Autonomie in den Bereichen Wohnsituation und Arbeit (weg von vollbetreutem Wohnen und Arbeiten hin zu eigenständigerem), es wurden auch signifikant mehr Kontakte zu Freunden gepflegt. Diese Veränderungen stellte auch Andres et al. [3] fest. Vermutlich sind auch hier begleitende Faktoren wie soziale Kontakte und Zusammenkommen mit „Gleichgesinnten“, Zuwendung und Verstehen wirksam.Im Folgenden sollen die Limitationen der Studie erwähnt werden. Die beiden Kontrollgruppen boten keine idealen Vergleichsbedingungen, da sie einerseits ähnliche Themen beinhalteten wie die Experimentalgruppe (Schweizer Stichprobe), andererseits andere Settingbedingungen hatten als die Experimentalgruppe (Anwesenheit in den Werkstätten für mehr als sechs Monate in der österreichischen Kontrollgruppe). Somit waren die Kontrollgruppen auch untereinander recht verschieden.Andererseits wäre es nicht in unserem Sinne und auch ethisch nicht vertretbar gewesen, Patienten irgendeine Form der Behandlung vorzuenthalten, um ideale Kontrollbedingungen zu schaffen. Es ist ja ein sehr erfreuliches Zeichen, wenn Patienten, die in keinerlei Rehabilitationsprogramm eingebunden sind, schwer zu finden sind.Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Hinblick auf die erste Evaluation (Zeitpunkt t2) nur zwei der fünf eingangs formulierten Hypothesen (weniger Rehospitalisierungen bei PKB und verbesserter Wissenstand der Patienten über die Krankheit) belegt werden konnten und unter Berücksichtigung der Langzeitevaluation (t3) nur die Hypothese der verbesserten Krankheitsbewältigung mit

Haller et al. 182
Hilfe der Bewältigungsorientierten Therapie teilweise bestätigt werden konnte.Die Tatsache, dass vermutlich nur ein Teil der Patienten unserer Behandlungsgruppe, jedoch zugleich auch ein Teil der Patienten der Kontrollgruppe von der Intervention profitierte, legt es nahe, genauer zu untersuchen, welche Untergruppen von Schizophrenie Patienten von welcher Art der therapeutischen bzw. rehabilitativen Intervention im Sinne einer verbesserten Krankheitsbewältigung und einer Steigerung des Wohlbefindens profitieren können. Dies sollte in unseren Augen in Zukunft verstärkt in den Blickpunkt der (psycho)therapeutischen Schizophrenieforschung rücken.
Dank
Die Studie wurde in Österreich vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank finanziell unterstützt (Projektnr. 6559), in der Schweiz vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Projektnr. 3252651.97).Für die Textbearbeitung danken wir Frau Mag. Elisabeth Staudecker
Literatur
[1] American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. APA, Washington D.C. (1994).
[2] Andreason NC.: Scale for Assessment of Negative Symptoms. Iowa City: University of Iowa, College of Medicine, Department of Psychiatry, unveröffentlichtes Manuskript (1984).
[3] Andres K., Schindler F., Brenner HD., Garst F., Donzel G., Schaub A.: Bewältigungsorientierte Gruppentherapie für Patienten mit schizophrenen oder schizoaffektiven Störungen. Fortschritte der Neurologie und Psychiatrie 5, 22532 (1998).
[4] Andres K., Pfammatter M., Garst F., Teschner C., Brenner HD.: Effects of a copingoriented group therapy for schizophrenia and schizoaffective patients:
a pilot study. Acta Psychiatr Scand 101, 31822 ( 2000).
[5] Andres K., Pfammatter M., Brenner HD.: Therapiemanual zur Psychoedukation und Krankheitsbewältigung (PKB). In: Roder V., Zorn P., Andres KL., Pfammatter M., Brenner HD (Hrsg.): Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von schizophren Erkrankten. HuberVlg, Bern (2002).
[6] Andres K., Pfammatter M., Fries A., Brenner HD.: The significance of coping as a therapeutic variable for the outcome of psychological therapy in schizophrenia. Eur Psychoatry 18 (4), 14954 (2003).
[7] Bäuml J., Kissling W., Buttner P. et al.: Informationszentrierte Patienten und Angehörigengruppen zur ComplianceVerbesserung bei schizophrenen Psychosen. Erste Ergebnisse der Münchner PIPStudie. Vortrag gehalten am 4. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Verhaltensmedizin und Verhaltensmodifikation (25. - 27.3.1993b).
[8] Bäuml J., PitschelWalz G., Kissling W.: Psychoedukative Gruppen bei schizophrenen Psychosen für Patienten und Angehörige; Methodik und praktische Durchführung in Anlehnung an die Münchner PIPStudie Ergebnisse der Einjahreskatamnese mit Diskussion von möglichen Konsequenzen für die ambulante Langzeitbetreuung. In: Stark A. (Hg.) Verhaltenstherapeutische Ansätze im Umgang mit schizophren Erkrankten: Konzepte, Praxis, Perspektiven. DGVTVlg, Tübingen (1996).
[9] Bechdolf A., Knost B., Kuntermann C., Schiller S., Klosterkotter J., Hambrecht M., Pukrop R.: A randomized comparison of group cognitive behavioural therapy and group psychoeducation in patients with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 110 (1), 218 (2004) Erratum in: Acta Psychiatr Scand 110 (6), 483 (2004).
[10] Bechdolf A., Köhn D., Pukrop R., Klosterkötter J.: A randomized comparison of group cognitive behavioural therapy and group psychoeducation in acute patients with schizophrenia: outcome at 24 months. Acta Psychiatr Scand 112 (3),17379 (2005).
[11] Behrendt B.: Meine persönlichen Warnsignale: Ein Psychoedukatives Therapieprogramm zur Rezidivprophylaxe bei schizophrener und schizoaffektiver Erkrankung. Manual für Gruppenleiter. DGVTVerlag, Tübingen (2001).
[12] Buchkremer G., Klingberg S., Holle R., Schulze Monking H., Hornung WP.: Psychoeducational psychotherapy for schizophrenic patients and their key relatives or caregivers: results of a 2year followup. Acta Psychiatr Scand 96(6), 48391 (1997).
[13] Bustillo JR., Lauriello J., Horan WP., Keith SJ.: The psychosocial treatment of schizophrenia: an update. Am J Psychiatry 158, 16375 (2001).
[14] Drury V., Birchwood M., Cochrane R., Mac Millan F.: Cognitive therapy and recovery from acute psychosis: a controlled trial.I: impact on psychotic symptoms. Br J Psychiatry 169, 593601 (1996a).
[15] Endicott J., Spitzer RL., Fleiss JL., Cohen J.: The Global Assessment Scale: A procedure for measuring overall severity of psychiatric disturbances. Arch Gen Psychiatry 33, 76671 (1976).
[16] Fries A., Pfammatter M., Andres K., Brenner HD.: Wirksamkeit und Prozessmerkmale einer psychodedukativen und bewältigungsorienterten Gruppentherapie für schizophren und schizoaffektiv Erkrankte. Verhaltenstherapie 13, 23743 (2003).
[17] Gould RA., Mueser KT., Bolton E., Mays V., Goff D.: Cognitive therapy for psychosis in schizophrenia: An effect size analysis. Schizophrenia Research 48, 33542 (2001).
[18] Gumley A., Karatzias A., Power K., Reilly J., McNay L., O’Grady M.: Early intervention for relapse in schizophrenia: impact of cognitive behavioural therapy on negative beliefs about psychosis and selfesteem. Br J Clin Psychol 45, 24760 (2006).
[19] Hahlweg K., Dürr H., Müller U.: Familienbetreuung schizophrener Patienten. Ein verhaltenstherapeutischer Ansatz zur Rückfallprophylaxe: Konzepte, Behandlungsanleitung und Materialien. Beltz, Psychologie Verlags Union, Weinheim (1995).
[20] Hecht H., Faltermaier A., Wittchen H.U.: Social Interview Schedule (SIS). Roderer; Regensburg (1987).
[21] Herz MI., Lamberti JS., Mintz J. et al.: A program for relapse prevention in schizophrenia: A controlled study. Arch Gen Psychiatry 57(3),27783 (2000).
[22] Hiller H., Zaudig M., Mombour W.: IDCL: Internationale DiagnosenChecklisten für ICD10 und DSMIV. Huber, Bern, Göttingen, Toronto (1995).
[23] Hinterhuber H., Meise U., Hinterhuber EM.: Empowerment als Ziel sozialpsychiatrischer Bemühungen. Neuropsychiatrie 22(2), 127131 (2008).
[24] Hornung PP., Feldmann R., Schonauer K., Schäfer A., Schulze Mönking H., Klingberg S., Buchkremmer G.: Psychoedukativpsychotherapeutische Behandlung von schizophrenen Patienten und ihren Bezugspersonen. Nervenarzt 70, 44449 (1999).
[25] Kieserg A., Hornung WP.: Psychoedukatives Training für schizophrene Patienten: (PTS): Ein verhaltenstherapeutisches Behandlungsprogramm zur

Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnen 183
Rezidivprophylaxe. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. DGVT-Verlag, Tübingen (1996).
[26] Klingberg S., Wiedemann G., Buchkremer G.: Kognitive Verhaltenstherapie mit schizophrenen Patienten: Design und erste Ergebnisse einer randomisierten EffectivenessStudie. Z Klin Psychol Psychiatr Psychother 30(4), 25967 (2001).
[27] Kuipers E., Garetey P., Fowler D., et al.: LondonEast Anglia randomised controlled trial of cognitivebehavioural therapy for psychosis, I: effects of treatment phase. Br J Psychiatry 171, 31927 (1997).
[28] Linden M., Nather J., Wilns HU.: Zur Definition, Bedeutung und Messung der Krankheitskonzepte von Patienten: Die KrankheitskonzeptSkala (KKSkala) für Schizophrene Patienten. Fortschr Neurol Psychiat 56, 3543 (1988).
[29] Merinder LB., Viuff AG., Laugesen HD., Clemmensen K., Misfelt S., Espensen B.: Patient and relative education in community psychiatry: A randomized controlled trial regarding its effectiveness. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 34,28794 (1999).
[30] Muthny FA.: Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung. Hogrefe, Göttingen, Toronto, Zürich (1989).
[31] Overall JE., Gorham DR.: The Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). Psychol Reports 10, 799812 (1962).
[32] Pilling S., Bebbington P., Kuipers E.: Psychological treatments in schizophrenia: I. Metaanalysis of family intervention and cognitive behaviour therapy. Psychological Medicine 32, 76382 (2002).
[33] PitschelWalz G., Leucht S., Bäuml J., Kissling W., Engel RR.: The effect of family interventions on relapse and rehospitalization in schizophreniaa metaanalysis. Schizophrenia Bulletin 27, 7392 (2001).
[34] Rector NA., Beck AT.:Cognitive behavioral therapy for schizophrenia: An empirical review. J Nerv Ment Disease 189, 27887 (2001).
[35] Roick C., Schindler J., Angermeyer M.C., FrietzWieacker A., RiedelHeller S., Frühwald S.: Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? Neuropsychiatrie 22 (2), 100111 (2008).
[36] Schaub A., Andres K., Schindler F.: Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapien in der Schizophreniebehandlung. Psycho 22, 71321 (1996).
[37] SchmitzNiehues B., Erim Y.: Problemlösetraining für schizophrene Patienten: Ein bewältigungsorientiertes TherapieManual zur Rezidivprophylaxe. DGVTVerlag, Tübingen (2000).
[38] Schrank B., Amering M.: „Recovery“ in der Psychiatrie. Neuropsychiatrie 21(1), 4550 (2007).
[39] Sensky T., Turkington D., Kingdon D. et al.: A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for persistent symptoms in schizophrenia resistant to medication. Arch Gen Psychiatry 57, 16572 (2000).
[40] Steingrad S., Allen M., Schooler NR.: A study of the pharmacologic treatment of medicationcompliant schizophrenics who relapse. J Clin Psychiatry 55, 47072 (1994).
[41] Tarrier N., Beckett R., Harwood S., Baker A., Yusupoff L., Ugarteburu I.: A trial of two cognitivebehavioural methods of treating drugresistant residual psychotic symptoms in schizophrenia patients: I. Outcome. Br J Psychiatr, 162, 52432 (1993a).
[42] Tarrier N., Yusupoff L., Kinney C., et al.: Randomized controlled trial of intensive cognitive behaviour therapy for patients with chronic schizophrenia. Br Med J 317, 30307 (1998).
[43] Tarrier N., Wittkowski A., Kinney C., Mc Carthy E., Morris J., Humphreys L.: Durability of the effects of cognitivebehavioural therapy in the treatment of schizophrenia: 12month followup. Br J Psychiatry 174, 50004 (1999).
[44] Tarrier N., Lewis S., Haddok G.: Cognitive- behavioural therapy in first- episode and early schizophrenia, 18month followup. Br J Psychiatry 184, 23139 (2004).
[45] Toifl K. Kimmel B.,Mayring P., Mörth HM.: Psychose aus Sicht der Komplexitätsforschung – ein Modell zu Untersuchung der Selbstorganisation eines dysfunktionalen Selbst. Neuropsychiatrie 21(4), 275283 (2007).
[46] Wienberg G., SchünemannWurmthaler S., Sibum B.: Schizophrenie zum Thema machen: Psychoedukative Gruppenarbeit mit schizophren und schizoaffektiv erkrankten Menschen / PEGASUS. Manual und Materialien. PsychiatrieVlg, Bonn (1995).
[47] Wiersma D., Jenner JA., Willige van de G., Spakman M., Nienhuis J.: Cognitive behaviour therapy with coping training for persistent autitory hallucinations in schizophrenia: a naturalistic followup study of the durability of effects. Acta Psychiatr. Scand 103, 39399 (2001).
[48] Wykes T., Parr AM., Landau S.: Group treatment of auditory hallucinations: Exploratory study of effectiveness. Br J Psychiatr 175, 18085 (1999b).
Mag. Christina HallerAbteilung für Klinische PsychologieUniv.Klinik für Allgemeine Psychiatrie und SozialpsychiatrieDepartment für Psychiatrie und [email protected]

Schlüsselwörter:
Nahtoderlebnis – Suizidversuch –
Suizidrisikoeinschätzung
Key words:
near-death experience – suicide attempt
–suicide risk assessment
Sind Nahtoderlebnisse nach Suizid-versuchen bedeutsam für die wei-tere Suizidrisikoeinschätzung? Ein FallberichtWir berichten von einem 59jährigen Mann, der im Rahmen eines gescheiterten Suizids ein Nahtoderlebnis hatte und deshalb für sich einen weiteren Suizidversuch ausschloss. Die vereinzelt vorliegende Literatur weist darauf hin, dass Nahtoderlebnisse nach Suizidversuchen häufig vorkommen und trotz positiver Erlebnisqualität eher suizidpräventiv wirken dürften. Die mögliche Bedeutung für die Suizidrisikoeinschätzung wird diskutiert.
Are near-death experiences follo-wing attempted suicide important for suicide risk assessment? A case reportWe describe a 59year old patient who reported a neardeath experience following attempted suicide. The neardeath experience induced reduction of suicidality. Previous studies suggested a high prevalence of neardeath experiences following attempted suicide and that neardeath experiences may decrease rather than increase subsequent suicide risk. Implications for suicide risk assessment are discussed.
Einleitung
Die Einschätzung von Suizidalität ist Teil des psychiatrischen Alltags. Richtlinien dafür beinhalten das Erfassen von Risikofaktoren (Depressivität, Hoffnungslosigkeit, Impulsivität, bisheriges suizidales Verhalten usw.) und von protektiven Faktoren (z.B. soziale Unterstützung). Im folgenden Fallbericht weisen wir auf Nahtoderlebnisse als einen weiteren bisher kaum beachteten aber möglicherweise wichtigen Schutzfaktor für Suizidalität hin: Wir berichten über einen Patienten, der nach einem gescheiterten Suizid ein Nahtoderlebnis
hatte und aufgrund dieser Erfahrung weiteres suizidales Verhalten für sich ausschloss. Anschließend berichten wir von der bisherigen Forschung zum Thema und diskutieren die mögliche Bedeutung für die Suizidprävention.
Fallbericht
Der 59jährige Patient kam nach operativer und intensivmedizinischer Versorgung einer lebensgefährlichen Schussverletzung, die er sich in suizidaler Absicht zugefügt hatte, zur Aufnahme an den Sonderauftrag für Suizidprävention. Anamnestisch waren eine symptomatische Epilepsie nach Schädelhirntrauma und eine Alkoholabhängigkeit bekannt. Der Patient berichtete von in der letzten Zeit zunehmenden Streitigkeiten mit Verwandten und Bekannten. Auslösend für den schweren Suizidversuch, der aufgrund der gewählten letalen Methode und des fast tödlichen Ausgangs als gescheiterter Suizid bezeichnet werden kann, war eine Kränkung durch einen Bekannten. Nach ICD10 lag neben den anamnestisch bekannten Krankheitsbildern eine schwere depressive Episode vor.
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
Sind Nahtoderlebnisse nach Suizidversuchen bedeutsam für die weitere Suizidrisikoein-schätzung? – Ein Fallbericht
Karl Kralovec1, 2, Martin Plöderl1, 2, Ursula Aistleiner1, Clemens Fartacek2 und
Reinhold Fartacek1, 2
1 Sonderauftrag für Suizidprävention, Univ.-Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie I, Paracelsus Privatmedizinische Universität Salzburg2 Forschungsprojekt Suizidprävention, Institut für Public Health, Paracelsus Privatmedizinische Universität Salzburg
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 184–186 Fallbericht Case Report

Sind Nahtoderlebnisse nach Suizidversuchen bedeutsam für die weiteren Suizidrisikoeinschätzungen? 185
In den Gesprächen berichtete der Patient von einem Nahtoderlebnis infolge der schweren Verletzung: Er habe schönes Licht gesehen, eine farbige Blumenwiese und lachende Leute im Kreis um ihn herum. Es sei einfach ein gutes Gefühl gewesen, ein supergutes Gefühl. Dann sei es wieder schwarz geworden. Das sei ein Einstieg in eine andere Dimension gewesen. Es gebe keinen Zufall. Er sei gläubig, es gebe etwas, ein höheres Wesen. Er bete jetzt mehr. Gott habe ihm damit gesagt, er müsse noch etwas in Ord-nung bringen, er müsse noch etwas erledigen. Er dürfe sich daher nicht umbringen, er werde es auch sicher nicht mehr versuchen. Er sei jetzt überzeugter, dass es weitergehe nach dem Tod.
Der Patient wurde nach Besserung der Stimmungslage in einem stabilen psychischen Zustandsbild und von Suizidalität klar distanziert entlassen. Eine psychotherapeutische Weiterbehandlung lehnte er ab, es erfolgten aber im folgenden knappen halben Jahr monatliche Kontrollen bei der Autorin dieses Artikels. Nach etwa fünf Monaten wurde er – er berichtete wiederum über erlebte Kränkungen im Bekanntenkreis – für etwa vier Wochen aufgrund einer erneuten depressiven, jedoch nicht suizidalen Entwicklung stationär aufgenommen. Er konnte schließlich stimmungsmäßig gebessert wieder entlassen werden. Anschließend erfolgte weiterhin eine ambulante psychiatrische Betreuung einmal pro Monat, wobei bis acht Monate nach dem Suizidversuch keine Suizidgedanken mehr auftraten.
Diskussion
Nahtoderlebnisse sind Phänomene, die Elemente wie etwa mystische Erfahrungen, Depersonalisation, Dissoziation vom physischen Körper oder – wie auch im geschilderten Fall – stark positive Affekte umfas
sen können [5]. Sie werden mit einer erstaunlich großen Häufigkeit berichtet: In einer GallupUmfrage etwa berichteten ein Drittel derer, die im Rahmen einer Erkrankung oder einer Verletzung dem Tod sehr nahe kamen, von einem Nahtoderlebnis [2], in einer Umfrage unter ausschließlich psychiatrischen Patienten taten dies 22 Prozent [6]. Ähnlich hohe Werte (26 bzw. 47 %) fanden sich in zwei Studien bei Menschen nach einem schweren Suizidversuch [5,11].
Sucht man in der Medline nach Literatur, die sich mit einem möglichen suizidpräventiven Effekt von nach Suizidversuchen berichteten Nahtoderlebnissen beschäftigt, so finden sich nur wenige und schon einige Jahre zurückliegende Arbeiten: Ring & Franklin 1981/82 und Greyson 1981 wiesen darauf hin, dass Menschen, die nach einem Suizidversuch ein Nahtoderlebnis hatten, eher von einer verminderten Suizidalität berichteten [3,11]. Dieser protektive Effekt auf Suizidalität erscheint paradox, da ja ein Nahtoderlebnis in der Regel als sehr positiv und angenehm geschildert wird. Aus suizidpräventiver Sicht ist spannend, dass bekannterweise ein überlebter Suizidversuch als einer der prädiktivsten Suizidrisikofaktoren für die Zukunft gilt, ein Suizidversuch mit Nahtoderlebnis viel leicht aber ganz im Gegenteil einen Schutzfaktor darstellen könnte. Wenngleich nun auch in Österreich die Suizidforschung eine lange Tradition hat [1, 7, 8, 10, 12, 14], so wurde dennoch unseres Wissens in den letzten Jahren weder hierzulande noch international trotz obiger Daten weitere Forschungsarbeit zum Thema veröffentlicht. Auch die Erhebung von Nahtoderlebnissen nach einem Suizidversuch gehört nicht zur psychiatrischen Praxis. Daher denken wir, dass es wichtig sein könnte, auf dieses Thema erneut hinzuweisen. Sollte sich in prospektiven Arbeiten der mögliche suizidprotektive Effekt bestätigen, so wäre die Exploration von Nahtoderlebnissen nach Suizid
versuchen eine sinnvolle Ergänzung bei der Einschätzung der weiteren Suizidalität.
Als mögliche Ursache eines suizidprotektiven Effekts beschrieb Greyson, dass nach einem Nahtoderlebnis materielle und soziale Misserfolge nicht mehr die Wichtigkeit hätten wie zuvor [4]. Die Schilderung unseres Patienten hingegen betonte die Bedeutung des Faktors Religion: So berichtete unser Patient von einem höheren Wesen, von Gott, von einem Verbot, sich zu töten und davon, dass das Leben offenbar einen Sinn habe, da ja noch etwas erledigt werden müsse. Gerade in den letzten Jahren ist die Rolle von Religion in der Psychiatrie zunehmend Gegenstand wissenschaftlicher Publikationen geworden [13] und es fanden sich etwa auch Hinweise dafür, dass Religion bzw. Religiosität einen gewissen schützenden Effekt hinsichtlich Suizidalität haben [9]. Die eigentlichen Wirkmechanismen von Religion in diesem Zusammenhang sind aber bislang nicht ganz klar. Vielleicht könnten Arbeiten über die Ursachen eines möglichen suizidprotektiven Effekts von Nahtoderlebnissen auch diesbezüglich wichtige Erkenntnisse liefern.
Schlussfolgerung
Aufgrund der vereinzelt vorhandenen Literatur und angesichts des geschilderten Fallberichts, der inzwischen bereits einen achtmonatigen Nachsorgezeitraum umfasst, scheinen Nahtoderlebnsisse nach schweren Suizidversuchen einerseits häufig aufzutreten, andererseits stellen sie möglicherweise einen Schutzfaktor für weiteres suizidales Verhalten dar. Es wäre wichtig, in weiterführender und möglichst auch prospektiver Forschungsarbeit zu prüfen, ob Nahtoderlebnisse nach einem Suizidversuch tatsächlich suizidprotektiv wirken und dann diese

Kralovec et al. 186
Erkenntnisse ggf. in der klinischen Routine, sprich in der Einschätzung von Suizidalität, anzuwenden.
Literatur
[1] Aichhorn W., Fartacek R., ThunHohenstein L.: Erhöht die Therapie mit Antidepressiva das Suizidrisiko bei Kindern und Jugendlichen? Eine Stellungsnahme. Neuropsychiatr 22, 1622 (2008)
[2] Gallup G. Jr.: Adventures in immortality. A look beyond the threshold of death. McGrawHill, New York 1982
[3] Greyson B.: Neardeath experiences and attempted suicide. Suicid Life Threat Behav 11, 106 (1981)
[4] Greyson B.: Neardeath experiences and personal values. Am J Psychiatry 140, 61820 (1983).
[5] Greyson B.: Incidence of neardeath experiences following attempted suicide. Suicid Life Threat Behav 16, 405 (1986)
[6] Greyson B.: Neardeath experiences in a psychiatric outpatient clinic population. Psychiatr Serv 54, 164951(2003)
[7] Hausmann A., Rutz W., Meise U.: Frauen suchen Hilfe Männer sterben! Ist die Depression wirklich weiblich? Neuropsychiatr 22, 4348 (2008)
[8] Heinrich M., Berzlanovich A., Willinger U., Eisenwort B.: Zur Messung der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen. Neuropsychiatr 22, 252260 (2008)
[9] Kralovec K., Plöderl M., Yazdi K., Fartacek R.: Die Rolle von Religion und Religiosität in der Suizidologie. Psychiatrie & Psychotherapie 5/1, 1720 (2009)
[10] Niederkrotenthaler T., Herberth A., Sonnek G.: Der „WertherEffekt“: Mythos oder Realität? Neuropsychiatr 21, 284290 (2007)
[11] Ring K., Franklin S.: Do suicide survivors report neardeath experiences? Omega 12, 191208 (198182)
[12] Ritter K., Stompe T.: Die Akzeptanz von Suizidmotiven ein Schlüssel zu den Unterschieden nationaler Suizidraten? Neuropsychiatr 22, 172179 (2008)
13] Seyeringer M., Friedrich F., Stompe T., Frottier P., Schrank B., Frühwald S.: Die
„Gretchenfrage“ für die Psychiatrie Der Stellenwert von Religion und Spiritualität in der Behandlung psychisch Kranker. Neuropsychiatr 21, 239247 (2007)
[14] Yilmaz T.A., RiecherRössler A.: Suizidversuche in der ersten und zweiten Generation der ImigrantInnen aus der Türkei. Neuropsychiatr 22, 261267 (2008)
Dr. Karl KralovecSonderauftrag für Suizidprävention, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie I, Paracelsus Privatmedizinische Universität Salzburg, Christian Doppler Klinik [email protected]

Schlüsselwörter:Alzheimer – Azidose – Zelltod – β-Amyloid – vaskulär
Keywords:Alzheimers disease – acidosis – cell-death – β-amyloid – vascular
Spielt die Übersäuerung im Gehirn eine zentrale Rolle bei Alzheimer?Die Alzheimersche Erkrankung ist gekennzeichnet durch die bekannten βAmyloid Plaques, die Tau Pathologie, den Zelltod von cholinergen Nervenzellen, entzündliche Prozesse und cerebrovaskuläre Schäden. Die Gründe, warum es dazu kommt, sind bisher vollkommen unklar. Wir stellen die Hypothese auf, dass chronische lang andauerende milde Schäden der cerebrovaskulären Gehirnkapillaren zu einer Minderdurchblutung des Ge hirns, Übersäuerung und Neurodegeneration führen, die in weiterer Folge die Zelltodkaskade mit der ßAmyloid Fehlfunktion und der TauPathologie sowie Entzündungen einleiten. Vaskuläre Risikofaktoren, wie die Hyperhomozysteinämie oder die Hypercholesterolämie, könnten dabei eine Rolle spielen. Die Akkumulation von chronischen "leichten ischämischen Schäden" könnten die kognitiven Defekte bedingen, wie
man sie bei vaskulärer Demenz oder Alzheimer sieht. Diese Zusammenfassung versucht die verschiedenen Ereignisse zu verbinden, die bei Alzheimer auftreten, und setzt dabei die cerebrovaskuläre Hypothese in den Vordergrund.
Does acidosis in brain play a role in Alzheimers disease?Alzheimers disease is characterized by βamyloid plaques, tau pathology, cell death of cholinergic neurons, inflammatory processes and cerebrovascular damage. The reasons for the development of this chronic disease are not known yet. We hypothesize that chronic long lasting mild damage of the cerebrovascular brain capillaries cause hypoperfusion, acidosis and neurodegeneration, and induces a cell death cascade with βamyloid dysfunction and taupathology and inflammation. Vascular risk factors, such as hyperhomocysteinemia or hypercholesterolemia, may play a role in this process. The accumulation of chronic silent strokes may cause cognitive defects as seen in vascular dementia and Alzheimers disease. This summary tries to link the different events, which occur in Alzheimers disease, focusing on the cerebrovascular hypothesis.
Übersäuerung im Körper und Gehirn
Der menschliche Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser und die meisten chemischen Reaktionen des Organismus laufen darin ab. Diese lebensnotwendigen biochemischen Prozesse im Körper brauchen ein stabiles Milieu in und ausserhalb der Zellen. Der pHWert spielt hierbei eine essentielle Rolle. Definiert wird der pH (pondus hydrogenii) als „Maß für die Stärke der sauren bzw. basischen Wirkung einer wässrigen Lösung". Dabei hängt der pHWert vom Verhältnis der Protonen (H+) und Hydroxylionen (OH) in der Lösung, sowie vom Verhältnis der intra und extrazellulären Ionen (intrazellulär: K+, H+, HCO3
, Cl ; extrazellulär: Na+, Cl ) ab. Der arterielle pHWert liegt beispielsweise zwischen 7,38 und 7,42 und ist somit leicht basisch. Der intrazelluläre pHWert hingegen ist beinahe neutral und bewegt sich zwischen 7,0 und 7,3. Sinkt der pHWert unter den physiologischen Bereich, dann spricht man von einer Übersäuerung oder Azidose. Diese Azidose führt zu pathologischen Prozessen in der Zelle und es kann so zur Schädigung von Eiweißen kommen, und somit zum Verlust der Funktionalität von Zellen. Eine Azidose herrscht vor, wenn von Stoffwechselprodukten mehr Protonen abgegeben werden, als vom Körper gepuffert werden können. Dies geschieht z.B. dann, wenn das durch die Glycolyse gebildete CO2 nicht vollständig oxi
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
Spielt die Übersäuerung im Gehirn eine zentrale Rolle bei Alzheimer?
Michael Pirchl und Christian Humpel
Psychiatrisches Labor für Experimentelle Alzheimerforschung, Univ.-Klinik für
Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 187–192 Bericht Report

Pirchl, Humpel 188
diert wird und in Protonen (H+) und Hydrogencarbonationen (HCO3
) gespalten wird (Fig.1). Übersäuerungen im Körper werden in 2 große Klassen eingeteilt: die respiratorische Azidose, die durch unzureichende CO2 Abatmung geprägt ist, und die metabolische Azidose, die durch eine stoffwechselbedingte Verringerung des pHWertes gekennzeichnet ist. Die Ursachen von Azidosen sind manigfaltig, und umfassen Störungen der Lungenfunktion, Atembeschwerden, schwere Kreislaufstörungen, Stoffwechselstörungen, chronische Niereninsuffizienz oder hohe Elektrolytverluste. Auch eine unausgewogene Ernährung kann die Stabilität der Puffersysteme beeinflussen. Nahrungsmittel mit einem hohen Schwefel oder Phosphorgehalt reduzieren die basischen Puffer, wobei Produkte mit einem hohen Anteil an Elektrolyten die basischen Puffer steigern. Erstere sind vor allem tierische Produkte wie Fleisch, Eier, Fisch, Käse aber auch Alkohol. Im Gegensatz dazu stehen pflanzliche Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse und Kartoffeln (Quast, 2008).Es ist allgemein anerkannt, dass Azidose ein wichtiger Teilaspekt ischä mischer Hirnschädigungen ist (Siesjo, 1988). Azidose wird einerseits durch erhöhte CO2
Konzentrationen im Gewebe verursacht, oder durch eine Anhäufung von azidogenen Substanzen (z.B. Laktat oder Ketone) durch einen dysfunktionalen Metabolismus (Rehncrona, 1985). Schwere Hyperkapnie (arteriel les CO2 ~300 mm Hg) könnte eine Senkung des pHWertes bis auf ~6,6 bewirken ohne jegliche morphologische Anzeichen für eine irreversible Zellschädigung (Rehncrona, 1985). In schweren Fällen von Ischämie und GewebsHypoxie kommt es zu einer anaeroben Stoffwechsellage, die wiederum mit einer Anhäufung von Säuren wie beispielsweise Laktat (Milchsäure) verbunden ist. Diese Anhäufung von Säuren kann den pH auf Werte bis zu
6,0 reduzieren (Rehncrona, 1985), verbunden mit irreversiblen Schäden. Diese Schädigungen scheinen auf der Wirkung von freien Radikalen (oxidat iver Stress) zu beruhen (Li und Siesjo, 1997), die dann zum Zelltod von Nervenzellen führen. Erst kürzlich konnten wir zeigen, daß cholinerge Nervenzellen nach Azidose (pH < 6,6) innerhalb von 12 Tagen absterben (Pirchl et al., 2006) (Fig. 2C&D).
Regulation des pHWertes in der Zelle
Ionen spielen im Gehirn eine ganz besondere Rolle, so ist die gesamte axonale Reizleitung durch Natrium und Kaliumionen reguliert. Die Freisetzung von Neurotransmittern an der Synapse wiederum ist durch Calcium reguliert und eine Fehlregulation von Calcium ist eng mit dem Zelltod von Nervenzellen verbunden. Die Depolarisation einer Nervenzelle resultiert in einer leichten Senkung des intrazel
lulären pHWertes und Alkalisierung des Extrazellulärraumes. Um den pHWert in einem konstanten Bereich zu halten, verfügt der Körper über komplexe Puffer und Transportsysteme in den Zellen (Siesjö et al., 1985; �ue at al., 2003). Die Regulation des SäureBasenGleichgewichts im Gehirn ist daher von besonderer Bedeutung. Um die neuronale Funktionalität zu gewährleisten, sind unterschiedliche Transportsysteme in den Gehirnzellen erforderlich. Sowohl Nervenzellen als auch Astrozyten sind mit Transportern, Pumpen und Kanälen ausgestattet, die primär oder sekundär in die pHRegulation eingebunden sind. Der wichtigste und schnellste Mechanismus, um Protonen aus der Zelle zu bringen, ist der Na+/H+ Antiporter (Fig.1). Dieser Transporter ist relativ inaktiv bei neutralem pH, aber eine Reduktion des intrazellulären pH aktiviert den Na+/H+ Antiporter schnell und sekretiert H+ aus der Zelle. Alternativ können Protonen auch durch die ATPgetriebene Protonenpumpe in intrazellulären Organellen (Golgi, Vesikel, Lysosome) gespei
Figur 1: Regulation des pHWertes. Glucose wird zu CO2 abgebaut, welches normalerweise metabolisiert wird. Unter bestimmten Bedingungen (z.B. Laktat, Ketone, ...) wird das CO2 nicht oxidiert und in Protonen (H+) und Hydrogencarbonat (HCO3
) gespalten. Die Protonen können über den NatriumProtonen (Na+/H+) Antiporter aus der Zelle geschleust werden oder durch die ATPgetriebene Protonenpumpe in Organellen (Golgi, Vesikel, Lysosom) aufgenommen werden. Das Hydrogencarbonat kann durch den HCO3
/Chlorid Antiporter aus der Zelle geschleust werden. Eine Dysfunktion der Protonenregulation führt zu einem reduzierten pH.

Spielt die Übersäuerung im Gehirn eine zentrale Rolle bei Alzheimer? 189
chert werden (Fig.1). Die Aufnahme des Neurotransmitters in das Vesikel ist durch eine solche ATPgetriebene Protonenpumpe gesteuert, die das innere Mileu des Vesikels übersäuert. Einen längerfristigen Mechanismus stellt auch die Bindung von Protonen an die wichtigste körpereigene Pufferbase Hydrogencarbonat dar, wobei mehr als die Hälfte der Blutpufferung über dieses System ablaufen. Metabolisch gebildetes HCO3
wird über den HCO3
/Cl Antiporter ausgeschleust (Fig.1).
Laktat im Gehirn
Es ist bekannt, dass Nervenzellen sehr sensibel auf Veränderungen des pHWertes reagieren und eine Übersäuerung resultiert im Zelltod der Nervenzellen. Gerade ischämische Ereignisse sind eng mit der Übersäuerung der betroffenen Gehirngebiete assoziiert, resultierend aus einer massiven Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Zucker. Diese verringerte Sauerstoffzufuhr bedingt einen erhöhten anaeroben Stofwechsel, wobei Pyruvat durch die LaktatDehydrogenase (LDH) vermehrt zu Laktat abgebaut wird. Die damit verbundene Anhäufung des stark azidogenen Laktats senkt den pHWert. Deshalb kann die LDHKonzentration auch als ein Maß für die Gewebsschädigung bei Ischämie herangezogen werden. Die Rolle des Laktats im Gehirn ist jedoch zweideutig: Einerseits ist es ein Stoffwechselprodukt, welches den pH reduziert, andererseits ist es im neuronalen Metabolismus und Energiehaushalt involviert. Im Gehirn ist Laktat nach unterschiedlichen Formen von mildem Stress schon innerhalb von 67 min erhöht, und wird erst innerhalb von 40 min auf das Normalniveau reduziert (Fillenz, 2005). Es ist dabei unklar, ob Laktat unter physiologischen Bedingungen als Hauptenergielieferant für aktive Neuronen dient, wenn andere Energiequellen fehlen (Fillenz, 2005). Bei
epileptischen Anfällen ist die Laktatanhäufung eher mäßig (~10 µmol/g) (Siesjo, 1982), aber bei schweren Fällen von Ischämie oder Hypoxie hingegen kommt es zu enormen Anstiegen der Laktatkonzentration (3060 µmol/g), verbunden mit irreversiblen Schädigungen der Nervenzellen. Wir selber konnten zeigen, dass Laktat (bis zu 100 µM) in vitro keinen Zelltod von cholinergen Nervenzellen bewirkt (Pirchl et al. 2006), sondern eher protektiv wirkt (Pirchl et al., in Vorbereitung). Interessant ist auch, dass Laktat das zelluläre β Amyloid in hippocampalen Neuronen erhöht (Brewer, 1997).
Übersäuerung und Alzheimer
Bei der Alzheimerschen Erkrankung ist eine Fehlregulaton von AmyloidVorläufer Protein (APP) Spaltung und die Bildung von βAmyloid(142) eine der wichtigsten Hypo thesen (AmyloidKaskade). Das βAmyloid(142) verklumpt dabei stark und bildet die bekannten Plaques im Gehirn. Eine veränderte proteolytische Prozessierung von APP könnte neurotoxische Formen des βAmyloidPeptids hervorbringen, was eine Schlüsselrolle in der Auslösung neuronalen Zelltods sein könnte (Fig. 2A). Eine dermaßen gestörte Prozessierung von APP könnte eine erhöhte Produktion von toxischem βAmyloid(142) und dessen Oligomerisierung (Fig.2A) an den Synapsen nach sich ziehen, was der Auslöser der Alzheimerschen Erkrankung sein könnte (Wirths et al., 2004; Oddo et al., 2006).Die Prozessierung von βAmyloid wird dabei vom pHWert beeinflusst, was eine direkte Verbindung der Azidose zur Alzheimer Demenz aufzeigt. Wir haben kürzlich gezeigt (Marksteiner und Humpel, 2008), dass ein niedriger pH zum Zelltod führt, gefolgt von einer unkontrollierten Freisetzung von βAmyloid. Abhän
gig von der Konzentration, Zeitspanne, Temperatur, Ionenkonzentration und dem pH bildet βAmyloid dabei unlösliche FibrillenAnsammlungen (Atwood et al., 2003; Carrotta, 2005; Atwood et al., 1998; Matsunaga et al. 1994). Es wurde gezeigt, dass ein niedriger pH das ideale Milieu für eine Aggregation von βAmyloid ist
(Fig.2). Die Strukturänderungen sind vom pH und von Eisenionen abhängig (Atwood et al., 2003). Amyloid ist bei einem pH von 14 und >7 löslich, wenn es in seiner βhelikalen monomeren Form vorliegt. Die βFaltblattstruktur hingegen bildet sich bei einem pHWert zwischen 4 und 7 was zur Aggregation von βAmyloid führt (Atwood et al., 2003; Yip et al., 2005). Eine Reduktion des pHWertes führt auch zu einer Mobilisierung von Eisenionen (wie z.B. Zn2+ oder Cu2+), die im Kortex in hohen Konzentrationen vorliegen und die Aggregation und Umwandlung von βAmyloid in Fibrillen begünstigen (Atwood et al., 2003; Atwood et al., 1998; Tanzi und Bertram, 2005). Es wird angenommen, dass Histidin essentiell für die Eisenmediierte Aggregation von βAmyloid ist. Eine Cu2+induzierte Aggregation von βAmyloid tritt auf, wenn der pH bereits bis 6,8 erniedrigt ist. Das deutet darauf hin, dass durch eine H+induzierte Konformationsänderung des βAmyloids eine Eisenbindungsstelle freigelegt wird, die eine reversible Aggregation des Peptids ermöglicht (Atwood et al., 1998). βAmyloid (142) neigt mehr zur Fibrillenbildung und scheint gleichzeitig die toxi schere Form des Pep tids zu sein (Tanzi und Bertram, 2005). Die AminosäureSequenz 1522 des βAmyloid Pep tids könnte sowohl für die Aggregation bei Azidose, als auch für die proteolytische Aktivität bei physiologischem pH verantwortlich sein (Matsunaga et al. 1994). Kürzlich zeigten unsere Aggregationsexperimente mit dem Western Blot tatsächlich, dass das βAmyloid der Ratte kleine lösliche oligomere Aggregate bei einem

Pirchl, Humpel 190
pHWert von 6,0 bilden kann (Fig. 2B). Außerdem zeigen unsere immunhistochemischen Färbungen eine aggregierte Form extrazellulären βAmyloids nach Azidose, das dem Bild von postmortem Gehirnen von AlzheimerPatienten sehr nahe kommt (Humpel und Marksteiner, 2008) (Fig. 2EG),Die Bluthirnschranke spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des pHWertes, indem sie beispielsweise schädliche säurehaltige Stoffwechselprodukte oder exzitatorische Aminosäuren (wie das Glutamat) aus dem Gehirn abhält oder entfernt. Es ist nicht anzunehmen, dass Alzheimer durch einen Schlaganfall ausgelöst wird, andererseits können kleine ischämische Läsionen („silent strokes“), welche
für sich genommen keine kognitiven Veränderungen hervorrufen, dementielle Symptome einleiten bzw. verstärken (Humpel and Marksteiner, 2005). In der Tat, nach kardiovaskulären Erkrankungen sind cerebrovaskuläre und ischämische Hirnschädigungen die häufigste Ursache für Demenz und kognitiven Abbau bei älteren Menschen (Erkinjuntti et al., 2004). Es ist bekannt, dass ischämische Ereignisse das AmyloidVorläuferprotein, βAmyloid und Tau induzieren (Kalaria, 2000). Ungefähr 35% der Alzheimer Patienten zeigen, durch Autopsie gesicherte, vaskuläre Infarkte und 60% zeigen Läsionen der weißen Substanz. Die additiven Effekte von Schlaganfällen und AlzheimerPathologie könnten daher zu einem früheren Einsetzen der
Demenzerkrankung führen. Mehrere LängsschnittStudien berichten von einem Zusammenhang zwischen Schlaganfällen und kognitivem Abbau (Langa et al., 2004; Linden et al., 2004). Eine lange chronische Einwirkung von vaskulären Risikofaktoren kann die Bluthirnschranke und die Gehirn kapillaren schädigen. Zu diesen vaskulären Risikofaktoren zählen Hyperhomozysteinämie, Hyper cholestero lämie, Rauchen, Alkohol, hoher Blutdruck, u.a. (Humpel, 2008 und 2009). Durch die chronische Schä digung der Bluthirnschranke kann es zur Beschädigung der Neurovaskulären Einheit (NVE) und zur Unterversorgung anliegen den Gewebes kommen (Hypoperfusion). Unter dem Begriff der Neurovaskulären Einheit versteht man die enge funktionelle Verbindung zwischen Endothelzellen der Blutgefäße, AstrozytenEndfüßchen, welche diese völlig umgeben und NervenzellFortsätzen, welche dieses System innervieren (Iadecola, 2004). Die Schädigung von Gehirnkapillaren durch Azidose könnte indirekt auch cholinerge Nervenzellen des basalen Vorderhirns (Nucleus basalis von Meynert, mediales Septum und Diagonales Band von Broca) betreffen, da diese Axone synaptische Verbindungen mit den Astrozyten der BlutHirnSchranke eingehen (Hamel, 2004; Farkas und Luiten, 2001; Vaucher und Hamel 1995). Die Degeneration cholinerger Nervenzellen zählt zu den Hauptmerkmalen der Alzheimer Pathologie (Fig.3), und könnte somit durch Schäden der Neurovaskulären Einheit vermittelt sein, sodass es zum retrograden Zelltod cholinerger Nervenzellen kommt. Eine Unterversorgung der Nervenzellen mit Sauerstoff und essentiellen Energiesubstraten kann zum direkten Zelltod (Zelltodkaskade) und zu einer erhöhten Freisetzung des schädlichen βAmyloid(142) aus den nekrotischen Zellen führen. Wie schon erwähnt begünstigt eine
Figure 2: A: Die Spaltung von AmyloidVorläufer Protein (APP) führt zu einem löslichen βAmyloid(142) Peptid, welches unter bestimmten Bedingungen (Zink, Kupfer, Apolipoprotein E4, Azidose) oligomerisiert und aggregieren kann, was zum Zelltod führt. B: Unter sauren Bedigungen (*) kann das βAmyloid(142) aggregieren, wie im Western Blot gezeigt. C&D: Saure Bedingungen (D) führen sehr rasch, innerhalb von 12 Tagen, zum Zelltod von cholinergen Nervenzellen, im Vergleich zu neutralem pH (C). EG: Normalerweise bilden Gehirnzellen unter neutralem pH βAmyloid(142) (E), aber bei Azidose sterben diese Zellen und das βAmyloid wird unkontrolliert freigesetzt (F); bei der Zugabe von Apolipoprotein E4 aggregiert dieses freigesetzte βAmyloid (F) (genommen aus Marksteiner und Humpel, Molecular Psychiatry 2008; 13: 939952).

Spielt die Übersäuerung im Gehirn eine zentrale Rolle bei Alzheimer? 191
Unterversorgung des Gehirns eine Senkung des pHWertes, was zur Aggregation des freigesetzten extrazellulären βAmyloids führen kann (Atwood et al., 2003). Durch die Schä digung des cerebrovaskulären Systems kommt es dann auch zu einer Fehlregulation des Transportes von βAmyloid aus dem Gehirn und zur weiteren Anhäufung von toxischem βAmyloid(142). Apolipoprotein E dürfte dabei als Bindungsprotein von βAmyloid eine wichtige Rolle spielen. In der Tat ist das βAmyloid an Gehirngefäßen stark abgelagert (Angiopathie). Weitere Schritte dieser ZelltodKaskade könnten inflammatorische Prozesse (mikrogliale Aktivierung und Entzündung) und die Bildung neurofibrillärer Tangles (Tau Pathologie) beinhalten (Fig. 3).
Zusammenfassung
Die Regulation des pHWertes im Gehirn und im vaskulären System nimmt eine besonders wichtige Rolle ein. Azidose ab einem pHWert unter 6,6 könnte schwerwiegende Konsequenzen auf das überleben cholinerger Neuronen und cerebrovaskulärer Zellen haben. Es wäre möglich, dass die chronische Akkumulation von „silent strokes“ über Jahrzehnte und die damit verbundene transiente aber wiederholte Senkung des pHWertes schwerwiegende Folgewirkungen für das Gehirn haben. Dies könnte zur kognitiven Beeinträchtigungen oder einer vaskulärer Demenz und schlussendlich einer Alzheimerdemenz führen.
Literatur
Atwood CS, Moir RD, Huang �, Scarpa RC; Bacarra ME, Romano DM et al. Dramatic aggregation of Alzheimer Aβ by Cu(II) is induced by conditions representing physiological acidosis. J Biol Chem 1998; 273: 1281712826.
Atwood CS, Obrenovich ME, Liu T, Chan H, Perry G, Smith MA et al. Amyloidβ: a chameleon walking in two worlds: a review of the trophic and toxic properties of amyloidβ. Brain Res Rev 2003; 43: 116.
Brewer GJ. Effects of acidosis on the distribution of processing of the βamyloid prcursor protein in cultured hippocampal neurons. Mol Chem Neuropathol 1997; 31: 171186.
Carrotta R, Manno M, Bulone D, Martotrana V, San Biagio PL. Protofibril formation of amyloidprotein at low pH via a noncooperative elongation mechanism. J Biol Chem 2005; 280: 3000130008.
Erkinjuntti T, Roman G, Gauthier S et al. Emerging therapies for vascular dementia and vascular cognitive impairment. Stroke 2004; 35: 10101017.
Farkas E, Luiten PG. Cerebral microvascular pathology in aging and Alzheimer's disease. Prog Neurobiol 2001; 64: 575611.
Fillenz M. The role of lactate in brain metabolism. Neurochem Int 2005; 47: 413 417.
Hamel E. Cholinergic modulation of the cortical microvascular bed. Prog Brain Res 2004;145: 1718.
Humpel C. "Alzheimer´s disease – is it caused by cerebrovascular dysfunction?", Chapter 15, In: "Neurovascular Medicine: Pursuing Cellular Longevity for Healthy Aging", Kenneth Maise (Editor), Oxford University Press, 2008, 369402.
Humpel C. Cerebrovascular damage: a cause for Alzheimer´s disease. Chapter I. In: "IschemiaReperfusion Pathways in Alzheimer´s disease", Ryszard Pluta (Editor), Nova Science Publishers, p 116, 2007; ISBN: 1600217443.
Humpel C. and Marksteiner J.„Cerebrovascular damage as a cause for Alzheimer's disease?" Current Neurovascular Research 2 (2005) 341347.
Iadecola C. Neurovascular regulation in the normal brain and in Alzheimer's disease. Nat Rev Neurosci 2004; 5: 347360.
Kalaria RN. The role of cerebral ischemia in Alzheimer's disease. Neurobiol Aging 2000; 21: 321330.
Langa KM, Foster NL, Larson EB. Mixed dementia: Emerging concepts and therapeutic implications. JAMA 2004; 292: 29012908.
Figure 3: Hypothese der Alzheimer Pathologie. Durch chronische vaskuläre Risikofaktoren (Homozystein, Rauchen, Cholesterol, hoher Blutdruck ....) werden Gehirngefäße chronisch geschädigt. Diese Schädigung führt zu Schäden an der Neurovaskulären Einheit (NVE) und Bluhirnschranke (BHS). Die dadurch unterversorgten cholinergen Nervenzellen sterben durch retrograden Zelltod ab. Dieser Zelltod kann zur Aktivierung von Mikroglia und Freisetzung pro-inflammatorischer Zytokine kommen, einhergehend mit der typischen TauPathologie. Gleichzeitig wird das Gehirngewebe (vor allem der Kortex) schlecht versorgt, was zu einer Übersäuerung und Akkumulation von "silent strokes" führen dürfte. Durch diese Schädigung wird βAmyloid(142) (Aβ42) prozessiert und kann nicht mehr richtig aus dem Gehirn transportiert werden, es lagert sich an Blutgefäßen ab (Angiopathie), bzw. aggregiert unter bestimmten Bedingungen (Apolipoprotein E4 (ApoE4) und Übersäuerung) und bildet die typischen Plaques.

Pirchl, Humpel 192
Li PA, Siesjo BK. Role of hyperglycaemiarelated acidosis in ischemic brain damage. Acta Physiol Scand 1997; 161: 567580.
Linden T, Skoog I, Fagerberg B et al. Cognitive impairment and dementia 20 months after stroke. Neuroepdemiology 2004; 23: 4552.
Marksteiner J, Humpel C. Βetaamyloid expression, release and extracellular deposition in aged rat brain slices. Molecular Psychiatry 2008; 13: 939952
Matsunaga Y, Fujii A, Yokotani J, Takakura T, Yamada T. Eight residue amyloid β peptides inhibit the aggregation and enzymatic activity of amyloidβ42. Regul Peptides 1994; 120: 227236.
Oddo S, Caccamo A, Smith IF, Green KN, LaFerla FM. A dynamic relationship between intracellular and extracellular pools of βamyloid. Am j Pathol 2006; 168: 184194.
Pirchl M, Marksteiner J, Humpel C. Effects of acidosis on brain capillary endothelial cells and cholinergic neurons: relevance for vascular dementia and Alzheimer's disease. NeurolRes 2006; 28: 657664.
Quast S. SäureBasenHaushalt. http://www.qualimedic.de/saeure_basen_haushalt.html 2008.
Rehncrona S. Brain acidosis. Ann Emerg Med 1985; 14: 770776.
Siesjö BK. Lactic acidosis in the brain: Occurence, triggering mechanisms and pathophysiological importance. Ciba Found Symp 1982; 87: 77100.
Siesjö BK, von Hanwehr R, Nergelius G, Nevander G, Ingvar M. Extra and intracellular pH in the brain during seizures and in the recovery period following the arrest of seizure activity. J Cereb Blood Flow Metab 1985; 5: 4757.
Siesjö BK. Acidosis and ischemic brain damage. Neurochem Pathol 1988; 9: 3188.
Tanzi RE, Bertram L. Twenty years of the Alzheimer's disease amyloid hypothesis: a genetic perspective. Cell 2005; 120: 545555.
Vaucher E, Hamel E. Cholinergic basal forebrain neurons project to cortical microvessels in the rat: Electron microscopic study with anterogradely transported Phaseolus vulgaris leucoagglutinin and choline acetyltransferase immunocytochemistry. J Neurosci 1995; 15: 74277441
Wirths O, Multhaup G, Bayer TA. A modified βamyloid hypothesis: intraneuronal accumulation of βamyloid peptide the
first step of a fatal cascade. J Neurochem 2004; 91: 513520.
�ue J, Douglas M, Zhou D, Lim JY, Boron WF, Haddad GG. Expression of Na+/H+ and HCO3
dependent transporters in Na+/H+ exchanger Isoform 1 null mutant mouse brain. Neurosci 2003; 122: 3746.
Yip AG, McKee AC, Green RC, Wells J, Young H, Cupples LA et al. APOE, vascular pathology, and the AD brain. Neurology 2005; 65: 259265.
A.Univ. Prof. Mag. Dr. Christian HumpelPsychiatrisches Labor für Experimentelle Alzheimerforschung, Univ. Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Medizinische Universität Innsbruckchristian.humpel@imed.ac.at

Viel zu früh hat uns unser hochgeschätzter Kollege und Freund Michael Haberfellner am 6.8.2009 verlassen.Eine bösartige Erkrankung, die er mit erstaunlicher Geduld verarbeitet hat, war stärker und hat seinen irdischen Lebensweg im Alter von 52 Jahren vollendet.Michael hat in Linz die Khevenhüllerschule besucht und die Matura mit Auszeichnung bestanden. Er studierte in Innsbruck und absolvierte nach dem Turnus die Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Neurologie im damaligen WagnerJaureggKrankenhaus.Schon damals zeichnete er sich aus durch seine Umsicht, seine Wertschätzung gegenüber PatientInnen und KollegInnen, seinen Eifer und seiner gesamtheitlichen Sicht von Krankheiten.
Parallel absolvierte er eine Ausbildung in systemischer Psychotherapie und war an verschiedensten Bereichen der psychosozialen Versorgung tätig.So leitete er medizinisch den psychosozialen Not und Krisendienst der promente OÖ, war aktiv am Aufbau der mobilen Krisenversorgung in Linz tätig und war auch Beratungsarzt an den Linzer psychosozialen Diensten.
Er ließ sich dann in einer psychiatrischen Praxis nieder und schaffte es sehr schnell eine erfolgreiche, vorbildliche Praxis aufzubauen mit starken Verbindungen zu den verwandten Berufen.
Als einem der ganz wenigen gelang es ihm während der Praxistätigkeit sich wissenschaftlich zu betätigen und schlussendlich an der ParacelsusPrivatuniversität in Salzburg 2006 zu habilitieren.In dieser Zeit der Praxisführung wurde er zum Fachgruppenobmann der Fachgruppe für Psychiatrie und Neurologie der OÖ Ärztekammer bestellt und übte diese Funktion bis zuletzt aus.Als sich abzeichnete, dass die psychiatrischmedizinische Rehabilitation in OÖ konkrete Formen annehmen würde, bewarb er sich um die Stelle der Leitung dieser Piloteinrichtung in Bad Hall.
Als Primarius erfüllte er dort eine über OÖ hinaus sehr wichtige Aufgabe des Aufbaues, des Feldes der psychiatrischmedizinischen Rehabilitation und in der Kooperation mit den Sozialversicherungen insbesondere Pensionsversicherungen, die inhaltliche Definition und Strukturierung dieser Arbeit.
Er konnte den Neubau begleiten und durfte noch die Eröffnung dieses vorbildlichen Hauses erleben.
In der Österreichweit gegründeten Gesellschaft für Psychiatrische Rehabilitation wurde er einer der beiden Geschäftsführer.
Dr. Haberfellner war in verschiedenster Weise hoch aktiv, er war Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und im Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie war er im berufethischen Gremium in maßgeblicher Funktion.
Seine Arbeit dort wirkte immer äußerst glaubhaft, er war umsichtig, redlich und lebte diese Forderungen, die an andere gestellt wurden.
Die berufliche Haupttätigkeit in den letzten Jahren war jedoch die psychiatrische medizinische Rehabilitation im Rahmen der promente Organisation.
Wir erlebten ihn als äußerst präsenten und ganzheitlich denkenden Mediziner, der seinen Mitmenschen hohe Wertschätzung entgegenbrachte und selbst sehr viel Ansehen und Zuwendung erlangte.Darüber hinaus war er ein Familienmensch, sorgender Ehegatte und Vater und umgeben von einem sehr tragenden breiten Freundeskreis.
Wir werden Michael Haberfellner und seine Leistungen nicht vergessen und sind überzeugt, dass sein Werk weiterlebt. Wir sind dankbar, dass er unter uns war.
© 2009DustriVerlag Dr. Karl FeistleISSN 09486259
In MemoriamPrivat Doz. Prim. Dr. Egon Michael Haberfellner
Werner Schöny
Wagner-Jauregg-Nervenklinik Linz
Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 3/2009, S. 193 In Memoriam In Memoriam