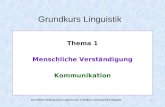Historische Linguistik I -...
Transcript of Historische Linguistik I -...
Historische Linguistik
Gerrit Kentner
26. Juni 2014
1 / 59
Klausur
Zeit: 10. Juli 2014 von 16-18 UhrRaum: HZ 6
4 Teilbereiche:
I Phonetik/Phonologie
I Morphologie
I Syntax
I Semantik/Pragmatik
(Fragen zu Psycholinguistik und histor. Linguistik werdenin die Teilbereiche integriert)
1 / 59
Klausur
Zu jedem Teilbereich gibt es 4 Fragen, von denen 3 bearbeitetwerden sollen. Fur jede korrekt geloste Aufgabe werden 10Punkte vergeben; bei unvollstandigen oder nur teilweiserichtigen Losungen werden entsprechend weniger Punktegegeben. Die hochste zu erreichende Punktzahl ist 120 Punkte.Die Klausur gilt als bestanden, wenn Sie 40 Punkte erreichen.
2 / 59
Lekture
Grundlage dieser Sitzung:
Moutons interaktive Einfuhrung in die Historische LinguistikGeschichte der deutschen Sprache
http://www.donhauser.mouton-content.com/
www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/uploads/media/Sprachwandel.pdf
3 / 59
Historische Linguistik
Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft befasst sich mitder Genealogie der Sprachfamilien (Ermittlung vonVerwandtschaftsbeziehungen auf Basis bestimmter sprachlicherMerkmale), den historischen Sprachstufen und derRekonstruktion der jeweiligen Protosprache.
Als Sprachfamilie wird eine Gruppe genetisch verwandterSprachen bezeichnet, d.h. Sprachen, die von einer gemeinsamenVorgangersprache (Proto- oder Ursprache) abstammen.
4 / 59
Historische Linguistik
Feststellung der Verwandtschaft - ein Beispiel
5 / 59
Historische Linguistik
6 / 59
Wie kommt es zu Sprachwandel?
I Sprachkontakt/ Mehrsprachigkeitz.B. Lehnvokabular mit bestimmten linguistischenEigenschaften, die z.T. ubertragen werden konnen
I Herausbildung von Normen, soziale Ambitionen, Prestigebestimmter Varietatenz.B. wegen-Konstruktion mit Gen. oder Dat.
I Sprachentwicklung des Kindesz.B. Grammatikalisierung in Kreolsprachen
I Abbau von Markiertheitz.B. Abbau von Kasusmorphologie
I Streben nach Systemkonformitatz.B. ge-wink-t > ge-wunk-en (analog zu sinken, trinken,singen, zwingen, klingen)
7 / 59
Wie kommt es zu Sprachwandel?
Die außeren Faktoren (Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit, Normund Prestige) haben einen großen Einfluss auf denSprachwandel.
Endogame Sprachgemeinschaften (z.B. Islandisch) entwickelnsich sehr langsam im Vergleich zu Sprachen mit starkemKontakt zu anderen Sprachen.
8 / 59
Historische Sprachstufen des Deutschen
I Althochdeutsch (750-1050)
I Mittelhochdeutsch (1050-1350)
I Fruhneuhochdeutsch (1350-1650)
I Neuhochdeutsch (1650-Gegenwart)
9 / 59
Dt. Sprachraum um 1000
10 / 59
Althochdeutsch
11 / 59
Althochdeutsch
Sankt Gallener Paternoster, spates 8. Jhd.
12 / 59
Dt. Sprachraum um 1400
13 / 59
Althochdeutsch vs. Mittelhochdeutsch
14 / 59
Mittelhochdeutsch
Konrad von Megenberg: Buch von den naturlichen dingenMitte 14. Jhd.
15 / 59
Mittelhochdeutsch
Konrad von Megenberg: Buch von den naturlichen dingenMitte 14. Jhd.
16 / 59
Mittelhochdeutsch
Konrad von Megenberg: Buch von den naturlichen dingenMitte 14. Jhd.
17 / 59
Mittelhochdeutsch
18 / 59
Mittelhochdeutsch vs. Fruhneuhochdeutsch
19 / 59
Dt. Sprachraum um 1900
20 / 59
Dt. Sprachraum um 2000
21 / 59
Phonologischer Wandel
Entwicklung der Nebensilbenvokale (1. Abschwachung)
Althochdeutsch - Mittelhochdeutsch
22 / 59
Phonologischer Wandel
Entwicklung der Nebensilbenvokale (2. Schwund)
Mittelhochdeutsch - Neuhochdeutsch
23 / 59
Phonologischer Wandel - Folgen fur dieFlexionsmorphologie
a-Deklination Ahd Mhd Nhd
Kasus sg. – pl. sg. – pl. sg. – pl.
Nom tag – taga tac–tage Tag–TageGen tages–tago tages–tage Tages–TageDat tage–tagum tage–tagen Tag(e)–TagenAkk tag–taga tac–tage Tag–Tage
i-Deklination Ahd Mhd Nhd
Kasus sg. – pl. sg. – pl. sg. – pl.
Nom kraft – krefti kraft–krefte Kraft–KrafteGen krefti–krefteo krefte–krefte Kraft–KrafteDat krefti–kreftim krefte–kreften Kraft–KraftenAkk kraft–krefti kraft-krefte Kraft–Krafte
I Reduzierung der Flexionsmorpheme – Kasuszusammenfall
24 / 59
Phonologischer Wandel - Folgen fur dieFlexionsmorphologie
Der phonologisch bedingte Schwund der Kasusmorphologieam Nomen hat auch syntaktische Folgen:
Ahd: tag-o (gen. pl.)
I Fusion von Kasus- und Numerusmorphologie am Nomen
Mhd: der (gen. pl.) Tag-e (pl.)
I Herausbildung des Artikels als isolierende Flexionsform
I Flexion am Nomen im Laufe der Entwicklungagglutinierend (nur noch Plural kodiert: “one form - onefunction”)
I Artikel ersetzt fusionierende Flexionsform am Nomen,flektiert selbst aber wieder fusionierend.
25 / 59
Phonologischer Wandel - Folgen fur dieFlexionsmorphologie
Analog dazu: der phonologisch bedingte Schwund derFlexionsmorphologie am Verb hat auch syntaktische Folgen:
Ahd.: nam-un (1. Pers. pl.)
I Fusion von Person- und Numerusmorphologie am Verb
Nhd.: wir (1. Pers. pl.) nahm-en (pl.)
I obligatorische Verwendung des Pronomens als isolierendeFlexionsform
I Flexion am Verb im Laufe der Entwicklung agglutinierend(nur noch Plural kodiert: “one form - one function”)
I Pronomen ersetzt fusionierende Flexionsform am Verb,flektiert selbst aber wieder fusionierend.
26 / 59
Lexikalischer Wandel
Das Lexikon unterliegt stetigem Wandel - Worter verschwindenaus dem Sprachgebrauch, andere kommen hinzu
27 / 59
Lexikalischer Wandel
I aussterbende/ausgestorbene WorterFug, Behuf, kommod, brasig, Karzer, siech, hold,Kartatsche, Drillich, furbass, versehrt, Fidibus ...
I (relativ) neue WorterComputer, Festplatte, Ozon, Anquatscherin, Kick, chillen,krass, Spam, Tesa
I (relativ) neue Wortbedeutungen, neue Konnotationfett, absturzen, Pirat, behindert, geil,...
28 / 59
Lexikalischer Wandel
Sprecher/Horer nutzen Bedeutungspotential sprachlicherAusdrucke kreativ, es entstehen neuartige Verwendungsweisen,die sich im Gebrauch durchsetzen.
I Entstehung neuer/ungebrauchlicher Verwendungsvarianten
I Auswahl aus den Verwendungsvarianten
I Verbreitung und Konventionalisierung
29 / 59
Lexikalischer Wandel
Kommunikative Verfahren, die zur Entstehung neuerVarianten fuhren
I MetapherBildhafter Ausdruck, der auf Ahnlichkeitsbeziehung beruht
I gegenstandlich: scharfes Messer - geistig: scharfes ArgumentI Maus - Nagetier / Steuergerat fur Computer; Ahnlichkeit
hinsichtlich der außeren FormI schildern - fruhere Bedeutung (“Schilder bemalen”) ist
verblasst.
I Metonymie
30 / 59
Lexikalischer Wandel
Kommunikative Verfahren, die zur Entstehung neuerVarianten fuhren
I Metapher
I MetonymieBeziehung der semantischen Kontiguitat (“Beruhrung”)
I Die Presse lief auf vollen Touren - “Gerat zum Drucken” →Er las die Presse jeden Morgen - “Produkt des Druckens”
I gemutliche und korperliche Anstrengung - “das Gemutbetreffend” → gemutliches Wohnzimmer - “angenehm,behaglich”
I Eine Tasse trinken - Gefass fur Inhalt
31 / 59
Lexikalischer Wandel
Ergebnisse des Bedeutungswandels
I Quantitative VeranderungI Erweiterung der BedeutungI Einschrankung der Bedeutung
I Qualitative VeranderungI BedeutungsverbesserungI Bedeutungsverschlechterung
32 / 59
Lexikalischer Wandel
Ergebnisse des Bedeutungswandels
I Quantitative VeranderungI Erweiterung der Bedeutung
schenken fruher nur i.S.v. “einschenken, zu trinken geben”;I Einschrankung der Bedeutung
List fruher nur i.S.v. “gelehrte Kenntnis, schlauer Betrug”
33 / 59
Bedeutungswandel
Qualitiativer Bedeutungswandel
I Meliorisierung
ahd. marahscalk - “Pferdeknecht”
ndh. Marschall - hoher milit. Rang
ahd. arabeit - “Muhsal”
ndh. Arbeit
I Pejorisierung
ahd. thiorna - “Madchen”
mhd. dierne - “Dienerin”
ndh. Dirne
ahd. stinkan - “riechen, duften”
34 / 59
Lexikalischer Wandel durch Wortbildung
Epochenubergreifende Haupttendenzen hinsichtlich derWortbildung
I Tendenz zur Univerbierung.Beispiel: Aus vorangestelltem Genitivattribut wird Stamminnerhalb eines Kompositums[ [ des Tages] Licht ] → Tageslicht[ [ der Geburt] Tag ] → Geburtstagt
I Wortbildung durch Derivation ist ursprunglich aufKomposition zuruckzufuhren. Aus Kompositionsgliedernwerden Affixe → GrammatikalisierungWerk > -werk vgl. Automobilwerk vs. Raderwerk, Blattwerk-tum, -schaft, -heit waren in fruheren Sprachstufenselbstandige Morpheme
35 / 59
Lexikalischer Wandel durch Wortbildung
Epochenubergreifende Haupttendenzen hinsichtlich derWortbildung
I Integration von Fremdaffixen ins morphologische System,Verdrangung1. Entlehnung: lat. molin-arius → mulin-ari “Muller”2. Bildungsmuster: ahd. satul “Sattel” → satul-ari“Sattler”3. Standardisierung/Verdrangung ahd. scepf-o“Schopfer” wird ersetzt durch scepf-ari
I Ein Ergebnis dieser teils widerspruchlichen Tendenzen istdie Trennung von Flexions- und Derivationsmorphologieund eine deutliche Unterscheidung des syntaktischen Status(Unterscheidung von Wortarten) mittelsWortbildungsmorphemen.
36 / 59
Historische Linguistik
Was bisher geschah:
I Allgemeines zur historischen Linguistik
I Periodisierung des Deutschen (Alt-, Mittel-, Fruhneu-,Neuhochdeutsch)
I Beispiel fur phonologischen Wandel und...
I ... die Folgen fur die Flexionsmorphologie
I lexikalischer/ semantischer Wandel
I weiter gehts mit:
I Beispiele fur syntaktischen Wandel
I Warum uberhaupt Sprachwandel
I aktuelle Wandelphanomene (“Zweifelsfalllinguistik”)
37 / 59
Syntaktischer Wandel
Nebensilbenabschwachung im Deutschen fuhrt zum Verlust derFlexionsmorphologie.→ Schwachung der distinktiven Kraft derSubstantivmorphologie→ kompensatorische Herausbildung des Artikelsystems
38 / 59
Herausbildung des Artikelsystems
ahd N tho antuurtita Iohannes init quadda antwortete Johannes und sprach
N ouh sunna ni biscinitauch (die) Sonne nicht scheint
Dem+NSprachun tho thie hirtasprachen da diese Hirten
nhd N Hans antworteteDet +NDer Hans antworteteDet+NDie Sonne scheint nichtDet+NDie Hirten reden miteinander
39 / 59
Genitivattribute
ahd Gen+N
a. rehtnissa gardadas Zepter der Gerechtigkeit
b. menniscon chintdie Kinder der Menschen
c. davides sunuDavids Sohn / Sohn Davids
mhd Gen+N / N+Gen
a. ein adames ritterlicher tugendeein Edelstein ritterlicher Tugend
b. mıner tohter tockedie Puppe meiner Tochter
c. zer kemenaten tr zur Tur der Kemenate
40 / 59
Genitivattribute
fnhd N+Gen
a. zehilff der kuniginzur Unterstutzung der Konigin
b. zuo der porten des tempelszur Pforte des Tempels
fnhd Gen+N
a. mit Herodis dienermit Herodes Dienern
b. der frawen Kunstdie Kunst der Frauen
41 / 59
Genitivattribute
nhd N+Gen
a. das Dach des Hausesb. das Auto der Schwesterc. der Sohn Ottosd. der Sohn des beruhmten Otto
nhd Gen+N (nur bei Eigennamen)
a. Ottos Sohnb. *des beruhmten Otto Sohn
42 / 59
Kasussyntax3 Tendenzen
I Verlust der adverbialen Funktion der Kasus
nur noch in Relikten erhalten: eines Tages, kurzerhand,jeden Tag, morgens
Ausbau der adverbialen PrapositionalkonstruktionenI Genitiv verliert die Funktion des Objektkasus
Ahd. und Mhd. verfugen uber Vielzahl von Verben, die einGenitivobjekt lizensieren thenken, niozan, geron (denken,genießen, begehren).
Ersatz durch Akkusativ (etw. begehren) oderPrapositionalobjekte (denken an)
Dem Genitiv bleibt die Funktion des AttributskasusI Abbau unpersonlicher Verben, Profilierung des Nominativ
als Subjektkasus
mih hungrit, mir droumit, mir bedriezit → ich hungere, ichtraume, –
43 / 59
Wie kommt es zu Sprachwandel?
I Sprachkontakt/ Mehrsprachigkeitz.B. Lehnvokabular mit bestimmten linguistischenEigenschaften, die z.T. ubertragen werden konnen
I Herausbildung von Normen, soziale Ambitionen, Prestigebestimmter Varietatenz.B. wegen-Konstruktion mit Gen. oder Dat.
I Sprachentwicklung des Kindesz.B. Grammatikalisierung in Kreolsprachen
I Abbau von Markiertheitz.B. Abbau von Kasusmorphologie
I Streben nach Systemkonformitatz.B. ge-wink-t > ge-wunk-en (analog zu sinken, trinken,singen, zwingen, klingen)
44 / 59
Wie kommt es zu Sprachwandel?
Die außeren Faktoren (Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit) habeneinen großen Einfluss auf den Sprachwandel.
Endogame Sprachgemeinschaften (z.B. Islandisch, Japanisch)entwickeln sich sehr langsam im Vergleich zu Sprachen mitstarkem Kontakt zu anderen Sprachen (Deutsch, Englisch).
45 / 59
Wie kommt es zu Sprachwandel?
Bei einer Herrschaft in Schaffhausenfindet eine gut empfohleneKammerjungferdauernde Stelle.Offerten beliebe man mit Zeugnisabschriftenund Photographie unterChiffre xxx einzusenden anRudolf Mosse, Schaffhausen.
46 / 59
Wie kommt es zu Sprachwandel?
Warum ist eine solche Anzeige heute nicht mehr denkbar?
I “Die Welt andert sich, die Sprache muss mit denVeranderungen Schritt halten.”
das kann allerdings keine hinreichende Begrundung furSprachwandel allgemein sein!
als Erklarung furphonologischen/morphologischen/syntaktischen Wandelsticht dies Argument wohl nicht.
47 / 59
Sprachwandeltheorie
Das Problem der “falschen Fragen” (Rudi Keller, Sprachwandel;zitiert nach F. Ladstaetter)
I Die Frage “Warum andert sich die Sprache?” prasupponiert“Die Sprache andert sich.”
Sprache als lebendiger Organismus? Wir wissen doch,dass es nicht die Sprache ist, die etwas tut, wenn sie sichverandert.
I Die Frage “Warum andern die SprecherInnen ihreSprache?”
klingt, als wurden die SprecherInnen ihre Sprachewillentlich andern. So, als ware die Sprache ein vonMenschen gemachtes Artefakt, das sie herzustellen undumzubauen imstande waren.
48 / 59
Sprachwandeltheorie
I Kellers These:Die permanente Veranderung unserer Sprache erzeugen wirdurch das tagliche millionenfache Benutzen unserer Sprache(cf. Keller 1994: 30). Diese Veranderungen beabsichtigenwir in der Regel nicht, und meist bemerken wir sie auch garnicht.
I “korrekte” Ausgangsfrage:
Wieso erzeugen wir durch unser tagliches Kommuniziereneinen Wandel?Welches sind die Mechanismen dieser standigenVeranderung?
49 / 59
Sprachwandeltheorie
Umweltphanomene
I naturliche Dinge (Naturphanomene)
I kunstliche Dinge (menschengemacht)
Wozu gehort Sprache?
I Phanomene der 3. Artlassen sich weder als Natur- noch als Kulturphanomenhinreichend beschreibenBeispiel: Autostau “aus dem Nichts”, Trampelpfad uberden Rasen.
I Sprache als Phanomen der 3. Art - ungeplantes kollektivesHandeln mit nicht-intendierten kausalen Konsequenzen
50 / 59
Sprachwandeltheorie
Menschliches Handeln:
I vernunftgeleitet (z.B. Planung einer Kanalisation)
I gefuhlgeleitet, instiktiv (z.B. Nahrungsaufnahme)
I regelgeleitet (Sprachgebrauch)System von Regeln, Konventionen
51 / 59
Sprachwandeltheorie
Beispiel eines “Invisible-hand-Prozesses”:Pejorisierung von Weib
I Galanteriegebot gegenuber Frauen
I Handlungsmaxime: “Greife bei der Anrede einer Fraulieber eine Etage zu hoch als eine zu niedrig.”
I nicht-intendierte kausale Folge:mit der Zeit wird tendenziell das ’nachsthohere’ Wort zumunmarkierten Normalausdruck, das ehedem normale wirdentsprechend pejorisiert.
52 / 59
Sprachwandeltheorie
Treiber des Sprachwandels sind nach KellerHandlungsmaximen:
I Rede so, dass Du die Ziele, die Du mit Deinerkommunikativen Unternehmung verfolgst, am ehestenerreichst.
I Rede verstandlich
I Rede amusant, witzig
I Rede wie die anderen (Anpassung)
I Rede so, dass Du beachtet wirst
I Rede so, dass es Dich nicht unnotige Anstrengung kostet
I Die Maximen konfligieren - das sorgt fur eine Instabilitatim Sprachsystem, die dem Wandel Vorschub leistet.
53 / 59
Aktueller Sprachwandel
aus Rudi Keller
54 / 59
Aktueller Sprachwandel
I Fugenelement
I Kausales vs. epistemisches “weil”
I neuer Determinierer son / sone
I ...
55 / 59
Seminar(s)arbeitHauptseminar(s)arbeit
56 / 59
kausales vs. epistemisches weil
(1) weil bei Schiller (i.S.v. wahrend):
Heirate, weil Du jung bist.
temporaler Ausdruck wurde zu kausalem Ausdruck umgedeutet.
57 / 59
kausales vs. epistemisches weil
(2) Ist Peter noch hier?
a. Nein, der ist schon weg, weil sein Auto steht nichtmehr auf dem Hof.
b. #Nein, der ist schon weg, weil sein Auto nicht mehrauf dem Hof steht.
I Der weil-Satz mit Hauptsatzsyntax antortet nicht auf dieFrage “Warum ist das so?” sondern
I auf die Frage “Woher weißt Du das?”
I ein weil-Satz mit Nebensatzsyntax ist fur die epistemischeLesart nicht geeignet.
58 / 59
son als indefiniter Demonstrativartikel?
der → dieserein → ??
(3) a. son Ding hab ich noch nie gesehen.b. mit soner Maschine geht das wunderbar.c. Ein son Ding hab ich eben noch gesehen - jetzt
ist es weg.d. ??Ein so ein Ding hab ich eben noch gesehen.
59 / 59