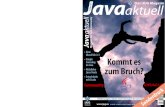III. Buchbesprechungen
-
Upload
hannes-mayer -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
Transcript of III. Buchbesprechungen

II. M I T T E I L U N G E N
Professor Konrad Rubner 80 Jahre
Am 9. M~irz feierte Univ.-Professor Dr. KONRAD RUUNER seinen 80. Geburtstag. Aus dem reichen Lebenswerk des Jubilars ist auf seine T~itigkeit als Privatdozent
an der Universit~it M~inchen und Leiter des Lehrreviers Grafrath, dann auf eine lang- jiihrige Lehrt~itigkeit also. Professor fiir Waldbau und Forstnutzung an der Forst- lichen Hochschule Tharandt hinzuweisen.
Durch seine vielseitigen wissenschafilichen Arbeiten, insbesondere sein bedeutendes Werk ,,Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaus", das bereits in 5. Auf- lage vorliegt, geh~Srt RUBNER ZU den bekanntesten Vertretern der Waldbauwissen- scha~ in Deutschland.
Professor RUBN~R war auch Mitarbeiter des Forstwissenschaflclichen Centralblattes. Eine ausfiihrliche Wtirdigung ist im Jahrgang 1961 dieser Zeitschrifi erschienen.
Dem riistigen Achtziger diirfen die besten Wtinsche Rir weitere Frische und Leistungsfiihigkeit ausgesprochen werden.
IUFRO-Kongre£ 1967 in Miinchen
Der Deutsche Verband Forstlicher Forschungsanstalten (President Professor Dr. Dr. h. c. K. MANTEL) gibt im Einvernehmen mit dem Pr~isidenten der IUFRO (Professor Dr. Dr. h . c . J . Sv~ER) bekannt, daf~ der n~ichste Kongret~ der IUFRO vom 4. bis 9. September 1967 in Miinchen stattfindet.
Im Zusammenhang mit dem Kongret~ werden Gebiets- und Fachexkursionen sowie gr6t~ere Exkursionen dutch das gesamte Bundesgebiet vorbereitet werden.
Das Kongret~-Sekretariat befindet sich in Miinchen 13, Amalienstrafle 52.
I I I . B U C H B E S P R E C H U N G E N
Pflanzensoziologie. Grundziige der Vegetationskunde. Von Prof. Dr. Dr. h . c . J . BRAuN-BLANQUET, Leiter der Station Internationale de G6obotanique M~diterra- n~enne et Alpine, Montpellier. 3, neubearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage; 865 S., 442 Textabb. und 86 Tab. Gzln. 170,- DM. Springer-Verlag Wien-New York 1964.
In den Nachkriegsjahren begann eine stiirmische Entwicklung der Vegetationskunde, die schon in der 1951 erschienenen 2. Auflage des Buches ihren Niederschlag land. Seitdem hat sich das Wirkungsfeld der angewandten Pflanzensoziol0gie in einem aui~ergew~hnlichen Maf~e erweitert. Fiir Land- und Forstwirtschafi, Kulturtechnik und Wasserbau und nicht zuletzt dutch die Vegetationskartierung ftir Wirtschatts- und Landesplanung ist die Pflanzensoziotogie

122 Buchbesprechungen
in dem umfassenden Sinne, wie sie BRA*m-BLANQt3ET auffaf~t, zu einem unentbehrlichen Hilfs- mittel der Grundlagenerhebung geworden. Diesen Aufschwung verdankt die Vegetations- kunde in erster Linie der Tatsache, daf~ sic nicht ausschlief~lich um ihrer selbst willen zu Be- schreibung und Gliederung der Pflanzengesellschaf~en betrieben wurde. Der gegenseitig frucht- bare Kontakt zu allen Nachbarwissenscha~en fiihrte zu einer ungeahnten Ausweitung und konsequenten Vertiefung des Faches, das schliefflich zu einer unentbehrlichen Teamdisziplin fiir mannigfache Bereiche wurde. Gerade durch ihre synoptische Betrachtungsweise hil~ die Vegetationskunde mit, bei manchen Problemen begriindete LSsungen zu entwickeln.
So ist es nicht verwunderlich, daf~ der Umfang des Buches erheblich, ja sogar bis zur technisch m/Sglichen Grenze zugenommen hat. Nach wie vo.r nehmen die grundlegenden Aus- ftihrungen iiber Geftige und Erfassung der Vegetatio.nseinheiten nur knapp ein Viertel des Umfanges ein. Das Hauptaugenmerk wird auf die syniSkologische Erfassung der Vegetation gelegt, auf die urs~ichliche Kl~irung der Pflanzenvergesdlscha~ungen. Dabei werden nicht nur die Standortsfaktoren im weitesten Sinne eingehend an vielen Beispielen behandelt, sondern auch den Wechselwirkungen zwischen Standort und Gesellschaf~ (z. B. Wcttbewerb) nachge- gangen. Durch die Mitarbeit fachkundiger Spezialisten entstand eine abgerundete Darstellung. Prof. R. BACH, ETH Ztirich, gelang in dem bodenkundlichen Abschnitt durch konzentrierte Beschr~inkung eine klare Darstellung der Wechselwirkungen zwischen Boden und Vegetation. Wertvo.ll fiir die angewandte forstliche Vegetationskunde (Standortserkundung) sind die zahlreichen Beispiele aus Waldgesells&aiten. Die Pro fessoren S'rocxER (Darmstadt) und LANaE (Harm. Miinden) arbeiteten an den Abs&nitten fiber Klimafaktoren und Gesells&ai~s- funktion mit. Klar gegliederte und mit vielseitigen Einzelheiten belegte Ausfiihrungen tiber Entwi&lung, Geschichte (noch unter Mitarbeit yon FIRBAS, G&tingen) und Verbreitung der Pflanzengesellscha~en bilden den Schlut~teil des Bu&es. Ober 1600 VerSffentli&ungen belegt die Literaturtibersicht. Ein Register der Armamen und Pflanzengesellscha~en sowie das Sach- verzeichnis erleichtern den Gebrauch des Handbuches.
Durch Beschr~inkung auf wesentli&e Probleme, knappe Formulierungen, tibersichtliche Gliederung wird der schier untibersehbare Stoff in einer Form geboten, die zu immer wieder- kehrender Information anregt. Diese 3. Auflage der Pflanzensoziologie stellt zweifellos die KrSnung eines auf~erordentlich fruchtbaren Lebenswerkes dar. Souver~iner lJberbli& und ab- gekl~irtes Urteil allein reichen nicht aus zur Erkllirung dieser aui~ergewiShnlichen Leistung, wenn man bedenkt, dai~ der Altmeister der Pflanzensoziologie im Juli 1964 zu Chur seinen 80. Geburtstag feiern konnte.
Fiir die forstliche Vegetations- und Standortskunde bedarf das Buch keiner besonderen Empfehlung mehr, denn daftir ist der Name BRAUN-BLANQUET l~ingst zu einem Begriff ge- worden. Dartiber hinaus kann das Buch ftir jeden Forstmann, der ftir die LebensgemeinschaR des Waldes besonderes Interesse hegt, vorbehaltlos empfohlen werden. Gewonnene Einsichten in die vielf~iltige biologisch-Skologische Verflochtenheit yon Pflanzengemeinschaflcen fiihren auch zu einem vertieften Verstiindnis der Waldbiochore. Gleichzeitig regt das Buch zu kri- tischer Betrachtung und Untersuchung an. Hoffentllch verhindert nicht der hohe Preis die dem gehaltvollen Werk gewtinschte weite Verbreitung auch im forstlichen Kreis. HANNES MAYER
i3kologische Untersuchungen in der subalpinen Stufe zum Zwecke der Hochlagen- aufforstung. Tell II . Gemeinschattsarbeit der Forschungsstdle fiir Lawinenvorbeu- gung Innsbruck. Leitung: Hof ra t Dipl .-Ing. Dr. R. HAMPEL. Mitt. der Forstl. Bundes- versnchsanst. Mariabrunn, 60. He~, 1963
Tell I der Gemeinschaftsarbeit unterrichtete tiber eine vielf~iltige standortskundliche Fak- torenanalyse in der subalpinen Stufe (siehe Forstw. Cbl. 1963, S. 315). Im abschliet~enden zweiten Tell wird zun~ichst das waldbauliche Verhalten der Zirbe als wichtigster Baumart ftir die Hochlagenaufforstung in einigen entscheidenden Punkten beleuchtet: Frostresistenz (I-~OLZER), S&neeschiitte-Krankheit (DoNAUBAUER), CO2-Assimilation (TRANQUILLINI), Stoff- produktion und Zuwachs (OswALI)). Nach den eingehenden Untersuchungen tiber Klima, Boden und Vegetation herrschen bei einer Aufforstung fiir die Zirbe auf der Freifliiche der- art ungtinstige Bedingungen, dab Starthilfen zur Verminderung der Extreme von entscheiden- der Bedeutung sind. Die Ergebnisse der unerllif~lichen Grundlagenforschung werden somit unmittelbar ftir die Praxis der Hochlagenaufforstung wirksam. Da Zirbe bei zu geringer Schneeh/She an windexponierten Standorten durch Frosttrocknis stark in Mitleidenscha~ ge- zogen wird und bei zu gro~er Schneeh~She der Nordischen Schtitte erIiegt, kommt wind- beeinflussenden Bauten zum Schneeausgleich eine wichtige Rolte zu. Sic erweitern nicht nur das Aufforstungsareal, sondern gew~ihrleisten au& die schnellere Entwi&lung der Auf- forstungen. Hierher sind auch Verbauungen windabh~ngiger Lawinen durch Stiitzwerke, Schneez~iune, Kolktafeln und Dtisen zu rechnen, wobei die Verwehungsbauten durch Freiland- versuche und Windkanalexperimente entwi&elt wurden (HovF, BERNARD, WOi'rNER, FUCHS). Nach bodenmikrobiologischen Erkennmissen (MosEs) ist fiir einen sicheren Aufforstungs-

Buchbesprechungen 123
erfolg auf den waldfreien 1Jdlandfl~ichen eine aktive F6rderung der Mykorrhizabildung durch fachgerechte Bodenimpfung unerl~ifllich.
Von besonderem Interesse fiir die praktische Hochlagenaufforstung ist das yon AmxTZ~Y entwickelte Wind-Schnee-ESkogramm, in dem schaubildartig die bisherigen Forschungsergeb- nisse der Station Obergurgl in ihrer gegenseitigen Verflochtenheit ~ibersi&tlich aufgezeigt wet- den. An dem Idealprofil eines Riickens mit Luvschattseite, windexponierter Kuppe und Lee- Sonnseite werden 11 Aufforstungseinheiten ausgeschieden, die nach der Bodenvegetation ab- gegrenzt werden. Ein erstes Diagramm zeigt den Vegetationstyp mit charakteristischen Test- pflanzen in Abhiingigkeit yon Relief und Bodentyp und Lokalklima. Schematisch stellt ein zweites Diagramm die Abh~ingigkeit des Pflanzenvorkommens yon der Windst~irke, den maximalen und minimalen Schneeh6hen und Bodenoberfliichentemperaturen dar. Daraus wer- den die natfirliche Verbreitung yon Zirbe, L~rche und die auftretenden Sch~den verst~indlich (3. Diagramm). Zwei weitere Diagramme behandeln die jeweiligen Aufforstungsmai]nahmen (Pflanzenwahl, Saatm/Sglichkeit, Pflanzzeitpunkt) und technische Mal~nahmen. zur Beein- flussung yon Wind und Schnee, die zum Gelingen der Aufforstung beitragen k6nnen. Durch diese eing~ingige Darstellung gelang eine zusammenfassende Beurteilung vieler Einzelergeb- nisse, wobei die klare Beschriinkung des Anwendungsbereiches (kontinentale Innenalpen, silikatische Grundgesteine, L~irchen-Zirbenwald, naturn~ihere Vegetationstypen) positiv her- vorgehoben werden muff. Eine gewisse Schematisierung ist zwangsl~iufig. Aber die praktische Durchfiihrung der Hoehlagenaufforstung, mit vielen materiellen und personellen Schwierig- keiten belastet, zwingt zu weiterer Vereinfachung. Diesem interessanten Versuch zur Dar- stellung eines wichtigen Teil-Faktorenkomplexes kann auch hinsichtlich seiner waldbaulichen Auswertung der Obergurgler Untersuchungen roll beigepflichtet werden.
Da Wind und Schnee nut zum Tell das Gelingen der Aufforstung primiir entscheiden, sollen erg~inzend ein Temperatur-Wasserhaushalts-, ein Humus- und ein bodenchemisches Ctkogramm erarbeiter werden. Die Wahl oder Kombination verschiedener iJkogramme ge- schieht durdl einen Dkogrammordner. Gegen eine derartige schematische Auswertung der Er- gebnisse, die auf ein einziges Untersudmngsobjekt zuriickgehen, m/Jssen Bedenken angemeldet werden. Der Forstmann in der Praxis und mehr noch der geschulte Waldarbeiter sind bei der Anwendung der ~kogramme und einer f3bertragung der an Idealobjekten dargestellten Er- gebnisse auf die mannigf~iltigere Wirklichkeit erheblich iiberfordert. Auf diese Weise l~iflt sich eine waldbauliche Gesamtanalyse mit dem erw[inschten Eftekt vielleicht ffir das Obergnrgler Untersuchungsgebiet, aber ohne gewissenhalte Priifung der I~bertragbarkeit nicht fiir ein Auf- forstungsobjekt selbst im eingeschr~inkten Anwendnngsbereidl gewinnen.
Da yon der Vegetation an Ort und Stelle alle Mat~nahmen abgeleitet werden, kommt bereits dem Pflanzentest entscheidende Bedeutung zu. Die Verwendung yon Einzelpflanzen mit zum Teil weiter/3kologischer Amplitude verleitet zu Fehlsd~liissen. Zumindest w~ire zur Erh/~hung der Sicherheit eine Verwendung yon Artengruppen, noch besser der Artengruppen- kombination erforderlich. Da die Testpflanzen nicht die gleiche Bedeutung in naturnahen Vegetationseinheiten und in anthropogenen Ersatzgesellschatten besitzen, besteht die Gefahr weiterer Fehldiagnosen. Unterschiedliche Auswirkungen des anthropogenen Einflusses erkennt selbst der Fachmann erst nach individuellem 6rtlichem Studium der Vegetation. Es handelt sich bei der Hochlagenaufforstung um so grot~e Summen und so lange Zeitriiume, dag man die mit erheblichem Aufwand gewonnenen wertvollen Untersuchungsergebnisse in der letzten Auswertungsphase nicht etwas inkonsequent aufs Spiel setzen diirf~e.
Unter Ber~i&si&tigung dieser Erw~igungen bietet sich - auch na& kausalanalytischer K15,rung noch oftener Zusammenh:,inge in den restli~en U kogrammen - ein anderer Weg zur lokalen waldbauli&en Gesamtanalyse an. In den Ho&lagenaufforstungsobjekten wird durch 6kologisch ges&ulte Fachleute im Benehrnen mit dem Betriebsleiter (waldbaute&nische M6g- lichkeiten) eine lokale Standortserkundung (Ausaperungskarte sowieso unerl,iglich) mit Vege- tationskartierung (Aufforstungseinheiten) zur Erfassung der lokalen Besonderheiten durcbge- fiihrt. Dabei leisten die an Idealprofilen entwi&elten Ukogramme wertvolle Hilfe. Durch kritischen Vergleich mit dem Obergurgler Untersuchungsgel~inde ergibt sich die weitere oder engere l[lbertragbarkeit der dort entwi&elten waldbauli&en Schluflfolgerungen. Fiir diese vegetationskundlich interpretierten (getrennt nach naturnahen und anthropogenen Ausbildun- gen) und 15kologisch charakterisierten Standortseinheiten ist die waldbauliche Gesamtbeurtei- lung incl. technischer Maflnahmen durchzufiihren.
Abschlieflend wird iiber praktische Erfahrungen bei der Hochlagenaufforstung des P r o - jektes ,Wildba&- und Lawinenvorbeugung Vorderes Zillertal" (STAuDER) beri&tet. Trotz erheblichen Aufwandes fiir die Intensivierung der Alpwirtschat~ (Koppelweidebetrieb, Giille- anlagen) und Forstwirtscha~ (Aufschliefung dutch Wege, Trennung yon Wald und Weide, Pflanzenanzucht, Aufforstungskontrolle, Aufforstung) machen sich diese Investitionen letzten Endes bezahlt.
In vorbildlicher Gemeinscha~ erarbeitete die Forschungsstelle far Lawinenvorbeugung unter der Leitung yon Hofrat Dr. R. HAMVEL vcertvolle Grundlagen fiir eine erfolgver-

124 Buchbesprechungen
sprechende Aufforstung subalpiner Hochlagen in den Zentralalpen. Hoffentlich kSnnen die noch offenen Fragen (bodenkundliche Probleme, Wasserhaushalt, Pflanzenern~ihrung) dur& Schaffung methodischer Voraussetzungen in ~ihnlich umfassender Weise angegangen werden. Die beiden gewichtigen Ninde belegen beispielhat~, dab nut dutch ein Teamwork wissenschaf~- li& ges&ulter Spezialisten in einer vielseitigen, welt ausholenden Grundlagenarbeit wi&tige Fragestellungen der Praxis beantwortet werden kSnnen.
Im Rahmen der Aufforstung landwirtschafldi&er Grenzertragsb/Sden spielt die Hoch- lagenaufforstung (z. B. Projekt Alpe Schlappold/Oberstdo,rf-Sonthofen) da und dort im bave- rischen Alpenbereich eine Rolle. Wenn auch die inneralpinen Ergebnisse nicht unmittell~ar iibertragbar sirtd, so regen doch ~ihnli&e Probleme zu verglei&enden Beobachtungen und Untersuchungert an. Allein die tiefen Einbli&e in den Lebenshaushalt des Bergwaldes re&t- fertigen schon eine weite Verbreitung der beiden B~inde iiber die unmittelbar betroffenen Forstverwaltungen im Gebirge hinaus. Die Untersuchungen sind nicht nur fiir Lehre und Forschurtg, sondern anch fiir die Praxis anregend, da hier ein iiberzeugender Versuch unter- nommert ist, yon exakt erhobenen Grundlagen ausgehend fiir eine Waldgesells&a~ (L~ir&en- Zirbenwalcl) begriindete waldbauliche Maf~nahmen zu entwi&eln. Dieser Einblick in so viel- f~iltige Probleme regt zur Uberpriifung und zum Ausbau der waldba.uli&en Analyse auch unter artderen Fragestellungen an. HANNES MAYrR
Allgemeine Viruspathologie der Pflanzen. Von E. K6Hrr~. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1964. 178 S., 86 Abb. Gzln. 48, - DM.
Als Berufener stellt der vormalige Direktor des Instituts fiir Iandwirtschat~li&e Virus- forschung der Biologischen Bundesanstalt den Stand der derzeitigen Virusforschung in einer allgemeinen pflanzli&en Viru~pathologie dar. Die vorliegende Neuauflage lehnt si& eng an die Bearbeitung dieses Teiles itn Handbu& der Pflanzenkrankheitert an. Sie ist abet neben wesentlichen neuen Erkennmi~sen mit iiber 40 zus~itzlichen Abbildungen urtd zahlreichen neuen oder erweiterten Tabellen bereichert.
Der Verfasser behandelt eingangs die Frage der anatomischen urtd physi0,1ogis&en Aus- wirkungen yon Virusinfektionen auf die Wirtspflanze. Dabei werden bereits wichtige Diagnose- merkmale beriihrt. Nach morphologischen Gesichtspunkten unterscheidet er drei Virus-Haupt- gruppert: die gestreckten (elongated) Viren, die kleinen Kugelviren, die polyeder~ihnliche KSrper meist Ikosaeder darstellen, und die grogen Kugelviren. Es ist eindeutig gekl~irt, dag fiir die Infektion und die Ausl/isung der Erkrankung das Virus in die lebende Zelle gelangen mug, um Symptome hervorzurufen, da es nut im Plasma vermehrungsf~ihig ist. Damit sind 5.1tere Angaben, dag unverletzte Pflanzenteile durch I~Iberbrausen mit virushaltigem Sat~ irt- fizierbar sind bzw. datg Infektionen dutch Einbringen yon Viren in Stomata des unverletzten Pflanzengewebes m6glich sind, widerlegt. Entspre&end der Wi&tigkeit der Ubertragungsart fiir die Identifizierrtng urtd das Studium yon Viruskrankheitert wird der Krankheitsiiber- tragung ein breiter Raum einger~.umt. Nebert der Ubertragung dutch Pfrop.fung, dur& Samen und Pollen erlang:t die mechanis&e Clbertragung und die dutch Vektoren, insbesondere dutch Arthropoden, groge Bedeutung. Zur Artabgrenzung und deren Unters&eidung werden fol- gende Merkmale herangezogen: Gestalt und GrStge yon Viruspartikeln, die serologis&e Re- aktion, der Pr~imurtit~,itstest, das Verhalten in vitro, der r3bertragungsmodus, der Wirts- pflanzenkreis und Zelleinschliisse. Fiir gut untersuchte Virusarten ist nachgewiesen, dal~ sie eine Vielzahl vort St~immen oder Varianten umfassen, die sich in bezug auf Symptombildung deutlich vo,neinander unterscheiden. So wurden beispielsweise fiir das TMV etwa 50 ver- schiedene Varianten na&gewiesen. Ein eigertes Kapitel ist den Mischinfektionen dur& ver- schiedene Virusartert, die an ein und derselben Pflanze auftreten k6nrten, gewidmet. Dabei wird der Begriff der Interferenz erl~iutert, wobei es si& um Erscheinungen handelt, die als Folge des ,,Zusammentreffens oder Beisammenseins yon Viren in der Pflanze zu beoba&ten sind, sei es, dag die Viren einander selbst hemmend oder f/Srdernd beeinflussen, sei es, dag als Folge der Begegnung die Symptombildung in besonderen Bahnen verl~iuflc, wozu auch Symptomunterdrii&ung und -verstS.rkung zu rechnen sind". Dabei ist es bedeutungsvoll, ob die Virusparmer miteinander nahe verwandt sind oder ni&t. An& bei Viren kann wie bei Pilzen yon einer Wirtswaht gesprochen werden, d. h. ein Virus vermag nut bestimmte Wirts- pflanzen zu infizieren. Entsprechend der Wirtsempfiingli&keit ist seine jeweilige Resistenz oder Anf~illigkeit abzuleiten. Mit Fragen iiber die Epidemiologie und Cikologie der Virosen unters&eidet der Verfasser abs&liegend zwei Wege der Virusausbreitung, n~imli& den der Ubertragung yon Pflanze zu Pflanze und den Transport vort irtfizierten Pflanzen und Pflan- zenteilen.
An jedes Hauptkapitel schliei~t si& ein umfangreiches Literaturverzei&nis an. Der in einer souverS.nen Zusammenschau und mit meisterhatter Darstellung gebotene
Uberbli& der allgemeinen pflanzli&en Viruspathologie 15.gt fiir eine Neuauflage nur wenige Wiirts&e often. So sollte beispielsweise der Frage einer mSglichen Virusinfektion bei Gymno-

Buchbesprechungen 125
spermen mehr Bedeutung beigemessen werden. Es sollte insbesondere geprfii°c werden, inwie- welt die besondere Struktur der Gymno.spermengef~it~e einen Virusbefall beeintr~ichtigt oder unmSglich macht. Aut~erdem ist es wiinschenswert, das grof~teils hervorragende Bildmaterial mit Gr6t~enangaben zu versehen. Das Buch ist in gleichem Maf~e fiir alle, die beruflich mit Viruskrankheiten und Fragen der Viruspathologie zu tun haben, wie fiir Studenten als Ein- fiihrung in die pflanzliche Virologie wertvoll. Seine Ausstattung ist gediegen und rechtfertigt den Anschaffungspreis. J. JusG, Mfinchen
Untersuchungen fiber den Einflufl der Wildz~iune auf die Waldbioz~Snose. Von G. EXCALD. 4 Abb. und 19 Tab. Schri~enr. Forstl. Abt. Univ. Freiburg, Bd. 2, 1965, 1-62. Ober die iSkologischen Voraussetzungen der Disposit ion yon Kiefernw;ildern ffir Insekten-Gro~sch~idlinge. Von W. LODGE. Bayer. Landw. Verl. Miinchen, Basel, Wien. 4 Abb. und 17 Tab. Schri~enr. Forstl. Abt. Univ. Freiburg, Bd. 2, 1965, 63-135. Gesamthe~ (135 S.). Brosch. 24,- DM.
Die Erkenntnis, dal~ rationelle Forstwirtscha~ auf der Grundlage einer Betrad~tung und Behandlung des Waldes als biozSnotische Einheit beruhen muff, bildet seit l~ingerem die Richt- schnur der Forstwirtscha~ und Forstwissenschaflcen. Jede Arbeit, die zur Erweiterung nnd Vertiefung dieser Grundlage beitr~igt, dient damit letzttich der ErhShung der Produktion. In diesem Sinne sind die beiden vorliegenden forstbiozSnologischen Arbeiten zu werten, die in den vergangenen Jahren im Forstzoologischen Institut der Universit~it Freiburg entstanden.
G. EWALD untersuchte die Frage, wie sich die Fernhaltung des Wildes dutch Z~unung auf die WaldbiozSnose auswirkt. Dabei gelangte er zu dem iiberraschenden Ergebnis, dat~ im Schutze des Zaunes slch zwar die Vegetation, nicht abet zugleich die Tierwelt anreicherte. Den Grund hierftir erblickt er - - zumindest zum Tell - - darin, dat~ sich um das ausgesperrte Wild zahlreiche Parasiten und Kotfresser sammelten und dat~ die Vegetation innerhalb des Zaunes aus verschiedenen Griinden (z. B. mechanischer Behinderung) fiir viele Tierarten kein Optimum darstellte. Die biozSnotische Bedeutung der Z~iunung sleht e rvor allem in der An- reicherung der Pflanzen und damit des humusbildenden Materials, also in einer Bodenver- besserung. Allerdings dfiri°ce die Tieranrelcherung aul%rhalb des Zaunes nut ffir die vom Verf. allein untersuchte oberirdische Tierwelt gelten. Eine Einbeziehung der subterranen Tiere h~itte ohne Zweifel deren (mit der Bodenverbesserung verbundene) Anreicherung deutlich gemacht und das faunistische Gesamtbild verschoben.
Von einem ganz anderen Standpunkt aus drang W. LODGE in das Geffige der Wald- bioz6nose ein, indem sie am Beispiel yon Kiefernbesfiinden der Schwetzinger Hardt nach Beziehungen zwischen Standortseigenscha~en und Schiidlingsauftreten suchte. Sie land hierbei, dat~ die Sch~idlingsdisposition des Standorts mit abnehmender Bodenfeuchtigkeit und ab- nehmendem Stickstoffgehalt des Bodens (gemessen am N-Gehalt der Nadeln) zunimmt. Faunistische Untersuchungen der Verfasserin ergaben unter anderem, dal~ in den sch~idlings- disponierten W~ildern der sogen, eiserne Bestand an Schadinsekten wesentlich hSher, die Dichte der anderen Insektenarten dagegen viel geringer war als in anderen W~ildern. Im Gegensatz zu einigen bisher bekannten Fiillen war jedoch die Paratisierung der tiberwintern- den Sch~idlingspuppen w~ihrend der Latenzperiode auf stark und schwach disponierten Stand- orten gleich hoch.
Alles in allem bilden die beiden Arbeiten eine wertvolle Bereicherung unserer Erkennt- nisse iiber die WaldbiozSnosen. Es erscheint wlinschenswert, dat~ derartige Themen mehr als bisher zum Gegenstand forstwissenschal°dicher Untersuchungen gemacht werden. W. SCHWENKE
Spuren tierischer T~itigkeit im Boden des Buchenwaldes. Von Dr. GERHARD ZACHA- RIAE. Forstwissenscha~liche Forschungen-BeihefLe zum Forstwissenscha~lichen Central- b l a t t - HeR 20, 1965.68 S., 20 Abb. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Kar t . 16,- DM, ftir Bezieher des Forstw. Cbl. 12,80 DM.
Untersuchungen tiber den Abbau der Waldstreu stof~en beim forstlichen Boden- und Standortskundler wie auch beim praktisch t~itigen Forstmann auf besonderes Interesse. Das ist verst~indlich, well die Fruchtbarkeit yon WaldbSden in hohem Ma£e yon der Art der Streuzersetzung und Humusbildung abh~ingt.
Einen auflerordentlich wertvollen Beitrag zu diesem Problemkreis legt Verf. vor, der Mitarbeiter der Bundesforschungsanstalt for Forst- und Holzwirtschai°c in Reinbek ist. In den Jahren 1957--1963 hat er in zahlreichen ~iIteren Buchenbest~inden Nord-und Sfiddeutschlands zu verschiedenen Jahreszeiten unmittelbar am Standort verfolgt, wie die Bodenfauna an der Zersetzung der Laubstreu und an der Strukturbildung ira humosen Oberboden mitwirkt. Er

126 Buchbesprechungen
hat diese Gel~indebeobachtungen durch Di.innschliff-Untersuchungen unterbaut und durch Ver- suche im Freiland und Labor ergS-nzt. Dabei kam es ihm in erster Linie darauf an, die morphologisch sichtbaren Leistungen der Fauna zu erfassen und die Spuren ihrer TS.tig- keit (Fraflbilder, Losungsformen, Spuren der Form-, Grab- und Wtihlarbeit) zu beschreiben. Er diskutiert die Schwierigkeiten, die si& bei der Interpretation dieser Spuren ergeben.
Die Fiille yon Einzelbeobachtungen, die yon verschiedenartigen Standorten mit einem breiten Spektrum morphologis&er Humusformen stammen, werden yon Verf. originell und tibersichtlich geotcdnet. Er entwickelt ein Waldboden-Mo,dell, bei dem er sich alle ftir die Streuverarbeitung wi&tigen Tiergruppen vertreten denkt. An diesem Beispiel beschreibt er elf &arakteristis&e, si&tbare tierische Leistungen. Fiir jeden ,,Arbeitsgang" gibt er an, welche Tiergruppen dafiir verantwortlich sind, welche Horizonte sie besiedeln und wel&e Spuren tie hinterlassen. Die Biologie dieser Tiergruppen wird insoweit gestreitt, als dies ftir das Ver- sfiindnis ihrer Leistungen und Spuren wichtig ist. Den spezifis&en Ablauf der Streuzersetzung am konkreten Standort betra&tet Verf. jeweils als Sonderfall jener vollstS.ndigen Reihe tierischer ArbeitsgS.nge im Modellboden. Hierbei fallen einzelne Tiergruppen und ihre Lei- stungen aus, andere treten dafiir in den Vordergrund. Deshalb sind far jeden Arbeitsgang die f6rdernden und hemmenden Standortsmerkmale kurz genannt.
Dieses Vor~ehen ermSglicht es Verf., die Bedeutung der einzelnen Tiergruppen ftir die Zersetzung der Buchenstreu und ftir die Humus- und Strukturbildung zu beurteilen. Dabei kommt er teilweise zu neuen Vorstellungen. Der chemische Abbau der Pflanzenreste obliegt weitgehend der Mikroflora. Die Bodenfauna beeinfluf~t die stofflichen Umwandlungen in- direkt dadurch, daft sie gtinstige Arbeitsbedingungen fiir die Mikroorganismen scha~. - - Na& den Beoba&tungen des Verf. ftihren auf den meisten BSden vor allem die Arthropoden und nicht die Regenwiirmer die me&anische Zerkleinerung der Streu dur&. Nur auf besonderen Standorten verarbeiten die groflen Regenwurmarten die Laubstreu vollst~indig, ohne daft eine Zerkleinerung vorangeht. - - Fiir die Kriimelung in schweren N5den sind die im Mineralboden tiitigen Enchytraeen wichtig, well sie den hier ziemlich dichten Regenwurmkot zerteilen. Die als Liiffungs- und Drainagesystem wirksamen R~Shren stammen dagegen haupts~ichlich yon den Regenwiirmern. - - Die grabenden und wiihlenden Tiere, darunter besonders auch die Laufk~ifer, tragen zur Lo&erung und Krtimelung bei. - - Collembolen, Nematoden und Ori- batiden kommen in den Humusauflagen zwar in grofler Zahl vor, leisten aber ftir die Zer- setzung und Huminifizierung nur wenig. - - Well eine bestimmte morphologische Humusform dur& das Zusammenwirken vers&iedenartiger und wechselnder Tiergruppen zustande kom- men kann, pl~idiert Verf. daftir, bei der Definition der Humusformen auf bodenzoologische Kriterien zu verzichten.
Die klar gegliederte, durch vorztigli&e Diinnschliff-Photos in Schwarzweig und s&ema- tis&e Skizzen gut illustrierte Arbeit vermittelt einen ausgezei&neten Uberbli& tiber die m/iglichen Leistungen der Bodenfauna in mitteleurop~iischen Buchenw~ildern. Die Schriff ist sehr anregend und wirft viele neue Fragen auf. So darf man z. B. gespannt sein auf die angektindigte Studie, in der Verf. die Ursa&en ftir die yon Standort zu Standort we&selnde Besiedlung mit humusbiologis& wichtigen Tiergruppen schS.rfer herausarbeiten und kl~iren will, yon wel&en stand/Srtli&en Faktoren das Auftreten oder Fehlen bestimmter tierischer Leistungen im Einzelfall abh~ingt. Diese Untersuchung wird ein weiterer wichtiger Schritt sein auf dem yon Verf. aufgezeigten Weg, bodenzoologische Erkennmisse fiir die Humus- wirtschaff im Wald nutzbar zu machen. REHFVESS
Wirtschattsstatistik. Methoden und Aussagen. Dargestellt am BeispM der amtlichen Statistik fiir Holzwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland von ROLF HESCH. Hamburg und Berlin 1963.
Mit der vorliegenden Arbeit wird eine neue forstliche Schriftenreihe begonnen, die yon O. ECKMOLLNER, Wien, H. TROMP, Ztirich, und C. WIEBECI~E, Reinbek, herausgegeben wird. Sie soll in einer Zeit, in der die Fortswirtschatt s6indig mit neuen Schwierigkeiten zu rechnen hat, eine Hilfe ftir Praxis und Wissenschaff sein und durch die Ver/Sffentlichung yon Er- fahrun,gen und Ergebnissen einem deutlich empfundenen Mangel abhelfen.
Der Verfasser will die Voraussetzungen rechdicher und organisatorischer Art herausstellen, die ftir die einzelnen Erhebungen bestehen, die statistische Methodik darlegen, ferner Aus- sagen tiber die Genauigkeit der Statistiken machen und schlief~lich VerbesserungsvorschlS.ge bringen.
Deshalb stellt er in den folgenden Kapiteln zun~ichst die Rechtsgrundlagen und die Tr~iger der amtlichen Statistik eingehend dar. Der Verfasser macht deutlich, welche Bedeu- tung einer richtigen Wahl yon Erhebungseinheiten ftir die Aussagekraff einer Statistik zu- kommt. Je nadx Anwendung solcher Einheiten bekommt man ganz verschiedene Ergebnisse, die ri&tig gedeutet sein wollen.

Buchbesprechungen 127
Nach solchen grundsiitzlichen Erw~igungen werden die Statistiken tiber Holzwirtschaff besproehen. Die Methode der Erstellung wird in jedem Falle gezeigt; die besonderen Pro- bleme, die sidi daraus ergeben, werden dargelegt. In die viertelj~ihrlichen Produktionserhebun- gen wurden beispielsweise zuniidist nut Betriebe mit 10 und mehr Besch~iftigten aufgenommen. Damit wurde nut ein Tell der Erzeugung des produzierenden Gewerbes erfaft. Ein anderes Beispieh Es konnte nidit genau festgestellt werden, welche Betriebssparte im einzelnen welche Menge an Produkten erzeugt, wenn die Statistik nut nadi Waren gegliedert ist, wobei wie bei Fiarnierplatten, z.B. als Produzenten, Furnierwerke, aber audi Sperrholzwerke in Frage komrhen.
Dutch eine Vielzahl soldier Hinweise wird ein gutes Urteil dartiber erm6glicht, was einer Statistik entnommen werden kann, welche Werte m/Sglidierweise entstelh sind und wortiber die Erhebung keine braudibare Aussage madien kann.
Endlich wird festgestellt, daft zur Zeit die Holzwirtsdia~ tiberhaupt nur z.T. statistisdi erfaflt wird.
Der Verfasser weist an M~ingeln der Statistiken soldie reditlicher und organisatorisdier, methodischer und holzwirtsdia~lidi-fachlicher Art nach. Dabei stellt sich heraus, daft letztere iiberwiegen. Eine Verbesserung vorhandener Statistiken wird daher allein sdion dutch ent- sprechende Beratung der Erhebungsstellen erreicht werden ktinnen.
Das Buch bringt eine Ftille yon Gesiditspunkten, die dem Versfiindnis der Materie d e r Statis~ik dienen. Der Leser wird die darin enthaltenen Feststellungen und Erkenntnisse dank- bar verwerten k/Snnen. F. BICHLMAIER
Forststatistisches Jahrbuch 1961 - Baden-Wiirttemberg - , 9. Jahrgang. Heraus- gegeben vom Ministerium fiir Ern~ihrung, Landwirtscha~, Weinbau und Forsten - Ministerialforstabteilung - , Stut tgart 1964. 410 S. mit einleitendem Text. 1 Forst- bezirkskarte.
Die Abwanderung von Arbeitskr~ifien war im Berichtsjahr gr/Sfler denn je. Insgesamt verlor die Forstverwaltung 1926 Arbeiter und Arbeiterinnen (gegentiber 1766 im voraus- gegangenen Jahr). Besonders ungtinstig madite sidi diese Entwicklung in den Ballungsr~iumen bemerkbar. Nachdem audi ein Umsetzen von Waldarbeitern in andere Forstbezirke die ent- standenen Liicken nidit ausfiillen konnte, muflten in versdiiedenen Forst~imtern erstmals Holzeinschlagsunternehmer eingesetzt werden. Das Einsdilagsprogramm yon 1 500 000 fm o. R. fiir den Staatswald wurde um 7 °/0 tibersdiritten; der Einschlag erreidite eine H/She yon fund 1,61 Mill. fm, das sind 5,3 fm/Jahr und ha. Dabei zeigt eine 13bersidit fiber die Ver- teilung des Sortenanfalles in den letzten neun Jahren neben einem geringen Anstieg des Laubnutzholzanteiles einen weiteren deutlidien Rtickgang des Brennholzes. Auch wurde weniger Nadelgrubenholz ausgehahen. Die Entwicklung der Holzpreise im Berichtsjahr wurde durdi folgende Hinweise diarakterisiert: Die Preise f/ir Fi/Ta-Stammholz B Sfiirke- klasse 4 stiegen yon 91,- DM/fm im November 1960 auf 102,- DM/fm im August 1961. Audi bei Kiefernstammholz kam es zu einer merklidien Preisbefestigung.
Eichenstammholz hingegen verzeichnete ein geringftigiges Nadigeben der Preise; Budien- stammholz mufte ebenfalls Preiseinbufen hinnehmen.
Aus der Ftille yon Angaben sei noch erwiihnt, daf sich die Kosten ffir den Neubau yon Hauptfahrwegen etwa auf VorjahreshtShe hielten. Ebenso waren die Kosten ftir die Unter- haltung fester Wege nur wenig h/Sher als im Jahre zuvor. Erm/Sglidit wurde dieses giinstige Ergebnis durch Rationalisierung, denn die Lohnerh6hung betrug seit dem Vo.rjahr 9 °/o.
Die auf den Nadihaltshiebssatz bereinigten Einnahmen betrugen 1961 143 501 571,- DM gegentiber Gesamtausgaben yon 112202826,-DM. Danach errechnet sidi ein bereinigter 13bersdiuf yon 31 298 745,- DM, das sind pro ha Holzboden 107,- DM und pro Elm o. R. 21,- DM.
Der 13bersdiuf liegt damit zwar tiber demjenigen der vorhergegangenen beiden Jahre, erreicht aber dennodi nut die Iq6he des Betrages yon 1953 trotz eines deutlidien Anstieges des Nachhahshiebssatzes und einer Anhebung des Durdisdinittserl6ses je Elm o. R. um 14,- DM: Die Ausgaben pro Efm o. R. sind in diesem Zeitraum in gleicher Weise an- gewadisen.
Neben diesen Angaben ftir den Staatswald des Landes k6nnen dem Bericht Hinweise tiber die Bewirtschaffung des K~Srpersdiaffswaldes und des Privatwaldes entnommen werden, so daf der Leser tiber das foCstlidi Wissenswerte wiederum umfassend informiert wird.
F. BICHLMAIER

128 Buchbesprechungen
Dendrometer bands to measure stand growth. Von ALVIN A. ALM und BRt3CE A. Be, owN. Minnesota Forestry Notes Nr. 156 yore 15. 10. 1964. Herausgegeben yon der ,,School of Forestry, Universi ty of Minnesota, St. Paul 1, Minnesota". 2 S., 1 Abb., 1 Tab.
Die Verfasser yon der Forstabteilung bei der Universit~t yon Minnesota verwendeten zur Messung d~s Grundfliichenzuwachsganges yon Best~inden w~ihrend einer Vegetations- periode Dauerumfangmel~biinder, die durch eine Feder straff gehalten werden. Zwei 46j~ihrige ,,white-pine"-Versuchsfliichen mit je ca. 60 St~immen wurden verglichen. Die eine hatte eine Stamm-Grundfi~iche yon 44 m~/ha, die andere war stark durchforstet und hatte nur 33 m~/ha. W/Schentlich wurde der Umfang an allen B~iumen abgelesen. Die durchforstete Fliiche hatte mit 0,75 m~/ha einen gr6f~eren Grundflilchenzuwachs als die dichte Fl~iche (0,48 me/ha), der Volumenzuwachs wurde nicht bestimmt. Auf Grund bekannter Gesetzm~if~igkeiten mlif~te iibrigens die 13berlegenheit der starken Durchforstung im gleichzeitigen Volumenzuwachs bedeutend geringer sein.
Zum Tell wurde der w/Schentlich abgelesene Zuwachs durch das Quellen und Schwinden von Stamm und Rinde iiberlagert oder kompensiert. Nach einer graphischen Darstellung, aus welcher der Referent die folgenden Zahlenwerte abgegriffen hat, ist die Kontraktion Ende September/Anfang Oktober mit etwa 10 °/0 des erreichten Grundfliichenzuwachses bei der stark durchforsteten Fl~iche und mit sogar 30 °/0 bei der undurchforsteten FEiche am gr/Sf~ten. Die Verfsser betonen deshalb auch besonders, dai~ das mit den Mei~biindern registrierte ,,Wachstum" nicht genau dern tats~ichlichen Holzzuwachs entspricht. R. KENNrL
Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und-tiere e.V. Mi~nchen 1965, 30. Bd. Schri~leitung PAUL SCHMIDT, 8000 Miinchen 2, Linprunstr. 37/IV r. Selbst- verlag. Jahresmindestbeitrag 1 1 , - D M (Inland), 1 2 , - D M (Ausland) bei kostenloser Lieferung des Jahrbuches.
Das auch dieses Jahr wieder sorgf~iltig redigierte und reich ausgestattete Jahrbuch gibt einen vielseitigen Querschnitt iiber die Lage des Naturschutzes in unserer Zeit.
In Usterreich (WErqD~L~ER~ER: Naturschutz als kulturelle Verpflichtung unserer Zeit), Bayern (HoEGNrR: Der Ruf der Heimat schweigt hie) und in der Schweiz (OrcHSLIN: Pro- bleme und Sorgen auch in der Schweiz) werfen die zunehmende Industrialisierung und Tech- nisierung, aber auch die zur Erholung in die Naturlandschaf~ str6menden Massen immer schwierigere Probleme auf. Noch verbliebenen Resten anniihernd urspriJnglicher Gebiete gilt deshalb besonders der bewahrende Schutz; MICHrLER, Fluffland der Salzach vor dem Um- bruch?, LINK, Jetzt auch der Hirschberg?
Planm~.f~ig schreitet die yore Verein angeregte und teilweise unterstiJtzte Durchforschung der ~lteren Naturschutzgebiete voran; MAXER, zur Waldgeschichte des Steinernen Meeres, Naturschutzgebiet K6nigssee; FELDNER-GRGBL-MAYER, der Sadebaum in den Ammergauer Bergen. Neugeschaffene Naturschutzgebiere werden vorgestellt, wie das Murnauer Moos (KRAEMER), Kaisergebirge (ERLAC~ER) oder der Hohe Ifen (FRe',0. Diese instruktiven Bei- trage erm/Sglichen einen in vielf~iltiger Weise gewinnbringenden Besuch und regen zu weiteren Untersuchungen an.
Vegetationskundliche (GAMs, Afrikanische Elemente der Alpenflora; EBrRLr, Alpendost) und tierkundliche Beitr~.ge (TRATZ, tiber Kolkraben und Uhu; STEINBACHER, i~ber den Vogeb zug) runden das Jahrbuch. Nicht zuletzt fehlt auch nlcht ein aktueller Bericht iJber die dutch die Presse bekannte Mure yon Landl in Tirol (GALL). Diese Skizze fiihrt eindrucksvoll vor Augen, daf~ trotz aller technlscher Fortschritte im Alpenraum jegliches Menschenwerk in be- sonderer ,,Naturn~he" zu stehen hat.
Wet sich eng der Natur verbunden fiJhlt, wer die sich anbahnenden Gefahren fiir unsere noch urspri~ngliche Bergwelt in naher und ferner Zukunft nur etwas ahnt und wet die zu- nehmende Kostbarkeit dieser gef~hrdeten, unbezahlbaren Naturreste in ihrer tats~chlichen Bedeutung f~ir das wirkliche Leben roll erfafgt, der mug aus banger Sorge slch zur Schar jener Idealisten gesellen, die unermtidlich und verantwortungsbewul~t fiir die Nachwelt jene Werte erhalten helfen, die kurzsichtiger Menschengeist im Nu fi~r immer vernlchten wiirde. Haben nieht gerade wir Forstleute die moralische Verpflichtung, die Bestrebungen des Ver- eins tatkr~i~ig zu unterstiitzen? HANNES MAYER