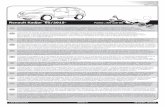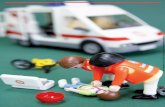128 Farben. Ein Musterbuch für Architekten, Denkmalpfleger und Gestalter
Jarren,_Otfried_+_Patrick_Donges_2011_-_Strukturen_de,_119-128
-
Upload
amaado-ashshaa -
Category
Documents
-
view
4 -
download
1
Transcript of Jarren,_Otfried_+_Patrick_Donges_2011_-_Strukturen_de,_119-128
6 Strukturen des intermediären Systems der Interessenvermittlung
Innerhalb des politischen Systems lässt sich ein intermediäres System der Interes-senvermittlung als relevante Struktur politischer Kommunikation ausmachen. Das intermediäre System vermittelt zwischen der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bür-ger auf der einen und den politischen Entscheidungsträgern auf der anderen Seite. Im folgenden Kapitel werden zunächst die Begriffe Interessen- und Entscheidungs-vermittlung definiert und auf die Komplexität dieser Prozesse hingewiesen (6.1). Später werden die einzelnen Vermittlungsebenen des intermediären Systems einge-führt (6.2) und dieses als constraint für politische Akteure modelliert (6.3). Somit stellen Veränderungen des intermediären Systems, etwa in Folge der Medialisie-rung von Politik, unmittelbar eine Herausforderung für die politischen Akteure dar (6.4).
6.1 Interessen- und Entscheidungsvermittlung
Interessenvermittlung ist ein Oberbegriff für drei analytisch unterscheidbare Grundfunktionen: der Generierung von Interessen, ihre Aggregation sowie schließ-lich ihre Artikulation (vgl. Rucht 1991). Die Funktion der Interessengenerierung verweist zunächst darauf, dass Interessen in der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger nicht einfach da sind, sondern stimuliert, geweckt oder einfach auch erzeugt werden müssen. Wie noch zu zeigen sein wird, sind politische Organisationen in hohem Maß darauf angewiesen, bei ihren Mitgliedern die Fiktion gemeinsamer Interessen zu erzeugen. Innerhalb der Organisation findet dann eine Interessenag-gregation statt, die sich wiederum in verschiedene Teilprozesse differenzieren lässt: die Selektion der Interessen, die als gemeinsame Interessen weiter verfolgt werden, die Umdeutung von Interessen, beispielsweise bei Widersprüchen zwi-schen ihnen, und schließlich ihre Bündelung in Form von Forderungen, Program-men, Gesetzentwürfen etc. Drittens erfolgt die Interessenartikulation, die Thema-tisierung und Sichtbarmachung der Anliegen, sei es in Form öffentlicher oder in-terpersonaler Kommunikation (z. B. Lobbying). „Vermittlung“ bezeichnet daher mehr als einen reinen Transport von Interessen und Entscheidungen, vielmehr ent-wickelt das intermediäre System darüber hinaus auch ein Eigenleben und Eigen-
O. Jarren, P. Donges, Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft,DOI 10.1007/978-3-531-93446-4_ ,© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011
6
120 6 Strukturen des intermediären Systems
interesse. Akteure des politischen Systems generieren häufig erst Interessen, deu-ten sie um und transformieren sie hinsichtlich ihrer eigenen Interessen als Akteur.
Der Begriff der „Vermittlung“ bezieht sich zudem auf beide möglichen Rich-tungen der Kommunikation. Einerseits findet im intermediären System eine Inte-ressenvermittlung von der Gesellschaft an die politischen Entscheidungsträger statt, die aus Sicht des politischen Systems auch als Input-Kommunikation be-zeichnet wird. Als Output-Kommunikation – oder Entscheidungsvermittlung – wird dann die umgekehrte Kommunikation von den politischen Entscheidungs-trägern zu den Bürgerinnen und Bürgern bezeichnet. Entscheidungsvermittlung bedeutet, dass sich politische Entscheidungsträger für ihre Entscheidung vor der Öffentlichkeit rechtfertigen, sie erklären und für sie um Zustimmung werben. Da-bei erfolgt quasi eine Abnahme und Bewertung der kollektiv verbindlichen und implementierten Entscheidung durch die Bürgerinnen und Bürger, die dann wieder in Form neuer Interessen und Ansprüche in den politischen Prozess einfließen kann.
Intermediäres System
„Ganz allgemein bezeichnet ein intermediäres Element oder System ein Bindeglied. Damit wird auf zwei weitere Elemente verwiesen, die durch das intermediäre Element verknüpft, also in einen Funktionszusammen-hang gebracht werden. Intermediäre Systeme verbinden (mindestens) zwei externe Systeme, zwischen denen Kommunikationsschranken exis-tieren oder die sogar in einem spannungsreichen bzw. widersprüchlichen Verhältnis zueinander stehen“ (Rucht 1991: 5).
Im intermediären System – verstanden als ein Interaktions- und Kommunikations-raum – werden sowohl bei der Interessen- als auch bei der Entscheidungsvermitt-lung nicht einfach die „Sprachen“ der externen Systeme Staat und Lebenswelt „übersetzt“, sondern es entwickelt sich auch eine eigene Kommunikationsweise, um zu beiden externen Systemen anschlussfähig zu sein (vgl. Neidhardt 2007, Rucht 2007, Streeck 1987). Um dies zu leisten, müssen intermediäre Systeme in der Lage sein, unterschiedlichste kommunikative Anforderungen – zwischen Le-benswelt und Regierung – zu erfüllen. Das intermediäre System kann nicht einfach als Subsystem des politischen Systems angesehen werden, sondern muss als ein offener und grundsätzlich für alle individuellen und kollektiven Akteure zugängli-cher Handlungs- und Kommunikationsraum verstanden werden. Beim in-termediären System handelt es sich um ein differenziertes, flexibles und multi-funktionales Handlungsfeld, dem ein systemischer Charakter zuerkannt wer-den kann. Intermediäre Systeme sind „somit formal gesehen selbst demokratische politische Systeme en miniature“ (Steiner/Jarren 2009: 257).
6.2 Die Vermittlungsebenen des intermediären Systems 121
In einem Modell von Rucht (1991) wird deutlich, dass die Akteure des interme-diären Systems in unterschiedlicher Weise in der Gesellschaft wie im politisch-administrativen System (Entscheidungssystem) verankert sind. Politische Parteien sind grundsätzlich auf eine große Durchdringung der Gesellschaft aus, denn sie wollen möglichst viele Wähler auf sich vereinen. Aus Sicht der Parteien handelt es sich bei Neuen Sozialen Bewegungen, Vereinen oder Verbänden um das gesell-schaftliche Vorfeld, das es vor allem für Wahlen zu gewinnen gilt. Vereine und Verbände hingegen organisieren nur spezifische Teilinteressen und wenden sich deshalb nur an einen bestimmten gesellschaftlichen Teilbereich. Ad-hoc-Zu-sammenschlüsse wie Bürgerinitiativen beziehen sich eher auf bestimmte Gruppen von Betroffenen oder auf Themen, die zumeist umstritten sind und von anderen politischen Akteuren nicht aufgegriffen werden.
Abbildung 6-1: Verankerung der Akteure des intermediären Systems (nach Rucht)
(Quelle: nach Rucht 1991; Rucht 2007)
6.2 Die Vermittlungsebenen des intermediären Systems
Den Akteuren des intermediären Systems obliegt die Vermittlung von Interessen zwischen Staat und Gesellschaft, aber auch zwischen den Akteuren selbst und Tei-len der Gesellschaft. Diese Aufgabe wird weitgehend durch Formen der politischen
Parteien
Verbände
Bew egungen
Bürger
Gruppen
M ilieus
M assenm edien
Systeme der Informationsvermittlung
Politisch adminis-trativesSystem
Öffentlicher Raum Umwelt
(nicht-öffentliche polity)
Umwelt (Privatsphäre)
122 6 Strukturen des intermediären Systems
Kommunikation geleistet. Wir können dabei die folgenden Vermittlungsebenen im intermediären System analytisch unterscheiden:
Auf der horizontalen Ebene findet Kommunikation, Konflikt sowie Koope-ration zwischen den intermediären Organisationen statt. Zum einen interagieren und verhandeln die Organisationen miteinander als kollektive Akteure. Zum anderen existiert hier eine Form von Durchdringung, denn einzelne Personen gehö-ren verschiedenen Organisationen zugleich an: Parteimitglieder üben Vorstands-funktionen in Sportvereinen aus oder Parlamentarier wirken hauptberuflich als Verbandsfunktionäre. Diese Art von Funktions- und Rollenverknüpfung finden wir vor allem bei Mitgliedern politischer Parteien. Sie vernetzen damit unter-schiedliche Organisationen und politische Prozesse. Mögliche Forschungsfragen sind hier: Welche Beziehungen bestehen zwischen den intermediären Organisatio-nen (Kooperation, Koalition, Konkurrenz u. a.m.) und welche formalen oder in-formalen Austauschverhältnisse finden wir vor?
Auf der vertikalen Ebene findet Kommunikation, Konflikt und Kooperation zwischen den intermediären Organisationen sowie den Organisationen, die wir zum politischen System zählen können, statt. Hier agieren vor allem Akteure, die bei der Politikformulierung, Programmentwicklung und Politikrealisierung mitwir-ken. Verbände, vor allem aber die politischen Parteien und ihre Vertreter, haben für diese Informations- und Kommunikationsprozesse eine besondere Bedeutung, weil sie sowohl in den intermediären Organisationen agieren (also in Parteien und Verbänden) und zugleich auch Positionen im politischen System innehaben (so Regierungs- oder Verwaltungspositionen). Sie können aufgrund dieser herausra-genden Stellung in besonderer Weise politische Prozesse vernetzen, auch weil ihre Organisationsvertreter auf allen Ebenen agieren. Wegen ihrer einflussreichen Posi-tion sind sie für andere Akteure gesuchte Kooperations- oder Verhandlungspartner. Mögliche Forschungsfragen sind hier: Mit Hilfe welcher Kommunikationsformen wird versucht, Einfluss auf politisches Entscheidungshandeln (beispielsweise durch Konflikt- oder Kooperationsstrategien) zu gewinnen? Auf Basis welcher Strategien versucht das politisch-administrative System, Einfluss auf die Akteure des interme-diären Systems wie auch auf die Bürger zu gewinnen?
Als organisationsinterne oder binnenkommunikative Ebene wird die Kom-munikation innerhalb der Akteure des intermediären Systems bezeichnet. Diese ist vor allem bei Großorganisationen, wie etwa den Volksparteien, von Bedeutung. Innerhalb solcher Großorganisationen existieren unterschiedliche Gruppierungen („Flügel“), die jeweils eigene Ansprüche an die Ziele und Programme der Organi-sationen richten und ihre Differenzen untereinander zum Teil öffentlich austragen. Mögliche Forschungsfragen sind hier: Wie organisiert und koordiniert sich der Akteur selbst (innerorganisatorische Kommunikation; Beziehungen zu Unter-stützern oder Mitgliedern)?
Die gesellschaftliche Ebene steht schließlich ein wenig quer zu den anderen; sie ist aber empirisch vorfindbar: Zwischen einzelnen Personen wie Bürger
6.3 Das intermediäre System als constraint für politische Akteure 123
gruppen, kollektiven Akteuren und den Medien findet kontinuierlich ein Aus-tauschprozess über zahlreiche soziale Vorgänge statt, in dem immer auch mit dar-über debattiert wird, was denn politische Angelegenheiten sein sollen. Auf der gesellschaftlichen Ebene wird darüber entschieden, was als politisches Problem de-finiert, ob und wie es bearbeitet werden soll. Findet ein Thema Beachtung, in den Medien, bei anderen Akteuren? Zur Formulierung und Durchsetzung von (neuen) Interessen werden vielfach auch neue soziale Organisationen entwickelt. Beispiele sind Bürgerinitiativen oder Ad hoc-Zusammenschlüsse, die zu den Sozialen Bewe-gungen gerechnet werden können.
6.3 Das intermediäre System als constraint für politische Akteure
Bezogen auf die Möglichkeiten der politischen Kommunikation, setzen Verfas-sungen und Gesetze den Akteuren Grenzen. So können sich nicht alle Akteure an formalen Prozessen, sei es in Gebietskörperschaften, in parlamentarischen Prozes-sen oder bei Anhörungen, beteiligen. Durch rechtliche Bestimmungen gelten für Parteien (beispielsweise in Deutschland Art. 21 Grundgesetz, „Parteiengesetz“) be-stimmte Vorgaben hinsichtlich ihrer inneren Verfasstheit („innerparteiliche Demo-kratie“), die für Verbände oder Bürgerinitiativen nicht gelten. Diese normativen Verpflichtungen können wir zu den strukturellen Faktoren zählen, denen die Akteure des intermediären Systems unterworfen sind – und die sich auch auf die kommunikativen Möglichkeiten bzw. ihre Strategien auswirken (vgl. Abbildung 2-5). Zu den strukturellen Faktoren gehören vor allem: die Position eines Akteurs im intermediären System; die normativen Verpflichtungen und demokratisch motivierten Selbstbindungen
eines Akteurs (Grenzen); die Nähe oder Distanz eines Akteurs zum politisch-administrativen System, zu
Entscheidungsträgern und damit zum politischen Entscheidungsprozess; der Organisationstypus eines Akteurs (Dauerhaftigkeit); Ressourcenoptionen; Mitgliederoptionen; Medienzugangsoptionen.
Durch den Hinweis auf Optionen soll darauf verwiesen werden, dass die Mög-lichkeiten in den genannten Bereichen für die Akteure grundsätzlich – also struktu-rell – unterschiedlich sind: Verbände oder Parteien verfügen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder besserer finanzieller Möglichkeiten über andere Optionen zur Ausbildung von Organisationen und für politische Handlungen als beispielsweise (Bürger-)Initiativen. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für das parlamentarisch-politische System und ihrer relativen Dauerhaftigkeit haben Parteien grundsätzlich auch bessere Zugangsmöglichkeiten zu den Medien als neu gebildete Akteure. Auch zwischen Parteien kann dann wieder unterschieden werden: Regierungspar-
124 6 Strukturen des intermediären Systems
teien haben gegenüber Oppositionsparteien einen Vorteil beim Medienzugang, weil sie Entscheidungen treffen können. Daher wird ihren Sprechern und Aktivitäten eine größere Medienaufmerksamkeit zuteil als denjenigen von Oppositionsvertre-tern.
Auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl von historischen und situativen Fak-toren, die den Akteuren spezifische Handlungen ermöglichen oder eben nicht er-möglichen. Zu den historischen Faktoren zählen Handlungsmuster und -regeln, die sich beispielsweise in einer Stadt oder einem Land aufgrund der langjährigen Dominanz einer politischen Partei oder bestimmten Personengruppen herausge-bildet haben. Jedes politische Handlungsfeld – sei es eine Gemeinde, ein bestimm-tes Parlament oder ein Politikfeld – entwickelt sich im Laufe der Zeit; es bilden sich bestimmte Interaktionsweisen (-muster), Mehrheits- und Minderheitskulturen, spezifische persönliche Beziehungen zwischen Handelnden heraus. Bestimmte Bedingungen erleichtern oder erschweren die Anmeldung wie Durchsetzung von Interessen.
Zu den situativen Faktoren können zu einem bestimmten Zeitpunkt vor-herrschende Konstellationen, gerechnet werden. Zu den historischen und situativen Faktoren gehören: das spezifische Ensemble der Akteure in einem politischen Handlungsfeld (bei-
spielsweise anhaltende Majoritäts- oder Minoritätsverhältnisse); die faktische Stellung eines Akteurs im politisch-administrativen System (bei-
spielsweise „Regierung“ oder „Opposition“); die Verfügbarkeit von Ressourcen (Geld, Mitgliederaktivitäten) in einem kon-
kreten Fall; Möglichkeit zur Nutzung bereits vorhandener oder erst zu begründender Bezie-
hungen zum Mediensystem; situative Faktoren im politischen Prozess (Vorhandensein von „Gelegen-
heiten“). Historische und situative Faktoren sind für das unterschiedliche Einflusspotenzial von einzelnen Akteuren relevant. Durch anhaltende Interaktionen bilden sich Ko-operationsgemeinschaften, Zweckbündnisse oder Koalitionen zwischen Akteuren heraus, die wir als Akteurkonstellationen bezeichnen (zum Begriff „Akteurkons-tellation“ vgl. Abschnitt 2.5). Im politischen Alltag wird vielfach von Milieus oder – polemisch gewendet – von Filz gesprochen. Situative Faktoren bestimmen die Handlungsmöglichkeiten von Akteuren in bestimmten Prozessen, wobei die situa-tiven Faktoren vor dem Hintergrund einer historischen Folie zu sehen und zu inter-pretieren sind.
Zwischen den strukturellen und den hier als historisch und situativ bezeichneten Faktoren gibt es Interdependenzen. Die Interdependenzen sind nicht zuletzt auf normative Grundentscheidungen bei der Etablierung politischer Systeme zurückzu-führen: In einem repräsentativ verfassten politischen System kommen den politi-schen Parteien normativ andere Aufgaben zu, als in einem System wie der
6.4 Veränderungen des intermediären Systems als Herausforderung 125
Schweiz, in dem direkt-demokratische Elemente gleichsam für das politische Sys-tem – und damit natürlich auch für die politische Kultur in einem weiten Sinne – konstitutiv sind. Damit sind nun zahlreiche Faktoren angesprochen, die in der einen oder anderen Weise für die empirische Forschung relevant sein können.
6.4 Veränderungen des intermediären Systems als Herausforderung für politische Akteure
Der vielschichtige Wandlungsprozess bei den Medien ist unübersehbar, die Ent-wicklungen wie auch die Folgen für das intermediäre System und seine Organisati-onen sind aber insgesamt schwer abschätzbar. Dies liegt auch darin begründet, dass es keinen übergreifenden Forschungsstand zur politischen Kommunikation inter-mediärer Organisationen gibt: „Die Forschung ist stark akteurspezifisch geprägt und befasst sich entweder mit Parteien, mit Verbänden oder mit Bewegungen, wo-bei man sich innerhalb der Forschung zudem einseitig an den jeweiligen teildiszip-linären Traditionen und Ansätzen orientiert“ (Steiner/Jarren 2009: 254). Abbildung 6-2 stellt ein eher traditionelles Modell des intermediären Systems dar, in dem die vier wichtigsten Gruppen von Akteuren gleichrangig nebeneinander stehen und zwischen Lebenswelt (Bürgerinnen und Bürger) und der politischen Spitze in beide Richtungen vermitteln.
Abbildung 6-2: Intermediäres System (Traditionelles Modell)
Politische Entscheidungsträger
Bürgerinnen und Bürger
Initiativen, Soziale
BewegungenVerbände Parteien Massen-
medien
Aufgrund ihrer Entkopplung von den gesellschaftlichen Organisationen und ihrer stärker gewordenen ökonomischen Ausrichtung sind die Massenmedien mehr und mehr aus dem Schatten der anderen intermediären Organisationen herausgetreten
126 6 Strukturen des intermediären Systems
und haben sich – wenn wir die Struktur des intermediären Systems betrachten – ei-genständig positioniert. Aber durch den Wandel hin zu einer „Mediengesellschaft“ (vgl. Abschnitt 1.2) ist es innerhalb des intermediären Systems zu einer Verschie-bung der Bedeutung der Massenmedien gekommen: Sie stehen nicht mehr quasi „neben“ den anderen Akteuren des intermediären Systems, sondern schieben sich zunehmend zwischen die Bürgerinnen und Bürger und die übrigen Akteure des in-termediären Systems, wie in Abbildung 6-3 veranschaulicht wird. Die Abbildung macht auch deutlich, dass Bürgerinitiativen und Neue Soziale Bewegungen mehr als die anderen Typen politischer Akteure auf die Vermittlungsleistung der Mas-senmedien angewiesen sind.
Abbildung 6-3: Intermediäres System (Mediatisiertes Modell)
Politische Entscheidungsträger
Bürgerinnen und Bürger
Bürger-initiativen,
Neue Soziale
Bewegungen
Verbände Parteien
Massenmedien
Die Medienöffentlichkeit verliert jedoch ihre relative Stabilität – im Sinne von Überschaubarkeit wie auch einer gewissen Vorhersagbarkeit – in dem Maß, wie das journalistische Selektionsverhalten sich auf Grund unterschiedlicher Zielgrup-penmedien und Formate differenziert, auch weil unterschiedlich „professionalisier-te“ Kommunikatoren an der Nachrichtenauswahl und -aufbereitung beteiligt sind, und weil sich das Nutzungsverhalten weiter individualisiert. Die politische Medi-enöffentlichkeit wird aus der Sicht der intermediären Akteure zu einem schlecht kalkulierbaren Prozess. Sie wird es vor allem dann, wenn die herkömmlichen Mas-senmedien mit ihren Programmstrukturen an Bedeutung einbüßen. Das erklärt, weshalb größere intermediäre Akteure mehr Aufwand für die Analyse von Medien
6.4 Veränderungen des intermediären Systems als Herausforderung 127 betreiben müssen (Issue Monitoring) und die eigenen PR-Aktivitäten forcieren (Professionalität, Erhöhung des Outputs u. a.m.).
Zugleich büßt die politische Medienöffentlichkeit dann an relativer Stabilität ein, wenn von den Journalisten der vorpolitische Raum stetig vergrößert wird. Das ist dann der Fall, wenn immer mehr soziale Phänomene als „politisch“ ausgegeben und an das politische System adressiert werden. Das kann dann zu einem Problem für das politische System insgesamt werden, wenn die Akteure des intermediären Systems weiter an Relevanz in der Vermittlungskommunikation zwischen den Bürgern und dem Entscheidungssystem einbüßen. Je weniger Parteien, Verbän-de, Vereine oder Akteure der Neuen Sozialen Bewegungen vor Ort präsent sind, also je weniger sie dauerhaft große Teile der Gesellschaft zu durchdringen und Probleme behandeln zu vermögen, desto mehr sind auch diese Akteure auf PR- wie Medienaktivitäten angewiesen.
Wenn Medienorganisationen und Journalisten nicht oder nur noch im geringen Maße durch politisch-rechtliche Vorgaben auf das politische System hin orientiert werden (Informationsauftrag), so kann das intermediäre System unter stark öko-nomisierten Medienbedingungen an Aufmerksamkeit verlieren: Politische Öffent-lichkeit ist für Medien eben eine Öffentlichkeit neben vielen. Politische Öffent-lichkeit wird auf Grund des gesellschaftlichen Wandels insgesamt – also auch außerhalb der medialen Öffentlichkeit – zu einem Teilbereich auf einem großen Marktplatz, auf dem auch immer wieder neu ausgehandelt und definiert wird, was denn politisch sein, was unter Politik verstanden werden soll. An diesem Aushand-lungsprozess haben die Medien durch die Auswahl der Themen und der Berück-sichtigung von Akteuren allerdings einen wesentlichen Anteil.
Intermediäre Akteure sind sich der steigenden Konkurrenz um Medienzugänge in der Mediengesellschaft erst zum Teil bewusst: Vor allem die traditionellen In-termediäre gehen davon aus, dass sie für die Gesellschaft von großer Bedeutung seien, so dass dem politischen System, seinen Organisationen und Akteuren eine besondere Aufmerksamkeit zukomme – und dass Politik eine Art Vermittlungs-privileg in der medialen Kommunikation beanspruchen könne und genieße. Das ist jedoch immer weniger der Fall. Für alle intermediären Akteure gilt, wenn auch in einem unterschiedlichen Maß: Gewissheiten hinsichtlich der Thematisierung in den Medien sind rar; die Veränderungsdynamik im gesamten Medienbereich ist auf Grund von Modernisierungs- und Globalisierungstendenzen ausgeprägt; die Adres-saten politischer Informationsangebote sind nicht mehr so leicht zu erreichen und verhalten sich eigenwillig und die Konkurrenz um öffentliche Aufmerksamkeit als Bedingung der Möglichkeit öffentlicher Akzeptanz hat zwischen den politischen Akteuren wie auch zwischen politischen und Akteuren aus anderen gesellschaftli-chen Teilsystemen zugenommen. Diese Entwicklung lässt sich aber nicht nur auf Veränderungen im Medienbereich zurückführen: Politik vollzieht sich in der mo-dernen Gesellschaft immer weniger als alles entscheidende und machtvolle Staatspolitik auf nationaler Ebene, sondern als transnationale Gesellschafts-
128 6 Strukturen des intermediären Systems
politik, an deren Willensbildungs- und Aushandlungsprozessen zahlreiche Akteure mitwirken. Politik und politische Akteure sind dann um so mehr zur Be-einflussung politischer Prozesse ganz generell auf ihre informatorischen und kom-munikativen Qualitäten angewiesen. Dabei handelt es sich übrigens um Ei-genschaften, die nicht nur für individuelle Akteure Relevanz haben, sondern um Kompetenzen, die auch intermediäre Organisationen ausbilden müssen, wenn sie den politischen Handlungsrahmen wie auch einzelne politische Prozesse mitgestal-ten wollen.
Das intermediäre System der Interessenvermittlung strukturiert das Ver-halten zentraler Akteure der politischen Kommunikation – Parteien, Ver-bände und Interessengruppen sowie neue soziale Bewegungen. Auch in
der Struktur des intermediären Systems lässt sich Medialisierung im Sinne einer Bedeutungszunahme der Medien festmachen. Die Auswirkungen dieser Verände-rungen werden im nächsten Kapitel wieder aufgegriffen, in dem die politischen Akteure eingehender beleuchtet werden.
Neidhardt, Friedhelm (2007): Massenmedien im intermediären System moderner Demokra-tien. In: Jarren, Otfried/Lachenmeier, Dominik/Steiner, Adrian (Hrsg.): Entgrenzte De-mokratie? Herausforderungen für die politische Interessenvermittlung. Baden-Baden: Nomos, S. 33-47.
Rucht, Dieter (1991): Parteien, Verbände und Bewegungen als Systeme politischer Inte-ressenvermittlung. (WZB Discussion Paper FS III 91-107) Berlin: Wissenschafts-zentrum.
Rucht, Dieter (2007): Das intermediäre System politischer Interessenvermittlung. In: Jar-ren, Otfried/Lachenmeier, Dominik/Steiner, Adrian (Hrsg.): Entgrenzte Demokratie? Herausforderungen für die politische Interessenvermittlung. Baden-Baden, S. 19-32.
Steiner, Adrian/Jarren, Otfried (2009): Intermediäre Organisationen unter Medieneinfluss? Zum Wandel der politischen Kommunikation von Parteien, Verbänden und Bewegun-gen In: Marcinkowski, Frank/Pfetsch, Barbara (Hrsg.): Politik in der Mediendemokra-tie. Wiesbaden, S. 251-269.
Streeck, Wolfgang (1987): Vielfalt und Interdependenz. Überlegungen zur Rolle von in-termediären Organisationen in sich ändernden Umwelten. In: Kölner Zeitschrift für So-ziologie und Sozialpsychologie 39 (4), S. 471-495.