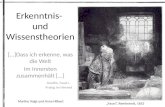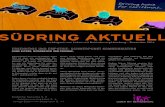Kultur und Erkenntnis
-
Upload
michael-schmid -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
Transcript of Kultur und Erkenntnis

Michael Schmid
Kultur und ErkenntnisKritische Bemerkungen zu Max Webers Wissenschaftslehre
Die folgenden Überlegungen zeigen, dass Max Webers berühmter Aufsatz zur ,,,Objektiviät' sozialwis-senschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis" als Ausgangspunkt eines methodologisch verteidigungs-fähigen soziologischen Forschungsprogramms nicht dienen kann. Einige der weitreichendsten Fehlannah-men werden analysiert und ansatzweise korrigiert und verbessert.
1. Problemstellung
Max Weber gilt als Klassiker. Entsprechendverständlich ist deshalb die Frage, inwieweitseine Übernahme der (Mit-)Herausgeber-schaft des „Archivs für Sozialwissenschaftund Sozialpolitik" und im Besonderen seinim 1. Band der neuen Folge abgedruckterAufsatz zur ,,,Objektivität` der sozialwissen-schaftlichen und sozialpolitischen Erkennt-nis" aus dem Jahr 1904 die Geburt eines ge-nuin „soziologischen Paradigmas" ankün-digt. Ich bin sicher, dass viele dazu neigen,diese Frage zu bejahen, glaube indessennicht, dass eine einfache und durchweg posi-tive Antwort möglich ist. Gewiss kann mannicht übersehen, dass Webers Zeitgenossenseine erkenntniskritische Position teilten,wonach die sozialwissenschaftliche Metho-dologie darauf verzichten sollte, „sklavischden Naturwissenschaften zu folgen" (Käsler1985: 164); auf der anderen Seite aberscheint die „schillernde Vieldeutigkeit seinesDenkens" (Albert et al. 2003b: 1) und beson-ders die „authentic confusion" (Runciman1972: 9) seiner Wissenschaftslehre geradezueine Interpretationsindustrie ins Leben geru-fen zu haben, die sich ebenso unermüdlichwie erfolgsoffen um die Klärung der Fragebemüht, auf der Basis welchen Methodenver-ständnisses Weber welche Forschungsprob-leme behandeln wollte (vgl. Prewo 1979;Schluchter 1979: 15ff.; Hennis 1987; Schluch-ter 1988: 23ff.; Tenbruck 1999; Schluchter2003: 49ff.)2 — wobei sich mit zunehmendemzeitlichem Abstand der Eindruck verfestigt,dass seine „Wissenschaftslehre" ohne peni-ble Rekonstruktion seiner Problemlage kaum
noch verständlich ist (Burger 1976: x; Nusser1986; Oakes 1988; Tenbruck 1999). Zu-gleich aber scheint Webers „Klassizität" derVielzahl seiner Anhänger keine Wahl zu las-sen: Sie müssen seinen methodologischenSchriften auch dann einen forschungsleiten-den Sinn abgewinnen, wenn diese in demVerdacht stehen, „höchst eklektische" (Run-ciman 1972: 9) Kompilationen, „polemischeGelegenheitsarbeiten" (Wagner/Zipprian1994: 10) bzw. Ausdruck einer „private epi-stemology" (Sica 1988: 150) zu sein, undwenn zugleich wenig dafür spricht, sich ätout prix in die von Weber verteidigte Tradi-tion der Erforschung historisch einzigartiger„Vorgänge des Kulturlebens"(Weber 1968b:161) zu stellen (vgl. Kahlberg 1994: 12ff.) 3 ,
Mein Kommentar des Weberschen „Ob-jektivitätsaufsatzes" möchte die dieser Sach-lage entspringenden Kämpfe um die Deu-tungshoheit des Weberschen Werkes nichtentscheiden, zumal im vorliegenden Zusam-menhang an eine ausgewogene Beurteilungdes fraglichen Textes nicht zu denken ist. Ichbehelfe mich deshalb damit, dass ich Webers„Postulat der Werturteilsfreiheit"4 , seinen„Methodologischen Individualismus" (vgl.Norkus 2001: 12) und seine (freilich nichtimmer missverständnisfreien) Versuche, dieSoziologie als eine handlungstheoretischausgerichtete Wissenschaft im Gespräch zuhalten 5 , ohne näheres Besehen akzeptiere6 ,
um vor diesem Hintergrund einige der offen-kundigen Mängel und fragwürdigen Wei-chenstellungen des „Objektivitätsaufsatzes"anzusprechen. Meine Kritik richtet sich dabeivor allem auf zwei zusammenhängendePunkte: Zum einen möchte ich auf das aus 545

M. Schmid: Kultur und Erkenntnis
546
heutiger Sicht zweifelhafte lneinanderfließenvon Logik und Erkenntnistheorie aufmerk-sam machen und zum anderen klar stellen,dass sich Webers Auslassungen über Kausa-lurteile und Idealtypen nur auf Umwegen zurBeantwortung der Frage eignen, in welchemUmfang und mit welchem Recht sich dietheoretische Soziologie als eine erklärendeWissenschaft präsentieren kann, oder andersund summarisch formuliert: Ich versuche zuzeigen, dass sich seine Wissenschaftslehre —entgegen seiner eigenen Einschätzung, derenZielrichtung und Ergebnis — mit der derzeiti-gen Auffassung über die wissenschaftslogi-schen Erfordernisse einer erklärenden Wis-senschaft nur mühsam zur Deckung bringenlässt7 .
2. Kritik der WebersehenWissenschaftslehre
Ich bemühe mich, diese Kritik in sechs ge-trennten, wenn auch in dieselbe Richtungführenden Schritten zu entwickeln und be-ginne mit dem Problem der
2.1 Logik
Es ist mehrfach aufgefallen, dass sich Weberzur Analyse der „kulturwissenschaftlichenLogik" (Weber 1968c: 215ff.), wie er selbstbemerkt, neben Dilthey, Windelband undSimmel vor allem Rickert anschließt (Weber1968a: 12; 1968b: 146), welcher der Logikdie Aufgabe zuweist, die „Begriffsbildung"der Wissenschaften zu begleiten 8 . Damit ver-pflichtet sich Weber freilich einer recht „an-tiquierten" Auffassung von „Logik"9, die sei-ne methodologischen Analysen durch erhel-lungsbedürftige Ungenauigkeiten und Mehr
-deutigkeiten belastet — zunächst ganz unab-hängig von der Frage, ob er unter Rekurs aufdas dominante Logikverständnis seiner Zeitsein Ziel hat erreichen können, gegen Win-delband, Schmoller und Menger, aber auchgegen Rickerts selbst eine Klärung der Be-dingungen „historischer Kulturerkenntnis"(Weber 1968b: 164) herbeizuführen. Beson-ders auffallend ist, dass Webers Auffassung
darüber, welche Aufgabe die Logik im Er-kenntnisprozess und damit im Rahmen einererkenntnissichernden Methodologie besitzensollte, verschiedene Unterscheidungen unbe-achtet lassen muss, auf die man in neuererZeit nicht glaubt verzichten zu können. Ge-nauer: Indem Weber die „Wissenschaft vomKulturleben" (ebd.: 147) nicht mit Hilfe vonSätzen, sondern von Begriffen vorantreibenmöchte, setzt er sich einem mehrschichtigenMissverständnis aus, das aus seiner ständigenVermengung von Begriffen und Aussagenresultiert; näher hin verwechselt er zum ei-nen die Aufgabe, solche Begriffe unter Be-nennung von „Merkmalen" des durch sie zubezeichnenden Sachverhalts zu „definieren",also ihre „Intension" festzulegen bzw. ihre(semantische) Bedeutung zu „explizieren" °,mit der Beurteilung des Gehalts jener Aussa-gen, in denen diese Begriffe Verwendungfinden bzw. die zur Begriffsbildung Verwen-dung finden. Folge dieses Missgriffs ist es,dass er zunächst der wiederholten Versu-chung unterliegt, die „Extension" eines Be-griffs mit dem „Wertbereich" von Aussagenzu vermischen bzw. den Unterschied zwi-schen der „Allgemeinheit" und damit demGehalt von Aussagen und dem logischenUmfang von „Gattungsbegriffen" zu überse-hen. Zugleich verleitet ihn sein schillerndesLogikverständnis, in dem konventionale Be-stimmungen und inhaltliche Erwägungen zu-sammenfließen, auch dazu, auf die deutlicheTrennung von Begriffsdefinition und Syntax(allgemeiner und singulärer) Aussagen zuverzichten; und endlich entgeht ihm auf dieseWeise (offenbar) auch der Unterschied zwi-schen der Logik von Definitionen bzw. derlogischen Struktur von Aussagen einerseitsund der (Tauto-)Logik ihrer Ableitungsbezie-hungen andererseits. Ohne diese Unterschei-dungen indessen lässt sich die logische Syn-tax theoretischer Erklärungen, die ich imAbschnitt 2.4 behandeln werde, nicht erhel-len. 11
Zum Zweck einer solchen syntaktischenBestimmung der „Adäquatheitsbedingun-gen" von Erklärungsargumenten ist es auchwenig hilfreich, dass Weber derartige Ablei-tungsverfahren (und andere logische Opera-tionen 12) für zwingende gedankliche Vor
-gänge hält bzw. umgekehrt und korrespon-

Berl.J.Soziol., Heft 4 2004, S. 545-560
dierend dazu die Klärung epistemologischerBedingungen, also der (faktischen oder empi-rischen) Voraussetzungen unseres Erkennt
-nisvermögens als eine Aufgabe der „logi-schen Analyse" betrachtet. Folge dieser un-durchsichtigen Gemengelage von (formaler)Logik und (inhaltlicher) Erkenntnistheorieist, dass es dem Leser in letzter Instanzschwer fällt auseinander zu halten, was alsrelativ „willkürliche" 13 Begriffsbestimmung,was als tautologische „Transformationsre-gel" und was als empirische und entspre-chend revisionsanfällige These über dasmenschliche Begriffsbildungs - 14 und Er-kenntnisvermögen zu gelten hat, 15 weshalbein angemessenes Urteil darüber, wie sichdieser Unterscheidungsmangel auf die Bil-dung und Überprüfung theoretischer Hypo-thesen auswirken mag, kaum möglich er-scheint. Aus heutiger Sicht sollte zudem klarsein, dass solchen Gleichsetzungen einhöchst strittiges Verhältnis von Psychologieund Logik zugrunde liegt, das in unseren Ta-gen kaum noch jemand verteidigt. 16
Auf eine Klärung dieses vernebelten Ver-hältnisses von Begriffen, logischen Argu-menten und empirischen Behauptungen überdie Bedingungen der sozialwissenschaftli-chen Begriffs- und Erkenntnisbildung könnteman verzichten, drohte Weber nicht dieGrenze zwischen Beschreibung und Er-klärung zu verwischen (vgl. Runciman 1972:79), wenn er im Gefolge seiner unscharfenAuffassung die zentrale Aufgabe der Wis-senschaft weniger in der Revidierbarkeit vonhypothetischen Annahmen 17 als in der „ste-ten Neubildung der ,Begriffe" (Weber1968b: 161, 198) vermutet, was seinerseitsvoraussetzt, dass man seine Sichtweise ak-zeptiert, wonach die „Auslese" (Weber1968a: 11) der gegenstandsbestimmendenund d.h. für ihn „kulturbedeutsamen" Merk-male die eigentlich erkenntniskritische Lei-stung der Soziologie (als einer „Kulturwis-senschaft") sei (Weber 1968b: 161ff.) 18 . Da-mit gerät Weber, trotz aller Abwehr hegelia-nischer „Emanationstheorien", in die Gefahr,Definitionen als Wesensbestimmungen derihn interessierenden Sachverhalte zu deu-ten. 19
Hinter dieser Sichtweise verbergen sichindessen zwei Ungereimtheiten: Zum einen
ist zu fragen, wozu „klare" und zugleich „un-wirkliche Begriffe" (ebd.: 175, 208) benötigtwerden, wenn der Zugang zu einer „unmittel-bar gegebenen empirischen Wirklichkeit"(ebd.: 197, 207) annahmegemäß jederzeitmöglich ist.20 Verständlich wäre WebersThese nur, wenn „Begriffe" für „Theorien"stünden, deren „Geltung" in der Tat davonabhängen muss, dass sie mit bestimmten„Daten" übereinstimmen, was indessen we-der voraussetzt noch dazu berechtigt, die„Wirklichkeit" als eine (theorie- und damitbegriffsfrei zugängliche) „Gegebenheit" zuverstehen. 21 Zum anderen sieht Weber offen-bar nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit,dass Begriffsdefinitionenkeinen empirischenGehalt haben (können), sondern semantisch -operative Festlegungen darstellen, und dasssolche Festlegungsverfahren, auch wenn sieein „historisches Interesse" (Weber 1968a:50, 84) bzw. „Erkenntnisinteresse" (Weber1968b: 161) zu erkennen geben, 22 kein Urteilüber die Wahrheit oder auch nur die Wahr
-heitsfähigkeit von Aussagen über den so be-stimmten Gegenstandsbereich zulassen. 23
Webers „ökumenische", wesentliche sprach-logischen Differenzierungen unbeachtet las-sende Logikauffassung übersieht damit of-fenbar, dass die Beurteilung von Begriffs-wahlen andere Verfahren erfordert als diePrüfung von Aussagen,24 was seine Anhän-gerschaft noch heute dazu verführt, Begriffs-bildung für den Königsweg der sozialwissen-schaftlichen Theoriebildung zu halten bzw.wegen der Gleichstellung von „Begriff' und„Theorie" letztere als Konventionen zu ver-stehen, deren Auswahl nur spärlichen Re-striktionen unterliegt. Dabei ist vor allem zubeklagen, dass eine solche Auffassung zudem Missverständnis führt, man könne infol-ge der Tatsache, dass Begriffe (relativ frei)wählbare Konstruktionen darstellen, auf jedenähere Prüfung der mit ihrer Hilfe gewonne-nen Aussagen verzichten. 25
Zu guter Letzt hat Weber auch keine deut-liche Unterscheidung entwickeln könnenzwischen der definitorischen Subsumptioneines singulären (oder „historischen ") Be-griffs unter einen „Gattungsbegriff' bzw. der„Deduktion der Wirklichkeit aus den ,Geset-zen" (ebd.: 188)26 — in seiner Sprache for-muliert: begriffs- und denklogischen Opera- 547

M. Schmid: Kultur und Erkenntnis
548
tionen — einerseits und der syntaktischenStruktur eines deduktiven, zumal eines er-klärenden Arguments andererseits. Für dasErklärungsverständnis der Sozialwissen
-schaften hatte dieser Mangel indessen ebensoweit reichende wie gravierende Konsequen-zen. Zwar sieht Weber, dass Erklärungen un-ter Angabe von „Regelmäßigkeiten" (ebd.:173) und „hypothetischen" Gesetzes- Begrif-fen (ebd.: 174) gegeben werden müssen — ei-ne eigenständige Analyse der Logik solcherArgumente, wie sie vierzig Jahre später CarlG. Hempel vorgelegt hat (vgl. Hempel 1965:245ff.), aber fehlt und damit jede Möglich-keit zu klären, wie sich das von Weber insAuge gefasste Verhältnis von „kausalen Er-klärungen" (Weber 1968c: 225) und der Bil-dung begrifflicher (Ideal-)Typen im Rahmeneines post-Rickertschen Logik- und Metho-dologieverständnisses behandeln lässt.27
So bin ich keinesfalls davon überzeugt,dass die von Weber angestrebte und an dieserStelle nicht zu kommentierende Gegen-standsbestimmung der „Sozial-Ökonomie"(vgl. Sombart/Weber/Jaffes 1904; Weber1968b: 161ff.) die von ihm vorgenommeneKennzeichnung der „logische(n) Funktionund Struktur der Begriffe" (Weber 1968b:185) tatsächlich erfordert; bzw. ich befürch-te, dass sich die von ihm beklagte „unendli-che Verschlungenheit der begrifflich-metho-dischen Probleme, welche auf dem Gebietder Kulturwissenschaften fortwährend leben-dig bleibt" (ebd.: 205), zu einem Gutteil derUnzulänglichkeit seines Verständnisses „lo-gisch-methodische(r) Probleme" (Weber1968a: 1) verdankt. Dies lässt mich zweifeln,ob man abschließend entscheiden kann, obWeber durch die „Bildung klarer Begriffe"(Sombart/Weber/Jaffe 1904: VI) sein Prob-lem hat lösen können, zwischen naturwissen-schaftlichen Verallgemeinerungen und idio-graphischer Beschreibung eine haltbare„Vermittlungsposition" (Mommsen 1974:216)28 zu beziehen, oder ob man nicht besserberaten wäre, von der lnaktualität seinesAusgangsproblems und der daran geknüpftenLösungsvorschläge auszugehen. Die in mei-nen Augen bedauerlichste Folge dieser Un-klarheit liegt darin, dass sich jene, die sichunter rechtfertigungssichernder Berufung auf„St. Weber" (Turner 1985: 7) 29 der Erfor-
schung der „Kultur" widmen wollen, ihr un-strittiges Forschungsinteresse mit Hilfe einerMethodologie glauben verteidigen zu müs-sen, deren logische Voraussetzungen ihr Pro-tagonist offenbar nicht abschließend hatklären können.
2.2 Kulturbedeutung
Eines der Merkmale, anhand derer sich dieKulturwissenschaften „logisch" von den Na-turwissenschaften unterscheiden, ist in denAugen Webers die „Kulturbedeutung" (We-ber 1968b: 153) ihrer Forschungsgegenstän-de. Weber versteht darunter die Relevanzeinzigartiger historischer Geschehnisse fürdas Selbstverständnis einer Forschergenerati-on und er hofft darauf, die bei der betreffen-den Relevanzabschätzung zugrunde gelegtenWerturteile für die Selektion forschungslei-tender Fragestellungen nutzen zu können.Dass die Auswahl von Forschungsthemen andie Wertüberzeugungen der Forscher gebun-den bleibt, ist, solange sie freiwillig ge-schieht, sicher trivial. Darüber hinaus indes-sen unterliegt die Lehre von der „Kulturbe-deutung" einigen Einschränkungen, die mirdie Emphase unzugänglich machen, mit dersie Weber vorträgt. Zum einen kann mannicht übersehen, dass auch die Themenaus-wahl der Naturwissenschaften (vor allem imBereich der Kosmologie, der Biologie/Pa-läontologie und Archäologie) durch derenwertimprägnierte Kulturbedeutung gesteuertsein kann (vgl. Nagel 1964: 165£). Im Wei-teren können sich Forschungsfragen auchwissenschaftsinternen Problemen verdanken,die im Verlauf eines prosperierenden Wis-senschaftsprogramms auftreten und auchdann auf Lösung drängen, wenn sich derenKulturbedeutsamkeit nur undeutlich abschät-zen lässt — Klagen über die „gesellschaftlicheIrrelevanz" bestimmter Forschungen wärensonst nicht möglich. 30 Darüber hinaus hatSiegfried Landshut (1929: 9) bereits vor ge-raumer Zeit darauf hingewiesen, dass sichdie Soziologie nicht verbieten lassen sollte,ihre Probleme der „Wirklichkeit des zu ent-nehmen statt „einem Zusammenhang, densich der Forscher selbst ausdenkt" (ebd.: 7),wobei allerdings vorauszusetzen wäre, dass

Berl.J.Soziol., Heft 4 2004, S. 545-560
man über eine ausbaufähige Theorie verf.lgt,die eine hinreichende Identifikation der for-schungswürdigen Widrigkeiten des mensch-lichen Zusammenlebens erlaubt. 31 Und um-gekehrt — darin sieht Runciman (vgl. Runci-man 1972: 33ff.) einen ebenso bedauerlichenwie gewichtigen Mangel der WeberschenVorstellung von der „Kulturbedeutung" — istdie Kenntnis der diese tragenden „Wertbe-ziehung" (Weber 1968b: 213) insoweit unzu-reichend, als die wertgesteuerte Festlegungeines die weitere Forschung leitenden The-mas nicht zugleich und zwangsläufig darüberinformieren muss, mit Hilfe welcher Begriffeund Kausalannahmen man dieses zu bewälti-gen habe (vgl. Runciman 1972: 39), 32 wiewenig Weber offensichtlich berücksichtigt,dass die zugestandene Revisionsbedürftig-keit der im Forschungsverlauf gefundenenBegriffe und Thesen sich rückwirkend aufdie Beurteilung der Kulturbedeutung aus-wirkt, oder anders: Weber sieht offenbarnicht, dass das wertgeprägte „Erkenntnisin-teresse" einer Forschergemeinde den Start ei-nes erfolgversprechenden Erklärungspro-gramms behindern und zu empirisch haltlo-sen oder sich widersprechenden Theorienführen könnte. Der Vollständigkeit halberwäre noch der Einwand zu nennen, dass We-bers Konzeption der Kulturbedeutung offen-bar die Möglichkeit vernachlässigt, Kultur
-phänomene auch aus der Perspektive von„Kulturwertideen" zu studieren, die außer-halb des Okzidents Geltung haben (vgl. ebd.:92)33 und für die „innere Erfahrungen" (We-ber 1968a: 14) zu postulieren einige Kühn-heit erfordert.
2.3 Idealtypen
Bei der von Weber initiierten Suche nach denBedingungen der „sozialwissenschaftlichenErkenntnis" fiel keiner seiner Vorschläge auffruchtbareren Boden als seine Vorstellung,die historisch argumentierende „Kulturwis-senschaft" könnte vermittels der Bildung von„Idealtypen" gegenüber dem nomothetischenund verallgemeinernden Zugriff der Natur-wissenschaften eine eigenständige Konturgewinnen. Allerdings lässt sich auch nichtübersehen, dass es Weber zu keiner Zeit ge-
Lungen ist, eine eindeutige Klärung dessenherbeizuführen, was unter diesen verstandenwerden sollte. Teils bezeichnet Weber sie inÜbereinstimmung mit seinem Logikver-ständnis als „reinen Begriff' (Weber 1968b:194) bzw. als „Grenzbegriff" (ebd.: 194);teils als abstraktes „Gedankenbild ", „Utopie"(ebd.: 190) oder „gedankliche Konstruktion"(ebd.: 201), teils als „Hypothese" (ebd.: 203),was er allerdings an anderer Stelle widerruft(ebd.: 190). Auf der einen Seite sollen Ideal-typen infolge ihres unzureichenden Realitäts-bezugs keine Darstellung der Wirklichkeitgeben (können), andererseits aber scheintWeber ihrer kritischen Konfrontation mit der„Wirklichkeit" nicht aus dem Weg gehen zuwollen (ebd.: 191); einesteils sollen sie derhistorischen Einzigartigkeit kulturbedeutsa-mer Konstellationen gerecht werden, ande-rerseits aber gibt es auch Idealtypen über„Gattungsbegriffe" (ebd.: 201 ff., 205).
Die mangelnde Eindeutigkeit und Inkonsi-stenz solcher Bestimmungsversuche sindfrüh aufgefallen (vgl. v. Schelting 1934).Nun kann man diese Unstimmigkeiten umge-hen, indem man Idealtypen — wie dies CarlHempel (1965: 155ff.) vorgedacht hat 34 — alshypothetische und d.h. vor allem als „unvoll-ständige Modelle" deutet, die durch empiri-sche Kritik erweitert und korrigiert werdenkönnen und insofern die Heuristik eines For-schungsprogramms begründen (vgl. Schmid1994: 432ff.); indessen resultiert aus einersolchen Deutung zum einen die völlige Ein-ebnung des Unterschieds zwischen natur -und sozialwissenschaftlichen Erklärungen,worauf sich in Gefolgschaft der Weber-The-se, wonach von einer „prinzipiellen Schei-dung gesetzlicher und historischer Erkennt-nis" (Weber 1968b: 187; der Sache nachauch Weber 1968a: 17) auszugehen sei, nurwenige seiner Anhänger einlassen möchten(vgl. Schluchter 2003: 56); zum anderensprengt die Übernahme des HempelschenModellverständnisses den Rahmen des be-griffsanalytischen Instrumentariums in ei-nem Umfang, den Weber alleine deshalbnicht akzeptieren kann, weil er darauf zählt,dass ihm die Bildung von begrifflichen Ty-pen einen Weg zur Hypothesenbildung erstweist (Weber 1968b: 190). Diese „heuristi-sche" Funktion der Idealtypen (ebd.: 190) 549

M. Schmid: Kultur und Erkenntnis
550
findet immer wieder Verteidiger, obgleichWeber nicht hat plausibel machen können,wie es ihm — ohne solche Hypothesen bereitsvor Augen zu haben — alleine vermittels eta-blierter Wertbeziehungen gelingen sollte, dieMerkmale auszuwählen, die der idealtypi-schen Begriffsbildung zugrunde liegen sol-len.
Zudem scheint Weber Idealtypen, da siesich zur „Darstellung des Wirklichen" (ebd.:190) zugestandenermaßen nicht eignen, fürnicht widerlegbar zu halten (vgl. Runciman1972: 35; Albert 2003: 81). Das macht eszum einen schwer, sie als ausarbeitungswür-dige Theorien zu betrachten, und stellt denKritiker zum anderen vor die Verlegenheit,sich der „Wirklichkeit" nur „nähern" zu kön-nen, wenn er den jeweiligen Idealtypus nach-haltig revidiert und damit korrigiert (vgl. fürdiese Notwendigkeit Schmid 2004: 23ff.).Solange aber eine solche erfahrungsgeleiteteKorrektur von Idealtypen zugunsten ihrervölligen Neukonstruktion in den Fällen un-terbleiben kann, in denen „das Licht dergroßen Kulturprobleme weiter gezogen(sei)" (Weber 1968b: 214) und die geschicht-liche Entwicklung dem Forscher neuartigeThemen aufdrängt, dürfte die Konstruktionsolcher „reinen Begriffe" mit den Erforder-nissen einer erfahrungskritischen Methodo-logie unvereinbar sein.
Ich kann nicht leugnen, dass mir ange-sichts solcher Mängel Verbreitung und Be-liebtheit der „typologisierenden Methode"ein Rätsel geblieben sind.
2.4 Kausale Erklärung und Verstehen
Beachtenswert bleibt demgegenüber WebersHinweis, dass Idealtypen in jedem Fall alsein „genetischer Begriff' aufgefasst werdenmüssen (ebd.: 194, 202), worunter er die For-derung versteht, dass mit deren Hilfe die Ent-stehungs- oder Bestandsbedingungen des un-tersuchten Gegenstands zu erheben seien.Damit kann Weber in den Augen jener, de-nen an einer methodologisch verbürgtenTrennung zwischen Kultur- und Naturwis-senschaften wenig liegt, ohne Zweifel als Be-fürworter einer erklärenden (Sozial- undKultur- )Wissenschaft gelten. 35 Bedauerli-
cherweise ist es ihm aber weder in seinem„Objektivitätsaufsatz" noch späterhin gelun-gen, ein Erklärungsverständnis zu ent-wickeln, das eine Brücke zu den Ergebnissender modernen Wissenschaftsphilosophie zuschlagen erlaubt. Dass viele seiner Anhängersich infolgedessen bemühen, von dieserneueren Erklärungsauffassung (vgl. zumÜberblick Salmon 1989; Sintonen 1997) Ab-stand zu halten, hat zur Durchleuchtung derSachfrage, welche Adäquatheitsbedingungensozialwissenschaftliche Erklärungsargumen-te zu erfüllen haben, verständlicherweise we-nig beigetragen. Entsprechend fällt meine Bi-lanz auch in dieser Frage gemischt aus: Zumeinen ist es — wie angedeutet — nur unter Hin-tanstellung der Rickert-Weberschen „Be-griffslogik" möglich, Idealtypen als ein er-klärungstaugliches Instrument zu rekonstru-ieren; auf der anderen Seite weist WebersKausalitätsverständnis, das sich weitgehendauf John Stuart Mill zu stützen scheint (Run-ciman 1972: 80), die seit langem bekanntenKurzsichtigkeiten auf (vgl. für einen kurzenProblemüberblick Little 1998: 215ff.). ZweiEinwände sind dabei unübersehbar: So kannes — wie bereits kurz angesprochen — nichtrichtig sein, dass die theoriefreie Ausmes-sung der Kulturbedeutung einer gesellschaft-lichen Erscheinung dazu hinreicht, kausal -wirksame Faktoren zu identifizieren und vonkausalirrelevanten zu unterscheiden; zum an-deren ist Mills Vergleichs- und Differenzme-thode nur anwendbar, wenn man alle kausal -relevanten Größen kennt (vgl. ebd.: 191),was nach Webers Zugeständnis keinesfallsgarantiert ist. 36
In letzter Instanz weiß Weber, dass manzur Identifikation und Auswahl von Kausal
-faktoren auf Theorien zurückgreifen muss,37
er ziert sich aber zunächst alleine deshalb,Theorien als systematische Versammlungenallgemeiner Gesetze aufzufassen, weil er die„Kulturerkenntnis" (Weber 1968b: 164) aufein „Interesse am historischen Individuum"(Weber 1968c: 253) festlegen möchte, demdurch Hinweise auf „Gesetze" nicht gedientzu sein scheint (Weber 1968a: 13, 1968b:I74f.). 38 Erst in seiner Auseinandersetzungmit der Erkenntnisauffassung Eduard Meyersbeginnt Weber zu konzedieren, dass das Aus
-findigmachen (sozialer) Wirkursachen auf

Berl.J.Soziol., Heft 4 2004, S. 545-560
„allgemeine Erfahrungsregeln" menschli-chen Handelns (Weber 1968c: 287ff.) zu-rückgreifen muss, 39 die Weber kurz nachdem „Objektivitätsaufsatz" mit einer „gene-ralisierenden Kausalbetrachtung" im Sinneeiner „Gesetzlichkeit" in Verbindung bringt(Weber 1968a: 127).
Diese Sichtweise würde zur Stützung ei-nes akzeptierbaren sozialwissenschaftlichenErklärungsmodells hinreichen (vgl. Albert1968: 151; Runciman 1972: 61ff.), 40 wenndem nicht zwei Hindernisse entgegen stün-den: Zum einen ist es Weber offenbar nichtgelungen, eine hinreichend ausgearbeiteteHandlungstheorie zu entwickeln (vgl. Reh-berg 1994: 631; Esser 2003; Albert 2003:80), die derartige Erfahrungsregeln algorith-misch systematisiert und damit erst heuris-tisch verwendbar macht,41 wenngleich sichParallelen zur (modernen) Rationaltheorie,die dies zu leisten verspricht, aufdrängen(vgl. Norkus 2001, 2003); daneben aber ver-weist Weber zur Klärung der Frage, welcheKausalfaktoren in eine erklärende kulturwis-senschaftliche Betrachtung Eingang findensollten, zum einen auf deren Kulturbedeu-tung und zum zweiten auf die Identifizierbar
-keit „objektiver Möglichkeiten" (Weber1968c: 266ff.). Wie bereits besprochen, füh rtdie erste Denkfigur nicht zum Ziel, aber auchdie zweite löst sein Auswahlproblem solangenicht, als anzuerkennen ist, dass man dieseMöglichkeiten ohne Rekurs auf theoretischesWissen nicht kennen kann. 42 Weber scheintdies zumindest zu ahnen (ebd.: 276, 287)43
und nimmt damit das Ergebnis der Counter-factual- Debatte vorweg, die mit der Einsichtgeendet hat, dass zum Beleg kontrafaktischerMöglichkeiten auf eine dieses Urteil stützen-de Theorie nicht verzichtet werden kann.44
Dass man angesichts dieser Notwendigkeiteiner theoriegestützten Ableitung „objektiverMöglichkeiten" die Gewinnung entsprechen-der „allgemeiner Erfahrungsregeln" nichtausschließlich den „Phantasiebildern" (ebd.:275) des Forschers überlassen kann, sollte al-lerdings eine Selbstverständlichkeit sein; je-denfalls „ersetzt der Einfall nicht die Arbeit",wie Weber (1956: 313) selbst formuliert.
Im Lichte dieses Einwandes wäre es auchangebracht, das Verhältnis von Erklären undVerstehen neu zu regeln, das Webers „Ob-
jektivitätsaufsatz" nicht näher thematisiert.Eine derartige Neuinterpretation sollte sichnicht durch die Undurchsichtigkeiten des„deutenden Verstehens" beeindrucken lassen(vgl. Prewo 1979: 55f; Schwinn 1992: 36ff.;Tenbruck 1999: 50ff.) und zeigen, dass esnicht angeht, Verstehensverfahren mit Er-klärungsnotwendigkeiten zuungunsten letz-terer zu kontrastieren (vgl. Schluchter 2000:129, 2003: 58) oder gegeneinander auszu-spielen; vielmehr sollte sie herausstellen,dass zur näheren methodologischen Charak-terisierung des „Verstehens" der Rahmen ei-ner hypothetischen und nomologischen Deu-tung des menschlichen Handelns nicht ver-lassen werden kann (vgl. Runciman 1972:74f.; Esser 1991; Albert 1984; Murphey1994; Norkus 2001; Albert 2003: 78f.).45 Ei-ne „Vergeisteswissenschaftlichung" der So-ziologie, die nomologischem Handlungswis-sen keinen forschungsrelevanten Platz zuer-kennen möchte, kann sich auf die WeberscheWissenschaftslehre jedenfalls nicht beru-fen, 46 solange man mit Albert, Runciman,Boudon u.a. unterstellen kann, dass Webersoziologische Erklärung durch den Hinweisauf jene „allgemeinen Erfahrungsregeln"theoretisch fundieren wollte.
2.5 Funktionalismus
Ein weiterer Gesichtspunkt, der zur Beurtei-lung der Wirkungsgeschichte der Weber-schen Wissenschaftslehre wichtig ist, deutetsich im „Objektivitätsaufsatz" nur undeutlichund allenfalls indirekt an. Am leichtestennähert man sich ihm, wenn man Webers Ide-altypen — der oben geschilderten DeutungCarl Hempels folgend — als Versuch versteht,die gegenstandskonstituierenden Merkmalezu erheben und damit ein „idealisiertes Mo-dell" über die Bestands- oder Gleichge-wichtsbedingungen des derart „begriffenen"Sachverhalts zu erstellen; das wäre gleichzu-setzen damit, dass die zusammengetragenen,ihn definierenden „Merkmalskomplexe"(Weber 1968b: 194) Informationen über denvon Außengrößen unbeeinflussten, „stö-rungsfreien Ablauf' eines Geschehens (We-ber 1968c: 200; Weber 1968d: 395f.) bereithalten. Möglicherweise klingt es etwas ge- 551

M. Schmid: Kultur und Erkenntnis
552
wagt, Weber — ganz entgegen einer verbreite-ten Tradition, die ihn als Verteidiger einerTheorie des Konflikts in Beschlag nehmenmöchte — als Gleichgewichtstheoretiker zulesen; aber vielleicht gewinnt diese Lesart anÜberzeugungskraft, wenn man bedenkt, dassWeber in idealtypifizierenden Kategorien„gesellschaftlicher Ordnungen" denkt (vgl.Weber 1968e: 541 ff., 1985: 1 ff.; kommentie-rend Schluchter 2003), die man — wie diesTalcott Parsons praktiziert hatte — desglei-chen im Rahmen von Gleichgewichtsmodel-len rekonstruieren kann.
In dieser Sichtweise aber schlummert diefolgende Gefahr: Indem Weber die ihn inter-essierenden Sachverhalte mit Hilfe „reinerBegriffe" beschreibt, neigt er dazu, zur Lö-sung der Frage, wie diese Sachverhalte sichreproduzieren, nur solche Mechanismen zudiskutieren, welche die idealiter unterstellteStörungsfreiheit des Geschehens bzw. dessenGleichgewichtsdienlichkeit stützen. 47 Ange-sichts dessen aber läuft seine Konstruktions-anweisung darauf hinaus, die Forschung aufdie Identifikation jener Bedingungen zu kon-zentrieren, die man notwendigerweise vor
-aussetzen muss, um den Nachweis anzutre-ten, dass es die jeweils interessierenden,grenzwertig modellierten Sachverhaltegibt. 48 Auf diese Weise kann man zwar Exi-stenzbeweise führen, indem man zeigt, dassBedingungskonstellationen auch kontrafak-tisch ausgewiesen werden können, ange-sichts derer man bestimmte, idealtypischeSachverhalte (als objektiv mögliche) würdeerkennen können. Auf der anderen Seite aberwird man aufgrund einer solchen Vorgehens-weise kaum dazu in der Lage sein, dietatsächlichen Dynamiken zu modellieren,denen ein derart charakterisierter Sachverhaltausgesetzt ist und die auch solche „Abläufe"zu erklären erlauben sollten, die eine Verän-derung oder gar das Zusammenbrechen derbesagten Bedingungskonstellationen erzwin-gen. Um auch solche Fälle zu berücksichti-gen, müsste man Webers Forschungspro-gramm von der Erklärung geschichtsbedeut-samer (und in der Regel vergangener) Einze-lereignisse vermittels singulärer Kausalan-nahmen auf die Bildung verallgemeinerungs-fähiger, „generativer Mechanismen "49 um-stellen, welche die unterschiedlichsten „Kon-
stellationen" als Folge des zweckgerichtetenHandelns von Akteuren erklären, die sich,mit verschiedenartigen Ressourcen und „ob-jektiven Möglichkeiten" versehen, unter-schiedlichen Problemsituationen gegenübersehen, wobei mit gleichgewichtsförderlichenHandlungskonsequenzen nicht oder allen-falls ausnahmsweise gerechnet werden soll-te. 0 Demgegenüber setzen sich Webers ide-altypische Analysen infolge ihrer Gleichge-wichtsbetonung dem von Hempel (1965:305ff.) formulierten Verdacht aus,funktiona-listisch zu argumentierten, und ich bin unsi-cher, ob man ihm nach der über Jahrzehnteandauernden Kritik am (methodologischenwie theoretischen) Funktionalismus 51 dafürdanken kann, die soziologische Forschungauf eine derartige Denkweise festgelegt zuhaben.
2.6 Metaphysik und Ontologie
Dass Weber begriffsrealistisch denkt undnachdrücklich Wert auf die Konstruktion„reiner Typen" legt, verdankt sich nicht zu-letzt seiner eigenwilligen Erkenntnismeta-physik. 52 Seiner Auffassung folgend, ist derdenkende Mensch mit einer „absoluten" und„unendlichen Mannigfaltigkeit" der Wirk-lichkeit konfrontiert (Weber 1968b: 171), derer allgemeine Gesichtspunkte nicht entneh-men kann; allenfalls bietet ihm die Realitätein „Chaos von Existenzialurteilen über un-zählige einzelne Wahrnehmungen" (ebd.:177), die ihm die „sinnlose Unendlichkeitdes Weltgeschehens" (ebd.: 180) indessennicht zu entschlüsseln vermögen. „Ordnungin das Chaos der Tatsachen" (ebd.: 207) brin-gen nur die vermittels „geschulte(r) Phanta-sie" (ebd.: 194) entwickelten „gedanklichenKonstruktionen" (ebd.: 201) des Forschers,die das „Leben in seiner irrationalen Wirk-lichkeit" (ebd.: 213) dem Diktat einer ge-dachten Ordnung unterwerfen, die das We-sentliche vom Unwesentlichen scheiden(ebd.: 171) und auf diesem Weg die „Unend-lichkeit von ursächlichen Momenten" beim„Zustandekommen des einzelnen ,Vor
-gangs" (Weber 1968c: 271) begrenzen.Es ist sicher unleugbar, dass Webers
Überzeugung, wonach die wertvollsten In-
zentrieren, die man notwendigerweise vorzentrieren, die man notwendigerweise vor

Berl.J.Soziol., Heft 4 2004, S. 545-560
strumente einer solchen „denkenden Ord-nung" (Weber 1968b: 160) in der kulturbe-deutsamen Auslese historischer Ereignissebzw. in der Bildung „abstrakter" Idealtypenzu suchen seien, die es erlauben, der chaoti-sche Erkenntniswirklichkeit eine individuelleGestalt zu geben, auf deren Erforschung sichdie Soziologie als „Wirklichkeitswissen-schaft" konzentrieren kann, mit dieser Meta-physik vereinbar ist (vgl. zu dieser DeutungFreund 1994). Aus der Sicht heutiger Ver-hältnisse stellt sich Weber damit in diehöchst lebendige Tradition einer anti-realisti-schen und konstruktivistischen Philoso-phie. 53 Allerdings hat bereits vor über dreißigJahren Runciman auf deren Kosten aufinerk-sam gemacht, wenn er anmerkt, 54 dass unterdieser Bedingung nichts zugunsten der „Gel-tung" kausaler Analysen sprechen kann (vgl.Runciman 1972: 36). Wenn „kausale Analy-sen" (Weber 1968c: 279) empirischen Gehalthaben sollen, dann muss man eine realisti-sche Erkenntnistheorie 55 voraussetzen, wel-che die Welt zumindest in dem Umfang alsgeordnet ansieht, den man benötigt, um Kau-salmodelle dadurch kritisieren zu können,dass man die Nichtwirksamkeit bestimmterFaktoren nachweisen bzw. die Entdeckungenbislang verdeckter Kausaleinflüsse machenkann.56
Damit aber sind der „geschulten Phanta-sie" des Forschers (Weber 1968b: 194) bzw.seiner gedanklichen „Formung des Gesche-hens zu einem ursächlichen Zusammenhang"(Weber 1968c: 290) mehr als deutliche Gren-zen gesetzt; angesichts solcher Grenzen soll-ten Annahmen darüber, was es gibt, wenigereine Funktion unvermittelter Wahrnehmungs-urteile oder der begrifflichen Architektursein, in der sich unser Forschungsinteresseartikuliert, als eine logische Implikation unse-rer Theorien (vgl. Quine 1961: 13f.). Natür-lich braucht man infolgedessen nicht zu leug-nen, dass Theorien „reine Gedankengebilde"(Weber 1968b: 197) darstellen, die insoweitimmer fraglich, ja falsch sind, als sie die kau
-salwirksamen Faktoren des interessierendenZusammenhangs nie vollständig ausformulie-ren;57 misslich ist nur, diese Einsicht mit derFolgerung zu belasten, dass deshalb ihre em-pirische Kontrolle für das Vorantreiben einesForschungsprogramms unerheblich sei.
Ich habe Zweifel, ob man auf der Basis ei-ner solchen Fehleinschätzung der methodo-logischen Sachlage die Soziologie als einekritikoffene „Erfahrungswissenschaft" (ebd.:149) betreiben und verteidigen kann.
3. Ergebnis
Ich glaube nicht, dass Webers „Objektivitäts-aufsatz" für das derzeitige methodologischeSelbstbild der Soziologie als einer kritikoffe-nen, empirisch orientierten und theoriegelei-teten Erfahrungswissenschaft wichtig ist; dieSoziologie ist in meinen Augen in keinemFall eine „eigenrechtlich" (Schluchter 1988:49) argumentierende Unternehmung, son-dern eine theoretisch-erklärende Wissen
-schaft wie jede andere. Ihre methodologischeEigenart und Eigenständigkeit aus der „Kul-turbedeutung" ihrer Themenwahl abzuleitenoder aus der Tatsache, dass Akteure Erwar-tungen hegen und „Ideen" verfolgen bzw. als„stellungsnehmende Kulturmenschen" (We-ber 1968b: 180) agieren und dabei ihrem ei-genen wie dem Handeln anderer dessen„sinnvolle Deutbarkeit" (Weber 1968a: 67)unterlegen, halte ich insofern für irreführend,als sich daraus keinerlei Zwang ergibt, vonden Standardbedingungen einer realistischenund wahrheitsorientierten Methodologie ab-zurücken. 58
Demgegenüber glauben offensichtlichviele, Weber habe die ihr Eigenständigkeitverbürgende „Logik der Kulturwissenschaft"erfolgreich beschrieben; sie übersehen indes-sen, dass er sich bei diesem Versuch einemLogikverständnis anvertraut, das die Identifi-kation der Prüfungsbedingungen unseresTheoriewissens, von dessen NotwendigkeitWeber gleichwohl bis zuletzt überzeugt zusein schien, in unakzeptabler Weise er-schwert (Norkus 2001: 303ff.). Oder anders:Ich sehe keinen durch ihren Gegenstand oderihre „Fragestellung" provozierten Sinn darin,der Soziologie eine vorgeblich eigenständigekulturwissenschaftliche Methode oder Er-kenntnistheorie zu verordnen, solange sie in-folgedessen durch Eigenheiten definiert wer-den muss, welche die Entwicklung und Prü-fung ihrer Theorien behindern 59 bzw. — 553

M. Schmid: Kultur und Erkenntnis
554
genährt durch die allerdings an Weber vor-beiführende Leugnung, dass es eine sinnvolle
Handlungstheorie geben könne — die soziolo-gische Forschung auf die Erforschung „kon-kreter historischer Zusammenhänge" (Weber1968b: 214) begrenzen. Ich halte den Wider-stand gegen solche Beschränkungen auchdann für berechtigt, wenn das Kulturschick-sal des Kapitalismus selbstverständlich eingewichtiges Thema soziologisch-historischerForschung bleibt und Handlungserklärungennur dann gültig sind, wenn sie die „sinnhaf-te" Weltdeutung der Akteure ebenso berück-sichtigen wie deren Selbstverständnis alsKulturschöpfer und Moralwesen. Oder stren-ger formuliert: Dass eine nomologische So-ziologie diese Themen nicht angemessen ein-ordnen und behandeln könne, ist eine Chimä-re, welche die Einheit des Fachs zu sprengendroht, seit es — nicht zuletzt Dank der Initiati-ve von Max Weber — seine akademische Exi-stenz begonnen hat. Ich bin deshalb geneigt,Weber einen „tragischen Charakter" zu nen-nen, weil seine gelungene Mithilfe bei demVersuch, der Soziologie einen angestammtenPlatz im Orchester der universitären Fachdis-ziplinen zu verschaffen, ihre „Identitätsfin-dung" zugleich derart erschwert hat, dass —ganz im Gegensatz zur Einschätzung derSachlage bei Roth (1989: 406) — ihr Ver-schwinden aus dem anerkannten univer-sitären Fächerkanon keinesfalls ausgeschlos-sen werden kann.6 o
Anmerkungen
1 So formuliert es das programmatische An-schreiben der Herausgeber des vorliegendenHeftes, wobei unterstellterweise auf Albert etal. (2003) Bezug genommen wird.
2 Einige Interpreten Webers suchen sich indessenseinem Werk ohne jeden Blick auf seine Wis-senschaftslehre zu nähern, vgl. Bendix 1964.
3 Aufgrund dessen kann sich — trotz der gemein-samen Betonung der Wichtigkeit von Institu-tionen — zwar die sogenannte „Historische So-ziologie" auf Weber berufen, nicht aber die anModellbildung und politischen Steuerungs-möglichkeiten interessierte analytische Sozio-logie.
4 Eine Weberdeutung, der ich mich anschließe,findet sich bei Albert 1965 und Albert 2003.
Ich stimme der Einschätzung von Schluchter(2000: 129ff.) zu.Besonders einleuchtend ist m.E. Webersgleichzeitige Abwahl psychologisch- redukti-ver und (allerdings weniger deutlich) struktura-listischer Erklärungen; so sind soziologischeErklärungen ihm zufolge nur sinnvoll, wenn esgelingt, aggregierte Konstellationen aus Vor
-gängerverteilungen heraus zu erklären (Weber1968b: 174). Für deren Abfolge freilich gibt eskeine „Gesetze", vor allem keine „Entwick-lungsgesetze" (vgl. Weber 1968a: 26ff.), d.h.ohne Rückgriff auf „nomologisches Wissen"darüber, „wie Menschen auf gegebene Situa-tionen zu reagieren pflegen" (Weber 1968c:276f.), kann demnach nicht geklärt werden,wie diese Konstellationen ihre Wirksamkeitentfalten (vgl. dazu Abschnitt 2.4). WebersVorstellung einer „kausal erkennenden ,Deu-tung— (Weber 1968a: 89) als Voraussetzungeiner hypothetisch-rationalen Handlungser-klärung (Weber 1968a: 115, 127ff.) und seineKritik an der Verwendung sog. „Kollektivbe-griffe" (Weber 1968b: 210f.) lassen sich mitdieser Problemsicht unschwer vereinbaren.Sein soziologisches Erklärungsschema kommtdem Verständnis dessen entgegen, was neuer-dings als „mikrofundierende Erklärung" ver-standen wird (vgl. zu Begriff und Sache Lin-denberg 1977; Boudon 1986; Coleman 1990;Esser 1993; Little 1998: 197ff, 237ff. undSchluchter 2003: 60). Man muss gegen Weberallenfalls festhalten, dass zu diesem Zweck —weit über das von ihm Geleistete hinaus — einemodellfähige und vereinheitlichte nomologi-sche Handlungstheorie entwickelt werdenmuss. An dieser Aufgabe wird — auch ausge-hend von Weber — gearbeitet (vgl. Norkus2001; Norkus 2003; Esser 2003).Zur näheren Kennzeichnung der Forderungen,die ich an eine wissenschaftslogisch verteidi-gungsfähige theoretische Soziologie stelle, vgl.Schmid 2005.Vgl. Rickert 1913; kommentierend Burger1976: 11ff.; Oakes 1988: 41ff.. Schluchter(1988: 80ff.) erinnert darüber hinaus an dieKantschen Wurzeln der Weberschen Erkennt-nislehre.Ich möchte Weber selbstredend nicht dafür ta-deln, dass er die Arbeiten von Frege, White-head und Russell nicht berücksichtigt hat; esgeht mir nur um den Hinweis, dass deshalb dervon ihm eingeschlagene Weg der Klärung dervon ihm so genannten „logischen" Problemeder sozialwissenschaftlichen Erkenntnis (letzt-lich) nicht zielführend war — einige Details zurSachlage führe ich nachfolgend an.

Berl.J.Soziol., Heft 4 2004, S. 545-560
10 Es findet sich bei Weber leider keine ausgear-beitete „Definitionslehre", wie sie im Gefolgeder modernen Sprachlogik entstanden ist (füreinen Überblick vgl. Suppes 1957: 151ff.). Ichvermute, dass er wie Rickert (1929: 22) in je-dem Fall davon „absehen" möchte, Definitio-nen mit der konventionalen Festlegung von„Wortbedeutungen" gleichzusetzen, wie dasderzeit üblich ist, um sie stattdessen als Be-standteil eines erkenntnissichernden „Denk-prozesses" zu verstehen. Weber scheint freilichnicht zu sehen, dass er auf diesem Weg auf ei-ne empirische Theorie des menschlichen Er-kenntnisvermögens angewiesen ist, fair derenEntwicklung ihm jede Voraussetzung fehlt.Entsprechend ist es fragwürdig, wenn sich So-ziologen noch heute an seinen Problemstandbinden.
11 Vgl. zu diesem Programm Hempel 1965:245ff.
12 So etwa „Synthese" (Weber 1968b: 200, 207),„Abstraktion" (ebd.: 206) und „Konkretisie-rung" (ebd.: 213f.), aber auch „Isolierung" und„Generalisierung" (Weber 1968c: 277). Fürden Zwangscharakter des logischen Denkensvgl. Weber 1968a: 4.
13 Tenbruck (1999: 29) hatte mehr Recht als erwahrscheinlich haben wollte, als er Webers be-griffslogische Verfahrensvorschläge als „will-kürlich" kennzeichnete. Folgt man Runciman(1972: 80ff.), dann steht hinter der Willkürlich-keit der Begriffsbildung das Problem, dass un-bestimmt ist, wie man „soziale Tatbestände"„beschreiben" sollte, solange zu diesem Zweckkeine prüfbare Theorie angewendet werdenkann. Dass es keine solche Theorie gebe, warin der Tat Webers Überzeugung; ich werde zuzeigen versuchen, dass sich sein Problem ent-schärfen lässt, wenn man diese These meidet.
14 Dass Weber die empirischen Prozesse der Be-griffsbildung nicht kannte (vgl. dazu etwaMurphey 1994: 1 ff.), wird ihm niemand vor-werfen können; gleichwohl fällt angesichtsneuerer Einsichten die mit einem Ton vonRechthaberei durchsetzte Insensibilität seinerBehauptungen um so deutlicher ins Auge.
15 Die Vermengung dieser Gesichtspunkte wirddort greifbar, wo Weber in geradezu Wittgen-steinscher Weise von „der logischen Strukturder Erkenntnis" spricht (Weber 1968c: 287).
16 Zur Kritik der Gleichsetzung logischer Regelnmit „Gesetzen des Denkens" oder „Erkennens"vgl. Popper (1963: 64, 207, 328), vgl. auchQuine (1966: xiiiff.), der darauf hinweist, dasslogische Verfahren keine „Denkgesetze", son-dern wahrheitskonservierende Transformati-onsregeln darstellen.
17 Dass Kausalhypothesen widerlegt werden kön-nen, gesteht er (natürlich) zu (vgl. Weber1968b: 278); er ist aber unentschieden, ob die-se Revisionsoffenheit für Idealtypen, denen„generative" Kausalhypothesen zugrunde lie-gen sollten, in gleicher Weise gilt (vgl. dazuAbschnitt 2.3).
18 Vgl. dazu Abschnitt 2.2.19 Vgl. in meinen Augen mehr als deutlich Weber
1968a: 5; zur unmissverständlichen Kritik die-ser Auffassung vgl. Popper 1966: 292.
20 In jedem Fall ist diese Form des Empirizismusnur schwer mit der Auffassung vereinbar, We-ber sei Kantianer gewesen. Tenbruck erklärtWebers merkwürdige Sichtweise als Folge sei-ner Übernahme einer zu seiner Lebenszeit weitverbreiteten „naturalistischen Ontologie" (vgl.Tenbruck 1999: 17ff.), nicht aber weshalb We-ber die daraus resultierenden Unklarheitenübersehen und vernachlässigen konnte.
21 Obgleich es Weber als angeblicher Kantianerbesser wissen müsste, versündigt er sich damitgegen ein zentrales Dogma des modernenTheorieverständnisses: Der Theoriegeleitetheitvon Beobachtungsaussagen. Zur Frage derWeberschen Erkenntnismetaphysik vgl. Ab-schnitt 2.6.
22 Dass Weber die Gewinnung entsprechender„Wertgesichtspunkte" ebenso der „Logik" zu-rechnet wie die Begriffsbildung (Weber 1968c:231), ist aus heutiger Sicht ebenso schwer ver-ständlich wie das Verfahren, das einen Zusam-menhang zwischen „Interesse" und den defi ni-tionswichtigen Merkmalen herstellen soll.
23 So kann Popper (1966: 364) die methodologi-sche Bedeutung dieser „Erkenntnisinteressen"nicht erkennen.
24 Oder anders formuliert: Ich fürchte, dass We-bers „Geltungsbegriff' den, wie er sagen wür-de, „logischen" Unterschied zwischen der Ak-zeptanz von Begriffswahlen und der Wahrheitvon Theorien missachtet.
25 Ich komme im Abschnitt 2.3. auf diese Fragezurück.
26 Eine solche „Deduktion" ist unmöglich: Mankann keine „Tatsachen" aus Sätzen „ableiten ";aus Sätzen sind nur Sätze deduzierbar.
27 So gesehen nützt es wenig, die Logik von Er-klärungen durch den Rückgriff auf die Quellenklären zu wollen, aus denen Webers Wissen-schaftslehre schöpft.
28 Runciman (1972: 101) spricht vom „middle gro-und" zwischen Idealismus und Positivismus.
29 Wie Turner neige ich zu der These, dass wirweniger auf den Schultern der Helden unsererDisziplin stehen als in ihrem Schatten. Wir se-hen zu wenig, weil sie uns die Sicht verstellen. 555

M. Schmid: Kultur und Erkenntnis
556
30 Dies impliziert zugleich die von Weber offen-bar nicht konzedierte Möglichkeit, kulturellePhänomene beschreiben zu können, ohne auf„Wertideen" Bezug zu nehmen (vgl. Runciman1972: 97). Webers Diktum, wonach „der Be-griff der Kultur ein Wertbegriff' sei (Weber1968b: 175), stellt insoweit eine forschungs-hinderliche Übe rtreibung dar.
3I Weber kann so nicht argumentieren, weil erdiese Theorie erst anhand der Kulturbedeutungder durch sie zu behandelnden Themen gewin-nen will.
32 Vgl. auch McIntyre 1996: 143ff. In diesemSinn macht sich Weber einer Art „descriptivebias" (ebd.: 62ff.) schuldig.
33 Dass Webers Religionssoziologie das Gegen-teil beweist, trägt zur Interpretationsvielfaltseines Werks sicher bei.
34 Anklänge an dieses Verständnis finden sichfrüh bei Roth (1971: 119ff) und neuerdingsbei Fararo (2001: 48).
35 Vgl. Boudon 1986; Albert et al. 2003.36 Entsprechend hat er die fällige Debatte, ob sei-
ne Protestantismus-These die „richtigen" Kau-salfaktoren nennt, nur zu leidvoll und unterAufgebot furioser Formulierungen durchste-hen müssen, vgl. Weber 1978.
37 Im Fall der Kulturwissenschaften ist dies of-fenbar eine allgemeine, aber „idealisierte"Theorie des rationalen Handelns (vgl. Weber1968a: 130ff., 1968c: 226f und systematisie-rend Norkus 2001). Angesichts dessen halteich die Deutung, Weber habe sich darumbemüht, institutionenspezifsche Handlungsty-pen vorzuschlagen (vgl. Swedberg 1998), fürweniger überzeugend.
38 In seiner Auseinandersetzung mit der Grenz-nutzenlehre (Weber 1968d: 384ff.) wird deut-lich, dass sich seine Kritik in erster Linie aufvon ihm so genannte „psychophysische Geset-ze" richtet, die dem Bedeutsamkeitsaspekt dermenschlichen Handlungsorientierung nicht ge-recht werden. Die neuere Nutzentheorie, dieWerte und Erwartungen zugleich berücksich-tigt und durch Anschlusstheorien über Wert-und Erwartungsbildung ergänzt werden kann,wird hingegen von der Weberschen Kritik auchdann nicht erreicht, wenn der nomologischeStatus nutzentheoretischer Grundannahmenselbstverständlich strittig bleibt.
39 Diese Sicht verteidigt Weber bereits in „Kniesund das Irrationalismusproblem" (1968a:127ff.), und sie findet sich noch im Spätwerk(vgl. Weber 1985: 9).
40 Webers Sichtweise wäre zumal dann zu folgen,wenn — wie Albert und Boudon in gleicherWeise vermuten — diese „Erfahrungsregeln"
Bestandteil psychologischer Theorien seinkönnen.
41 Parsons (1967: 77) hat deshalb Webers Theo-riebildung zu Recht als „atomistisch" kritisiert.
42 Vgl. zur Herkunft und Reichweite der Weber-schen Möglichkeitstheorie Wagner/Zyprian1985. Inwieweit man eine Parallele der Weber-schen Möglichkeitsauffassung zur Restrikti-onsanalyse der Ökonomie ziehen kann, wäreeine Untersuchung wert. Implikation eines sol-chen Vergleichs muss aber die Einsicht sein,dass die Benennung von Möglichkeiten als sol-che, ohne Verweis auf die Auswahlregel, dieangibt, welche der Möglichkeiten ein Akteurselegiert, keine vollständige Handlungser-klärung erlaubt.
43 Folgt man Elster (1981: 274), dann wusste eres.
44 Hempel (1965: 162) ist bereit, Weber dieseEinsicht als ein Positivum zuzuschreiben.Folgt man Achinstein (1971: 51 ff.) und Runci-man (1972: 69), dann besteht zwischen einemGesetz und einem „counterfactual" eine se-mantisch-notwendige Folgerungsbeziehung.
45 In erfrischender Kürze stellt Kahlberg (1994:48f.) fest, dass „Verstehen" ein Feststellungs-verfahren für jene Motive darstellt, die Hand-lungserklärungen voraussetzen müssen. D.h.aber, dass sich Vertreter einer „reinen Herme-neutik" zu Unrecht auf Webers Auffassungenberufen. Eine sinnvolle Problembeschreibungkann der Linie folgen, die Schneider (2002:37f.) vorzeichnet.
46 So würde ich gerne Runciman (1972: 77) undWeiß (1994) verstehen, obwohl ersterer derKulturwissenschaft eine Aufgabe zuweist, diemit der Verfertigung von Erklärungen zunächstnichts zu tun hat: Nämlich die Erfassung von(deskriptionsfähigen) „Bedeutungen" (vonÄußerungen, Artefakten etc.), in denen sich dieAkteure wiedererkennen können (Weber1968a: 92ff.). Um ein definitorisches oder se-mantisches Problem handelt es sich dabei aberoffenbar nicht; es geht um Deutungshypothe-sen, die auch falsch sein können. In keinemFall aber ist es richtig, dass derartige Deutun-gen nomologische Erklärungen irrelevant wer-den lassen, vgl. McIntrye 1996: 121 ff.
47 So stellt etwa Coleman (1990: 422ff.) fest, dassWebers Idealtypus der Bürokratie das Agency-Problem als gelöst voraussetzt, was selbstver-ständlich keinesfalls immer gewährleistet ist.An anderen Stellen macht Weber den Bestandeiner Herrschaftsform bekanntlich vom Legiti-mationsglauben der Herrschaftsunterworfenenabhängig, ohne im Einzelfall klären zu können,auf welchem Wege dieser Glaube sicher zu

Berl.J.Soziol., Heft 4 2004, S. 545-560
stellen ist. Für den allgemeinen Punkt, dass Er-klärungen reproduktionstauglicher Verhältnis-se (aber auch deren Veränderung) handlungs-oder institutionentheoretisch fundierte Abstim-mungsmechanismen erfordern, vgl. an Weberdirekt gewandt Rehberg 1994: 648; und allge-mein Little 1998; Bunge 1996; Schmid 2004.
48 Genau das verleiht den so gefundenen Idealty-pen den vielfach beobachteten Charakter einer„Definition".
49 Vgl. dazu Schmid 2005. Es spricht wenig da-gegen, diese Mechanismen als kausale zu be-handeln, solange man deren akteurkausale(energetische) und strukturkausale (restriktive)Bestandteile unterscheidet.
50 Natürlich weiß Weber um die „Paradoxie derWirkung gegenüber dem Wollen" (Weber1920: 524); man sollte dann aber sehen, dassangesichts dessen jede idealtypische Behand-lung eines Sachverhalts nur zufälligerweiserichtig sein kann.
51 Vgl. für einen immer noch angemessenenÜberblick über diese Kritik Demerath/Peterson1967.
52 Auch diese Vorstellungswelt scheint aufRickert zurückzugehen, vgl. Rickert 1928:383ff.
53 Besonders in der Metahistorie ist eine solcheErkenntnistheorie verbreitet, vgl. Evans 1998.Dass ein realistischer Zugang möglich ist, do-kumentiert Lloyd (1986).
54 Mommsen (1974: 226) ist ihm darin wenigspäter gefolgt.
55 Vgl. zum „realistischen Hintergrund der wis-senschaftlichen Methode" Albert 1982: 6ff.und des Weiteren Musgrave 1993, Kapitel 14und 15.
56 Vgl. Murphey 1994: 251ff. Die Bezeichnung„Metaphysik" muss nicht unbedingt nahe le-gen, dass man an die „Geordnetheit" der Rea-lität glauben oder dem Betreiben von Wissen-schaft voraussetzen muss, bedeutet in jedemFall aber, dass man Wissenschaft als ein Unter-nehmen betreibt, das die Korrektur falscherAnnahmen über die theoretisch postulierteRealität erlaubt.
57 Ich habe den Verdacht, dass Weber die Nicht-widerlegbarkeit von Idealtypen (des Handelns)
insbesondere deshalb vorsieht, weil er natür-lich weiß, dass das „deutende Verstehen" eineheikle Angelegenheit sein kann. Idealtypenwären dann ein typisches Produkt einer „kon-ventionalistischen Strategie", um theoretischeAnnahmen vor Widerlegungen zu schützen(vgl. dazu Popper 1979: 357ff.).
58 Ich verweise zum Beleg dieser Sicht aufSchneider (1991), der klarstellt, dass man zur
empirischen Behandlung von Deutungsstruk-turen den Rahmen einer realistischen Methodenicht verlassen muss.
59 Ich bin in dieser Frage mit Runciman (1972:35) einig.
60 Vgl. zu dieser allerdings durch einige wissen-schaftspolitische Hoffnungen durchsetzen Ein-schätzung Müller 2001.
Literatur
Achinstein, Peter (1971): Law and Explanation.An Essay in the Philosophy of Science. Ox-ford: Oxford University Press.
Albert, Gert/Agathe Bienfait/Steffen Sigmund/Claus Wendt (Hrsg.) (2003a): Das Max We-ber-Paradigma. Tübingen: Mohr Siebeck.
Albert, Gert/Agathe Bienfait/Steffen Sigmund/Claus Wendt (2003b): Das Weber-Paradigma.Eine Einleitung. In: Gert Albert/Agathe Bien-fait/Steffen Sigmund/Claus Wendt (Hrsg.),Das Max Weber-Paradigma. Tübingen: MohrSiebeck, S. 1-20.
Albert, Hans (1965): Wertfreiheit als methodi-sches Prinzip. Zur Frage der Notwendigkeit ei-ner normativen Sozialwissenschaft. In: ErnstTopitsch (Hrsg.), Logik der Sozialwissenschaf-ten. Kiepenheuer & Witsch: Köln, S. 181-210.
Albert, Hans (1968): Traktat über Kritische Ver-nunft. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Albert, Hans (1982): Die Wissenschaft und dieFehlbarkeit der Vernunft. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck).
Albert, Hans (1984): Kritik der reinen Hermeneu-tik. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Albert, Hans (2003): Weltauffassung, Wissen-schaft und Praxis. Bemerkungen zur Wissen
-schafts- und Wertlehre Max Webers. In: GertAlbert/Agathe Bienfait/Steffen Sigmund/ClausWendt (Hrsg.), Das Max Weber-Paradigma.Tübingen: Mohr Siebeck, S. 77-96.
Bendix, Reinhard (1964): Max Weber. Das Werk— Darstellung, Analyse, Ergebnisse. München:R. Piper & Co. Verlag.
Boudon, Raymond (1986): Theories of SocialChange. A Critical Appraisal. Cambridge undOxford: Polity Press.
Bunge, Mario (1996): Finding Philosophy in theSocial Sciences. New Haven und London: YaleUniversity Press.
Burger, Thomas (1976): Max Weber's Theory ofConcepts Formation. History, Laws, and IdealTypes. Durham, NC: Duke University Press.
Coleman, James S. (1990): Foundations of SocialTheory. Cambridge, MASS./London: BelknapPress.
557

M. Schmid: Kultur und Erkenntnis
558
Demerath, Nicholas J./Richard A. Peterson (1967)(Hrsg.): System, Change, and Conflict. A Rea-der on Contemporary Sociological Theory andthe Debate over Functionalism. New York/London: Free Press/Collier Macmillan.
Elster, Jon (1981): Logik und Gesellschaft. Wi-dersprüche und mögliche Welten. Frankfurta.M.: Suhrkamp.
Esser, Hartmut (1991): Alltagshandeln und Ver-stehen. Zum Verhältnis von erklärender undverstehender Soziologie am Beispiel AlfredSchütz und „Rational Choice". Tübingen:J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Esser, Hartmut (1993): Soziologie. AllgemeineGrundlagen. Frankfurt a.M./New York: Cam-pus.
Esser, Hartmut (2003): Die Rationalität der Werte.Die Typen des Handelns und das Modell dersoziologischen Erklärung. In: Gert Albert/Aga-the Bienfait/Steffen Sigmund/Claus Wendt(Hrsg.), Das Max Weber-Paradigma. Tübin-gen: Mohr Siebeck, S. 153-187.
Evans, Richard J. (1998): Fakten und Fiktionen.Über die Grundlagen historischer Erkenntnis.Frankfurt a.M./New York: Campus.
Fararo, Thomas J. (2001): Social Action Systems.Foundation and Synthesis in SociologicalTheory. Westport, CN/London: Praeger.
Freund, Julien (1994): Die Rolle der Phantasie inWebers Wissenschaftslehre. Bemerkungen zuseiner Theorie der objektiven Möglichkeit undder adäquaten Verursachung. In: GerhardWagner/Heinz Zyprian (Hrsg.), Max WebersWissenschaftslehre. Interpretationen und Kri-tik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 473-490.
Hempel, Carl G. (1965). Aspects of Scientific Ex-planation and Other Essays in the Philosophyof Science. New York/London: Free Press/Collier MacMillan.
Hennis, Wilhelm (1987): Max Webers Fragestel-lung. Studien zur Biographie des Werks. Tü-bingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Kahlberg, Stephen (1994): Max Weber's Compa-rative Historical Sociology. Cambridge/Ox-ford: Polity Press.
Käsler, Dirk (1985): Soziologische Abenteuer.Earle Eduard Eubank besucht europäische So-ziologen im Sommer 1934. Opladen: West-deutscher Verlag.
Landshut, Siegfried (1929): Kritik der Soziologie.Freiheit und Gleichheit als Ursprungsproblemder Soziologie. München/Leipzig: Duncker &Humblot.
Lindenberg, Siegwart (1977): Individuelle Effek-te, kollektive Phänomene und das Problem derTransformation. In: Kurt Eichner/Werner Ha-bermehl (Hrsg.), Probleme der Erklärung so-
zialen Verhaltens. Meisenheim: Verlag AntonHain, S. 46-84.
Little, Daniel (1998): Microfoundations, Method,and Causation. Brunswick/London: Transac-tion.
Lloyd, Christopher (1986): Explanation in SocialHistory. Oxford/New York: Basil Blackwell.
McIntyre, Lee C. (1996): Laws and Explanationsin the Social Sciences. Defending a Science ofHuman Behavior. Boulder, CO: WestviewPress.
Mommsen, Wolfgang (1974): Max Weber. Ge-sellschaft, Politik und Geschichte. Frankfurta.M.: Suhrkamp.
Müller, Hans-Peter (2001), Soziologie in der Ere-mitage? In: Eva Barlösius/Hans-Peter Mül-ler/Steffen Sigmund (Hrsg.), Gesellschaftsbil-der im Umbruch. Leske + Budrich: Opladen, S.37-63.
Murphey, Murray G. (1994): Philosophical Foun-dations of Historical Knowledge. Albany, NY:State University of New York Press.
Musgrave, Alan (1993): Alltagswissen, Wissen-schaft und Skeptizismus. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck).
Nagel, Ernst (1964): Problems of Concept andTheory Formation in the Social Sciences. In:Hans Albert (Hrsg.), Theorie und Realität.Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehreder Sozialwissenschaft. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), S. 159-175.
Norkus, Zenonas (2001): Max Weber und Ratio-nal Choice. Marburg: Metropolis Verlag.
Norkus, Zenonas (2003): Die situationsbezogeneund die prozedurale Sicht von Handlungsratio-nalität in Max Webers Begriffsbildung. In: GertAlbert/Agathe Bienfait/Steffen Sigmund/ClausWendt (Hrsg.), Das Max Weber-Paradigma.Tübingen: Mohr Siebeck, S. 125-152.
Nusser, Karl-Heinz (1986): Kausale Prozesse undsinnhafte Vernunft. Max Webers philosophi-sche Fundierung der Soziologie und der Kul-turwissenschaften. Freiburg/München: VerlagKarl Alber.
Oakes, Guy (1988): Weber and Rickert. ConceptFormation in the Cultural Sciences. Cambrid-ge, MA/London: MIT Press.
Parsons, Talcott (1967): Sociological Theory andModern Society. New York/London: FreePress/Collier MacMillan.
Popper, Karl R. (1966): The Open Society and ItsEnemies. Vol. II: The High Tide of Prophecy —Hegel and Marx. London: Routledge & KeganPaul.
Popper, Karl. R. (1963): Conjectures and Refutati-ons. The Growth of Knowledge. New York/Evanston: Harper & Row.

BerU.Sozio\., Heft 4 2004, S. 545-560
Popper, Karl R. (1979): Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Tubingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck).
Prewo, Rainer (1979): Max Webers Wissenschaftsprogramm. Versuch einer methodischenNeuerschlief3ung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Quine, Willard van Orman (1961): From a Logical Point of View. Logico-Philosophical Essays. New York: Harper Torchbooks.
Quine, Willard van Orman (1966): Methods ofLogic. London: Routledge & Kegan Paul.
Rehberg, Karl-Siegbert (1994): Kulturwissenschaft und Handlungsbegrifflichkeit. Anthropologische Uberlegungen zum Zusammenhangvon Handlung und Ordnung in der SoziologieMax Webers. In: Gerhard Wagner/Heinz Zyprian (Hrsg.), Max Webers Wissenschaftslehreo Interpretationen und Kritik. Frankfurt a.M.:Suhrkamp, S. 602-661.
Rickert, Heinrich (1913): Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Tubingen: Verlag von lC.B. Mohr(Paul Siebeck),
Rickert, Heinrich (1928): Der Gegenstand der Erkenntnis. Einflihrung in die Transzendentalphilosophie. Tubingen: Verlag von J.C.B. Mohr(Paul Siebeck)
Rickert, Heinrich (1929): Zur Lehre der Definition. Tubingen: Verlag von J.C.B. Mohr (PaulSiebeck)
Roth, Guenther (1971): Sociological Typologyand Historical Explanation. In: Reinhard Bendix/Guenther Roth, Scholarship and Partisanship. Essays on Max Weber. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press,S. 109-128.
Roth, Guenther (1989): Vergangenheit und Zukunft der historischen Soziologie, In: JohannesWeif3 (Hrsg.), Max Weber heute. Enrage undProbleme der Forschung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 406-424.
Runciman, Walter G. (1972): A Critique of MaxWeber's Philosophy of the Social Sciences.Cambridge/LondonlNew York/Melbourne:Cambridge University Press.
Salmon, Wesley C. (1989): Four Decades ofScientific Explanation. In: Philip Kitcher/Wesley C. Salmon (Hrsg.): Minnesota Studies inthe Philosophy of Science. Vol. XIll: ScientificExplanation. Minneapolis: University of Minnesota Press, S. 3-219.
Schelting, Alexander von (1934): Max WebersWissenschaftslehre. Das logische Problem derhistorischen Kulturerkenntnis. Die Grenzender Soziologie des Wissens. Tubingen: Verlagvon J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Schluchter, Wolfgang (1979): Die Entwicklungdes okzidentalen Rationalismus. Tubingen:J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Schluchter, Wolfgang (1988): Religion und Lebensfuhrung, Band I: Studien zu Max WebersKultur- und Werttheorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Schluchter, Wolfgang (2000): Handlungs- undStrukturtheorie nach Max Weber. In: BerlinerJournal fur Soziologie 10, S. 125-136.
Schluchter, Wolfgang (2003): Handlung, Ordnung und Kultur. Grundzuge eines weberianischen Forschungsprogramms. In: Gert AIbert/Agathe BienfaitiSteffen Sigmund/ClausWendt (Hrsg.), Das Max Weber-Paradigma.Tilbingen: Mohr Siebeck, S. 42-74.
Schmid, Michael (1994): Idealisierung und Idealtypo Zur Logik der Typenbildung bei Max Weber. In: Gerhard Wagner/Heinz Zyprian(Hrsg.), Max Webers Wissenschaftslehre. Interpretationen und Kritik. Frankfurt a.M.:Suhrkamp, S. 415-444.
Schmid, Michael (2004): Rationales Handeln undsoziale Prozesse. Beitrage zur soziologischenTheoriebildung. Wiesbaden: Verlag fur Sozialwissenschaften.
Schmid, Michael (2005): 1st die Soziologie eineerklarende Wissenschaft?, In: Uwe SchimanklRainer Greshoff (Hrsg.), Was erklart dieSoziologie? Methodologien, Probleme, Perspektiven. Hamburg: LIT Verlag (I.E.).
Schneider, Wolfgang Ludwig (1991): ObjektivesVerstehen. Rekonstruktion eines Paradigmas:Gadamer - Popper - Toulmin - Luhmann. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Schneider, Wolfgang Ludwig (2002): Grundlagender soziologischen Theorie. Band I: WeberParsons - Mead - Schiltz. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Schwinn, Thomas (1992): Jenseits von Subjektivismus und Objektivismus. Max Weber, Alfred Schutz und Talcott Parsons. Berlin:Duncker & Humblot.
Sica, Alan (1988): Weber, Irrationality and SocialOrder. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
Sintonen, Matti (1997): Explanation: The FifthDecade. In: Matti Sintonen (Hrsg.), Knowledge and Inquiry. Essays on Jaako Hintikka'sEpistemology and Philosophy of Science. Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi Verlag, S. 225238.
Sombart, Werner/Max WeberlEdgar Jaffe (1904):Geleitwort. In: Archiv fllr Sozialwissenschaftund Sozialpolitik. Neue Foige des Archivs furSoziale Gesetzgebung und Statistik, 19. Band(der Neuen Folge Band I), S. I-VII. 559

M. Schmid: Kultur und Erkenntnis
Suppes, Patrick (1957): Introduction to Logic.Princeton, NJ: D. van Nostrand Company, Inc.
Swedberg, Richard (1998): Max Weber and theIdea of Economic Sociology. Princeton, NJ:Princeton University Press.
Tenbruck, Friedrich (1999): Das Werk Max We-bers. Gesammelte Ausätze zu Max Weber. Tü-bingen: Mohr Siebeck.
Turner, Jonathan H. (1985): Herbert Spencer. ARenewed Appreciation. Beverley Hills/Lon-don/New Delhi: Sage.
Wagner, Gerhard/Heinz Zyprian (1985): Metho-dologie und Ontologie. Zum Problem kausalerErklärung bei Max Weber. In: Zeitschrift fürSoziologie 14, S. 115-130.
Wagner, Gerhard/Heinz Zyprian (1994): Zur Ein-führung. In: Gerhard Wagner/Heinz Zyprian
(Hrsg.), Max Webers Wissenschaftslehre. In-terpretationen und Kritik. Frankfurt a.M.:Suhrkamp, S. 9-28.
Weber, Max (1920): Gesammelte Aufsätze zurReligionssoziologie I. Tübingen: J.C.B. Mohr(Paul Siebeck).
Weber, Max (1956): Vom inneren Beruf zur Wis-senschaft. In: Johannes Winckelmann (Hrsg.),Max Weber, Soziologie — WeltgeschichtlicheAnalysen — Politik. Stuttgart: Alfred KrönerVerlag, S. 311-339.
Weber, Max (1968a): Roscher und Knies und dielogischen Probleme der historischen Natio-nalökonomie. In: ders., Gesammelte Aufsätzezur Wissenschaftslehre. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), S. 1-145,
Weber, Max (1968b): Die „Objektivität" sozial-wissenschaftlicher und sozialpolitischer Er-kenntnis. In: ders., Gesammelte Aufsätze zurWissenschaftslehre. Tübingen: J,C.B. Mohr(Paul Siebeck), S. 146-214.
Weber, Max (1968c): Kritische Studien auf demGebiet der kulturwissenschaftlichen Logik. In:ders, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschafts-lehre. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),5.215-290.
Weber, Max (1968d): Die Grenznutzenlehre unddas „psychophysische Grundgesetz". In: ders,Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), S. 384-399.
Weber, Max (1968e): Soziologische Grundbegrif-fe. In: ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissen-schaftslehre. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Sie-beck), S. S. 514-581.
Weber, Max (1978): Die Protestantische Ethik II.Kritiken und Antikritiken. Hrsg. von JohannesWinckelmann. Gütersloh: Mohn.
Weber, Max (1985): Wirtschaft und Gesellschaft.Grundriß der verstehenden Soziologie. Tübin-gen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Weiß, Johannes (1994): Kausale Durchsichtigkeit.In: Gerhard Wagner/Heinz Zyprian (Hrsg.),Max Webers Wissenschaftslehre. Interpretatio-nen und Kritik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S.507-526.
560
(Hrsg.), Max Webers Wissenschaftslehre. In-