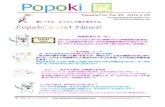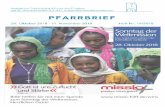Mitteilungen Juni 2016 als PDF dgir-mitteilungen-juni-2016.pdf
mafo1.pdf
Transcript of mafo1.pdf

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN-WEIHENSTEPHAN
Professur für Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft
METHODEN DER MARKTFORSCHUNG I (Demoskopische Methoden)
Themenübersicht WS 2002/2003 ___________________________________________________________________________ Datum Thema ___________________________________________________________________________
Theoretischer Teil 17.10 Einführung 24.10. Methodologische Grundlagen. Erhebungsmethoden (Überblick) 31.10. Befragungsmethoden 07.11. Einstellungsmessung 14.12. Auswahlverfahren: Stichprobentheorie 21.11. Stichprobentechnik und Quotenauswahlverfahren
Praktischer Teil 28.11. Einführung in SPSS einfache Auswertungsverfahren 05.12. Dies Academicus 12.12. Einführung: Vorstellung des Projekts, Brainstorming 19.12. Entwicklung des Fragebogens; Stichprobenziehung und Vergabe der
Interviewtermine 16.01.-23.01. Durchführung der Telefonbefragung (Feldarbeit) 30.01.-06.02. Auswertungsverfahren

Gliederung 0 Verwendete und empfohlene Literatur 1 Einführung in die demoskopische Marktforschung 1.1 Abgrenzung der demoskopischen Marktforschung 1.2 Gegenstände der demoskopischen Marktforschung 1.3 Entstehung der demoskopischen Marktforschung 2 Methodologische Grundlagen der empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung
(sozialökonomische Forschung) 2.1 Grundfragen der empirischen Sozialforschung 2.2 Methodologie - Methode 2.3 Begriff und Bedeutung der Theorie in der empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung 2.3.1 Grundlagen der Theoriebildung 2.3.2 Entstehung und logischer Aufbau von Theorien in der empirischen Forschung 2.3.2.1 Das Problem der Induktion 2.3.2.2 Die Lösung des Induktionsproblems nach POPPER 2.3.2.3 Logischer Aufbau von Theorien 2.3.3.4 Überprüfung von Theorien an der Erkenntniswirklichkeit 3 Methoden der Primärforschung 3.1 Beobachtung 3.2 Experiment 3.3 Befragung 3.3.1 Standardisiertes/strukturiertes Interview 3.3.2 Panelerhebungen 3.3.2.1 Verbraucherpanel 3.3.2.2 Handelspanel 3.3.3 Telefonische Befragung 3.3.3.1 Die Bedeutung telefonischer Umfragen 3.3.3.2 Bestimmungsgründe der Datenqualität 3.3.3.3 Computerunterstützte Telefoninterviews 4 Das Einstellungskonzept in der Marktforschung 4.1 Grundlagen der Einstellungstheorie

4.1.1 Der Einstellungsbegriff 4.1.2 Einstellung und Verhalten 4.2 Messung von Einstellungen 4.2.1 Skalenniveaus 4.2.2 Skalenformen 4.2.3 Eindimensionale Skalierungsverfahren 4.2.4 Mehrdimensionale Skalierungsverfahren 4.3 Entwicklung eines Testinstruments zur Messung von Einstellungen 5 Grundlagen der Stichprobentheorie 5.1 Begriffsdefinition 5.2 Fragestellung der Stichprobentheorie 5.3 t-Verteilung bei kleinen Stichproben 5.3.1 Heterograder Fall 5.3.2 Homograder Fall 5.4 Mittelwertvergleiche 6 Stichprobentechnik 6.1 Technik der uneingeschränkten Zufallsauswahl 6.2 Technik der eingeschränkten Zufallsauswahl 6.2.1 Geschichtete Stichprobenauswahl 6.2.2 Klumpen- und mehrstufige Auswahlverfahren 6.3 Quotenauswahlverfahren 7 Verfahren der Datenauswertung 7.1 Univariate Verfahren 7.1.1 Eindimensionale Häufigkeitsverteilungen 7.1.2 Lageparameter 7.1.3 Streuparameter 7.2 Bivariate Auswertungsverfahren 7.3 Multivariate Verfahren

7.3.1 Einteilung der Verfahren 7.3.2 Faktorenanalyse 7.3.3 Clusteranalyse

1
0 Verwendete und empfohlene Literatur ATTESLANDER,P.: Methoden der empirischen Sozialforschung. 6. Aufl., Berlin, New York 1991. ATTESLANDER, P.; KOPP, M.: Befragungen. In: ROTH, E. (Hrsg.): Sozialwissenschaftliche Methoden: Lehr- und Handbuch für Forschung und Praxis. 2.Aufl., München, Wien,
Oldenburg 1987, S.144-172. BACKHAUS, K. u.a.: Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einführung. 7. Aufl., Berlin, Heidelberg, New York 1993. BÄNSCH, A.: Käuferverhalten. 4.Aufl., München, Wien 1989. BECKER, W.: Beobachtungsverfahren in der demoskopischen Marktforschung. (Bonner Hefte für Marktforschung, H. 9) Stuttgart 1973. BEHRENS, K.C. (Hrsg.): Handbuch der Marktforschung. Wiesbaden 1977. BEREKOVEN, L.; ECKERT, W.; ELLENRIEDER, P.: Marktforschung. Methodische Grund- lagen und praktische Anwendung. 5. Aufl., Wiesbaden 1991. BESCH, M.: Erklärung und Prognose des Konsumentenverhaltens bei Nahrungsmitteln mit Hilfe von Einstellungsmessungen. In: W. HEINRICHSMEYER (Hrsg.), Prognose und Prognose-
kontrolle, Schriften der GEWISOLA Bd. 17, Münster-Hiltrup 1980, S. 471-493. BLANKENSHIP, A. B.: Professional Telephone Surveys. New York u.a.O. 1977. BLEYMÜLLER, J.; GEHLERT, G.; GÜLICHER, H.: Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. 7.Aufl., München 1991. DAWES, R.M.: Grundlagen der Einstellungsmessung. Weinheim, Basel 1977 DILLMANN, D. A.: Mail and Telephone Surveys. The Total Design Method. New York usw. 1978. FREY, J. H.: Survey Research by Telephone. Beverly Hills, London, New Dehli 1983. FRIEDRICHS, J.: Methoden empirischer Sozialforschung. 14. Aufl., Opladen 1990. GRASER, S.: Der Einsatz des Haushaltspanels bei der Erforschung von Nahrungsmittelmärkten.
Weihenstephan 1983. GROVES, R. M.; KAHN R. L.: Surveys by Telephone. A National Comparison with Personal Interviews. New York usw. 1979. HANSEN, J.: Das Panel. Zur Analyse von Verhaltens- und Einstellungswandel (Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung, 39), Opladen 1982.

2
HERRMANN, Th.: Methoden als Problemlösungsmittel. In: ROTH, E. (Hrsg.): Sozialwissen- schaftliche Methoden: Lehr- und Handbuch für Forschung und Praxis. 2.Aufl., München,
Wien, Oldenburg 1987, S.18-46. HEYN, W.: Stichprobenverfahren in der Markforschung. Würzburg 1960. HOLM, K. (Hrsg.): Die Befragung. Bd. 1-6, München 1975 ff. KARG, G.: Wirtschafts- und Sozialstatistik. Vorlesungsskript, Weihenstephan 1989/90 KELLERER, H.: Theorie und Technik des Stichprobenverfahrens. Eine Einführung unter
besonderer Berücksichtigung der Anwendung auf soziale und wirtschaftliche Massenerschei-nungen. (Einzelschriften der Deutschen Statistischen Gesellschaft, Nr. 5), 3. Aufl., München 1963.
KÖNIG, R.: Die Beobachtung. In: KÖNIG, R. (Hrsg.): Handbuch der empirischen Sozialfor- schung, Bd. 2, Stuttgart 1973, S. 1-65. KROEBER-RIEL, W.: Konsumentenverhalten. 6. Aufl., München 1996. MACCOBY, E.E.; MACCOBY, N.: Das Interview - ein Werkzeug der Sozialforschung. In: KÖNIG, R., (Hrsg.): Das Interview. Köln, Berlin 1969, S. 37-85. MAYNTZ, R.; HOLM, K.; HÜBNER, P.: Einführung in die Methoden der empirischen
Soziologie. 5. Aufl., Opladen 1978. MEFFERT, H.: Marketingforschung und Käuferverhalten. 2.Aufl., Wiesbaden 1992. MÜLLER-HAGEDORN, L.: Das Konsumentenverhalten. Grundlagen für die Marktforschung. Wiesbaden 1986. NOELLE, E.: Umfragen in der Massengesellschaft. Einführung in die Methoden der Demosko-
pie. Reinbeck 1976. OPP, K.-D.: Wissenschaftstheoretische Grundlagen der empirischen Sozialforschung. In: ROTH,
E. (Hrsg.): Sozialwissenschaftliche Methoden: Lehr- und Handbuch für Forschung und Praxis. 2.Aufl., München, Wien, Oldenburg 1987, S. 47-71.
POPPER, K.: Logik der Forschung. Tübingen 1989. REICHERT, J.: Verbraucherpanel als Instrument der Marktforschung. Agrarwirtschaft, Jg. 19
(1970), S. 89-95. RICHTER, J.H.: Die Strategie schriftlicher Massenbefragungen. Bad Harzburg 1970. SACHS, L.: Angewandte Statistik. Berlin, Heidelberg 1984.

3
SALCHER, E.F.: Psychologische Marktforschung. Berlin, New York 1978. SCHACH, S.: Methodische Aspekte der telefonischen Bevölkerungsbefragung. Allgemeine Überlegungen und Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. (Universität Dortmund,
Fachbereich Statistik, Forschungsbericht Nr. 87/7) Dortmund 1987. SCHÄFER, E.; KNOBLICH, H.: Grundlagen der Marktforschung. 5. Aufl., Stuttgart 1978. SCHEUCH, E.K.: Das Interview in der Sozialforschung. In: KÖNIG, R. (Hrsg.): Handbuch der empirischen Sozialforschung. Bd. 2, Stuttgart 1973, S. 66-190. SCHRADER, A.: Einführung in die empirische Sozialforschung. Stuttgart 1971, S. 94-109. STROBEL, K.: Die Anwendbarkeit der Telefonumfrage in der Marktforschung. Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Kommunikations- und des Repräsentanzproblems.
(Europäische Hoschschulschriften: Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft, Bd. 472). Frank-furt, Bern, New York 1983.
TRIANDIS, H. C:: Einstellungen und Einstellungsänderungen. Weinheim, Basel 1975. ÜBERLA, K.: Faktorenanalyse. 2. Aufl., Berlin, Heidelberg, New York 1977. ZIMMERMANN, E.: Das Experiment in den Sozialwissenschaften. (Studienskripten zur
Soziologie, H. 37), Stuttgart 1972.

4
1 Einführung in die demoskopische Marktforschung 1.1 Abgrenzung der demoskopischen Marktforschung Grundaufgabe der Marktforschung: Deckung eines aktuellen bzw. zukünftig zu erwartenden Informationsbedarfs. Vielzahl unterschiedlicher Informationsansprüche --> Vielfalt von Formen der Marktforschung, die nach verschiedenen Aspekten klassifiziert werden können, z.B. a) Klassifikation nach der Art der Informationsgewinnung: Primärforschung: - Deckung des Informationsbedarfs durch Erhebungen am Markt.
- Erhebungsmethoden: Beobachtung, Befragung (v.a. zur Tatsachenermittlung), Experiment (v.a. zur Hypothesenprüfung).
Sekundärforschung: Beschaffung, Zusammenstellung und Analyse bereits vorhandenen Materials. b) Klassifikation nach der Art des Untersuchungsobjekts (nach K. Ch. Behrens): demoskopische Marktforschung (empirisch und subjektbezogen):
Ermittlung der mit den Marktteilnehmern (Produzenten, Händlern, Konsumenten) untrennbar verbundenen Tatbestände objektiver Art wie Alter, Geschlecht und Beruf sowie subjektiver Art wie Einstellungen, Meinungen und Bedürfnisse/Motive.
ökoskopische Marktforschung (empirisch und objektbezogen): Erfassung der objektiven, von den Marktteilnehmern losgelösten Marktgrößen wie Umsätze,
Nachfrage, Angebot, Preisbildung (Resultat der Handlungen der Marktteilnehmer) (Meffert, 1992, S. 177). 1.2 Gegenstände der demoskopischen Marktforschung Tatsachen (facts) - Handlungen (Käufe) objektive - soziodemographische Merkmale (Alter, Beruf, Einkommen) Sachverhalte

5
- Wissen (z.B. um die Existenz einer Marke) - Wahrnehmungen (z.B. einer Werbebotschaft) Meinungen - Vorstellungen, Assoziationen (Imageforschung) - Einstellungen, Ansichten (Meinungen i.e.S.), Erwartungen subjektive - Absichten Sachverhalte - Wünsche Motive (das, was "hinter" den Meinungen und Handlungen steht) - Motive i.e.S. - Emotionen - Werte Zur Erhebung der Daten bedient sich die demoskopische Marktforschung im wesentlichen dreier Methoden: (1) Befragung, (2) Beobachtung, (3) Befragung und Beobachtung nach experimentel-len Grundsätzen (Behrens, 1966, S.13 ff.). 1.3 Entstehung der demoskopischen Marktforschung Geburtsstunde in den USA: 1911 erste Marktforschungsabteilung (durch Charles Coolidge Parlin bei der Curtis Publishing Company), Konsumentenbefragung. Drei Entwicklungsphasen der Demoskopie: 1. Periode der originären, nicht repräsentativen, nicht psychologisch fundierten Datenermittlung 2. Periode der originären und repräsentativen, aber nicht psychologisch fundierten Datenermitt-lung 3. Periode der originären, repräsentativen und psychologisch fundierten Datenermittlung zu 1. Phase der originären, nicht repräsentativen, nicht psychologisch fundierten Daten-ermittlung Am Anfang stand die Erkenntnis, daß es nötig sei, Informationen originär bei den Sozialsub-jekten (für uns Marktsubjekte) einzuholen. - Beginn: Anfang des 19. Jh., Kameralistik - politische Arithmetik ("Soziale Physik", Quetelet
1835; Moralstatistik, Durkheim 1897); - in Deutschland: Ende des 19. Jh. erste empirische Studien durch den Verein für Socialpolitik
(Alfred Weber/Max Weber). - 1911: erste demoskopische Markterhebungen (USA).

6
Das theoretische Erhebungsmodell war jedoch noch primitiv: Bis Anfang der 30er Jahre bestand die Vorstellung, je größer die Untersuchungsgruppe, desto besser die Resultate --> Massenbe-fragung.

7
zu 2. Phase der originären, repräsentativen, aber nicht psychologisch fundierten Daten-ermittlung Theoretische Neuorientierung in den 30er Jahren: - Anwendung der Stichprobentheorie: Ermittlung einer repräsentativen Stichprobe durch
Zufallsauswahl. Entscheidend ist Auswahlmechanismus (Urnenmodell, Random-Sample), Stichprobenumfang ist variable Größe. Theoretische Fundierung: Wahrscheinlichkeitstheorie
- 1936 Präsidentschaftswahl in den USA: "Literary Digest" befragt 2 Mio. Amerikaner (v.a. Telefon- und Autobesitzer): Prognose des Wahlsieges des Republikaners Landon; Gallup befragt repräsentative Stichprobe von ca. 3000 Personen und prognostiziert den Wahlsieg des Demokraten Roosevelt --> Ergebnis: Sieg Roosevelts.
Demoskopische Marktforschung erfährt entscheidenden Auftrieb durch die Möglichkeit der Befragung kleiner repräsentativer Gruppen. zu 3. Phase der originären, repräsentativen und psychologisch fundierten Datenermittlung - bisher: Repräsentativbefragung ohne psychologische Reflexion - direkte Befragungstechniken:
bei Faktenermittlung relativ problemlos, versagt bei "Motivforschung" und allen "heiklen" Themen.
- in der dritten Phase Einbau von indirekten Befragungstechniken, psychologischen Befragungs-techniken; Verwendung von Ergebnissen psychologischer Persönlichkeitsforschung
- Ergänzung der Befragung durch (psychologisch fundierte) Beobachtung und Experiment (Behrens, 1966, S.29 ff.). Daher heute Methoden der demoskopischen Marktforschung in zwei Problemkreise eingeteilt: A) Methoden zur repräsentativen Auswahl der Untersuchungspersonen (Merkmalsträger) =
Auswahlmethoden B) Methoden zur psychologisch fundierten Erhebung der Untersuchungsgegenstände (Merk-
male) = Erhebungsmethoden In jeder methodisch befriedigenden demoskopischen Marktuntersuchung daher notwendig: A) fundierte Kenntnis der Auswahltechniken --> Stichprobentheorie u. -techniken --> Quotenauswahl --> Panelerhebung B) fundierte Kenntnis der Erhebungstechniken --> Interviewtechniken (Erstellung von Fragebögen) --> Beobachtungstechniken --> Experiment

8
2 Methodologische Grundlagen der empirischen Sozial- und Wirt-
schaftsforschung (sozialökonomische Forschung) 2.1 Grundfragen der empirischen Sozialforschung Abbildung 1: Grundfragen der empirischen Sozialforschung Was soll Warum soll erfaßt werden ? erfaßt werden ? Wie soll erfaßt werden ? (Atteslander, 1991, S.15) Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen. Empirisch bedeutet, daß theoretisch formulierte Annahmen an spezifischen Wirklichkeiten überprüft werden. Systematisch weist darauf hin, daß dies nach Regeln vor sich gehen muß (Atteslander, 1991, S.16). 2.2 Methodologie - Methode Methodologie: Bezeichnung für die Lehre von den Methoden. Methoden (altgriech. methodos= nachgehen): mittelbare Systeme von Regeln, die von Akteuren als Handlungspläne zielgerichtet verwendet werden können (Herrmann, 1987, S.33f.). Methodologische Regeln sind Festsetzungen, sie sind gleichsam die Spielregeln des Spiels "empirische Wissenschaft" (Popper, 1989, S.25). Die systematische Analyse der sozialen Wirklichkeit geschieht anhand von vier Methoden, die je nach Forschungsinteresse einzeln oder in Kombination eingesetzt werden (Übersicht 1).

9
Übersicht 1: Gegenstandsbereiche und Methoden empirischer Sozialforschung
soziale Wirklichkeit Produkte menschl. Tätigkeit aktuelles menschl. Verhalten (Bauten, Texte, Bilder etc.) Verhalten in "natürli- Verhalten in vom Forscher chen" Situationen bestimmten Situationen ("Feld") ("Labor") offenes Verhalten Gespräche über... Inhaltsanalyse Beobachtung Befragung Experiment (verändert nach Atteslander, 1991, S.81) 2.3 Begriff und Bedeutung der Theorie in der empirischen Sozial- und Wirtschaftsfor-
schung Nach POPPER besteht die Tätigkeit des wissenschaftlichen Forschens darin, Sätze oder Systeme von Sätzen aufzustellen und systematisch zu überprüfen. In den empirischen Wissenschaften werden insbesondere Hypothesen und Theorien-Systeme an der Erfahrung durch Beobachtung und Experiment überprüft. Die Aufgabe der Forschungslogik ist es, die empirisch wissenschaftli-che Forschungsmethode einer logischen Analyse zu unterziehen (Popper, 1989, S. 3). Erkenntnistheoretische Grundlagen der Theorienbildung - Relativität des Evidenzprozesses: Das Evidenzerlebnis ("Aha- Erlebnis") ist subjektiv und damit noch kein empirischer Beweis. - Begriffsrealismus:

10
Das Gleichsetzen logischer Aussagen (bzw. formaler Modelle) mit Wirklichkeitsaussagen ist unzulässig.
- Werturteilsproblematik: Es ist selbstverständlich und ungefährlich, daß Werturteile (Vitalverhältnisse) darüber ent-
scheiden, ob eine wissenschaftliche Frage gestellt wird. Es ist aber unzulässig, daß Werturteile darüber entscheiden, wie eine wissenschaftliche Frage beantwortet wird.
2.3.1 Grundlagen der Theoriebildung Erfahrungswissenschaften sind Theoriensysteme. Eine Theorie ist ein System von Aussagen bzw. eine Menge logisch miteinander verbundener widerspruchsfreier Hypothesen. Sie enthält eine Reihe unabhängiger Aussagen, aus denen weitere Aussagen mit Hilfe von Regeln abgeleitet werden (Friedrichs, 1990, S.62). Eine Hypothese ist ein mit Begriffen formulierter Satz, der empirisch falsifizierbar ist und an der Erfahrung scheitern können muß (z.B.: "In der Bundesrepublik ist die Arbeitslosenquote bei Personen mit Hochschulabschluß kleiner als bei Personen mit anderen Qualifikationen") (Attes-lander, 1991, S.65). 2.3.2 Entstehung und logischer Aufbau von Theorien in der empirischen Forschung Theorie und Erfahrung - Vier Stufen der empirischen Forschung (nach Claude Bernard) I) Es werden Beobachtungen gemacht II) Abstraktion wesentlicher Elemente als Basis einer Hypothese oder Theorie III) Entwicklung der Hypothese oder Theorie und Voraussage neuer Erkenntnisse bzw. Er-
eignisse IV) Neue Tatsachen werden zur Überprüfung der Voraussagen gesammelt: Beobachtungen II 2.3.2.1 Das Problem der Induktion Der Begriff Induktionsschluß bezeichnet die Ableitung von allgemeinen Sätzen (Theorien, Hypothesen) aus besonderen Sätzen (Beobachtungen, Experimente) (Popper, 1989, S.3). Gemäß den Regeln der Logik ist es jedoch nicht möglich, aus Untersuchungsergebnissen allgemein zutreffende Theorien abzuleiten (Opp, 1987, S.62).

11

12
2.3.2.2 Die Lösung des Induktionsproblems nach POPPER Nach POPPER gibt es keine logische, rationale und nachkonstruierbare Methode, etwas Neues zu entdecken. Jede Entdeckung enthalte ein "irrationales Element", sei "schöpferische Intuition" (Popper, 1989, S.7). Er umgeht das Induktionsproblem, indem er Theorien deduktiv (ableitend) überprüft. Die Methode der kritischen Nachprüfung ist folgende: Aus einem vorläufig unbegrün-deten Einfall, einer Hypothese oder einem theoretischen System werden auf logisch-deduktivem Weg Folgerungen abgeleitet. Diese werden untereinander und mit anderen Sätzen verglichen, indem man feststellt, welche logischen Beziehungen zwischen ihnen bestehen (Popper, 1989, S.7). Die "empirische Anwendung" der abgeleiteten Folgerungen ist eine mögliche Methode zur deduktiven Überprüfung: - Aus dem theoretischen System werden empirisch möglichst leicht nachprüfbare bzw. anwend-
bare singuläre Folgerungen ("Prognosen") deduziert. - Diese Folgerungen werden durch praktische Anwendungen, Beobachtungen oder Experimente
überprüft (fasifiziert oder verifiziert) (Popper, 1989, S.8). 2.3.2.3 Logischer Aufbau von Theorien Schema I: Entstehung einer Theorie T1 H1 H2 H3 P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 Die Denkrichtung geht von den Protokollsätzen (P; Beschreibung einer Beobachtung) zu den Hypothesen (H), die eine Erklärung liefern. Die Hypothesen werden zu allgemeinen Sätzen (T; Theorien) verknüpft. Schema II: Logischer Aufbau einer Theorie T1 H1 H2 H3

13
P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 Aus einer Theorie können die Hypothesen deduktiv abgeleitet werden. Die Protokollsätze ergeben sich durch deduktive Ableitung aus der erklärenden Hypothese. 2.3.2.4 Überprüfung von Theorien an der Erkenntniswirklichkeit Theorien sind niemals empirisch verifizierbar, aus einer verifizierten besonderen Aussage (Protokollsatz, Beobachtung) kann nicht logisch auf eine Theorie geschlossen werden. POPPER erkennt ein solches System empirisch an, das einer Nachprüfung durch die "Erfahrung" standhält, er schlägt die Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium vor: "Ein empirisch wissenschaftliches System muß an der Erfahrung scheitern können" (Popper, 1989, S14f.). Ist eine Hypothese aufgestellt, so werden aus ihr auf deduktivem Wege spezielle Folgerungen (Prognosen) abgeleitet, die möglichst leicht empirisch nachprüfbar sind. Ergibt die empirische Prüfung, daß die Folgerung falsch ist, so ist damit auch die Hypothese falsifiziert (Popper, 1989, S.8). Notwendige und hinreichende Bedingungen für die Falsifikation: - Wir nennen eine Hypothese/Theorie nur dann falsifiziert, wenn wir Protokollsätze anerkannt
haben, die ihr widersprechen. - Die Hypothese/Theorie ist aber erst dann falsifiziert, wenn ein die Hypothese/Theorie widerle-
gender Effekt (Erklärung) gefunden wird. 2.3.3 Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (Thomas S. Kuhn) Kuhns These lautet: Fortschritt in der Wissenschaft vollzieht sich nicht durch kontinuierliche Veränderung, sondern durch revolutionäre Prozesse; ein bisher geltendes Erklärungsmodell wird verworfen und durch ein anderes ersetzt. Diesen Vorgang bezeichnet sein berühmt gewordener Terminus “ Paradigmenwechsel”. Unter “Paradigma” versteht Kuhn “die ganze Konstellation von Meinungen, Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden.” Diese “Paradigmata” geraten von Zeit zu Zeit durch neue wissenschaftliche Entdeckungen in eine Krise. Alte und neue Konstellationen stehen in Auseinandersetzung, bis sich das neue Paradigma durchgesetzt hat.

14
Quelle: Thomas S. KUHN, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (suhrkamp taschenbuchwissenschaft 25) Frankfurt/Main, 1989. 3 Erhebungsmethoden der Primärforschung Die Überprüfung von Hypothesen erfolgt in der empirischen Markt- und Sozialforschung mittels dreier Methoden: - direkte und indirekte Beobachtung - Experiment - mündliche und schriftliche Befragung (Salcher, 1978, S.24). Die Befragung stellt hierbei die wichtigste Methode dar. 3.1 Beobachtung Unter (wissenschaftlicher) Beobachtung wird die zielgerichtete und planmäßige Erfassung wahrnehmbarer Sachverhalte (z.B. sichtbares Verhalten bzw. Sortimentsbestände) durch Perso-nen und/oder Geräte verstanden. Formen der Beobachtung - verdeckt oder offen (Beobachter als solcher erkennbar?) - teilnehmend oder nicht-teilnehmend (Beobachter an Interaktionen beteiligt?) - systematisch oder unsystematisch (Beobachtung mit systematischem Schema?) - Feld- oder Laborbeobachtung - Selbst- oder Fremdbeobachtung (Friedrichs, 1990, S.273) Anwendung der Beobachtung in der Primärforschung - systematische Erforschung der Ereignisse und Veränderungen im jeweiligen Absatzmarkt
(Messung von Erfolgskennzahlen, Beobachtung von Handelsmaßnahmen) - Erfassung non-verbaler Verhaltensweisen (Gestik, Mimik, Laufverhalten von Kunden) - Erforschung komplexer Zusammenhänge, wie Leseverhalten, Einkaufsverhalten,
Verwendungsverhalten bei bestimmten Produkten, Verhalten des Verkaufspersonals (Meffert, 1992, S.200f.) Beurteilung der Beobachtung als Methode der Primärforschung - Beschränkung auf äußerlich registrierbare, "objektive" Tatbestände. Meinungen, Einstellungen
und Motive können nicht erfaßt werden.

15
- Ermittlung der Ursache für beobachtetes Verhalten erfordert zusätzliche Befragung. - Abläufe können nur zum Zeitpunkt des Auftretens beobachtet werden, Veränderungen erfor-
dern mindestens zwei Beobachtungen. - Unabhängigkeit von der Auskunftsbereitschaft der Versuchsperson - Problem des Interviewereinflusses entfällt. (Salcher, 1978, S.88ff.). 3.2 Experiment Ein Experiment ist eine wiederholbare, unter kontrollierten, vorher festgelegten Umweltbedin-gungen (Kontrolle der Störvariablen) durchgeführte Versuchsanordnung. Diese gestattet es, mit Hilfe der Messung der Wirkungen eines oder mehrerer unabhängiger Faktoren auf die jeweilige abhängige Variable (aktive Manipulation der unabhängigen Variablen), aufgestellte Hypothesen empirisch zu überprüfen (Meffert, 1992, S.207). Ein Experiment dient also der Aufdeckung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen (Kausalzusammenhänge). Formen des Experiments - Feldexperiment oder Laborexperiment - projektives Experiment (experimentelle Bedingungen werden vom Forscher konstruiert) oder
"Ex-post-facto-Experiment" (experimentelle Bedingungen sind selbst zustande gekommen; Analyse bereits vorhandenen Materials/bestehender Sachverhalte).
Versuchsanordnungen - Zeitpunkt der Messung (vor oder nach der Manipulation): B = before A = after - Versuchsgruppen: E = experimental group C = control group - Mögliche Anordnungen: EBA oder EA - CA oder EB - CA oder EBA - CBA Anwendungsbeispiele - Überprüfung der Wirkung verschiedener Produktgestaltungen auf die Produkteinschätzung
seitens der Verbraucher - Wirkungen verschiedener Preise oder Plazierungen auf den Abverkauf eines Produkts - Überprüfung des Einflusses verschiedener Werbemittel auf die Markenerinnerung (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.151). Beurteilung des Experiments in der Primärforschung

16
- i.d.R. können nur kurzfristige Wirkungen gemessen werden (Problem der Kontrolle von Einflußfaktoren)
- kostenintensiv - geeignet zur unmittelbaren Aufdeckung von Kausalzusammenhängen (Meffert, 1992, S.206-
ff.). 3.3 Befragung Bei der Befragung wird der Befragte entweder aufgefordert, über ihm bekannte Tatsachen Auskunft zu erteilen oder seine Meinung zu Tatbeständen zu äußern, bei denen er zu einer Äußerung fähig scheint (Schäfer, Knoblich, 1978, S.248). Elemente der Befragung - Befragter (Einzelperson, Experten, Haushalte als Gruppen) - Befragungsgegenstand (Ein-Themen-Befragung oder Mehr-Themen- bzw. Omnibus-
Befragung) - Kommunikationsart (mündlich, schriftlich, telefonisch) - Standardisierungsgrad (Formulierung, Zahl und Reihenfolge der Fragen festgelegt oder nur
Thema vorgegeben) - Befragungshäufigkeit (mehrmalige Befragung des gleichen Personenkreises zu einem Unter-
suchungsgegenstand = Panel) Formen der Befragung siehe hierzu Übersicht 2 3.3.1 Standardisiertes/strukturiertes Interview: Charakterisierung Ein Interview ist dann strukturiert, wenn die Befragung mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführt wird, der Inhalt, Anzahl und Reihenfolge der Fragen festlegt. Als standardisiert wird ein Interview bezeichnet, bei dem Antwortkategorien verwendet werden. Hauptzweck der Strukturie-rung bzw. Standardisierung ist eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Interviewer-gebnisse (Atteslander, Kopp, 1987, S.150ff.). Aufbau des Fragebogens Der Aufbau des Fragebogens wird von vier Fragegruppen geprägt:

17
- Einleitungs-, Kontakt-, Eisbrecherfragen (sollen den Auskunftspersonen die Befangenheit nehmen und Aufgeschlossenheit für das Interview herbeiführen)
- Sachfragen (bilden den Hauptteil und beziehen sich auf den eigentlichen Untersuchungsgegen-stand)
- Kontrollfragen (dienen der Überprüfung der Befragtenauskünfte auf Konsistenz, Kontrolle der Interviewer)
- Fragen zur Person (meist am Ende des Interviews, Erfassung soziodemographischer und ökonomischer Merkmale).
Der Aufbau des Fragebogens erfolgt nach logischen und psychologischen Gesichtspunkten. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: - Motivation des Befragten (Eisbrecherfrage) - Förderung der Aussagewilligkeit (Abwechslung) - Vermeidung von Ausstrahlungseffekten (Präsenz-, Konsistenz-, Lerneffekte, Fragebeantwor-
tung wird durch andere Fragen des Fragebogens beeinflußt) (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.99f.).
Quelle : verändert nach Atteslander , 1991 , S. 159
Übersicht 2: Formen der Befragung

18
Frageformen 1) Offene und geschlossene Fragen: offene: keine Vorgabe von Antwortkategorien; Kategorisierung der möglichst wörtlich
festgehaltenen Antworten erfolgt nachträglich (Erinnerung/Recall) geschlossen: Vorgabe von Antwortkategorien (Ja-Nein-Fragen, Skala-Fragen, Alternativfragen;
Wiedererkennung/Recognition) 2) Direkte und indirekte Fragen direkte: v.a. Wissensfragen, Fragen nach Sachverhalten indirekte: v.a. bei tabuisierten oder durch Status- oder Prestigedenken beeinflußten Themen (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.95ff.). Klassifizierung von Fragen - Wissenfragen (Wissen über nachprüfbare Fakten wird ermittelt) - Faktfragen (Fragen nach überprüfbaren Tatsachen) - Soziodemographische Fragen (Fragen nach Alter, Geschlecht, Beruf...) - Einschätzungsfragen (z.B. Welche Schokolade ist süßer, die Marke A oder B?) - Bewertungsfragen (Frage nach Werturteil, z.B. Wie schmeckt Ihnen die Schokolade der Marke
D?) - Einstellungsfragen - Statement-Batterien - Filterfragen - Fragen, bei denen Rangordnungen gebildet oder Intensitäten angegeben werden müssen - Handlungsfragen (Fragen nach dem Handeln der Befragten) (Holm, 1975, S.32ff.) Faustregeln bei der Formulierung von Fragen - einfach, kurz, konkret - keine Fremdworte, Abkürzungen oder Slangausdrücke - neutrale Formulierungen (ohne Wertung) - keine Suggestivfragen - keine doppelten Verneinungen - keine hypothetisch formulierten Fragen - nur ein Sachverhalt pro Frage - Ausgewogenheit der Antwortvorgaben (positive und negative Aspekte)

19
(Atteslander, 1991, S.192f.). Vorbereitungsphase: Die Geburt des standardisierten Fragebogens Die Fragebogenkonferenz:
Teilnehmer: Personen möglichst unterschiedlicher Fachrichtungen Beratungsablauf: Besprechung des Untersuchungsplanes, Skizzierung der Fragenvorschläge, Beratung der Entwurfsplanung
Vortest: Verwendung der freieren Interviewformen, Durchführung durch Fachleute
Das Meßniveau von Fragen (1) Die ordinale Frage: Die Frage ist so formuliert, daß die Antworten Rangzahlen zugeordnet werden können.
Rangzahlen ergeben Ordinalskalen. (2) Die quantitative Frage:
Die Frage wird so formuliert, daß die Antworten auf metrischen Skalen aufgetragen werden können. Wir unterscheiden zwischen Intervallskalen und Ratioskalen. Intervallskalen haben keinen Nullpunkt, Ratioskalen haben einen natürlichen Nullpunkt.
Interviewer: Organisation und Feldarbeit “Nicht der Interviewer sondern der Fragebogen muß schlau sein.” (NOELLE-NEUMANN)
(1) Stichworte zum Interviewer: − sorgfältige Auswahl, gründliche Schulung − Idealbild: der kontaktfreudige Pedant
(2)Die Interviewerorganisation muß den Interviewereinfluß neutralisieren. (3)Besonderheiten des Telefoninterviewers:

20
− sympathische, klare Stimme − gutes Hörverständnis − hohe Konzentrationsfähigkeit

21
Methoden der demoskopischen Marktforschung Befragung, standardisiertes Interview, Programmfrage-Testfrage: Programmfrage: “Betrachten Sie (befragte Hausfrau) die Bezeichnung “Zöpfli” als Hersteller-
Hinweis oder als Gattungsbegriff ?” Übersetzung der Programmfrage in Testfragen: (1) Interviewer überreicht Bildblatt “ZÖPFLI”:
“Hier steht “ZÖPFLI”-es handelt sich um eine Ware. Haben Sie davon schon einmal gehört oder gelesen?” Vorgegebene Antworten: Ja/Nein, noch nie.
(2) Falls Ja: “Wissen Sie, um was für eine Ware es sich handelt?” Vorgegebene Antworten: Ja, und zwar: (Raum für wörtliches Notieren der Antwort) / Unmöglich zu sagen.
(3) Falls Angabe gemacht wurde:
“Glauben Sie, daß “ZÖPFLI” von einer ganz bestimmten Firma oder von verschiedenen Firmen hergestellt werden?” Vorgegebene Antworten: Von einer bestimmten Firma / von verschiedenen Firmen / Weiß nicht.
(4) Falls von einer bestimmten Firma: “Und wie heißt diese Firma?” (Raum für wörtliches Notieren der Antwort)
Quelle: E. NOELLE, Umfragen in der Massengesellschaft, S. 54 f.

22
3.4 Panelerhebungen Panelerhebungen sind Untersuchungen, die bei einem bestimmten gleichbleibenden Kreis von Untersuchungseinheiten (Personen, Haushalte, Einkaufstätten, Unternehmen) in (regelmäßigen) zeitlichen Abständen wiederholt zum gleichen Untersuchungsgegenstand durchgeführt werden (Meffert, 1992, S.213). Ziel eines Panels ist die Erforschung von Markt- bzw. Verhaltensänderungen im Zeitablauf. Außer einer deskriptiven Erfassung von Wechselvorgängen sollen mit Hilfe von Panels Ver-änderungen erklärt und aufbauend eine weitere Entwicklung prognostiziert werden. Je nach Untersuchungseinheiten wird zwischen Handels-, Unternehmer- und Verbraucherpanel unterschieden (Meffert, 1992, S.214). Übersicht 3: Basis- und Sonderformen der Panelerhebung

23
Quelle : Meffert, 1992, S. 214 3.4.1 Verbraucherpanel Die Durchführung eines Verbraucherpanels erfordert eine aktive Beteiligung der Teilnehmer (z.B. Ausfüllen von Fragebögen, Führen von Ausgabenlisten). a) Individualpanel Untersuchungseinheit: Einzelperson Ziel: Gewinnung von Informationen über ausgewählte quantitative (Bedarf) oder qualitative
(Einstellungen) Aspekte des Konsumentenverhaltens. b) Haushaltspanel Untersuchungseinheit: Haushalt Ziel: v.a. Gewinnung von Erkenntnissen über das für den gesamten Haushalt gültige Einkaufs-
verhalten ("Spiegelbild" des Einzelhandelpanels) Im Verbraucherpanel sollen die Teilnehmer z.B. zu Einkaufsort, Packungsgröße und -art sowie Verwendungszweck Buch führen und Angaben zur eigenen Person machen. Aus diesen Ergeb-nissen lassen sich Informationen gewinnen - über den Gesamtmarkt und die Marktteilnehmer - über Unterschiede im Kaufverhalten, z.B. die Abhängigkeit von soziodemographischen Fakto-
ren - über quantitative und qualitative Aspekte des Einkaufsverhaltens (Einkaufshäufigkeit und -zeit,
Markentreue etc.) Die Repräsentanz von Panelinformationen wird jedoch eingeschränkt durch -"Panel-Sterblichkeit": Ausscheiden von Panelteilnehmern (Ortswechsel, Panelermüdung) - Panel-Effekt: ständige (Selbst)Kontrolle führt zu bewußten oder unbewußten Verhaltens-
änderungen bzw. zu falschen Angaben - Panel-Erstarrung: Veränderung soziodemographischer Merkmale in Zeitablauf (Familienstand,
Alter) Beispiele: G & J- Verbraucherpanel, GfK- Verbraucherpanel (Meffert, 1992, S.213ff.).

24

25
3.4.2 Handelspanel - Informationsgewinnung erfolgt v.a. durch Beobachtung - Untersuchungseinheiten: Großhandels- und Einzelhandelsbetriebe verschiedener Handels-
segmente - Bildung repräsentativer Stichproben, meist nach dem Quotenverfahren ermittelt (nach Betriebs-
typ, Organisationsform, Standort (Nielsen-Gebiete)) - Panelinformationen betreffen die Entwicklung von Warenbewegungen und Lagerbeständen der
in das Panel einbezogenen Handelsgeschäfte und Produkte. Aus den Ergebnissen des Handelspanels ergeben sich folgende marketing-relevante Informatio-nen: - Entwicklung des Umsatzes, Umschlagsgeschwindigkeit, Distributionsgrad - Ermittlung von Kennzahlen (Marktpreise, Lagerbestände) für verschiedene Warengruppen,
Marken, Sorten, Regionen - Spezialuntersuchungen zur Messung von Aktionserfolgen werden möglich. - Hersteller können auf Effizienz ihrer Außendienstmitarbeiter schließen, die Entwicklung von
Neuprodukteinführungen beobachten etc. Die Repräsentativität der Panelinformationen wird durch das Problem der Marktabdeckung beeinflußt, das dadurch entsteht, daß bestimmte Betriebsformen, wie Versandhandel und Waren-haus sowie bestimme Handelsunternehmen wie Aldi ihre Teilnahme verweigern. Beispiele: Nielsen-LEH-Index, GfK-Basispanel, GfK-Leader-Panel (Meffert, 1992, S.217ff.). 3.4.3 Telefonische Befragung 3.4.3.1 Die Bedeutung telefonischer Umfragen Entwicklung in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland Gründe für die steigende Bedeutung telefonischer Umfragen: - zunehmende Telefondichte - Probleme bei persönlichen Interviews (steigende Verweigerungsraten, schlechtere Erreich-
barkeit)

26
- technische Entwicklungen (C.A.T.I.) - steigender Bedarf an schnellen Umfragen 3.4.3.2 Bestimmungsgründe der Datenqualität Qualität der Stichprobe Einflußgrößen: - Telefondichte - Struktur der Telefonbesitzer bzw. Nicht-Besitzer (demographische Unterschiede bzgl. Alter, sozialer S- Verfahren der Stichprobenziehung (Telefonbuch, RDD = random digit dialing) - Ausschöpfung der Stichprobe Fragebogengestaltung Besonderheiten bei der Konstruktion des Fragebogens: - hohe Bedeutung der Einleitung und der ersten Fragen - Gewährleistung des "Fragenflusses" - Gestaltung "kritischer" Fragentypen: Auswahlfragen, Rangreihenfolgen, Skalenfragen, Einsatz
von Hilfsmittel - Vermeidung längerer Pausen - begrenzte Länge des Fragebogens Ablauf des Interviews - verändertes Antwortverhalten des Befragten (Einfluß des Frageninhalts und -typs) - Antwortverzerrungen (Interviewereinfluß - Einfluß durch Dritte) Beurteilung der Telefonbefragung - Befragte sind rel. schnell erreichbar - rel. geringe Kosten (v.a. bei regionalen Umfragen) - direktes Gespräch ermöglicht beiderseitige Rückfragen - i.d.R. nur vergleichsweise kurze Interviews möglich - keine Registrierung non-verbaler Reaktionen möglich - keine Befragungsunterlagen wie Bilder, Skalierungsunterlagen etc. verwendbar - keine gleichzeitige Registrierung situativer Informationen möglich (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.110).

27
3.4.3.3 Computerunterstützte Telefoninterviews (C.A.T.I. = computer-assisted telephone interviewing) Vorteile: - zentrale Durchführung - Kontrolle der Gesprächsführung - exakte Filterführung - Verminderung von Plazierungseffekten - sofortige Datenüberprüfung - fehlerfreie Datenerfassung - schnelle Verfügbarkeit der Ergebnisse - automatische Ablaufsteuerung (Generierung und Auswahl von Telefonnummern, Termin-
planung) - verbesserte Situation für den Interviewer Einflußfaktoren auf die Kosten: - Zielgruppe - Stichprobenverfahren und Umfang der Stichprobe - max. Anzahl der Wiederholungskontakte - Dauer der Feldzeit - Dauer des Interviews - Anteil offener Fragen - Art der Ergebnislieferung 4 Das Einstellungskonzept in der Marktforschung 4.1 Grundlagen der Einstellungstheorie 4.1.1 Der Einstellungsbegriff Verschiedene Definitionen:

28
- Eine Einstellung ist ein "innerer Bereitschaftszustand/innere Haltung des Individuums, gegen-über bestimmten Reizen relativ fest gefügte/stabile positive oder negative Reaktionen zu zeigen" (Bänsch, 1989, S.32).
- Nach KROEBER-RIEL ist eine Einstellung die "subjektiv wahrgenommene Eignung eines Gegenstandes zur Befriedigung einer Motivation". Seine Arbeitsdefinition lautet: Einstellung = Motivation + kognitive Gegenstandsbeurteilung (Kroeber-Riel, 1992, S.53).
4.1.2 Einstellung und Verhalten Nach der Drei-Komponenten-Theorie umfassen Einstellungen - eine affektive (emotionale) Komponente (positive/negative Gefühle gegenüber einem Ein-
stellungsgegenstand) - eine kognitive Komponente (Wahrnehmung, Wissen, Meinungen, Überzeugungen) - eine konative Komponente (Verhaltenskomponente) Kennzeichnend für Einstellungen ist die Konsistenz von Fühlen, Denken und Handeln (Triandis, 1975, S.11). Die verhaltensantreibende und verhaltenssteuernde Wirkung der Einstellung ist Grundlage der EINSTELLUNGS - VERHALTENS - HYPOTHESE (E-V-HYPOTHESE) d.h. Einstellungen bestimmen das Verhalten. Da jedoch in Untersuchungen immer häufiger eine umgekehrte Beziehung bzw. Wechselwirkungen zwischen Einstellungen und Verhalten festge-stellt werden, wird die Hypothese in dieser Form zunehmend kritisiert. Die Einwände zur Gültigkeit der E-V-Hypothese faßt KROEBER-RIEL wie folgt zusammen: "Vergleicht man die positiven Belege für die E-V-Hypothese und die "Gegenbeweise", so kommt man zu dem Ergebnis, daß die E-V-Beziehung durchaus eine tragfähige Hypothese für die Erklärung und Prognose des Verhaltens ist. Allerdings muß man sich durchschnittlich mit schwachen bis mittelstarken E-V-Beziehungen abfinden." Er schlägt deshalb vor, der Hypothese den Zusatz "unter bestimmten Bedingungen" hinzuzufügen (Kroeber-Riel, 1992, S.164ff.). Auf eine enge Beziehung kann um so eher geschlossen werden, wenn die gemessene Einstellung - möglichst situationsbezogen ist, - eine hohe Intensität aufweist, - von möglichst zentraler Bedeutung ist, - eine hohe zeitliche Stabilität besitzt (Besch, 1980, S.483f.).

29
Schematische Darstellung der Faktoren
des Käuferverhaltens
Quelle: Bänsch, 1989, S.4 4.2 Messung von Einstellungen

30
Da es sich bei Einstellungen um nicht beobachtbare psychische Größen (theoretische Konstrukte) handelt, müssen meßbare (empirische) Größen (= Indikatoren) gesucht werden, die anzeigen, ob eine bestimmte Einstellung vorliegt. Je nach Art des Indikators lassen sich die Verfahren zur Einstellungsmessung drei Gruppen zuordnen: 1. Psychobiologische Meßverfahren (z.B. Pulsfrequenz) 2. Beobachtung 3. Subjektive Erfahrungen (z.B. Befragungen) (Kroeber-Riel, 1992, 182ff.) In der praktischen Marktforschung werden Einstellungen meist über Befragungen unter Ver-wendung von standardisierten Skalen gemessen. 4.2.1 Skalenniveaus (Meßniveaus) Übersicht 4: Skalenniveaus - Kennzeichen und Anwendung
Skala Merkmale mögl. rechneri-sche Handhabung
Beispiele
nicht metrische Skalen
Nominalskala Klassifizierung qualitativer Eigenschafts-ausprägungen
Bildung von Häufigkeiten
Geschlecht, Religion
Ordinalskala Rangwert mit Ordinalzahlen, keine Aussage über Abstände
Ermittlung des Median
Rangordnun-gen, Beliebt-heit verschie-dener Marken
metrische Skalen
Intervallskala gleichgroße Skalenabschnit-te, ohne natürli-chem Nullpunkt
Addition und Subtraktion
Thermometer
Ratioskala gleichgroße Skalenabschnit-te, mit natürli-chem Nullpunkt
Addition Sub-traktion, Division, Multiplikation
Körpergröße, Preis
Quelle: nach Backhaus et al., 1993, S.XV 4.2.2 Skalenformen

31
Die gebräuchlichsten Formen sind: - numerische Skalen: Skalenstufen werden mit Zahlen bezeichnet, Pole verbal; in der Markt-
forschung üblich: 4er-, 6er- und 7er Skalen - verbale Skalen: alle Skalenpunkte verbal benannt; z.B. trifft nicht zu - trifft ein bißchen
zu - trifft überwiegend zu - trifft ganz genau zu - graphische Skalen: graph. Verdeutlichung der Skalenabstände, z.B. größer werdende Kreise - unipolare oder bipolare Skalen: bipolar: Benennung der Skalenenden mit unterschiedlichen Begriffen: gut
- schlecht, jung - alt unipolar: alt - nicht alt, gut - nicht gut - abgestufte oder kontinuierliche Skalen: abgestuft: Untergliederung in gleich weit voneinander entfernte Skalen-
punkte kontinuierlich: nur Endpunkte festgelegt (Salcher, 1978, S.96ff.) 4.2.3 Skalierungsverfahren Eindimensionale Skalierungsverfahren: Mittels eindimensionaler Skalierungsverfahren wird versucht, eine der Komponenten der Einstellung mittels geeigneter Indikatoren zu operationalisieren. Verfahren hierzu sind: - die Methode der summierten Einschätzungen nach LIKERT: affektive Komponente;
Einstellungen werden als ablehnende oder zustimmende Haltung zu einem Objekt ermittelt - die Methode der gleich erscheinenden Intervalle nach THURSTONE: affektive Komponente - die Skalogramm-Analyse nach GUTTMAN: konative Komponente Mehrdimensionale Skalierungsverfahren Mittels mehrdimensionaler Skalierungsverfahren sollen subjektive Umwelteindrücke ermittelt werden. Zu den wichtigsten mehrdimensionalen Skalierungsverfahren gehören: - das Semantische Differential von OSGOOD (Polaritätsprofil): Dieses Verfahren ist den sog.
Assoziationsverfahren zuzuordnen. Hierbei wird der befragten Person zu einem Begriff oder Gegenstand eine Vielzahl von Eigenschafts-Gegensatzpaaren in Form von Adjektiven vor-

32
gelegt, die zum Befragungsobjekt mehr einen assoziativen als einen sachlichen Bezug haben.
Der Befragte soll dann den Grad der Assoziation angeben, die er bei der Verknüpfung des Stimulus
mit dem jeweiligen Eigenschaftspaar verbindet. Zur Auswertung des Semantischen Differentials bietet sich eine graphische Veranschaulichung an.
- das Modell von FISHBEIN - das Modell von TROMMSDORFF Die Modelle von FISHBEIN und TROMMSDORFF gehören zu den sog. Multiattributmodel-
len. Ziel dieser Modelle ist es zu zeigen, wie sich die Einstellung einer Person gegenüber einem Objekt aus den differenzierten Vorstellungen dieser Person über dieses Objekt erklären läßt. Es wird also nicht nur ermittelt, wie positiv oder negativ die Einstellung ist, sondern auch ihre Struktur (Müller-Hagedorn, 1986, S.182). Die Messung bezieht sich auf konkrete Merkmale des Untersuchungsobjekts. Multiattributmodelle sind zwar genauer als z.B. das semantische Differential, aber i.d.R. auch wesentlich aufwendiger.
4.3 Entwicklung eines Testinstruments zur Messung von Einstellungen Die Entwicklung erfolgt in der Regel in zwei Schritten: 1. Schritt: Erstellung eines umfangreichen Item-Pools. Empfehlung zur Sammlung: - Sichtung und Analyse vorliegender Marktuntersuchungen - Gruppenexploration, Tiefeninterviews - Gespräche mit Experten Bei der Item-Formulierung ist zu beachten, daß - die Items eindimensional formuliert sind, - die Items nicht zu ähnlich formuliert sind, - die Items klar positiv oder negativ sind (keine doppelte Negation), - in etwa gleich viele positive und negative Items zu jedem relevanten Einstellungsbereich
vorhanden sind. 2. Schritt: Reduktion des Item-Pools Eine möglichst geringe Anzahl von Items soll ein Maximum an Informationen liefern.

33
1. Stufe: Semantische Reduktion gleichlautende, inhaltlich nicht verschiedene Items werden ausgeschieden 2. Stufe: Dimensionale Selektion alle Einstellungsbereiche sollen möglichst gleichmäßig vertreten sein 3. Stufe: Testtheoretische Reduktion Durchführung eines Pretests an einer begrenzten Anzahl von Personen; anschließende Reduktion nach den Kriterien - Trennschärfe - Schwierigkeitsgrad - Eindimensionalität
Quelle: in Anlehnung an KROEBER-RIEL, 1984 ,S. 183

34
5 Grundlagen der Stichprobentheorie 5.1 Begriffsdefinition Definition Eine Stichprobe (sample) ist ein nach einem besonderen Verfahren ausgewählter Teil einer Grundgesamtheit. Eine Grundgesamtheit ist eine statistische Masse von Merkmalsträgern, die sachlich, zeitlich und räumlich genau abgegrenzt ist. Wird jedes einzelne Element auf die interessierenden Mermale untersucht, handelt es sich um eine Vollerhebung (Totalerhebung). Aus finanziellen, zeitlichen und organisatorischen Gründen wird jedoch meistens nur ein Teil der Grundgesamtheit (= Stichprobe) untersucht (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.47). Aus den Ergebnissen der Stichprobenuntersuchung sollen Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen werden (Repräsentationsschluß). Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die unter-suchte Teilmasse repräsentativ für die Grundgesamtheit ist, d.h. wenn sie ein verkleinertes, aber wirklichkeitsgetreues Abbild der Grundgesamtheit darstellt. Zur Auswahl der Stichprobe (n) aus der Grundgesamtheit (GG) stehen zwei Gruppen von Verfahren zur Verfügung: 1) Zufallsauswahl Die Selektion der Untersuchungseinheiten erfolgt durch einen Zufallsprozeß, wobei jedes
Element der GG mit einer berechenbaren, von Null verschiedenen Wahrscheinlichkeit in die Stichprobe gelangen kann. Auch der Stichprobenfehler (Zufallsfehler) ist berechenbar.
Verfahren der Zufallsauswahl (Random-Verfahren): - einfache Zufallsauswahl - geschichtete Zufallsauswahl - Klumpenauswahl - mehrstufige Auswahlverfahren 2) Bewußte Auswahl

35
Die Stichprobe wird konstruiert und die Auswahl der zu untersuchenden Elemente nach sachrelevanten Merkmalen vorgenommen.
Verfahren der bewußten Auswahl: - Quotenverfahren - Konzentrationsverfahren (bewußte Konzentration auf bestimmte Elemente der GG) Sonderform: Auswahl aufs Geratewohl (nicht repräsentativ!) (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.48ff.; Meffert, 1992, S.189ff.) 5.2 Fragestellung der Stichprobentheorie In der Praxis wird die Stichprobe häufig nach der uneingeschränkten Zufallsauswahl bestimmt. Dabei hat jedes Element der GG die gleiche Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe zu gelangen. Die Ableitung der Stichprobenverteilung erfolgt mit Hilfe von Urnenmodellen. Je nach zu untersuchendem Merkmal wird unterschieden zwischen dem Urnenmodell für ein dichotomes Merkmal und dem Urnenmodell für ein metrisch skaliertes Merkmal. - Dichotomer oder auch homograder Fall bedeutet, es liegt ein nominal-skaliertes Merkmal mit
zwei Ausprägungen vor (z.B. berufstätig - nicht berufstätig, Geschlecht etc.). - Bei der heterograden Fragestellung wird dagegen ein metrisch skaliertes Merkmal untersucht (quantitative Merkmale, wie z.B. Alter, Betriebsgröße etc.). 1) Urnenmodell für ein dichotomes Merkmal (homograder Fall) Die N Elemente der Grundgesamtheit werden durch N Kugeln (weiß und schwarz) in einer
Urne dargestellt. Die M Elemente der GG, die das zu untersuchende Merkmal aufweisen, werden dabei durch die M schwarzen Kugeln symbolisiert. Die weißen Kugeln (= N-M) weisen das Merkmal nicht auf.
Die Stichprobenziehung vom Umfang n entspricht somit einer Ziehung von n Kugeln aus einer
Urne mit N Kugeln. Der Anteil P der schwarzen Kugeln in der Urne beträgt dabei P = M/N. Enthält die Stichprobe m schwarze Kugeln, dann beträgt der Stichprobenanteilswert p = m/n. Der Anteil Q der weißen Kugeln in der GG beträgt entsprechend Q = (N-M)/N, der Stichpro-benanteilswert q = (n-m)/n.

36
2) Urnenmodell für ein metrisch skaliertes Merkmal (heterograder Fall) Die N Elemente der GG werden wiederum durch N Kugeln in einer Urne dargestellt. Den
Kugeln sind die entsprechenden Merkmalswerte Xi (i = 1,...,N) der Elemente der GG (z.B. Betriebsgröße in ha) zugeordnet. Betrachtet man eine Stichprobe vom Umfang n und bezeich-net mit xi den Merkmalswert, der auf der i-ten gezogenen Kugel aufgedruckt ist, dann liefert die Stichprobe eine Folge von n Merkmalswerten xi (i = 1,...,n).
Aus dieser Stichprobe kann das arithmetische Mittel berechnet werden:
xn
xii
n_
= ⋅=∑1
1
Die Stichprobenvarianz s2 ist als ( )sn i
i
n2
1
211
=−
⋅ −=∑ χ χ
definiert. Für die GG ergibt sich als arithmetisches Mittel
µ = ⋅=∑1
1NX i
i
N
und als Varianz 2
1
21σ µ= −=∑N
X i
i
N
( )
Bei der Ableitung der Stichprobenverteilung muß die Entnahmetechnik berücksichtigt werden.
Beim "Ziehen mit Zurücklegen" wird die gezogene Kugel jeweils wieder im die Urne zurück-gelegt, beim "Ziehen ohne Zurücklegen" bleibt sie außerhalb (Bleymüller, Gehlert, Gülicher, 1991, S.71ff.). Die Entnahmetechnik bestimmt die Anzahl aller möglichen voneinander verschiedenen Stichproben.
Mögliche Stichprobenanzahl A) Ziehen mit Zurücklegen (einzelne Elemente können öfter vorkommen): Anzahl sämtlicher möglicher Stichproben: Nn

37
B) Ziehen ohne Zurücklegen a) Anzahl der verschiedenen Reihenfolgen für N-Elemente (Permutation) N! = N(N-1)(N-2)...[N-(N-1)] Bsp.: N = 3 (e1,e2,e3) e1 e2 e3 e2 e1 e3 e3 e1 e2 e1 e3 e2 e2 e3 e1 e3 e2 e1 3! = 3⋅2⋅1 = 6 b) Anzahl der möglichen Kombinationen ohne Wiederholung einzelner Elemente und ohne Berücksichtigung der Anordnung
( )Nn
Nn N n
=
−!
! ! gesprochen: N über n
Bsp.: N = 3 n = 2 e1 e2
e1 e3
32
32 1
3 =
−=!
! !
e2 e3 c) Anzahl der Kombinationen ohne Wiederholung einzelner Elemente und mit Berücksichti- gung der Anordnung (Variation)
NN n
!( )!−
Bsp.: N = 3 (e1,e2,e3) e1 e2 e2 e1 e3 e1 e1 e3 e2 e3 e3 e2 (Bleymüller, Gehlert, Gülicher, 1991, S.51f.) Verteilung der Stichprobenwerte Bei nicht zu kleinen n und N-n verteilen sich die Anteilswerte p und q (im homograden Fall)
bzw. die Mittelwerte x_
(im heterograden Fall) aller möglichen Stichproben angenähert nach einer Gauß'schen Normalverteilung (Ziehung der Stichprobe ohne Zurücklegen).

38
Die Gauß'sche Verteilungsfunktion ist festgelegt durch die Parameter Erwartungswert (Lagepa-
rameter =∧
arithmetischem Mittel) E(X) = µ und die Varianz Var(X) = σ2. Die Fläche unter der Kurve der Normalverteilung entspricht der Gesamtheit aller möglichen Stichprobenmittelwerte. Die Abstände (Flächenstücke) vom Mittelwert lassen sich anhand der Wendepunkte der Verteilung lokalisieren. Zwischen µ-1σ und µ+1σ liegen 68,3%, zwischen µ-2σ und µ+2σ 95,5% und zwischen µ-3σ und µ+3σ 98,7% der Gesamtfläche (Friedrichs, 1990, S136f; Bleymüller, Gehlert, Gülicher, 1991, S.60f.).

39
Darstellung 1: Die Normalverteilungskurve
68,3 % 95,5 %
99,7 % Die Wahrscheinlichkeit, daß ein zufälliger Wert x aus der GG im Intervall [a,b] liegt, ist durch den Flächananteil über [a,b] gegeben. Die Normalverteilungskurve ist im allgemeinen nur für eine Zufallsvariable z mit µ = 0 und σ = 1 tabuliert. Es lassen sich jedoch sämtliche andere Normalverteilungen durch einfache Transformation in die Standardnormalverteilung überführen.
z xi= − µ
σ
Häufig benutzte z-Werte sind: z = ± 1 oder µ ± 1σ = 68,27 % der Gesamtfläche z = ± 1,96 oder µ ± 1,96σ = 95 % der Gesamtfläche z = ± 2 oder µ ± 2σ = 95,45 % der Gesamtfläche z = ± 2,58 oder µ ± 2,58σ = 99 % der Gesamtfläche z = ± 3 oder µ ± 3σ = 99,73 % der Gesamtfläche z = ± 3,29 oder µ ± 3,29σ = 99,9 % der Gesamtfläche (Atteslander, 1991, S.309ff.).
Tangenten an den Wendepunkten

40
Verteilungsgesetze (Heterograder Fall) Beispiel: Eine Grundgesamtheit enthalte N = 5 Personen im Alter von 21, 27, 30, 33 und 39 Jahren; d.h. Xi = 21,27,30,33,39. Das arithmetische Mittel µ beträgt
µ = = + + + + =∑ XN
Jahrei 21 27 30 33 39
530
die Varianz σ2 beträgt
( ) ( ) ( )σχ µ2
2 2 221 305
27 305
36=−
=−
+−
+ =∑ i
NJahre...
√σ2 = σ wird als Standardabweichung (Streuung) bezeichnet. Sie beträgt im Beispiel √36 = 6. Für n = 3 gibt es
( ) ( )Nn
Nn N n
=
=
+ −=
−=
53
53 5 3
10!! !
!! !
mögliche Stichproben.
Nr. der Stich-probe
Einzelwerte (xi) der Stichproben zugehörige Mittel-
werte (x_
)
1 21 27 30 26 2 21 27 33 27 3 21 27 39 29 4 21 30 33 28 5 21 30 39 30 6 21 33 39 31 7 27 30 33 30 8 27 30 39 32 9 27 33 39 33 10 30 33 39 34

41
300
Das arithmetische Mittel aller verschiedenen Stichprobenmittel ist
χχ
µ=
= = =∑ i
Nn
30010
30
Die Übereinstimmung von x und µ gilt allgemein! Lehrsatz: Wenn eine einfache Stichprobe vom Umfang n ohne Zurücklegen aus einer Grund-
gesamtheit von N Elementen gezogen wird, ist der Durchschnitt allerNn
möglichen Stich-
probenmittel gleich dem Durchschnitt der Elemente der Grundgesamtheit.
Der Durchschnitt allerNn
möglichen Stichprobenmittel wird als Erwartungswert von x
bezeichnet. Daraus ergibt sich E x x( ) = = µ (Karg, 1989/90, S.26f). Die Streuung aller möglichen Stichprobenmittel x um den Mittelwert der GG µ ist geringer als die Streuung der Einzelelemente Xi der GG um den Mittelwert µ. D.h. die x gruppieren sich enger um den wahren Mittelwert µ als die Xi.

42
Lehrsatz: Wenn eine einfache Stichprobe vom Umfang n ohne Zurücklegen aus einer Grundgesamtheit mit
N Elementen gezogen wird, ist die Varianz aller Nn
möglichen Stichprobenmittel gegeben
durch die Formel:
x nN nN
22
1σ σ= ⋅ −−
wobei σ2 = Varianz der Elemente der GG N = Anzahl der Elemente der GG n = Anzahl der Elemente in der Stichprobe
Der Quotient aus N nN
−−1
wird als Endlichkeitskorrekturfaktor bezeichnet. Wenn n bezüglich N
genügend klein ist (Faustregel: Auswahlsatz Nn
< 0,05) kann dieser Faktor gleich 1 gesetzt
werden. Für obiges Beispiel gilt: σ 2 36=

43
( )σ
χ µσ σ
xi
xNn
bzwn
N nN
2 22
61
6=−
= = ⋅ −−
=∑ ... ....
Verteilungsgesetze (Homograder Fall) Für den homograden Fall mit P = Anteil der Träger eines bestimmten Merkmals in der GG = M und Q = Anteil der "Nichtmerkmalsträger" in der GG = N-M gilt: Die Varianz der Grundgesamtheit beträgt σ2 = PQ. Das arithmetische Mittel der p-Werte aller
Nn
möglichen Stichproben (Erwartungswert von p; E(p)) ist gleich dem Anteilswert P der
Grundgesamtheit: E (p) = P (gültig nur für eine angenäherte Normalverteilung bei nicht zu kleinem n).

44
Die Streuung aller p Werte ist
p
PQn
N nN
2
1σ = ⋅ −−
(Kellerer, 1963, S.35f.) Ergebnisse: Für nicht zu kleine n und N-n gilt: - Die Mittelwerte xi aller möglichen Stichproben verteilen sich annähernd einer Normalvertei-
lung. - Der Mittelwert dieser Normalverteilung ist µ, d.h. gleich dem Mittelwert der Einzelwerte der
Grundgesamtheit. - Zwischen der Streuung σx
2 all dieser möglichen Stichprobenmittel und der Streuung σ2 der
Einzelelemente der Grundgesamtheit (Umfang = N Elemente) gilt:
x nN nN
22
1σ σ= ⋅ −−
- σ2 ist ein Maß für die Güte eines Stichprobenplans. Der wahre Wert µ liegt im "Vertrauensbe-
reich" (confidence interval) x z x zx x− ≤ ≤ +σ µ σ
z wird dabei durch den vorgegebenen Sicherheitsgrad festgelegt. Beispiel: Der zu z = 2 gehörige Sicherheitsgrad beträgt 95,5 % (2σ -Regel). Die Berechnung des Vertrauensbereiches erlaubt die folgenden Aussagen: a) Bei einem z-Wert von ... liegen ...% aller möglichen Stichprobenmittel (Anteilswerte)
innerhalb des abgegrenzten Bereichs. b) Der Mittelwert (Anteilswert) einer einzigen zufälligen Stichprobe liegt mit einer statistischen
Sicherheit von ...% (entspricht einem z-Wert von ...) innerhalb des abgegrenzten Vertrauens-bereichs.
c) Mit einer statistischen Sicherheit von ...% (entsprechend z = ...) liegt der (unbekannte) Parameter der Grundgesamtheit (µ im heterograden Fall, P im homograden Fall) im abge-grenzten Vertrauensbereich um den Mittelwert x (bzw. Anteilswert P) einer einzigen zufälligen Stichprobe.

45
Varianz einer Zufallsstichprobe (s2) Bisher wurde ausgehend von einer bekannten Grundgesamtheit auf die Verteilung von Stich-probengrößen geschlossen (Induktionsschluß; direkter Schluß). In der Praxis stellt sich jedoch das Problem, daß ausgehend von einem Stichprobenergebnis die unbekannten Parameter einer Grundgesamtheit bestimmt werden sollen. Dieser Schluß von einer Stichprobe auf die Parameter der Grundgesamtheit wird als Repräsentationsschluß (indirekter Schluß) bezeichnet. Da jedoch i.d.R. nur eine einzige Stichprobe gezogen wird, sind nicht nur die Einzelelemente der GG Xi, und damit auch µ und σ2, sondern auch die Varianzen der möglichen Stichprobenmittel σx
2 bzw.
σp2 unbekannt. Einen guten Schätzwert für die Varianz der GG bildet die Varianz einer einzigen nicht zu kleinen Stichprobe aus dieser GG (Bleymüller, Gehlert, Gülicher, 1991, S.85). Heterograder Fall (ohne Zurücklegen) Theoretische Ableitungen ergeben, daß sich als Ersatzwert für die unbekannte Varianz der GG (σ2) bei nicht zu kleinem n der Schätzwert
sx xn
i22
1=
−−
∑ ( ) , d.h. die Varianz der Einzelelemente der speziellen Stichprobe eignet.
Damit gilt für die Varianz der Stichprobenmittelwerte
σx
sn
N nN
22
1= ⋅ −
−
Für genügend große Stichproben gilt n ≈ n-1 und damit
sx xni2
2
=−∑ ( )
(bei Verwendung von n-1 im Nenner wird s2 als unverzerrter Schätzwert
bezeichnet) Beachte: σ2 = Varianz der Elemente der GG s2 = Varianz der Elemente der Stichprobe σ2 = Varianz aller Stichprobenmittel (Kellerer, 1963, S.40f.) Der Erwartungswert von s2 [E(s2)] beträgt

46
E s NN
( )2 2 2
1=
−≈σ σ (Kellerer, 1963, S.48)
Homograder Fall Für den homograden Fall gilt analog
s pqn
N nNp
2
1= ⋅ −
−
Für genügend große Stichproben (µ > 100) können mit Hilfe der Schätzwerte die Parameter der GG berechnet werden. x zs x zs bzw p zs p p zsx x p p− ≤ ≤ + ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ≤ ≤ +µ .
5.3 t-Verteilung bei kleinen Stichproben Im Fall einer kleinen Stichprobe (n < 30) kann die Varianz s2 dieser Stichprobe nicht als Schätzwert für die unbekannte Varianz σ2 der Grundgesamtheit verwendet werden. 5.3.1 Heterograder Fall Für den heterograden Fall gilt, daß die Verteilung des Ausdrucks x
sx n
sn
x
− = −µ
der sog. Student-Verteilung, kurz "t-Verteilung", folgt (dabei wird allerdings streng genommen vorausgesetzt, daß die zugrundeliegende Gesamtheit normalverteilt ist). Je kleiner n ist, um so mehr weicht die t-Verteilung von der Normalverteilung ab, und zwar in dem Sinn, daß sich das Kurvenbild verflacht. Der Parameter der t-Verteilung ist die Anzahl der Freiheitsgrade (FG = n - 1). Die Flächenanteile unter der t-Verteilung sind berechnet und tabelliert. Bei kleinen Stichproben wird demnach bei der Berechnung des Vertrauensbereichs der z-Wert durch den t-Wert ersetzt.

47
Bei einem Sicherheitsgrad von 95 % ergeben sich bei wechselnden Stichprobenumfängen die folgenden t-Werte:

48
Sicherheitsgrad FG = n - 1 t-Wert z-Wert zu = 95 % 5
10 20 30 50 100 500 ≥ 1000
2,571 2,228 2,086 2,042 2,008 1,984 1,965 1,960
1,960
Für Stichproben n > 100 ist der t-Wert praktisch gleich dem z-Wert. 5.3.2 Homograder Fall Im homograden Fall wird bei kleinen Stichproben eine sog. Kontinuitätskorrektur 1/2n zur Ausweitung des Vertrauensbereichs eingefügt. Das Produkt n ⋅ p soll > 5 sein. 5.4 Mittelwertvergleiche Es wird eine sog. Nullhypothese aufgestellt und überprüft. Diese lautet: die Unterschiede zwischen den Mittelwerten sind nur zufälliger Art, beide Stichproben gehören derselben Grund-gesamtheit an. Die Nullhypothese gilt als bestätigt, wenn die Differenz zwischen den Mittel-werten kleiner ist als das z-fache der Standardabweichung der Differenz. Die Wahl des z-Wertes (bei kleinen Stichproben t-Wert, FG = n1 + n2 -2) legt dabei die Irrtumswahrscheinlichkeit fest. Die Standardabweichung der Differenz ist (bei Unterstellung einer unendlichen Grundgesamtheit) gegeben zu
S sn
snD = +1
2
1
22
2
Beispiel: Es liegen zwei Stichproben mit den Umfängen n1 = 225 und n2 = 107, mit den Mittelwerten x1 = 19,88 und x2 = 15,23 und den zugehörigen Standardabweichungen s1 = 17,84 und s2 = 9,07 vor.

49
Die Nullhypothese wird bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % (z = 1,96), 1% (z = 2,58) und 0,1% (z = 3,29 ) überprüft.

50
D x x
S sn
snD
= − = − =
= + =
1 2
12
1
22
2
19 88 15 23 4 65
1 478
, , ,
,
(SD = Standardabweichung der Differenz) Bei z = 1,96 ist SD ⋅ z = 2,897 < D z = 2,58 ist SD ⋅ z = 3,813 < D z = 3,29 ist SD ⋅ z = 4,863 > D. Ergebnis: Die Nullhypothese wird bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % und 1 % widerlegt, bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,1% jedoch bestätigt.

51
Zeichenerklärung a) Zeichen in der Grundgesamtheit Vereinbarung: Werte der Grundgesamtheit werden mit großen lateinischen oder kleinen griechi sc N Grundgesamtheit M Anzahl der Primäreinheiten der Grundgesamtheit P, Q Anteilswert einer Ausprägung der Grundgesamtheit Xi Ausprägung der Grundgesamtheit µ Mittelwert der Grundgesamtheit σ2 Varianz der Verteilung b) Zeichen in der Stichprobe Vereinbarung: Stichprobenwerte werden mit kleinen lateinischen Buchstaben benannt. n Umfang der Stichprobe m Anzahl der Primäreinheiten der Ausprägung der Stichprobe p, q Anteilswerte einer Stichprobenausprägung xi Beobachtungswerte der Stichprobe x arithmetisches Mittel der Beobachtungswerte (Schätzwert für µ) x Durchschnitt aller Mittelwertex ; Erwartungswert von x s2 Varianz einer Zufallsstichprobe s Standardabweichung σx
2 Varianz aller Zufallsstichprobenmittel
E(x) Erwartungswert der Zufallsvariablen x (entspricht dem arithmetischen Mittel µ) Var(x) Varianz der Zufallsstichprobe (entspricht σ2) E(x) und Var(x) sind Parameter für Wahrscheinlichkeitsverteilungen, µ und σ2 für Häufigkeits-verteilungen in der deskriptiven Statistik

52
6 Stichprobentechnik Wie bereits in Kapitel 5.1 dargestellt, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl einer Stichprobe zur Verfügung. Im folgenden werden einige Verfahren beschrieben. 6.1 Technik der uneingeschränkten Zufallsauswahl Urnenmodell - blinde Losentnahme aus gut gemischter Urne (d.h. unmittelbar aus der Grund-gesamtheit). Jedes Element der Grundgesamtheit hat die gleiche berechenbare Chance, in die Auswahl zu gelangen. Simulation des Urnenmodells: - Zufallszahlentafel - Systematische Auswahl mit Zufallsstart - Sonstige: - Schlußziffernverfahren - Buchstabenauswahl - Geburtstagsauswahl (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.49). 6.2 Technik der eingeschränkten Zufallsauswahl Hier hat jedes Element nicht mehr die gleiche, wohl aber eine berechenbare und von Null verschiedene Chance, in die Auswahl zu kommen. Wir unterscheiden: (1) Geschichtete Stichprobenauswahl (2) Klumpenauswahl (3) Mehrstufige Auswahlverfahren 6.2.1 Geschichtete Stichprobenauswahl Zweck der Schichtenbildung ist es, die Streuung und damit den Auswahlfehler in der Stichprobe zu verringern. Das Prinzip der Schichtenbildung besteht darin, die Grundgesamtheit nach

53
bestimmten Kriterien in möglichst homogene Teilmengen zu zerlegen. Aus diesen Teilgesamt-heiten werden anschließend einfache, zufallsgesteuerte Stichproben entnommen. Die Schichtung bewirkt eine erhebliche Reduzierung des Zufallfehlers. Da Streuungen quadratische Ausdrücke sind, leuchtet unmittelbar ein, daß Summen von Quadraten (von Teilgesamtheiten) kleinere Größenordnungen erreichen, als die Quadratsumme der Grundgesamtheit. Abbildung 2: Verfahren der geschichteten Zufallsauswahl
Quelle : Meffert, 1992, S. 193 Bei dieser Art des Auswahlverfahrens tauchen die folgenden Probleme auf: (1) Wieviele Elemente sind aus jeder Schicht zu nehmen? (2) Jede der Teilstichproben aus jeder Schicht liefert einen Mittelwert. Wie erhält man daraus
den Mittelwert für die gesamte Stichprobe? (3) Wie ermittelt man den Vertrauensbereich für den Mittelwert der Grundgesamtheit? Zu (1): Die einfachste Möglichkeit ist die proportionale Auswahl, d.h. jede Schicht ist in der Stichprobe im gleichen Verhältnis wie in der Grundgesamtheit vertreten ( n1/n2 = N1/N2). Die
bestmögliche Auswahl berücksichtigt zusätzlich noch die Streuung in jeder Schicht (wenn diese, evtl. aus Voruntersuchungen, wenigstens annähernd bekannt ist). Die Größe der Stich-

54
probe aus jeder Schicht ist dann proportional dem Produkt aus Umfang und Varianz in jeder Schicht. Also:
nn
NN
1
2
1 1
2 2
= σσ
Zu (2): Beim geschichteten Stichprobenverfahren ergibt sich der Mittelwert der Gesamtstich-probe (µ) als gewogenes Mittel sämtlicher Teilstichprobenmittelwerte (x j ), wobei der Umfang
der zugehörigen Schichten (Nj) als Gewichte benutzt wird. Also:
µ = =∑∑
∑x NN
x NN
j j
j
j j
Zu (3): Die durchschnittliche Varianz aller möglichen Mittelwerte in allen Schichten (Schät-zwert) ergibt sich als gewogener Durchschnitt aus den Varianzen jeder Schicht. Gewogen wird mit dem Quadrat der Anzahl der Elemente jeder Schicht (Varianz = 2. zentrales Moment!), also:
sN
sn
N nNx
j
j
j j
j
22
211
= ⋅ ⋅−−
(Bei kleinen Auswahlsätzen (d.h. nj gegenüber Nj sehr klein) kann die Endlichkeitskorrektur entfallen) (Kellerer, 1963, S.91ff.). 6.2.2 Klumpen- und mehrstufige Auswahlverfahren Bei diesen Auswahlverfahren fallen Auswahleinheit und Untersuchungseinheit auseinander. Vorteile der Klumpen- und der mehrstufigen Auswahl liegen in der Senkung der Erhebungs-kosten durch räumliche Konzentration sowie im organisatorisch-technischen Bereich, d.h. die einzelnen Elemente der GG müssen nicht vollständig bekannt sein. Beispiel:

55
Die Grundgesamtheit sind die landw. Betriebe (Haushalte) des Bundesgebietes. Die GG verteile sich annähernd gleichmäßig auf die Gemeinden. Wir greifen aus diesen 8500 Gemeinden jede hundertste heraus (systematische Zufallsauswahl). Nun können wir entweder a) eine Klumpenauswahl (cluster sampling) vornehmen, d.h. alle Betriebe (Haushalte) aus
diesen 85 Gemeinden befragen. Abbildung 3: Verfahren der Klumpenauswahl
Quelle : Meffert, 1992, S. 194 oder b) ein zweistufiges Auswahlverfahren durchführen, d.h. innerhalb der ausgewählten
Gemeinden (Primäreinheiten, Klumpen) durch eine einfache Zufallsauswahl eine bestimmte Anzahl von Untersuchungseinheiten (Sekundäreinheiten) auswählen
(Meffert, 1992, S.194f.). Im Gegensatz zum geschichteten Stichprobenverfahren strebt man beim Klumpenverfahren möglichst heterogene Klumpen an, die möglichst viele verschiedenartige Elemente enthalten.

56
Aus dem Rahmen fallende Untersuchungseinheiten können jedoch einen "Klumpeneffekt" ( in sich sehr homogene, aber von der GG stark abweichende Klumpen) hervorrufen. Eine Sonderform des Klumpenauswahlverfahrens ist die Flächenstichprobe (area sampling). Hierbei werden die Klumpen geographisch bestimmt (z.B. Planquadrate eines Stadtplans) (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.51f.). Einige Richtlinien für die Planung eines mehrstufigen Auswahlverfahrens: Kennzeichen: Eine Reihe von Zufallsauswahlverfahren sind hintereinander geschaltet. Zweckmäßig: Primäreinheiten (Klumpen, Schichten) so abgrenzen, daß diese möglichst gleich viele Sekun däreinheiten enthalten. Falls dies nicht möglich ist, wenigstens proportionale Auswahlsätze
vorsehen. Damit vereinfachen sich nämlich die komplizierten Berechnungsformeln für Mittel-werte, Anteilswerte, Varianzen und Vertrauensbereiche der mehrstufigen Auswahl und damit die Hochrechnung auf die Grundgesamtheit. Die Formeln für die Berechnung von Mittelwerten und Streuung bei Klumpen- und mehrstufiger Auswahl sind den Formelsammlungen zu entnehmen.
Je nachdem, ob auf den einzelnen Auswahlstufen das gleiche oder aber unterschiedliche Aus-wahlverfahren herangezogen werden, liegen reine oder kombinierte mehrstufige Verfahren vor. Eine Mischform zwischen zufälligem und nicht zufälligem Auswahlverfahren stellt das Random-Route-Verfahren dar. Dabei werden bestimmte, nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Ausgangs-punkte (z.B. Straßenecken) vorgegeben und von diesen soll nach bestimmten Regeln weiter verfahren werden (z.B. jeder fünfte Haushalt wird befragt) (Berekoven, Eckert, Ellenrieder,1991, S.52f.). Beispiel: Aufbau der Stichprobe für eine Bauernbefragung (Ege-Region, Türkei 1978) Methode: Kombination von Schichtung und Stufung 1. Auswahlschritt:

57
- Einteilung der 174 Kreise in Anbauintensitätsklassen - Ziehung einer 10 % Kreisstichprobe proportional zur Klassenbesetzung = 17 Kreise 2. Auswahlschritt: - Einteilung der Dörfer, die in den 17 gezogenen Kreisen liegen, in Berg- und Taldörfer - Ausscheiden aller Dörfer mit mehr als 2.000 Einwohnern - Ziehung einer 5 % Dorfstichprobe, proportional ihrer Verteilung in den 17 Kreisen sowie p 3. Auswahlschritt: - Festlegung der Anzahl der in den 42 Dörfern zu befragenden Bauern proportional zur
Dorfgröße - Einteilung der Bauern in den Dörfern in Betriebsgrößenklassen - Ziehung einer 7 % Bauernstichprobe proportional ihrer Verteilung in den Betriebsgrößen-
klassen = 250 Bauern 6.3 Quotenauswahlverfahren (bewußtes Auswahlverfahren) Die Anwendung des Quotenverfahrens geht von der Kenntnis aller bzw. ausgewählter, unter-suchungsrelevanter Merkmale und den Ausprägungen sowie ihrer relativen Verteilung (Quote) in der Grundgesamtheit aus. Auf dieser Grundlage wird eine Stichprobe konstruiert, die bezüglich der Verteilung der herangezogenen Merkmale für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Z.B. bieten sich für Untersuchungen, die für die Bevölkerung der Bundesrepublik repräsentativ sein sollen, die Merkmale Alter, Beruf- oder Einkommensschicht und ihre prozentuale Verteilung in der Gesamtbevölkerung für die Zusammensetzung einer Stichprobe an. Die Merkmalsverteilung wird dann zahlenmäßig auf den Stichprobenumfang umgerechnet. Der Interviewer erhält dann eine Quotenanweisung, d.h. es wird ihm z.B. vorgegeben, 12 Personen zu befragen, davon sollen 7 männlich und 5 weiblich sowie 3 Arbeiter, 4 Angestellte/ Beamte, 1 Selbständiger und 4 Nichterwerbstätige sein. Welche konkreten Personen der Interviewer befragt, bleibt ihm überlasssen. Beurteilung des Quotenverfahrens im Vergleich zum Random-Verfahren Die Vorteile des Quotenverfahrens liegen in seiner kostengünstigen, schnellen und flexiblen Handhabung. Es kann auch noch dann eingesetzt werden, wenn die Zufallsauswahl nicht mehr oder nur noch mit großem Aufwand möglich ist. Gegen ein Quotenverfahren spricht, daß eine

58
statistische Fehlerberechnung sowie Auswertungs- und Testverfahren, die eine Zufallsauswahl voraussetzen, nicht mehr durchführbar sind. In der Praxis können nur relativ wenige Merkmale quotiert werden, insbesondere bereitet die Quotierung qualitativer Merkmale Probleme. Weiter-hin ist die Gefahr von Verzerrungen, v.a. durch Nichteinhaltung von Quotenvorgaben relativ groß (Berekoven, Eckert, Ellenrieder, 1991, S.53ff., Meffert, 1992, S.191).


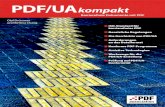
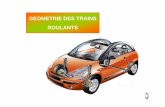






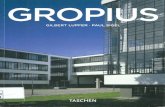
![BIOPHYSIK Physik der Zelladhäsionbiophys/PDF/PJ2015.pdf · 4).) ((), (+ (– – [()() ] , / / . (), () ...](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5d56f76688c99392138b6b93/biophysik-physik-der-zelladhaesion-biophyspdfpj2015pdf-4-.jpg)