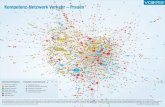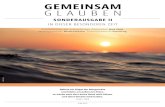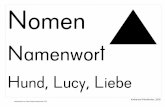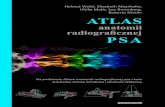Mayrhofer-Gestaltung1980
-
Upload
marcis-gasuns -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Mayrhofer-Gestaltung1980

VERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR LINGUISTIK UND KOMMtJNIKATJONHFORSCHUNG
Herausgegeben von
ALEXAXDER ISXA'fiiCHENKO (t) und MANFHED MAYRHOFER (bis Heft 8)
MARIO WANDRUSZKA und WoLmANU U. DRESSLEH (ab Heft 9)
HEI•'T 1
Wilhelm ErLERS, Über Sprache aus der Sicht von Einzelsprachen (S 287/3) 1973 .
HEI•'T 2
Georg Renatus SOL TA, Zur Stellung der lateinischen Sprache (S 291/4) 1~ .
HEFT 3
Alexander !SSATS('HENKo, Mythen und Tatsachen über die Entstehung der russischen Literatursprache. (S 298/5) 1975
HEFT 4
Renate R_-\TH,\fA YH, Die perfektive Präsensform im Russischen E · , lt'l l k . ~mc
mu 1 _atera- ontrastive Frmktionsanalyse der russischen Form an-~:~: Ihrer französischen und deutschen Entsprechungen. (S 310/1)
.EH, Italienische Interferenzen in der :dr~ ·ischen. (H 353) l!l79
L zur Vertretung der indogermanischen m Druck).
--IL'F<o.-\RD, Etudes phonologiques sur Je 180
t Graz 1927, Schuchardt-S,ymposium d'sät:r.e, im ~amen der Hprachwissennerausgegeben von Klaus LICHE.\1 und k).
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE
SITZUNGSBERICHTE, 368. BAND
VERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR LINGUISTIK UND KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG
HERAUSGEGEBEN VON MARIO WANDRUSZKA UND WOLFGANG U. DRESSLER
HEFT II
MANFRED MAYRHOFER '
ZUR GESTALTUNG DES ETYMOLOGISCHEN WÖRTERBUCHES
ElNER "GROSSCORPUS-SPRACHE"
MIT JE EINEM ANHANG
VON
VASILIJ IVANOVIC ABAEV
SOWIE VON
KARL HOFFMANN UND EVA TICHY
VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
WIEN 1980

Vorgelegt von Sekretär MANFRED MAYRHOPER
in der Sitzung am 9.November 1979
/
-···rvm1 iiCECOi031lAR nc. ti~,.~:~.1~: A
IIIICm~~d f;.IUHYPW
;wl 0
Alle Rechte vorbehalten
-ISBN 3 7001 0341 7
Copyright © 1980 by Österreichische Akademie der \\"'issenschaften
Wien Druck: Ernst Becvar, A-1150 Wien
INHALT
Vorbemerkungen 5
Abkürzungen 7
Zur Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer "Groß-corpus-Sprache" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Anhang 1:
Die Prinzipien eines etymologischen Wörterbuches. Von V ASILIJ
I VANOVIC ABAEV. Deutsch von HEINZ DTETER PoHL (1952/1980)
Anhang Il:
"Checkliste" zur Aufstellung bzw. Beurteilung etymologischer Deutungen. Von KARL HoFFMANN und EYA TICHY
Register:
A. Autorenregister
B. Sachregister
C. Wortregister "''
... ' l '~
29
47
53
54
57

>
VORBEMERKUNGEN
Der Hauptteil dieses Sitzungsberichtes wurde in extremer Kürzung (als Referat von 20 'Minuten Rededauer) am 26. 10. 1979 bei der VII. Arbeitstagrmg österreichisoher Linguisten, sodann, weiterhin mit einigen Kürzungen, in der Gesamtsitzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am 9. 11. 1979 vorgetragen; ich folgte schließlich nach einigem Bedenken auch der Aufforderung meiner altgermanistischen Kollegen, die vollständige Fassung des Vortrages am 24. 1. 1980 in der .Jahressitzung des Arbeitskreises der Wiener Altgermanisten zu verlesen. Die mir wichtigen Fragestellnngen dieser Arbeit hatten also den Vorzug, dreimal vor fachkundigem Publikum vorgetragen und jeweils in mehreren VVortmeldnngen diskutiert zu werden. Ich habe aus diesen Diskussionen viel gelernt, wie sich ~ der endgültigen Fonn des Aufsatzes zeigt, der zudem einem Briefwechsel mit Jürgen Untermann sehr verpflichtet ist; ich hoffe aus dem kritischen Echo auf die veröffentlichte Studie weiteres über einen Buchtypus zu lernen, dessen bestmögliche und zugleich praktikable Gestaltung mich seit Jahren beschäftigt.
Die Annahme des Akademie-Vortrages als Sitznngsbericht erlaubt mir außerdem, zwei Arbeiten im Anhang zu veröffentlichen, die mit dem Vortrag thematisch verküpft sind und bisher nicht in gebührender Form publik geworden waren. Als ich Vasilij lvanoviC Abaevs Darlegungen über die Prinzipien eines etymologischen \Vörterbuches (1952) für meine Arbeit einzusehen versuchte, mußte ich feststellen, daß die russische Erstpublikation nicht nur in ganz Österreich, sondern auch in mehreren deutschen Instituten, an die ich mich wandte, nicht aufzutreiben war; die Voprosy jazykoznanija, seit den späteren fünfziger Jahren in vielen Bibliotheken gehalten, wurden 1952 von westlichen Instituten noch kaum bezogen. Unter diesen Umständen schien es mir nützlich, den Aufsatz in deutscher Sprache neu zu veröffentlichen; Heinz Dieter Pohl, der sich durch mehrere Übertragnngen russischsprachiger Fachliteratur bereits verdient gemacht hat, war zu der Übersetzung ins Deutsche bereit. Als ich Herrn Kollegen Abaev um die ~rlaubnis der Neupublikation bat, erhielt ich zu meiner freudigen (] berraschung das Angebot, er wolle selbst den Text von 1952 durch

V or'bemerkungen :i '
Zusätze und Streichungen auf den heutigen Stand bringen. Dieser ;,1
erneuerte russische Text Abaevs ist es also, den H. D. Pohl als Anhang I übersetzt hat; meine kleine Veröffentlichung hat somit das '· Privileg, den Erfahrungsbericht des Verfassers eines der besten Ety- I . ·I mologika (s. u. 16 Anm. 18) auf dem Stand von 1980 in deutscher
Sprache vorzulegen. Die vorbildliche und durchdachte "Checkliste" zur Aufstellung bzw.
Beurteilung etymologischer Deutungen von Karl Hoffmann und Eva Tichy war bisher nur in hektographierter Form einem kleinen Kreise zugänglich. Ich bin den beiden Kollegen sehr dafür verbunden, daß sie einer Veröffentlichung als Anhang li meines Sitzungsberichtes zugestimmt haben; dieses Heft, das dem Nachdenken über Etymologie nnd Etymologika neue Impulse zu geben wünscht, erhält durch jenen
zweiten Anhang einen gedankenreichen Abschluß.
Wien, im März 1980 MANFRED MA YRHOFER
p
ABAE\" 1952
CHA:XTRAINE 1968
CHANTRAlNE 1977
DROSDOWSKJ 1957
FRIHK 1960
HERMANK 1938
HOF>'MANN 1978
HOFMANN 1938
HCBSCHMANN 1897
JUNKER 1956
KIPARSKY 1959
MALKIEL 1976
ScnMrrr 1977
ABKÜRZUNGEN
V. I. ABAEV, 0 principach etimologiCeskogo slovarja. Voprosy jazykoznanija 1952/5, 50ff. [s. u. S. 29ff.]
PIERRE CHAKTRAINE, Dictionnaire itymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Tome I Paris 1008 ,
P.CHANTRAlNE, Dictionnaire ... [s. CHANTRAINE
1968] Tome IV-1, Paris 1977 Gt'NTHER DROSDOWSKI, Zur etymologischen For~ schung. Forschungen und Fortschritte 31 {1957) 339fT. ~ ScHMITT 1977, 200ff. [mit einem "Nachtrag 1975", S.211f.] HJALMAR FRIHK, GriechiFmhes etymologisches Wörter~ buch. Band I, Heidelberg 1960 EDCA~D HER~A~N. Zwei Vorschläge, wie ein ety~ molo.gtsches Worterbuch angelegt sein soll. Iruloger~ mamsche Forsch-ungen 56 {1 938) 192ff.
\V<~L.F<iANG HOFFMANK, Zum gehrauchswert etymo~ logtscher wörterbücher. Der lemmata-bestand von ~luge--Mitzka und Duden und eine umfrage unter t~en benutzern. Zeitschrift für germanische linguist.k 6 (1978) 31 ff. A[LOIS]-W ALDE, Lateinisches etynwlogisches Wörter~ buch. 3., neubearbeitete Auflage von J[OHA.:.;N] B. HOFMANN. Erster Band, Heidelberg 1938
H[EINRICH] Ht'BSCHMANN, Armenische Grammatik. I. .[u~d einziger] Theil. Armenische Etymologie. Le1pz1g 1897 H[EINHICH] F .. J.JC:NKER, Besprechung von Max V~smer, Russisches etymologisches "\\'örterbuch, Lt.eferung 1.-17 {Heidelberg 1950-1954). Deutsche Ltteraturzeztung für Kritik der internationalen W is~ senschaft 77 (1956) 31 ff.
v_~ALENTINI KIPARSKY' Ober etymologische Wörter~ bucher. Neuphilologische Mitteilungen 60 (1959) 209ff. .
y AKO:T MALKlEL, Etymoloyical dictionaries (. J A tentatzve typology. Chicago-London 1976
Rt~DlGER SCHMITT (ed.), Etymologie. [Wege der For~ schuog Bd. 373]. Darmstadt 1977

8
UNTERMANN 1975
ZAMBONI 1976
Abkürzungen
JüRGEN UNTERMANN, Etymologie und Wortge&chichte. Institut für Sprachwissenschaft fder] Universität Köln, Arbeitspapier Nr.25 (.Juni 1975). Zugleich veröffentlicht in HANH.IAKOB SEILER (ed.), Linguistic Workshop Ill (München 1975) 93ff. -Die Arbeit wird hier mit den Seitenzahlen des "Arbeitspapiers Nr. 25" zitiert.
ALBERTO ZAMBONl, L'etimologia. Bologna 1976
ZUR GESTALTUNG DES ETYMOLOGISCHEN WÖRTERBUCHES EINER "GROSSCORPUS-SPRACHE"
1. Die Frage, welche Stellung die Etymologie in der Sprachwissenschaft von heute einnehme, und insbesondere die Frage, in welcher Form die etymologische Erforschung des gesamten Lexikons einer Sprache am besten dargeboten werde, finden wir in der neueren Fachliteratur mit rmerwarteter Intensität und Ausführlichkeit gestellt. Dies wird durch die Existenz eines ganzen Buches über etjmologische Wörterbücher, des ,.Versuches einer Typologie·' dieser Buchgattung wohl am augenf.illigsten, den der bedeutende Romanist Y AKOV MAL
KIEL 1976 erscheinen ließ 1. Aus der weiteren Literatur der neueren Zeit zur Frage der Gestaltung etymologischer "'~örterbücher lassen sich mehrere Titel herausgreifen, wie man heute an Hand der nützlichen Bibliographie in Rt'DWER ScHMITTs Textauswahl "Etymologie" 2 leicht nachprüfen kann: da ist vornehmlich an VANILI.J IvANOVIC ABAEVS
russischen Aufsatz über die Prinzipien eines etymologischen '"rörterbuchs (1952) zu erinnern 3 und an VALENTIN KJPARSKYS sieben Jahre später erschienene Darlegrmg "Über etymologische Wörterbücher" 4 .
Einige der klügsten rmd wichtigsten, teilweise aber auch zum \Viderspruch herausfordernden Feststellungen über die Gestaltung etymologischer Wörterbücher finden sich schließlich, im Titel nicht so deutlich
angekündigt, in dem äußerlich anspruchslosen Arbeitspapier "Etymologie und Wortgeschichte" von Jt'RGEN UNTERMANN (1975)5
.
1 MALKIEL 1976 l s. das Abk.-Verzeichnis, o. S. 7]. - V gl. auch das Kapitelehen ,.i dizionari etimologici" bei ZAMBONI 1976, 181 ff.
2 SCHMITT 1977, 451 ff. Dem sind noch einige Titel anzufügen, die HARRT
MEIERs gehaltvolle Rezension von MALKIEL 1976 nennt (Romanisches Jahrbuch 27 [1976] 187),
3 ABAEY 1952; s. dazu unseren Anhang I, u. S.29ff. 4 KIPARSKY 1959.
. 5 UNTERMANN 1975; s. dazu o. S. 8. - Der interessanten und gründ
hohen Untersuchung von HoFFMANN 1978 (wertvoll als Vergleich zwischen "KLUGE-MITZKA" und .,DUDEN", s. u. 8.16, § 3.2.1) ist schwerlich darin zu folgen, daß die nur teilweise Benützung etymologischer \Vörterbücher durch 28 Informanten aus dem Lehrkörper der Universität Trier "ein Unverkennbar

10 Gestaltung eines Etymologikons
1.1. Daß ich zur Gestaltung eines etymologischen Wörterbuchesund zwar eines besonderen Typus, des Etymalogikans einer "Großcorpus-Sprache", welchen Typus ich alsbald terminologisch einordnen werde (u. 3.2.2.1) - ein paar Gedanken vorzubringen -wünsche, ist leicht verständlich: bin ich' doch, freilich mit Unterbrechung durch andere Arbeiten, in den drei Jahrzehnten meiner bisherigen produktiven Lebenszeit an ein etymologisches \V örterbuch gebrmden gewesen. das bibliographisch noch immer nicht abgeschlossen ist; zwar liegt da~ eigentliche Lexikon in drei Bänden vor, aber der vierte, der RegisterBand, ist erst zur Hälfte gedruckt. Daß ich die Arbeit an diesem \\'~örterbuch als Student im frühen dritten Lebensjahrzehnt begonnen habe, also ohne alle Erfahrung und mit einer durch spätere Erfahrungen ad ahsurdum geführten Grundkonzeption, befahigt mich heute. über Glanz und Elend etymologischer Wörterbücher aus der einprägsamsten Schule zu sprechen, die es gibt: aus der Schule verdienter harter Kritik rmd der Einsicht in eigene Fehlkonzepte.
1.2. Diese Zeilen sollen freilich nicht nur dazu dienen, Erfahrungen weiterzugeben, sie haben auch ein praktisches Ziel: der trotz meiner Bedrückrmg über die Mängel der ersten Teile meines Buches anfang~ verdrängte \V rmsch, noch einmal ein ganz neu es, ein ganz anderes et:ymologisches \Vörterbuch des Altindoarischen zu schreiben, hat im Sommer 1979- wohl aus einer Verbindrmg von Urlaubskräftigrmg rmd "Masochismus - plötzlich wieder Gestalt angenommen; ein Seminar über Etymologie, das ich im davorliegenden Sommersemester abhielt, mag an diesem Sinneswandel beteiligt sein. Es liegt mir also sehr daran, aus der kritischen Lektüre der _erwälmten theoretischen Arbeiten und aus meinen eigenen Erfahrrmgen Überlegrmgen zu der bestmöglichen Gestaltrmg eines etymologischen Wörterbuches abzuleiten rmd diese Überlegungen sodann einer kritischen Hörer- und Leserschaft vorzulegen.
1.2.1. Vorweg ist freilich zu sagen: wollte ich auf alle Vorschläge und Einwände eingehen, die auf den vielen Seiten der Besprechrmgen meines von dreißig Rezensenten kritisierten Buches rmd in den wichtigsten prinzipiellen Publikationen zur Etymologie stehen, ich fände mich alsbald in jenem Zustand eines absurden Tributs an das Ziel, es allen recht zu machen, der aus einer Geschichte JOHAN}l" PETER HEBELS
deutlicher hinweis auf die untergeordnete rolle, die etymologie in der gegenwärtigen forschung und lehre spielt", sei (S. 40); HoFFMAN~ räumt selbst a. a. 0. ein, daß die Resultate seiner Erhebung "keineswegs repräsentativ sein können". [Den Hinweis auf HOFI<'MAN~ 1978 verdanke ich Martin Peters. J
Definition der Etymologie 11
bekannt ist. Es gibt kaum eine Darstellungsform. die in dieser Literatur nicht sowohl einen Verfechter wie einen V erdammer fande. Ich muß mich auf einige der wichtigsten Einwände rmd Vorschläge beschränken, wobei ich UNTERMAN~s Papier wohl die meisten Anregrmgen
schulde. 2. So ist bei UNTERMAN~ endgültig die für die Lebensberechtigung
etymologischer Wörterbücher entscheidende Frage beantwortet_, ob angesichtsgewisser unwissenschaftlicher Exzesse im Bereich der "6tymologie-origine" - etwa: der Zerlegrmg bereits rekonstruierter Wurzeln in noch kleinere Einheiten, der Annahme romanhafter Bedeutungsvorgänge in vorgeschichtlicher Zeit, u. dgl. - nur eine andere Form von "Etymologie", die "etymologie-histoire-des-mots", als wissenschaftlich zu gelten habe. Das bedeutet, - da sich bei dieser Betrachtungsweise die französische Sprache rmd der Name KuRT ßALDINGER sogleich ins Bewußtsein drängen -daß die etymologische Darstellung etwa des Französischen nur die reizvollen Vorgänge der Veränderung von Bedeutung, Lautfonn, stilistischem rmd sozialem 'V ert jedes französischen \Vortes im V er lauf der Jahrhunderte französischer "Cberliefernng zu beschreiben habe, nicht aber die Frage nach seiner Herkunft stellen solle. An dem Wert der Wortgeschichte ist natürlich nicht der geringste Zweifel anzubringen; daß aber auch die .,Etymologie" in ihrem griechischen VVortsinn eine berechtigte rmd notwendige Untersuchungsform darstellt, auch wenn sie - wie fast jede \Vissenschaft ~ gelegentlich von Phantasten mißbraucht wurde Wld wird, das hat UNTI<:RMA~~ in strengster linguistischer Sprache formuliert: "Etyrrwlogie bezeichnet die Ermittlung und Beschreibung des Vorgangs, der aus einem gegebenen VV ortschatz rmd aus gegebenen grammatischen Mitteln für einen auftretenden Bedarf eine neue Lautfolge herstellt und [ihr] einen Inhalt zuordnet" 6 ; sie hat "Lexikon, \Vort.bildung rmd Motivation als Faktoren einer solchen Zuordnung darzustellen und gehört damit zur synchronen Beschreibrmg der Spra~ ehe" 7 ; wenn man "auf eine kohärente theoretische Reflexion über Sprachwandel rmd Sprachgeschichte" nicht "verzichten zu können glaubt[] ... , dann gehört die etymologie-origine zu den unveräußer-
6 UNTERMANN 1975, 10 (3,1).
7 UNTERMANN 1975 [Zusammenfassung]. -Zwn Verhältnisvon Etymolo
gie (als Teil der synchronen Beschreibung der Sprache), synchroner Bedeutungsanalyse und Wortgeschichte s. auch die wichtigen Bemerkungen von H.-un-u MEIER, Hommages a Jacques Pohl (Brüssel 1980) 165 und 173 Anm. 6~8, mit Lit.

12 Etymologie und Wortgeschichte
liehen Aufgaben der Sprachwissenschaft"~. Für ein etymologisches \\r örterbuch bedeutet dies, daß es in erster Linie nach dem Ursprung der Bestandteile des Wortschatzes, nach jenen Prozessen der ersten Verbindung von bestimmten Phonemketten mit bestimmten Bedeutungsinhalten zu fragen hat; die weitere Geschichte der in dieser Sprache als Erbe vorliegenden, fertigen Wörter, durch eine möglicherweise Jahrhunderte umfassende Folge von Belegen, kann notü,tlls durch ein eigenes, ein "geschichtliches VV örterbuch", erlaßt werden. Das ideale Werk bleibt zweifellos ein etymologisches und wortgeschichtliches Wörterbuch, dessen Entstehung jedoch von persönlichen Konstellationen abhängt. In meinem konkreten Falle: ich suche vorerst noch nach einem kooperationsbereiten Indologen mit wortgeschichtlichen Interessen, einer Forscherpersönlichkeit nach der Art des verewigten LonR RE~oe, der in einem solchen etymologisch-wortgeschichtlichen Wörterbuch den geschichtlichen Schicksalen der altindoarischen Wörter nachzugehen hätte, während mir die Frage nach ihren Ursprüngen bliebe: als nachweisliche Bildungen in der indogermanischen oder indoiranischen Vorstufe des Altindoarischen, als innerindoarische Bildungen nach produktiven Bildungsgesetzen, oder als Übernahme aus anderen Sprachen, mit "anderer Grammatik" (um nochmals eine Definition UNTERMAN~s aufzunehmen) 9 : aus einer der jüngeren Stufen des Indoarischen, denen die altindoarische Hochsprache vieles entnommen hat, aus den nichtarischen Sprachen Indiens oder aus weiteren fremden Quellen, Diese Frage der vert->C'hiedenartigen Quellen eines Lexikons wird uns noch einmal zu beschäftigen haben (4.1.2). - Nur im Falle einer solchen Zusammenarbeit könnte ich mir ein altindoarisches Wörterbuch von der vorbildlichen Art des "Dictionnaire etymologiqu.e de la langu.e Latine" vorstellen, in welchem der Indogermanist MEILLET die Urspnmgsquellen, der Latinist ER. NOUT die \Vortgeschichten dargestellt hat. Findet sich ein solcher Mitarbeiter nicht ein, so schiene mir ein neuerliches \Vörterbuch der "etymologie-origine" weiterhin vertretbar, was selbstverständlich nicht den Verzicht auf sorgsame philologische Prüfung des Wortmaterials bed~uten darf; über jene, die eigentlich "etymologische" Seite eines Lexikons möchte ich einige Gedanken vorbringen.
3. Eine unter den Fordenmgen UNTERMANNS an ein etymologisches Wörterbuch hat mich besonders betroffen gemacht, weil sie eine Dar-
8 UNTERMAN}J" 1975, 4f. 9 UNTERMAN}J" 1975, 15f.
Etymologie und Einzelwort 13
stellungsform mit neuen und überzeugenden Argumenten verteidigt und fordert, die ich im Verlauf der Entstehung meines eigenen Buches mehr und mehr als platzraubende Untugend über Bord geworfen hatte. UxTERMAKN schreibt!(): "Etymologie wird immer für das Einzelwort gemacht, für die einmal geprägte Form, der ein Inhalt zugeordnet ist. Jede dieser Formen hat, wenn sie als autonome Eintragung in einem synchronen Lexikon steht, auch den Anspruch auf eine autonome Stelle in einem etymologischen Lexikon", und er fügt als Anm. 3 hinzu: "Je besser ein etymologisches Lexikon ist, um so vollständiger führt es
die synchron gegebenen it.ems als Stichwörter auf- hierin ist etwa das etymologische Wörterbuch von Feist nahezu vorbildlich, die DudenEtymologie ist besser als das deutsche etymologische \IV örterbuch von Kluge ... ". - Was das heißt, möchte ich an einem lateinisch-griechischen Beispiel demonstrieren, das auch in einem klassischen Text MANC LEeMANNs vorkommt 11
. Die Existenz von Iatein. agö ,treibe, führe' und griech. &y(u ,treibe, führe' sowie entsprechender Verben im Indoiranischen, Armenischen, Keltischen, Germanischen und Tocharischen beweist, daß im Indogermanischen schon die Zuordnung einer Phonemkette spätidg. *ag-, altidg. *H2eg-, mit thematischer Verbalflexion, an ein Zeichen mit der semantischen Seite "treiben, führen" vollzogen war. Diesem abgeschlossenen Prozeß - er ist in strenger Definition keine "Etymologie", da wir durch die Lautveränderungen hindurch nicht zu älterer Semantik oder einem Bildungsvorgang vorstoßen; es handelt sich nur um eine der .,GleichWlgen", die hohen Wert für die FeststelJung einer genetischen Verwandtschaft haben 1 t -
tragen die etymologischen Wörterbücher Rechnung, indem sie jeweils ein Lemma &yw bzw. ago usw. anführen.
Nun gibt es seit Aischylos (und als Eigenname seit Homer) das Nomen agentis &xnup ,.F'ührer', und im Lateinischen seit Plautus das gleichgebildete iictor ,Treiber, Darsteller'. Diese beiden Bildungen
10 UNTERMANN 1975 15
11 Die Stelle in LEL~A~~s "Grundsätzliche[m] zur etymologischen For
schung", das ursprünglich die Einleitung zu zwei Rezensionen in Gnorrwn 9 (1933) 225ff. bildete, ist heut€ bequem in zwei Wiederabdrucken zu finden: M. LECMANX, Kleine Schriften {Zürich und Htuttgart 1959) 187, bzw. bei ScHM!TT 1977, 163.
12 Auf einen weiWren "\\'ert dieser Gleichung weist mich J. UNTERMAN}J"
(briefL) hin: sie dient auch der Isolierung eineA kleinsten bedeutungstragenden Segments auf lexika.lischer Ebene, nämlich ag~; hätte man lly-w nicht, so müßt€ Inan für CM.x~nup eine hypothetische \Vurzel "ak- oder ag~" ansetzen.

14 Wörterbuch-Eintragungen
könnten lautgeset.:lich gleichgesetzt werden; daß man zögert, dem Indogermanischen auf Grund dieser Evidenz ein Zeichen zuzuordnen 13
,
rührt daher, daß einerseits die beiden Gebilde semantisch etwas voneinander abweichen und daß andererseits die Ableitung durch -tor- ein produktives Mittel sowohl im Lateinischen wie im Griechischen war, eine Bildung *ag-tor- zu ag-ö also in jeder der beiden Sprachen nach deren Einzelgrammatik geschaffen werden konnte. Die moderneren etymologischen Wörterbücher haben aus diesem Grunde auch kein eigenes Stichwort äctor oder &x't"wp: FRtHK 1960 vermerkt unter &yw die Bildung hmp und sagt dazu, daß "lat. aetor wohl davon unabhängig gebildet" sei 14 ; das noch modernere Wörterbuch von CHAN'l'RAJNE 1968 bringt unter dem Stichwort iyw nur noch die Formulierung "&xrwp ...
avec un suffixe --:wp qui se retrouve dans ce type de noms" 15, also ohne Hinweis aufdas Lateinische, dessen \V ortbildungsregeln offenbar nicht in ein griechisches etymologisches VVörterbuch gehören. Ein Indogermanist alten Schlages wie HoFMAXN 1938 hat hingegen noch ein eigenes Lemma äctor, er setzt es durch ein "=" mit gr. &x:rwp der Bildung und wohl auch dem Ursprung nach gleich und verweist im \\Teiteren auf die Wortfamilie von agö 16
; diese Darstellungsweiseund sie ist auch die der Anfangsteile meines eigenen Buches, wobei ich sowohl aus Erfahrungsmangel noch der "alten Schule" folgte und zudem von der Freude an der Lautgesetz-Didaktik vetführt war - ist mit Recht als "atomistisch" getadelt worden. Die etymologischen WÖrterbücher unserer Zeit stellen also vollständige Wortsippen zusammen und teilen nur ihnen dann die etymologischen Aussagen zu.
Nach UNTERMANNs unangreifbarer Forderung müßte es jedoch in
einem etymologischen Wörterbuch- er sagt es nicht, aber ich lege ihn sicherlich richtig aus- wieder ein gesondertes Lemma (z. B. lat.) iictor
geben: weil iictor ein eigenes lateinisches \Vort ist. Dieses Lemma
13 Der Diskussionsbeitrag von HELMUT RTX nach meiner Verlesung der Kurzfassung dieses Beitrages am 26. iO. 1979 erinnerte daran, daß man daraus, daß actor und h•wp im Lateinischen und Griechischen einzelsprachlich bildbar waren, nicht den umgekehrten Schluß ziehen dürfe, ein idg. *Ht€Y-torkönne es nicht gegeben haben, weil es aus den beiden Belegen nicht deduzierbar sei. Seine einstige Existenz ist sogar höchst wahrscheinlich - aber nicht wegen lat. iictor und gr. &x.rwp, sondern weil für das Idg. die Existenz einer Wurzel *HzeY- und eines produktiven Suffixes *-tor-zu sichern ist.
14 FRn·m. 1960, 18. 15 CHANTRAINE 1968, 18a. 16 HOFMANN 1938, 10 bzw. 23.
Grundtypen der Sprachüberlieferung 15
müßte erklären, nach welchen Wortbildungsregeln äctor zu G{]Ö gehört. Da mein Frennd UNTERMANN Indogermanist und Wissenschaftshistoriker ist, schreibe ich ihm weiterhin (vielleicht zu Unrecht) die Fordernng zu, dieser Artikel "iictor" müsse auch eine warnende Bemerkung (im Kleindrnck) enthalten, das Wort sel mit der aus dem Griechischen unabhängig erklärbaren Bildung ixTwp gleichgesetzt und in die gemeinsame Vorstufe des Lateinischen und Griechischen zmücktransponiert worden; das sei zum mindesten unbeweisbar. - Und bei dieser Auslegung von UNTERMA~Ns klugen Sätzen ergreift mich ein Unbehagen beim Gedanken an die \V ortmengen des Lateinise-hen, des Griechischen und - pro domo gesprochen - des Altindoarischen; ich frage mich weiter, ob es gerecht ist, den offenbar unzureichenden etymologischen \V Örterbüchern dieser Sprachen als "nahezu vorbildlich" das gotische etymologische \V örterbuch von FEIST entgegenzuhalten.
3.1, Die Erfüllung der Forderung, womöglich jedes synchrone Lexem einer Sprache in ihrem etymologischen Wörterbuch als eigenes Lemma aufzuführen, war im Falle des Gotischen leicht, ja nahezu selbstverständlich: der belegte gotische \Vortschatz ist vergleichsweise gering, da diese Sprache nur in Teilen der Bibelübersetzung vorliegt, dazu in kleinen weiteren altgotischen Denkmälern, von denen nur noch die wenigen Blätter mit Bruchstücken eines Kommentars zum Johannes-Evangelium, Skeireins genannt, eine Erwähnung verdienen. Sieht man UNTERMANNS Forderung prinzipiell als richtig an, findet man sie aber nur in Pällen einer eingeschränkten Überlieferung wie der gotischen voll durchführbar, dann erkennen wir hier ein reines Problem der Praxis und empfinden gleichzeitig, daß es offenbar verschiedene Typen des "Cberlieferungszustandes von Sprachen gibt, nach denen sich auch verschiedene Typen etymologischer "\Vörterbücher als angemessen empfehlen. Von den Überlieferungszuständen her möchte ich eine grobe Einteilung in vier Grundtypen vorbringen, die gewiß der Verfeinerung zugänglich wäre und auch den Nachteil hat, daß die drei l~tzteren Typen nicht in allen Fällen deutlich voneinander abgrenzbar Sind.
. 3.2. Folgende Großgruppen von Sprachen, mit denen - auf Grund eme_r länger dauernden Beleggeschichte und (bzw. oder) genetischer Reztehnngen zu anderen Sprachen -überhaupt Etymologika verbunden werden können, möchte ich unterscheiden:
3.2.1. Infonnantensprachen -- Sprachen, die in einer größeren Menschengruppe als Erstsprachen im Gebrauch sind und deren Lexi-

16 Infonnantenspra.chen
kon (mit Ausnahme einiger Spezialtermini, die auf Sondergruppen [z. B. Berufe] eingeschränkt sind) einem Mitglied dieser Gruppe zmn mindesten passiv, zu einem hohen Anteil auch aktiv zu Gebote steht. Der Verfasser des etymologischen Wörterbuches einer Informantensprache (meine Gründe für die Vermeidung der Metapher "lebende Sprache" werde ich alsbald darlegen [3.2.2]) ist in nicht wenigen Fällen sein eigener - erster oder eint:iger ~ Informant. Im Rahmen memes Themas habe ich auf die8en T~ypus etymologischer Wörterbücher kaum einzugehen; UNTERMA:'H\s Einwand, synchron gegehene items fehlten oft als Stichwörter in etymologischen'\\-' örterbüchem, gilt- wenigstens in den Fällen, wo Etymologen ihre Muttersprache behandeln - wohl nur selten. Sein Urteil, in dieser Hinsicht sei "die Duden-Etymologie ... besser als ... Kluge" li, hätte die verschiedenartige "Zielgruppe" dieser Bücher bedenken sollen: die Duden-Etymologie ist ein etymolo
gisches Wörterbuch für Deutschsprechende; der "KLnm" ist eines für Germanisten (wobei ed nicht selten vorkommt, daß ein Individuum beiden Gattungen gleichzeitig angehört). Es entspricht, wohl nur dem Vertrauen des "KLnm" in den fachkrmdigen Leser, manches muttersprachliche \V ort auch im Rahmen einer \\7 ortfamilie aufzufinden,
welches der interessierte Laie nicht finden würde, daß der "KLLTC:E" den Wortschatz weniger aufgliedert als das Etymologikon der Duden
Reihe18. 3.2.2. Corpussprachen - Sprachen, die nicht als Besitz einer
Sprachgemeinschaft, sondern durch ihre Niederlegung in einem :extcorpus, also in Werken der Literatur, in Inschriften und Wetteren
Quellen faßbar sind. Die für die Sprachwissenschaft schon zu &HL~lCHERS Zeiten als ungeeignet erwiesene Metaphorik aus dem Naturretch
17 "CNTERMANN 1975, 15 Anm. 3. - [Genaue ~;tatistische Daten zu den Unterschieden zwischen diesen beidf'n Biü·hern hidd .iPtzt HIII·T~L\~X 1978: ~. auch o. 9 Anm. 5.] .
1s zu .Jen Etymologika von Infonn;ntens~raehen möchte ich noeh an~erken daß eines der besten Bücher dieses Typs m dem bewundernswerten W .erk MA{...KIELs, das fernstliegendes Material verwertet hat, nicht behandelt 1st; auch Kritiken von MALKIELs Buch haben dies vermerkt (s. L. Z<il'STA, K:a.tylos 21 [1976(77)]184; R. HcHMlTT, LangWl{Je 54 [1978]422). Es ist d~s osset1sche
etymologische Wörterbuch des Osseten V: I. AnAEV., das m .seme~. rm~he~ Auswertung von Geschichte. Rprachverglewhrmg, D1alektol~gw, mu~dhc~e
1 Überliefenmg und Ethnographie ,.an almost perfect synthes1s of a h1stonc~ and an etvmological dictionary" bietet (SCH:r-tHTT, a. a. 0.). Vgl. auch dte Beurteilung von ABAE\"s Slovarb bei L.ZGUfl1'A, Manual of Lexicography (Den Haag--Paris 1971) 201 Anm.22.
' Corpussprachen 17
sollte auch hier, in einer Benennung wie "tote Sprachen", vermieden werden: Corpussprachen wie Latein oder Sanskrit können unter Son
dergruppen, etwa Priestern, Gelehrten, Dichtem, durchaus "leben", und ,,\Viederbelebungen" von Corpussprachen wie im Falle des Hebräi
schen im heutigen Israel verbieten den Vergleich mit dem irreversiblen Naturvorgang des Todes. Für die Corpussprachen schlage ich - in Blickrichtung auf mein Thema, die etymologischen Wörterbücher -drei Hauptgruppen vor.
3.2.2.1. "Großc.orpussprachen" - also Sprachen in so reichlicher
schriftlicher Bezeugrmg, daß ein hoher Prozentsatz des Lexikons, der seinerzeit den Trägern dieser Sprache, den Informanten von einst, verfügbar war, auch uns bekannt ist: Sprachen wie Latein, Altgrie
chisch, Sanskrit im weiteren Sinne (Altindoarisch). 3.2.2.2. "Kleincorpussprachen". Sie sind in Textcorpora erhalten,
die immerhin groß genug sind, um einen hinlänglichen Eindruck von der Struktur, der Grammatik, dem Grundwortschatz dieser Sprachen zu
geben; andererseits können wir sicher sein, jeweils nur einen Bruchteil solcher Sprachen erhalten zu haben. Hierher gehören das schon geschil
derte Gotisch (3.1) oder das Altpersische der vielen, aber eintönigen Königsinschriften 19.
3.2.2.3. Die Grenze zu den Kleincorpussprachen verschwimmt, wenn wir die letzte Gruppe von Corpussprachen abtrennen wollen: die "Restsprachen"; Sprachen, die nur in wenigen Inschriften oder gar nur
in Glossen, indirekten Nachrichten, Personen- und Ortsnamen erhalten sind. Sie sind gewöhnlich nur klassifizierbar und wenigstens zum Teil verständlich, wenn sie einer gut bezeugten Sprachfamilie angehören. So denkt man hiebei vornehmlich an Restsprachen indogermanischer
19 J('RGEN UNTERMANN bringt mir in seinem Briefvom 29. 10. 1979 eine Verfeinerung nahe, für die ich ihm selbst das Wort überlasse: Man könne, so meint er, zu den Kleincorpussprachen "auch Sprachen rechnen, die nicht deswegen nur zu einem Teil bekannt sind, weil die Ungunst der Oberlieferung uns um Vieles gebracht hat (wie etwa beim Althochdeutschen), sondern deshalb, weil das Corpus aus historisch-kulturellen Gründen beschränkt ist: das Friesische ist in seiner älteren Periode nur zum Zweck der Fixierung von Rechtsverhältnissen und Geschichtsfakten niedergeschrieben worden, nicht auch für Lyrik, Epik oder anderes; das Altarmenische ist von Theologen geschrieben worden, nicht von Bänkelsängern oder Journalisten ... Es gibt a_Iso ... einen Unterschied zwisehen ,zerstörten Corpora', die man, selbst wenn Sie umfangreich sind, besser den ,Restsprachen' subsumieren sollte, und Corpussprachen mit ,absichtlich' begrenztem Umfang ... ".
\03HAfl

18 Restsprachen
Zuordnung: an das Thrakische, Lydische, Messapische, Phrygische, Dabei wünsche ich nicht in Grundsatzkämpfe mit Kennern der letztgenannten Sprachen verwickelt zu werden, die vielleicht auf dem Recht dieser Sprachen beharren wollen, noch als "Kleincorpussprachen" eingeordnet zu werden.
4, Probleme der Gestaltung eines etymologischen Wörterbuches stellen sich bei echten Restsprachen kaum. Der Normaltypus ihrer Darstellung - von dem nur Groteskfalle abweichen - ist ein Gesamtlexikon, ja ein Verzeichnis aller Belegstellen, ein .,Thesaurus"; zumeist verbunden mit einer Gesamtausgabe des Corpus dieser rudimentär überlieferten Sprache. Diesen Informationen werden dann, sorgfältig durch Argumentationsausdruck und Schriftbild davon geschieden, die sichersten Angaben zum Urspnmg des deutbaren Teiles des Lexikons angefügt, deren \Veglassung ein bedauerlicher Informationsverzicht wäre. Als Musterbeispiel nenne ich das "Lydische Wörterbuch" von RoBERTO Gt:RMA"I (Heidelberg 1964 ), das, obwohl ein Büchlein in Kleinformat von weniger als 300 Seiten, neben einleitenden Angaben zu Schrift und Sprache den gesamten damals verfügbaren lydischen Wortschatz mit allen Belegstellen (S.49ff) und eine Edition der lydischen Inschriften bietet (S, 249f[), Mitteilungen zur Herkunft lydischer Wörter werden im Rahmen des Lexikons gegeben, indem z. B. aufS. 56 der Stamm ai.a- in seiner synchronen Bedeutung "anderer" mit allen Stellenangaben angeführt wird; im Kleindruck folgt dann dieser Lexikoneintragung noch die Aussage zur Herkunft: "Der Vergleich mit lat, alius usw, liegt auf der Hand , , , ", d, h, die schon in der Vorstufe mehrerer indogermanischer Sprachen vollzogene V erknüpfung von *aljo- mit "anderer" setze sich hier offenbar nach lydischen Lautgesetzen fort.
4.1. "\\7as die Etymologika von Kleincmllussprachen betrifft, so ist der Typus "FEH.;T" - mit seiner weitgehenden Deckung von lexikalischen und etymologischen Eintragungen - von kompetenter Seite gerühmt worden; nicht nur, wie erwähnt, von UNTERMA~N:w, auch von ANDRf: MAHT1NET 21 . Lehrreicher als die Aufzählung ihrer Vorzüge wird uns die Besinnung auf Mängel sein, die solchen Etymologika vorgeworfen werden können oder bereits vorgeworfen worden sind. Die \Vörterbücher zu Kleincorpussprachen erweisen sich oft als das V ersuchsfeld,
211 S.o.3, S, 13ff. 21 A.MARTINET, La Linguistique 2 (1966) 123 ("un des plus beaux ouvra
ges,, ,"),
Kleincmpussprachen 19
auf dem noch vorgeführt werden kann, was in den Büchern des Großcorpus-Typs nicht mehr tolerabel wäre. Ho bietet uns FE1HT einige veritable Beispiele für Platzverschwendung, die er sich bei dem kleinen Wortbestand seines Gegenstandes leisten konnte, weil ein großformatiges Buch von über 700 Seiten immer noch unter der Toleranzgrenze für Verleger und Käufer liegt; der Verfasser eines "Großcorpus"Wörterbuches hingegen lernt aus diesen Beispielen für das, was in seinem Falle existenzwichtig ist: für die Unterscheidung von Unentbehrlichem und Entbehrlichem, Ein Beispiel aus FEisT, auf das schon ED"L\RD HERMANN 1938 hingewiesen ha.t 22 : es ist gewiß eine wichtige Mitteilung, daß das Gotische für "Mutter" ein Wort obskurer Herkunft23, aipei, hat, also nicht das gemeingermanische Wort (nhd. Mutter usw.), das aus indogermanischer Zeit ererbt ist (lat. mäter
usw.) 24 . Diese "Fehlanzeige" hätte mit zwei \Vörtem --einem germanischen (Mutter) und einer Repräsentanz des Indogermanischen (mä
ter) - belegt werden können. Bei FEIST stehen für diese negative Information zwölf Zeilen, in denen er das indogermanische "Mutter"Wort in drei germanischen und fünfzehn nichtgermanischen Sprachen aufführt, deren Formen in mehreren älteren Büchern zu finden gewesen wäre 25 .
4.1.1. Wie mit Recht kürzlich von Rt'DIGElt ScHMlTT geschrieben worden ist26
, sind solche Sprachen mit eingeschränktem Corpus auch der ideale Versuchsboden für die Erstellung etymologischer "\\7örterhücher anderen Typs als des herkömmlichen alphabetisch geordneten Etymologikons: ein etymologisches Wörterbuch "nach Sachgruppen" etwa sollte zuerst an einer Kleincorpussprache wie dem Gotischen
22 HERMANN 1938, 193. 23 FEHns Annahme einer Entlehnwtg aus "illyr. OHE>H" fallt dahin, da
dies eine vox nihili ist ("OH8H" steht auf der angeblich "balkanillyrischen" lnschrift, die von ÜGNENOV,\ wtd GARE.J unabhängig als christlich-griechische lnschrift erkannt worden ist: s. die Lit.-Angaben bei H. KRONAHHER, Sprache 11 [1965] 176). Zu neueren Deutungsversuchen s. B. DE\'LAMMINCKG. ,JlTQUHS, Complement aux dictionnaires etymologiques du Ootique I (Löwen 1977) 36[,
24 "Got[ique]. mO]mr" bleibt ghostword, obwohl es allein auf den Seiten 4-5 von ,JEA~ HATT>RYs Büchlein L'indo-europeen (Paris 1979) dreimal erscheint.
25 Dazu herzhaftE. HERMANN, a. a. 0.: "\Venn das so fortgeht, gehen die etymologischen Wörterbücher an der Elephantiasis zugrunde
26 La11{1uage 54 (1978) 421 Anm, 2,

20 Herkunfts-Abschnitte
versucht werden, wie dies offenbar geplant ist27 • Ich gestehe, daß ich die Anwendbarkeit auf den "Großcorpus-Typ" erst nach Vorliegen dieses Experiments zu beurteilen wagen werde.
4.1.2. Nur der Vollständigkeit halber gehe ich auf die Forderung ein, die in einer mir weithin unsympathischen Rezension, der Besprechung von VAsMERS russischem etymologischem Wörterbuch durch H. F.J. Je~KER, erhoben worden ist (.JDIKER 1956, 33): ein Etymologikon müsse "mehr als ein ,gedruckter Zettelkasten' sein" - wieviel weiter wären wir, wenn etwa manche Mitteliranisten ihre Zettelkästen drucken zu fassen geruhten!- und es solle dem Vorbild von H(1BHCH
MANN 1897 folgen; leider hat der Verlasser eines von mir geschätzten \V Örterbuches in einem prinzipiellen Aufsatz beide Dicta J L'NKERs zu wiederholen für nötig gehalten (DR<"DOWSKI 1957, 340a, 343b).- Nun gehört der Schreiber dieser Zeilen zu den glühendsten Bewunderern von HEe-JRlCH Ht'BHCHMANNS Genie, Nüchternheit und Darstellungskunst; aber es fragt sich doch sehr, ob das Muster der "Armenischen
Etymologie" auf irgendeine andere Corpussprache voll anwendbar wäre (wobei gerechterweise zu erwähnen ist, daß JUNKER, a. a. 0. zwar dieses Wörterbuch einer Corpussprache als Vorbild angepriesen, es aber den Verfassern von Wörterbüchern "lebende[r] (Schrift-)Sprache[n], wie ... Russisch" empfohlen hat). Nur die singuläre Situation des Altarmenische'll hat ein Etymologikon ermöglicht, das die "\Vörter und Namen in "Abschnitten" -persische Namen, persische VVörter, neupersische und arabische Wörter, syrische Namen, syrische WÖrter, griechische Namen, griechische "\Vörter, französische Wörter, Lehnwörter unsicherer Herkunft, echtarmenische Wörter- vorzuführen erlaubte. Man stelle sich die Situation bei Corpussprachen vor, deren Lehnwortquellen weithin unbekannt sind, -- wie im Falle des Altgriechischen - aber auch bei solchen, in deren Umkreis wir fremde Sprachen kennen, die zweifellos Lehnwörter in jene Sprachen abgegeben haben:
27 SCHMlTT, a. a. 0.; nach freundlicher Auskunft von HANS ScHMF..lA (lnnsbruck) vom 3. 9. 1979 handelt es sich bei dem von ihm und W. MEID geplanten Werk um eine Gesamtdarstellung des gotischen \Vortschatzes mit fortlaufendem Text, nicht nach "Stichwörtern", sondern nach Wortfeldern geordnet. Einen Einblick, wie eine solche Gesamtdarstellung etwa aussehen wird,- ein erster Teil, "Unbelebte Natur", ist für die nächsten Jahre geplant-- vermit~ teln Studien wie \V. MEID, Die Bezeiclmungen für den Menschen im Gotischen, Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft 2 (1976) 65ff., oder W. MEID, Zur Etymologie des Wortes fur ,,Mensch" im Irischen, Studies ... Offered to Leonard R. Palmer (Innsbruck 1976) 173ff. ~ vgl. auch P. KELLY, Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft 2 ( 197 6) 43 ff.
Fachliteratur-Angaben 21
also ein lateinisches Etymologikon, das nicht mit "ä, äh", sondern mit einem Abschnitt "etruskische Namen" begänne, oder ein altindoarisches, das zu wissen vorgäbe, welcher Teil des Wortschatzes als
"dravidische \Vörter" einzustufen sei. Sogar im Falle von Ht'BSCHMANNs Meisterwerk sind bereits Fragen laut geworden, ob in einer Neubearbeitung das "Abschnitt"-Prinzip wirklich ideal wäre: durch die Fortschritte der Indogermanistik (besonders in Morphologie und historischer Phonologie [Laryngaltheorie u. dgl.]) und, vor allem, durch die gewaltige Mehrung unseres \Vissen~ von iranischen Sprachen, die 1897 noch unbekannt waren und als (gegenüber Ht'BHCHMAN~ viel differenziertere) Quellen des Armenischen in Betracht kommen, muß heute schon manches Wort in seinem Buch von einem "Absclmitt" in einen anderen überführt werden. \Väre es ein Unglück, wenn ein "neuer Hi"B.SCH~L\~K" - er ist leider nicht in Sicht -- die \Vörter und Namen wieder alphabetisch anführte und dann in einem Anhang die so dankenswerte Einteilung in Herkunfts-"Abschnitte" träfe? Die (gerade dem Schreiber dieser Seiten gewiß wesentliche) Frage, welche .,persischen (besser: iranischen} Namen" im Corpus des Armenischen vorkämen, könnte damit ebenso gut beantwortet werden wie durch das Modell von 1897.
4.1.3. Daß diese Arbeit von der Gestaltung des etymologischen \Vörterbuches einer Corpus-Sprache handelt, ist der einzige Grund dafiir, daß von ELMAR SEEBOLDs Vergleichendem und etymologischem Wörterbuch der germani-8Chen .<;tarken Verben (Den Haag-Paris 1970) hier nicht die Rede ist.. Für den Typus des Etymologikons einer Sprachfamilie ist dieses von vielen Seiten gerühmte Buch gewiß ein höchst überlegenswertes Modell.
4.2. Eine letzte prinzipielle Frage stellt sich noch, ehe die Arbeit an einem etymologischen Wörterbuch begonnen werden kann: wie weit soll die Fachliteratur, wie weit sollen die einzelnen etymologischen Lösungsvorschläge beachtet, zitiert oder gar referiert werden? Da es in über 150 Jahren historischer Sprachwissenschaft ungezählte Veröffentlichungen zu Wortdeutungen gibt, von denen zwar viele unwahrscheinlich, wenige aber direkt falsifizierbar und somit auszuscheiden sind, besteht die Möglichkeit, viele Lemmata eines Etymologikons jeweils mit seitenlangen Referaten der Lösungsvorschläge zu füllen, deren Anzahl oft zweistellig ist. Von dieser Problematik sind die Wörterbücher von Großcorpus- (und von Informanten- )Sprachen am meisten betroffen, da der Zahl der Stichwörter die Belastung durch Sekundärliteratur gewöhnlich kongruent ist. Es gibt eine allzu einfache Methode, dieser peinvollen Situation zu entgehen, und sie findet ihren

22 Großcorpus-E tymologikon
klarsten Ausdruck in dem - im Original polnischen - Vorwort des polnischen etymologischen V\lörterbuches von ALEKRANDER BRPCKNER ::!H: " ... ich gebe bei jedem Stamme bzw. Worte diejenige Erklärung, die ich selbst für die richtige, wahrscheinliche oder mögliche halte und wahre tiefstes Schweigen über sämtliche andere ... weder erwähne ich noch bekämpfe ich somit andere Schlußfolgerungen, obgleich ich sie alle anf das genaueste kenne" 2"- Diese Einstellung lehne ich heftig ab, nicht aus der subjektiven Abneigung gegen die in ihr sich offenbarende Selbstgerechtigkeit und Arroganz, sondern aus der Überzeugung von der dialektischen Natur unserer \Vissenschaft, in der oft der Zusammenstoß zweier unzureichender Begründungen schlagartig die evidente Lösung ergibt30 . Neben allen schon diskutierten Forderungen an ein etymologisches VV örterbuch bleibt somit auch die bestehen, daß es den Zugang zu der bisherigen Sekundärliteratur nicht 'Tersperren darf.
4.3. Der Frage nach der praktischen Gestaltung des etymologischen \V Örterbuches einer Großcorpus-Sprache nähert man sich am besten, indem man das Ideal eines Wörterbuchs dieses Typus aufstellt. Dieses müßte:
4.3.1. alle selbständigen Eintragungen eines überlieferten Corpus in etymologische Lemmata umsetzen (Forderung UNTERMANN);
4.3.2. diese Lemmata müßten nach der ihnen jeweils zukommenden Grammatik aufprimäre Einheiten bezogen werden, die ihrerseits nicht mehr ableitbar sind: a) nach den Regeln der produktiven Grammatik der beschriebenen Sprache (T;:rpus &.x-Twp von &:y-w, o. 3); b) nach denen einer älteren Grammatik, deren fertige Bildnngen schon in der beschriebenen Sprache ererbt sind (wie das von *per- ,hindurch' (griech. m:p(, 1t6poc;] gebildete *pr-tu- > lat. portus, nhd. Furt), die also die Konstruktion von \Vurzeln nötig machen, damit man Wörter als korrekte grammatische Ableitungen aus ihnen nachweisen kann 31 ; c) nach den Regeln einer fremden Grammatik. hei Entlehnungen -wie
~~~ A. BRCCKNER, Slownik etymologiczny j~zyka polskiego (Krakau-Warschau 1926-27) X.
29 Die deutsche CbersetzWlg nach KlPAR:"iKY 1959,219. 30 Dazu ein schönes Beispiel bei \V. PoRzm, Die Gliederung, des indogerma
nischen Sprachgebiets (Heidelberg 1954) 28.- In hohem Maße dialektisch und "sekundärliteratur-kritisch" ist, im Bereich der Etymologie, die Methodik von WALTHER Wnn; als eine von vielen sei seine Studie zu ved. rnUni- "\Veiser, Asket, Einsiedler" genannt, 'fl./J!J.rx 7 (1961) 24ff.
3! UNTERMANN 1975, 13, 14.
GroßcorpUB-Etymologikon 23
im Falle des Verhältnisses von altindoar. 8aufi:ra- "männlich, stolz" bzw. seiner in die Hochsprache umgesetzten Ausgangsform * sö(fr-a- zu griech. crwTI;p, dem hellenistischen Herrscher-Epitheton, das in eine griechische Wortsippe als regelrechte Ableitung eingebettet ist 32 und sich, nach T. B~'RRows brillanter Erklärung, somit als hellenistisches Lehnwort im jüngeren Altindoarischen erweist33 .
4.3.3. Die Stichwörter sind sodann nicht nur danach zu befragen, woher sie kommen,- nach welcher Grammatik sie bei ihrem Zustandekommen gebildet wurden -- sondern auch danach, wohin sie gegangen sind: ob Jateinische "\Vörter in romanischen, altindoarische in späteren indoarischen Sprachen fortleben, nnd in welchen. -Es sind ferner, wie das in jedem Etymologikon geschieht, die vergleichbaren Formen in den verwandten, vornehmlich in den nächstverwandten Sprachen anzuführen.
4.3.4. Unter diesen Lemmata soll mitgeteilt werden, welche etymologischen Deutungen den betreffenden VVörtem in der VVissenschaftsgeschichte gegeben worden sind (o. 4.2). In schwierigen Fällen, die immer wieder die Kombinationsfreude der Forscher angeregt haben, kann dies - ich deutete es bereits an - für ein Einzelwort eine mehrseitige Darstellung erfordern.
4.3.5. Nach Möglichkeit -- wenn dieser Sprache nicht bereits ein wortgeschichtliches Wörterbuch gewidmet oder versprochen ist - soll das innersprachliche Schicksal der Wörter sich an die Beschreibung ihrer Entstehung und ihrer Vergleichung mit dem Sprachgut verwandter b'prachen anschließen; es soll also ein Wörterbuch zugleich etymologisch und wortgeschichtlich sein 34 •
4,4. Ich weiß nicht, ob ich alle Forderungen an ein ideales etymologisches Wörterbuch schon angeführt habe; es verschlägt nichts, wenn
32 Vgl. CHANTRAlNE 1977, 1085a, mit Lit. 33
T. B LTRROW, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and lrelaml!970, 15ff.
34 L.ZGUSTA, Manual of Lexicography (Den Haag-Paris 1971) 200ff. behandelt historische und etymologische 'Wörterbücher nebeneinander, stellt in pragmatischer Weise fest, daß ,.the historical and the etymological [elements] · · · are almost always intenningled" (a. a. 0. 200) und erwähnt. offenbar als wünschenswerten Typus, VVörterhücher wie ERNOlTT--MElLLET oder ABA..EV
Welche "try to be both etymological and hiRtorical, combining the two asp~cts'; (a. a. ~· 201 ). ~~Für ABAE\' (unten S. 31 ff.} ist die Trennung von Etymologie ~nd \\ ort~e~~hiChte weitgehend aufgehoben, dies aber wohl als Folge glückheher personbcher Konstellationen.

Idealforderungen
ich hier abbreche, ohne die eine oder andere Forderung noch erwogen zu haben. Das bisherige zeigt bereits, was ein solches ldeal-Etymologikon einer echten Großcorpus-Sprache wäre: ein Thesaurus, multipli~ ziert mit Ableitungslehre, Sprachvergleichung und Wissenschaftsgeschichte. Das wäre gewiß ein wundervolles Buch, gegen das sich lediglich ein Einwand erhebt: es würde 30, vielleicht 50 Bände umfassen 35 und damit die Kapazität fast jedes Verlegers, fast jedes Käufers ü"berfordern; und es setzt einen Verfasser voraus, der in voller geistiger Frische das 250. Lebensjahr erreichen sollte. Solange diese wirtschaftlichenund biologischen Hemmnisse nicht überwunden sind, sind wir zu der Frage verpflichtet, durch welche Einschränkungen wir an Stelle dieses Ideals ein Etymologikon gewinnen könnten, das optimal, aber doch noch von dieser Welt ist.
5.1. Das E tymologikon einer Großcorpus-Sprache wird weiterhin darauf verzichten müssen, alle Lexikoneintragungen als eigene Lern~ mata anzuführen. Es wird dabei bleiben, Wortfamilien anzuführen, und in diesen nur ausgewählte Ableitungen mitteilen - vor allem solche, die unerwartete Aussagen zur \Vortbildung, zur Semantik oder zur Lautgeschichte machen. Ein Etymologikon einer reich bezeugten Sprache kann nicht deren deskriptives Lexikon und deren VV ortbildungs~ lehre ersetzen.
5.2. Für die Informationen der f->prachvergleichung ist größte Sparsamkeit nötig und möglich, da diese Informationen zumeist schon wiederholte Male in anderen Büchern stehen. Niemand kann dazu angehalten werden, ein Buch zu schreiben, das einem Robinson, der dieses Buch als einziges auf seine Insel gerettet hätte, ermöglichen würde, mit diesem einzigen Buch ein Doktorat in der entsprechenden Sprachwissenschaft zu planen. Dissertationen und Rigorosen werden immer noch in der überwältigenden Mehrheit der Fälle in Seminarbibliotheken und nicht auf unbewohnten Inseln vorbereitet. - Im Falle der von mir behandelten Sprache bedeutet dies: die wichtige
35 Es gibt ein reales Beispiel, wo ein "et,ymologisch" genanntes Wörterbuch - es ist einer der bedeutendsten Kultursprachen der Moderne gewidmet -eine höhere zweistellige Zahl von Bänden erreicht hat: \\'~. vo~ W ARTBUROs Französisches Etynwlogisches Wörterbuch. V gl. dazu die interessanten Urteile von MALKIEL 1976,64 {"For these scholars, who, Jike ... "'~artburg, dreamed of an etymological dictionary built into a thesaurus ... , the opportunities afforded by diffusionist analysis were tobe exploited"), 74f. {",Vartburg's ide~t - conceived around 1920, if not earlier - . .seems, in retrospect, to have entailed a considerable overextension ofhuman and archival resources").
Vergleichsmaterial 25
Information, ob ein archaisches indoarisches Wort ausgestorben ist oder in mehreren neuindischen Sprachen fortlebt, könnte durch eine Formel von pä:~lineischer Kürze erreicht werden, die im letzteren, positiven Falle auf das vorhandene indoarische \\7 örterbuch von SIR RALPH Tt.:RNER hinweist36
; daß ein altindoarisches \Vort wie mätdr
"Mutter" auf ein bereits indogermanisches Zeichen zurückf(eht, das muß nicht durch eine Aufzählung dieser \Vortgleichung in allen indogermanischen Sprachen dokumentiert werden, sondern hier genügt eine Information wie "idg., s.Jat. miiter usw." und ein knappster Hinweis auf eines der vielen Bücher, welche die ganze "Mutter"-Gleichung anführen.
5.2.1. Ein besonderes Problem bildet in meinem Falle, auf welche \V eise die für das Indoarische wichtigste Information mitgeteilt werden soll: ob ein indoarisches Lexem indo-iranischen lJrsprungs ist oder nicht. Auch hier ist Kürze geboten: der Hinweis auf eine einzige iranische Entsprechung und die formelhaft kurze Hinführtmg auf die jeweils ausführlichste Sekundärquelle sollten für die Aussage genügen, daß eine indoarische \Vortsippe bereits indoiranisch ist. Einfacher wäre es gewiß, wenn man, wie im Falle von SIR RALPH TCRNERs Buch, auf eine einzige gesamt-iranische Wortsammlung verweisen könnte; doch muß ich mit aller Härte sagen, daß es nicht mein Verschulden ist, wenn nicht alle Kenner und Hüter iranischer Sprachen besonders einiger erst in diesem ,Jahrhundert erschlossener mitteliranischer Sprachen - deskriptive Glossare herausgebracht haben, deren Vorliegen erst ein gesamt~iranisches \V örterbuch ermöglicht hätte 37 • Die Verpflichtung, unter meinen indo-arischen Stichwörtern heimlich ein unvollkommenes gesamt-iranisches \Vörterbuch zu veröffentlichen, der ich seinerzeit einigen Ratgebern zuliebe gefolgt bin, würde ich heute nicht mehr verspüren.
o.3. Auf die Hinführung zu den älteren, nicht allgemein akzeptierten Deutungen darfman nicht verzichten, wie ich ausdrücklich bekannt habe (o. 4.2). Aber auch hier ist die Wahl extremer Kurzformen möglich: also auf keinen Fall Referate aller vorgeschlagenen Deutungen; möglichst auch nicht die Zitate der Stellen der jeweiligen Deutungsveröffentlichung, sondern, wo immer möglich, ein Kurzhinweis auf Sammlungen solcher Zitate (in Bibliographien, älteren Sammelwerken u. dgl.). Man darf dem späteren Untersucher eines bestimmten
Wor~- die vorhandene Sekundärliteratur nicht verschweigen; aber 311
R[ALPH] L. Tl'RNER, A Comparative Dictionary of the lndo-Aryan Languages. London 1966.
37 [Nach der Niederschrift dieser Zeilen erschien erlreulicherweise ein
Umfanglieber Band, der in einem begriißenswerten Gegensatz zu den oben geführten Klagen steht und uns der Möglichkeit, daß ein gesamt-iranisches Wörterbuch geschaffen werde, einen kräftigen Schritt näherbringt: [SIR] H[AROLDJ W. BAILEYs Dictionary of Khotan Saka, Ca:mbridge 1979.]

26 Nutzung älterer Sammlungen
man kann von ilun verlangen, daß er in einer Bibliothek solchen Samruhmgen die Fachliteratur entnimmt und dann diese selbst aufsucht und kritisch nachliest. Viele modernere etymologische Wörterbücher haben den V orteil genutzt, daß ihr Gegenstand einen Vorgänger hatte, der die Fachliteratur einer überlebten V\lissenschaftsepoche enthielt, die, wie ich nochmals betonen möchte, den Keim enthalten kann, der in der dialektischen Begegnung mit anderen Meinungen das eTlJf.LOV zu Tage bringt. Ein mir durch seine herzhaften Ausdrücke lieber Kollege hat solche ältere Kompendien treffend als "Quatsch-Sammlungen" bezeichnet. Einige der heutigen Gelehrten erleichtern sich ihre Arbeit durch einen Rückgriff auf diese so ungalant benannten Bemühungen einer früheren Generation, so etwa H.TAL~IAR FRIHK durch Rückverweise auf das etymologische "\V~ örterbuch des Griechischen von 1916, den "BOTSACQ" 38. Im Falle meines eigenen nun als Lexikon abgeschlossenen Etymalogikans hatte ich keine Möglichkeit zu einem solchen Rückverweis, denn das letzte abgeschlossene Etymologikon des Altindischen stammte aus dem vorigen ,Jahrhundert und zitierte keine Fachliteratur39. Zu der Ermunterung, die I .. ast eines neuen etymologischen Wörterbuchs dieser Sprache auf mich zu nehmen, trägt zweifellos die Tatsache bei, daß ich heute neben anderen Sammel- und V erweiswerken mein eigenes älteres Buch zu derlei bibliographischer Entlastung verwenden könnte.
6. Es ist gewiß kein ideales Werk, das ich hier skizziert habe; statt eine lesbare Aufzählung des Gesicherten an Material und Forschungsgeschichte zu bieten, jagt es den Benützer immer wieder zu den Regalen seiner Bibliothek, damit er in anderen Büchern nachlese, wo dieses Gesicherte schon steht. Aber es ist ein praktikables V\Törterbuch, ein Wörterbuch, das in absehbarer Zukunft abgeschlossen werden könnte. Es ist keine Gefahr, daß bei einer so rie:;;igen und problemreichen Materie wie der Hochsprache Altrlndiens angesichtsdieser Darstellungsform lediglich ein kleines Bändchen entstünde, das man nur nach der Bewältigung großer Vorarbeiten überhaupt benützen könnte,
3~ EMILE ßOIHACQ, Dictionnaire etymologique de la langue Grecque. Heidelberg-Paris 1916.
39 Es handelt sich um C. C. UHLENBECK, Kurzgefaßte8 etyrnologi8ches Wörterbuch der Altindischen Sprache, Amsterdam 1898/9. Alle übrigen Versuche sind Torsi geblieben; eine interessante Schilderung der bis 1935 unternommenen Bemühungen bietet \V ALTHER WOHT, Vergleichendes und etymologisches Wörterbmh des Alt-Indoarischen (Altindischen), Erster [und einziger] Teil (Heidelherg 1935) 14ff.
Realisierbarkeit 27
wie jene schmale und doch an Informationsgehalt unübertroffene Grammatik des ersten - in Altriodien lebenden - linguistischen Genius, den wir kennen. Vermutlich würde auch dieses auf Sparsamkeit in der Mitteilung des Bekannten achtende Werk wieder ein DreiBände-Buch werden, das aber diesmal den Namen "etymologisches (oder etymologisch-wortgeschichtliches?) Wörterbuch", olme einschränkendes Adjektiv, verdiente. Daß es nicht das "ideale \\-'örterbuch" würde, das ich oben zu skizzieren begonnen habe (4.3[.1 ff.]), ist mir klar; aber es ist praktikabel und abschließbar. Und darauf kommt es an; "wer ... nur Ideale anerkennt, der will eigentlich keine Besserung", hat ein heute vielfach neu entdeckter Linguist des 19. und frühen 20.Jahrhunderts, JAN BAlJDOUIN DE CoeRTENAY, in einem anderen Zusammerihang gesagt40 .
411 Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen (Leipzig 1908) 46.- [Korr.Note: Leider kann auf das Buch von MAX P~'ISTEH, Einführung in die romani8che Etynwlogie { Darmstadt J 980) und sein umfängliches Kapitel "Die etymologischen ·Wörterbücher" (H. 121-187) nur noch hingewiesen werden; es ist wenige Tage vor dem Ausdruck dieser Hchrift erschienen].

ANHANG 1:
DIE PRINZIPIEN EINES ETYMOLOGISCHEN WÖRTERBUCHES
Von VAsiLI.J lvANonc ABAEY (1952/1980)
Deutsch von HEINZ DIETER PoHL •
1. DIE BEDEtl'l't,"NG DEs WoRTES "ETYMOLOGIE"
Das Wort ,.Etymologie" ist aus griech. hu~'o' ,. wahr(haft)" und J.byo, .,Wort, Bedeutung" gebildet und bedeutet wörtlich die Lehre von den "wahren", d. h. ursprünglichen Bedeutungen der Wörter. In dieser Bedeutung begegnet das Wort bei den späteren griechischen Autoren (zuerst beim Stoiker CHRYHIPPOS),. von denen es auch die lateinischen Grammatiker übernommen haben. VARRO (De lingua latina V, 2) definiert die Etymologie als Teil der Grammatik, der studiert cur et unde sint verba ("warum und woher die Wörter sind"). In neuerer Zeit wird die Etymologie gewöhnlich als diejenige Disziplin der Sprachwissenschaft definiert, die sich mit der Herkunft der Wörter beschäftigt I Doch was ist unter .,Herkunft" des Wortes zu verstehen? Wenn man sagt, daß russ. perstenb "Ring" von perst "Finger" mit Hilfe eines bestimmten Formans gebildet ist, kann man hier haltmachen und die Etymologie, d. h. die Herkunft des Wortes perstenb, für festgestellt
* Zur Genese dieser vom Autor überarbeiteten Fassung s. die Vorbemerkungen, o. S. 5f. Der Original-Titel findet sich o. S. 7. - Russischen Bei
spielen wurden vom Übersetzer die deutschen Bedeutm1gen beigefügt; sonstige Zusätze erscheinen in eckigen Klammern.
1 Das französische "\V örterbuch "LAROUSSE" (1913) definiert die Etymologie als "science qui s'occupe de l'origine des mots". So auch das "Erklärende Wörterbuch der russischen Sprache" (D. N. USAKOV, Tolkovyj slovarb rus.~kogo jazyka): "Gebiet der Sprachwissenschaft, das den Urspnmg der Wörter untersucht.'' Nich MEYERs Enzyklopädischem Lexikon (1897): "Untersuchm1g der Grundbedeutnng, des Ursprungs der Wörter" (Etwas anders VIII9 (1973) 231 b. (M. M.)].

30 Anhang Abaev
halten. Aber was bedeutet z. B. die Feststellung der Etymologie von russ. dva "zwei"? Soll man es mit aksl. dbva oder idg. *duwO verbinden? Kann man denn behaupten. daß diese Gegenüberstellungen den Ursprung des Wortes dva als bestimmte lautliche und semantische Einheit erklären? Geben sie Antwort auf die Frage, aus welchen vorangegangenen stofflichen Elementen und auf welcher semantischen Grundlage dieses Zahlwort entstanden ist·? Natürlich nicht. Diese Gegenüberstellungen führen nur die Geschichte des Wortes in bestimmte vergangene Epochen zurück, bis in die Zeit der slavischen rmd indogermanischen Grundsprache. Zum Ursprung im engeren Sinn gelangen wir so nicht. Daher schlagen einige Forscher, welche die Et~ymologie definieren, vor, nicht vom "Ursprung", sondern von den "genetischen Zusammenhängen" des Wortes zu sprechen. So beschreibt A. A. BELEC'KJ.r die Etymologie als ,.Feststellung der auf- und absteigenden genetischen Zusammenhänge einer bestimmten Form einer bekannten Sprache'' 2 .
Der italienische Linguist V. PrsANI sieht in seiner Monographie die Aufgabe etymologischer Forschungen darin, determinare i materiali Jormali adoperati da chi per primo ha creato una parola, e insieme il concetto ehe con e8sa egli ha voluto esprimere 3. Obwohl diese Definition nicht vom "Ursprung" spricht, versteht sie ihn dennoch darunter. Für die sprachwissenschaftliche Weltanschammg des Autors ist charakteristisch, daß er die Benennung als einen Akt individueller Wortschöpfung ansieht.
Vielleicht besteht kein Grund, den Terminus., Ursprung" aus der Definition der Etymologie zu verbannen. Aber man muß die bekannte Relativität dieses Tenninus im Auge behalten. Der "Ursprung" des Wortes gibt nicht immer seine ursprüngliche Bildung aus irgendwelchen vorausgegangenen Elementen an. In der Regel gelingt es nur, die genetischen Zusammenhänge eines "'T ortes bis zu einer bestimmten vorausgegangenen Epoche (man kann sagen, bis zur Gnmdsprache) zurückführen, ohne letztlich zu entdecken, "warum und woraus" dieses entstanden ist.
Die wissenschaftliche Etymologie, wie auch im allgemeinen die Sprachwissenschaft, beginnt mit der Begründung der vergleichend-historischen Methode, in deren Rahmen die Etymologie folgenden tatsächlichen Inhalt erhielt:
2 A. A. BELECKIJ, Principy €timologi6eskich issledovanij [Prinzipien etymologischer Forschungen]. Avtoreferat doktorskoj dissertacii, Kiev 1951, S. 3.
3 V. PT~ANJ, L'etimologia. 8Wria, questioni, metodo. Milano 1947, 8. 79·~ 80 [2. Auflage Brescia i967; deutsche Übersetzung: Die Etymologie. Geschichte ~Fragen- Methode. München 1975, 8. 79]: "das fonnale Sprachmaterial zu determinieren, das derjenige verwendete, der ein Wort als erster geschaffen hat, und zugleich die Vorstellung, die er mit diesem Wort ausdrücken wollte".
Historische Lexikologie 31
1. Erbwörter einer bestimmten Sprache mit. den Wörtern der verwandten Sprachen zu vergleichen und deren fonnale und inhaltliche Geschichte bis in die Gnmdsprache zurückzuverfolgen; 2. \Vörter, die sich innerhalb einer bestimmten Sprache als abgeleitet erweisen (innersprachliche Derivate), hinsichtlich ihrer Bestandteile, der \Vurzel, des Stammes und der Fonnantien im Rahmen dieser Rprache zu identifizieren; 3. bei Lehnwörtern deren Quelle zu zeigen.Auf diese drei Aufgaben läuft der Inhalt der etymologischen Forschungen hinaus.
2. DIE ETYMOLOGIE H-IT EI~ TEIL DER HISTORlOCHEN LEXIKOLOGIE
Die Etymologie ist nicht irgendein besonderer, selbständiger Zweig oder Teil der Sprachwissenschaft; sie bildet einen Teil der historischen Lexikologie, und nur in dieser Eigenschaft erhält sie ihre Existenzberechtigung.
Im traditionellen Gebrauch wird der Terminus ,.historisches \Vörterbuch" nur auf ein \V örterbuch angewendet, das die Geschichte der Wörter ausschließlich auf Grund schriftlicher Denkmäler einer bestimmten Sprache verfolgt 4
. Folgt man dieser Einsicht, bedeutet dies, daß schriftlose Sprachen und sehr junge Schriftsprachen keine Geschichte haben. Eine solche engherzige philologische Auffassung von: "Geschichte" ist unannehmbar und abzulehnen. Ein V\Törterbuch wird nicht historisch in dem Maß, in welchem die Wörter in schriftlichen Denkmälern belegt sind, sondern in dem Maß, in dem es von echtem Historismus erfüllt ist, d. h., in dem es auf dem Studium der Gesetze der Sprachgeschichte im Zusammenhang mit der Geschichte der Gesellschaft und der Geschichte eines Volkes aufgebaut ist.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Gegenüberstellung eines etymologischen Wörterbuches mit einem .,historischen" Wörterbuch nach traditioneller Ansicht nicht berechtigt. Obwohl sie verschieden konzipiert sind, dienen sie nur einem Ziel ·- der Geschichte.
4 Die Verfasser eines etymologischen \Vörterbuchs der lateinischen Sprache, ER!'I;OUT nnd MEILLI<~'f, erklären im Vorwort, daß sie sich die Arbeit geteilt haben, und schreiben: A. ERNOL"l' "übernahm, was durch das Studium der Texte zu erfahren ist" (par l'etude des textes), mit anderen \Vorten, .,die Sachlage in der historischen Epoche der lateinischen Rprache" (l'etat des choses ii. l'epoque historique du latin). A. MEILLET "übernahm den vorhistorischen Teil" (la partie prehistorique), d. h. "die Geschichte der Wörter vor den ersten Textbelegen" (l'histoire des mots avant les premie.res donnes des textes). Die geschätzten Autoren entgingen nicht dem Widerspruch: es er\\•eist sich nämlich der .,vorhistorische" Teil als "Geschichte". Aber deutlich erscheint der Gedanke, daß man \Vortgeschichte nur auf Grnnd von Texten einer bestimmten Sprache begründen könne.

32 Anhang Abe.ev
Das ,,historüwhe" \V örterbuch ist auf rein philologischer Dokumentation aufgebaut und verfolgt die \Vortgeschichte auf Grund schriftlicher Zeugnisse der jeweiligen Sprache.
Das etymologische "Wörterbuch, das auch die Daten der philologischen Dokumentation ausschöpft, beschränkt sich nicht auf diese; es erforscht die Geschichte und die genetischen Zusammenhänge der Wörter auf der breiten Basis der vergleichend-historischen Sprachwissenschaft und geht damit weit über den Ralunen hinaus, der mittels der schriftlichen Denkmäler einer ~i'prache skizziert wird.
Das "historische" \Vörterbuch interessiert sich nur für die Geschichte eines Wortes außerhalb der Abhängigkeit von seinen genetischen Beziehungen mit anderen \Vörtem dieser Sprache und, noch mehr, anderer Hprachen.
Hingegen ist das etymologische Wörterbuch bestrebt, mit maximaler Breite und Tiefe diese genetischen Beziehungen aufzudecken, indem es sich auf die ganze Summe der historisch-phonetischen, historisch-morphologischen und historisch-semasiologischen Daten der jeweiligen Sprache stützt sowie auch auf die ganze Familie oder Gruppe verwandter Sprachen und- was EntlehmmgPn betrifft - auf nicht verwandte Sprachen.
Das "historir-whe" \V örterbuch erzeugt das Bild einer pri\~ilegierten Sonderstelhmg von Sprachen mit jahrhundertealter schriftlicher Überlieferung.
Ein etymologisches \V örterbuch kann fiir jede beliebige Sprache abgefaßt werden, nicht nur für Sprachen mit langer schriftlicher Tradition, auch für solche mit noch junger Schrifttradition und für schriftlose Sprachen, wenn nur die Daten aus der Dialektologie und der vergleichend-historischen Forschung erlauben, die Geschichte des Lexikons der Sprache für einen bedeutenden Zeitraum ihrer Entwicklung zu rekonstruieren.
Dies sind die wichtigsten Unterschiede zwischen einem ,.historischen" und einem etymologischen \Vörterbuch. Aber sie sind unwesentlich im Vergleich mit dem, was diese WÖrterbücher verbindet: sie gehören ein und demselben Gebiet der Sprachwissenschaft an -·-der historischen Lexikologie.
Jede Etymologie, sogar wenn sie nur auf den einfachen Vergleichzweier genetisch zusammengehöriger Formen hinausläuft, enthält Elemente der Geschichte. Andererseits kann die einfaehe Registrierung von Formen in einigen Schriftdenkmälern auch einen historischen \Vert haben. Es versteht sich von selbst, daß gute etymologis~he und philologische Untersuchungen mehr enthalten müssen, als die bloBe Gegenüberstellung oder Registrienmg von Formen.
Es wurde bereits versucht, in einem Wörterbuch das im engeren Sinn "historische" Material (Dokumentation auf Grund der schriftlichen Zeugnisse der jeweiligen Sprache) mit dem et:ymologischen zu vereinigen. So in dem erv.•ähnten lateinischen etymologischen Wörterbuch von ERNOUT und MEIL
LET. In diesem Wörterbuch sind die einzelnen Stichwörter folgendermaßen abgefaßt: Zuerst wird eine philologische Dokumentation des \Vort-es bei den lat-einischen Schriftstellern gegeben; es wird auf seinen Gebrauch in älterer und späterer Zeit und auf seine Gebrauchsfrequenz hingewiesen: welche Verschiedenheiten in Form und Bedeutung bei diesem Wort in verschiedenen Epochen und bei verschiedenen Autoren festgestellt werden können; welche Derivationen dieses Wort haben kann. Darauf folgt die eigentliche Etymologie, d. h. die
Wortgeschichte 33
Erklärung der genetischen Beziehungen dieses Wortes zu anderen Wörtern des Lateinischen und der verwandten indogermanischen Sprachen, bzw. ein Hinweis auf seine Herkunft, wenn es sich um ein Lehnwort handelt.
3. GESCHICHTE DER WöRTER l'ND GESCHICHTE DES VOI..KE8
Sobald ein et:ymologisches Wörterbuch nach seiner Bestimmung nichts anderes als eine Geschichte der Wörter sein kann, wird der enge Zusammenhang zwischen etymologischen Forschungen und Forschungen zur Geschichte und Ethnogenese [des Volkes] sichtbar.
Die Geschieht€ der \Vörter ist mit der Geschichte des Volkes aufs engste verbunden, unvergleichbar enger als die Geschichte des grammatischen Systems. Der \\-r ortschatz einer Sprache ist Veränderungen besonders leicht zugänglich, er befindet sich in einem Zustand fast ununterbrochenen "\\-' andels. Allerdings verändert sich das Lexikon nicht wie der Überbau, nicht durch Wegfall von Altem und Aufbau von Neuem, sondern durch Ergänzung des vorhandenen Wortschatzes durch neue \Vört-er, die im Gefolge von VeräJ?-derungen der sozialen Struktur und der Entwicklung von Produktion, Kultur, \Vissenschaft u, dgl. entstanden sind. Was den Grundwortschatz anbelangt, so wird dieser in der Hauptsache bewahrt und benützt, als Grundlage des Wortbestandes der Sprache.
Dies ist auch verständlich. Es besteht keine Notwendigkeit, den Grundwortschatz zu tilgen, wenn er eine Reihe von historischen Perioden hindurch ·mit Erfolg verwendet werden konnte.
Die Unterscheidung zwischen Wortbestand und Grundwortschatz hat erstrangige Bedeutung für die etymologische Arbeit, für die richtige Auswertung etymologischer Untersuchungen in historischer Hinsicht und ganz allgemein für das Problem des Zusammenhanges zwischen der Geschichte der Sprache und der Geschicht-e des Volkes.
Der Gnmdwortschatz hat dank seiner Langlebigkeit im Verlaufe einer Reihe von Jahrhunderten eine äußerst wichtige Bedeutung für die Beurteilung der Herkunft eines Volkes und seiner Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Völkern (ethnogenetisches Problem).
Der übrige Wortschatz erweist sich dank seiner Anfalligkeit für Veränderungen, die aus den Lehensbedingungen der Gesellschaft entspringen, als besonders wertvoll für die Beurteilung der Prozesse, die mit der Veränderung der Sozialstruktur und mit der \\rirtschaftlichen, kulturellen usw. Entwicklung zusammenhängen.
Besonders ist auf die Bedeutung einer Gruppe des Lexikons hinzuweisen: auf die Lehnwörter. Sie liefern oft das wertvollste Material in bezug auf einstige Kontakte und kulturelle Beziehungen des Volkes mit anderen Völkern.
Daher findet die et,ymologische Forschung im allgemeinen, im besonderen aber die Zusammenstellung vollständiger etymologischer Wörterbücher einen Ehrenplatz unter den Aufgaben der Sprachwissenschaft als Gesellschaftswissenschaft.

34 Anhang Abaev
4. GESCHICHTE DER WöRTER nm GESCHICHTE DER DENKENS
Mit diesen Ausführungen erschöpft sich nicht die wissenschaftliche Bedeutung und das Interesse etymologischer Untersuchungen. Die Geschichte der \Vörter hängt nicht nur mit der äußeren Geschichte des Volkes, sondern auch mit der Geschichte seines Denkens zusammen. Die Sprache bewahrt als "unmittelbare gedankliche Wirklichkeit" ein vielhundertjähriges Bild menschlicher Geschichte- das Erkennen, das Verstehen, die Unterwerfung der Umwelt.
\\i' enn die Etymologie nicht nur der formalen, sondern auch der inhaltlichen Seite der Wortgeschichte hinreichende Aufmerksamkeit schenkt, ist sie in der Lage, reiches Material zur Dar~tellung der Geschichte des menschlichen Denkens zu liefern: wie und auf welchen Wegen erfolgt. das Begreifen und die Benennung dieser oder jener Erscheinungen und Beziehungen, wie erkennt der Mensch mit. Hilfe der Sprache die Wirklichkeit, "eignet er sie sich an", wie begründet er dank der abstrahierenden Arbeit seines Geistes aus einer Vielzahl von Einzelformen und Einzelvorstellungen allgemeine und abstrakte Begriffe - das sind die Fragen, zu deren Beleuchtung etymologische Untersuchungen ein vielf<ilt.iges Material liefern.
Die etymologischen Forschungen illustrieren z. B. gut einen wichtigen Prozeß in der Entwicklung des Denkens: allgemeine und abstrakte Begriffe entstehen nicht plötzlich; sie bilden sich langsam auf der Basis der konkreten, bildliehen Vorstellungen. Altiran. suxra- .,rot" enthält die Wurzel 8Uk
"Feuer", .,brennen"; das Bild des Feuers gab die Grundlage des abstrakten Begriffs .,rot". Osset. arf "tief' stammt aus altiran. *iipra-, zu iip- "Wasser"; dem abstrakten Begriff "Tiefe" ging die konkrete Vorstellung vom "tiefen "\Vasser" (Fluß, Meer, See) voraus; aus der Form ""\Vassertiefe" entstand mit der Zeit der Begriff" tief' überhaupt. Russischem krut6j "steil" entspricht im Litauischen kraiitas ["Ufer"), slavischem brlgö "Ufer" im Deutschen Berg. Offensichtlich diente das Bild des steilen, jähen Ufers als Grundlage für den abstrakten Begriff "steil" [im Russischen]. So verhält es sich auch mit anderen abstrakten Begriffen. Dank den Erfolgen der etymologiRchen Forschung sehen wir, wie das menschliche Denken mit seiner wichtigsten Aufgabe, der Bildung allgemeiner und abstrakter Begriffe, fertig wird. Von den konkreten Begriffen "Feuer, Gewässer, Ufer, Berge" ausgehend werden die allgemeinen Begriffe "rot, tief, steil, hoch" usw. abstrahiert5 .
5 Es versteht sich von selbst, daß der Weg vom Konkreten zum Abstrakten nicht der einzige Weg der semantischen Entwicklung ist. Es gibt nicht wenige Beispiele, wo das Konkrete die Benennung nach dem Abstrakten erhält. [ ... J Wir haben Beispiele zur Bildung abstrakter Begriffe von konkreten angeführt, weil mit diesem Prozeß vor allem die entscheidenden Fortschritte menschlichen Denkens zusammenhängen.
Prinzipien der Etymologie
5. DIE ETYMOLOGIE ALH WIRRENRCHAFT IHT AURSERHALB DER
VERGLETCHE~D-Hlf-3TORTSCHEN METHODE "l~DENKBAR
35
Versuche, die Herkunft der \Vörter zu erklären und verwandte Wörter in Yerschiedenen Sprachen zu finden, wurden schon im frühen Altert.wn gemacht. Bei den antiken Autoren kann man nicht wenige solcher "etymologischer" Versuche finden 6. Es muß nicht darauf hingewiesen werden, daß sie verfehlt sind. Manchmal glückte den Autoren jedoch eine richtige Erklärung. Die sogenannten "Volkt-:~etymologien" sind ebenfalls nicht immer verfehlt. Auch in ihnen findet man manchmal ein Körnchen VVahrheit. Nichtsdestoweniger kann man von Etymologie als \Vissenschaft erst seit der fundierten theoretischen und praktischen Begründung der vergleichend-historischen Methode sprechen, d.h. seit dem Anfang des 19.Jahrhunderts. Diese Methode, die selbst. aus den Anfangsgründen der Etymologie erwachsen ist, insbesondere dadurch, daß gemeinsame Elemente in verschiedenen indogermanischen Sprachen zu Tage getreten sind, erarbeitete diejenigen exakten. oftmals überprüften Prinzipien und Kriterien der etymologischen Forschung, welche die etymologische Arbeit aus dem Bereich der Vennutnngen und Spekulationen auf den Boden exakter wissenschaftlicher Verfahren versetzen und Resultate teils absoluter, teils relativer Wahrscheinlichkeit hervorbringen. Ohne den disziplinierenden Einfhill dieser Prinzipien würde die Etymologie auf den schwankenden Boden, auf dem sich nur Phantasten und Dilettanten wohlfuhlen, zurückkehren.
6. PRINZIPTEX DEB ETUII fl) •t;JSCHEX FüRSCHl"XG
Die YOn der vergleichend-historischen Sprachwissenschaft ausgearbeiteten Prinzipien etymologischer Forschnng sind gut bekannt und wurden wiederholt dargelegt7
Als Grundprinzip, das mit dem 'Wesen der vergleichend-historischen Methode selbst zusammenhängt, kann man das Prinzip des Systems bezeichnen. Dieses Prinzip fordert, daß der Forscher, der genetische Zusammenhänge
6 Einer von PLATONs Dialogen, "Kratylos oder die Richtigkeit der Namen", ist zu einem großen Teil der etymologischen Betrachtung einer Reihe von griechischen W örtem gewidmet.
7 V gl. die zitierten Arbeiten von A. A. BELECKI,J [ Anm. 2] und V. PISANI [Anm. 3].

36 Anhang Abaev
zwischen den Wörtern herstellt, nicht den Rahmen einer bestimmten Sprache oder einer Gruppe von venvandten Sprachen, die auf eine gemeinsame Grundsprache zurückgehen, verläßtl'. Nur innerhalb dieser Grenzen kann die Feststellung etymologischer Zusammenhänge mit wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit auch in größeren Ausmaßen durchgeführt werden. Die t':"berzeugungskraft. von Zusammenhängen ist um so größer, je strenger wir lllls an den Rahmen des Systems halten und dabei das System einer Sprache oder einer Gruppe verwandter Sprachen im Auge haben. Der Vergleich von Wörtern, die zu verschiedenen Systemen gehören, kann keinen besonderen \Vert haben, ehe gezeigt wird, daß die Ähnlichkeiten ihrerseits ein System bilden, d. h. auf irgendeine ursprüngliche sprachliche Einheit zurückgehen.
Mit anderen \V orten: Die Etymologie hat immer von der genealogisehen Klassifizierung der Sprachen und vom Begriff des sprachlichen Erbes auszugehen.
Die Feststellung von genetischen Beziehungen zwischen \V örtern im Rahmen eines Systems wird auf Grund einer Reihe von Kriterien durchgeführt, von denen gewöhnlich das phonetische, das morphologische und das semantische an erster Stelle stehen.
Das phonetische Kriterium verlangt, daß die vorliegenden etymologischen Gleich1mgen und deren Erklänmgen unmittelbar auf den für diese Sprache oder Sprachgruppe festgestellten gesetzmäßigen Lautentsprechungen fußen. Der etymologische Zusammenhang von osset. ra:jyn mit russ. ldjatb "bellen" stützt sich nicht nur auf deren semantische Identität, sondern auch auf die feststehende Tatsache, daß für die indoiranischen Sprachen, zu denen das Oasetische gehört, Rhotazismus charakteristisch ist, d. h. die systematische Ersetzung von l durch r. _Folglich ist das Auftreten von r im Oasetischen anstelle von l im Russischen gesetzmäßig. Dies kann mit Beispielen wie russ. lul "Strahl" - osset. ruxs "Licht" u. a. veranschaulicht werden.
Das morphologische Kriterium verlangt. daß bei der etymologischen Analyse nicht nur mit einem Zusammentreffen von \Vurzeln und Stämmen gerechnet wird, sondern auch mit der Einheitlichkeit und der gesetzmäßigen Entsprechung von -\i\7ortbildungsformantien und allgemein mit der morphologischen Geschichte der Wörter. So besteht der Zusammenhang von osset. rast "gerade" mit Iatein. rectus oder von osset. Jyst ,,(auf)geschrieben" mit Iat-ein. pictus nicht nur in einer gemeinsamen Wurzel, sondern auch darin, daß diese \Vörter in beiden Sprachen Formen des Präteritalpartizips repräsentieren; vgl. im Ossetischen a-raz-yn a-rrest ,,lenken", fyssynjfinsun : jystjfinst "schreihen", im Lateinischen rego : rectus ,Jenken", pingo : pictus .. malen".
Das semantische Kriterium verlangt vom Etymologen besonders erns~ hafte Aufmerksamkeit nicht nur gegenüber der äußeren (phonetischen und morphologischen) Seite der verglichenen 'Wörter, sondern auch gegenüber der inhaltlichen Seite. Die Wege der semantischen Entwicklung der \Vörter sind des öfteren sehr verwunderlich und gekrümmt, was aber nicht bedeutet, daß auf diesem Gebiet \Villkür und Chaos herrschen und daß der Etymologe hier an keinen Rahmen und an keine Beschränkungen gebunden wäre. Eine breite Berücksichtigllllg des historisch-semantischen Materials aus verschiedenen
8 Dies bezieht sich natürlich nicht auf die Entlehnungen.
Probleme der Etymologie 37
Sprachen, diesmal nicht nur verwandter Sprachen, gibt den Leitfaden durch das scheinbare Chaos der semantischen Erscheimmgen und verleiht vielen etymologischen Erklärungen eine Schlagkraft von der inhaltlichen Seite her, wie sie sie auch von der formalen Seite her haben können.
Wenn wir z. B. osset. ca'-sgom (crPskom) "Gesicht" als Zusammensetznng von cwst .,Auge" und kom ,.Mund" auffassen, gehen wir nicht nur davon aus, daß eine solche Erklänmg den Normen der ossetischen Phonetik und 'Wortbildung nicht widerspricht, sondern wir stützen uns auch auf Fakten aus anderen Sprachen, wo der Begriff "Gesicht" auf die gleiche Weise ausgedrückt wird, z. B. awarisch berkal .,Gesicht" aus ber "Auge" und kal "Mund".
7. SCHWIERIGKEITEN UND ZWEIFEL
Es wäre ein großer Fehler, zu glauben, daß die etymologische Arbeit nnter Berücksichtigung der aufgezählten Prinzipien stets glatt vor sich ginge und immer zu soliden, keinen Zweifel hervorrufenden Ergebnissen führte. In Wirklichkeit finden wir in jedem beliebigen etymologischen \Vörterbuch neben den wahrscheinlichen auch eine große Anzahl problematischer und zweifelhafter Erklärungen. Es ist so, daß ein und dasselbe Wort bei verschiedenen Autoren bis zu einem Dutzend und mehr verschiedene Etymologien hat. Eine große Anzahl der Wörter bleibt im allgemeinen unerklärt. Woher kommt dies? Sehr oft infolge der objektiven Lage der Dinge: des FehJens oder der Mangelhaftigkeit von VergleichsmateriaL Hier sind wir machtlos. Nicht selten aber liegt die Wurzel des Übels in der Unzulänglichkeit und Unzuverlässigkeit der augewandten Methoden und Verfahrensweisen.
Die Sache ist, daß die angeführten Kriterien - Phonetik, Morphologie, Semantik ~-·-über keine absolute Genauigkeit- und Regelmäßigkeit verfügen.
Es ist bekannt, daß beispielsweise oft die Regelmäßigkeit- der Lautentsprechnngen durch Analogiewirkung gestört wird. Manche Schwankungen und Abweichungen von den herrschenden lautlichen Normen können auch, unabhängig von der Analogie, Einflüsse einzelner Dialekte sein.
So sind im Indoiranischen in einer Reihe von Fällen ,,ungeset-zmäßige" Schwankungen von st-immlosen aspirierten und nichtaspirierten Konsonanten zu beobachten. Indisch khan- "graben" entspricht iran. kan- (statt zu erwartendem *xan-). Ind. athar- (in dtharvan- "Feuerpriester") entspricht iran. ätar"Feuer". Altpers. amaxam ,.uns" muß lautgeset-zlich auf *asmi'ikham zurückgehen, aber im Awesta finden wir ahmiibm, im Altindischen asmdkam. Die indoiranischen Bezeichnungen für "Horn, kleiner Ast" werden als *Si'ikhii(altind. Stikhii-, pers. Sax) rekonstruiert, aber osset. sag ,,Hirsch'', sa.goj "Gabel" veranlassen uns, eine Parallelform *siika- anzusetzen. Osset. cad "See" und pers. läh "Brunnen" repräsentieren nnzweifelhaft ein und dasselbe \Vort, aber für ersteres ist altiran. *t.ata-, für letzteres *liitha- anzusetzen. Die Bezeich-

38 Anhang Abaev
nung fiir ,.Stadt" weist in den indoiranischen Sprachen ein Schwanken von *kantha- und *kanta- auf. Griech. E:yW weist auf idg. *e(jd(m), aber altind. ahdm auf *e(Jh6m (wonach griech. *ExW zu erwarten wäre). Es sind auch phonetische Schwankungen anderer Art zu beobachten, z. B. zwischen stimmhaftR,n und stimmlosen Konsonanten. So geht das Wort für "Herz" im Europäischen (altslav. srbdbce, griech. x~XpOiet, Iatein. cor, cordi.~ usw.) auf idg. *krd-, die indoiran. Form jedoch (altind. hrd-, awest. z;~rad-) auf idg. *fihrd- zurück. Es gibt gewisse Kategorien von Wörtern, die sich den Lautgesetzen "nicht unterwerfen wollen". Dazu gehören die sogenannten .. Kinderwörter" (Ammensprache), die lautnachahmend und lautmalend sind (Ideophone).
Holehe und ähnliche "Abnormitäten" können letztlich die Bedeutnng der Lautgesetze nicht erschüttern, aber sie zwingen dazu, vorsichtig zu sein und sich nicht blind auf die Cnfehlbarkeit dieser Gesetzmäßigkelten zu verlassen. Man kann sagen: eine Forschung, die sich sklavisch auf die Unfehlbarkeit der Lautgesetze gründet, hat nur halben \Vert; eine Forschung, die überhaupt nicht mit solchen Gesetzen rechnet, ist wertlos.
\Venn schon die Lautgesetze auf Schritt nnd Tritt durch alle möglichen "Anomalien" gestört werden, können die Gesetze der Remantik noch weniger auf Universalität und Unveränderlichkeit Anspruch erheben. Welche Gesetzmäßigkeit liegt z. B. darin, daß der Bär in einem Fall ,,Honigfresser" {im Slavischen), in einem anderen ,.Brauner" (im Germanischen) und in einem dritten Fall entweder "Zottiger" oder "Leckender" (durch beides wird litauisch Iokfis erklärt) benannt wird ?
Es ist kein Wunder, wenn von Zeit zu Zeit Stimmen laut werden die überhaupt jede Gesetzmäßigkeit auf dem Gebiet der Semantik Jeugnen 9. '
Die Schwierigkeiten, die bei der Feststellung der lautlichen und semantischen Geschichte der Wörter entstehen, führen zu Skeptizismus hinsichtlich etymologischer Untersuchungen überhaupt. Ein solcher Skeptizismus entstand bei einigen Linguisten - man kann vielleicht sagen, als Zeichen des guten Tones. A.MEILLET schrieb einmal, daß ihm 90 von 100 im Umlaufbefindlichen Etymologien zweifelhaft oder fehlerhaft erschienen.
Als Stammvater der heutigen Skeptiker ist der heilige Al'(WHTl~TH zu betrachten, der geschrieben hat: Ut somniorum interpretativ, ita verbarum origo pro cujusque ingenio judicatur ("mit der Entstehung der Wörter verhält es sich so wie mit der Erklärung von Traumbildern: jeder erklärt sie nach seinem eigenem Verständnis"). Was bei An;m._;nNrs naiv aus der Hilflosigkeit der \Vissenschaft seiner Zeit formuliert worden ist erweist sich heute nach den gewaltigen Erfolgen der Sprachwissenschaft, al~ H,ypertrophie eine~ Skeptizismus besonderer Art. Ein Skeptizismus, der nicht konkrete Mängel und Lücken der etymologischen Forschung vor Augen hat, sondern die etymologische Arbeit als Ganzes, entbehrt heute jeder Grundlage. Es bleibt eine nnabänder-
9 "Est-il possihle de fonnuler les lois selon Jesquelles !es sensdes mots se transfonnent? Nous sommes disposes a repondre que non. La complexite des faits est teile, qu'elle echappe 8. toute regle certaine" (MICHEL BR11:AL, L'histoire des mots, 1887).
1 Kenntnis der Realien 39
liehe Tatsache, daß die gesamte vergleichend-historische Sprachwissenschaft aus Etymologien entstanden, auf ihnen gewachsen und zu einem bedeutenden Teil auf ihnen begründet ist. Ein Wendepunkt in der Geschichte der Sprachwissenschaft war das Gegenüberstellen von \Vurzeln und Formen des Sanskrit mit solchen der europäischen Sprachen. Es war etymologische Arbeit, was am Anfang der Linguistik als \Vissenschaft stand. Die erfolgreiche Entwicklung der vergleichend-historischen Sprachwissenschaft war deshalb möglich, weil bei aller Kompliziertheit und Vielfalt der sprachlichen Erscheinnngen und Prozesse sich ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten in den lautlichen wie in den morphologischen und auch den semantischen Entsprechungen zeigten: in den einen mehr, in den anderen weniger. Hätte es diese Gesetzmäßigkelten nicht gegeben, es gäbe keine vergleichend-historische Sprachwissenschaft.
Wenn bei alledem in der etymologischen Arbeit viel Zweifelhaftes und Ungewisses bleibt, so bedeutet dies nur, daß die Methoden dieser Disziplin immer noch unvollkommen sind und daß man sich zu deren Verbesserung ohne Unterlaß anstrengen muß. ~Ur Skeptizismus nnd Pessimismus ist hier kein Platz. Skeptizismus hinsichtlich der Etymologie birgt Agnostizismus hinsichtlich aller Sprachgeschichte in sich.
\Velches sind die Wege zur Übenvindung dieser Schwierigkeiten, die bei etymologischen Untersuchungen auftreten 1 Es ist nicht leicht, Universalrezepte, die in allen Fällen passen, zu empfehlen. Oben wurden die Kriterien aufgezählt: das Kriterium des Systems, der Phonetik, der Morphologie, der Semantik- sie behalten unter allen Umständen ihre Bedeutung. \Venn man mit irgendeinem von ihnen nicht ganz zufrieden ist, muß man die übrigen zur Erklärung des betreffenden Wortes um so strenger anwenden. Wenn die eine oder andere Etymologie zweien dieser Kriterien nicht entspricht, empfiehlt es sich, diese Etymologie aufzugeben.
Aber es gibt noch ein Kriterium von erstrangiger Wichtigkeit, das während der ganzen Zeit der vergleichend-historischen Sprachwissenschaft leider ein Schattendasein gefiihrt hat.
8. KE~NTNIH DER REALIEN ~DIE WICHTIGSTE BEDINGUNG EINER
ECHT \VlHHENSCHAFTLICHEN ETYMOLOGIE
Wir haben schon auf die Verdienste der vergleichend-historischen
Sprachwissenschaft, welche die wissenschaftlichen Grundlagen, Methoden und Verfahren der etymologischen Forschung erarbeitet hat, gebührend hingewiesen. Wer die Erfolge der vergleichend-historischen Sprachwissenschaft auf dem Gebiet der Etymologie hoch einschätzt, darf freilich nicht die Augen vor den schwachen Seiten vieler ~ man
kann sagen, der Mehrheit - der etymologischen Arbeiten des vergan
genen und unseres ,Jahrhunderts verschließen. Der wichtigste unter
Oiesen Mängeln ist die Mißachtung der Realien, zum Teil laber] bloß

40 Anha.ng Ab&ev
deren Unkenntnis 10. Die Tatsache, daß schon J.GRIMM von seinem stetigen Streben spricht, "von den Wörtern zu den Sachen überzugehen" und darauf hinweist, daß "hei Etymologien oft die Kenntnis der Sachen nützlich ist", daß auch später bedeutende Linguisten wie z. B. H. ScHt:CHARDT ihre Stimme gegen lebensfremde Etymologien erhoben und selbst gute Beispiele dafür gegeben haben, wie der \Veg zu einer richtigen Etymologie durch tiefschürfendes Studium der Realien zu finden sei, hat an dieser Situation nicht viel geändert. Das Fehlen eines Hauches von Leben also, akademische Selbstgefälligkeit, Stubengelehrtheit bleiben die anfechtbarste Seite vieler, vieler etymologischer Arheiten. Hunderte von Etymologien sind ausschließlich auf die lautHohe Ähnlichkeit und auf die sichtbare, scheinbare Bedeutrmgsnähe aus der Sicht des Urhebers der Etymologie aufgebaut, aber nicht aus der Sicht derer, die die entsprechenden Wörter geschaffen haben. Indessen werden sowohl das phonetische als auch das semantische Kriterium sowie die anderen Kriterien nur vor dem Hintergrund einer tiefen rmd allseitigen Kenntnis derjenigen historisch bedingten Realien effektiv rmd nützlich, auf denen die zu besprechenden \\r örter begründet und auf die sie zurückzuführen sind. Eine Etymologie ohne Berücksichtigrmg der Realien ist wie ein Gebäude ohne Fundament.
VVeder die Phonetik noch die :-;;emantik für sich allein schützen vor den gröbsten Fehlern, wenn sie nicht durch breitangelegte historische Erkundungen des Forschers untermauert werden, durch die Kenntnis dessen, was A. A. BELECKU als "historischen Kontext" bezeichnet 11 .
An anderer Stelle 12 mußte ich die mißlungene Etymologie von osset. Amistal (Bezeichnung eines Sommermonats) feststellen, die von G. MoRGENSTIERNE, dem bekannten norwegischen Iranisten, vorgeschlagen worden war. Er zerlegt das Wort in zwei Teile: ami und stal. Der erste Teil wurde von ihm mit awest. hf!mina- "Sommer" verglichen, der zweite (stal) blieb ohne Erklärung. In \Virklichkeit repräsentiert aber osset. Amistal ein entstelltes apastal und hat zum Awesta überhaupt keine Beziehung. Der hier betrachtete Sommer-
10 Den Terminus "Realien" verwenden wir im weitesten Sinn als ZusammenfasslUlg für alle konkret-historischen, materiellen, sozialen und kulturellen Bedingungen, unter denen \Vörter entstehen und die ihnen ihren Stempel aufdrücken.
11 Ein gutes Beispiel auf den "Realien begründeter Etymologie hat H. SCHUCHARDT vorgeschlagen, indem er französ. trauver mit Iatein. turbare verknüpft hat. Eine solche semantische Entwicklung kommt aus dem Milieu der Jl'ischer: sie trübten, schlugen das Wasser, um die Fische aufzuscheuchen und zu ,entdecken' (trauver).
12 Izvestija Akademii nauk SSSR, Otd.lit. jaz. VIII/I (1949), S. 77.
Realien und Etymologien 41
monatwurde .,Monat der Apostel" genannt, da in diesen Monat das Fest der Apostel Petrus und Paulus (29.Juni) fiel.
Der Mißgriff, der in diesem Fall G. MORGE~STIERNE unterlief, ist in vieler Beziehung typisch und lehrreich. Abgesehen von der willkürlichen Zerteihmg des \Vortes in zwei Teile, von denen der zweite unerklärt blieb, unterliefen MORGENHTTERNE zwei ernste methodologische Fehler:
a) Das \Vort wurde aus dem Kontext gerissen Wld außerhalb der lexikalischen Gruppe, der es angehört, -~ in unserem Fall außerhalb der Kalenderterminologie - isoliert betrachtet;
b) Es wurde nicht einmal die Frage nach der Herkunft und den historischen Wurzeln des ossetischen Kalenders insgesamt gestellt, dem der Monat Amistal als eines seiner Elemente angehört..
Hätte MORGENSTIER~E den Namen Amistal nicht außerhalb des gesamten ossetischen Kalenders betrachtet und sich für dessen Geschichte interessiert, so hätte er leicht feststellen können, daß der osset.ische Kalender der christliche ist und altiranische Elemente in ihm nicht zu finden sind. Es genügt, die Namen anderer Monate und Feste anzuführen: BasiltCP (hl. Basilius der Große), Tutyr (hl. Theodor Tyro), Nikkala (hl. Nikolaus), Majrremy kwadza:n (Mariae Himmelfahrt), Oeorguba (hl. Georg), usw. - In dieser Gruppe findet auch Amistal "Apostel" seinen Platz.
Letzlieh überzeugt uns von der Richtigkeit 1mserer Etymologie die balkarische Sprache, wo wir eine Fonn Ab<Jstal finden, die dem apostal näher steht. Fast alle aufgezählten \Vörter gehen auf die Anfänge des ossetischen Christ-entums zurück, d. i. ungefahr das 10. Jh., als die Alanen offiziell christianisiert wurden. Diese Tatsachen ließ MoRGE~~TIERNE außer acht und gelangte so zu einer falschen etymologischen Erklärung.
9. BEISPIELE VO~ ACF REALIEN BEnRCNDETEN ETYMOLOtaEN
Osset. fysym bedeutet "Wirt, Hausherr (gegenüber dem Gast), hospes". Von der lautlichen Seite her könnte es durchaus mit awest. fAümant- "Vieh besitzend" verglichen werden. Aber wie steht es mit der Bedeutung 1 Wir würden erwarten, daß der, der Gäste empfängt, vor allem ein Haus besitzen muß und daß dessen Bezeichnnng dem Sinne
nach etwa "Hausherr", nicht aber "Viehbesitzer" ist. So wäre es, wenn das Wort fysym unter den Bedingungen seßhaften Lebens entstanden wäre. Aber versetzen wir uns in die Verhältnisse des Nomadenlebens, dann wird die Etymologiefysym~f.!ümant- nicht nur annehmbar, sondern, so kann man sagen, unwiderlegbar. Während bei seßhafter Lebensweise den Gast ein Hausbesitzer empfängt, ist unter Nomaden die Möglichkeit, Gastfreundschaft zu gewähren, nicht an den Besitz eines Hauses, sondern an den Besitz von Vieh gebunden, da gerade das Fleisch des Viehs als hauptsächliche Bewirtung dient. Es ist verständlich, daß unter solchen Bedingungen ein "Besitzer von

42 AnhangAb&ev
Vieh" sich auch als "Gastgeher" erweist. Unsere Etymologie wird dadurch entscheidend gestützt, daß sie auf der Kenntnis der konkreten Bedingungen der Lehensweise von Nomaden und Viehzüchtern heruht, unter welchen Bedingungen das 'Vort entstanden ist, aber auch auf der Kenntnis davon, daß die Vorfahren der Osseten in weit zurückliegender Vergangenheit tatsächlich so gelebt hahen.
Osset. wacajrag "Gefangener, Sklave". - Die Etymologie eines Wortes mit der Bedeu.tung .,Sklave" kann verschieden sein. Man kann es auf einen Stammesnamen zurückführen ([z. B.] altind. diisci- "NichtArier, Knecht" = awest. dliha- "ein Stammesname"); man kann auf den Begriff der "Arheitskraft" hinweisen ([z. B.] pers. täkar zur Wurzel kar- "tun", vgl. auch russ. rab "Knecht" und rab6ta "Arbeit"); man kann es mit dem Begriff der "Freiheitsberaubung" ([z. B.] pers. banda "Knecht", wörtlich "gebunden", russ. nev6lbnik "Sklave" [ ~ "Unfreiwilliger"]) zusammenbringen. Allerdings liefert uns keine dieser Bedeutnngen den Schlüssel zur Erklärung von osset. wacajrag. Das Studium der Geschichte der Sklavenhaltung eröffnet uns ein weiteres Kennzeichen des Sklaven: er diente als Handelsware. Von alters her hatte der Sklavenhandel in der Vergangenheit eine weite Verbreitung. In unterentwickelten Gesellschaftsformen der Stammesorganisation und der Kriegerdemokratie, wo das Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung noch keine Möglichkeit für eine breite Anwendung der Sklavenarbeit in der Wirtschaft hatte, konnte das Halten von Sklaven in der Hauptsache nur ein Ziel verfolgen: deren VV eiterverkauf. So war es auch in der Gesellschaft der Skythen und Sarmaten, deren Nachkommen die heutigen Osseten sind. In einer solchen Umwelt mußte "Sklave" vor allem mit "Handel" zusammenhängen und nicht mit irgendeinem anderen Begriff. Osset. wacajrag überzeugt uns davon, daß es so war. In diesem Wort ist mitteliran. viilär "Handel" und das verbreitete Suffix-ag zu erkennen, welches "Vorbestimmheit für etwas" bedeutet. Im ganzen bedeutet wajcarag also, etymologisch erklärt, "zum Verkauf bestimmt, 'Vare".
Der Zusammenfall der Bedeutnngen "Gefangener" und ,,Sklave" in ein Wort ist ebenfalls lehrreich. Er weist daraufhin, daß in der Umwelt und zu der Zeit, als das \V ort entstand, Krieg und Gefangennahme die Hauptquelle der Erbeutung von Sklaven waren.
Wir sehen an diesem Beispiel, daß die historischen Daten selbst, welche sprachliche Tatsachen erklären, ihrerseits durch die. sprachlichen ~~ten ?eleuchtet werden. So muß es auch sein. Zusammenarbeit und gegensettlge Htlfe zwischen Geschichte lllld Sprachwissenschaft sind nicht einseitig, sondern gegenseitig: indem der Sprachwissenschaftler sich auf historische Daten zur
Realien und Etymologien 43
richtigen Erklänmg sprachwissenschaftlicher Tatsachen etützt, kann er seinerseits dem Historiker wertvolle zusätzliche Materialien zur Beleuchtung historisch-kultureller Fragen liefern.
Osset. frPStinon ,.genesend" scheint morphologisch ganz durchsichtig:frns- (Vorsilbe) "nach", Ausgang-on (ein Adjektivsuffix). Das Wort muß also "sich im Zustand nach etwas befindend" bedeuten. Wonach? Offensichtlich nach einer Krankheit. Folglich muß tin "Krankheit" bedeuten. Allerdings ist ein solches oder ein gleichklingendes Wort mit der Bedeutung .,Krankheit" weder in den iranischen noch irgendwelchen anderen Sprachen, zu denen das Ossetische Beziehung hat, auffindbar. Phonetisch konnte tin aus ein nach s (jfYs-cin-on --+ fresti
rwn) entstehen. Ein solches Wort gibt es im Ossetischen, aber es bedeutet nicht "Krankheit", sondern "Freude". Daraus geht hervor, daß der Zustand nach der Krankheit als Zustand ,.nach der Freude" bezeichnet wurde. Das Resultat ist so paradox, daß man es verwerfen und die Forschung in anderen Richtrmgen fortsetzen oder das VVort als unerklärbar betrachten könnte. Das sollte man aber nicht tun. Es ist notwendig, sich für einige ethnographische Daten zu primitiven Ansichten über das Wesen der Krankheit zu interessieren. Nach diesen Vorstellungen wird die Krankheit von einer Gottheit gesandt. Im Zusammenhang damit besteht für die Benennung einiger Krankheiten Tabu, besonders für epidemische, wie z. B. Pocken. Sie werden sinnbildlich benannt, durch einschmeichelnde Benennungen wie "die Gute", "Gevatterin", "Freund", usw.; dies, um sich die entsprechende Gottheit geneigt zu machen. Im Lichte solcher ethnographischer Gegebenheiten kann man annehmen, daß die in osset. frestirwn "genesend" steckende Krankheit "Freude" genannt wurde. Es ist dies eine einfaltige List des vor Epidemien machtlosen Menschen, um die sich ausbreitende Krankheit geneigt zu stimmen, damit sie nicht mehr zurückkehre.
Osset. syvrPdcey ,.Schnuller, Saugflasche (der Kinder)" hat im zweiten Teil fred<Pg ,.Brustwarze" (mit regelmäßigem Übergang von f -+ v). Das anlautende sy, das nur aus zwei Lauten besteht, läßt eine Vielzahl von etymologischen Assoziationen und Vermutungen zu. Sie alle erweisen sich als überflüssig, wenn wir erfahren, daß Schnuller in alter Zeit aus Horn hergestellt worden sind. Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir im ersten Teil unseres zusammengesetzten Wortes sy "Horn" (in der heutigen Sprache gewöhnlich mit -k'a-Erweiterung syk'a) vor uns haben.

44 Anhang Abaev
Osset. ZIPvretdur "Stützzapfenlager der Mühle" (auf dem sich die vertikale Achse der Turbine dreht) ist wortbildungsmäßig ganz durchsichtig; es besteht aus zcevret "Ferse" und dur "Stein". Wenn wir allerdings den entsprechenden Teil einer heutigen Mühle in den Bergen betrachten, finden wir dort keinen Stein: das Stützzapfenlager wird aus Eisen gemacht. Offensichtlich wurde das Wort aus jenen Zeiten ererbt, alH dieser Bestandteil der Mühle aus Stein hergestellt worden ist. Ich habe in Ossetien noch alte Menschen getroffen, die sich an jene Zeit erinnert haben und deshalb jedem Stubengelehrten die Etymologie des Wortes za:vaddur besser erklären konnten.
Der Etymologe erlebt eine gewisse Genugtuung, wenn eine von ihm vorgeschlagene Erklärung mit den geschichtlichen Erkenntnissen, welche die entsprechenden Realien betreffen, in Einklang steht.
Unter den skythischen Glossen des HESYCH begegnet das Wort crctxu\18ocx-r; "Bezeichnung für ein Gewand bei den Skythen". Indem ich mich aufiranisches Sprachmaterial stützte, erklärte ich dieses Wort als Zusammensetzung aus sak-gun-dak "Gewand (dak) aus Hirsch-(sak)fell (gun)". Eine solche Erklärung erschiene willkürlich, wenn nicht bei Hesych folgende Erklärung zum Wort -.OC~oc\IÖo;:; stünde: "ein dem Hirsch ähnliches Tier, dessen Haut die Skythen als Kleidung benützen".
•••
\Vir waren bestrebt, in einer Reihe von Beispielen die Notwendigkeit aufzuzeigen, bei etymologischen Forschungen historische, ethnographische, volkskrmdliche und andere Daten verwandter Disziplinen in breitem Umfang heranzuziehen. Ähnliche Beispiele könnten zu Hrmderten gebracht werden. Sie sprechen alle von einem: wirklich wissenschaftliche etymologische Forschrmg muß eine breite Stütze in einem allseitigen Studium der Realien haben. A. A. BELECKlJ sagt zurecht: "Die etymologische Forschrmg wird dann noch wertvoller rmd fruchtbringender, wenn sie gleichzeitig auch historische Forschnng
ist 13."
Ihre höchste Vollendung erreicht die Etymologie, wenn sie nicht nur eine Wissenschaft von den \Vörtern, sondern auch von den dahinter verOOrgenen Realien ist.
13 ßELECKIJ, loc.cit.52.
Etymologikon neuen Typs 45
Hieraus folgt ein wichtiger Schluß: kein Linguist muß in einem solchen Ausmaß mit den vielfaltigsten Kenntnissen zu Geschichte, Kultur, Ethnographie, Folklore, Archäologie usw. ausgerüstet sein wie der Etymologe. Und weiter: auf dem Gebiet der Etymologie ist die Zusammenarbeit des Sprachwissenschaftlers mit Fachleuten der gesellschaftswissenschaftliehen Nachbardisziplinen besonders wünschenswert und fruchtbringend.
10. ÜBER EIN ETYMOLOGISCHES WöRTERBUCH NEUEN TYPS
Artikel zur Geschichte einzelner WÖrter werden, wenn sie gut geschrieben sind, mit begeistertem Interesse auch von Nicht-Linguisten gelesen. Warum aber sind etymologische Wörterbücher, die, so scheint es, nichts anderes sein sollten als Sammlnngen solcher Artikel, für Nicht-Fachleute trocken und wenig interessant? Dies ist z. T. damit zu erklären, daß die Verfasser um maximale Gedrängtheit bemüht sein müssen, um auf kleinstem Raum viel Vergleichsmaterial zu bringen, weil es schwierig ist, in einem Lexikonartikel das ganze lebendige historische Material rmterzubringen, welches man in einer einem Einzelwort gewidmeten Spezialuntersuchung entfalten kann. Das ist aber nicht das einzige. Die Hauptursache der "Trockenheit" der bestehenden etymologischen \V Örterbücher liegt in dem, worüber wir schon gesprochen haben: in der Abgewandtheit von den Realien. Und hier erhebt sich vor uns der verlockende Traum von einem etymologischen Wörterbuch neuen Typs. In ein solches Wörterbuch müssen die vielfältigen historischen Kenntnisse, die mit der Entstehung und dem Schicksal der einzelnen Wörter zusammenhängen, Eingang finden.
Die Sprache und ihre Geschichte stellen einen hohen Erkenntniswert für jeden denkenden Menschen dar. Leider bleiben diese Schätze für NichtFachleute größtenteils ein Buch mit sieben Siegeln - wegen der bekannten Isolierung der Sprachwissenschaft von den anderen Gesellschaftswissenschaften und wegen der außerordentlich großen "akademischen 8elbstgef&lligkeit", die vielen sprachwissenschaftlichen Arbeiten eigen ist. Ein etymologisches Wörterbuch neuen Typs muß frei von einer solchen Abgeschlossenheit und Trockenheit sein. In ihm muß der Puls der Geschichte schlagen, müssen lebendige Züge der Lebensweise, der Kultur des betreffenden Volkes zum Vorschein kommen, die sich in der Geschichte der \V örter seiner Sprache widerspiegeln.
Wenn ein solches \\-~örterbuch geschaffen würde, wäre es nicht Eigentum bloß eines kleinen Kreises von Spezialisten. Es könnte zum Handbuch jedes gebildeten Menschen werden, da man darin nicht nur eine Aufstellung von lexikalischen Entsprechungen finden kann, sondern ein breites und vielfältiges

46 Anhang Ab!Ulv
Anschauungsmaterial, das durch die Geschichte der \Vörter verschiedene Seiten des vergangeneu Lebens eines Volkes, seiner materiellen und geistigen Kultur, seiner Kontakte zu anderen Völkern beleuchtet.
Eine wesentliche Besonderheit eines solchen \Vörterbuchs, das auch aus seiner Orientierung auf einen breiten Leserkreis entspringt, muß sein, daß in ihm nicht nur \Vurzelwörter erklärt werden, sondern auch zum Teil abgeleitete, wenn deren Wortbildungsstruktur nicht zur Gänze durchsichtig oder für den Nicht-Fachmann anschaulich ist oder wenn sie von besonderem semantischem, historischem oder kulturellem Interesse sind.
Wenn ich von einem etymologischen \Vörterbuch neuen Typs spreche, möchte ich abschließend unterstreichen, daß ein solches Wörterbuch herkömmliche etymologische \Vörterbücher nicht verdrängen und ablösen muß. Diese behalten als N<Whschlagewerke für Fachleute ihre Bedeutung. Das neue Wörterbuch hat andere Zielsetznngen und orientiert sich an weiten Kreisen der Gebildeten; es wird daher seinen Platz neben herkömmlichen Wörterbüchern, und unabhängig von ihnen, einnehmen. Es wird als ein ,.Fenster" dienen, durch das die Sprachwissenschaft. in den weiten Raum der Gesel1schaftswissenschaften hinausgeht und ihren Anteil zu der Kenntnis eines Volkes, seiner Kultur, seiner Geschichte, seines Denkens und Selbstbewußtseins beiträgt.
ANHANG li:
"CHECKLISTE" ZUR AUFSTELLUNG BZW. BEURTEILUNG
ETYMOLOGISCHER DEUTUNGEN
Von KARL HoFFMANN und EvA TICHY
I. Vorlco"mrnen
1. Realität des Vorkommens
a) in gesprochener Sprache b) in Inschriften c) in der Literatur d) in Sekundärquellen
aa) einheimische Lexikographie bb) einheimische Grammatik
e) in der Fachliteratur: ghost-word1
2. Zeit des Vorkommens
a) Zeitpunkt der ersten Bezeugnng b) Dauer der Bezeugung c) Unterbrechungen in der Bezeugung
3. Ort des Vorkommens
a) Sprache(n) b) Dialekt(e) c) soziologische Schicht (Hochsprache, Umgangssprache usw.) d) Altersgruppe (z. B. Kindersprache) e) Fachjargon f) Individualsprache
4. Häufigkeit des Vorkommens
a) Normalwort b) begrenztes Vorkommen
aa) sachlich begründet ( -----+20) bb) sprachlich begründet ( ~21) cc) literarisch bedingt ( -----+8, 9)
c) hapax legomenon aa) einmal bezeugt bb) mehrfach im gleichen Kontext bezeugt

48 Anhang Hoffmann~Tichy
5. lautliche und graphische Variation
a) ältere Formen b) jüngere Formen c) Dialektformen d) Formen anderer soziologischer Schichten e) schriftsprachliche Formen f) Allegroformen g) zersungene Formen h) metrisch angepaßte Formen i) volkstümliche Spielformen
usw.
6. Eigenname
7. Onomatopoiie
li. (schriftliche) Bezengung
8. Textsorte (Literaturgattung)
a) Dichtung b) literarische Prosa c) Gesetzessprache
US\\'.
9. Textschicht (literarische Epoche)
10. Überlieferungslage
a) Überlieferungsvarianten b) Ergebnisse der Textkritik
II. Schriftbild und Lautung
a) Schriftsystem aa) phonematisch bb) phonetisch
b) Graphik aa) Mehrdeutigkeit der Lesung bb) Vertauschungshäufigkeit der Schriftzeichen cc) Ligaturen dd) Einfachschreibung von Geminaten ee) Worttrennung
c) Orthographie aa) historisch bb) differenzierend cc) etymologisierend
d) (erschlossene) Aussprache
III. Sprachechtheit
12. Fremdwort
13. Lehnwort
14. Lehnübersetzung
I 5. Kunstwort
,,Checkliate"
16. dichtersprachliches Wort
a) Archaismus aa) echter bb) falscher ( ~b)
b) Neuerung aa) metrisch bedingt bb) expressiv cc) durch Umdeutung eines literarischen Vorbilds
I 7. Augenblicksbildung (kontextgebundene Fehlbildung)
I 8. Scherzbildung
IV. Wortbedeutung(en)
49
19. philologische Bedeutungsbestimmung an sämtlichen Belegstellen
a) Feststelhmg der jeweils relevanten Bedeutungskomponenten b) syntaktischer Gebrauch c) Kontexte d) 8yntagmen e) Phraseologie f) inhaltliche Parallelen
20. sachliches Umfeld
a) natürliche Gegebenheiten b) materielle Kultur c) geistige Kultur
usw.
21. sprachliches Umfeld
a) Synonyme b) Homonyme c) Bedeutungsparallelen d) Bedeutungsopposita e) \Vortfeld f) Fachterminologie
g) Volksetymologie

50 Anhang Hoffin&llll-Tichy
22. Gebrauchsweisen
a) sachbezogen (speziell) b) erweitert c) metaphorisch d) euphemistisch e) Tabu ' f) stilistisch beschränkt g) formelhaft
23. Bedeutungswandel
a) primäre und ableitbare Bedeutungen in einer synchronen Sprachschicht
b) primäre und ableitbare Bedeutungen in mehreren synchronen Sprachschichten
c) primäre und ableitbare Bedeutnngen in diachroner Abfolge
V, Tentative Rekonstruktion
24. Möglichkeiten der lautlichen Rekonstruktion
a) lautgesetzliche Antezedenten aa) Anlaut bb) Inlaut cc) Auslaut
b) lautgesetzlich geschwundene Laute c) mehrdeutige Laute und Lautgruppen d) heterogener Laut, Gleitlaut e) durch metrische Anpassung veränderter Laut (z. B. metrische
Dehnung) f) Assimilation g) Dissimilation h) Metathese i) Haplologie k) lautliche Angleichung an Wörter des sprachlichen Umfelds ( -21,
27, 28)
25. Segmentierung
a.) systematische Feststellung möglicher Morphemgrenzen durch mechanische Zerteilung
b) Reimverband c) Anlautsverband
26. morphologische Bestimmung
a) Morpheme aa) durchsichtig bb) verdunkelt
b) Präfix und seine Bedeutungen
"Checkliste" 51
c) Wurzel und ihre Derivate: morphologische rmd semantische Bestimmung
d) Suffix und seine Funktion, Suffixkonglomerak e) Flexion: Flexionsendungen, Flexionstyp f) Komposition
aa) durchsichtig bb) verdunkelt
g) Kompositionstyp h) Akzent i) Genus
27. Kontamination
28. Analogie
a) Proportion b) Imitation
29. Ergebnisse der tentativen Rekonstruktion (Transposite)
a) des gesamten \Vortkörpers b) einzelner Morpheme (einschließlich der Wurzel) c) in der Ur-Stufe der betreffenden Sprache d) in der Vorur-Stufe e) im Urindogermanischen
VI. Etymologische Anknüpfung
30. Anklang des behandelten Wortes
a) an Wörter derselben Sprache b) an Wörter anderer Sprachen
31. Anklang der Transposite ( --+29)
a) an Transposite von \Vörtem derselben Sprache b) an Transposite von ''Törtem anderer Sprachen c) an durch Sprachvergleich rekonstruierte Wörter
aa) einer gemeinsamen Vorstufe bb) des Urindogennanischen
32. morphologische Bestimmung des Rekonstrukts ( --+26)
33. Motivation der Wortbildung
34. Ableitung der möglichen Bedeutungen des Rekonstrukts aus Bedeutung bzw. Funktion der Morpheme ( --+32)

52 Anhang Hotlinann-Tichy
35. Erklärung der Wortbedeutung
a) des behandelten Wortes b) damit verglichener Wörter
aa) gleich gebildeter bb) auf eine gemeinsame Grundform rückführbarer cc) t,eilweise gleich gebildeter dd) anders gebildeter
36. Erklärung des vorhistorischen Bedeutungswandels
a) durch Änderungen des sachlichen Umfelds ( -+20) b) durch Änderungen des sprachlichen Umfelds ( -+21) c) mittels Bedeutungsparallelen
37. Erklärung des historischen Bedeutungswandels ( ~23)
38. Motivation der Benennung
a) bei Elementarwörtern und \Vurzeln: unbegründbar b) bei strukturierten "\\rörtern: auf Grund eines charakteristischen
sachlichen Merkmals
39. Andere Deutungsmöglichkeiten
a) bisher geäußerte b) bisher nicht geäußerte c) ausgeschlossene d) widerlegbare e) nicht widerlegbare f) wahrscheinliche
REGISTER*
A. AUTORENREGISTER
Abaev V. I. 9, 16 A.18, 23 A.34, 29ff.
B~iley H. W. 25 A.37 Baidinger K. 11 Baudouin de Courtenay J. 27 u.
A.40 Beleckij A. A. 30 u. A. 2, 35 A. 7, 40,
44 u. A.13 Boisacq E. 26 A. 38 Breal M. 38 A. 9 Brückner A. 22 u. A. 28 Burrow T. 23 u. A. 33 Qabej E. 19 A.23 Ch~ntraine P. 14 u. A.15, 23 A.32 Dev lamminck B. 19 A. 23 Drosdowski G. 20 Ernout A. 12, 23 A.34, 31 A.4, 32 FeistS. 13, 15, 18f. Frisk H. 14, 26 Grimm J. 40 Gusmani R. 18 H~udry J. 19 A. 24 Hermann E. 19 u. A. 25 Hoffin~nn W. 9 A. 5, 16 A.17 Hofinann J. B. 14 Hübschmann H. 20f. Jucquois G. 19 A. 23 Junker H. F. J. 20 Kelly P. 20 A. 27
Kip~rsky V. 9 Kluge F. 9 A. 5, 13, 16 Kronasser H. 19 A. 23 Lemnann M. 13 u. A. 11 M~lkiel Y. 9, 16 A.18, 24 A. 35 Martinet A. 1 8 u. A. 21 Meid W. 20 A. 27 Meier H. Meillet A.
38
9 A. 2, 11 A. 7 12, 23 A. 34, 31 A. 4, 32,
Mitzka W. 9 A. 5 Morgenstieme G. 40f. Ognenova L. 19 A. 23 Pisani V. 30 u. A. 3, 35 A. 7 Porzig W. 22 A. 30 Rix H. 14 A.13 Schleicher A. 16 Schmeja H. 20 A. 27 Schmitt R. 9, 16 A. 18, 19 u. A. 26' Schuchardt H. 40 u. A. 11 Seebold E. 21 Turner R. L. 25 u. A. 36 Uhlenbeck C. C. 26 A. 39 UntermannJ. 9, llff., 17 A.19, 18,
22 u. A. 31 Vasmer M. 20 Wartburg W. v. 24 A.35 Wüst W. 22 A. 30, 26 A. 39 Zgus~ L. 16 A.18, 23 A. 34
• Die Reihenfolge in den drei Registern ist die des lateinischen Alphabets, auch bei Eintragrmgen in griechischer Schrift; äja, ö, ü haben den Standort von a, o, u; a, b, b und diakritische Zeichen werden bei der Reihung nicht berücksichtigt.- Das RegisterAistauf Vertreter der modernen Wissenschaft eingeschränkt; die Namen antiker Persönlichkeiten finden sich im Register B.

ß. SACHREGISTER
Ableitung, s. WortbildWlg Abstraktion 34 Alanen 4i Altarmenisch, s. Armenisch Althochdeutsch 17 A. 19 Altpersisch 17 Analogie 37, 51 Armenisch 17 A.l9, 20f. Atomismus 14 Augustinus 38 ,Bär', Benenmmg für 38 Bedeutm1g, s. Semantik Beleggeschichte 15; s. auch Überlie-
ferung, Wortgeschichte Christianisierung der AlanenfOsseten
41 Chrysippos 29 Corpus, sprachliches 16ff.; absicht
lich beschränkt 17 A. 19 ; zerstört 17 A.l9; Sammlung der Schriftdenkmäler 31; Textsorte, Schicht, Überliefenmgslage 4-8. - S. auch Corpussprachen
Corpussprachen 16 ff. Denken, menschliches, seine Ge
schichte 34-; seine Entwicklung 34; sein Fortschritt 34 A. 5
Derivation, s. Wortbildung Deutung, etymologische, s. Etymolo
gie Dialekteinfluß 37 Dialektik in der etymologischen For-
schung 22, 26 Dialektologie 16 A. 18, 32 Dravidisch 21 Duden-Etymologie 9 A. 5, 13, 16 Entlehnung, s. Lehnwörter Erbwörter; Erbe, sprachliches 31,
36 Ethnogenese 33 Ethnographie 16 A. 18
Etymologie, Stellung in der heutigen Linguistik 9, 9f. A. 5; E. und ·wortgeschichte tlf., 23 A.34; Bedeutungvon "E." 29; Aufgabe der E. 30f.; E. als Teil der historischen Lexikologie 31 ff.; vorwissenschaftliche und Volks-E. 35; E. innerhalb der vergleichend-historischen Methode 35; E. am Beginn der Linguistik als Wissenschaft 39; Aufstellung und Beurteilung etymologischer Deutungen 47ff. - S. auch die Folgenden
"etymologie-histoire-des-mots" t 1. - S. auch Wortgeschichte
"etyrnologie-origine" 11 f. Etymologikon, Etyrnologika, Typolo
gie 9, 15ff.; von Restsprachen 18; von Kleincorpussprachen 18f.; nach Bachgruppen 19f.; nach Herkunfts-Abschnitten 20f.; von Großcorpussprachen 22ff.; in Verbindung mit einem wortgeschichtlichen Wörterbuch 23 u. A. 34; ältere Etyrnologika als bibliographische Entlastung 26; Gegenüberstellung von E. und historischem Wörterbuch abzulehnen 31 ff.; E. neuen Typs 45ff.
Fortleben von Wörtern iri jüngeren Sprachstufen 23
Französisch 11 , 24 A. 35 Friesisch 17 A. 19 Genese, genetisch, s. Sprachver
wandtschaft Germanisch 21, 38. - S. auch Alt
hochdeutsch, Friesisch, Gotisch; vgl. Register C
Geschichte 33 Gleichung 13 u. A.l2
Sachregister
Gotisch 15, 17, 19f. - S. auch RegisterC
Griechisch (Altgriechisch) 13ff., 17, 20, 26. - S. auch Register C
Großcorpussprachen 17 Grundwortschatz 33 Hebräisch (modern) 17 Hellenismus in Indien 23 Hesych 44 Ideophone 38 Indoarisch (Sanskrit) 12, 15, 17, 21,
23, 25, 26. - S. auch Register C Indogermanisch 14, 17f., 19, 22, 25,
30. - S. auch Register C Indoiranisch 25, 36, 37 Informantensprachen 15f. Iranisch, Quelle fremder Namen und
\\-r örter im Armenischen 21 ; Fehlen eines gemeiniranischen Wörterbuches 25 u. Anm. 37. - S. auch Altpersisch, Oasetisch sowie Register C
Kalenderterminologie, ossetische 41 Kindenvörter 38 Kleincorpussprachen 17 u. A.19,
19f. Konkretum, konkrete Vorstellung 34 Kontext 41 Krankheit[en], Bezeichnung für 43
Latein 13ff., 17, 21, 23.- S. auch Register C
Laut.gesetzlichkeit, Lautgeschichte 24, 36; Abweichungen von der Lautgesetzlichkeit 37; Einschränkung in der Anerkennung der Lautgesetze 38
Lautnachalunung 38 Lehnwörter 12, 20, 23, 31, 36 A.8;
L. und Fremdwörter, Lehnübersetzungen etc. 49
Lemma im Etyrnologikon 13, 14f., 24
Lexikologie, historische 31 ff. Lexikon 12, 13, 15f., 24, 33 Lydisch 18 Messapisch 18
Metaphorik in der Sprachwissenschaft 16f.
Methode 35 ff. Morphologie, morphologisches Krite-
rium 36, 50f. Motivation 11 Muttersprache 16 Namen, fremde 21 Nomadenturn 41 Ossetisch 34, 36, 40f., 42ff. - S.
auch Register C Päl).ini 25, 27 Philologie 12 Phonemkette 11, 12, 13 Phonetisches Kriterium, s. Lautge-
setzlichkeit Phrygisch 18 Pla ton 35 A. 6 Produktivität in Grammatik und
Wortbildung 14, 22 Realienkenntnis als Vorbedingung
wissenschaftlicher Etymologie 39ff., 44f., 49 (,sachliches Umfeld')
Rekonstruktion 50f. Restsprachen 17f., 17 A.l9 Rhotazismus 36 Russisch 29f. - S. auch Register C
Sanskrit, s. Indoarisch Sarmaten 42 Schriftdenkmäler, s. Corpus Segment, Segmentierung 13 A. 12,
50 Sekundärliteratur 21 f., 25f. Sekundärliteraturkritik 22 A. 30 Semantik, semantisches Kriterium
11 u. A.7, 13, 14, 24, 36f., 46, 50, 52; Zweifel an der Gesetzmäßigkeit in der semantischen Entwicklung 38
Sklave, Sklavenhandel 42 Skythen 42 Slavisch 30, 38. - S. auch Russisch
und Register C Sozialstruktur 33 Sprache, Erkenntniswert ihrer Ge
schichte 45

56 . Sa.chregister
Sprachverwandtschaft, Sprachfamilie, genetische Zusammenhänge 13, 15, 17, 21, 30,36
Sprachwandel 11 Sprachwissenschaft als Gesellschafts
wissenschaft 33; ihre Zusammen-arbeit mit gesellschaftswissenschaftliehen Nachbardisziplinen 45
Stichwort, s. Lemma Synchronie 11 u. A. 7, 13, 15, 16, 18 System 35f. Tabu, sprachliches 43 Thesaurus 18, 24 Thrakisch 18 Überbau 33 Überlieferung (Beleggeschichte) 15;
mündliche Ü. 16 A. 18 Ursprung (- Etymologie) 30
Varro 29 Weltanschauung, sprachwissenschaft
liche 30 Wissenschaftsgeschichte 15, 21 f.,
23, 24 WortbildWlg (- AbleitWlg) 12, 13,
14, 24, 31,46 Wörterbuch, etymologisches, s. Ety
mologikon Wörterbuch, geschichtliches (histori
sches) 12, 16 A.18, 23, 31fT. Wortgeschichte 11, 12, 23. -
S. auch "etymologie-histoire-desmots'', Überliefenmg
Wortschöpfung, individuelle 30 Wortsippe, \Vortfamilie 14, 16, 24 Wurzeln, Notwendigkeit ihrer Kon-
struktion 22
C. WORTREGISTER
Alnstol balkar. 41 äctor Iatein. 13, 14f. u. A.13 *ag- idg. 13 agö Iatein. 13 &yw griech. 13 u. A. 12, 22 ahdm altindoar. 38 ahmiik<Jm awest. 37 ai~ei got. 19 &x:rwp griech. 13 u. A.12, 14f. u.
A.13, 22 a}.a- lyd. 18 *aljo- idg. 18 alius Iatein. 18 amiixam altpers. 37 A mistol osset. 40, 41 iip- altiran. 34 apoBtol (- ApoBtel) > osset. Ami.otol
40f. *iipra- altiran. 34 arcest osset. 36 arazyn osset. 36 arf osset. 34 asmtikam altindoar. 37 iitar- altiran. 37 dtharvan- altindoar. 37 banda pers. 42 BasiltfR osset. 41 ber awar. 37 Berg nhd. 34 berkal awar. 37 fnolg• slav. 34 cad osset. 37 &ih pers. 37 &ikar pers. 42 Ca!sgom, cceskom osset. 37 CO?st osset. 37 *liita-, *tiitha- altiran. 37 ein osset. 43 cor, cord- Iatein. 38 diiha- awest. 42 *dak skyth. 44
diisd- altindoar. 42 dur osset. 44 *duwö idg. 30 dva russ. 30 döva altkirchenslav. 30 *eyhOm idg. 38 iyW griech. 38 *eyiJ(m) idg. 38 Eruf.LO<; griech. 26, 29 freda'g osset. 43 fres- osset. 43 Jrestinon osset. 43 finst osset. 36 finsun osset. 36 fMlmant- awest. 41 Furt nhd. 22 fyssyn osset. 36 fyst osset. 36 fysym osset. 41 Georguba osset. 41 *ghrd- idg. 38 *gun skyth. 44 hq,mina- awest. 40 *Hze.rj- altidg. 13 *H,eg-tor- altidg. 14 A.l3 hrd- altindoar. 38 kal awar. 37 kan- iran. 37 *kanta- indoiran. 38 *kantha- indoiran. 38 kar- iran. 42 xct.p8[cx. griech. 38 khan- altindoar. 37 kom osset. 37 krafitas litau. 34 *lird- idg. 38 krut6j russ. 34 lajatb russ. 36 AOyoc; griech. 29 lokfl• litau. 38 lut russ. 36

58 Wortregister
M ajrrmny kwadzam osset. 41 mätdr- altindoar. 25 miiter Iatein. 19, 25 miijar "got." (ghostword) 19 A. 24 mUni- altindoar. 22 A. 30 Mutter nhd. 1 9 nev6lbnik russ. 42 N ikkola osset. 41 OHBH •• illyr." (ghostword) 19A.23 -on osset. 43 *per- idg. 22 7tEp( griech. 22 perst russ. 29 pirstenb russ. 29 pictus Iatein. 36 pingo Iatein. 36 rrOpoc; griech. 22 port'U8 Iatein. 22 *prtu- idg. 22 rab russ. 42 rab6ta russ. 42 uejyn osset. 36 rMt osset. 36 rectm lateiR. 36 rego Iatein. 36 ruxs osset. 36
sag osset. 37 ; < * sak 44 sagoj osset. 37 *säka- iran. 37 • sak-aun-dak skyth. 44 *Säkhä- indoiran. 37 Slikhii- altindoar. 37 (J"txxuvSocxlj skyth. (Hesych) Sautlra- altindoar. 23 Säx pers. 37 crw't'"'t)p griech. 23 * sötlra- mittelindoar. 23 srbdbce altslav. 38 suk- altiran. 34 suxra- altiran. 34 sy, syk'a osset. 43 syvreda:g osset. 43 ':'rl.pa.v3oc; Hesych 44 •-tor- idg. 14 A.13 trauver französ. 40 A.ll turbare Iatein. 40 A.ll Tutyr osset. 41 valär mitteliran. 42 wacajrag osset. 42 zwva>t osset. 44 zwva>tdur osset. 44 zarad- awest. 38
44