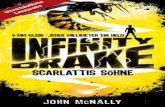Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel; Medical aspects of common non-lethal...
Transcript of Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel; Medical aspects of common non-lethal...

originalarbeit
Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel 11 3
Zusammenfassung Durch die Bereitstellung und Wei-terentwicklung nicht-letaler Wirkmittel (NLW) wird bei polizeilichen und militärischen Einsätzen ein, der jeweiligen Situation angepasstes, stufenweises Eingrei-fen mit dem Ziel der Deeskalation ermöglicht. Die zur Eindämmung von Ausschreitungen ziviler Menschen-ansammlungen eingesetzten chemischen, kinetischen und elektrischen Waffensysteme können bei fehlerhaf-ter Anwendung potentiell tödliche Verletzungen her-vorrufen, die nicht nur von klinischer, sondern auch von juristischer Relevanz sind. Der praktizierende Arzt wird hierbei vor die Behandlungs- und Beurteilungs-problematik neuer Verletzungsformen gestellt. Um eine adäquate ärztliche Versorgung gewährleisten zu können und um bei gutachterlichen Nachfragen bezüglich der Verletzungsentstehung kompetente Rückschlüsse zie-hen zu können, ist eine detaillierte Kenntnis über die Wirkungsweisen dieser NLW essentiell. Die vorliegende Übersichtsarbeit stellt die derzeit gängigsten NLW dar und gibt einen Überblick über mögliche Verletzungsbil-der und deren Behandlungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter Nicht-letale Wirkmittel · Wasserwer-fer · Gummigeschosse · Reizgas · Elektroschockdis-tanzwaffen
Medical aspects of common non-lethal weapons
Summary The development and provision of non-lethal weapons (NLW) allow military and law enforcement personnel to exploit gradual engagement in counter-ing potentially hazardous threats. Chemical, kinetic and electrical weapons systems are used to curb violence in civilian crowds. With inappropriate usage, these tech-nologies can cause potentially fatal injuries that are not only of clinical, but also of legal relevance. In this con-text, the practicing physician is faced with treatment as well as assessment issues of new forms of injuries. In order to assure medical care and to be able to draw com-petent expert’s conclusions, a detailed knowledge of the medical effects of these NLW is necessary. The review at hand presents today’s most popular NLW and gives an overview of their possible injury potential and required treatments.
Keywords Non-lethal weapons · Water cannon · Rub-ber bullets · Tear gas · Conducted electrical weapon
Einleitung
Im militärischen und auch polizeilichen Einsatz spielt die Verhältnis- und Zweckmäßigkeit der angewandten Gewalt eine zentrale Rolle [1, 2]. Das Hauptziel liegt in der Regel darin, die von einem Angreifenden ausge-hende Gefahr möglichst effektiv abzuwehren und gleich-zeitig die Verletzung unbeteiligter Dritter zu vermeiden. Im Idealfall wird bei dem Kontrahenten eine temporäre Handlungsunfähigkeit erreicht, ohne dass dieser nach-haltige physische oder psychische Schäden erleiden muss. Unter dem Begriff der Handlungsfähigkeit ist in diesem Zusammenhang die menschliche Fähigkeit zu verstehen, „nach der man unter Ausnutzung seiner physischen Voraussetzungen sowie seiner sensomoto-
Dr. med S. N. Kunz () · PD F. MonticelliIFFB Gerichtsmedizin und Forensische Neuropsychiatrie,Paris-Lodron Universität Salzburg-Linz, Ignaz-Harrer-Str. 79,5020 Salzburg, ÖsterreichE-Mail: [email protected]
Dr. C. GroveInstitut für Rechtsmedizin, Ludwig-Maximilians Universität München, München, Deutschland
Eingegangen: 13. August 2013 / Angenommen: 31. Oktober 2013© Springer-Verlag Wien 2013
Wien Med WochenschrDOI 10.1007/s10354-013-0251-z
Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel
Sebastian Niko Kunz · Christina Grove · Fabio Monticelli

originalarbeit
2 Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel 1 3
rischen, kognitiven und psychosozialen Fähigkeiten im Alltag dem jeweiligen individuellen Entwicklungsstand entsprechend kompetent zu handeln in der Lage ist“ [3]. Um diesen Forderungen einer sofortigen Mannstopp-wirkung bei gleichzeitig minimalem Verletzungsrisiko des Betroffenen gerecht zu werden, kommen sogenannte Nicht-Letale Wirkmittel (NLW) zum Einsatz. Es handelt sich hierbei um verschiedene Waffensysteme, die durch unterschiedliche Applikationsformen einen Kontrahen-ten von seiner ursprünglichen Intention abhalten und gleichzeitig nur minimale und vor allem vollständig reversible Verletzungen hervorrufen sollen. Derzeit auf dem Markt erhältliche Wirkmittel reichen von chemi-schen Reizstoffen über mechanische Geschosse bis hin zu Geräten, die das akustische-, optische oder senso-motorisch-elektrische Wahrnehmungsvermögen beein-flussen. Trotz dieser Produktvielfalt beschränken sich die derzeit polizeilicherseits eingesetzten Wirkmittel auf chemische Reizstoffe, nicht-letale kinetische Geschosse und Elektroschockdistanzwaffen.
In der vorliegenden Arbeit werden die unterschiedli-chen Aspekte dieser gängigen NLW dargestellt und deren pathophysiologische Auswirkungen auf den mensch-lichen Körper kurz erläutert. Hierbei sollen dem prak-tizierenden Arzt die Möglichkeiten und Grenzen der medizinischen Behandlung und Begutachtung darge-stellt werden.
Die Entwicklung der NLW
Aufgrund von Bürgerrechts- und Protestbewegungen in Europa und den U.S.A. wurden zu Beginn der 60er Jahre neue Waffengattungen zur Überwachung und Eindäm-mung ziviler Menschenansammlungen entwickelt und unter dem Begriff der NLW subsumiert. Unter diesen, als sogenannte „crowd and riot control“ eingesetzten Waffen dominierten vor allem das auch heute noch als Reizgas verwendete CS- (2-Chlorbenzylidenmalonsäuredinitril) und CN- (2-Chloracetophenon) Gas [4]. Die Rassenun-ruhen in Detroit und Newark 1967 wurden in den U.S.A. zum Anlass genommen, neue Leitlinien für Einsätze des Militärs und der Polizei zu bestimmen und weitere Alter-nativen zum Einsatz tödlicher Waffen zu entwickeln [5]. Durch das 1996 in den U.S.A zu diesem Zweck gegründete „Joint Non-Lethal Weapons Program“ [6] und mit Hilfe der 1998 in Europa gegründeten Arbeitsgruppe „Euro-pean Working Group Non-Lethal Weapons“ [7] wurde das bisher auf CS- und CN-Gas sowie Schlagstöcke und Wasserwerfer beschränkte Repertoire der NLW durch neue Technologien erweitert. Die meisten dieser Metho-den befinden sich noch in der Entwicklungsphase und werden derzeit nur für den militärischen Markt erprobt.
Chemische NLW
Chemische Reizstoffe werden nicht nur zur Kontrolle von Ausschreitungen bei Massenansammlungen verwendet,
sondern sind auch zum Personenschutz für Privatper-sonen ab 18 Jahren frei verkäuflich. Das Grundprinzip dieser als Pfeffersprays und Tränengas bekannten Reiz-stoff-Sprühgeräte beruht auf einer intensiven Schleim-hautreizung der Augen und oberen Atemwege.
Die Hauptwirksubtanz des polizeilicherseits einge-setzten und auch privat weit verbreiteten Pfeffersprays ist das reizende Oleoresin capsicum (OC), das aus dem Fruchtfleisch subtropischer Chilipflanzen gewonnen wird. Alternativ gibt es auch Geräte, die mit dem syn-thetisch hergestellten Capsaicin Pelargonsäure-vanil-lylamid (PAVA) ausgestattet sind. In beiden Fällen wird durch Beimischung von Benzol und unter Verwendung der pyrotechnischen Hilfsmittel Nitrozellulose und Sin-oxid die lipophile Flüssigkeit unter Druck einem Kontra-henten in das Gesicht gesprüht. Andere Sprühsysteme haben ein permanentes Druckreservoir, entsprechend einer gewöhnlichen Sprühdose.
Laut den Technischen Richtlinien für Reizstoff-Sprüh-geräte der Polizeieinsatzkräfte des Bundes und der Län-der [8] können je nach Gerät 4–6 Sprühstöße pro Sekunde abgegeben werden mit einer Einsatzreichweite zwischen 2,5–7 m und einem Sprühbilddurchmesser von bis zu 40 cm.
Eine akute Membrandepolarisierung der Nozizep-toren von Haut und Schleimhäuten bewirkt über die Ausschüttung eines Neurotransmitters, der sogenann-ten Substanz P, ein intensives Schmerzempfinden mit Schwellung und Rötung der Schleimhäute, Tränen-fluss und temporärer Erblindung durch unwillkürli-chen, krampfartigen Lidschluss. Gemäß Hersteller und einigen Publikationen ist die Wirkung auf 30 bis 45 min beschränkt und hinterlässt keine bleibenden Schäden [9]. Vorübergehende Sensitivitätsstörungen und kurzzei-tige Entzündungsreaktionen der Augenbindehaut sind in der Regel innerhalb einer Woche vollständig rever-sibel [10]. Demgegenüber gibt es in der medizinischen Literatur jedoch auch Falldarstellungen, welche von bleibenden Hornhautschäden mit Erosionen des Horn-hautepithels berichten [11, 12]. Aus diesem Grund ist bei direktem Augenkontakt nach Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen (10–15 minütige Augenspülung unter fließendem Wasser, mit Hilfe der Isogutt-Augenspülfla-sche oder mittels einer fetthaltigen Flüssigkeit) auch eine Fluoreszenzbeobachtung und Spaltlampenmikroskopie zum Ausschluss von Hornhautschäden notwendig.
Bei Inhalation von chemischen Reizstoffen kommt es zu Schleimhautreizungen und -schwellungen der obe-ren Atemwege mit Hustenreiz und kurzzeitiger Atem-not. Laut einer Studie von Chan et al. [13] entstehen bei Einatmung von Oleoresin keine klinisch relevanten Beeinträchtigungen der Atmung. Jedoch gibt es einzelne Falldarstellungen, die eine Anwendung von Reizstoff-Sprühgeräten mit Todesfällen in Polizeigewahrsam in Verbindung bringen [14]. Die lebensbedrohlichen Aus-wirkungen des Reizstoffes liegen hierbei in einer mögli-chen Auslösung von Bronchospasmen [15].
Das weniger populäre Tränengas (CS-Gas) wird in der Regel aus einem in der Hand gehaltenen Aerosolbehälter

originalarbeit
Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel 31 3
Insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern ist nach Exposition mit Tränengas oder Pfefferspray eine sofortige Zufuhr von Frischluft und, falls erforderlich, die Einleitung einer künstlichen Beatmung sowie eine medi-zinische Überwachung notwendig (Tab. 1).
Mechanische NLW
Wasserwerfer
Der Einsatz von Wasserwerfern ist ein gängiges polizei-liches Mittel zur Deeskalation bei Großdemonstrationen mit jährlichen Einsatzzahlen in der Bundesrepub-lik Deutschland zwischen 95 und 280 [18]. Durch die gerichtete Applikation großer Wassermengen von bis zu 2200 l/min und Druckverhältnissen von 15 bis 30 bar erfährt eine getroffene Person eine großflächige stumpfe Gewalteinwirkung. Abhängig von der Körperre-gion und Wirkungsfläche kann es zu Quetschungen der Haut und des darunter liegenden Weichteilgewebes bzw. der Organe kommen. Der lokal wirkende Druck führt zunächst zu einer Überdehnung des Hautgewebes mit
in einem kontinuierlichen Flüssigkeitsstrom, bestehend aus einer 5 % igen Lösung CS sowie dem Lösungsmittel Methylisobutylketon (MIBK), versprüht. Das verwen-dete Treibmittel ist bei den meisten Produkten kompri-mierter Stickstoff. Der genaue Wirkmechanismus von CS konnte bisher noch nicht vollständig geklärt werden und ist wohl stark konzentrationsabhängig. Ein postulierter Wirkungsmechanismus besteht darin, dass es bei Haut-kontakt zu einer Reduktion von Chlorid-Ionen und zur Bildung von Salzsäure kommt, was letztliche zu lokalen Reizerscheinungen führt [16]. Zusätzlich agiert CS als Alkylierungsmittel intrazellulärer Sulfhydrylgruppen, was eine Inhibierung verschiedener Enzymgruppen und unter anderem eine Freisetzung von Bradykinin ver-ursacht. Ähnlich wie Capsaicin kommt es auch bei die-sem Substanzgemisch zu Schleimhautirritationen mit Schmerzempfindungen, erhöhtem Speichelfluss, thora-kalem Engegefühl, Brennen im Hals, den Augen und der Nase. Zusätzlich wurden bei manchen Patienten starke Hautreaktionen mit Nekrotisierung der Oberhaut und Ekzembildung beobachtet. Einzelne Fälle mit der Aus-bildung eines tödlichen toxischen Lungenödems sind ebenfalls beschrieben [17].
Tab. 1 Medizinische Aspekte verschiedener Nicht-Letaler Waffen
NLW Hauptwirkung Pathophysiologischer Effekt Äußerlich sichtbare
Verletzungen
Hauptrisiken Behandlungsmethode
Reizstoff-Sprühgerät Chemische Schleimhautreizungen
Membrandepolarisierung von Schmerzrezeptoren
Schwellung und Rötung der Schleimhäute
Oberflächenkeratitis Augenspülung mit fetthaltigen Flüssig-keiten
Inhibierung von Enzymgruppen Stromale Narben Verbandlinse
Atemnot Spaltlampenuntersu-chung der Cornea
Asthmaanfall Frischluftzufuhr
Stimmritzenkrampf
Toxisches Lungenödem
Wasserwerfer Stumpfe mechanische Gewalteinwirkung
Mechanische Applikation von Druck- und Scherkräften
Hautverletzungen, Hauteinblutungen
Hautverletzungen Medikamentöse Schmerztherapie
Hochdruckinjektions-verletzungen
Antibiotikatherapie
Débridement Sonographischer Aus-schluss intraabdomi-neller Blutungen
Kompartmentsyndrom Radiologischer Frak-turausschluss
Rippenbrüche Ausschluss von Injek-tionsverletzungenPrellungen
Gummigeschosse Stumpfe mechanische Gewalteinwirkung
Mechanische Applikation von Druck- und Scherkräften
Hautverletzungen, Hauteinblutungen
Hautverletzungen Medikamentöse Schmerztherapie
Rippenbrüche Radiologischer Frak-turausschluss
Bean Bags Prellungen EKG – Untersuchung
Commotio Cordis
CEW Elektrische Reizung Überlagerung der Erregungs-leitung im Nervengewebe mit allgemeiner Muskelkontraktion
2 mm große oberflächliche Hautpenetrationsstelle
Sekundärverletzungen durch unkontrollierte Stürze
Entfernung der Pfeil-elektroden
Allg. Wundversorgung

originalarbeit
4 Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel 1 3
12-gauge Schrotgewehr abgeschossen. Sie führen bei einem Körpertreffer zu einem temporären Schmerz- beziehungsweise kurzzeitigen psychischen Schock-zustand und sollen so die getroffene Person von Ihrer ursprünglich intendierten Handlung abhalten. Das Ver-letzungsniveau ist hierbei hauptsächlich von der Schuss-entfernung und der getroffenen Körperregion abhängig. Anvisierte Treffer größerer Muskelgruppen der unte-ren Extremitäten, wie von Herstellerseite empfohlen, resultieren in Hauteinblutungen und oberflächlichen Abschürfungen (Abb. 1). Insbesondere bei Beschuss mit Gummigeschossen können bei relativen und absolu-ten Nahschüssen schwerwiegendere Verletzungen wie Frakturen oder innere Blutungen nicht ausgeschlossen werden [23]. Bei einer effektiven Reichweite von bis zu 36.6 m und einer kinetischen Energie von ca. 150 J [24] finden sich in der medizinischen Literatur sogar einzelne Falldarstellungen mit tödlichem Ausgang bei Beschuss im absoluten und relativen Nahbereich [25]. Dass Tref-fer im Brustbereich über eine Herzkontusion (Commotio cordis) zu einer tödlichen Rhythmusstörung führen wür-den, konnte im Rahmen einer tierexperimentellen Stu-die mit narkotisierten Schweinen widerlegt werden [26]. Klinisch relevante Veränderungen der Herzaktivität oder Herzenzyme wurden hierbei nicht festgestellt.
In jedem Fall sollte bei einem Treffer innerhalb der als kritisch anzusehenden Kopf- und vorderen Brustkorbre-gion zusätzlich zur primären Wundversorgung eine ärzt-liche Überwachung des Patienten stattfinden (Tab. 1).
Elektrische NLW
Unter den elektrischen Nicht-letalen Wirkmitteln wer-den vor allem die konventionellen Elektroschockgeräte und die heutzutage weit verbreiteten Elektroschock-
resultierenden Gefäßverletzungen, Hauteinblutungen und Abhebung oberer Hautschichten. Je nach Größe und Druck des Wasserstrahls können auch sogenannte Hoch-druckinjektionsverletzungen entstehen. Diese Sonder-form der Fremdkörpereinsprengungen ist vor allem bei Arbeitsunfällen aus dem Bereich der Industrie bekannt. Hierbei gelangt innerhalb von kurzer Zeit eine große Wassermenge durch eine verhältnismäßig kleine Perfo-rationsstelle der Haut in den Körper. Die resultierenden Verletzungen werden wegen der anfangs blanden äuße-ren Wundverhältnisse unterschätzt, so dass eine spätere chirurgische Intervention aufgrund von subkutanen Fremdkörpereinlagerungen oder Nekrosenbildungen oftmals nicht vermieden werden kann [19].
Bei großflächiger tangentieller Einwirkungsrichtung kann es zur Ablederung (sog. Décollement) der Haut kommen. Je nach Druckintensität kann die resultie-rende Verletzung einem Kompartmentsyndrom ähneln mit großflächigen Zell- und Muskelgewebszerstörungen [19]. Aufgrund der großflächigen Gewebeschädigung kommt es in Folge gehäuft zu Wundheilungsstörungen.
Auch Prellungsverletzungen innerer Organe sind denkbar, wobei es hierbei nicht notwendigerweise zu schwerwiegenden äußeren Verletzungen kommen muss [20]. In der medizinisch-wissenschaftlichen Literatur existieren derzeit keine systematischen Untersuchungen, die mögliche Verletzungsmechanismen mit den entspre-chend auf den Körper einwirkenden Wassermengen in Relation zueinander setzen. Untersuchungen potentiel-ler Augendefekte beim spielerischen Einsatz von Was-serspritzpistolen haben gezeigt, dass die Druckschwelle organgefährdender Augenverletzungen deutlich unter-halb der durch einen Wasserwerfer möglichen Applika-tion liegt [21]. Zwar kann die Strahlstärke und damit die Wirkung des Wasserwerfers variabel eingestellt werden, aufgrund der hohen Einsatzdistanz von bis zu 65 m auf bewegte Zielobjekte kann eine hohe Zielgenauigkeit jedoch nicht immer garantiert werden. Dass eine feh-lerhafte Anwendung von Wasserwerfern zum Verlust des Sehvermögens führen kann, zeigen die Folgen eines fehlerhaft eingesetzten Wasserwerfers im Rahmen einer eskalierten Protestaktion in Deutschland (Stuttgart) im September 2010 [22].
Verletzungen aufgrund von Wasserwerfern sind in jedem Fall durch eine primäre Wundreinigung und eventuell chirurgische Versorgung zu behandeln. Eine detaillierte Inspektion der Oberhaut ist wichtig, um Hautemphyseme und Wasserinjektionen ausschließen bzw. zeitnah behandeln zu können (Tab. 1).
Nicht-letale kinetische Geschosse
Nicht-letale kinetische Geschosse, wie beispielsweise Hartgummigeschosse (z. B. eXact iMpact, Defense Tech-nology® oder Rubber Slug 12 GA, Lightfield Ammuni-toin Corp®) oder sogenannte Bean Bags (z. B. 37/40 mm Bean Baton Round, Defense Technology®) werden mit-tels eines 40 mm Granatwerfers oder auch mit einem
Abb. 1 Hautverletzung nach Beschuss mit dem Gummige-schoss eXact iMpact (eigene Versuche)

originalarbeit
Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel 51 3
Selbst bei äußerlich unauffälligem Befundbild ist vom behandelnden Arzt ein diagnostischer Ausschluss der durch die jeweilige Gewalteinwirkung möglicherweise hervorgerufenen Verletzungen durchzuführen.
Da Verletzungsbilder resultierend aus NLW in der Regel aus behördlichen Konflikten entstehen, ist bereits vor beziehungsweise während der Behandlung eine detaillierte Dokumentation besonders wichtig. Eine genaue, wenn möglich fotographische Erfassung äuße-rer und innerer Befunde erleichtert eine spätere gerichts-ärztliche beziehungsweise juristische Beurteilung.
InteressenkonfliktDer Autor gibt an, dass für sich und seine Koautoren (Dr. Grove C, PD. Dr. Monticelli F) kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
1. Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Genf. 1949. Verfügbar unter: http://www.admin.ch/ch/d/sr/i5/0.518.51.de.pdf. Zugegriffen: 13. Juli 2013.
2. Waffengebrauchsgesetz (WaffGebrG). Wien. 1969. Verfügbar unter: http://www.ris.bka.gv.at/Gelten-deFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum-mer=10005345. Zugegriffen: 16. Juli 2013.
3. Matschke J, Lohmann F, Giese A, Seifert D, Püschel K, et al. Erhaltene Handlungsfähigkeit nach Kopfschuss. Archiv für Kriminologie. 2002;209:88–94.
4. Applegate R. Part II Using Riot Chemicals. In: Applegate, R. Riot Control – Materiel and Techniques. 1st edn. Harris-burg: Stackpole Books; 1969. S. 126–211.
5. Seaskate Inc. The Evolution and Development of Police Technology. National Institute of Justice, US Department of Justice. Washington, DC; 1998.
6. U.S. Department of Defense Non Lethal Weapons Program. verfügbar unter: http://jnlwp.defense.gov/about/history.html. Zugegriffen: 29. Juli 2013.
distanzgeräte subsumiert. Der Ursprung dieser Elektro-schockgeräten, oder auch Conducted Electrical Weapons (CEW) genannt, liegt im Gegensatz zu kinetischen und chemischen NLW nicht im militärischen oder polizei-lichen Bereich, sondern in der Landwirtschaft. Das Grundprinzip, durch elektrisch ausgelöste Schmerzreize den Abbruch einer Handlung zu bewirken wurde bereits 1939 von Whitaker beschrieben [27]. Frühe Produkte die-ser Waffen waren in Form von Hand- oder Stabgeräten erhältlich und konnten nur im Kontaktmodus verwendet werden. Zwei Elektroden wurden einem Kontrahenten auf die Haut aufgesetzt und hierdurch kurze Stromim-pulse von weniger als 20 s Dauer und mit Spannungen von über 100 kV bei Stromstärken von 3–8 A übertragen [28].
Diese Grundidee wurde letztlich von Cover et al. auf-gegriffen und dahingehend weiterentwickelt, dass die Stromapplikation bei einem Kontrahenten nicht nur eine schmerzinduzierte Reaktion hervorruft, sondern durch eine intradermale Stromapplikation mittels zweier die Haut penetrierender Pfeile, das neuromuskuläre Sys-tem ganzheitlich erfasst wird [29]. Die auf dieser Basis entwickelten Elektroschockdistanzwaffen, wie beispiels-weise der TASER® haben die herkömmlichen Geräte weitestgehend abgelöst. Grundsätzlich bewirkt die neue Technologie der CEW durch eine intradermale Strom-applikation hoher Spannungen bei gleichzeitig gerin-gen Stromstärken eine willentlich nicht beeinflussbare, allgemeine tonisch-klonische Muskelkontraktion mit konsekutiver Immobilisierung des Getroffenen. Diese Reaktion wird durch eine direkte Stimulation vom Typ A-a-Motoneuronen bewirkt, welche dann den Impuls zur motorischen Synapse weiterleiten und so die erwünschte tonische Muskelkontraktion bewirken. Die potentiellen Gefahren dieser Technologie wurden in medizinischen Publikationen vielfach und zum Teil auch kontrovers diskutiert und hinterfragt [30]. Zwar haben einzelne For-schungsgruppen auf gewisse Risiken von CEW hingewie-sen [31, 32], ein direkter Kausalzusammenhang zwischen klinisch relevanten pathophysiologischen Veränderun-gen und der fachgerechten Anwendung von CEW konnte dennoch nicht zweifelsfrei hergestellt werden [33, 34].
Für den erstbehandelnden Arzt steht daher die Wund-versorgung primärer, d. h. durch die Hautpenetration der Pfeilelektroden verursachter Verletzungen (Abb. 2) im Vordergrund. Nur bei kardialen Vorschädigungen sollte eine medizinische Überwachung des Patienten erfolgen (Tab. 1).
Fazit für die Praxis
Auch wenn NLW bei fachgerechter Anwendung für eine betroffene Person in der Regel keine schwerwiegenden oder bleibenden Schäden verursachen, ist eine genaue Anamnese und Erfassung äußerer und eventuell auch innerer Verletzungen durch den erstbehandelnden Mediziner notwendig.
Abb. 2 Hautverletzung nach TASER-Beschuss (eigene Versuche)

originalarbeit
6 Medizinische Aspekte gängiger nicht-letaler Wirkmittel 1 3
22. Spiegel online. Stuttgart-21-Protest: Wasserwerfer-Op-fer bleibt auf einem Auge blind. 2010. verfügbar unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/stuttgart-21-protest-wasserwerfer-opfer-bleibt-auf-einem-auge-blind-a-722939.html. Zugegriffen: 1. Aug. 2013.
23. de Freminville H, Prat N, Rogieras F, Voiglio EJ, et al. Less-lethal hybrid ammunition wounds: a forensic assess-ment introducing bullet-skin-bone entity. J Forensic Sci. 2010;55:1367–70.
24. eXact iMpact Specification Manual. Defence Technology®.
2003. verfügbar unter: http://www.defense-technology.com/pdfs/specs/Sponge_Round.pdf. Zugegriffen: 1. Aug. 2013.
25. Charlier P, Alvarez JC, Durigon M, de la Grandmaison GL, et al. Unusual death by rubber bullet: should these guns be reclassified as lethal weapons? Am J Forensic Med Pathol. 2012;33:e4.
26. Kunz SN, Arborelius UP, Gryth D, Sonden A, Gustavsson J, Wangyal T, Svensson L, Rocksén D, et al. Cardiac Changes After Simulated Behind Armor Blunt Trauma or Impact of Nonlethal Kinetic Projectile Ammunition. J Trauma. 2011;71:1134–43.
27. Whitaker HB. Electric shock as it pertains to the Electric Fence. Bulletin of Research. Underwriter's Laboratories. 1939;14:1–55.
28. Burdett-Smith P. Stun gun injury. J Accid Emerg Med. 1997;14:402–4.
29. Stratbucker RA. The Scientific History. In: Kroll MW, Ho JD, Herausgeber. TASER® Conducted Electrical Weapon: Phy-siology, Pathology, and Law. Springer Science+Business Media. LLC; 2009. S. 11–21.
30. Kunz SN, Grove N, Fischer F. Acute pathophysiological influences of conducted electrical weapons in humans: A review of current literature. Forensic Sci Int. 2012;221:1–4.
31. Nanthakumar K, Billingsley IM, Masse S, Dorian P, Cameron D, Chauhan VS, Downar E, Sevaptsidis E, et al. Cardiac electrophysiological consequence of neuromus-cular incapacitating device discharges. J Am Coll Cardiol. 2006;48:798–804.
32. Valentino DJ, Walter RJ, Dennis AJ, Margeta B, Starr F, Nagy KK, Bokari F, Wiley DE, Joseph KT, Roberts RR, et al. Taser X26 Discharge in Swine: Ventricular Rhythm Capture is Dependent on Discharge Vector. J Trauma. 2008;65:1478–85.
33. Kunz SN, Monticelli F, Kaiser C. Tod durch Elektroschock-distanzwaffen – eine reine Ausschlussdiagnose? Rechtsme-dizin. 2012;22:369–73.
34. Dawes DM, Ho JD, Reardon RF, Strote SR, Nelson RS, Lun-din EJ, Orozco BS, Kunz SN, Miner JR, et al. The respiratory, metabolic, and neuroendocrine effects of a new generation electronic control device. Forensic Sci Int. 2011;207:55–60.
7. European Working Group Non-Lethal Weapons. verfügbar unter: http://www.non-lethal-weapons.com. Zugegriffen: 29. Juli 2013.
8. Polizeitechnisches Institut der Deutschen Hochschule der Polizei. Technische Richtlinie (TR) Reizstoff-Sprühgeräte (RSG) mit Oleoresin Capsicum (OC) oder Pelargonsäure-vanillylamid (PAVA). Polizeien der Länder und des Bundes. 2008. Verfügbar unter: http://www.pfa.nrw.de/PTI_Inter-net/pti-intern.dhpol.local/WG/Regelungen/RSG/TR-RSG_11–08.pdf. Zugegriffen: 30. Juli 2013.
9. Zollman TM, Bragg RM, Harrison DA. Clinical Effects of Oleoresin Capsicum (Pepper Spray) on the Human Cornea and Conjunctiva. Ophthalmology. 2000;107:2186–9.
10. Vesaluoma M, Müller L, Gallar J, Lambiase A, Moilanen J, Hack T, Belmonte C, Tervo T, et al. Effects of oleoresin cap-sicum pepper spray on human corneal morphology and sensitivity. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41:2138–47.
11. Kniestedt C, Fleischhauer J, Stürmer J, Thiel MA, et al. Pfef-fersprayverletzungen des vorderen Augensegmentes. Klin Monbl Augenheilkd. 2005;222:267–70.
12. Brown L, Takeuchi D, Challoner K. Corneal abrasions associated with pepper spray exposure. Am J Emerg Med. 2000;18:271–2.
13. Chan TC, Vilke GM, Clausen J, Clark RF, Schmidt P, Snow-den T, Neuman T, et al. The effect of oleoresin capsicum „pepper“ spray inhalation on respiratory function. J Foren-sic Sci. 2002;47:299–304.
14. Steffee CH, Lantz PE, Flannagan LM, Thompson RL, Jason DR, et al. Oleoresin capsicum (pepper) spray and „in-cust-ody deaths“. Am J Forensic Med Pathol. 1995;16:185–92.
15. Miller JJ, Skolnick J. Inhalation Injury after Capsaicin Expo-sure. J Ky Med Assoc. 2006;104:103–5.
16. Worthington E, Nee PA. CS exposure-clinical effects and management. J Accid Emerg Med. 1999;16:168–70.
17. Karagama YG, Newton JR, Newbegin CJR. Short-term and long-term physical effects of exposure to CS spray. J R Soc-Med. 2003;96:172–4.
18. Deutscher Bundestag. Antwort der Bundesregierung. Einsatz von Wasserwerfern. Drucksache 17/3977. 2010. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/039/1703977.pdf. Zugegriffen: 30. Juli 2013.
19. Smith GD. High pressure injection injuries. Trauma. 2005;7:95–103.
20. Kessel B, Eliam D, Ashkenazi I, Alfici R, et al. Severe hydro-blast intra-abdominal injuries due to high-pressure water jet without penetration of abdominal cavity. Injury Extra. 2005;36:82–3.
21. Duma SM, Bisplinghoff JA, Senge DM, McNally C, Alphonse VD, et al. Eye injury risk from water stream impact: biome-chanically based design parameters for water toy and park design. Curr Eye Res. 2012;37:279–85.