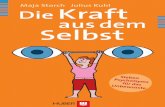Paris — Wien ||
Transcript of Paris — Wien ||


W

Veröffentlichungen des
Instituts Wiener Kreis
Band 13
Hrsg. Friedrich Stadler

Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Nemeth Universitat Wien, Wien, Osterreich
Dr. Nicolas Roudet lnstitut Fran~ais, Wien, Osterreich
Gedruckt mit Unterstutzung des Bundesministeriums fur Bildung, Wissen- schaft und Kultur in Wien sowie des Magistrats der Stadt Wien, MA 7 - Gruppe Kultur, Wissenschafts- und Forschungsforderung
Das Werk ist urheberrechtlich geschutzt. Die dadurch begrundeten Rechte, insbesondere die der Ubersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ahnlichem Wege und der Speiche- rung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
O 2005 Springer-VerlagNVien Printed in Austria SpringerWienNewYork ist ein Unternehmen von Springer Science + Business Media springersat
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnun- gen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann benutzt werden durften. Produkthaftung: Samtliche Angaben in diesem Buch erfolgen trotz sorgfaltiger Bearbeitung und Kontrolle ohne Gewahr.
Satz: Reproduktionsfertige Vorlage der Herausgeber Druck: Bdrsedruck Ges.m.b.H., 1230 Wien, Osterreich
Gedruckt auf saurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier - TCF SPIN: 11000440
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet uber http://dnb.ddb.de abrufbar
ISBN-1 0 3-21 1-21 538-7 SpringerWienNewYork ISBN-13 978-3-21 1-21 538-8 SpringerWienNewYork

Zur Einfiihrung
Elisabeth Nemeth Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung ................... 7
Friedrich Stadler Paris - Wien: Enzyklopadien irn Vergleich. ijber vergessene Wechselwirkungen ................................................. 25
Paris - Wien. Enzyklopadieprojekte im Vergleich
Thomas Mormann Geographie des Wissens und der Wissenschaften: von der Encyclopedie zur Konstitutionstheorie .................................... 33
Dominique Lecourt L'Encyclopedie vue par Diderot ............................................................ 65
Pierre Wagner L'EncyclopBdie de Diderot et d'Alembert est-elle I'expression d'une conception scientifique du monde? ....................................................... 73
Anastasios Brenner Histoire et logique dans I'ecriture encyclopedique ................................ 89
Wien - Paris: der Logische Empirismus in Frankreich. Zur Geschichte eines gescheiterten Kommunikationsversuchs
Hans-Joachim Dahms Neuraths Lehren aus der franzosischen Enzyklopadie ...................... 105
Antonia Soulez Der Neurath-Stil, oder: der Wiener Kreis, Rezeption und Rezeptionsproblerne auf den Kongressen
...................................................................... 1935 und 1937 in Paris 121
Mathieu Marion Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science ................ 151
Peter Schottler 13, rue du Four. Die Encyclopedie Fran~aise als Mittlerin franzosischer Wissenschaft in den 1930er Jahren ............................ 179

,,Physikalistische Einheitswissenschaft" und International Encyclopedia of Unified Science
Melika Ouelbani Carnap und die Einheit der Wissenschaft .......................................... 205
Thomas Uebel Social Science in the Framework of Neurath's Physicalist Encyclopedia: Some Anti-Reductionist Concerns Allayed ...................................... 221
Aufklarungsdenken unter neuen Vorzeichen?
George A. Reisch Doomed in Advance to Defeat? John Dewey on Logical Empiricism, Reductionism, and Values ................................................................. 241
Namenregister .................................................................................... 253
Die Autoren ......................................................................................... 257

ELISABETH NEMETH
ORDNUNGEN DES WISSENS UND GESELLSCHAFTLICHE AUFKLARUNG
Vorbemerkung
Eines der zentralen Anliegen des .Wiener Kreises" ist heute aktueller denn je. Es bestand darin sichtbar zu machen, wie ganz unterschiedli- che, weit auseinander liegende Bereiche wissenschaftlicher Theoriebil- dung miteinander in Zusammenhang gebracht werden konnen. Dass dieses Projekt zunachst .Einheitswissenschaft" genannt wurde, gab Anlass zu einer Reihe von Missverstandnissen die bis heute nicht aus- geraumt sind. Es ging den Logischen Empiristen der 1920er und 30er Jahre weder darum, alles Wissen auf die Physik zu reduzieren, noch darum .das System" der Wissenschaften zu konstruieren oder sie in das Korsett einer physikalischen Sprache zu zwingen. .Das System ist die gro13e wissenschaftliche Lugeu schrieb Otto Neurath 1935 und setz- te .die Enzyklopadie als Modellu dagegen: die Vision eines lebendigen Gesamten, dessen innere Struktur nicht ein fur alle Mal festgelegt wer- den kann. So wie gesellschaftliche ,UtopienU fur Neurath prinzipiell nur in einer Mehrzahl von Alternativen denkbar sind, so treten auch "Enzy- klopadien" immer im Plural auf. Neurath sah von Anfang an, dass die Entwicklung wissenschaftlichen Wissens nicht als ein linear fortschrei- tender Akkumulationsprozess verstanden werden kann. Erweiterungen unseres Erfahrungswissens werden auch dadurch moglich dass die Natur menschlichen Wissens einer Analyse unterzogen und ein Stuck weit geklart wird. Die Frage, worin wohlbegrundetes Wissen denn uberhaupt besteht, ist seit jeher eng verbunden mit der Frage, wie wir uns die innere Ordnung des Wissens in seiner Gesamtheit vorstellen sollen.
Die International Encyclopedia of Unified Science sollte sich daher nicht damit begnugen, eine moglichst grol3e Bandbreite von Erkennt- nissen der Offentlichkeit zuganglich zu machen. Sie sollte auch eine Vorstellung davon vermitteln, wie moderne Wissenschaften ihre Er- kenntnisanspruche formulieren und uberprufen - also sichtbar machen, was in den modernen Wissenschaften als .wohlbegrundetes Wissen" gilt. Mit dieser Konzeption gingen die Herausgeber der .Encyclopedia" - und vor allem der .Motor der Sache", Otto Neurath - uber das gangi- ge Verstandnis einer Enzyklopadie weit hinaus und knupften ausdruck-

8 Elisabeth Nemeth
lich an die Enzyklopadisten der franzosischen Aufklarung an. Wie die Enzyklopadie des 18. Jahrhunderts, so sollte auch die International Encyclopedia of Unified Science Instrument gesellschaftlicher Aufkla- rung sein. Es ist wichtig zu sehen, dass ,,Aufklarungl' hier nicht als Ver- kundigung von angeblich feststehenden wissenschaftlichen Fakten an die ~ffentlichkeit verstanden wurde. Die modernen Wissenschaften waren nicht nur Instrument, sondern auch Gegenstand des aufklaren- den Blicks. Dieser sollte sich nicht nur auf die natiirliche und die gesell- schaftliche Welt richten, sondern auch auf die Wissenschaften selbst. Alle Menschen sollten sich ein realistisches Bild daruber verschaffen konnen, auf welche Weise modernes Wissen hervorgebracht wird und auf welchen Verfahrensweisen moderne Wissenschaftler ihre Erkennt- nisansprikhe begrunden. Somit war die Encyclopedia ausdrucklich gegen den Hang zur Selbstuberhohung gerichtet, der den modernen Wissenschaften genauso innewohnt wie anderen Spharen gesellschaft- lichen Handelns. Neuraths Argumente gegen den "Pseudorationalis- mus" fanden ihre reichhaltigste Gestalt in seinen Schriften zum Kon- zept der Enzyklopadie.
Der vorliegende Band will darauf aufmerksam machen, dass das Konzept, das der Enzyklopadie der Logischen Empiristen zugrunde liegt, um vieles reichhaltiger ist als das klischeehafte Bild, das die gan- gige Einschatzung dieses Unternehmens bis heute pragt. Wir wollen dessen Reichhaltigkeit sichtbar machen, indem wir das Unternehmen unter mehreren konzeptionell und historisch unterschiedlichen Blick- winkeln betrachten. Im ersten Teil wird es auf das grofie Vorbild der Enzyklopadisten des 18. Jahrhunderts in Frankreich zuruckbezogen und mit diesem verglichen. Der zweite Teil geht der Geschichte des Projekts im 20. Jahrhundert nach und richtet den Blick vor allem auf die Kooperationen mit franzosischen Wissenschaftlern und Philosophen in den 1920er und 30er Jahren. Der dritte Teil deutet an, dass der Begriff der Einheit der Wissenschaft nicht von allen Proponeten des Logischen Empirismus in derselben Weise gefasst wurde, und zeigt, dass die .physikalistische Einheitswissenschaft" - wenn sie in der Weise ge- dacht wird wie Neurath das tat - den Sozialwissenschaften einen wich- tigen Platz einraumt. Im vierten Teil werfen wir einen Blick auf den his- torischen Kontext, in dem sich das Aufklarungsprojekt des Logischen Empirismus wiederfand, nachdem diese philosophische Bewegung aus Europa vertrieben worden war.

Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung 9
I. Paris - Wien. Enzyklopadieprojekte im Vergleich
Es gibt eine Reihe von Affinitaten zwischen der von Neurath zwischen 1935 und 1945 vorangetriebenen International Encyclopedia of Unified Science (IEUS), die freilich ein Torso geblieben ist, und der Konzeption, die Diderot und d'Alernbert in der groaen Encyclopedie verwirklicht haben. Pierre Wagner fasst in seinem Beitrag die folgenden ins Auge springenden Gerneinsamkeiten zusamrnen: 1. Beide Projekte sind von dern Wunsch getragen, die verfugbaren Erkenntnisse ihrer Zeit in einen Zusarnrnenhang zu bringen. Dabei geht es eher um eine kollektive Arbeit kritischen Ordnens als darum, eine Sicht der Welt im Ganzen zu erreichen. (In diesern Sinn legten die logi- schen Ernpiristen Wert darauf, die .wissenschaftliche Weltauffassung" scharf zu unterscheiden von rnetaphysisch oder religios begrundeten .WeltanschauungenU.) 2. Beide Enzyklopadien kritisieren die Obskurantismen der Metaphysik und streben nach gronerer Klarheit bei der Analyse philosophischer Probleme. 3. Ihr Erkenntnisbegriff ist empiristisch: Erkenntnis erreichen wir nur, wenn wir auf die Erfahrung und die Tatsachen zuruckgreifen. 4. Der Philosophie wird jegliche Vorrangstellung gegenuber den Wis- senschaften abgesprochen. 5. Beide Enzyklopadie-Projekte sind von der ljberzeugung getragen, dass die Wissenschaft in den Dienst gesellschaftlicher Emanzipation gestellt werden kann.
Tatsachlich klingen die Worte, rnit denen Diderot und d'Alernbert ihr Projekt charakterisieren, irnrner wieder verbluffend ahnlich wie rnanche Schriften Neuraths. So fuhrt Dorninique Lecourt in seinern Beitrag vor, dass Diderot seine Aufgabe darin sah, die Einheit der Welt erfahrbar zu rnachen: die Encyclopedie stellt Beziehungen zwischen weit entfernten und ganz unterschiedlichen Erkenntnissen her und Iadt so die Leserin ein, selbst Beziehungen zu entdecken. In diesem Sinn sol1 die Encyclo- pedie eine Jebendige Einheit" sein. Sie stellt die Welt als ,,Einheit in unendlicher Mannigfaltigkeit" dar - "beinahe ohne feste und bestimrnte Unterteilung" - und zeigt, dass wir uns einen Weg durch diese Vielfalt suchen rnussen, dessen Ziel nicht von vornherein feststeht.
Auch Neurath hat gegen den "Geist des Systems" die grundsatzli- che Vielfalt rnoglicher Ordnungen des Wissens gesetzt und hat sich dabei ausdrucklich auf d'Alembert berufen. Die Enzyklopadie des 18. Jahrhunderts war, so Neurath

10 Elisabeth Nemeth
keine ,faute de mieux-Enzyklopadie' anstelle eines umfassenden Systems, sondern eine Alternative zu Systemen. ... Diese Enzyklo- padie verfugte ... uber keine umfassende Einheitlichkeit; sie war durch eine Klassifizierung der Wissenschaften, Verweise und ande- re Techniken organisiert."'
Das .enzyklopadische Modell", das Neurath vorschwebte, sollte es moglich machen, auch das Gesamte des Wissens des 20. Jahrhun- derts als "lebendiges Wesen" zu sehen:
Die Enzyklopadie wird die Situation eines lebendigen Wesens und nicht die eines Phantoms zum Ausdruck bringen; jene, die die En- zyklopadie lesen, sollen das Gefuhl haben, dal3 Wissenschaftler von der Wissenschaft als einem Wesen aus Fleisch und Blut spre- then.*
Gemeinsamkeiten dieser sehr allgemeinen Art beginnen freilich zu verblassen, sobald wir die Dinge etwas genauer betrachten. Da zeigt sich zum Beispiel sehr schnell, dass die Enzyklopadisten des 18. Jahr- hunderts weder unter "Metaphysik" noch unter ,,Philosophieu noch unter den .WissenschaftenU dasselbe verstanden wie die Logischen Empiris- ten (siehe den Beitrag von Pierre Wagner). Und dass sich daher die Frage, wie die Einheit des Wissens in seiner unendlichen Vielfalt er- fasst werden kann, im 18. Jahrhundert auf ganz andere Weise stellte als im 20. Jahrhundert. Zwar liegt beiden Projekten die (Jberzeugung zugrunde, dass es fur die Aufgabe, eine geordnete Sicht des Wissens in seiner Gesamtheit zu geben, nicht eine einzige richtige Losung gibt, sondern eine Pluralitat von grundsatzlich gleichberechtigten Moglichkei- ten. Aber - das arbeitet Pierre Wagner in seinem Beitrag heraus - fur Diderot und d9Alembert stellte sich dabei vor allem die Frage, wie die explodierende Menge der Erkenntnisse ihrer Zeit geordnet und wie dieses Gesamte sinnvoll unterteilt werden kann. (Was sind die Zweige des Baums menschlicher Erkenntnis? Wie sol1 das Tableau der Wis- senschaften eingeteilt werden?) Dagegen hatten es die Logischen Em- piristen mit einer Welt bereits entwickelter spezialisierter wissenschaft- licher Disziplinen zu tun. Ihr Problem war es zu zeigen, was denn .Ein- heit der Wissenschaft" unter den Bedingungen der Spezialisierung iiberhaupt bedeuten kann. Und wahrend die Enzyklopadisten des 18. Jahrhunderts den Ausdruck ,,WissenschaftU in der Bedeutung von ,,Er- kenntnis" im allgemeinen gebrauchten (im Gegensatz zu Meinung, Einbildung, Glauben ...) und sich uberhaupt nicht fijr die Frage interes-

Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung 1 1
sierten, was .WissenschaW als solche ist und was nicht, stand die letz- tere Frage im Mittelpunkt des Projekts der Einheitswissenschaft.
Das Programm der .Einheitswissenschaft" ist zu Recht als das "positive Para- digmau des Logischen Empirismus bezeichnet worden. Dieses bleibt aber un- terbestimmt, wenn die Betonung der Einheit ausschliel3lich als "gegen einen haufig angenommenen Hiat zwischen sogenannten Geisteswissenschaften einerseits und Naturwissenschaften andererseits" gerichtet verstanden ~ i r d . ~ Dass dieser Hiatus abgelehnt wurde, ist naturlich richtig, aber es ist wichtig herauszustreichen, dass das Projekt der Einheitswissenschaft auf kulturelle Tendenzen reagierte, die weit uber die Auseinandersetzung um das Verhaltnis zwischen Natur- und Geisteswissenschaften hinausgingen. Das Pathos, mit dem das Manifest des Wiener Kreises die Einheitswissenschaft als Ziel pro- klamiert, wird nur dann verstandlich, wenn man sieht, dass die Einheitswissen- schaft als direkter Konkurrent all jener metaphysischen Einheitsentwurfe konzi- piert wurde, mit denen die deutschsprachigen Gelehrten des spaten 19. und fruhen 20. Jahrhunderts das zu uberwinden suchten, was sie die ,,Krise der Wissenschaft" nannten und was in ihren Augen ein Ergebnis der Spezialisie- rung der Wissenschaften war. Die Stromung unter den deutschen Gelehrten, die Fritz Ringer beschrieben und als "Bewegung zur Synthese" bezeichnet hat, hat ihre Ursprijnge im 19. Jahrhundert. Im Lauf der 1920er Jahre wurde diese Bewegung zu einer Obsession, die den GroMeil der deutschsprachigen Gelehr- ten erfasste. Damals wurde der Ruf nach einer neuen einheitsstiftenden ,,Meta- physik" ganz ausdriicklich erhoben, und gegen Ende der 1920er Jahre wurde dieser Ruf imrner allgemeiner und aggre~siver.~ Diejenigen unter den Mitglie- dern des Wiener Kreises, die das Programm der .Einheitswissenschaft" vertra- ten (das waren nicht alle, sondern vor allem Neurath, Carnap, Hahn und Frank), akzeptierten in gewisser Weise die von den ,,MetaphysikernU ihrer Zeit vertretene Auffassung, dass das .SpezialistentumU der empirischen Wissen- schaften nicht das letzte Wort sein konne. Sie traten mit dem Anspruch an, die Art und Weise, in der die Erkenntnisse der Wissenschaft zusammenhangen, darzustellen, und m a r nicht durch Zuruckfuhrung auf metaphysische Begriffe, sondern mit rein rationalen Mitteln: mit logischer Analyse und empirischer For- schung.
Die .wissenschaftliche Weltauffassung" des Wiener Kreises und das Programm der .Einheitswissenschaft" reagierten also auf eine ganz andere wissenschaftliche und philosophische Konstellation als die En- cyclopedic des 18. Jahrhunderts. Daher sind fiir Pierre Wagner vor allem die Unterschiede zwischen den beiden Konzeptionen von Inte- resse. In seinem Beitrag wird deutlich, dass der strukturelle Vergleich der beiden Aufklarungsprojekte dann besonders instruktiv ist, wenn er darauf abzielt, die unterschiedlichen Problemlagen zu rekonstruieren, auf die sie reagierten.
Wahrend Pierre Wagner von der ,,wissenschaftlichen Weltauffas- sung" des Wiener Kreises ausgeht urn herauszuarbeiten, worin sich die Fragestellungen des 18. Jahrhunderts von denen des Wiener Kreises

12 Elisabeth Nemeth
unterscheiden, blickt Anastasios Brenner gleichsarn in die urngekehrte Richtung. Seine ljberlegungen setzen dort an, wo d'Alernbert zwischen zwei moglichen Verfahren zur Organisation der Encyclopedic unter- scheidet. Im Discours preliminaire stellt diAlernbert dem genealogi- schen Verfahren das historische Verfahren gegenuber. Nach Brenner zeigt sich hier in Ansatzen bereits die Unterscheidung zwischen der rationalen Rekonstruktion der Erkenntnis und ihrer historischen Erkla- rung, jener Unterscheidung, die im Logischen Ernpirisrnus seit Rei- chenbachs Unterscheidung 1938 eine zentrale Rolle spielen sollte. Freilich interessierten sich die Logischen Ernpiristen vor allem fur die rationale Rekonstruktion wissenschaftlicher Behauptungen, und - spa- testens irn Lauf der 1940er Jahre - verschwand die historische Seite der Wissenschaft weitgehend aus ihrern Blickfeld. Wenn man dagegen Neuraths Schriften aufrnerksarn liest, zeigt sich, so Brenner, dass die Geschichte in vielen seiner Argurnentationen einen hohen systernati- schen Stellenwert besitzt. Aufierdern wird er nicht rnude, das Pro- grarnm der Logischen Ernpiristen historisch zu verankern. (Neuraths bekannteste diesbezugliche These sagt, dass die spezifischen sozia- len, politischen und kulturellen Bedingungen in der bterreichisch- ungarischen Monarchie dazu gefuhrt hatten, dass sich ein ernpiristi- sches, an den Wissenschaften orientiertes Denken in Osterreich hatte leichter durchsetzen konnen als irn Deutschen Reich.)
Eine wichtige Wurzel dieser Orientierung der Wissenschaftsphilo- sophie an der Geschichte der Wissenschaften liegt in der franzosischen Tradition. Neurath raurnt nicht nur den Enzyklopadisten der Aufklarung, sondern auch anderen Denkern der franzosischen Tradition einen her- ausragenden Platz ein: Cornte, Poincare, Duhern, Abel Rey. Brenner rnacht darauf aufrnerksarn, dass die kritische Haltung Neuraths gegen- uber Cornte in ihren Grundlinien schon bei Poincare gegeben war. Und er hebt hervor, dass es falsch ware, das lnteresse an den forrnalen Zugen wissenschaftlicher Theorien, das fur den Logischen Ernpirisrnus so charakteristisch ist, ausschliefilich in der Linie Russell - Frege - Wittgenstein zu verankern. Es ist wichtig zu sehen, dass sich in der franzosischen Wissenschaftsphilosophie die Klarung der forrnalen Struktur rnit einer eindringlichen Analyse der Geschichte der Wissen- schaft verband. Wenn Henri Poincare und Pierre Duhern die forrnalen Zijge wissenschaftlicher Theorien untersuchten (die Interpretation for- rnaler Systerne, die ljbersetzung unterschiedlicher Wissenschaftsspra- chen ineinander, operationale Definitionen), taten sie dies ausdriicklich unter Berufung auf ihre wissenschaftshistorische Arbeit.

Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung 1 3
Brenner spricht damit eine Geschichte der wechselseitigen Pra- gungen des Denkens zwischen Frankreich und ~sterreich an, die bis heute stark unterbelichtet ist. Fur die Erforschung dieser Zusammen- hange kann gerade das Enzyklopadieprojekt der Logischen Empiristen Anknupfungspunkte bieten. Brenner weist darauf hin, dass im Frank- reich an der Wende zum 20. Jahrhundert und in dessen ersten Jahr- zehnten mehrere enzyklopadische Unternehmen ins Werk gesetzt wur- den: die Grande Encyclopedie von Marcelin Berthelot, die von Lucien Febvre ins Leben gerufene Encyclopedie fran~aise, sowie die grol3e historische Synthese, an der Henri Berr arbeitete, und der neue Positi- vismus von Abel Rey. Bei aller Verschiedenartigkeit finden sich in die- sen Unternehmungen Ansatze, die mit der .Bewegung fur die Einheit der Wissenschaft" der Logischen Empiristen verwandt sind, und die ja auch zu konkreten Kooperationsversuchen gefuhrt haben. Damit sind wir aber schon beim Thema unseres zweiten Abschnitts. Bevor wir uns ihm zuwenden, sol1 noch vom Beitrag Thomas Mormanns die Rede sein, der unseren Band eroffnet.
Mormanns Beitrag ist fur das Thema dieses Bandes insofern von besonderem Interesse, als er zeigt, dass die Aufmerksamkeit auf den historischen Ort eines wissenschaftlich-philosophischen Projekts auch zur vertieften strukturellen Klarung der damit verbundenen philosophi- schen Fragen fuhren kann. Mormann sieht in der Encyclopedie Dide- rots und d'Alemberts einen Versuch zur ,,Territorialisierungi' des Wis- sensraums, der deutliche Parallelen zum grol3en geographischen Pro- jekt der Vermessung Frankreichs aufweist, das zur selben Zeit im Auf- trag des Konigs von der italienisch-franzosischen Familie Cassini durchgefuhrt wurde. Davon ausgehend schlagt Mormann vor, sowohl die Enzyklopadie des 18. Jahrhunderts als auch die der Logischen Emipiristen als Versuche zu verstehen, eine geographische Beschrei- bung des Wissensraumes vorzulegen. In beiden Projekten lassen sich implizit und explizit enthaltene Strukturtheorien aufweisen, nach denen der Wissensraum jeweils konzipiert wird. Bei d'Alembert handelt es sich um einen .in sich stimmigen Komplex geometrischer Metaphern [...I, die sich zu einer elementaren geographischen Theorie der enzyklopa- dischen Ordnung entfalten lassen." Die Grande Encyclopedie kann unter diesem Gesichtspunkt als eine Art Atlas angesehen werden, der die Geographie des Wissens in einer neuen Weise kartiert. Dieser Atlas entwirft .eine neue revolutionare Geographie des Wissensraumes, die die uberkommenen Grenzziehungen und Nachbarschaftsbeziehungen des mundus intellectualis von Grund auf zu revidieren bestrebt war". Mormann sieht in der Parallelitat der Encyclopedie mit dem Cassini-

14 Elisabeth Nemeth
Projekt ein "charakteristisches Merkmal eines Baconischen Programms [...I, das die Eroberung des mundus visibilis und des mundus intellectu- alis miteinander verknupfte." Dieses Programm ist getragen von der fur die Aufklarung charakteristischen Sehnsucht nach einem Raum, aus dem alle dunklen Stellen getilgt sind und das nicht nur theoretische, sondern auch eminent praktische Ziele verfolgte: es sollte eine Orien- tierung in der unermesslich gronen Fulle der neuen und zukunftigen Erkenntnisse ermoglichen.
Unter dieser die beiden .geographischen1' Projekte zusammenfuh- renden Perspektive gewinnt die Enzyklopadie von Diderot und d'Alembert nicht nur an historischer Tiefenscharfe, sondern auch an theoretischem Interesse. Denn in der herkommlichen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie sind, so Mormann, die geometrischen Aspekte des Wissens - ebenso wie nichtpropositional formulierte Erkenntnisse im allgemeinen - gewaltig unterschatzt worden. Deshalb ist es .bemer- kenswert, dass sowohl die Grande Encyclopedic wie auch die osterrei- chische Enzyklopadie diese in der Philosophie lange Zeit ubliche Ver- nachlassigung nichtpropositionalen Wissens iiberwinden wollte, indem sie Graphiken und Diagrammen eine grofie Bedeutung beimafien."
Wenn wir die logisch-empiristische Enzyklopadie unter diesem Ge- sichtspunkt einer .Geographic des Wissensraumsu betrachten, zeigt sich, dass nicht nur Neurath versucht hat, die philosophischen Implika- tionen einer enzyklopadischen Ordnung der Wissenschaft auszuformu- lieren, sondern auch Carnap. Seine Konstitutionstheorie kann .als eine ,theoretische Geographie' wissenschaftlichen Wissens verstanden wer- den kann, der es um die Explizierung der moglichen geometrischen Strukturen eines Wissensraumes geht." Den Fortschritten der Geomet- rie seit dem 18. Jahrhundert ist es zu verdanken, dass es Carnap ge- lang, .uber dlAlemberts elementare Ansatze einer Geometrie des Wis- sens hinauszugehen und die Aufgabe der Philosophie als einer Theorie der Ordnung des wissenschaftlichen Wissens deutlicher zu explizie- ren." Genau hierin liegt aber ein philosophisches Potential, das, so Mormann, zur Erhellung der Struktur jener neuen Enzyklopadie genutzt werden sollte, die sich heute vor unseren Augen - im Internet - entwi- ckelt und zu deren Klarung und Entwicklung die traditionelle Epistemo- logie und Wissenschaftsphilosophie bisher wenig beigetragen hat.

Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung 15
2. Wien - Paris: der Logische Empirismus in Frankreich. Zur Geschichte eines gescheiterten Kommunikationsversuchs
Das Projekt der International Encyclopedia of Unified Science (IEUS) hat Neurath erst im Exil (ab 1935) vorangetrieben, aber es hat eine lange Vorgeschichte, die Hans-Joachim Dahms in seinem Beitrag re- konstruiert. Diese Geschichte beginnt mit der ldee einer Volksbucherei (fur die Neurath im Jahr 1921 Einstein gewann), geht uber den Entwurf eines .LeselexikonsU im Jahr 1928, bis hin zum Beschluss der IEUS wahrend des Kongresses fur Einheit der Wissenschaft 1935 in Paris. Die Idee, dieses Projekt mit der franzosischen Aufklarungstradition zu verbinden, stammt nach Dahms' Rekonstruktion von Einstein, der aber bei der Enzyklopadie selbst nicht mitgearbeitet hat. Neurath hat spater als Organisator des Projekts die alte Enzyklopadie immer wieder als Vorbild im Sinne der Aufklarung genannt, und er bezeichnete die Mitar- beiter des Projekts als .Neue Enzyklopadisten" - eine Bezeichnung, der freilich der Mitherausgeber Morris nicht vie1 abgewinnen konnte. Diese Skepsis hat, nach Dahms' Rekonstruktion, wohl auch damit zu tun, dass sich das Konzept in den Jahren von 1921 bis 1935 verscho- ben hat: weg von der Volksbildung hin zu einem wissenschaftlichen Publikum. Deshalb findet Dahms die Bedenken von Morris sehr nach- vollziehbar und stellt die Frage: .steht eine sich auf die Wissenschaft beschrankende und nur an Wissenschaftler sich wendende Enzyklopa- die nicht schon per se einem aufklarerischen Anspruch im Wege?"
Jedenfalls konnte Morris keine grol3e Nahe zwischen IEUS und Aufklarungstradition feststellen - fur Dahms ein Symptom dafur, dass Neuraths Bemuhen, ,,der Bewegung des logischen Empirismus ein gewisses historisches Bewusstsein und Traditionsverstandnis einzu- hauchen" letztlich gescheitert ist. Dass das IEUS Projekt als ganzes ein Torso geblieben ist, sieht Dahms nicht nur in historischen und politi- schen Umstanden begrundet, sondern auch darin, dass Neuraths ein- heitswissenschaftliches Programm geradezu utopische Dimensionen gehabt habe (siehe dazu auch Soulez in diesem Band).
Auch Antonia Soulez geht in ihrem Beitrag einer Geschichte des Scheiterns nach. Sie fragt sich, warum der Logische Empirismus in der philosophischen Landschaft Frankreichs keine Spuren hinterlassen hat, obwohl sich die Gruppe auf den Kongressen fur Einheit der Wissen- schaft 1935 und 1937 der philosophischen Offentlichkeit in Paris aus- fuhrlich vorgestellt hat.5 Soulez zeichnet zuerst die komplexe Diskussi- onssituation auf den beiden Kongressen nach und arbeitet die grol3en Unterschiede zwischen 1935 und 1937 heraus. Wahrend die Gruppe

16 Elisabeth Nemeth
der Wiener 1935 noch selbstbewusst und in gemeinsamer Front auftrat, war der kampferische Ton 1937 verschwunden. Das hat sicherlich da- mit zu tun, dass sich der Wiener Kreis 1937, wie Soulez sagt, schon .auf der Durchreise" ins Exil befindet, daruber hinaus aber wohl auch damit, dass bereits der Kongress von 1935 nicht den erhofften Erfolg gebracht hatte. Abgesehen von wenigen Ausnahmen ist die Philoso- phie des Logischen Empirismus in Frankreich nicht rezipiert worden. Soulez sieht dafur mehrere Ursachen: erstens die Aversion der franzo- sischen Philosophen gegenuber dem logischen Symbolismus a la Rus- sell und Frege; diese richtet sich, zweitens, erst recht gegen Carnaps .rationale Rekonstruktioni' wissenschaftlicher Gegenstande mit rein formalen Mitteln. Die dritte Ursache sieht Soulez in den Argumenten, die Jean Cavailles, einer der wenigen Philosophen, die sich mit dem Logischen Empirismus ernsthaft auseinandergesetzt haben, vorbrach- te. Er warf den Wienern vor, in eine Art ,,wissenschaftlicher Philologie" zu verfallen. Weder eine physikalistische Sprache noch ein syntakti- sches System seien imstande das philosophische Projekt zu realisie- ren, das die neue Philosophie zu realisieren angetreten war: namlich die Gegenstande der Wissenschaft neu zu begrunden. Die vierte Ursa- che durfte in Neuraths .StilU zu suchen sein. Das immense Projekt einer Enzyklopadie, die als terminologisches Ganzes begriffen wird, sowie deren programmatischer Charakter mussten in Frankreich auf Skepsis und Ablehnung stol3en. .Denn so sehr diese auch von der franzosi- schen Aufklarung durchdrungen war, mischte sich doch ein utopisch- sozialplanerischer Zug hinein, der eher typisch osterreichischen Ur- sprungs ist." Soulez nennt schliel3lich einen Franzosen, der, wenn er noch am Leben gewesen ware, als Gesprachspartner fur Neurath vie1 besser geeignet gewesen ware als Lalande und Rougier: der Humanist Louis Couturat. Auch er erhoffte sich eine ,,Versohnung der Geister mittels einer Universalsprache".
De facto aber spielte der Philosoph Louis Rougier eine eminent wichtige Rolle dafur, wie der Logische Empirismus in Paris wahrge- nommen und eingeschatzt wurde. Der intellektuellen Biographie Rou- giers geht Mathieu Marion in seinem Beitrag ein Stuck weit nach. Rou- gier organisierte gemeinsam rnit Neurath den Kongress in Paris 1935, stellte daher viele Kontakte ,,vor Ort" her und gab nachher die Kon- gressakten heraus. Neuraths Korrespondenz mit Philipp Frank, der die wissenschaftliche Situation in Paris recht gut kannte und den Neurath daher oft um Rat fragte, zeugt von einer Unzahl von Komplikationen, Missverstandnissen und Konflikten, die bei der Vorbereitung des Kon- gresses auftraten und die bis heute kaum erforscht sind. Jedenfalls

Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung 1 7
wurde Rougier auf Grund dieser Aktivitaten von seinen franzosischen Kollegen als gehorsamer Schuler des Kreises wahrgenommen. Nicht nur das philosophische Bild der .Wieneri' in Frankreich wurde dadurch beeinflusst, 1Jber Rougier, der mit der Vichy-Regierung kokettiert haben sol1 und schlienlich als Anhanger der Novelle Droite in Frankreich ende- te (siehe dazu Schottler in diesem Band), wurde der Logische Empiris- mus nach dern zweiten Weltkrieg auch politisch mit sehr negativen Konnotationen belastet. Die schwierige Frage, ob Rougiers schlechte politische Reputation zu Recht besteht oder nicht, klammert Marion in seinem Beitrag ausdrucklich aus. Statt dessen geht er einigen der intel- lektuellen Beziehungen nach, die zwischen den Logischen Empiristen und dern Mann bestanden, der als .Botschafter" des Wiener Kreises (Schottler) in Paris auftrat. Schon Philipp Frank hat darauf hingewiesen, dass Rougier keineswegs als Schiler der Logischen Empiristen gelten kann, sondern von einem unabhangigen Standpunkt aus zu ahnlichen wissenschaftsphilosophischen Auffassungen gekommen ist. Marion nimmt dies als Ausgangspunkt seiner Rekonstruktion. Er zeigt auf, dass Rougier die meisten und wichtigsten Bucher schon geschrieben hatte, bevor er (Anfang der 1930er Jahre) mit Schlick in Kontakt trat. Seine Schriften zeugen von einer eingehenden Kenntnis der Probleme der zeitgenossischen Wissenschaftsphilosophie. Sie zeugen auch da- von, dass Rougier nach einer konventionalistischen Alternative zwi- schen Empirismus und Rationalismus suchte und sich dabei an Augus- te Comte und anderen grol3en Vertretern der positivistischen Tradition Frankreichs orientierte. Es ist faszinierend, so Marion, wie nahe Rou- giers Auffassungen dern Logischen Empirismus bereits waren, bevor er an den Diskussionen mit dern Wiener Kreis teilnahm, in denen er ubri- gens eine strikt antiphysikalistische Position nahe der von Moritz Schlick vertrat.
Wir konnen darin vielleicht ein weiteres lndiz dafur sehen, dass das Aufeinandertreffen der beiden (durchaus ungleichen) positivistischen Traditionen - der Comte'schen und der logisch-empiristischen - in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts zu weitaus fruchtbareren Konstella- tionen hatte fuhren konnen als dies tatsachlich der Fall war. Dass es dazu nicht kam, lag sicherlich primar an den politischen Katastrophen der Zeit. Es konnte freilich unter anderem auch mit der Rolle und der Personlichkeit Louis Rougiers zu tun haben.
Philipp Frank jedenfalls hatte diesen Eindruck. Schon in der Vorbereitung fur den ersten Kongress 1935 wares ihm ein grones Anliegen, die Verbindung mit dern Centre de Synthese, Abel Rey und Henri Berr starker zu niitzen (Philipp Frank an Neurath, MaiIJuni 1935). Und zwei Monate vor dern zweiten Kon-

18 Elisabeth Nemeth
gress, in einem Brief vom 29.5.1937, schreibt er an Neurath: .Ich wiirde sehr raten, das ,centre de synthese' fur unseren Enzyklopadiekongress zu interes- sieren." Und er fiigt hinzu:
Dabei durfen Sie auf Rougier nicht rechnen, der immer sucht, uns in Paris zu isolieren und fur sich zu monopolisieren. ... Dieses ,,centreu hat ja in mancher Hinsicht ahnliche enzyklopadische Tendenzen. ... Schreiben Sie an Bouvier, der aber nicht sehr aktiv ist. Die eigentliche Seele des ,,centreu ist Henri Berr, ein Historiker und Soziologe, mit dem Sie sich leicht ver- standigen werden. ... Von Henri Berr habe ich gehort, dass er neuen ldeen sehr zuganglich ist, und nach einem Anschluss der Soziologie an die Wis- senschaft sehr sucht. Er ist ,,directeur de la revue de synthese" und auner- dem "directeuf einer "revue de synthese historiqueu.
Neurath lud Abel Rey und Henri Berr umgehend zu einem Treffen ein, zu dem es auch tatsichlich gekommen sein durfte (Neurath an Frank, 4. Juni 1937)~
Tatsachlich - und damit kommen wir zum Beitrag von Peter Schott- ler - war Rougier keineswegs der einzige ,,VerbindungsmannV der Logi- schen Empiristen in Paris. Mit dem Centre de Synthese bestanden kontinuierliche Kontakte. So erschienen in den Jahren zwischen 1934 und 1937 in der Revue de Synthese mehrere Artikel von Schlick, Hem- pel, Carnap, Frank und Neurath. Es ist freilich merkwurdig, welche Be- ziehungen in Paris im Keim stecken blieben, obwohl sie aunerordent- lich nahe liegend waren - in einem intellektuellen und einem "geogra- phischen" Sinn. Im Universitatsgebaude mit der Adresse 13, rue du Four, war nicht nur das lnstitut fur Wissenschaftsgeschichte der Sor- bonne unter der Leitung von Abel Rey untergebracht, sondern auch das Gronprojekt der Encyclopedie Fran~aise, das vom Historiker Lu- cien Febvre herausgegeben wurde.' Neurath lien das Projekt der Inter- national Encyclopedia of Unified Science 1935 in Paris gleichsam offi- ziell beschliefien und machte es zwei Jahre spater zum Hauptthema des zweiten Kongresses in Paris. Genau zur selben Zeit, am selben Ort wie Abel Reys lnstitut wurde an einem enzyklopadischen Werk gearbei- tet, das von einem ahnlichen Geist durchdrungen war wie das Neu- raths. Denn, wie Schottler vorfuhrt, handelte es sich bei der Encyclope- die Fran~aise um ein humanistisches und rationalistisches Projekt, das in der politischen Aufbruchsstimmung des Front Populaire in Gang kam - das also Neurath auch politisch nahe stand. Auch Febvre berief sich auf Diderot und dlAlembert, verwarf aber wie Neurath die alphabetische Ordnung zugunsten einer methodischen Orientierung. Sein Vorhaben, eine .Enzyklopadie der Forscher, Erfinder ..., man konnte sagen der Produkteure" zu schaffen, weist im Vergleich zur Neurath'schen Kon- zeption sicherlich auch Unterschiede auf, trifft sich aber in wichtigen

Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung 19
Punkten mit ihr: etwa in der Absicht, fiihrende Wissenschaftler als Bei- tragende zu gewinnen und so das wissenschaftliche Wissen auf der Hi5he der Zeit einem breiten Publikum zuganglich zu machen. Die bei- den Konzeptionen trafen sich auch darin, dass nicht ein traditionelles, geisteswissenschaftliches Weltbild vertreten wurde, sondern eines, das .die neuen Natur- und Sozialwissenschaften privilegierte". Vor allem aber ein Charakteristikum der Encyclopedic Franqaise, das Schottler als .die eigentliche Innovation und das grol3e Wagnis des Projekts" bezeichnet, musste Neurath sehr gefallen haben: namlich die Haltung der .gelehrten Ungewissheit, der savante incertitude". Weil sich mit den wissenschaftlichen Umwalzungen seit der Jahrhundertwende auch das Wissenschaftsverstandnis gewandelt habe, musse, so Febvre, eine moderne Enzyklopadie "verstehen, nicht alles zu wissen". Neuraths lebenslange Kritik an allen Formen von Letztbegrihdung und .Pseudo- rationalismus", die er auch in der Wissenschaftsphilosophie diagnosti- zierte, hat durchaus ahnliche lntentionen und sie spielt in seiner als .Enzyklopadismusu bezeichneten Konzeption eine zentrale Rolle.
Dass es zu der naheliegenden Kooperation zwischen Febvre und Neurath nicht kam, konnte auch an den Spannungen gelegen sein, die, wie Schottler aus- fuhrt, zwischen Henri Berr und Lucien Febvre von der Mitte der 1930er Jahre an existierten. Es ware nicht das einzige Mal gewesen, wo sich die Organisato- ren der Kongresse fur die Einheit der Wissenschaft im Pariser Netzwerk der intellektuellen und sozialen Beziehungen verfangen haben.
Philipp Frank, der, wie Gerald Holton rnir in einern Gesprach irn Oktober 2004 versicherte, sehr gut Franzosisch sprach, kam irnrner wieder die Aufgabe zu, vermittelnde Briefe zu schreiben und Gesprache zu suchen. Er hat diese Rolle mit lronie und Charme gespielt, aber im Juni 1937 ermahnte er Neurath durchaus ernsthaft: .Dann mochte ich Sie darauf aufmerksam rnachen, dass es sehr wichtig ist, Rougier mitzuteilen, wen von den Franzosen Sie eingeladen haben. Sonst konnen leicht wieder neue Skandale entstehen." Und am Rand des Kongresses von 1937 scheint Frank damit beschaftigt gewesen zu sein, noch rnanche Wogen zu glatten. Jedenfalls schreibt er im September 1937: "Lieber Neurath! Nach den vielen Schrecken rneiner diplomatischen Tatigkeit in Paris habe ich rnich auf einige Tage nach Marienbad z~r i ick~ezo~en."~
3. ,,Physikalistische Einheitswissenschaft" und Encyclopedia of Unified Science
Der Begriff der Einheitswissenschaft, der in der Programmschrift von 1929 die Zielvorstellung des Wiener Kreises kennzeichnet, ist oft miss- verstanden worden. Das liegt sicherlich auch daran, dass erstens die ldee der Einheitswissenschaft keineswegs vom ganzen Kreis unter-

20 Elisabeth Nemeth
stutzt wurde (bekanntlich hat sich Schlick uber diesen Begriff lustig gernacht) und dass zweitens diejenigen, die sie unterstutzten (die wich- tigsten waren Neurath, Carnap, Hahn und Frank), darunter nicht unbe- dingt dasselbe verstanden oder sich auch im Lauf der Zeit das, was sie darunter verstanden, verschob.
Melika Ouelbani geht in ihrern Beitrag dem Begriff der Einheit der Wissenschaft bei den beiden bekanntesten Proponenten des Projekts, narnlich Carnap und Neurath, nach. Sie hebt hervor, dass sich schon in Carnaps Konstitutionssystern von 1928 zeigt, dass es fur sein logisches System letztlich gleichgultig war, ob die Basis des Systems phanorne- nalistisch oder physikalistisch konzipiert ist. Er konnte sich daher relativ leicht von Neuraths pragrnatischen Argumenten uberzeugen lassen, seinen ursprunglich eher phanornenalistischen Ansatz aufgeben und sich Neuraths Projekt einer physikalistisch begrundeten Einheitswis- senschaft anschlieaen. Dies anderte freilich nichts daran, dass Carnap unter Einheit der Wissenschaft die logische Vereinheitlichung aller Wis- senschaften verstand. Deshalb zeigten sich alsbald Differenzen zwi- schen Carnap und Neurath: zunachst in ihrer Konzeption der Protokoll- satze, und dann in ihrer Vorstellung von der Einheitswissenschaft, die Carnap als System auffasst. Neurath dagegen weist die Vorstellung von der Wissenschaft als deduktives System zuruck und schagt vor, die Einheit der Wissenschaft bewusst enzyklopadisch zu denken. Fur ihn bleibt "alles rnehrdeutig und in vielern unbestimrnt", und aunerdern sind irnrner rnehrere Forrnen gleichzeitig rnoglich. Ouelbani hebt hervor, dass es nicht der Pluralisrnus ist, der Neurath von Carnap trennt: auch Carnap hat, wie gesagt, schon irn Logischen Aufbau der Welt zwei Moglichkeiten fur die Wahl der Basis der Begriffe vorgesehen. (Und deshalb kann, wie Mormann betont hat, Carnaps Konstitutionssystern als eine Theorie moglicher Ordnungen des Wissensraums gelesen werden.) Freilich ist weder der grundsatzlich provisorische Charakter des Wissens noch die .Unreinheitu der physikalistischen Sprache (bei- des Charakteristika des Enzyklopadismus, die Neurath sehr wichtig sind), kompatibel rnit Carnaps Vorstellung eines rein logischen Systems der Begriffe.
Als Carnap ab 1935 an der International Encyclopedia of Unified Science rnitarbeitete, so lautet Ouelbanis Diagnose, fijgte er sich einer enzyklopadischen Konzeption der Wissenschaft, die diejenige Neu- raths, aber nie seine eigene war. Kein Wunder, dass Carnap nach Neu- raths Tod das Enzyklopadieprojekt nicht rnehr weiter verfolgte.
Thomas E. Uebel rnacht eine Seite der Einheitswissenschaft zum Therna, die besonders haufig auf Unverstandnis und auch auf heftige

Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung 21
Kritik gestofien ist, den Physikalismus: Wie kann es in einer physika- listischen Einheitswissenschaft Raum fur ein tragfahiges Konzept von Sozialwissenschaft geben? Uebels These ist, dass Neuraths "enzyklo- padische" Konzeption der Einheit der Wissenschaft gerade zeigen will, dass und auf welche Weise die Sozialwissenschaften als ,,physikalisti- sche" Wissenschaft aufgefasst werden konnen. Dabei ist wichtig zu betonen, dass Neuraths Vorstellung der Einheit der Wissenschaft kei- neswegs darauf abzielte, soziologische Gesetzmafiigkeiten auf physi- kalische Gesetze zuruckzufuhren - ebenso wenig wie auf psychologi- sche. Er lehnte beides ausdrucklich ab und bezog funktionelle und strukturelle Analysen und Erklarungen wie sie bei Durkheim, aber auch schon bei Marx zu finden sind, in den Physikalismus ein. In seiner ,,mi- nimalistisch" gefassten Einheitswissenschaft ist, so Uebel, eine Vielfalt von Erklarungsprinzipien und Methoden zugelassen, und sie gesteht den unterschiedlichen Disziplinen ihre begriffliche Autonomie zu. In welchem Sinn ist die Sozialwissenschaft dann aber .physikalistisch"? Uebel zeigt, dass Neurath - im Gegensatz zu Carnap - von Anfang an nicht daran dachte, die wissenschaftliche Sprache insgesamt auf die Sprache der Physik zuruckzufuhren. Wenn Neurath forderte, dass alle wissenschaftlichen Behauptungen in physikalistischer Sprache formu- lierbar sein mussen, dann sah er darin eine Art von Testverfahren, das zeigen sollte, ob sich ein komplexes Gesamtes von theoretischen Sat- Zen letztlich eingliedern Iasst in das .NetzU von Aussagen, die raum- zeitliche Beziehungen zum Ausdruck bringen. So war Freuds Psycho- analyse in Neuraths Augen ein moglicher Teil der Einheitswissenschaft: es musste nur gelingen, z.B. Aussagen uber das .Unbewusste" als Aussagen uber Vorgange in Raum und Zeit zu formulieren und damit die gesamte Theorie empirisch zu kontrollieren. Dass Neurath diesbe- zuglich optimistisch war, zeigt sich darin, dass er eine Arbeitsgruppe leitete, die die Psychoanalyse in physikalistischer Sprache darstellen sollte. Dementsprechend darf Neuraths Rede von .Behavioristiku nicht mit dem traditionellen Behaviorismus verwechselt werden - eine Ver- wechslung, die Uebel in Felix Kaufmanns Kritik am Physikalismus auf- weist und die bis heute weit verbreitet ist. In Neuraths Verstandnis sind Aussagen iiber die eigenen Erlebnisse und Gefuhle Beobachtungsaus- sagen wie andere auch. Sie sind als Aussagen uber Ereignisse in Raum und Zeit aufzufassen und daher Teil der physikalistischen Wis- senschaft. Neurath 1941: ,,Satze des Typs: ,Diese Eingangshalle eines Gebaudes begeistert mich' konnen als physikaiistische aufgefasst wer- den, da sie Beobachtungssatze sind."

2 2 Elisabeth Nemeth
4. Aufklarungsdenken unter neuen Vorzeichen?
Als die Mitglieder des Wiener Kreises in den Jahren 1935 und 1937 zu den Kongressen nach Paris karnen, waren sie, urn es in den Worten von Antonia Soulez zu sagen, .auf der Durchreise". Sie waren auf dern Weg in die USA, ins Exil, wo sich der Logische Empirismus bekanntlich rasch durchsetzte - freilich war dies eine Version des Logischen Ernpi- risrnus, aus dem die sozialen und politischen Ziele des Aufklarungspro- jekts schnell verschwanden.
Dass dies nicht unbedingt hatte so kornrnen rnussen, geht aus George Reischs Beitrag hervor. Die aufklarerischen lntentionen des Enzyklopadieprojekts wurden von Charles Morris und John Dewey, dern prorninentesten US-arnerikanischen Philosophen der Zeit, unein- geschrankt unterstutzt. Auch Morris und Dewey, so betont Reisch, sa- hen in der Wissenschaft eine organisierte, kollektive Praxis zur Erfor- schung von Natur und Gesellschaft, die in ihren Augen das wichtigste Instrument fur den Aufbau einer hurnaneren, friedlichen und okono- rnisch gerechten Welt war.
Freilich stirnrnten Pragrnatisrnus und Logischer Ernpirisrnus zwar in den Zielen iberein, aber nicht irnrner darin, was sie uber die Wissen- schaft und ihren epistornologischen Gehalt dachten. Auaerdern war den Logischen Ernpiristen die intellektuelle Welt der USA weitgehend frernd. Die philosophischen Auseinandersetzungen urn den Status und die Rolle der Wissenschaft wurden in den USA unter anderen Voraus- setzungen gefuhrt als in Europa. Daruber konnten sich die Ernigranten aus Europa nicht irn Klaren sein.
Fur Neurath gilt dies allerdings nur mit Einschrankungen. Er ist in den 1930er Jahren mehrmals in die USA gereist, hat ein bemerkenswert dichtes Netz von Kontakten geknupft und sich ein recht genaues Bild von der philosophisch- ideologischen Lage verschafft. Ab 1936 schrieb er lange Briefe an Philipp Frank, um diesen auf eine kunftige US-Reise vorzubereiten. Aus dern Brief- wechsel geht hervor, wie erstaunt Philipp Frank uber das war, was ihm uber die intellektuelle Gepflogenheiten in den USA zugetragen worden war, z. B. .dass die Worte ,Idealismus' und ,Materialismus' nicht ausgesprochen werden durfen, wenn man ein Auslander ist. Das gilt angeblich fur taktlos und als eine Einmi- schung in amerikanische Verhaltnisse. Ich weiss allerdings nicht recht, ob Idea- lismus eine amerikanische ,Nationalpreligion istug Neurath beschrieb Frank seine Erfahrungen und Einschatzungen sehr ausfuhrlich. Er hatte einen sehr scharfen Blick fur die unausgesprochenen Regeln, durch die sich der akademi- sche Stil in den USA von dem in Europa unterschied. Und er machte sich Sor- gen, dass diese kulturellen Differenzen einen moglichen Erfolg Franks in den USA behindern konnten." Aus den Briefen wird auch deutlich, mit welchem Eifer Neurath sich uber die politischen Krafte kundig gemacht hat, die an einem

Ordnungen des Wissens und gesellschaftliche Aufklarung 23
Aufklarungsprojekt im Sinn der .wissenschaftlichen Weltauffassung" interessiert sein konnten. lmmer wieder fordert er Frank auf aus diesem Grund mit Nagel, Hook, Hull, und Dewey Kontakt aufiunehmen." (Neurath an Frank, 16. Juli 1937)
John Dewey hat fur die International Encyclopedia of Unified Science zwei Beitrage geschrieben. Und obwohl er in vielen Punkten eine ahnli- che Vision von der gesellschaftlichen Bedeutung eines an den moder- nen Wissenschaften orientierten Rationalismus hatte wie die Logischen Empiristen, haben seine Beitrage bei den Herausgebern der Encyclo- pedia - Carnap, Morris und Neurath - nicht nur Zustimmung gefunden. Reisch analysiert die Differenzen und Debatten, die daraus entstanden. Dabei wird sichtbar, dass Dewey zu der Zeit, als ihm die Mitarbeit an der Encyclopedia angetragen wurde und er sie schliefilich akzeptierte, alle Hande voll damit zu tun hatte, Angriffe von Seiten der Neotho- misten zuruckzuweisen. Diese Angriffe richteten sich gegen eine an der modernen Wissenschaft orientierte Philosophie im allgemeinen und gegen Dewey im besonderen.
Dewey war weder mit Carnaps logischem Reduktionismus noch mit Neuraths Physikalismus einverstanden, vor allem aber wies er die Auf- fassung zuruck, dass Werturteile nur subjektive Gefuhle ausdrucken. Ware diese Auffassung richtig, so Dewey, dann ware eine wissen- schaftliche Werttheorie unmoglich - und genau eine solche wollte De- wey entwickeln und gegen die von den Neothomisten Adler und Hut- chins wiederbelebte Metaphysik verteidigen. Dewey, Carnap und Neu- rath waren darum bemuht, Missverstandnisse in diesen Punkten auszu- raumen. Aber Deweys Sorge blieb bestehen, dass gerade die pro- grammatische Antimetaphysik der Logischen Empiristen sowie der Ausschluss von Werturteilen aus der Wissenschaft, denjenigen Kraften in die Hande spielen wurden, die der US-amerikanischen ~ffentlichkeit einzureden suchten, dass Werte nur in einem metaphysischen System und nicht mit rationalen Argumenten begrundet werden konnen. Es scheint, dass Dewey sich bis zu einem gewissen Grad davon uberzeu- gen liefi, dass Carnaps und Neuraths Version des Logischen Empiris- mus mit seinen Anliegen vereinbar war. Freilich ist das, was Dewey befurchtete, letztlich doch eingetreten. In den 1950er Jahren setzte sich sowohl in der Wissenschaftstheorie als auch in der ~ffentlichkeit ein Bild von Wissenschaft durch, in dem Fragen der Wissenschaft vollstan- dig getrennt von allen Fragen gesellschaftlicher Werte dargestellt wur- den. Die Dichotomie zwischen Tatsachen und Werten war wahrend des Kalten Krieges omniprasent und trug dazu bei, dass der Logische Em- pirismus schliefilich zu einem vollig unpolitischen Projekt wurde.

24 Elisabeth Nemeth
Philipp Frank, der 1939 in die USA emigrierte, war der einzige der Logischen Empiristen, der mitten im Kalten Krieg als offentlicher lntellektueller auftrat und nicht mude wurde zu erklaren, dass Wissenschaft keineswegs im "Fakten Sammelnu besteht. Er warb fur eine enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Philosophie und vertrat die Auffassung, dass nicht die Wissenschaft per se, sondern ein philosophisch reflektiertes wissenschaftliches Denken wesent- lich zur Starkung von demokratischen Werten und Haltungen beitragen kann. Philipp Franks Versuch zu zeigen, dass die moderne Wissenschaftsphilosophie Teil des unvollendeten Projekts der Aufklarung ist, war in den USA der 1950er Jahre freilich marginalisiert. Auch die Rekonstruktion dieses Kapitels der Ge- schichte eines Scheiterns hat gerade erst begonnen.12
Anmerkungen
Neurath (1938) in: Gesammelte philosophische und methodologische Schriften, hg. von Rudolf Haller und Heiner Rutte, Wien: Holder-Pichler-Tempsky 1981, S.879. ibid. S. 893. Rainer Hegselmann in: Joachim Schulte und Brian McGuinness (Hg): Einheitswis- senschaff, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1992, S. 11. Siehe dazu das reiche Material in: Fritz Ringer: Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 189&1933, aus dem Amerikanischen iibersetzt von K. Laer- mann, Stuttgart: Klett-Cotta 1983 (Original: The German Mandarins, Cambridge: Haward Press, 1969). Zum Zusammentreffen der beiden Traditionen auf diesen Kongressen siehe auch Charles Alunni: .Le Congres Descartes, 1937: I'arene philosophique europeenne", Actes de la Recherche en Sciences Sociales No. 141-142: Mars 2002, S.130-131. Neurath-Nachlass, Wiener Kreis Stichting, Amsterdam, Inv. Nr. 236. Zur Geschichte der Encyclopedie Fran~aise siehe die Einleitung zu dem eben er- schienenen Band: Maurice Halbwachs et Alfred Sauvy: Le Point de Vue du Nombre 1936. Edition critique, dir. par Marie Jaisson et Eric Brian, Paris: I.N.E.D. 2005. Alle Zitate dieses Abschnitts aus: Neurath-Nachlass, Wiener Kreis Stichting, Ams- terdam, Inv. Nr. 236, Kopie im lnstitut Wiener Kreis. Frank an Neurath, September 1937. Neurath-Nachlass, Wiener Kreis Stichting, Amsterdam, Inv. Nr. 236, Kopie im lnstitut Wiener Kreis. Z.B. in Neurath an Frank, I. Juni 1937 und 16. September 1937. Neurath-Nachlass, Wiener Kreis Stichting, Amsterdam, Inv. Nr. 236, Kopie im lnstitut Wiener Kreis. Z.B. in Neurath an Frank, 30. November 1937, Neurath-Nachlass, Wiener Kreis Stichting, Amsterdam, Inv. Nr. 236, Kopie im lnstitut Wiener Kreis. Siehe Gary L. Hardcastle, Alan W. Richardson (eds.) 2003: Logical Empiricism in North America, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. XVIII, Minnea- polis-London: Univ. of Minnesota Press, und George Reisch: How the Cold War Transformed Philosophy of Science, Cambridge University Press 2005.

FRIEDRICH STADLER
PARIS - WIEN: ENNKLOPADIEN IM VERGLEICH. ~JBER VERGESSENE WECHSELWIRKUNGEN
Nachdem die internationale Forschung ijber den Wiener Kreis im eng- lischsprachigen Raum seit dem bahnbrechenden Aufsatz von Herbert Feigls .The Wiener Kreis in America" (1969) mehrere neuere Publikati- onen zur transatlantischen Wirkungsgeschichte hervorgebracht hat,' ist es hochst an der Zeit, sich der vernachlassigten .French Connectionu in der Wissenschaftsphilosophie zu widmen.* Diese verspatete Forschung ist umso bemerkenswerter, als wir um die engen wechselseitigen Be- ziehungen zwischen den Wienern und Parisern seit dem Fin de Siecle wissen, die sich - aufbereitet durch Ernst Mach - im konkreten in der starken Rezeption von Henri Poincare und Pierre Duhem im sogenann- ten ,,ersten Wiener Kreis" manifestieren. Dementsprechend hat schon Philipp Frank in seinem Buch Modern Science and its Philosophy (1949) diese bilaterale Entwicklung im Aufklarungsdiskurs der moder- nen Wissenschaftstheorie beschrieben und die dreifache Wurzel des Logischen Empirismus in einer modernisierten Variante betont: und m a r mit Bezug auf den englischen Empirismus, den franzosischen Rationalismus und den amerikanischen (~eo-)pragmatismus3
Im konkreten ging es damals bereits um eine Synthese von Empi- rismus und symbolischer Logik, wobei die Mach'sche Wissenschafts- lehre durch den franzosischen Konventionalismus verbessert werden sollte, nicht zuletzt urn auch Lenins Kritik am ,,Empiriokritizismus" be- gegnen zu konnen. Dabei diente Abel Reys Buch La theorie physique chez les physiciens contemporains (1907) zur ijberwindung der me- chanistischen Physik als willkommenes Theorienangebot. Die Vermitt- lung zwischen empirischer Beschreibung und analytischer Axiomatik der Wissenschaftssprache sollte schliefilich durch Poincare geleistet ~ e r d e n : ~
Nach Mach sind die allgemeinen Prinzipien der Wissenschaft ab- gekurzte okonomische Beschreibungen von beobachteten Tatsa- chen; nach Poincare sind sie freie Schopfungen des menschlichen Geistes, die iiberhaupt nichts uber beobachtete Tatsachen aussa- gen. Der Versuch, die beiden Konzepte in einem koharenten Sys- tem zu integrieren, war der Ursprung dessen, was spater Logischer Empirismus genannt wurde.

26 Friedrich Stadler
Dieses Ziel wurde mit Hilfe von Hilberts Axiomatik der Geometric als eines konventionalistischen Systems Jmpliziter Definitionen" erreicht:
Auf diese Weise konnte die Philosophie Machs in den "neuen Posi- t iv ism~~' ' eines Henri Poincare, Abel Rey und Pierre Duhem einge- gliedert werden. Die Verbindung zwischen dem neuen Positivismus und der alten Lehre von Kant und Comte besteht in der Forderung, dal3 alle abstrakten Ausdrucke der Wissenschaft - wie etwa Kraft, Energie, Masse - als Sinnesbeobachtungen interpretiert werden mussen.=
Denn Pierre Duhem schrieb bereits 1907 in La theorie physique, son objet et sa structure (Deutsch: Ziel und Struktur der physikalischen Theorien, [Jbersetzung von Friedrich Adler, mit einem Vorwort von Ernst Mach, 1908) ahnlich wie Mach:
Eine physikalische Theorie ist keine Erklarung. Sie ist ein System mathematischer Lehrsatze, die aus einer kleinen Zahl von Prinzi- pien abgeleitet werden und den Zweck haben, eine zusammenge- horige Gruppe experimenteller Gesetze ebenso einfach, wie voll- standig genau darzustellen.
AnschlieBend folgt die fur die Enzyklopadie wesentliche Erkenntnis:
Das experimentum crucis ist in der Physik ~ n m o ~ l i c h . ~
Trotz der metaphysischen Neigungen von Duhem wurde seine Lehre zu einem Bezugs-Rahmen fur weitere Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaft und Religion und, allgemeiner, zwischen Wissenschaft und Ideologien.
In der weiteren wechselseitigen Entwicklung verglich Frank die Publikationen von Louis Rougier mit denen von Moritz Schlick:
Er ging von Poincare aus, versuchte, Einstein in den .neuen Positi- vismus" einzugliedern und schrieb die beste umfassende Kritik der Schulphiloso hie ... die .Paralogismen des Rationalismus" (Paris: Alcan 1920). P
Der Physiker Marcel Boll ubersetzte Schriften von Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Moritz Schlick und Philipp Frank ins Franzosische und der ursprungliche Einfluss von Duhem sollte sich nun umkehren:

Paris - Wien: Enzyklopadien im Vergleich 27
Der franzosische General Vouillernin (vgl. C.E. Vouillernin, La logi- que de la science et I'Ecole de Vienne (Paris: Hermann 1935) ernp- fahl unsere Gruppe, weil wir die Schreibweise ,,Scienceu durch das bescheidene .scienceu ersetzten. ... Die franzosischen Neotho- rnisten ... sahen irn Logischen Positivisrnus den Zerstorer der idea- listischen und rnaterialistischen Metaphysik, die fur sie die gefahr- lichsten Feinde des Thornisrnus waren. Urn diese internationale Zusarnmenarbeit zu organisieren, wurde 1934 in Prag eine Vorkon- ferenz veranstaltet, an der Charles Morris und L. Rougier teilnah- men. Der Grundstein zur jahrlichen Veranstaltung internationaler Kongresse fur "Einheit der Wissenschaft" war darnit gelegt.'
Mit der Hochblute des Wiener Kreises in der Zwischenkriegszeit wird diese europaische und transatlantische lnternationalisierung - bei des- sen gleichzeitiger Desintegration in Deutschland und ~sterreich seit 1930ff. - verstarkt ausgebaut und vor allem durch einen direkten Ruck- griff auf die franzosische Encyclopedie des 18. Jhdts, irn Zusarnrnen- hang mit der International Encyclopedia of Unified Science der Logi- schen Ernpiristen theoretisch und praktisch weiter verfolgt. Hier ist es vor allern Otto Neurath, der unerrnudlich auch auf die franzosischen geistigen Vorlaufer seiner Unity-of-Science-Bewegung verweist und dies bis zurn Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Form von zwei in- ternationalen Kongressen in Paris (1935 und 1937) wirksarn als spat- aufklarererische kollektive Projekte urnset~t.~ Das konnte nicht uberra- schen, wenn man urn die Hinweise auf Cornte, Poincare und Duhem als Vorlaufer der .wissenschaftlichen Weltauffassung" in der Pro- grarnrnschrift des Wiener Kreises (1929) wei&.1°
Der "Erste Kongress fur Einheit der Wissenschaft in Paris 193SU, der "Congres International de Philosophie Scientifique" vorn 16.-21. September an der Sorbonne, stellte den ersten Hohepunkt der neuen Wissenschaftsphilosophie des Wiener Kreises irn Exil dar. Bereits Ende 1933 hatte Neurath rnit Marcel Boll und Louis Rougier noch als Vertre- ter des 1934 in Wien aufgelosten "Vereins Ernst Mach" in Paris Vorge- sprache gefuhrt, die sich auf einer Vorkonferenz in Prag 1934 fortsetz- ten. Und das abschlieaende Resurnee Neuraths uber die Pariser Kon- ferenz liest sich als eine aul3erst optimistische Prognose fur die Zukunft der "Gelehrtenrepublik des logischen Ernpirisrnus" und der "philosophie scientifique":
Der erste der lnternationalen Kongresse fur Einheit der Wissen- schaft ... war ein Erfolg fur den logischen Ernpirisrnus vor einer brei-

28 Friedrich Stadler
teren ~ffentlichkeit. Der in Frankreich so populare Titel ,,Philosophie Scientifique" erweckte Interesse. Die Presse brachte fortlaufend Berichte uber den Kongrel3. Zeitungen und Zeitschriften beschaftig- ten sich in Skiuen und Interviews mit ihm. Das war umso bemer- kenswerter, als es, wie Rougier und Russell in ihren Einleitungs- worten hervorgehoben haben, eine Tagung war, deren Aufgabe Wissenschaft ohne Emotionen bildete. Etwa 170 Menschen aus mehr als zwanzig Landern waren erschienen und zeigten in hohem Mafie Bereitwilligkeit zu dauernder Kooperation. Rougier, Russell, Enriques, Frank, Reichenbach, Ajdukiewicz, Morris erzeugten durch ihre Ansprachen bei der Eroffnung des Kongresses in den Raumen des lnstituts fiir intellektuelle Zusammenarbeit das leben- dige Gefuhl, dal3 es eine Gelehrtenrepublik des logischen Empiris- mus gebe.ll
Unter den franzosischen Institutionen, die den Kongress mit veranstal- teten, finden sich das genannte .L1lnstitut International de Cooperation Intellectuelle", das ,,Comite dlOrganisation de IrEncyclopedie Franqai- se", die .Cite des Sciences", das ,,lnstitut dlHistoire des Sciences et des Techniques" sowie das ,,Centre lnternational de Synthese". Die Doku- mentation des Kongresses erschien in acht Heften in der Reihe "Actua- lites scientifiques et industrielles" im Pariser Verlag Hermann & Cie. (1 936) - rnit zahlreichen franzosischen Beitragen.
Bertrand Russell, der in seiner Eroffnungsansprache eine Wurdi- gung Freges in Deutsch gehalten hatte, erinnerte sich darin rijckbli- ckend an eine Manifestation des rational-emprischen Denkens in Leib- nizscher ~radit ion: '~ .The Congress of Scientific Philosophy in Paris in September 1935, was a remarkable occasion, and, for lovers of rationa- lity, a very encouraging one ..." Dem schloss sich Neurath an, wenn er meinte, dass
die Einzelwissenschaften durch direktes Aufzeigen konkreter Zu- sammenhange aneinandergefugt werden und nicht indirekt da- durch, dal3 alle auf ein gemeinsam verschwommenes Begriffssys- tem bezogen werden
sollten.13 Der Kongress sprach sich schliel3lich dafur aus, das Projekt der
Encyclopedia of Unified Science mitzutragen, welches vom Munda- neum lnstitut unter Neuraths Leitung in Den Haag organisiert werden sollte. Dem 37kopfigen Komitee gehorten u.a. die franzosischen Ge-

Paris - Wien: Enzyklopadien irn Vergleich 29
lehrten Marcel Boll, H. Bonnet, E. Cartan, Maurice Frechet, J. Hada- mard, P. Janet, Lalande, P. Langevin, C. Nicolle, Perrin, A. Rey und L. Rougier an.
Diese Veranstaltung - welche auch als Dokurnentation der antifa- schistischen lntellektuellen aufgefasst wurde, wie das lnteresse von Robert Musil, Walter Benjamin und Bert Brecht zeigte - bildete schliefi- lich die Basis fur eine verstarkte transkontinentale Entwicklung zur KO- operation der deutsch-, englisch- und franzosischsprachigen Forscher- Innengerneinschaft, die vorwiegend von Neurath aus dem hollandi- schen Exil vorangetrieben werden sollte.14
Die zweite Runde der enzyklopadischen Renaissance wurde Ende Juli 1937 ebenfalls in Paris als "Dritter lnternationaler Kongrefi fur Ein- heit der Wissenschaft" anberaumt, nachdem vom Organisationskomitee (Carnap, Frank, Joergensen, Morris, Neurath, Rougier) ein Verlagsver- trag mit der University of Chicago Press fur die ersten beiden Bande der "International Encyclopedia of Unified Scienceii (IEUS) erreicht werden konnte.
Daruber hinaus wurde im Rahmen des gleichzeitig stattfindenden .Neunten lnternationalen Philosophiekongresses" (Neuvieme Congres International de Philosophie - Congres Descartes) eine eigene Abtei- lung zur "Einheit der Wissenschaft" (L'Unite de la Science: la Methode et les methodes) organisiert.
Trotz theoretischer Differenzen iiber die Konzeption der "Neuen Enzyklopadie" zwischen Carnap und Neurath (speziell uber den Wahr- heits- und Wahrscheinlichkeitsbegriff) hat Neurath dort den modernen Empirismus als eine Art heuristisches Puzzle mit dem Ziel eines "Mosa- iks der Wissenschaften" folgendermaaen prasentiert:15
Man kann von der .Enzyklopadieu als Modell ausgehen, und nun zusehen, wie vie1 man an Verknupfung und logischer Konstruktion, Eliminierung von Widerspruchen und Unklarheiten erreichen kann. Die Zusammenschau des logischen Empirismus wird so zu einer Aufgabe des Tages.
Es ging also vorwiegend darum, ,,in Erganzung der vorhandenen gro- fien Enzyklopadien das logische Rahmenwerk der modernen Wissen- schaft"I6 aufzuzeigen, mit dem Aufbau einer Art Zwiebel um den Kern von 2 Banden mit 20 Einleitungsmonografien zu weiteren 260 Mono- grafien, von denen schliefilich vor allem kriegsbedingt insgesamt nur 19 Monografien erscheinen so~lten.'~

30 Friedrich Stadler
Die vollstandige Realisierung dieses Unternehmens hatte also 26 Bande rnit 260 Monographien in englischer und franzosischer Sprache ergeben, erganzt mit einem I Obandigen bildstatistischen ,visuellen Thesaurus" rnit Weltubersichten irn Geiste Diderots und dlAlemberts. Die Historisierung und Soziologisierung der Wissenschaftsphilosophie war zugleich als ,,Science in Context" zur Verhinderung eines stark formalisierten .SzientismusW gedacht.
Dieser .Enzyklopadismus" sollte also kein absolutes Fundament der Erkenntnis oder .Systemm der Wissenschaften (weder rnit Verifikati- on noch Falsifikation als methodische Instrumente) liefern, sondern sich eher auf die grobe Alltagserfahrung als Ausgangsbasis unter Unsicher- heit und Unbestimmtheit stutzen, namlich rnit der
Grundidee, dass man keine endgiltig feste Basis, kein System vor sich hat, dass man immer forschend sich bemijhen mu13 und die unerwartetsten [Jberraschungen bei spaterer Nachprufung vie1 ver- wendeter Grundanschaungen erleben kann, ist fur die Einstellung kennzeichnend, die man als ,,Enzyklopadismusu bezeichnen mag ... Von unseren Alltagsformulierungen werden wir als Em piris ten im- mer wieder ausgehen, rnit ihrer Hilfe werden wir als Empiristen im- mer wieder unsere Theorien und Hypothesen uberpriifen. Diese groben Satze rnit ihren vielen Unbestimmtheiten sind der Aus- gangspunkt und der Endpunkt all unserer ~issenschaft . '~
Nun erhebt sich die Frage, warum es nach dieser relativen Erfolgsge- schichte zum Bruch und Vergessen dieser fruchtbaren austro- franzosischen Zusammenarbeit kam. Dies kann hier nur angedeutet werden:
1. Der Zweite Weltkriegs zerstorte eine zentraleuropaische spataufkla- rerische Wissenschaftskultur, speziell im .Roten wien".lg 2. Die Ideologisierung im Sog des zweiten Positivismus-Streites (Horkheimer vs. Neurath) und Personalisierung des Projektes durch den in Frankreich umstrittenen Louis Rougier nach 1945 erschwerte eine Wiederaufnahme in der ~orscher~emeinschaft.~~ 3. Emigration, Exil und Wissenschaftstransfer in die angloamerikani- sche Gelehrtenwelt und Verhinderung der (geistigen) Riickkehr, ver- starkt durch den dritten Positivismus-Streit im Kontext des Kalten Krie- ges und der dominierenden Dialektik der Aufklarung (HorkheimerlAdorno) verstarkte diesen Bruch nach 1938.

Paris - Wien: Enzyklopadien im Vergleich 3 1
4. Die Praferenz fur die "Deutsche Philosophie" des Idealismus und Existenzialismus der Nachkriegszeit mit dem Klischee des .Positivis- mus" und eine verspatete Forschung zur verschutteten Tradition der Wissenschaftsphilosophie seit der Jahrhundertwende in Frankreich selbst trugen zurn Bruch einer florierenden bilateralen Kommunikation bei. 5. Die intellektuelle Westintegration der 2. Republik Osterreich rnit einer Fokussierung auf die anglo-amerikanische geistige Welt margina- lisierte die "French Connection" zusatzlich nach dem Zweiten Weltkrieg.
Der vorliegende Band wird dazu beitragen, die entsprechenden For- schungslucken etwas zu verkleinern und die gemeinsame geistige Ver- gangenheit mit lnnovationen fur die heutigen Forschungslandschaft zu ersch~iefien.~'
Vielleicht wird durch die neue Historiographie die komplexe bilate- rale Beziehung zwischen dsterreich und Frankreich seit dem 2. Welt- krieg, mit der emotionsgeladenen ~ a l d h e i m - ~ r a und vor allem nach der politischen Wende des Jahres 2000 zumindest in der Gelehrtenwelt zugleich ent ideol~~is ier t .~~
Anmerkungen
Vgl. die neuesten Publikationen: Ronald N . Giere I Alan W . Richardson (eds.), Ori- gins of Logical Empiricism. Minneapolis-London: University of Minnesota Press 1996; Gary Hardcastle I Alan W. Richardson (eds.), Logical Empiricism in North America. Minneapolis-London: University of Minnesota Press 2004. Anastasios Brenner, .The French Connection: Conventionalism and the Vienna Circle", in: Michael Heidelberger 1 Friedrich Stadler (eds.), History of Philosophy of Science. New Trends and Perspectives. Dordrecht-Boston-London: Kluwer 2002, pp.277-286. Philipp Frank, Modern Science and its Philosophy. Cambridge: Haward Univers,ity Press 1949. Deutsch in: Kurt Rudolf Fischer (Hrsg.), Das goldene Zeitalter der Os- terreichischen Philosophie. Ein Lesebuch. WUV-Universitatsverlag 1995. S. 245- 296. Frank, ,,Der historische Hintergrund", in: ebda., S. 256. Ebda., S. 258f. Ebda., S. 259. Ebda., S. 291. Ebda., 291f. Stadler, The Vienna Circle. Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism. Wien-New York: Springer 2001, pp. 363ff., and 377ff.
, ~i&enschaftliche Weltauffassung. ~ e r wiener Kreis. Hrsg. vom Verein Ernst Mach. Wien: Artur Wolf Verlag 1929. Reprint in: Fischer (Hrsg.), a.a.O., S. 125-171.

32 Friedrich Stadler
11. Erkenntnis 5, 1935, S. 377. 12. Bertrand Russell, in: Actes du Congres lnternational de Philosophie Scientifique.
Sorbonne, Paris 1935. Paris: Hennann & Cie. 1936. p. 10. 13. Erkenntnis 5, 1935, p. 381. 14. Vgl. auch Antonia Soulez, "The Vienna Circle in France", in: Friedrich Stadler (ed.),
Scientific Philosophy: Origins and Developments. Dordrecht-Boston-London: Klu- wer 1993, pp. 95-1 12.
15. Otto Neurath, .Die neue Enzyklopadie" (1938), in: Joachim Schulte und Brian McGuinness (Hrsg.), Einheitswissenschaff FrankfurtlM.: Suhrkamp 1992, S. 208.
16. Ebda. 17. Otto Neurath / Rudolf Carnap / Charles Morris (eds.), Foundations of the Unity of
Science. Toward an lnternational Encyclopedia of Unified Science. 2 vols. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1971.
18. Neurath a.a.O., S. 213. 19. Wien und der Wiener Kreis. Orte einer unvollendeten Moderne. Ein Begleitbuch.
Hrsg. von Volker Thunn-Nemeth und Elisabeth Nemeth. Wien: WUV-Verlag 2003. 20. Vgl. dazu Hans-Joachim Dahms, Positivismusstreit. FrankfurtlM.: Suhrkamp 1994. 21. Zwei Beispiele: Das Moritz Schlick Editionsprojekt am lnstitut Wiener Kreis:
http://www.univie.ac.at/Schlick-Projekc sowie die von Felix Kreissler und Gerald Stieg 2002 initiierte Griindung der ,,Osterreichisch-franzosischen Gesellschaft fiir kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit / Societe franco-autrichienne pour la cooperation culturelle et scientifique". Diese Aktivitaten stehen in der Tradition der in der Forschung marginalisierten osterreichischen (Spat-)Aufklarung. Vgl. dazu: Kurt Blaukopf, .Kunstforschung als exakte Wissenschaft. Von Diderot zur Enzyklo- padie des Wiener Kreisesu, in: Friedrich Stadler (Hrsg.), Elemente moderner Wis- senschaffstheorie. Zur lnteraktion von Philosophie, Geschichte und Theorie der Wis- senschaffen. Wien-New York: Springer 2000, S. 177-21 1.
22. Vgl, die entsprechenden Beitrage in: Oliver., Rathkolb (Hrsg.), Aufienansichten. Europaische (Be)Wertungen zur Geschichte Osterreichs im 20. Jahrhundert. Inns- bruck: StudienVerlag 2003.

THOMAS MORMANN
GEOGRAPHIE DES WISSENS UND DER WISSENSCHAFTEN: VON DER ENCYCLOPEDIE ZUR KONSTITUTIONSTHEORIE
.... In jenem Reiche erlangte die Kunst der Kartographie eine derar- tige Vollkomrnenheit, daR die Karte einer einzigen Provinz den Raum einer ganzen Stadt einnahm und die Karte des Reichs den ei- ner Provinz. Mit der Zeit befriedigten diese ubermaRig groken Kar- ten nicht Ianger, und die Kollegs der Kartographen erstellten eine Karte des Reichs, die genau die GroRe des Reiches hatte und sich rnit ihrn in jedem Punkt deckte. Die nachfolgenden Geschlechter, die dern Studium der Kartographie nicht mehr so ergeben waren, waren der Ansicht, daR diese ausgedehnte Karte uberflussig sei und iiber- lienen sie, nicht ohne VerstoR gegen die Pietat, den Unbilden der Sonne und der Winter. In den Wusten des Westens haben sich bis heute zerstuckelte Ruinen der Karte erhalten, von Tieren behaust und von Bettlern; im ganzen Land gibt es sonst keinen ~berrest der geographischen Lehrwissenschaften."
J.L. Borges, Von der Strenge der Wissenschaft, (1954)
1. Das Problem der Fiille des wissenschaftlichen Wissens
Nach Wissen zu streben liegt Aristoteles zufolge in der Natur des Men- schen (Met. A, 980a). Dies gilt insbesondere fur das wissenschaftliche Wissen. Dieses naturliche Streben ist keineswegs immer unproblema- tisch: Es kann geschehen, dass wir nach Wissen streben, das verboten ist (vgl. Gen. 3,1), das aus anderen Grunden zu wissen gefahrlich kt, oder das zu wissen der Muhe nicht lohnt. Von diesen ,,gro13en1' Proble- men, die mit dem Streben nach Wissen verbunden sind, sol1 hier nicht die Rede sein. Schon auf einer banaleren Ebene erzeugt das Streben nach Wissen Probleme: Wenn alle von Natur aus nach Wissen streben, manchmal Erfolg damit haben, und ein grol3er Teil dieses Wissens nicht wieder vergessen wird, dann fuhrt das im Laufe der Zeit zu einer Wissensanhaufung, die nur noch schwer zu bewaltigen ist.' Das gilt insbesondere fur das wissenschaftliche Wissen. Die Fulle dieses Wis- sens ist uns schon Iangst uber den Kopf gewachsen. Dies gilt nicht nur fur die Details, sondern auch fur die Prinzipien. Selbst wenn sich der Einzelne gut aristotelisch auf die Prinzipien des Wissens beschrankte, ist es ihm seit langem unmoglich, ,,alles zu wissenm.* Fur die Gesell- schaft wird damit das Problem der Ordnung oder Organisation des

34 Thomas Mormann
Wissens akut. Seit der fruhen Neuzeit gab es zahlreiche, mehr oder minder naive Versuche, das wachsende Wissen in irgendeiner Weise zu ordnen, urn es fur die Gesellschaft nutzlich zu halten (vgl. Yeo 2002, 2003). Einer der einflussreichsten Ansatze war der Francis Bacons, den er in The Advancement of Learning (1 605) und spater ausfuhrlicher in De dignitate et augmentis scientiarum (1623) entwicke~te.~ Seine Konzeption konnte man als Geographie des Wissens und der Wissen- schaften bezeichnen. Zwar hat Bacon sie nicht erfunden, aber in be- sonders pragnanter Weise und in einem ausgezeichneten historischen Moment so formuliert, dass seiner Version eine nachhaltige Wirkung im 17. und 18. Jahrhundert beschieden war.
Bacon war uberzeugt, am Anfang eines neuen, durch die Wissen- schaft bestimmten Zeitalters zu stehen. Er konzipierte den Fortschritt des Wissens und der Wissenschaften als die Eroberung neuer Gebiete eines mundus intellectualis - in Analogie zur beginnenden kolonialen Eroberung der sichtbaren Welt, des mundus visibilis. Beide Unter- nehmungen waren fur ihn zwei Aspekte derselben ache.^ Fur beide bedurfte es detaillierter und zuverlassiger geographischer Kenntnisse der zu erobernden neuen Regionen. Am Ende von De augmentis ruhm- te er sich, .sozusagen einen kleinen Globus des mundus intellectualis hergestellt zu haben so getreu wie nur irgend moglich, auf dem dieje- nigen Teile bezeichnet und beschrieben werden, die ich entweder als nicht dauerhaft besiedelt oder durch die Arbeit des Menschen nicht gut bebaut vorgefunden habe." (Bacon 1961-1963, vol. 3, p. 328). Als Grundlage fiir dieses ehrgeizige Projekt einer Kartierung des mundus intellectualis diente Bacon eine Klassifikation des Wissens und der Wissenschaften, die sich wesentlich von den Vorstellungen des Mittel- alters und der Renaissance unterschied.
Bacons Projekt der Erforschung der Geographie des mundus intel- lectualis zielte nicht auf einen festen Kanon des Wissens, es war auf Expansion und Eroberung gerichtet und wies manche ~hnlichkeit auf mit den "wirklich geographischen" Projekten des 17. und 18. Jahrhun- derts, die im Kontext der kolonialen Eroberung der Welt durch die eu- ropaischen Machte zum ersten Mal in der Geschichte zu einigermanen zuverlassigen Weltkarten fuhrten. Bacons Projekt hatte auf viele der enzyklopadischen Projekte des 17. und 18. Jahrhunderts einen im- mensen Einflun, insbesondere auf Chambers ~ ~ c l o ~ e d i a ~ (1 728) und die von Diderot und d'Alembert herausgegebene Grande Encyclopedie (1 751 -1 772).
Ich mochte in dieser Arbeit die enzyklopadischen Projekte der fran- zosischen und der osterreichischen Aufklarer aus der Baconischen Per-

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 3 5
spektive einer .intellektuellen Geographie" betrachten, also als Versu- che, die Welt des Wissens - den mundus intellectualis - zu karto- graphieren. Diese Kartierung sollte denjenigen, die sich in ihrn be- wegten, helfen sich in ihrn zu orientieren. Darnit wurde der mundus in- tellectualis irn Prinzip fur alle zuganglich, wahrend zuvor eine Reise in die terra incognita ein Risiko darstellte, dern sich nur wenige wagernu- tige Forschungsreisende aussetzten.
Bei der Erorterung des osterreichischen Enzyklopadieprojektes mochte ich rnich auf Carnaps Konstitutionstheorie konzentrieren. Das entspricht nicht ganz dem ublichen Vorgehen, da bei Themen, die den Enzyklopadisrnus betreffen, ublicherweise Neurath eine Quasi- Monopolstellung eingeraurnt ~ i r d . ~ Ein Grund fur mein abweichendes Vorgehen ist, dass Carnaps Konstitutionstheorie in gewisser Hinsicht der Theorie der franzosischen Enzyklopadie naher steht als Neuraths Enzyklopadismus, ein anderer besteht darin, dass Carnaps Ansatz rneiner Meinung nach zukunftsweisender ist der Neuraths.
Bacons .intellektuelle Geographie" sollte nicht vorschnell als ,,blot3 rnetaphorisch" abgetan werden. Die geographische Forrnulierung war fur Bacon und viele Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts mehr als eine ausschrnuckende ~eschreibun~.' Ohne geographische oder allge- rneiner raumliche Metaphern dijrfte es schwierig, wenn nicht gar un- moglich sein, die allgerneine Expansion der dem Menschen zugang- lichen Welten irn 17, und 18. Jahrhundert auszudrucken.
Irn Rahrnen einer solchen Geographie sollen keineswegs so .gro- Be" Fragen behandelt werden, ob etwa die ,,Ordnung des Wissens" irn 17. Jahrhundert eine andere gewesen sei als irn 18. oder 20. Jahr- hundert. Es geht einfach darum zu zeigen, dass, welche Veranderun- gen der Wissensordnungen auch irnmer stattgefunden haben, diese in einer geographischen oder geornetrischen Sprache beschrieben und besser verstanden werden konnen.
Die Verwendung einer solchen Sprache ist nicht so weit hergeholt, wie es zunachst scheinen mag: Bereits wenn man von der Problernatik der .Ausdehnungu oder des .UrnfangsU des Wissens spricht, verwendet man Beschreibungsrnittel, die irnplizit auf einer Geometrie oder Geo- graphie des Gegenstandsbereichs beruhen, und es ist schwer zu se- hen, wie man das verrneiden konnte. Es mag sein, dass diese Georne- trie nicht die Geornetrie des physikalischen Raumes ist, aber darnit hat die rnoderne Auffassung von Geornetrie keine Probleme. Im modernen Verstandnis ist Geornetrie eine allgerneine Theorie von ,,Ordnungssetz- ungenu, die historisch zwar in der Theorie der euklidisch konzipierten Struktur des physikalischen Raurnes wurzelt, die aber uber diese Ur-

3 6 Thomas Mormann
spriinge spatestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hinausge- wachsen ist. Aus der Sicht einer modernen Geometrieauffassung er- scheint also eine Geometrie des Wissens und der Wissenschaften we- niger extravagant und metaphorisch als es aus Sicht einer eher traditi- onellen Auffassung von Geometrie der Fall ist.
Ausgangspunkt einer geometrischen Interpretation von Enzyklo- padien ist die einfache Beobachtung, dass Enzyklopadien sowohl im Verstandnis der franzosischen wie der osterreichischen Enzyklopa- disten mehr waren als alphabetisch geordnete Sammlungen des Wis- sens. Das ist nicht selbstverstandlich, weil viele .EnzyklopadienU trotz ihres Namens eben nicht mehr sind als alphabetisch geordnete Wor- terbucher, was sie wissenschaftsphilosophisch uninteressant macht. Im Unterschied dazu lagen sowohl der franzosischen wie der osterreich- ischen Enzyklopadie geometrische oder geographische Struk- turtheorien zugrunde, die darauf zielten, das vorhandene Wissen in geeigneter Weise zu klassifizieren, so dass es moglichst ubersichtlich und moglichst allen zuganglich prasentiert werden konnte. Beide Pro- jekte konnen als Versuche verstanden werden, eine geographische Beschreibung des Wissensraumes vorzulegen. Diese war nicht als eine blol3 theoretische Beschreibung gemeint. Wie man bereits bei Bacon sehen kann, hatte die Verwendung geographischer Metaphern eine eminent praktische Bedeutung.
Eine Strukturtheorie des Wissensraumes ist deshalb immer ein entscheidender Teil jeden Enzyklopadieprojektes, selbst in dem Ex- tremfall, wo vorgeblich auf jede andere Ordnung zugunsten der alpha- betischen verzichtet wird. Die rein alphabetische Ordnung ist als eine Schwundstufe zu betrachten, und bis heute sind zahlreiche Versuche unternommen worden, daruber hinauszuk~mrnen.~ Man kann unter- scheiden zwischen streng systematischen Gliederungen, die die ver- schiedenen Zweige des Wissens strikt hierarchisch gliedern, zum ande- ren gibt es Gliederungen, die das nichtdeduktive ,,Nebeneinandern ver- schiedener Wissensgebiete b e t ~ n e n . ~
Auch wenn also die Rede vom Raum des Wissens, seiner Geo- graphie oder Geometrie nicht als ein ausgearbeitetes Modell ver- standen werden kann, ware es ein Fehler, sie als blol3 metaphorisch und damit nicht mehr als ein rhetorisches Mittel zu interpretieren. Sie ist als eine Perspektive zu verstehen, aus der sich kognitive Strategien entwickeln, die in mehr oder minder elaborierten raumlichen Modellen entfaltet werden konnen.
Diese Perspektive befasst sich nicht, oder zumindest nicht direkt, mit den lnhalten einer gegebenen Enzyklopadie, sondern mit ihrer

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 3 7
Struktur. Das hat Vor- und Nachteile: Von Natur aus sind Enzyklopa- dien unubersichtlich. Geht es etwa um einen Vergleich der franzo- sischen und der osterreichischen Enzyklopadie, rnacht der grol3e zeitli- che und sachliche Abstand der Wissens des 18. und des 20. Jahr- hunderts einen inhaltlichen Vergleich nicht leicht. Naturlich kann man schnell ,,ideologische" Beziehungen zwischen beiden Unternehrnungen herstellen, indern man einen gerneinsarnen philosophischen Nenner zwischen der Pariser und der Wiener Enzyklopadie konstruiert und man beide als aufklarerische oder spataufklarerische Projekte charakteri- siert, die mit rnehr oder rninder grol3ern Erfolg realisiert wurden und die die und die Wirkungen in der philosophischen, wissenschaftlichen und politischen Landschaft hatten. Ich rnochte in dieser Arbeit dazu direkt nichts sagen, rnich also nicht in erster Linie rnit den lnhalten der jeweili- gen Enzyklopadien oder der ihnen zugrunde liegenden .IdeenU und .In- tentionen" befassen. Es geht im Folgenden vielrnehr urn Fragen der Struktur von Enzyklopadien, genauer gesagt, urn Strukturtheorien, die die franzosischen und die Wiener Enzyklopadisten irnplizit oder explizit vertraten.
Was die geornetrische Struktur der franzosischen Encyclopedic angeht, rnochte ich rnich auf d'Alernberts Discours Preliminaire de /'En- cylopedie (1 755) konzentrieren. Da Diderots und d'Alernberts Aus- fuhrungen zur Enzyklopadieproblernatik nicht allzu sehr von einander abweichen und d'Alernberts Discours die ausfuhrlichste Darstellung ist, sollte diese Vorgehensweise plausibel erscheinen. Auf osterreichischer Seite ist die Sache kornplizierter: ~blicherweise wird Neurath nicht nur als der spiritus rector des enzyklopadischen Unternehrnens angesehen, sondern auch als der einzige, der zurnindest Bruchstucke einer En- zyklopadietheorie vorgelegt hat. Ich mochte im folgenden zeigen, dass diese Darstellung unvollstandig ist. Auch bei Carnap finden sich Ansat- ze einer enzyklopadistischen Theorie des wissenschaftlichen Wissens. Diese sind irn Rahrnen des Neurathschen Enzyklopadieprojektes nie- rnals realisiert worden sind. [Jberdies sind sie als solche selten erkannt worden, da sie unter dern Rubrurn .Konstitutionstheorie" figurieren, was ihre Beziehung zu einer enzyklopadistischen Theorie des wissen- schaftlichen Wissens nicht unrnittelbar deutlich werden Iasst.
Aus der Perspektive einer Geographie des wissenschaftlichen Wis- sens Iasst sich zeigen, dass weitreichende sachliche ber rein- stirnrnungen zwischen dlAlernberts geornetrischer Theorie des Wissens und Carnaps Konzeption existieren. Allerdings gibt es auch Unter- schiede: am Beispiel von d9Alernbert und Carnap Iasst sich auch ein gewisser Fortschritt irn enzyklopadistischen Denken konstatieren, der

3 8 Thomas Mormann
sich dem Fortschritt verdankt, den die Geometrie seit dern 18. Jahr- hundert gemacht hatte: Carnaps reflektierteres Verstandnis von Geo- rnetrie erlaubte es ihm, uber d'Alernberts elementare Ansatze einer Geometrie des Wissens hinauszugehen und die Aufgabe der Philo- sophie als einer Theorie der Ordnung des wissenschaftlichen Wissens deutlicher zu explizieren.
Die Arbeit ist folgendermal3en gegliedert: im nachsten Abschnitt - Die Geographie des Wissens in der Encylopedie - sollen die Grund- zuge der geographischen Konzeption (im Sinne Bacons) expliziert wer- den, die der franzosischen Enzyklopadie zugrunde lagen. Danach, irn dritten Abschnitt - Territorialisierung - wird das enzyklopadische Unter- nehmen der Ausarbeitung einer Geographie des mundus intellectualis in Beziehung gesetzt zu anderen Unternehmungen im Zeitalter der Aufklarung, die bemuht waren, einen gestaltlosen und unwegsarnen Raum in ein kontrollierbares und uberschaubares Territorium zu ver- wandeln. Im vierten Abschnitt - Geographie und Konstitution des rnun- dus intellectualis - sollen die enzyklopadistischen Aspekte von Carnaps Konstitutionstheorie herausgearbeitet werden. Es geht also darum, die Konstitutionstheorie als eine Geometrie oder Architektonik des Wis- sensraumes und darnit als Rahmentheorie einer Einheitswissenschaft zu verstehen. Im fijnften Abschnitt - Geometrie und Pluralismus - wird Carnaps pluralistische Konzeption von Philosophie als Theorie mogli- cher Sprachrahrnen als eine verallgemeinerte Strukturtheorie von Enzy- klopadien interpretiert. Aunerdem wird gezeigt, dass auch Neuraths Enzyklopadismus mit dem hier skiuierten .geographischenU Ansatz vertraglich ist. Irn letzten Abschnitt schliel3lich geht es darurn, die klas- sischen Projekte der Grande Encylopedie und der Enzyklopadie der Einheitswissenschaft in Beziehung zu setzen rnit zeitgenossischen enzyklopadieformigen ~issensreprasentationen.'~
2. Die Geographie des Wissens in der Encyclopedie
Wahrend die meisten Enzyklopadien vor und nach der "Grande Encyc- lopedie" das Problem der Ordnung des Wissens eher beilaufig behan- deln, nehmen Diderot und d3Alernbert dieses Problem ernst: Diderot geht in einem eigenen Artikel (,,EnzyklopadieU) darauf ein, und noch ausfuhrlicher wird es von d'Alembert in der selbstandigen Schrift Dis- cours Preliminaire de I'Encyclopedie (dlAlembert 1751) behandelt. Ich werde im Folgenden nur auf d9Alemberts Discours preliminaire Bezug nehmen.

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 3 9
Es sol1 gezeigt werden, dass dlAlemberts "geometrische Theorie" aus einem in sich stimmigen Komplex geometrischer Metaphern be- steht, die sich zu einer elementaren geographischen Theorie der enzy- klopadischen Ordnung entfalten lassen. Die Grundzuge seines Ansat- zes finden sich bereits bei Bacon. Die zentralen Kornponenten von d'Alemberts Geographie des mundus intellectualis, wie er in der Encyc- lopedie dargestellt werden SOH, ergeben sich aus der Antwort auf die Fundamentalfrage jeder Enzyklopadie: Was ist der Zweck einer enzy- klopadischen Zusammenstellung der verschiedenen Zweige des Wis- sens? D'Alembert beantwortet diese Frage folgendermaaen:
Der Zweck der enzyklopadischen Zusarnmenstellung unseres Wis- sens besteht in einer Aufstellung in moglichst begrenztem Raum, und der Philosoph sol1 gewissermaaen uber diesem Labyrinth ste- hen und von einem uberlegenen Standpunkt aus gleichzeitig die hauptsachlichen Kunste und Wissenschaften erfassen konnen. Er sol1 die Gegenstande seiner theoretischen Erwagungen und die mogliche Arbeit an diesen Gegenstanden rnit einem schnellen Blick ubersehen; er sol1 die allgemeinen Zweige des menschlichen Wis- sens mit ihren charakteristischen Unterschieden oder ihren Ge- meinsamkeiten herausstellen und gelegentlich sogar die unsichtba- ren Wege aufzeigen, die von dem einen zu dem anderen fuhren. Man konnte an eine Art Weltkarte denken, auf der die wichtigsten Lander, ihre Lage und ihre Abhangigkeit voneinander sowie die Verbindung zwischen ihnen in Luftlinie verzeichnet sind; diese Ver- bindung wird immer wieder durch unzahlige Hindernisse unterbro- chen, die nur den Bewohnern oder Reisenden des in Frage kom- menden Landes bekannt sind und nur auf bestimmten Spezialkar- ten verzeichnet werden konnen. Solche Spezialkarten stellen nun die verschiedenen Artikel der Enzyklopadie dar, und der Stamm- baurn oder die Gesamtubersicht ware dann die Weltkarte. (Dis- cours, p. 85/87).
Kurz, der .Philosophu, d.h. der aufgeklarte Burger, sol1 sich mithilfe der Encyclopedie in der Geographie des mundus intellectualis orientieren konnen, auch wenn er nicht in allen seinen Gebieten heimisch sein konnte. Die Landkartenrnetapher macht klar, dass eine Enzyklopadie ein Model1 des wissenschaftlichen Wissens war, nicht das wissen- schaftliche Wissen selbst, und schon gar nicht eine getreue Re- prasentation einer an-sich-seienden Realitat. D'Alembert war sich uber die Differenz zwischen Karte und kartiertem Gebiet vollig irn Klaren. Er

40 Thomas Mormann
insistierte darauf, es sei wenig sinnvoll, fur den Raum des Wissens nur eine einzige .korrekteU enzyklopadische Darstellung anzunehmen. Irn Gegenteil, dem Leitfaden eines geographischen Pluralismus folgend, erklarte er:
~hn l ich wie auf den allgemeinen Karten unserer Weltkugel die Ge- genstande entsprechend zusamrnengeruckt erscheinen und je nach dem Gesichtswinkel, den das Auge infolge der Karten- zeichnung des Geographen einnimmt, ein verandertes Bild zeigen, so wird die Gestalt der Enzyklopadie von dem Standpunkt abhan- gen, den man bei der Betrachtung des gesamten Bildungswesens (univers lifteraire) zu vertreten gedenkt. Man konnte sich demnach ebenso viele wissenschaftliche Systeme denken wie Weltkarten verschiedenen Blickwinkels, wobei jedes dieser Systeme einen be- sonderen, ausschliel3lichen Vorteil den anderen gegenuber aufzu- weisen hatte. (loc. cit. p. 87)
Diese Vielfalt muss jedoch nicht zu einem trivialen Relativismus fuhren, was die Gestalt der Enzyklopadie angeht. In einer Art fairen Ausgleichs, der allen Wissenschaften dieselben Rechte einzuraumen bestrebt war, sollte nach d'Alembert ,diejenige enzyklopadische ijbersicht den Vor- zug vor allen anderen verdienen, die in der Lage ware, die mannigfal- tigsten Verbindungspunkte und Beziehungen zwischen den einzelnen Wissenschaften aufzuzeigenU" (ebd.). Um eine solche ,,optimale" en- zyklopadische Darstellung zu erreichen, wahlte die franzosische En- zyklopadie eine Darstellung, die sich eng an diejenige anschloss, die Bacon mehr als einhundert Jahre zuvor in De augmentis vorgeschlagen hatte. Diese beruhte nicht auf einer ontologischen Einteilung der Welt, sondern auf den epistemischen Fahigkeiten des Menschen, die Bacon und d'Alernbert als wesentlich erachteten fur den verstandigen, den- kenden Umgang des Menschen mit der Welt:
[Denken auf3ert sich auf zweierlei Art]: im zusammenfassenden Ur- teil uber die lnhalte der unmittelbaren Vorstellungen oder in ihrer Nachahmung. So bilden also das Gedachtnis, die Vernunff im ei- gentlichen Sinne und die Vorstellungskraff die drei verschiedenen Moglichkeiten fur unseren Geist, seine Gedankeninhalte zu ver- arbeiten. . . . Diese drei Begabungen bilden zunachst die drei Haupt- teile unseres Systems und die drei Hauptgebiete des menschlichen Wissens: die Geschichte auf der Grundlage des Gedachtnisses, die

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 4 1
Philosophie als Ergebnis der Vernunftarbeit und die schonen Kuns- te als Gebilde der Vorstellungskraft. (loc. cit., p. 91)
Das enzyklopadisch geordnete Wissen hat somit die Gestalt eines Baumes mit drei Hauptasten. Der Baum der Encyclopedie unterschei- det sich grundsatzlich von den ontologischen Baurnen aristotelischen Typs: Wahrend diese die Struktur der Welt widerspiegeln wollen, ist der Baum der Encyclopedie ein epistemologischer Baum, dem es nicht direkt um die Struktur der Welt, sondern um eine Reprasentation der Struktur des Wissens von der Welt geht. Wie oben erlautert, gilt eine solche Reprasentation als desto besser, je koharenter sie ist. Das Stre- ben nach Koharenz steht aber zunachst in Konflikt mit der alpha- betischen Anordnung. Dieses Problem sol1 durch ein System von ~ b e r - sichtstabellen und .~nmerkungen"'~ gelost werden:
Drei Mittel haben wir dazu angewendet: eine ~bersichtstabelle am Beginn des Werkes, Angabe der Wissenschaft, auf die sich die je- weiligen Artikel beziehen, und die Behandlung der Artikel selbst. . . . Im ubrigen wird aus der inhaltlichen Anordnung jedes etwas um- fangreicheren Artikels unfehlbar ersichtlich, dat3 dieser auch mit ei- nem anderen Artikel Beruhrungspunkte aufweist, der zu einer ande- ren Wissenschaft gehort, der zweite wieder zu einem dritten usw. Wir haben uns bemuht, durch genaue und haufige Hinweise in die- ser Beziehung allen Wunschen gerecht zu werden; denn die An- merkungen in diesem Worterbuch dienen dem besonderen Zweck, vor allem den Zusammenhang der behandelten Fragen aufzu- zeigen, . . . (loc. cit., p. 105)
D'Alembert betont, dass man die Ordnung der Enzyklopadie nicht u- berstrapazieren durfe. Ansonsten kommt Unsinn heraus: Das heil3t, es lassen sich Verbindungen herstellen, die sinnlos sind: ,,Der Nutzen der umfassenden Einteilungen liegt in der Sammlung eines sehr umfang- reichen Materials: sie darf aber keinesfalls das Studium des Materials selbst uberflussig erscheinen lassen." (ibidem) Auch diese Einsicht wird unterstutzt von der geographischen Basismetapher: wenn jemand die Karte eines Gebietes kennt, bedeutet das keineswegs, dass er sich dort wirklich auskennt. Der Unterschied zwischen Karte und kartiertem Gebiet kann immens sein. Schliet3lich ist zu bemerken, dass d'Alembert der genetischen Konnotation des .Stammbaumes" keine grol3e Bedeu- tung beimisst. Der ,,Stammu und seine ersten ~ s t e sind keineswegs als die ersten oder ursprunglichen Wissensgebiete anzusehen. Im Gegen-

42 Thomas Mormann
teil, gemal3 ihrer partikularistischen Grundeinstellung gehen die Enzy- klopadisten davon aus, dass zeitlich wohl zuerst die aut3eren Wissens- zweige auftraten, in denen es urn lokal begrenztes Wissen und lokal begrenzte Fertigkeiten ging. Die Verzweigungsstruktur reflektiert also weniger eine genetische Ordnung als eine logische Ordnung der Ver- allgerneinerung, so dass im Ursprung das allgerneinste Wissen lokali- siert wurde.13 Mit etwas gutern Willen Iasst sich diese Interpretation des Stamrnbaurns (der naturlich vorn biblischen Baurn der Erkenntnis her- ruhrt (vgl. Gen. 2.9)) mit der ansonsten vorherrschenden geographi- schen Metaphorik vereinbaren. DIAlembert schlug vor, den Starnm als ein strukturiertes lnhaltsverzeichnis der die Enzyklopadie ausrnachen- den Einzelkarten anzusehen. Wie dem auch sei, in jedem Fall sind epi- stemologische Baurne vielfaltiger als ontologische. Die Ontologie neigt zur Auszeichnung einer einzigen ,wahrenii Struktur, wahrend die Epis- ternologie dazu tendiert, eine Vielfalt rnoglicher epistemischer Ansatze zuzulassen. Dieser Freiraurn moglicher episternischer Strukturierungen wird von den Enzyklopadisten bewusst genutzt.
Ein bekanntes Beispiel liefert die Theologie: Irn Gegensatz zu Ba- cons Baum bestirnmen die Enzyklopadisten das theologische Wissen nicht als eine eigene Art von Wissen, was es von der Legislation der Vernunft unabhangig rnachen wurde, sondern als einen speziellen Ast des menschlichen Wissens, den sie uberdies noch in der Nahe der schwarzen Magie lokalisieren. Der subversive Charakter dieser Neu- strukturierung des Wisssensraurnes verdankt sich der Geometrie: Das heifit, sie lebt von dern suggestiven Modell der Geographie eines mun- dus intellectualis, dern alle Wissenssparten zugehorig sind und in dem sie mehr oder rninder weit von einander entfernt lokalisiert sind. Der Gebrauch des Terminus .RaurnU irnpliziert, dass diese verschiedenen Wissensbereiche nicht blot3 alphabetisch als blol3e Agglomeration un- zusarnmenhangender Teile dargestellt werden, sondern als naher oder ferner lokalisiert sind.
Es geht den franzosischen Enzyklopadisten nicht urn eine nur "the- oretische'', sondern urn eine neue revolutionare Geographie des Wis- sensraurnes, die die iiberkornmenen Grenzziehungen und Nach- barschaftsbeziehungen des mundus intellectualis von Grund auf zu re- vidieren bestrebt war. So schreibt der Historiker Darnton:
[Die Enzyklopadie] zeichnete die Kenntnisse nach philosophischen Prinzipien auf, ... Der grol3e strukturierende Faktor war die Ver- nunft, die gerneinsarn rnit der Erinnerung und der Einbildungskraft als ihren Schwesterfahigkeiten die Sinnesdaten in Zusarnrnenhang

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 43
brachte. ... Sie [die Enzyklopadisten] verbargen nicht die er- kenntnistheoretische Grundlage ihres Angriffs auf die alte Kos- mologie. ... Unter der Masse der achtundzwanzig Foliobande der Enzyklopadie mit ihren 71.818 Artikel und 2885 Tafeln liegt ein er- kenntnistheoretischer Richtungswechsel, der die Topographie des menschlichen Wissens verwandelt. ... Das radikale Element in der Enzyklopadie stammte nicht aus irgendeiner prophetischen Vision der fernen Franzosischen oder industriellen Revolution, sondern aus ihrem Versuch, die Welt des Wissens geman neuer, durch die Vernunft und die Vernunft allein bestimmter Grenzen zu zeichnen. Darnton (1 998, S.18, 19, 21)
Man bemerke, dass Darnton hier wie selbstverstandlich die geo- graphische Metapher einer "Topographie des menschlichen Wissens" verwendet, auch wenn er sie nicht zu ihrer Baconischen Basis zu- ruckverfolgt. Dies ist ein Beleg dafur, dass eine geographische Per- spektive sehr natijrlich ist. Die Grande Encyclopedie kann also als eine Art Atlas angesehen werden, der die Geographie des menschlichen Wissens in einer neuen Weise kartiert. Die Kartierung der Encyclopedie ist nicht einfach eine Bestandsaufnahme der Geographie des mundus intellectualis wie sie sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts darstellt, sie ist auch ein Manifest zu ihrer Veranderung (vgl. Darnton 1998, p. 19).
Karten, insbesondere solche, die die politischen, wirtschaftlichen und historischen Verhaltnisse wiedergeben wollen, sind Konstruk- tionen. Anzunehmen, sie reprasentierten die Welt so, wie sie wirklich ist, ware ein positivistisches Missverstandnis. Kaum weniger naiv ware es, von vornherein einen kategorialen Unterschied zwischen der Geo- graphie des mundus visibilis und dem mundus intellectualis anzuneh- men. Selbst im Alltag gibt es bei genauerem Hinsehen viele Beispiele, die belegen, dass die kartographischen Darstellungen auch des mun- dus visibilis und seiner verschiedenen Aspekte alles andere als naiv re- alistisch sind.14 Man denke etwa an Karten von Eisenbahn- oder U- Bahnnetzen, Stadtplane usw., fur die es eher auf topologische denn metrische Beziehungen ankommt. Es ist wenig sinnvoll, von den Karten der sichtbaren Welt zu fordern, sie sollten diese so beschreiben wir sie wirklich ist (vgl. Goodman 1963, S. 552).15 Allgemein kann man sagen, dass der kognitive Gehalt von Karten, Diagrammen und anderen nicht- propositional formulierten Erkenntnissen von der herkommlichen Er- kenntnis- und Wissenschaftstheorie gewaltig unterschatzt worden ist. Es ist bemerkenswert, dass sowohl die Grande Encyclopedie wie auch die osterreichische Enzyklopadie diese in der Philosophie lange Zeit

44 Thomas Mormann
ubliche Vernachlassigung nicht-propositionalen Wissens uberwinden wollten, indern sie Graphiken und Diagrammen eine grofie Bedeutung beimat3en.16
Die Vernachlassigung der geometrischen Aspekte des Wissens durch die traditionelle Philosophie verdankt sich zu einem Gutteil der Tatsache, dass die Philosophie lange Zeit zu enge Vorstellungen davon hatte, was unter Geornetrie zu verstehen sei. Solange man Geometrie mit euklidischer Geornetrie identifizierte, blieben die oben genannten Darstellungen wenig respektable .Veranschaulichungen" und "Visuali- sierungen", die rnit Wissen im eigentlichen Sinne nichts zu tun hatten, und deshalb auch kein wissenschaftsphilosophisches lnteresse bean- spruchen konnten. Erst aus der Sicht eines allgemeineren Verstandnis- ses von Geornetrie, welches sie irn Sinne Leibniz' als eine allgerneine Theorie von Ordnungssetzungen begreift, wird der geometrische Cha- rakter der erwahnten Darstellungen deutlich und erkenntnistheoretisch respekta bel.
Man mag einwenden, dass dieser Begriff einer verallgemeinerten Geornetrie nicht der war, von dern d'Alernbert ausging, als er seine Geographie des enzyklopadischen Wissens konzipierte. Das mag sein. Die Explizierung geometrischer Strukturen braucht nicht Hand in Hand und schon gar nicht gleichzeitig vonstatten zu gehen rnit ihrer Verwen- dung.
3. Territorialisierung
Das von Diderot und d'Alernbert geleitete Projekt der Encyclopedie gilt gerneinhin als das grofite, jernals realisierte Projekt der Aufklarung: ijber einem Zeitraurn von uber 25 Jahren hinweg waren hunderte von Gelehrten, Literaten, Illustratoren, und anderen ~utoren" damit be- schaftigt, zehntausende von Artikeln und tausende von Illustrationen zu verfassen. Schon in organisatorischer Hinsicht stellt dies eine unge- heure Leistung dar, die noch dadurch vergrofiert wird, dass die Encyc- lopedie lange Zeit rnit der staatlichen Zensur zu karnpfen hatte und auch die rnaterielle Produktion der Bande sich aus rnancherlei Grunden als nicht einfach erwies (cf. Darnton 1998).
Die enzyklopadische Kartierung des mundus intellectualis war je- doch keineswegs das einzige Grofiprojekt der Aufklarung, das sich rnit der geographischen Erfassung des Universurns irn Sinne von Bacon befasste. Auch der mundus visibilis hatte sein franzosisches Enzyklo- padieprojekt. Irn Auftrag des Konigs arbeiteten irn Frankreich des 17.

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 45
und 18. Jahrhunderts Astronornen, Mathematiker, und Geographen aus der italienisch-franzosischen Farnilie Cassini uber vier Generationen an der ersten zuverlassigen Topographie ~rankreichs." Darnit schufen sie den Prototyp fur die Verrnessung anderer europaischer Lander, und daruber hinaus der gesarnten Welt. Es ist wenig plausibel, die zeitliche Koinzidenz des Enzyklopadieprojektes und des Cassini-Projektes ei- nern bloaen Zufall zuzuschreiben. Die Parallelitat beider Projekte ist vielmehr als charakteristisches Merkrnal eines Baconischen Pro- gramms zu verstehen, das die Eroberung des mundus visibilis und des mundus intellectualis miteinander verknupfte. Es ist nicht abwegig, der Aufklarung allgemein .eine Sehnsucht nach einem aufgeklarten Raurn zuzuschreiben, aus dern alle dunklen Stellen getilgt sind" (Schlogel 2003, p. 169). Darnit konnte man die verschiedenen .geographischen1' Projekte in eine vereinheitlichende Perspektive stellen.
Ich mochte die von den franzosischen Enzyklopadisten angestrebte (Re)Strukturierung des Wissens und der Wissenschaften als Versuch einer Territorialisierung des Wissensraurnes bezeichnen. Was darunter zu verstehen ist, Iasst sich am einfachsten an Cassinis Parallelaktion erlautern, die ein geornetrisches Problem im herkomrnlichen Sinne betraf, narnlich die prazise Triangulierung und kartographische Er- fassung Frankreichs. Das, was zuvor als unbestimrnter und vager Raurn erfahren wurde, verwandelte sich durch Cassinis Triangulation in ein kontrollierbares und irn wortlichen Sinne bestimrntes Territorium, uber das die Staatsmacht verfugen konnte.
Eine Parallelsetzung des Projektes von Diderot und dlAlernbert auf der einen Seite, und des Triangulierungsprojektes Cassinis auf der anderen Seite, verweist darauf, dass der Begriff des Raumes, handle es sich nun um einen genuin geographischen oder einen konzeptuellen Raurn, eine hochst komplexe Kategorie ist, in der kognitive, soziale, und politische Kornponenten rnit einander verschrankt sind. Irn Falle des Triangulierungsprojektes ist das offenkundig. Das lnteresse an diesern Projekt ist offensichtlich politisch und okonornisch begrundet. Mehr noch, die Entstehung der Kartographie als wissenschaftliche Dis- ziplin verdankt sich wesentlich dern lnteresse der absolutistischen Herrscher an einer genauen Erfassung der Zahl ihrer Untertanen und dern Urnfang des von ihnen beherrschten Territoriurns (cf. Burke 2000. p.132f). Hand in Hand mit der Kartographie entstanden so wis- senschaftliche Disziplinen wie Statistik, Verwaltungs- und Militarwis- senschaften. Darnit wuchs ein Wissenskomplex, dessen Grenzen m a r nur schwer zu bestimrnen war, der aber ein schlagendes Argument fur die mogliche praktische Bedeutung allen Wissens darstellte: In einer

46 Thomas Morrnann
Baconischen Welt ist Aristoteles' naturliches Streben nach Wissen um seiner selbst willen eine Illusion oder zumindest eine Ausnahme.
Die wissenschaftlichen Grol3projekte des 18. Jahrhunderts, wie Cassinis Projekt, das fur den Erfolg maritimer Unternehmungen schlechthin wesentliche Projekt einer genauen Langengradmessung, das vor allem in Gronbritannien vorangetrieben wurde (cf. Sobel 1996), und eben auch das franzosische Enzykopadieprojekt konnten uns dar- an erinnern, dass den Raumen des Wissens und der Wissenschaft in einem ganz fundamentalen Sinn eine immense Ausdehnung eignet, die in einem muhsamen und aufwendigen Prozess der Territorialisierung bewaltigt werden muss. In diesem Prozess der Territorialisierung wird der zunachst unbestimmte und weglose Raum, in dem sich hochstens einige wenige zu bewegen wissen, bestimmt und im Prinzip allen zu- ganglich gemacht. Das heint, auch wenn etwa Cassinis Projekt vom franzosischen Absolutismus angestonen worden war und zunachst in erster Linie machtpolitischen und militarischen lnteressen diente, lien sich auf die Dauer seine allgemeinere, .demokratische6' Nutzung durch das Burgertum nicht verhindern.lg Allein der Umfang von Cassinis Atlas machte es unmoglich, es als .GeheimwissenU zu behandeln. Dasselbe gilt fur das Langengradprojekt, dessen Erfolg auf der Herstellung ge- nauer Zeitmessgerate beruhte, die sich zunachst nur wenige leisten konnten. Das Enzyklopadieprojekt als Kartierungsprojekt des Wissens- raumes war von vornherein auf die lnteressen des burgerlichen Stan- des zugeschnitten, aber auch die Realisierung der ursprunglich ,,abso- lutistischen" Kartierungsprojekte spielte letztlich den lnteressen des dritten Standes in die Hande.
Wahrend zu Ende des 18. Jahrhunderts die Eroberung des mundus visibilis noch im unabsehbaren Fortschreiten begriffen war, und die Grenzen der territorialen Expansion der kolonialen lmperien noch jen- seits des Vorstellungshorizontes lagen, machte sich Kant bereits Ge- danken uber die prinzipiellen Grenzen der Expansion des Wissens, was den mundus intellectualis anging. In der Grundfrage der Kritik der reinen Vernunft (1 787) .Was konnen wir wissen?" ist die Moglichkeit formuliert, dass wir nicht alles wissen konnen. Es deutet sich an, dass die Grenzen des menschlichen Wissens moglicherweise auch uber- dehnt werden konnen, und nicht alle Anspruche auf ,,Territorien des Wissens" zu rechtfertigen sind.*' So bemerkt er am Ende der trans- zendentalen Analytik, in der ,,Transzendentalen Doktrin der Urteilskraft":
Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durch- reist, und jeden Teil davon sorgfaltig in Augenschein genommen,

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 47
sondern es auch durchrnessen, und jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimrnt. Dieses Land aber ist eine Insel, und durch die Natur selbst in unveranderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrheit (...), urngeben von einern weiten und sturmi- schen Ozeane, ... wo manche Nebelbank, und manches bald weg- schmelzende Eis neue Lander lugt ... (A 236, B 295)
Die primare Aufgabe einer theoretischen Geographie des mundus intel- lectualis bestand fur Kant also darin, die prinzipiellen Grenzen der mog- lichen Territorien des Wissens zu bestimmen. Darnit sollte verrnieden werden, dass der empirische Verstand sich auf Unternehrnungen ein- Iasst, die von vorherein zurn Scheitern verurteilt sind (cf. A 238, B 297).21
Die Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts ist, wenn es urn wis- senschaftliches Wissen ging, irn wesentlichen Kant gefolgt, indem sie die prinzipiellen Aspekte ,,der Bedingungen der Moglichkeit" in den Vordergrund stellte. Selbst wenn, wie bei Popper, ,,das Problem des Wachsturns oder des Fortschritts als das zentrale Problem der Er- kenntnislehre" betrachtet wird (Popper 1959, xiv-xv), heiM das nicht, dass die Wissenschaftsphilosophie sich tatsachlich rnit den handfesten Problemen des unaufhorlich wachsenden wissenschaftlichen Wissens befasst hatte, es lief vielrnehr darauf hinaus, dass sie sich mit dern prinzipiellen Problem beschaftigte, wie ein solches Wachstum moglich i ~ t . ~ ~
Die vielfaltigen Schwierigkeiten und Problerne einer Territoriali- sierung der Wissensraurne hat sie rneistens ignoriert. Eine parallele Betrachtung der verschiedenen .geographischen1' Projekte des 18. Jahrhunderts konnte dazu beitragen, die damit verbundenen Einseitig- keiten und Verkurzungen sichtbar werden zu lassen.
4. Geographie und Konstitution des mundus intellectualis
Das Enzyklopadieprojekt des Wiener Kreises wird ublicheweise mit Otto Neuraths enzyklopadistischer Einheitswissenschaff identifiziert. Es gibt kaum Untersuchungen, die der Frage nachgehen, ob es nicht auch andere Mitglieder des Kreises gab, die sich mit dern Enzyklopadiepro- jekt als einern philosophischen Projekt beschaftigt haben, dern es urn die Ordnung des wissenschaftlichen Wissens zu tun war. Naturlich haben Mitglieder des Kreises Beitrage zur Encyclopedia of Unified Science geliefert, die Frage ist jedoch, ob irgend jemand aufier Neurath

48 Thomas Mormann
ernsthaft versucht hat, eine Theorie der globalen Ordnung des wissen- schaftlichen Wissens auszuarbeiten. Ich mochte in diesern Abschnitt zeigen, dass diese Frage fur Carnap zu bejahen ist. Genauer gesagt gibt es einen bisher ziemlich vernachlassigten Versuch Carnaps, die Konstitutionstheorie des Aufbau und Neuraths Projekt der Einheitswis- senschaft zusarnmenzubringen. Fur einige Jahre scheinen Neurath und Carnap das Projekt ins Auge gefasst zu haben, die Konstitutionstheorie des Aufbau als Basistheorie der Einheitswissenschaft zu verwenden. Dies wird im Manifest des Wiener Kreises programrnatisch so forrnu- liert:
Da der Sinn jeder Aussage der Wissenschaft sich angeben lassen rnul3 durch Zuruckfuhrung auf eine Aussage uber das Gegebene, so mu& auch der Sinn eines jeden Begriffs ... sich angeben lassen durch eine schrittweise Ruckfuhrung auf andere Begriffe, ... Ware eine solche Analyse fur alle Begriffe durchgefuhrt, so waren sie damit in ein ... .Konstitutionssystem" eingeordnet. Die auf das Ziel eines solchen Konstitutionssystems gerichteten Untersuchungen, die .Konsfitutionstheorie", bilden sornit den Rahrnen, in dern die lo- gische Analyse von der wissenschaftlichen Weltauffassung ange- wendet wird. . . . Die Einordnung der Begriffe der verschiedenen Wissenszweige in das Konstitutionssystem ist in grol3en Zugen heute schon erkenn- bar, fur die genauere Durchfuhrung bleibt noch vie1 zu tun. Mit dern Nachweis der Moglichkeit und der Aufweisung der Form des Ge- samtsystems der Begriffe wird zugleich der Bezug aller Aussagen auf das Gegebene und darnit die Aufbauform der Einheits- wissenschaft erkennbar. (Neurath 1981 (1 929), p. 3071308).
Bereits irn Aufbau hatte Carnap die Konstitution eines ~egenstandes*~ explizit rnit der Angabe seiner geographischen Koordinaten verglichen:
Der Konstitution eines Gegenstandes entspricht gleichnisweise die Angabe der geographischen Koordinaten fur eine Stelle der Erd- oberflache. Durch diese Koordinaten ist die Stelle eindeutig ge- kennzeichnet; jede Frage uber die Beschaffenheit dieser Stelle (et- wa uber Klima, Bodenbeschaffenheit, usw.) hat nun einen bestimrn- ten Sinn. (Aufbau, § 179)

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 49
Mit anderen Worten, ein Konstitutionssystem beschreibt die Geo- graphie (oder Geometrie) eines Begriffs- oder Gegenstandssystems - durchaus irn Sinne von Bacons Programrn einer Geographie des mun- dus intellectualis. Die Konstitutionstheorie als Theorie von Konstituti- onssystemen kann somit als eine Jheoretische Geographie" des wis- senschaftlichen Wissens verstanden werden, der es um die Ex- plizierung der moglichen geometrischen Strukturen eines Wissens- raumes geht. Fiir diese Interpretation sprechen zahlreiche Belege aus der Vorgeschichte des Aufbau. Auch in einigen weniger bekannten, z.T. unveroffentlichten Arbeiten, die Carnap zu Anfang der dreiaiger Jahre verfasste, sind die Umrisse einer solchen geometrischen Theorie er- kennbar. Hier sind die geometrischen oder geographischen Leitmotive seiner Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie deutlicher sichtbar als im Aufbau selbst, wo er bestrebt war, die geometrische Motivation seines Denkens zugunsten einer "streng logischen" Darstellung zu verbergen. In dem unveroffentlichten Vortrag Von Gott und Seele. Scheinprobleme in Theologie und Metaphysik (RCC-089-63-01) von 1929 argumentierte Carnap mit Hilfe von Bacons Analogie zwischen dem mundus visibilis und mundus intellectualis folgendermaaen fur eine verifikationistische und koharentistische Erkenntnistheorie:
Im Raum stehen alle Dinge in raumlicher Beziehung zu einander, und zu jedem Ding mu& es von mir aus einen Zugangsweg geben. Ebenso stehen aufgrund des Begriffssystems, gewissermaaen ei- nes ales umfassenden Begriffsraumes, alle Begriffe in Beziehung zueinander. ... Es mu13 zu jedem Begriff einen Verbindungsweg von meinen Erlebnisinhalten ... geben. .... Der englische Philosoph Hume hat vor zweihundert Jahren diese zwingende Forderung der Zuruckfiihrbarkeit eines jeden Begriffs auf Sinneseindriicke, die sogenannte positivistische Forderung auf- gestellt ... Und gegenwartig sind englische und deutsche Logiker damit beschaftigt, den ,,BegriffsraumU oder besser den ,,Stamm- baum der Begriffe" aufzustellen, d.h. das System (,,Konstitutions- system"), in dem die Wege zur Darstellung kommen, die von den einfachsten Erlebnisinhalten ... bis hinauf zu den kompliziertesten, abstraktesten Begriffen ... hinfiihren.
Ein System, in dem die ,,Wege zur Darstellung kommen", die ver- schiedene Orte mit einander verbinden, ist aber nichts anderes als eine Landkarte. Carnap verstand also die Konstitutionstheorie als Theorie

50 Thomas Mormann
einer allgemeinen Geographie von ~onst i tut ionss~stemen.~~ lm ihrem Kern findet man genau denselben Komplex geometrischer Metaphern wie in dlAlemberts Discours preliminaire und Bacons .intellektueller Ge- ographie". Auch in inhaltlichen Punkten stimmen die lntentionen der Encylopedie und der Konstitutionstheorie uberein. Sowohl Diderots und d'Alemberts Darstellung wie auch Carnaps konstitutionstheoretische Rekonstruktionen zielen auf eine Territorialisierung des Wissens- raumes im fruher definierten Sinne, d.h. auf seine Verfugbarmachung fur die gesamte Gesellschaft. Beide sind sich ebenfalls einig darin, dass eine solche .territorialisierendeU Kartierung des Wissensraumes grundsatzlich auf verschiedene Weisen geschehen kann: Es gibt keine ausgezeichnete, einzig richtige Strukturierung des Wissens genau so wenig wie es die eine .richtigeU Koordinatisierung der physikalischen Welt gibt. Jede Kartierung des Wissensraumes beruht, wie schon Goodman (1963) eindrucklich dargestellt hat, auf mannigfachen, meist konventionell begrundeten Abkurzungen, Vereinfachungen und Stilisie- rungen, die nicht als "Fehler" oder .Defekteil der Karte zu interpretieren sind, welche einer vollkomrnenen Karte a la Borges nicht mehr anhaf- ten wurden, sondern sie gehoren zum Wesen jeder vernunftigen, d.h. verwendbaren Karte (cf. ibidem, p. 5521553). Auch Carnap selbst be- schreibt zumindest implizit das Vorhaben des Aufbau als ein Kartie- rungsprojekt, in dem es darum geht, die Struktur des Wissensraumes zu explizieren:
Durch eine solche kennzeichnende Definition oder ,,Konstitutioni~ eines Begriffes ist freilich der Begriff keineswegs erschopft. Es ist nur sein Ort im System der Begriffe angegeben, wie gleichnisweise ein Ort der Erdoberflache durch seine geographische Lange und Breite; seine ubrigen Eigenschaften mussen in empirischer For- schung festgestellt werden und in der Theorie des betreffenden Gebietes dargestellt werden. Aber damit diese Darstellung sich auf etwas Bestimmtes bezieht, mu13 zuvor die Konstitution (die geogra- phischen Koordinaten im Gleichnis) angegeben sein." (Carnap 1927, p. 358)
Man mag einwenden, dass diese geometrische Interpretation der Kon- stitutionstheorie m a r plausibel sein mag, gleichwohl aber wenig be- deutsam ist, als Carnap selbst davon schon bald abgeruckt ist. ~ b e r - dies habe sie keinen Eingang in das .eigentlicheU Enzyklopadieprojekt des Wiener Kreises gefunden, eben Neuraths Enzyklopadie der Ein- heitswissenschaft. Letzteres ist sicher richtig. Die angestrebte Ko-

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 5 1
operation zwischen Konstitutionstheorie und enzyklopadischer Einheits- wissenschaft wurde nicht realisiert, und seit Mitte der dreil3iger Jahre nahrn Neurath in seinen Arbeiten zur Theorie der Enzyklopadie keinen Bezug rnehr auf die Konstitutionstheorie. Das heifit jedoch nicht, dass Carnap selbst den konstitutionstheoretischen Ansatz ersatzlos auf- gegeben hatte. In den dreiniger Jahren transforrnierte sich die Konsti- tutionstheorie als Theorie von Konstitutionssystemen in das Projekt einer neuen Art von Philosophie, deren Hauptaufgabe darin bestand, Vorschlage fur die Konstruktion von Sprachrahrnen (linguistic frarne- works) fur die Wissenschaft zu rnachen (cf. Carnap 1934). Ohne das hier irn Einzelnen begrunden zu konnen, rnochte ich behaupten, dass Konstitutionstheorie irn Sinne des Aufbau und Konstruktion von Sprach- rahmen enger rnit einander verwandt sind als man rneinen rnochte. Carnaps spaterer logisch-linguistischer Ansatz kann als eine Fortset- zung der Konstitutionstheorie verstanden werden. Dies wird klar, so- bald man sich daran erinnert, welchen Begriff von Sprache Carnap in Logische Syntax der Sprache seinen Untersuchungen zugrundelegt. .Spracheu tritt in Syntax im Plural auf; der Gegenstand von Syntax sind Sprachen, aufgefasst als Kalkule (Carnap 1968 (1934), p. 2ff). Daraus ergibt sich:
Die Syntax einer Sprache oder eines sonstigen Kalkuls handelt all- gernein von den Strukturen moglicher Reihenordnungen (be- stirnrnter Art) beliebiger Elemente. ... [Die reine Syntax] ist nichts anderes als Kornbinatorik oder, wenn man will, Geornetrie endlicher diskreter Reihenstrukturen bestimrnter Art. Die deskriptive Syntax verhalt sich zur reinen wie die physikalische Geornetrie zur rnathe- matischen . . ., (Carnap 1968 (1 934), p. 6, 7)
Grundsatzlich gilt, dass Carnaps Vorbild fur seinen syntaktischen Beg- riff von Sprache als Kalkul Hilberts Begriff von forrnaler Geometrie ist, wie er in Grundlagen der Geometrie (Hilbert 1899) expliziert wird (cf. Carnap 1934, p.9). Daruber hinaus Iasst sich zeigen, dass Carnaps linguistischer Konventionalisrnus seinen Ursprung irn strukturellen Kon- ventionalisrnus der Geometrie hat, den er irn Anschluss an Poincare bereits in seiner Dissertation (Carnap 1922) forrnulierte. Vereinfacht gesagt lautet seine These, dass die in den Wissenschaften ver- wendeten Sprachen ebenso konventionell sind wie die in der Geome- trie oder Geographie verwendeten Koordinatensysterne (Morrnann 2004). Die Rolle der Philosophie als Syntaxtheorie ist es, Vorschlage

5 2 Thomas Mormann
fur die Konstruktion von Wissenschaftssprachen, d.h. Koordinatisierun- gen von Wissensraumen zu machen.
SchlieBlich sei angemerkt, dass die Auffassung von Philosophie als Syntax der Sprache, d.h. als Mathematik oder Geometrie der Wissen- schaftssprache, keineswegs eine bloB erlauternde Funktion hatte. Sie lieferte Carnap das entscheidende Argument gegen Hume und Witt- genstein, auch die Satze Wissenschaftslogik seien streng genommen sinnlos:
Wenn nach Hume jeder Satz sinnlos ist, der nicht entweder zur Ma- thematik oder zur Realwissenschaft gehort, dann sind ja auch alle Satze eurer eigenen Abhandlungen sinnlos ... Demgegenuber wol- len wir hier die Auffassung vertreten, daB die Satze der Wissen- schaftslogik Satze der logischen Syntax der Sprache sind. Damit liegen diese Satze innerhalb der von Hume gezogenen Grenze; denn logische Syntax ist - wie wir sehen werden - nichts Anderes als Mathematik der Sprache. (Carnap 1934b)
Diese Belege sollten genugen, die Annahme plausibel zu machen, dass auch Carnaps linguistisch gewendete Konstitutionstheorie, die seit Anfang der dreil3iger Jahre die im Aufbau formulierte Version ab- zulosen begann, uber ein geometrisches Substrat verfugte, durch das sie sich als allgemeine Theorie der geometrischen oder geo- graphischen Struktur des mundus intellectualis im Sinne Bacons er- weist.
Naturlich unterscheidet sich Carnaps Geometriekonzeption er- heblich von der, die Bacon und die franzosischen Enzyklopadisten ihrem Ansatz zugrunde legten: wahrend Carnap von einer konstruk- tiven und formalen Konzeption von Geometrie ausging, die durch die strukturalistische Mathematik des 19. und 20. Jahrhunderts gepragt war, ist Bacons Verstandnis der Geographie des mundus intellectualis wohl eher naiv metaphorisch. Von Konventionalismus kann bei Bacon sicher nicht die Rede sein. Es ist jedoch bemerkenswert, dass dlAlembert und Diderot in ihrer Beschreibung der Geographie des Wis- sensraumes durchaus gewisse konventionelle Komponenten anerkann- ten: fur sie war eine Enzyklopadie immer aus einer bestimmten Per- spektive geschrieben, die niemals vollstandig objektiv begrundet wer- den konnte. Die Konventionalitat der Geometrie des Wissensraumes ubertrifft also in ihrem Fall die des gewohnlichen Raumes. Carnaps globaler Konventionalismus hingegen hat seine Lektionen der nichteuk- lidischen Geometrien gelernt und geht davon aus, dass die Geometrien

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 53
sowohl des mundus visibilis wie die des mundus intellectualis konventi- onell und damit nicht eindeutig bestirnmt sind. Dies sol1 irn nachsten Abschnitt genauer untersucht werden.
5. Geometrie und Pluralismus
Die Strukturtheorie einer enzyklopadischen Darstellung eines mundus intellectualis als .GeometrieU zu beschreiben, sollte, wenn diese Cha- rakterisierung nicht auf einer sehr allgemeinen Ebene verbleiben will, mit der Entwicklung der Geometrie schritthalten. Jedenfalls ware das ein Beleg fur die .Wirksamkeitn des geornetrischen Faktors. Ich mochte im Folgenden am Beispiel des imrner deutlicher werdenden geo- metrischen Pluralismus dafur argumentieren, dass das in der Tat der Fall war.
Es ist unmoglich, die Entwicklung der Geometrie seit dem 18. Jahr- hundert bis heute in wenigen Satzen sinnvoll zusammenzufassen. Gleichwohl kann man kurz auf einen entscheidenden Unterschied zwi- schen .alter" und .neuer" Geometrie hinweisen, namlich die Einsicht in die grundsatzliche Pluralitat geornetrischer Systeme. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts war es fur eine wissenschaftlich ernstzunehmende Wissenschaftsphilosophie nicht rnehr rnoglich, die Vielfalt moglicher Geometrien zu ignorieren. Die euklische Geometrie erwies sich als eine unter vielen moglichen. Diese Einsicht erweiterte nicht nur den Gegens- tands- und Anwendungsbereich der Geometrie, sondern fuhrte auch zu einer grundlegenden Transformation des Gegenstandsbereichs der Geometrie. Nicht mehr jedes geornetrische System wird einzeln fur sich untersucht, sondern die Gesamtheit moglicher geometrischer Systeme wird Gegenstand der Geometrie - Geornetrie wird zur Metageometrie. Das Erlanger Programm von Felix Klein, das Geometrien anhand der sie charakterisierenden Transformationsgruppen untersucht, ist das Projekt, das bis heute unter Philosophen am bekanntesten i ~ t . ~ ~ Carnap wurde anscheinend weniger durch Kleins Erlanger Programm, als durch Riemanns und Hilberts .neueU Geornetrie inspiriert, die uber Kleins Pluralisrnus moglicher Geometrien hinausgehen. Wie aus Der Raum (Carnap 1922) zu ersehen ist, war er besonders beeindruckt durch Poincares euklidisches Modell der hyperbolischen Geometrie (Poincare 1902). Er interpretierte dieses Modell als Beweis, dass die verschiedenen Geometrien (euklidische, hyperbolische und elliptische) als verschiedene Sprachforrnen aufgefasst werden konnten, in denen dieselben topologischen Sachverhalte ausgedruckt werden k ~ n n t e n . ~ ~

54 Thomas Morrnann
Dies fuhrte ihn zum Toleranzprinzip: ebenso wenig wie die Geometrie gewisse geometrische Systeme ausschloss, sollte auch die Syntax als Theorie moglicher Sprachformen gewisse Formen nicht diskriminieren oder gar verbieten, sondern sich auf ihre Bestandsaufnahme und Klas- sifizierung konzentrieren:
[Wlir wollen nicht Verbote aufstellen, sondern Festsetzungen tref- fen. ... Verbote konnen durch eine definitorische Unterscheidung ersetzt werden. In manchen Fallen geschieht das dadurch, dal3 Sprachformen verschiedener Arten nebeneinander untersucht wer- den (analog den Systemen euklidischer und nichteuklidischer Ge- ometrien), z.B. eine definite und eine indefinite Sprache, eine Spra- che ohne und eine Sprache mit Satz vom ausgeschlossenen Drit- ten. ... In der Logik gibt es keine Moral. Jeder mag seine Logik, d.h. seine Sprachform, aufbauen wie er will. Nur mu8 er angeben, wie er es machen will, syntaktische Bestimmungen geben anstatt philo- sophischer Erorterungen. (Carnap 1934, p. 45)
Ersetzt man hier ,,SprachformU durch .Koordinatensystem" oder ,,geo- metrisches System" wird der geometrische Hintergrund des To- leranzprinzips sichtbar: zur Orientierung im Raum kann jeder das Koor- dinatensystem verwenden, das ihm zusagt, solange er es so be- schreibt, dass Umrechnungen in andere Systeme moglich sind. Wie be- reits erwahnt, kann man schon bei d'Alembert ein analoges, auf die Struktur von Enzyklopadien bezogenes Prinzip des Pluralismus finden: es gibt nicht die eine .richtigem Darstellung, sondern viele verschiedene, die sich aus verschiedenen moglichen Perspektiven ergeben. Eine en- zyklopadische Ordnung des Wissens spiegelt also keineswegs eine eindeutig bestimmte .natiirlicheu Ordnung der Welt wider.
Das Toleranzprinzip war nicht auf Carnaps syntaktische Epoche beschrankt: Auch nachdem er den syntaktischen Ansatz in der Wissen- schaftsphilosophie aufgegeben hatte, hielt er am Toleranzprinzip fest, das er in Empiricism, Semantics, and Ontology (Carnap 1950) folgen- dermal3en formulierte:
Wir wollen denjenigen, die auf irgendeinem Gebiet der Forschung arbeiten, die Freiheit zugestehen, jede Ausdrucksform zu benutzen, die ihnen nutzlich erscheint, die Arbeit auf dem Gebiet wird fruher oder spater zu einer Ausscheidung derjenigen Formen fuhren, die keine nutzliche Funktion haben. Wir wollen vorsichtig sein im Auf-

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 5 5
stellen von Behauptungen und kritisch bei ihrer Priifung, aber duld- Sam bei der Zulassung sprachlicher Formen. (Carnap 1 950, p. 278)
Carnaps Konzeption von Philosophie als Theorie moglicher wissen- schaftlicher Sprachformen konnte man als Theorie der Planung von Enzyklopadien begreifen. Eine solche Theorie zielte darauf, der scien- tific community die sprachlichen und logischen Mittel an die Hand ge- ben, das zunachst .wildwuchsigeU und logisch nichtanalysierte Wissen in geeigneten Sprachrahmen ,rational zu rekonstruieren", um es damit allgemein zuganglich zu machen. Dies aber entspricht der Grund- intention jeder Enzyklopadie, ein Wissen als Ganzes zu prasentieren. Man konnte also Carnaps .neue Art des Philosophierens" charakterisie- ren als eine Theorie moglichen Wissens, d.h. als Theorie der Geogra- phie moglicher mundi intellectuales (vgl. Mormann 2001). Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass Carnaps Konstitutionstheorie als Theo- rie moglicher Konstitutionssysteme und allgemeiner als Theorie mogli- cher Sprachformen der Wissenschaften durchaus etwas mit dem Enzy- klopadieprojekt zu tun hatte, auch wenn die Enzyklopadie der Einheits- wissenschaft nicht auf der Grundlage der Konstitutionstheorie, sondern von Neuraths Enzyklopadismus (wenn auch nur zu einem kleinen Teil) verwirklicht worden ist.
Die Pointe von Neuraths enzyklopadistischem Ansatz war bekannt- lich seine Gegenuberstellung von .Enzyklopadien und .Systemu, wie er sie emphatisch in seinem beruhmt-beruchtigten Diktum ,,Das System ist die grol3e wissenschaftliche Luge" ausgedruckt hat. Vielleicht sollte man heute dieses Thema etwas nuchterner angehen. In einer allge- meinen Ordnungstheorie des Wissens, die vielleicht einmal als Nach- folgedisziplin der klassischen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie wird gelten konnen, wird man verschiedene Typen von Ordnungen unterscheiden: strikt logische, aber auch flexiblere wie die von Neurath vorgeschlagene .enzyklopadischeu Ordnung. Eine strikte Entgegen- setzung von .Systemu und .EnzyklopadieU fuhrt zu einer unnotigen Po- larisierung und verschleiert nur das Kernproblem der enzyklopadischen Konzeption, das darin besteht, dass Neuraths .EnzyklopadieS als Mo- dell des Wissens abhangig bleibt vom Begriff des Systems - der Begriff der Enzyklopadie wird definiert als Abschwachung des Begriffs des deduktiven Systems, indem eine Enzyklopadie im Unterschied zu ei- nem System hochstens partiell deduktiv strukturiert ist, anstatt prazis definierter Begriffe auch sogenannte ,,Ballungenl' auftreten konnen etc. Mit diesen negativen Charakterisierungen bleibt der Enzyklopadismus als Theorie empirischen Wissens gegen seine eigentlichen lntentionen

5 6 Thomas Mormann
der Theorie logisch-deduktiver Systerne verhaftet. Eine Bezugnahrne auf die Geometrie konnte hier hilfreich sein: Die Geornetrie besitzt ei- gene .positiveu begriffliche Ressourcen, die nicht darin aufgehen, sie schlicht als .Nicht-Logik" oder .schwachere Logik" zu charakterisieren. So ist es ohne Schwierigkeiten moglich, irn Rahmen einer Theorie geo- graphischer Kartierungen Unbestirnmtheit und Nichtwissen zu behan- deln. Die .weinen Flecken" auf Landkarten, das zwanglose Weglassen von Details, etc. erlauben es, mit dem Phanomen der .Ballungenn auch in einern geographischen Kontext urnzugehen. Aus diesem Grunde sind geometrische Beschreibungen des Wissensraumes rnit einem neurathianischen Enzyklopadisrnus nicht nur ohne weiteres vertraglich, sondern ihrn durchaus k~n~en ia l .~ '
6. Zusammenfassung und Ausblick
Das Hauptanliegen dieser Arbeit bestand darin, einen Zusarnrnenhang zwischen den Projekten der franzosischen und osterreichischen Enzy- klopadisten dadurch herzustellen, dass beide als Versuche interpretiert werden, die geographische Struktur eines mundus intellectualis irn Sinne Bacons zu bestirnrnen. Eine solche Strukturierung hat eine erni- nent praktische Bedeutung, ermoglicht sie doch, sich in dieser Welt des Wissens zu orientieren. An die Stelle riskanter Expeditionen Einzelner treten organisierte Reisen der Vielen. Was einst hochste Anstrengung und Geschicklichkeit erforderte, zu der nur wenige irnstande waren, sinkt zur routinierten Durchfuhrung von Aufgaben herab, zu deren Lo- sung im Prinzip alle fahig ist. Eine enzyklopadische Strukturierung des Wissens erscheint so als eine notwendige Voraussetzung fur die De- rnokratisierung und allgemeine Verbreitung des Wissens. In gewisser Weise Iasst sich enzyklopadische Strukturierung eines Wissensberei- ches daher als Fortsetzung wissenschaftlicher Theoretisierung auffas- sen. Schon Mach und Duhem haben darauf hingewiesen, dass wissen- schaftliche Theorien als Mittel verstanden werden konnen, empirisches Wissen in geeigneter Weise zu komprirnieren und zu klassifizieren, urn es moglichst leicht und effizient handhabbar zu rnachen:
Klassifizierte Erkenntnisse sind leicht anwendbar und sicher zu gebrauchen. Aus kunstgerechten Werkzeugkasten, in denen die In- strumente, die demselben Zweck dienen, beieinander liegen, dieje- nigen aber, die verschiedenen Aufgaben haben, durch Scheide- wande getrennt sind, nirnrnt der Arbeiter blitzschnell, ohne Zogern

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 57
oder ~ngstlichkeit, das Werkzeug, das er braucht. Dank der Theo- rie findet der Physiker mit Sicherheit, ohne Wesentliches aul3er Acht zu lassen oder iJberflussiges anzuwenden, die Gesetze, die ihm zur Losung eines gegebenen Problems dienlich sein konnen. (Duhem I978 (1 906), p. 26-27)
Enzyklopadien gehen noch einen Schritt weiter: sie ermoglichen auch den Nichtspezialisten eine erste allgemeine Orientierung in einem Wis- sensbereich. Eventuell, d.h. nach weiteren Studien, kann diese allge- meine Orientierung zu einem genuinen Wissen ausgebaut werden, das es erlaubt, sich in diesem Wissensbereich selbststandig zu bewegen.
Enzyklopadien, wenn sie denn mehr sein wollen als blot3 alpha- betisch geordnete Sammlungen von Wissensbestanden, haben also eine Struktur. Je nach dem, welche Aspekte man in den Vordergrund stellen will, kann diese Struktur als Geometrie, Geographie oder Archi- tektonik eines Wissensraumes beschrieben werden. Obwohl es manchmal zweckmal3ig ist, zwischen geometrischen, geographischen und architektonischen Aspekten zu unterscheiden, werde im folgenden eine Theorie der Struktur von Wissensraumen kurz als Geometrie be- zeichnet. Eine solche Geometrie bildet den formalen Rahmen einer philosophischen Theorie der moglichen Ordnung des wissen- schaftlichen Wissens. Eine solche Theorie hatte grol3e ~hnlichkeit mit Carnaps Konzeption von Philosophie als Theorie moglicher Sprach- formen, die in den Wissenschaften verwendet werden konnen und dar- uber hinaus in allgemeineren Bereichen, wo man von Wissen sprechen kann. Genauer gesagt, ware eine solche Theorie eine Verallge- meinerung von Carnaps Theorie, da sie nicht nur auf die linguistischen Aspekte der zu reprasentierenden Wissensbereiche abhebt, sondern allgemein auf ihre Struktur. Sie entsprache damit den .ontological fra- meworks", die Carnap in Empiricism, Semantics, and Ontology (Carnap 1950) einfuhrt. Ein wichtiger Unterschied ware der, dass die Erorterung der formalen Strukturen sich nicht beschrankte auf Logik und Mengen- theorie, sondern die Geometrie explizit mit einbezoge.
Zum Abschluss mochte ich vorschlagen, das Thema der enzyklopa- distischen Organisation und Reprasentation des Wissens nicht allein den Historikern zu ijberlassen. Man sollte sich nicht nur uber die rnehr oder minder interessante Geschichte des Enzyklopadiegedankens den Kopf zerbrechen. Es ist nicht abwegig, die franzosische, die osterreichi- sche, und alle Enzyklopadien der Vergangenheit als blol3e Vorlaufer einer wirklich modernen Enzyklopadie anzusehen, die gerade im Ent- stehen begriffen ist. Gemeint ist die Enzyklopadie, die durch die Ver-

58 Thomas Mormann
netzung des Wissens rnithilfe des lnternets dabei ist, Gestalt anzuneh- men. Zur Erhellung der Struktur und Entwicklung dieser neuen Enzyklo- padie haben die traditionelle Episternologie und Wissenschaftsphiloso- phie bisher wenig beigetragen, auch wenn sie fur das zukunftige Wis- sen von aul3erster Wichtigkeit sein wird.
Ohne auf Einzelheiten einzugehen und durchaus an der Oberflache bleibend, wird man behaupten konnen, dass die neue Enzyklopadie die Kategorien von Kodifizierung, Austausch und Verarbeitung des Wis- sens grundlegend verandern wird. Auch wird das Problem der Er- neuerung oder Aktualisierung des Wissens in der neuen Enzyklopadie wesentlich einfacher und befriedigender losbar sein als es sich die klassischen Enzyklopadisten je vorstellen k~nnten.~' Die Eingliederung individuellen Wissens in die neue Netz-Enzyklopadie wird eine Ver- einheitlichung der Terrninologie, die Einfuhrung verbindlicher Stichwor- ter, und andere Mahahrnen zur Standardisierung rnit sich bringen. Allgemein ist klar, dass eine solche Enzyklopadie ohne eine aus- gearbeitete Strukturtheorie nicht funktionieren kann.29 Mit elernentaren Starnrnbaurnen wie in der Encyclopedie oder intuitiven Erlauterungen wie bei Neurath (,,Zwiebelforrn der Enzyklopadie der Einheitswissen- schaft") wird es nicht rnehr getan sein. Das bedeutet nicht, dass die Struktur der neuen Enzyklopadie von ganz anderer Art sein wird als die ihrer Vorgangerinnen. Wie schon in Ausdrucken wie .Cyberspaceu oder .InfosphareU usw. angedeutet, werden auch in der entstehenden neuen Enzyklopadie raurnliche Strukturen im verallgemeinerten Sinne eine zentrale Rolle spie~en.~' Das Moment einer raurnlichen Struktur scheint eine Konstante jeder Art von Wissensdarstellung und -organisation zu sein. Dadurch wird ein Moment (sekundarer) Anschauung erzeugt, das beirn Menschen fur den Besitz von Wissen unverzichtbar zu sein ~cheint.~'
Die Wissenschaftsphilosophie hat in der Vergangenheit den .rnikro- logischenu Problemen der Wissenschaftssprache rninutiose Aufrnerk- sarnkeit geschenkt, wahrend Problerne der globalen Organisation von Wissenschaft weitgehend ignoriert worden sind - ein Beleg dafur ist die Tatsache, dass die enzyklopadistischen Problerne sicher nicht zurn Kernbestand der Wissenschaftsphilosophie gehoren. Die traditionelle Erkenntnistheorie und Wissenschaftsphilosophie sind den praktischen Problemen der ,,Handhabbarkeit", d.h. den Problernen der Territori- alisierung des mundus intellectualis aus dern Wege gegangen. Diese Zuruckhaltung Iasst sich auf die Dauer nicht aufrecht erhalten. Die neue virtuelle Enzyklopadie ist eine Tatsache, die man nicht ignorieren kann

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 59
und die eines der zentralen Themen der Philosophie betrim - das Wis- sen und die Wissenschaften.
Unter den Klassikern der Philosophie des 20. Jahrhunderts scheint mir Carnap, der die Aufgabe der Philosophie in der Konstruktion von Sprachformen erblickte, noch die deutlichste Ahnung davon gehabt zu haben, welchen Aufgaben sich eine wirklich moderne Philosophie des Wissens und der Wissenschaften in Zukunft zu stellen haben wurde.
Bibliographie
d0Alembert, J. Le Rond, 1997 (1 X l ) , Discours preliminaire de I'Encyc- lopedie - Einleitung zur Enzyklopadie, Hamburg.
Bacon, F., 1857-1874, The Works, Collected and edited by J. Sped- ding, R.L. Ellis and D.D. Heath, London. Reprint 1961-1963, Stutt- gart.
Black, J., 1997, Maps and History. Constructing Images of the Past, New Haven and London.
Blumenberg, H., 1985, Prolegomena zu einer Metaphorologie, Frank- furt1Main.
Burke, P., 2000, A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot, Cambridge.
Carnap, R., 1922, Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre, Kant- Studien Erganzungsheft No. 56. Berlin.
Carnap, R., 1927, Eigentliche und uneigentliche Begriffe, Symposion, Zeitschrift fur Forschung und Aussprache, Bd. 1, Heft 4, 355-374.
Carnap, R., 1998 (1928), Der logische Aufbau der Welt, Hamburg. Carnap, R., 1929, Von Gott und Seele. Scheinfragen in Metaphysik und
Theologie, in R. Carnap, Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften, hg. Von T. Mormann, Ham- burg: Meiner 2004.
Carnap, R., 1934 (1968), Logische Syntax der Sprache, Wien. Carnap, R., 1950, Empiricism, Semantics, and Ontologie, Revue de
Philosophie Internationale 4, 20-40. Dahms, H.-J., 1996, Vienna Circle and French Enlightenment - A
Comparison of Diderot's Encyclopedie with Neurath's International Encyclopedia of Unified Science, in E. Nemeth and F. Stadler (eds.), Encyclopedia and Utopia, The Life and Work of Otto Neurath (1 882 - 1945), Vienna Circle Yearbook 4, Dordrecht, 53-62.

60 Thomas Mormann
Darnton, R. 1998 (1979), Glanzende Geschafte. Die Verbreitung von Diderots .Encyclopedien oder Wie verkauft man Wissen mit Ge- winn?, FrankfurtlMain.
Dierse, U., 1977, Enzyklopadie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftstheoretischen Begriffs, Archiv fur Begriffsge- schichte, Supplementheft 2, Bonn.
Duhem, P, 1906 (1978), Ziel und Struktur der physikalischen Theorien, Hamburg.
Galison, P.L., 1997, Image and Logic. A Material Culture of Micro- physics, Chicago and London, The University of Chicago Press.
Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par une societe de gens de lettres. Mis en ordre & publie par M. Diderot, de I'Academie Royale des Sciences & des Belles- Lettres de Prusse; & quant a la Partie Mathematique, par M. D'Alembert, de I'Academie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse & de la Societe Royale de Londres, 1751-1765, Paris.
Goodman, N., 1963, The Significance of Der Logische Aufbau, in P. S. Schilpp (ed.), The Philosophy of Rudolf Carnap, 545-558.
Floridi, L. 1999, Philosophy and Computing. An Introduction, London and New York.
Kusukawa, S., 1996, Bacon's Classification of Knowledge, in M. Pelto- nen (ed.), 25-46.
Mormann, T., 2001, Carnaps Philosophie als Moglichkeitswissenschaft, Zeitschrifi fur philosophische Forschung 55 (1 ), 79-1 00.
Mormann, T. 2004, Geometry of Logic and Truth Approximation, in R. Festa, A. Aliseda, and J. Peijnenburg (eds.), Confirmation, Empiri- cal Progress, and Truth Approximation, Poznan Studies in the Phi- losophy of the Sciences and the Humanities vol. 83, 433-456, Am- sterdam and Atlanta.
Mormann, T., 2005, Carnap's Conventionalism and Differential Topol- ogy, PSA 2004, Proceedings of the 2004 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association.
Neurath, O., 1981, Gesammelte philosophische und methodologische Schriften, Band I und II, herausgegeben von R. Haller und H. Rutte, Wien.
Peltonen, M., 1996, The Cambridge Companion to Bacon (ed.), Cam- bridge.
Poincare, H., 1902, La Science et I'hypothese, Paris. Popper, K., 1934 (1959), Logik der Forschung, Tubingen. Popper, K. 1963 (1 989). Conjectures and Refutations, 5th revised edi-
tion. London.

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 6 1
Sobel, D., 1996, Langengrad, Berlin. Schlogel, K., 2003, Im Raume lesen wir die Zeit. iJber Zivilisations-
geschichte und Geopolitik, Mihchen und Wien. Steiner, G. 2002, Die Grarnmatik der Schopfung, Miinchen und Wien. Steinhart, E. C., 2001, The Logic of Metaphor. Analogous Parts of Pos-
sible Worlds. Synthese Library vol .229, Dordrecht, Kluwer. Tega, W., 1996, Atlases, Cities, Mosaics. Neurath and the Encyclope-
die, in E. Nemeth and F. Stadler (eds.), Encyclopedia and Utopia, The Life and Work of Otto Neurath (1882-1945), Vienna Circle Yearbook 4, Dordrecht, 63-77.
Yeo, R., 2001, Encyclopedic Visions: Scientific Dictionaries and En- lightenment Culture, Cambridge.
Yeo, R., 2002, Managing Knowledge in Early Modern Europe, Minerva 40, 304-314.
Yeo, R., 2003, A Solution to the Multitude of Books: Ephraim Cham- bers's Cyclopedia 1728 as .the Best Book in the Universe", Journal of History of Ideas 64(1), 61-72.
Ziman, J., 1978, Reliable Knowledge. An Exploration of the Grounds for Belief in Science, Cambridge.
Anmerkungen
Hellsichtig bemerkte Diderot im Artikel .Enzyklopadieu der Encyclopedic dam: .Wah- rend die Jahhunderte dahinflieaen, wachst die Masse der Werke unauthorlich, und man sieht einen Zeitpunkt voraus, in dern es fast ebenso schwer sein wird, sich in einer Bibliothek zurecht zu finden wie irn Weltall, und beinahe so einfach, eine fest- stehende Wahrheit in der Natur zu suchen, wie in einer Unmenge von Buchern." Zweihundert Jahre nach Diderot ist dieser Zeitpunkt langst gekornmen. In den sech- ziger Jahren des vorigen Jahrhunderk begann unter Experimentalphysikem die Furcht urnzugehen, in wenigen Jahren werde ein neues Experiment nur noch darin bestehen, ins Archiv zu gehen und die dort gesammelten Magnetbander durch einen Computer unter einem neuen Gesichtspunkt auswerten zu lassen (vgl. Galison . - 199% p. 1). Alles wissen zu wollen' war spatestens im 19. Jahrhundert ein untriigliches Zeichen fijr Dilettantismus. wie Flaubert in seinem .enzvkloaadischen" Roman Bouvard und .. . . Pbcuchet drastisch vorfijhrte. Fur eine Diskussion der verschiedenen Aspekte von Bawns Philosophie siehe Peltonen 1996. Die Titelseite der englischen ijbersetzung (1640) von De augmentis zeigt in einer allegorischen Darstellung die zwei Globen des ,,mundus visibilis" und des "mundus intellectualis", die sich die Hande reichen.

Thomas Mormann
Chambers Cyclopedia war ursprunglich das Vorbild fur die franzosische Encyclope- die, die zunachst als bloke Ubersetzung der Cyclopedia geplant worden war. Aus Griinden der terminologischen Bequemlichkeit mochte ich diese beiden Unter- nehmungen als die "franzosische Enzyklopadie" und die "osterreichische Enzyklopa- die" bezeichnen. Streng genommen, ist dies nicht korrekt: Nach der Encyclopedie Diderots und d'Alemberts gab es in Frankreich andere enzyklopadische Unternehm- ungen, die sich als . ~ n c ~ w ~ e d i e franpiseu bezeichneten, und die ,,osterreichischeU Enzvklo~adie ist weniaer in Osterreich als im US-amerikanischen Exil entstanden. Ich gehe also in dies& Arbeit ohne weitere Begrundung davon aus, dass Metaphern mehr sind (oder zumindest mehr sein konnen) als rhetorische Figuren ohne Er- kenntniswert. In vielen Fallen, so im Fall von Bacons geographischer Metaphorik, besitzen sie erkenntnisleitende Funktionen. Fur eine moderne Darstellung der Logik erkenntnisrelevanter Metaphern konsultiere man z.B. Steinhart (2001). Noch im spaten 20. Jahrhundert (1974) wurde in der Encyclopedia Britannica das Problem einer geeigneten, uber die bloRe alphabetische Ordnung hinausgehende Organisation des Wissens thematisiert: Im Vorwort (.PropaediaU) der 15. Auflage pladierte Mortimer Adler dafur, die Enzyklopadie solle mehr sein als ein "bloker La- gerraumu des Wissens, sondem solle dazu beitragen, die "gesamte Welt des Wis- sens als ein Diskursuniversumu zu begreifen. Er schlug vor, die Einheit des Wissens nicht hierarchisch, sondern kreisformig zu verstehen, so dass man von jeder Stelle des Kreises zu jeder anderen gelangen konne (vgl. Yeo 2001, p. 32). Wie Yeo be- merkt, leistet das aber bereits die alphabetische Ordnung. Neuraths Gegenuberstellung von .Systemu und .Enzyklopadie" ist also wohl nicht so neu und einzigartig, wie oft angenommen wird. Eine Bemerkung zur Terminologie: Gegeben die herkommlichen Bedeutungen von Geometrie, Geographie und Architektonik erweist sich keiner dieser Begriffe als im- mer ass end fur die Beschreibuna der Struktur von Wissensraumen. Fur die Be- schreibung eher deskriptiver ~ s ~ g k t e wird der Terminus ,,geographischU gewahlt, wahrend fur die Erorterung eher theoretischer Aspekte der Ausdruck .GeometrieU Verwendung findet; "~rchitektonik" hingegen soll auf die konstruktiven Aspekte raumlicher Konzeptualisierungen des Wissens verweisen. Bereits bei d'Alembert findet sich also die These, die spater auch von Neurath und Carnap verfochten wurde, namlich dass eine gegebene Enzyklopadie immer nur ei- ne unter vielen moglichen ist. Fur Carnaps Konstitutionstheorie entspricht dies der Behauptung, dass ein Wissensbereich immer auf verschiedene Weise konstituiert oder rational rekonstruiert werden kann. Des weiteren ist zu bemerken, dass dlAlembert ebenso wie Neurath fiir eine enzyklopadische Darstellung des Wissens eine nichthierarchische Struktur zugrunde legte, der es auf die Vielfalt der Verbin- dungen zwischen den Gebieten des Wissens ankommt. Anders ausgedruckt, eine Enzyklopadie verkorpert eher den systematischen Geist als den Geist des Systems. Genau in diesen ,,AnmerkungenU steckt die geometrische Feinstruktur der Encyclo- pedie: Die ,,enzyklopadische Geometrie" besteht in dem Geflecht wechselseitiger Verweisungen, durch die ein einzelner Artikel mit denjenigen Artikeln verbunden ist, auf die er verweist und die auf ihn verweisen. In Carnaps strukturalistischen Konsti- tutionssystemen sollte jeder Begriff allein durch seine Stellung im Gesamtsystem charakterisierbar sein, vgl. Aufbau, § 14. In der Tat versuchte Bacon eine extensionale Interpretation des Stammbaumes seiner Klassifikation der Wissenschaften, wonach dieser das Wissen der ,,prima phi- losophia" reprasentiere, d.h. das allen speziellen Wissensgebieten gemeinsame Wissen. Bacons "prima philosophia" ist jedoch wenig mehr als eine zufallige An- sammlung allgemeiner Prinzipien.

Geographie des Wissens und der Wissenschaften 63
Vgl. dazu die brillanten Ausfijhrungen von Schlogel (2003, p. 81ff.), fijr den geo- graphisch besonders bedeutsamen Begriff der Grenze auch (ebendort, p. 137ff.). Siehe Borges (1954). So plante Neurath fijr die Encyclopedia of Unified Science nicht weniger als 26 Textbande zu je zwei Monographien und 40 Bande mit Graphiken und Diagrammen in ISOTYPE zu veroffentlichen. Dieser Plan wurde allerdings niernals realisiert: Nur die beidan ersten Textbande sind erschienen, von den geplanten ISOTYPE-Banden kein einziger. Die franzosische Enzyklopadie hingegen erschien vollstiindig und ent- hielt. wie oben erwiihnt, mehrere tausend graphische Tafeln (cf. Dahrns 1996, p. 579. Viele Autoren sind bis heute unbekannt, und insgesamt ist die Gmppe der Verfasser von Artikeln fiir die Encyclop6die sehr inhomogen (cf. Damton 1998, p. 26). Das Ergebnis des .Cassiniprojektes', die .Carte gt5omktrique de la France' wurde nach jahrrehntelangen Vorarbeiten 1749 von Jacques Cassini in seinem Discours du meridien veroffentlicht. Die Erstellung dieser ersten ,,modemen" Karte Frank- reichs rnarkierte eine Zasur, und man sprach von ,,avant la carte" und "apres la carte' (siehe Schlijgel 2003, p. 169) Ein sehr anschauliches Beispiel B r Tenitorialisierung als Konstruktion eines geplan- ten Herrschaftsraumes bietet die sogenannte Jefferson-Hartley Karte, die die Grund- lage firr die Erweiterung des US-amerikanischen Territoriums im spaten 18. und fru- hen 19. Jahrhundert bildete, vgl. Schlogel 2003, p. 177. Schlogel bezeichnet diese Karte treffend als .die Matrix der arnerikanischen Demokratie". Dass Kant sich durchaus als der Baconischen Tradition zugehorig empfand, wird belegt durch die Tatsache, dass er der Kn'tik (B) ein Zitat aus der Instauratio Magna voranstellte. In dieser Hinsicht trim er sich merkwurdigerweise mit Neurath: auch dieser war der Auffassung, dass es in den Enzyklopadien durchaus ,,dunklen und nicht karto- graphierte Gebiete geben konnte, die sogenannten Ballungen. Den Optimismus der Aufklarung des 18. Jahrhunderts, alles in ein helles Licht setzen zu konnen, teilte er nicht. Die ldee einer cartesischen Wissenschaft, forrnuliert in einer cartesischen Sprache, deren samtliche Begriffe klar und distinkt definiert waren, erschien Neurath als Pseudorationalismus, d.h. als ein Rationalismus, der die Grenzen seines Terri- toriums uberdehnt. lmmerhin findet sich auch bei Popper die Einsicht in die Bedeutung geometrischer Strukturen fijr Wissensraume: Seine Theorie der Wahrheitsahnlichkeit (Popper 1989) geht davon aus, dass die Differenz zwischen verschiedenen konkurrierenden Theorie als Distanz im geometrischen Sinne aufgefasst werden kann (cf. Morrnann 2004). Im Aufbau machte Carnap keinen Unterschied mischen "Begriff und .Gegenstandu: .Wir konnen ... geradetu sagen, daR der Begriff und sein ~egenstand dasselbe sind. Diese Identitiit bedeutet iedoch keine Substantialisieruna des Beariffs. sondern eher urngekehrt eine .~unktionalisierun~" des ~e~enstandes.' (~utpjau; 5 5). Dies ist wahrscheinlich als eine Anspielung auf Cassirers "Substanzbegriff und Funktions- begriff" (Cassirer 1910) zu deuten. -
24. Diesern Kartencharakter eines Konstiiutionssystems haben die meisten Interpreten des Aufbau wenig Bedeutung beigemessen. Eine Ausnahme ist Goodman, der bereits 1963 feststellte: ,,The function of a constructional system is not to recreate experience but rather to map it." (Goodman 1963, p. 552).
25. Fiir den Neukantianer Cassirer wurde es bekanntlich zum leitenden Paradigma seiner gesarnten Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie (cf. Cassirer 1910).

64 Thomas Mormann
26. Meiner Meinung nach begeht Carnap in seiner Interpretation Poincares einen fund- amentalen mathematischen lrrtum (cf. Mormann 2005). Darauf kommt es fur das folgende jedoch nicht an, es genugt, dass Poincares Beispiel fur Carnaps Erkennt- nis- und Wissenschaftstheorie eine entscheidende Rolle gespielt hat (ob sich dies einem Missverstandnis verdankt oder nicht, ist gleichgultig): der (vermeintlich durch die Autoritat Poincarhs gedeckte) geometrische Konventionalismus dient als Para- digma fur seinen logischen und linguistischen Konventionalismus, wie er etwa im ,,Toleranzprinzipu zum Ausdruck kommt.
27. Neurath selbst verwendete fur die Eriauterung des Begriffs der Enzyklopadie eine Reihe von Bildern wie .GebaudeU, .Mosaik", .RahmenU, .polyzentrische Stadt" usw. (cf. Tega 1996). Alle diese Bilder schopfen offenbar aus der Geometrie, der Geogra- phie oder der Architektonik und bestatigen so den raumlichen Charakterder enzyklo- padischen Reprasentation des Wissens.
28. Die iibliche Methode, einer abgeschlossenen Enzklopadie post festum ,,Supple- mente" hinterher zu schicken, wurde immer als unbefriedigend empfunden.
29. Dass die Strukturierung des lntemets noch vie1 zu wunschen ubrig Iasst, weiR jeder Benutzer zur Genuge. In einem Buch von Floridi, auf das ich erst nach Fertigstellung dieser Arbeit gestoRen bin, wird diese Tatsache drastisch so ausgedruckt: ,,The In- ternet has been described as a library where there is no catalogue, books on the shelves keep moving and an extra lorry load of books is dumped in the entrance hall every ten minutes." (Floridi 1999, p. 85/86).
30. Siehe auch Floridi (1999, p. 130): .... a whole new vocabulary develops, one based on extensional concepts borrowed from the various sciences of space: cartography, geography, topology, architecture, set theory, geology, and so forth."
31. Dies deutet darauf hin, dass Aristoteles Recht haben konnte, der als Hauptmotiv des Strebens nach Wissens das Bedurfnis nach visueller Erfahrung ausmachte: ,,Nicht blot3 urn handeln zu konnen, ziehen wir das Sehen sozusagen allem anderen vor. Der Grund ist, dass diese Sinneswahrnehmung uns am meisten Kenntnisse ver- mittelt und viele Eigentiimlichkeiten der Dinge offenbart." (Met. A, 980')

DOMlNlQUE LECOURT
L'ENCYCLOPEDIE VUE PAR DIDEROT
Je ne resiste pas au plaisir de vous lire ce qu'ecrit Diderot de son en- gagement avec D'Alembert en 1747 dans le projet de I'Encyclopedie:
J'arrive a Paris. J'allais prendre la fourrure et m'installer parrni les docteurs en Sorbonne. Je rencontre sur mon chemin une femme belle comme un ange; je veux coucher avec elle, j'y couche, j'en ai quatre enfants; et me voila force d'abandonner les rnathematiques que j'airnais, Homere et Virgile que je portais toujours dans ma po- che, le thestre pour lequel j'avais du goirt; trop heureux d'entreprendre I'Encyclopedie a laquelle j'aurai sacrifie vingt-cinq ans de ma vie.
Ce sacrifice, celui qu'on appelait de son temps (( Le Philosophe D aura ete le seul a faire jusqu'au bout, contre vents et marees - quitte ou trahi par ses amis, a commencer par D'Alernbert lui-rnQme, qui, apres les rernous suscites par son article (( Geneve )) en 1757, abandonne I'animation de I'ouvrage, tout en continuant a lui fournir des articles de mathematiques et de physique, puis Grimm, puis Madame Necker et bien d'autres, des lors que I'entreprise aura ete interdite. Ce sacrifice en valait-il intellectuellement la peine? D'aucuns lui imputent la preten- due absence d'oeuvre personnelle de Diderot oubliant tous les textes ecrits parallelement oir s'exprime son genie propre; et negligeant de lire les contributions propres de Diderot au grand Dictionnaire. Sa perseve- rance, son courage, donnent en realite a penser qu'il ne s'est nullement agi pour lui d'une oeuvre annexe dans laquelle il ne se serait absorbe comme a contrecoeur que pour des raisons alirnentaires comme il le donne ici a entendre par goat du jeu d'esprit.
Si le projet d'abord ne lui appartient pas, il se I'approprie en fait rapidement. Par ses interventions personnelles, ses propres contribu- tions, ses suggestions, ses corrections, il lui a donne une allure particu- liere assez eloignee sans doute de celle que h i aurait conferee la direc- tion du seul D'Alernbert. Dans I'article ENCYCLOPEDIE (tome V, 1755) de I'ouvrage, il commente sa propre demarche et thematise sa position. II serait instructif de confronter systematiquement le contenu de cet article a celui du (( Discours preliminaire D. A lire les premieres lignes, mise a part une etymologie approximative qui traduit sans sourciller

6 6 Dominique Lecourt
pai'deia par connaissance D, la presentation du but de I'Encyclopedie semble repondre fidelement au Discours:
Le but d'une encyclopedie est de rassembler les connaissances eparses sur la surface de la terre; d'en exposer le systeme general aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hom- mes qui viendront apres nous; afin que les travaux des siecles pas- ses n'aient pas ete des travaux inutiles pour les siecles qui succe- deront; que nos neveux, deviennent plus instruits, deviennent en mQme temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mour- rions pas sans avoir bien merite du genre humain.
Tout change cependant lorsqu'on en vient a la question cruciale de I'ordre de I'ouvrage. Le (( Discours )) croit pouvoir justifier la presence de Francis Bacon au frontispice de I'ouvrage en rapportant I'ordre des matieres a celle des facultes de I'&ne - au mepris de la realite mQme du texte oic cet ordre n'apparait nullement. Dans I'article ENCYCLOPEDIE, c'est comme en passant qu'il y est fait allusion, comme a une evidence a rappeler! II apparait au fil du texte que Diderot a une tout autre vue de I'Encyclopedie. LIEncyclopedie doit donner une image de I'univers; (( tout s'y enchaine et s'y succede par des liaisons insensibles D. Ce qui lui importe, c'est que par principe I'Encyclopedie soit une, parce que le monde physique et humain est un.
Mais, Diderot sait bien que cette unite est ideale. I1 faudrait pouvoir acceder au point de vue du Createur pour I'apprehender completement. Ce qui ne nous est pas possible. Nous sommes donc condamnes au lacunaire.
Sommes-nous pour autant voues au decousu, a I'epars, au dispa- rate - les mots qui reviennent sous la plume de Diderot ? Non, car s'il n'y a pas de deduction lineaire possible, il y a la possibilite pour notre point de vue humain de faire transparaitre I'unite de I'ceuvre (donc aus- si I'unite de I'univers). Et comment? Essentiellement en multipliant les renvois, cc les uns des choses et les autres des mots D. D'autres encore (( auxquels it ne faut pas s'abandonner completement )) qui sont de nature (( analogique D. D'autres enfin satiriques et epigrammatiques. Comme celui de (( cordeliers )) a (( capuchon )) qui tempere d'un eclat de rire I'eloge des franciscains un peu trop force dans le premier. Belle formule: les renvois, c'est (( I'art de deduire tacitement les consequen- ces les plus fortes B.

L'EncyclopBdie vue par Diderot 67
Par le rnoyen de I'ordre encyclopedique, de I'universalite des connaissances et de la frequence des renvois, les rapports aug- rnentent, les liaisons se portent en tout sens, la force de la dernons- tration s'accroit, la nomenclature se complete, les connaissances se rapprochent et se fortifient; on aperqoit la continuite ou les vides ... .
Ce que Diderot ecrit ici des renvois, renvoie a ce qu'il dit par ailleurs du genie dans ses Pensees sur I'interpretation de la nature lorsqu'il quali- fie le genie par son esprit de cornbinaison D, et cet enthousiasrne qui (( rapproche les analogies les plus eloignees D. On connait les premie- res lignes de I'article THEOSOPHES qui tout entier devrait dissuader de ranger Diderot parrni les rationalistes classiques.
Voici peut-Qtre I'espece de philosophie la plus singuliere. Ceux qui I'ont professee regardaient en pitie la raison hurnaine . .. Les theo- sophes ont passe pour fous aupres de ces hornrnes tranquilles et froids dont 112rne pesante ou rassise n'est susceptible ni d'ernotion ni d'enthousiasrne, ni de ces transports dans lesquels I'hornrne ne voit point, ne sent point, ne parle point, cornrne dans son etat habi- tuel. Ils ont dit de Socrate et de son demon que si le sage de la Grece y croyait, c'etait un insense, et que s'il n'y croyait pas, c'etait un fripon. Me sera-t-il perrnis de dire un mot en faveur du demon de Socrate et de celui des Theosophes?
Et dans I'article ECLECTISME :
Quel est I'effet de I'enthousiasrne dans I'hornrne qui en est trans- porte, si ce n'est de lui faire apercevoir entre des Qtres eloignes des rapports que personne n'y a jarnais vu, ni suppose. A quel resultat ne sera point conduit un philosophe qui poursuit I'explication d'un phenornene de la nature a travers un long enchainernent de conjectures?
Ce qu'il irnporte de rnontrer ce sont les rapports - lesquels s'inscrivent toujours dans un systerne de rapports. D'oir la presentation qu'il donne de I'Encyclopedie par rnetaphores: elle est comparable a un arbre, a une rnappernonde, a une vile dont il ne (( faudrait pas construire toutes les rnaisons sur le rnQrne rnodele )), a (( une carnpagne immense cou- verte de rnontagnes, de plaines, de rochers, d'eaux, de forQts,

68 Dominique Lecourt
d'animaux et de tous les objets qui font la variete d'un grand paysage D.
Aux renvois de I'editeur, s'ajouteront les renvois spontanes des lecteurs. L'ceuvre aura ainsi une unite vivante. Elle sera, noble et an- cienne analogie, (( livre du monde )). Mais cette analogie est ici deve- loppee en un sens original. Le monde est en effet, explique Diderot, plein de lacunes et de disparates. II faut observer, decrire, enregistrer. Mais pourquoi? Parce qu'a ce prix nous pourrons voir I'intervalle qui separe les phenomenes (( se remplir successivement par des pheno- menes intercales B. (( II en naitra une chaine continue. Les systemes d'abord isoles, se fondront les uns dans les autres en s'etendant D.
A I'esprit de systeme du 18'"'~ siecle, IIEncyclopedie substitue ainsi un nouvel esprit qui cherche a cc dresser I'inventaire de nos connais- sances, a realiser notre avoir afin de le mieux exploiter )). Dans I'Essai sur les regnes de Claude et Neron (5 97), Diderot reflechissant sur les (( questions naturelles )) de Seneque en vient a des formules sembla- bles. (( Observer les phenomenes, les decrire et les enregistrer, voila le travail preliminaire; et plus on y sacrifiera de temps, plus on approchera de la vraie solution du grand probleme qu'on s'est propose ... D. Suit une nouvelle reference a Bacon: il faut questionner la nature puisqu'en physique il ne s'agit pas de ce qui s'est passe (( dans la tgte du physi- cien mais de ce qui se passe dans la nature D. Mais si elle ne repond pas?, demandera-t-on. Alors il faut (( suppleer a son silence par une analogie, par une conjecture D. Et ce sera (( rQver ingenieusement, grandement, si I'on veut, mais ce sera rQver; pour une fois oir I'homme de genie rencontrera juste, cent fois il se trompera . . . )).
L'ordre de IIEncyclopedie n'est donc pas pour I'essentiel celui d'une recapitulation mais celui d'un mouvement et un mouvement aventureux oir rien n'est garanti d'avance. Celui-ci va de I'epars (decousu, dispa- rate) vers une profonde unite. Mais une unite vivante, une force qui ouvre I'ceuvre sur son dehors - a commencer par les autres textes de Diderot lui-m9me, textes passes ou a venir (cf. Jacques Proust dans sa these sur la Philosophie de I'homme chez Diderot). Nous voici vraiment tres loin de I'idee d'une sornme. Beaucoup plus proche au demeurant de ce Francis Bacon celebrant le plaisir et le goQt de I'innovation et de la demarche par analogies, si different du Bacon cartesianise dont D'Alembert et les Lumieres fran~aises ont compose le portrait quelque peu caricatural.
Mieux: ce mouvement, parce qu'il est ouvert sur I'exterieur du monde des livres et qu'il prend en compte des realites comme I'agriculture ou les manufactures de bas, est destine a voir rapidement

L'EncyclopBdie vue par Diderot 69
certains articles perirnes. Ce que Diderot prevoit expressement. Cette reflexion occupe mQme plusieurs paragraphes de quelque Btendue dans I'article ENCYCLOPEDIE. Tel est le monde que doit refleter I'Encyclopedie: unite dans une multiplicite infinie (( sans presque au- cune division fixe et determinee N [. . .I.
Tout s'y enchaine et s'y succede par des nuances insensibles. Et a travers cette informe irnmensit4 d'objets s'il en apparait quelques uns qui, comrne les pointes des rochers, semblent percer la surface et la dominer, ils ne doivent cet avantage qu'a des systemes parti- culiers.
L'ordre de I'Encyclopedie, c'est (( I'enchahement des idees ou des phenornenes D qui en dirige la marche. Ce qui la rapproche des traites scientifiques: Dans les traites scientifiques, c'est I'enchainement des idees ou des phenomenes qui dirige le monde ... II en sera de mQme dans I'Encyclopedie D. Par les (( rapprochements N que cet ordre sug- gere, elle pourra a I'occasion produire des connaissances nouvelles.
C'est cet ordre encore qui determine le style de I'ouvrage. Un style qui doit tourner le dos a la scolastique; renoncer donc a I'expose sys- tematique; pas de more geometric0 chez Diderot. Un style qui doit par ailleurs se garder du N be1 esprit B. Diderot vise Fontenelle et Voltaire. Un style clair qui cependant doit a I'occasion savoir (( instruire et tou- cher B, comme hi-mQme s'y entend.
Diderot denonce I'indulgence qu'on a pour le style des grands livres et surtout des Dictionnaires. II insiste: I'Encyclopedie doit Qtre (( bien ecrite >). De fait, mQme dans les articles de seconde main, il varie non seulement le vocabulaire mais les tons. Passant du farnilier, au soutenu et au sublime.
Yvon Belavai dans ses Etudes sur Diderot (Paris: Presses universi- taires de France, 2003) en donne quelques exernples savoureux. Iro- nie: a L'Alcatrace est un oiseau "si ma1 defini qu'on ne risque pas de le trouver" )) . . . Les Bgouins (( font assez peu de cas de leur genealogie, pour celle de leurs chevaux, c'est tout autre chose w . Le ton soutenu est celui par exemple de I'article ART tout du long. Diderot ne se refuse mQme pas les sentences du type: (( je ne connais rien d'aussi machinal que I'homrne absorbe dans une meditation profonde, si ce n'est I'homme plong6 dans un profond sommeil B.
L'Encyclopedie de Diderot est ainsi - doit gtre - une realite vi- vante. II ne se lasse pas de le rappeler. Mais on n'a peut-8tre pas as- sez reflbchi a ce qu'enveloppait sous sa plume ce qualificatif de << vi-

7 0 Dominique Lecourt
vant )) ainsi applique. La lecture des Elements de physiologic, ouvrage sur lequel il n'a cesse de travailler, le montre indiscutablement non comme I'un parmi les philosophes materialistes du siecle, mais comme un <c materialiste vitaliste D. Et par ce vitalisme, Diderot apparait certai- nement plus proche encore de Leibniz qu'il ne I'est de Bacon. Le Leib- niz dont les projets encyclopediques hantent visiblement le texte de I'article (< Encyclopedie )) de L'Encyclopedie.
L'Encyclopedie a-t-elle rempli son objectif? Creant un cercle dans lequel I'ensemble du monde connu est represente, a-t-elle en particulier reussi a faire voisiner des techniques jusqu'alors autarciques? A-t-elle ainsi, en decloisonnant les corporations, permis a des inventions d'en susciter d'autres? Etait-il juste de penser que cette mission etait celle des (( gens de lettres D? II y a peut-4tre lieu de suivre ici Gilbert Simon- don qui suggere que ce n'est pas en fait par le contenu de I'expose qu'elle a represente une revolution intellectuelle, mais parce qu'elle a incite les meilleures plumes de son temps a ecrire sur des sujets qui leur etaient etrangers. L'Encyclopedie de Diderot donne effectivement un exemple unique d'une grande litterature technique integree dans la culture generale. Mais ne doit-on pas considerer que cette reussite - car c'en fut une - etait celle d'un moment historique exceptionnel, voue a rester sans lendemain. On a fait remarquer que I'Encyclopedie me- thodique de Panckoucke - la suivante - comporte 166 volumes et si- gne pour deux siecles et plus la dissociation des realisations techni- ques et de la culture generale. Une reintegration est-elle aujourd'hui possible? Peut6tre, des lors que les techniques d'information et de communication modifient - et pour la dynamiser en un sens ou en un autre - la dite culture generale. Peut-gtre encore des lors que les bio- technologies reveillent des interrogations sur la nature humaine dont I'idee m4me de culture generale se trouve indirectement tributaire!
Reste une question qui va nous mener a I'actualite la plus imme- diate: les planches, les celebres planches de I'Encyclopedie. On sait ce qu'on a pu en dire: qu'elles presentaient un etat deja tres ancien des techniques et des machines. Mais peu importe. Car c'est I'idee des planches qui est interessante: que les images sont plus adaptees que les mots pour communiquer une information technique. Mais on voit tout de suite a les feuilleter la difficulte sur laquelle est venu buter Dide- rot: une image ne peut souligner en elle ce qui est important. D'oir comme I'a tres bien souligne Pascal Chabot dans un ouvrage recent sur La philosophie de Simondon (Paris: J. Vrin, 2003) - c'est-a-dire sur un descendant de Diderot - I'utilisation d'un artifice graphique: les peti- tes mains coupees qui voltigent sur les pages en pointant ce qui est

LfEncyclopBdie vue par Diderot 7 1
remarquable. Des mains qui avaient, comme sur nos ordinateurs ac- tuels, fonctions d'indication, (( organes d'un savoir sur les techniques. Elles apparaissent comme deleguees par la raison qui s'introduit dans les techniques jusqu'a transformer les machines en des raisonne- ments )).
Tournons-nous vers I'article BAS qui traite de la machine a faire les bas. Diderot dit qu'(( on peut la regarder comme un seul et unique rai- sonnement P. Roland Barthes: (< ce qui frappe dans toute I1Encyclo- pedie, c'est qu'elle propose un monde sans peur ... D. Un monde fami- lier anterieur a la revolution industrielle, oh la science newtonienne deployait ses succes a echelle humaine oh ne s'etait pas encore glis- see la defiance qui nous assaille devant les prouesses de la (( pheno- menotechnique n et les realisations de la (( technoscience D. Pour sur- monter et maitriser cette defiance qui vire souvent au catastrophisme, comment ne pas ressentir la necessite d'un mouvement du type de celui que Diderot s'est epuise a organiser et entretenir. Un mouvement d'hommes libres ne visant que le bien commun du genre humain, dans leur emulation meme.

PIERRE WAGNER
L'ENCYCLOPEDIE DE DIDEROT ET D'ALEMBERT EST-ELLE L'EXPRESSION D'UNE CONCEPTION SClENTlFlQUE DU MONDE?
L'Encyclopedie editee par Diderot et d'Alembert est-elle I'expression d'une conception scientifique du monde? Si par cette expression on entend la "wissenschaftliche Weltauffassung" dont il a ete question dans le Cercle de Vienne, alors il faut bien reconnaitre que la reponse a cette question est clairement negative. Quel sens faudrait-il donner a I'expression pour qu'elle puisse s'appliquer a I'Encyclopedie? A y re- garder de pres, on s'aperqoit assez rapidement qu'il faudrait lui donner un sens si vague et si general que son application a I'ouvrage de Dide- rot et d'Alembert perdrait beaucoup de son inter&. Ce qui est digne dlinterQt, en revanche, ce sont les raisons pour lesquelles cette ques- tion doit recevoir une reponse negative. A cet egard, un detour ana- chronique par I'idee de "wissenschaftliche Weltauffassung" se revele Qtre eclairant pour la comprehension de certaines questions qui concernent I'Encyclopedie elle-mQme.
Lorsque les membres du Cercle de Vienne ont defendu I'idee d'une conception scientifique du monde (notee CSM desormais), ils se sont referes a l'esprit des Lumieres, et parfois explicitement a IIEncyclopedie de Diderot et d'Alembert. Dans ce qui suit, nous ne cherchons cepen- dant pas a faire une comparaison systematique entre I'Encyclopedie du dix-huitieme et la CSM du vingtieme siecle. La question de savoir si I'encyclopedie est I'expression d'une CSM sera seulement, ici, I'occasion d'apporter quelques precisions sur ce qu'il convient d'entendre par "sciencen dans I'ouvrage qu'ont dirige Diderot et dlAlembert, et sur la maniere dont les encyclopedistes concevaient la science et son rapport a la philosophie. Notre but n'est pas de determi- ner si c'est a tort ou a raison que les defenseurs de la CSM ont fait reference a IIEncyclopedie (cela exigerait de comprendre precisement en quel sens ces references ont ete faites); il s'agit plut6t d'eclairer un point qui concerne proprement I'ouvrage qu'ont dirige Diderot et d'Alembert: y a-t-il quelque chose comme une conception generate de la science, une philosophie de la science qui se degage de cet ou- vrage? Si oui, quelle est-elle? L'examen de la CSM, dans ce qui suit, n'a pas d'autre but que de fournir un detour commode pour eclairer ce point.

74 Pierre Wagner
Bien que la CSM ait ete decrite, illustree et defendue dans de nom- breux textes, il n'est pas tres facile de la caracteriser de maniere pre- cise, d'une part parce que les auteurs qui ont defendu cette conception n'en avaient pas toujours exactement la mQme idee, et d'autre part parce que les implications de cette conception ont beaucoup evolue, entre 1929 et 1936.
Je me contenterai de souligner quelques-uns des traits dominants de la CSM tels qu'ils apparaissent dans le "Manifeste du Cercle de Vienne" de 1929, ou dans les textes de Schlick, Hahn, Neurath et Frank parus dans le premier volume de la revue Erkenntnis en 1930. Lorsqu'on releve ces traits, il n'est pas difficile de voir quelles sont les idees caracteristiques de IIEncyclopedie avec lesquelles ils peuvent Qtre mis en correspondance; on pourrait mQme avoir I'impression de comprendre pourquoi les empiristes logiques se sont referes a l'esprit des Lumieres et ont parfois explicitement mentionne I'Encyclopedie (bien que les principales references a IIEncyclopedie, notamment sous la plume de Neurath, apparaissent plus tard, lorsque se developpe le projet d'une encyclopedie de la science unifiee).
1. L'unite de la science et I'ordre du savoir
Selon les auteurs du Manifeste du Cercle de Vienne la CSM vise la science unitaire. II s'agit mQme de I'une des premieres determinations qu'ils en donnent. Celle-ci se caracterise non par une these, celle de I'unite de la science, mais par une direction de recherche, un point de vue, une attitude qui visent a relier et harmoniser les travaux particu- liers des chercheurs dans les differents domaines de la science. A cette epoque, le probleme de I'unite etait pose de maniere explicite et il etait I'objet de debats dans nombre de sciences particulieres: se posaient notamment le probleme de I'unite des mathematiques, celui de I'unite de la physique, celui des liens entre les sciences de I'esprit et les sciences de la nature, ou encore entre les sciences formelles et les sciences du reel. Mais c'est au sujet de la science dans son ensemble que les tenants de la CSM soulevent la question. Les empiristes logi- ques ont emprunte differentes voies pour tenter de parvenir a cette unite de la science.
II n'est pas difficile de trouver dans I'Encyclopedie une visee qui semble a premiere vue tout a fait similaire a la recherche de I'unite de la science telle qu'elle s'exprime dans les premieres decennies du ving- tieme siecle au sein mQme des sciences puisque Diderot et d'Alembert

L'EncyclopBdie de Diderot et dlAlembert 75
ont explicitement cherche les moyens d'ordonner I'ensemble du savoir de maniere systematique. Ce probleme de la recherche d'un systeme de toutes les connaissances est souleve, par exemple, dans le Dis- cows preliminaire, dans I'article (( Elements des sciences n ou dans I'article redige par Diderot pour I'entree (( Encyclopedie n. Dans le Dis- cours preliminaire, dlAlembert traite assez longuement de I'ordre ency- clopedique des connaissances. II est cependant remarquable et tout a fait significatif que le mot "unite n'ait pas une seule occurrence, ni dans le Discours preliminaire ni dans I'article (( Elements des sciences )). Dans ces textes, il est question du "systeme de nos connaissances", des "branches de ce systemen, de ses "divisions", ou encore de "I'ordre encyclopediquen, de I1"arbre de nos connaissances", mais pas de I'unite de la science en tant que telle.
Cela ne signifie pas qu'une certaine forme de la question de I'unite ne soit pas posee, mais il importe de determiner en quel sens precis le probleme est souleve. Diderot et dSAlembert posent effectivement le probleme du lien, ou plutdt des liens qui existent entre les connaissan- ces, ou entre les sciences. Mais ce n'est pas pour autant que leur re- cherche porte sur la question de savoir quelle est I'unite du savoir au sens oir cette question se posait au debut du vingtieme siecle. Pour les encyclopedistes, il s'agit de savoir comment ordonner I'ensemble des connaissances, et comment diviser cet ensemble.
Les solutions que Diderot et d'Alembert apportent a ce probleme presentent deux caracteristiques remarquables:
a) II n'y a pas une solution, mais plusieurs; on peut mQme dire que les editeurs de I'Encyclopedie se plaisent a multiplier les ordres ou les systemes. Voici en effet ce qu'on peut lire dans le Discours prelimi- naire: "On peut donc imaginer autant de systemes differents de la connaissance humaine, que de mappemondes de differentes projec- tions; et chacun de ces systemes pourra mQme avoir, a I'exclusion des autres, quelque avantage particulier."
A cet egard, il est tout a fait significatif que I'ordre de presentation des articles soit I'ordre alphabetique, qui est, du point de vue de la connaissance, un ordre aleatoire. Lorsque Panckoucke s'engage dans la publication de I'Encyclopedie methodique et par ordre de matieres (1772-1832), il subvertit profondement I'esprit de I'ouvrage original en imposant un systeme de la connaissance. L'interQt de I'ordre alphabeti- que est qu'il ne fige pas I'ensemble en un systeme; il rend possible la projection de multiples ordres qui sont introduits par d'autres moyens. Au nombre de ces moyens, on compte notamment:

7 6 Pierre Wagner
i) le systeme figure des connaissances humaines, qui forme un grand tableau au debut de I'ouvrage. C'est au sujet de ce systeme que dlAlembert dit que de nombreux autres choix eussent ete possibles.
ii) ce que Diderot et d'Alembert appellent "le systeme des renvois", qui donne a I'ensemble de I'ouvrage une structure comparable a celle d'un graphe au sens mathematique du terme.
iii) I'ordre genealogique des connaissances, dont la presentation occupe la premiere grande partie du Discours preliminaire. Diderot, dans I'article (( Encyclopedie )), et d'Alembert, dans le Discours preliminaire, exposent egalement d'autres moyens utilises dans I'ouvrage pour multiplier les systemes de mise en ordre des connais- sances.
b) Les solutions apportees au problerne d'un systeme des connais- sances presentent une seconde caracteristique remarquable: le pro- bleme des liens entre les connaissances ou entre les sciences est sou- vent conry cornme la recherche d'un parcours. Or ce parcours ne pre- tend ni posseder I'objectivite que pourrait h i conferer un systerne logi- que, ni Qtre une image ou un miroir de la realite: il cherche a repondre a la question de la voie, du chemin que pourrait suivre celui qui a la vo- lonte de s'instruire et de prendre possession de ces connaissances. C'est ce que montre a I'evidence le systeme des renvois. DJAlembert utilise plusieurs fois I'image d'une carte, ou d'une mappemonde du savoir qui doit permettre a chacun de parcourir le reseau des connais- sances selon une trajectoire qui h i est propre. "Le systeme general des sciences et des arts est une espece de labyrinthe, de chemin tortueux, oC I'esprit s'engage sans trop connaitre la route qu'il doit tenir'." L'ordre encyclopedique ne pretend pas donner la clef d'un systeme de la science. II consiste "a rassembler 'les connaissances' dans le plus petit espace possible, et a placer, pour ainsi dire, le philosophe au-dessus de ce vaste labyrinthe dans un point de vue fort eleve d'oC il puisse apercevoir a la fois les sciences et les arts principaux2". II s1agit bien de multiplier, pour chacun, les possibilites de trouver une voie qui lui convienne pour s'instruire: "celui de tous les arbres encyclopediques qui offrirait le plus grand nombre de liaisons et de rapports entre les sciences, meriterait sans doute dJQtre prefere.3
2. Critique de la metaphysique et des systemes.
II y a un second trait de la CSM qui se prQte assez bien a un rappro- chement, ou plut6t a une tentative de rapprochement avec I'Ency-

L'EncyclopBdie de Diderot et dlAlembert 7 7
clopedie; il s'agit de la critique de la metaphysique. L'un des points sur lesquels les empiristes logiques du Cercle de Vienne etaient largement d'accord entre eux concerne la critique des philosophes qui pretendent acceder a des connaissances par des moyens qui ne sont pas ceux de la science, par exemple en faisant appel a une intuition qui permettrait, selon eux, d'atteindre des objets ou des verites qui restent inaccessi- bles par les moyens empiriques et discursifs de la science. La critique que les empiristes logiques font de ce genre de methode philosophique consiste a dire qu'au moment ou ces philosophes croient faire acte de connaissance selon une methode qui leur est propre, ils ne font que produire des enonces qui en realite sont depourvus de toute significa- tion cognitive. II s'agit la d'un des traits les plus connus de la CSM et certainernent celui sur lequel il est le rnoins utile de s'attarder. Voyons donc directement s'il est possible de trouver, dans IIEncyclopedie, des textes qui correspondent a cette critique de la rnetaphysique.
De fait, les encyclopedistes ne prennent qu'assez rarement le mot "metaphysique" en mauvaise part, et il existe bien, selon eux, une connaissance rnetaphysique qui est tout a fait legitime. Mais cette re- marque ne doit pas cacher qu'il existe egalement, dans I'Encyclopedie, une veritable critique, sinon de la metaphysique en tant que telle, du moins d'une certaine forme de metaphysique: celle des systemes ratio- nalistes qui sont, aux yeux de dlAlembert comrne de Diderot, de verita- bles romans de la raison. Ce qui est critique - notamment dans un celebre passage du Discours preliminaire - c'est I'esprit de systeme, que d'Alembert appelle aussi "I'esprit d'hypothese et de conjecture" et qu'il depeint d'une maniere clairement pejorative dans I'expression suivante: "le gofit des systemes, plus propre a flatter I'imagination qu'a eclairer la raisonn. L'usage des hypotheses est loin d'Qtre illegitime aux yeux des editeurs de I'Encyclopedie; ce qui est critique est plut6t I'echafaudage de systemes bitis sur des hypotheses abstraites, tres eloignees de I'experience. Voici ce qu'on peut lire a I'article (( Metaphy- sique n: "Quand on borne I'objet de la metaphysique a des considera- tions vides et abstraites sur le temps, I'espace, la matiere, I'esprit, c'est une science meprisablen; I'auteur de cet article ajoute cependant: "mais quand on la considere sous un vrai point de vue, c'est autre chose. II n'y a guere que ceux qui n'ont pas assez de penetration qui en disent du mal".
MQme si les encyclopedistes, contrairement aux partisans de la CSM ne pouvaient pas utiliser les decouvertes de la logique moderne pour critiquer la metaphysique comme depourvue de sens, on retrouve bien dans I'Encyclopedie une critique de la signification des systemes

7 8 Pierre Wagner
rnetaphysiques, par exernple au travers de I'eloge d'une analyse claire des concepts ou notions. Dans I'article (( ~lernents des sciences D, d'Alembert introduit I'idee d'une metaphysique des propositions. Voici ce qu'il en dit:
Cette rnetaphysique, qui a guide ou dQ guider les inventeurs, n'est autre chose que I'exposition claire et precise des verites generales et philosophiques sur lesquelles les principes de la science sont fondes. Plus cette rnetaphysique est simple, facile, et pour ainsi dire populaire, plus elle est precieuse; on peut rnQrne dire que la simplicite et la facilite en sont la pierre de touche.
A cette metaphysique simple et facile, d'Alembert oppose, pour la criti- quer, "la rnetaphysique obscure et contentieuse", celle qui pretend por- ter sur la nature des choses independarnrnent des faits, cornme c'est le cas lorsque les philosophes s'opposent sur des questions comrne celle de la nature du mouvernent, alors que toutes les ecoles s'accordent sur les verites de la geornetrie.
3. La necessite, pour la connaissance, de recourir a I'experience
II existe un troisieme trait rnarquant de la CSM qu'il est possible de rnettre en correspondance avec des idees caracteristiques de IIEncyclopedie qui semblent sirnilaires, au rnoins a premiere vue, a savoir la necessite pour la connaissance de recourir a I'experience et aux faits. Les partisans de la CSM defendent avec insistance I'idee selon laquelle il n'y a pas de connaissance par la pensee pure; pour eux, la signification des enonces depend directement de la rnaniere dont ils sont susceptibles d'Qtre, sinon verifies, du rnoins testes par I'experience.
La possibilite d'associer ce principe aux idees qu'on trouve dans IIEncyclopedie est directernent liee au point precedent, celui qui concerne la critique des systemes du rationalisme classique. Bien que d'Alernbert defende lui-mQme une forrne de rationalisrne, et qu'il doive beaucoup a la philosophie de Descartes, il rejette neanrnoins I'idee cartesienne selon laquelle les elements des sciences consisteraient en verites de la raison auxquelles nous pourrions avoir acces par la "lu- rniere naturellen, de rnQrne qu'il rejette le systeme des idees innees. D'Alernbert pense que les propositions qui forment les elements des sciences peuvent Qtre prouvees par une analyse des faits. Ainsi donne-

L'EncyclopBdie de Diderot et d'Alembert 7 9
t-il une preuve des principes de la mecanique (par exemple la loi d'inertie) en partant des faits pertinents pour cette science.
Quels sont dans chaque science les principes d'ou I'on doit partir? des faits simples, bien vus et bien avoues; en physique I'observation de I'univers, en geometrie les proprietes principales de I'etendue, en mecanique I'impenetrabilite des corps, en meta- physique et en morale I'etude de notre i m e et de ses affections, et ainsi des autres. (article G ~lements des sciences n).
On connait aussi le celebre passage du debut du Discours preliminaire: "Toutes nos connaissances directes se reduisent a celles que nous recevons par les sens; d'ou il s'ensuit que c'est a nos sensations que nous devons toutes nos idees." La critique, par d9Alembert, du "sys- teme des idees innees" peut Qtre consideree comme I'une des conse- quences des idees qui sont ainsi exprimees.
Un autre aspect de la necessite d'ancrer nos connaissances dans I'experience pour ne pas Qtre conduit a bitir des romans de la raison ou des systemes vides est illustre par la celebre querelle des newto- niens et des cartesiens, qui tourne definitivement a I'avantage des new- toniens lorsque la mecanique de Newton est confirmee de maniere eclatante par plusieurs evenements marquants de I'histoire des scien- ces comme les resultats des missions geodesiques menees au Perou (en 1735 par La Condamine et d'autres) et en Laponie (en 1736 par Maupertuis et Clairaut), et la prediction a un mois pres - grgce aux calculs effectues par Clairaut - du retour de la comete de Halley en 1759. Dans le systeme rationaliste cartesien, la theorie des tourbillons ne permettait aucune prediction aussi precise que la date, mQme ap- proximative, du retour d'une comete; et les predictions cartesiennes relatives a la courbure de la Terre furent contredites par les mesures et les observations.
Dans ce qui precede, nous avons releve trois traits caracteristiques de la CSM, en cherchant a determiner quel genre de correspondance avec I'Encyclopedie pourrait laisser penser que cet ouvrage est I'expression d'une CSM. II va de soi que dans tout ce qui vient d13tre dit, notre but n'etait pas de montrer qu'il y a effectivement des rapports importants entre la CSM et IIEncyclopedie. Les remarques qui prece- dent tendent bien plut6t a suggerer que les rapprochements qu'on pourrait Qtre tente de faire sont en realite assez faibles et assez peu convaincants.

80 Pierre Wagner
II y a indiscutablement, dans I'esprit des Lumieres tel qu'il s'exprime dans I'Encyclopedie, quelque chose de similaire a la CSM telle qu'elle est defendue par les empiristes logiques. Mais en realite, cette similari- te est mise a ma1 chaque fois que I'on considere separement I'une des caracteristiques de la CSM et que I'on effectue une comparaison pre- cise avec I'Encyclopedie.
II semble que cette similarite vienne plus de la multiplicite des points de rapprochement possibles (tant qu'on n'examine pas les cho- ses de trop pres) que de leur reelle pertinence. Parmi ces points, on cornpte notamment les suivants: 1) la volonte de rnettre des connaissances en commun et d'effectuer un travail collectif de critique et de mise en ordre, plut6t que de chercher a atteindre seul une vision du monde (la "Welfauffassung" s'oppose a I'idee d'une "Weltanschauung"); 2) la critique des obscurites de la rnetaphysique et I'aspiration a une plus grande clarte dans I'examen des problemes philosophiques; 3) I'abandon de toute connaissance a priori et la necessite d'un recours a I'experience et aux faits pour I'elaboration des connaissances; 4) I'abandon pour la philosophie de toute position de surplomb a I'egard des sciences; 5) I'idee que la science peut servir d'instrument pour une forme d'emancipation sociale.
Sur le dernier point, il ne fait pas de doute que I'entreprise des en- cyclopedistes a une vocation morale, sociale et politique, et que si I'on veut caracteriser leur "philosophie de la science1', c'est un point tout a fait essentiel. Dans I'Encyclopedie, la science se conqoit non seulement comme un systeme de connaissances abordees sous leur aspect theo- rique, mais aussi comme le ferment des progres de I'humanite et elle possede a ce titre des dimensions pedagogique, sociale, politique et morale, qui sont fortement marquees a I'interieur de I'ouvrage. Dans I'article (( Geometre D, par exemple:
lndependarnment des usages physiques et palpables de la geome- trie, nous envisagerons ici ses avantages sous une autre face, a laquelle on n'a peutdtre pas fait encore assez attention: c'est I'utilite dont cette etude peut 6tre pour preparer comme insensible- ment les voies a I'esprit philosophique, et pour disposer toute une nation a recevoir la lumiere que cet esprit peut y repandre.
Les encyclopedistes s'accordent sur I'importance politique et sociale de I'ouvrage, car ils ne doutent pas que la diffusion des sciences et d'une

LrEncyclop6die de Diderot et dfAlembert 8 1
philosophie rendue populaire soit au principe de I'emancipation, du progres et du bonheur de I'humanite. Cette dimension politique et so- ciale s'aper~oit egalement sous la plume de Diderot lorsqu'il ecrit que "I'Encyclopedie ne pouvait Qtre que la tentative d'un siecle philosophe4". Le caractere d'un bon dictionnaire est de "changer la f a ~ o n commune de penser". Dans I'esprit des editeurs, cette volonte demandait que I'on rendit accessible au public les connaissances des savants, et a cet egard, le travail de vulgarisation effectue par d'Alembert, qui se charge de la partie mathematique, est tout a fait exemplaire. "On ne saurait, ecrit-il dans I'article (( elements des sciences N, [...I rendre la langue de chaque science trop simple, et pour ainsi dire trop populaire."
Lorsque les auteurs du Manifeste du Cercle de Vienne se referent a "I'esprit des Lumieres", ils pensent certainement aussi a cet aspect. Mais la dimension emancipatrice, y compris en un sens social et politi- que, ne peut pas Qtre consideree cornme I'un des traits caracteristiques de la CSM sur lesquels les membres du Cercle de Vienne s'accorderaient entre eux: a cet egard, des positions comme celles de Schlick et de Neurath sont connues pour Qtre divergentes.
Sur ce point egalement, il serait certainement possible de montrer que la reference a "l'esprit des Lumieresn n'est justifiee que si I'on en reste a un niveau de tres grande generalite. Mais c'est une question que nous ne developperons pas davantage dans ce qui suit. Nous al- Ions plut6t examiner d'un peu plus pres un dernier point sur lequel on pourrait Qtre tente de proposer un rapprochement entre la CSM et IIEncyclopedie et qui est souligne avec force dans de nombreux textes parrni ceux qui illustrent et defendent la CSM: il s'agit de I'absence d'une reelle separation entre la science et la philosophie, ou de I'idee selon laquelle aucune methode proprement philosophique et non scien- tifique ne permet d'atteindre des connaissances qui sont inaccessibles aux methodes scientifiques elles-mQmes.
En realite, cette idee n'appartient pas en propre a la CSM au sens oir I'ont defendue les empiristes logiques; on la trouve en effet deja sous la plume de Russell au debut du siecle, et avant lui chez Mach, et elle sera reprise plus tard par Quine, qui lui donne un sens tres diffe- rent, dans le cadre de sa conception naturalisee de I'epistemologie. Cette idee n'en est pas moins I'un des principaux traits de la "wissen- schaftliche Weltauffassung". I1 est d'ailleurs directement lie a ceux qui ont ete evoques precedemment: la recherche d'une science unitaire, la critique et le depassement de la metaphysique, et la necessite d'un recours a I'experience pour toutes nos connaissances. Aussi n'est-it pas etonnant que les partisans de la CSM s'engagent clairement pour

8 2 Pierre Wagner
defendre une certaine conception des rapports entre science et philo- sophie. Cette position est particulierernent bien exprirnee par Philipp Frank dans sa conference de 1929 sur la signification des theories physiques contemporaines pour la theorie generale de la connais- sance: "Nulle part ne se trouve un point oir le physicien doive dire: ma tsche s'arrQte ici, et ici commence celle du philosophe." II convient d'ajouter deux choses pour bien comprendre le sens de cette citation: prernierement, que dans la CSM, la philosophie a pour vocation I'eclaircissernent des propositions, I'examen du sens, et non la produc- tion de propositions qui exprimeraient des connaissances proprement philosophiques; deuxiernernent, que ce travail d'eclaircissernent des concepts et des propositions n'est pas separe du travail des scientifi- ques. Sur ce dernier point, l'exemple qui est le plus souvent cite est celui de Einstein et de son analyse du concept de simultaneite: la theo- rie de la relativite est indissolublernent liee a I'analyse du concept de simultaneite, a la rnise en evidence du fait que le sens de ce concept n'etait pas parfaiternent clair avant que Einstein ait souleve la question de la rnise en oeuvre effective d'un contrble, par I'experirnentateur, de la sirnultaneite de deux evenernents.
Sur la question des rapports entre science et philosophie conside- ree d'un point de vue assez general, un rapprochement avec I'Encyclopedie est clairernent possible puisque ni Diderot ni dJAlembert ne con~oivent quelque chose cornme une philosophie qui serait sepa- ree de la science, qui viendrait apres ou au-dela de la science. Au de- but de IIEncyclopedie, lorsque Diderot donne une explication du sys- terne des connaissances humaines, il ecrit expliciternent que la science et la philosophie sont une seule et mQrne chose: "Dieu, I'Homme, et la Nature, nous fourniront [...I une distribution generale de la Philosophie ou de la Science (car ces mots sont synonymes); et la Philosophie ou Science, sera Science de Dieu, Science de I'Homme, et Science de la Nature."
Encore faut-il comprendre ce que signifie, pour Diderot, cette ab- sence de distinction entre science et philosophie. Or I'examen de ce point donne en fait une nouvelle raison, s'il en etait besoin, de n'utiliser I'expression "conception scientifique du monde" qu'avec la plus grande prudence lorsqu'il s'agit de qualifier I'esprit ou la philosophie de I'Encyclopedie. Car le rapprochement qui vient d'Qtre suggere entre deux rnanieres de cornprendre les rapports entre science et philosophie se revele Qtre tout a fait abusif lorsqu'on y regarde de plus pres. Mais ce qui est particulierernent eclairant, ici, est I'analyse des raisons pour lesquelles il en est ainsi. L'examen de ce point nous perrnettra d'aller

LrEncyclopBdie de Diderot et drAlembert 83
plus loin dans la comprehension de ce qu'il convient d'entendre par "science" dans le contexte de I'Encyclopedie; elle nous permettra ega- lement d'apporter une reponse a la question de savoir s'il y a une conception de la science propre a I'Encyclopedie, et quels sont les questions philosophiques qui sont soulevees par la science dans ce contexte. II s'agit aussi de montrer pourquoi I'idee de presenter I'Encyclopedie cornme I'expression d'une CSM introduit en definitive plus de confusion que de clarte et quelles sont les raisons pour lesquel- les le rapprochement ainsi suggere se revele 6tre a la fois anachroni- que et deplace.
On ne saurait contester que les encyclopedistes, tout comme les tenants de la CSM, pensent qu'il n'y a pas de reelle separation entre la science et la philosophie. Mais la signification de cette idee est, ici et la, tout a fait differente. Pour tenter de preciser quelle conception les en- cyclopedistes se font de la science et du rapport entre science et philo- sophie, nous developperons successivement plusieurs points dans ce qui suit. Certains de ces points concernent le sens du mot "science" a I'epoque oir sont ecrits les articles de IIEncyclopedie, et ils depassent le cadre de I'ouvrage de Diderot et dlAlembert; d'autres concernent plus precisement I'Encyclopedie proprement dite.
D'une maniere generale, le mot "science" peut Qtre precede d'un article defini ou d'un article indefini. Au singulier, dans le premier cas, on parle d'"une science", et I'on sous-entend donc qu'il en existe plu- sieurs; ce que I'on vise alors, ce sont "les sciences". Dans le second cas, on parle de "la science", et en ce sens, le mot ne se met pas au pluriel. Exarninons les deux usages du terme, en cornrnencjant par par- ler des sciences dans IIEncyclopedie.
I) Les sciences particulieres
Dans le systeme figure des connaissances hurnaines, beaucoup de ces sciences sont nomrnees et forment les ramifications d'un arbre qui re- presente le systeme, ou plutet, un systeme possible des connaissances hurnaines. Le tableau comporte trois colonnes, puisque le principe de la division, ernprunte a Bacon, est celui des trois facultes: la rnernoire, la raison, I'irnagination. Une premiere lecture du systeme figure indique que les sciences ne se trouvent que dans la colonne centrale, celle qui est placee sous le titre "raisonn et dont le norn general est "philosophie".
Dans les faits, le lecteur du systerne figure se convainc assez rapi- dement que lorsqu'il est question de sciences (au pluriel) dans ce ta- bleau, le mot "science" ne peut pas avoir le mQrne sens que celui que nous lui donnons aujourd'hui.

84 Pierre Wagner
La raison n'en est pas seulernent que les disciplines ont change de norn, ou que certaines d'entre elles ont disparu de I'encyclopedie, alors que d'autres ont fait leur apparition depuis. C'est plut6t que le terrne "sciencen ne designe pas la mQme chose. Donnons trois indices qui permettent de le rnontrer, et de le faire comprendre: - La division de la colonne centrale est une premiere indication qui va dans ce sens: "science de dieu", "science de I'homrne" et "science de la naturen. Face a la presence, dans le tableau, d'une science de Dieu, qui elle-mQrne regroupe des "disciplines", a c6te d'une science de I'homme et d'une science de la nature, le lecteur d'aujourd'hui peut legitirnement s'interroger sur le sens du mot science en cette occur- rence. - Deuxiernernent, le lecteur contemporain ne peut pas rnanquer d'Qtre frappe par les norns qu'il trouve dans cette colonne centrale; car parrni les sciences nornmees, on ne trouve pas seulement I'arithmetique, I'optique, la zoologie ou la botanique, on trouve egalement I'orthographe, I'heraldique, la navigation, la diete, I'astronomie judi- ciaire, ou le jardinage, dont la presence aux c6tes des autres discipli- nes nornmees ne peut que nous etonner. - En outre, la division du tableau en trois colonnes, parrni lesquelles seule la colonne centrale cornporterait des sciences ne doit pas Qtre prise trop au serieux. D'Alernbert lui-rnQrne s'emploie a brouiller cette division dans I'article Elements des sciences:
Nous dirons seulernent ici que toutes nos connaissances peuvent se reduire a trois especes; I'Histoire, les Arts tant liberaux que rne- caniques, et les Sciences proprernent dites, qui ont pour objet les rnatieres de pur raisonnernent; et que ces trois especes peuvent se reduire a une seule, a celle des sciences proprernent dites.
En effet, "I'histoire appartient a la classe des sciences, quant a la rna- niere de I'etudier et de se la rendre utile, c'est-a-dire quant a la partie philosophique" et "il en est de rnQrne des arts tant rnecaniques que liberaux".
Tout cela indique suffisarnment que lorsque Diderot et d'Alembert parlent des sciences, au pluriel, il s'agit de tout autre chose que ce a quoi nous pensons. Ce n'est pas que certaines sciences portent au- jourd'hui un norn different, que certaines sciences ont disparu ou que d'autres ont fait leur apparition dans le champ encyclopedique. C'est au contraire que le concept de science a une extension telle a I'epoque de Diderot et dlAlembert que le sens en est different. Or I'idee d'une

L'EncyclopBdie de Diderot et d'Alembert 8 5
conception scientifique du monde suppose que I'on prenne beaucoup plus au serieux que ne le font les encyclopedistes la distinction entre ce qui est science et ce qui ne I'est pas. En realite, cette question n'est pas posee et ne presente pas du tout pour eux I'interet que nous lui donnons. La question de la demarcation, qui est devenue centrale en philosophie des sciences, est tout a fait etrangere aux preoccupations des encycloped istes.
Cela apparait de maniere plus claire encore lorsqu'on considere un autre usage du mot "science", precede cette fois de I'article defini au singulier: non plus une science, ou les sciences, mais la science.
2) La science en general
Lorsque nous lisons sous la plume de Diderot que les mots "science" et "philosophien sont synonymes, nous ne devons evidemment pas en conclure que selon Diderot, ce que nous entendons aujourd'hui par "science" et ce que nous entendons par "philosophie" sont une seule et meme chose. Cela doit plut6t nous aider a mesurer combien le sens de ces mots est different de celui que nous leur donnons aujourd'hui. Di- derot ne veut certainement pas dire que les deux mots peuvent etre confondus. En realite, Diderot indique par la que I'apprentissage ou I'amour de la sagesse, ce que I'on nomme "philosophie", n'est pas dif- ferent d'une recherche de la connaissance conduite sous I'autorite de la raison, connaissance qu'il nomme "science", ce mot etant compris en un sens extrhement large. Diderot met implicitement en garde le phi- losophe: qu'il s'efforce de connaitre ce qui est susceptible de I'etre, et qu'il ne confonde pas cette recherche de la connaissance avec, par exemple, ce qui releve de I'autorite de I'Eglise ou d'un auteur respecte, des prejuges, de I'opinion, etc.
A I'epoque de I'encyclopedie, lorsque les philosophes parlent de la science, le mot doit s'entendre au sens de la connaissance; la connais- sance excellente, par opposition a I'opinion, a I'imagination, a la croyance, au temoignage. Dans le contexte de I'encyclopedie, ce qu'on nomme "la science" n'est ni une collection de disciplines ni un ensem- ble de methodes. Le sens du mot science que I'on trouve aujourd'hui et depuis la seconde moitie du XIXe siecle dans des expressions comme "la valeur de la sciencen, "l'avenir de la science", "la methode de la science", Yes objets de la science" correspond a tout autre chose que ce dont il est question dans I'Encyclopedie: il ne s'agit pas de la connaissance proprement dite en tant qu'elle se distingue, par exem- ple, de la croyance ou de I'opinion, mais d'un corps de connaissances qui, au XIXe siecle, se repartissent en disciplines constituees dont on

8 6 Pierre Wagner
peut discuter I'unite, la methode, I'objet, la valeur, et que I'on oppose alors aux lettres, aux humanites, ainsi, bien entendu, qu'a la philoso- phie. Or c'est precisement I'opposition puis la separation qui en resul- tent, celle de la science et de la philosophie, que les partisans de la conception scientifique du monde entendent remettre a certains egard en question, en contestant I'existence d'une methode de connaissance proprement philosophique, differente de la connaissance scientifique.
Nous oublions ou negligeons trop souvent le fait que la plupart des usages que nous faisons de I'expression "la science" datent grosso mod0 de la seconde moitie du XIXe siecle, et qu'il en va de meme du mot "scientifique"; que ce corps de connaissances n'est pas du tout conqu comme tel par les encyclopedistes, et que I'expression "concep- tion scientifique du monden n'a de sens que par rapport a un sens du mot science qui est tout a fait etranger aux reflexions que I'on trouve dans I'Encyclopedie.
On sait qu'en anglais, le mot 'scientist", qui designe celui que nous appelons "le scientifique" vient de Whewell, et que son usage date de 1840. En franqais, ce n'est que plus de quarante ans plus tard, apres 1880, que I'on commence a employer le mot "scientifique" comme substantif.
Nous avons deja souligne le fait que le mot unite n'a pas une seule occurrence dans tout le Discours preliminaire de I'Encyclopedie. C'est que le probleme des encyclopedistes n'est pas du tout de chercher a definir ce qu'est la science, ce qui est scientifique, ou de realiser I'unite de la science. Les encyclopedistes n'ont pas cette notion de la science qui nous est si familiere. En forqant un peu le trait, mais a peine, on pourrait dire que pour les encyclopedistes, la science, au sens oic nous entendons ce terme, cela n'existe pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sciences et que dans les sciences qu'ils nomment, nous ne retrouvons pas des disciplines que nous reconnaissons clairement comme etant des sciences particulieres. Cela veut plut6t dire que ce qu'ils entendent par "la sciencen n'est pas ce que nous entendons par la, et que le probleme de son unite ne se pose pas pour eux comme il se pose pour les tenants de la CSM au XXe siecle. Comment pourrait-il gtre question, pour les encyclopedistes, d'une "conception scientifique du monde"?
Si le mot "unite" est absent du Discours preliminaire, et si le pro- bleme de I'unite de la science ne se pose pas a eux comme il peut se poser a nous, il existe une question qui se pose clairement aux ency- clopedistes: celle de la division de la science. Quelles sont les bran- ches du systeme des connaissances humaines? Comment diviser

L'EncyclopBdie de Diderot et dfAlembert 8 7
I'arbre ou le tableau? Ce qui frappe le lecteur de I'Encyclopedie, et sur ce point, ce ne sont pas seulement le Discours preliminaire et quelques articles qui sont en question, c'est que I'ensemble de I'ouvrage se pre- sente comme un vaste laboratoire oir s'opere un processus de discipli- narisation, sur lequel les auteurs de I'ouvrage, qui forment "une societe de gens de lettres", ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux. On aper- qoit davantage un phenomene d'eclatement de la science, ou encore la naissance de sciences nouvelles comme I'economie politique, que la recherche d'une unification des sciences. Comment les encyclopedis- tes pourraient-ils rechercher la science unitaire, ou I'unite des sciences, alors que les sciences ne forment pas les champs disciplinaires que nous connaissons aujourd'hui?
Au demeurant, lorsque Diderot et dSAlembert parlent de I'avenir des sciences et de leur conception de la connaissance ils montrent claire- ment que sur cette question, ils ne partagent pas les mQmes idees. Plus generalement, il faut souligner que I'auteur de I'Encyclopedie est un auteur collectif et se presente - c'est bien ce qu'on peut lire sur la page de garde de I'ouvrage - comrne "une societe de gens de lettres". Or les quelques cent trente auteurs qui ont redige des articles pour IJEncyclop~die ont des idees differentes sur I'avenir de la connais- sance. Diderot et d'Alembert ont eu I'occasion, plus qu'aucun autre membre de I'auteur collectif, de s'exprimer sur ce point. II est vrai que ces deux auteurs partagent certaines idees caracteristiques de I'esprit des Lumieres, par exemple I'idee selon laquelle la promotion et le de- veloppement de la science sont des conditions du progres (compris en un sens moral et politique) parce qu'il ne fait aucun doute pour eux que les lumieres de la connaissance contribuent a I'education, a I'entente et au bonheur des peuples. Cependant, des que Diderot et d'Alembert s'expriment sur la rnaniere dont ils conqoivent la science, sur ce qu'on pourrait appeler leur "philosophie de la science", on aperqoit leurs pro- fondes divergences. Leurs representations des differents rnodeles de la science, de I'avenir de la science, ou de ce que devrait Qtre la science sont tres differentes. Ainsi, il ne sont pas du tout d'accord sur I'avenir des rnathematiques, sur leur r61e paradigmatique pour I'ensemble de la science, ou sur le sens et I'importance qu'il convient d'accorder au calcul des probabi~ites.~
L'une des consequences de ces remarques est que si I'on voulait a toute force user de I'expression "conception scientifique du monde" pour parler de ce qu'ont ecrit les auteurs de I'Encyclopedie, il faudrait commencer par mettre cette expression au pluriel.

88 Pierre Wagner
Lorsque nous disons que I'Encyclopedie n'est pas I'expression d'une CSM, nous ne reprochons nullement aux partisans de la "wis- senschaftlische Weltauffassung" de s'irtre refere a tort a I'oeuvre de Diderot et d'Alembert, ou plus generalement a I'esprit des Lumieres. Ce n'est evidemment pas la ce que nous avons voulu suggerer par les remarques qui precedent. Au demeurant, chez Neurath, la reference aux encyclopedistes du XVllle siecle ne concerne pas tant la CSM en tant que telle, que son projet d'encyclopedie. Et a cet egard, une tenta- tive de comparaison entre Diderot d'un c6te et Neurath de I'autre de- manderait un travail d'une tout autre ampleur. Notre but, ici, etait sur- tout de faire quelques remarques sur la "philosophie de la sciencen des encyclopedistes et le detour par la wissenschaftliche Weltauffassung des empiristes logiques nous a seulement donne I'occasion, par un effet de contraste, de mieux faire ressortir certains aspects de la ma- niere dont Diderot et dlAlembert concevaient la science et son rapport a la philosophie.
Notes
1. D'Alem bert, Discours preliminaire de I'Encyclopedie. Paris: J. Vrin 2000, p. 108. 2. Ibid., p. 109. 3. Ibid. 4. Article ENCYCLOP~DIE, in: Diderot, (Euvres compl6tes, t. VII, Paris: Hermann 1976,
p. 222. 5. Sur ces differents points, cf. Colas Duflo et Pierre Wagner, "La science dans
I'Encyclop6die. D'Alembert et Diderot", in: Pierre Wagner (ed.), Lesphilosophes et la science, Paris: Gallimard 2002, pp. 205-245.

ANASTASIOS BRENNER
HISTOIRE ET LOGIQUE DANS L'ECRITURE ENCYCLOPEDIQUE
Introduction
L'ecriture encyclopedique, dans sa tgche d'abreger notre savoir, recourt generalement a deux procedes: soit elle donne brievement le cheminement historique qui a conduit aux connaissances actuelles, soit elle fournit une reconstruction rationnelle de ces connaissances a partir d'elements simples. On peut en donner une illustration a partir de I'Encyclopedie de Diderot et dlAlembert, que les positivistes logiques prendront comme origine de leur propre projet encyclopedique. DIAlembert exprime nettement les deux procedes qui sous-tendent I'ouvrage qu'il dirige avec Diderot. En parlant de I'organisation des sciences, il ecrit:
Le premier pas que nous ayons a faire dans cette recherche est d'exarniner, qu'on nous permette ce terme, la genealogie et la filiation de nos connaissances, les causes qui ont dir les faire naitre et les caracteres qui les distinguent; en un mot, de remonter jusqu'a I'origine eta la generation de nos idees.'
Tel est I'objet de la premiere partie du Discourspreliminaire de I'Encyclopedie. La seconde partie adopte une autre demarche:
L'exposition historique de I'ordre dans lequel nos connaissances se sont succedees, ne sera pas moins avantageuse pour nous eclairer nous-mQmes sur la maniere dont nous devons transmettre ces connaissances a nos lecteurs2
La genealogie et I'histoire ne representent pas seulement les deux divisions du Discours preliminaire; elles correspondent aussi aux deux voies de la mise en forme encyclopedique.
La genealogie prefigure ce qu'on appellera au XXe siecle la reconstruction rationnelle. Certes, ce volet de I'Encyclopedie de Diderot et dYAlembert peut sembler retrospectivement manquer de rigueur. La physiologie experimentale et la psychologie empirique n'etaient pas encore constituees. Le ralliement a I'empirisme, que les positivistes logiques loueront, n'est pas vraiment justifie ni cornplet. On peut

90 Anastasios Brenner
neanmoins percevoir ici le debut d'un programme qui se prolonge chez Comte et chez Poincare. Lorsque celui-ci etudie la genese de nos notions fondamentales, il herite de d9Alembert, et la parente se marque encore avec I'analyse des sensations dlErnst Mach. Dans sa t k h e de construction logique du monde, Carnap se reclamera a son tour de Poincare et de Mach.
On aurait pu penser que les positivistes logiques, en s'engageant dans la voie encyclopedique, allaient faire table rase des tentatives anterieures. L'instrument remarquable que constitue la logique mathematique ne permettait-elle pas d'isoler les veritables atomes de signification et de recomposer, sur cette base, nos connaissances complexes? Mais peut-on reellement construire une encyclopedie sans recourir a I'histoire? N'oublions pas que ce projet represente un approfondissement et un elargissement. II doit procurer une justification de la conception scientifique du monde; il doit encore Qtre ouvert a des collaborateurs exterieurs au Cercle de Vienne. L'encyclopedie fournit alors I'occasion a Neurath de corriger une approche trop exclusivement logique. Celui-ci insiste sur I'apport de la sociologie et de I'histoire. Par la, il rappelle I'interQt pour I'evolution passee de la science, qu'il partage avec d'autres membres du Cercle, tels que PhilippFrank et Hans ~ a h n . ~ Un examen attentif des ecrits de Neurath revele que le terme d'histoire apparait constamment. Ce terme recouvre toute une serie d'arguments: le caractere evolutif de la science, la dimension historique du langage scientifique et I'histoire des sciences proprement dite.4 Nombreux sont les travaux qui nous incitent aujourd'hui a remettre en cause I'image figee et hieratique du Cercle de Vienne qui a longtemps eu cours.
Si Neurath revendique I'originalite du programme de I'Encyclopedie de la science unitaire, il ne rejette pas pour autant I'experience de ses predecesseurs. Comment des lors entendre la reference aux travaux anterieurs? Neurath ne nous offre pas une etude d'ensemble de I'Encyclopedie de Diderot et d9Alembert; il ne nous donne pas une histoire des encyclopedies. Nous risquons meme d'etre deroutes, en lisant pour la premiere fois les passages qu'il consacre a ses devanciers. On releve des generalisations hardies, des rapproche- ments surprenants et des raccourcis enigmatiques. Neurath est un auteur presse, et ses lectures sont subordonnees a la tsche poursuivie: la mise en place de la conception scientifique du monde et la redaction d'une encyclopedie d'un genre nouveau. II n'en reste pas moins que Neurath a une large culture; on decouvre, au detour d'une remarque, dans une note, qu'il connaissait bien les etapes intermediaires, la

Histoire et logique dans I'ecriture encyclopedique 9 1
filiation historique qui a rendu possible le positivisme logique. Son interpretation met en evidence des points qui echappent aux historiens specialistes: la descendance d'un courant de pensee, ses tendances subreptices et son potentiel latent. ~videmment, il nous faudra combler les lacunes du recit laisse par les positivistes logiques; nous devons fournir les explications qui manquent, et nous aurons a debusquer les prejuges.
Mais je voudrais aussi soulever la question de la signification de cet heritage pour nous aujourd'hui. La formation des membres du Cercle de Vienne se situe au tournant des XIXe et XXe siecles. C'est I'epoque de la publication de la Grande encyclopedic, sous la direction de Marcelin Berthelot, qui a pu servir d'exemple a depa~ser.~ Le Cercle de Vienne reagira aux revolutions scientifiques: on elaborera une conception scientifique du monde et, enfin, on commencers a realiser IIEncyclopedie de la science unitaire. II est a noter qu'au mQme moment, en France, Lucien Febvre lance I'Encyclopedie fran~aise.~ Ces deux encyclopedies procedent de la mQme volonte d'innover et de resserrer les liens entre les sciences. Pour une part, elles puisent leur inspiration a la mQme source: I'association de I'histoire et de la sociologie, la synthese historique d'Henri Berr et le positivisme nouveau dlAbel ~ e ~ . ' Pourtant, I'aboutissement est totalement different. On sait que Lucien Febvre est I'un des chefs de file de I'ecole historique franqaise, qui prend son essor entre les deux guerres. L'instrument logique aura peu de place dans I'encyclopedie qu'il dirige, et I'approche historique sera fondee sur la notion de mentalite. Pourquoi la pensee franqaise et la pensee autrichienne, qui semblaient si proches au debut du XXe siecle, ont-elles diverge par la suite? On sait que la philosophie autrichienne a contribue a la formation de la tradition analytique, alors que la philosophie franqaise, se rapprochant de la pensee allemande, s'est fondue dans la tradition continentale. D'une certaine maniere, la question des relations entre ces deux traditions se pose a I'interieur de I'encyclopedie, dans I'articulation entre logique et histoire. C'est cette question que je vous propose d'examiner.
Aux sources du projet encyclopedique
Quelle est I'attitude des positivistes logiques a I'egard de la tradition franqaise? Que vont-ils emprunter aux divers projets encyclopediques menes en France? Nous pouvons prendre comme point de depart un

92 Anastasios Brenner
passage de la plaquette intitulee cc La conception scientifique du monde: le Cercle de Vienne D, plus connue comrne le Manifeste du Cercle de ~ienne.' Les positivistes logiques dressent un tableau des precurseurs qui ont contribue a la formation de leur mouvement. Parmi une trentaine de noms, qui vont dans I'ordre chronologique d'Epicure a Wittgenstein, on releve: les Lumieres, Comte, Poincare et ~ u h e m . ~ On note que ces penseurs ou courants sont evoques a plusieurs reprises, en rapport avec les differentes directions de recherche poursuivies. Ils se retrouvent dans d'autres ecrits de Neurath et des membres du cercle.l0 I1 s'agit precisement dans le Manifeste de la constitution d'une conception scientifique du monde. Mais cette conception n'est pas sans rapport avec le projet encyclopedique que Neurath rendra public peu d'annees apres, comme nous le verrons tout a I'heure. Et I'on retrouvera les mQmes references dans ce domaine; ce sont autant d'etapes de I'elaboration d'une encyclopedie des sciences et de sa conception moderne. Ce passage du Manifeste nous permet de dresser un canevas. Les positivistes logiques gardent a I'esprit I'Encyclopedie de Diderot et d'Alembert, tout en etant soucieux de tenir compte de I'evolution ulterieure: ils mettent en avant I'unite des sciences proposee par Auguste Comte; enfin, ils retiennent I'apport dlHenriPoincare et de PierreDuhem au developpement des techniques d'analyse des concepts.
Que Neurath fasse reference a I'Encyclopedie de Diderot et dlAlembert ne doit pas nous etonner. Par son ampleur et I'originalite de sa mise en aeuvre, cette encyclopedie inaugure un genre de travail collectif, et Neurath en signale la modernite: cc Avec Bayle, les materialistes du XVllle siecle, d'Alembert et les autres encyclopedistes, le chemin s'ouvre deja tout droit vers le domaine moderne. n" Mais il y a aussi des raisons plus profondes. Neurath approuve I'orientation empiriste; il releve la critique des systemes metaphysiques; il cherche a renouveler le projet d'emancipation politique. Enfin, il s'interesse de pres a I'ecriture et a la methode encyclopedique.
Neurath ne manque pas de renvoyer a dlAlembert, lorsqu'il presente son propre projet:
J'ai propose le terme d"'encyclopedie" principalement par opposition au terme de "systeme" par lequel on presuppose I'existence d'une sorte de science totale fondee sur des axiomes et qui resterait a decouvrir. Cette notion est franchement douteuse si I'on commence a donner I'esquisse d'un tel systerne - constat qui

Histoire et logique dans I'ecriture encyclop6dique 93
a deja ete fait par le chef de file des encyclopedistes franqais, d '~ lem bert.12
II s'agit d'eviter de donner une image statique et dogmatique de I'ensemble des sciences. On trouve en effet une idee analogue chez dlAlembert, dans la premiere partie du Discours preliminaire:
Ce n'est point par des hypotheses vagues et arbitraires que nous pouvons esperer de connaitre la nature, c'est par I'etude reflechie des phenomenes, par la comparaison que nous ferons des uns avec les autres, par I'art de reduire autant qu'il sera possible, un grand nombre de phenomenes a un seul qui puisse en Qtre regarde comme le principe. Cette reduction constitue le veritable esprit systematique, qu'il faut bien se garder de prendre pour I'esprit de systeme avec lequel il ne se rencontre pas toujours.13
Une certaine conception de la science, que j'appellerai classique, sous- tend cette critique de I'esprit de systeme. La science doit Qtre systematique, mais elle doit eviter la tentation de contraindre les faits a prendre la forme d'un systeme en procedant par des conjectures. Ce distinguo fera fortune au point qu'un siecle plus tard mile Littre le consignera dans son dictionnaire. Le lexicographe, que I'on sait positiviste, ne s'en tient pas a la pure description linguistique: (( L'esprit de systeme est la disposition a prendre des idees imaginees pour des notions prouvees. L'esprit systematique est la disposition a concevoir des vues d'ensemble. L'un est un defaut, I'autre peut Qtre une qualite. ))I4
Voici en quels termes dlAlembert precise sa critique dans la seconde partie de son Discours preliminaire:
L'esprit de systerne est dans la physique ce que la metaphysique est dans la geometrie (...). C'est au calcul a assurer pour ainsi dire I'existence [des causes des phenomenes], en determinant exactement les effets qu'elles peuvent produire, et en comparant ces effets avec ce que I'experience nous decouvre. Toute hypothese denuee d'un tel secours acquiert rarement ce degre de certitude, qu'on doit toujours chercher dans les sciences naturelles, et qui neanrnoins se trouve si peu dans ces conjectures frivoles qufon honore du nom de ~ ~ s t e r n e s . ' ~

94 Anastasios Brenner
II a a I'esprit les systemes de Descartes et de Leibniz. En effet, selon dlAlembert, Descartes pretendait tout expliquer.I6 En revanche, Newton bannit (( les hypotheses vagues N; il developpe une theorie du monde et non un systeme.17 La metaphysique doit gtre etablie sur ce modele newtonien. Le merite revient a Locke d'avoir accompli cette tiche; il developpe (( une physique de I'ime n.18 Tels sont les principaux passages oir dlAlembert developpe sa critique de I'esprit de systeme.
Mais d'autres remarques, portant plus precisement sur I'ecriture encyclopedique, ont dQ attirer I'attention de Neurath. D'Alembert ne se contente pas de formuler les procedes que suivront les encyclopedistes dans leur tiche; il porte son attention sur la nature et sur la difficulte du travail:
Quoique I'histoire philosophique que nous venons de donner de I'origine de nos idees soit fort utile pour faciliter un pareil travail, il ne faut pas croire que I'ordre encyclopedique doive ni puisse mQme Qtre servilement assujetti a cette histoire. Le systeme general des sciences et des arts est une espece de labyrinthe, de chemin tortueux, oir I'esprit s'engage sans trop conna'itre la route qu'il doit tenir.lg
Ou encore cette expression de pluralisme: (( On peut imaginer autant de systemes differents de la connaissance humaine que de mappemondes de differentes projections. B~~
Cependant, il faut souligner tout ce qui separe les Lumieres des positivistes logiques. Le Cercle de Vienne met au premier plan la science unitaire. Ce n'est pas le cas de d'Alembert. Le systeme figure des connaissances humaines est rattache aux trois facultes de I'ime distinguees par Bacon: la memoire, la raison et I'imagination. La raison, quant a elle, donne lieu a deux sortes de sciences, selon que son objet est la nature ou I'homme, instaurant une dichotomie fondamentale, qui aura ses partisans jusqu'a nos jours. En proposant une bifurcation des sciences en cosmologiques et noologiques, Ampere, s'inspire des en~~clopedistes.~~ Or, avant le milieu du XlXe siecle, Comte oppose a cette conception un tableau des sciences, qui vise a mettre en relief leur unite. Et I'encyclopedie de Neurath se rapprochera sur plusieurs points du Cours de philosophie positive: il s'agit moins d'un dictionnaire raisonne que d'une classification des sciences.

Histoire et logique dans I'ecriture encyclopedique 9 5
Encyclopedie et unite des sciences
On peut noter plusieurs points de convergence entre Comte et les positivistes logiques. Rappelons tout d'abord en quels termes Comte rejette les tentatives de ses predecesseurs:
On est aujourd'hui bien convaincu que toutes les echelles encyclopediques construites, comrne celles de Bacon et de d'Alembert, d'apres une distinction quelconque des diverses facultes de I'esprit humain, sont par cela seul radicalement vicieuses, mQrne quand cette distinction n'est pas, cornme il arrive souvent, plus subtile que reelle; car, dans chacune de ses spheres d'activite, notre entendement emploie simultanement toutes ses facultes pr in~ipales.~~
L'ordre encyclopedique des six sciences fondarnentales que nous propose Comte est progressif et continu: mathematiques, astronomie, physique, chirnie, biologie et sociologie. Et Neurath ne manque pas d'inclure Comte dans la liste de ses predecesseurs:
Notre critique du systerne en tant que modele n'en est pas moins doublee d'un travail tres intense - dans le sens du 'scientisme' qui s'est developpe toujours plus consciemrnent depuis Saint-Simon, Comte, Cournot, et autres- pour instaurer dans la science un nouvel ordre et enchainement qui, sans pretendre prematurernent a une clarte universelle, prend son point de depart dans la masse des enonces donne^.^^
Neurath signale a juste titre I'influence de Saint-Simon sur Comte; il parait soucieux de replacer le positivisme dans le cadre d'un rnouvement general, qui comporte des aspects politiques. On releve egalement la reference a Cournot, qui avait ete quelque peu oublie. Celui-ci a apporte une contribution non negligeable a la philosophie des sciences par ses etudes conceptuelles et h i ~ t o r i ~ u e s . ~ ~ Quant a Auguste Comte, on note chez lui des anticipations etonnantes: il formule un critere empirique de signification, afin d'exclure la metaphysique, et preconise une approche resolument sociologique.
Neurath est parfois plus proche de Comte qu'il ne le pense. Ainsi, la critique qu'il lui adresse dans le passage suivant n'est pas entierement justifiee:

9 6 Anastasios Brenner
Nombreux sont ceux qui, suivant Comte, con~oivent la trans- formation de la pensee humaine de la maniere suivante: elle commence par une periode theologique religieuse, suivie d'une periode philosophique metaphysique, jusqu'a ce que celle-ci soit remplacee par une periode positiviste scientifique. Mais il existe des raisons en faveur d'une autre notion du changement historique, et ceci est interessant d'un point de vue educatif et psychologique. Si des elements de base de la conception scientifique du monde ont ete presents des le printemps de I'humanite, alors nous avons une meilleure chance de pouvoir les rea~ t i ve r .~~
Or justement Comte pretend que I'esprit positif est present des I'origine; son action s'accentuerait au fur et a mesure, produisant invinciblement le progres.26
Toutefois, le positivisme comtien comporte des difficultes. Rappelons que Comte par sa cc Theorie fondamentale des hypo- theses )), exposee dans la vingt-huitieme le~on du Cours de philosophie positive, cherche a reglementer I'usage de la conjecture en science. L'hypothese doit Qtre une simple cc anticipation )) sur I'observation future. Elle n'est qu'un <c artifice )) pour contourner les difficultes que peut presenter I'analyse directe d'un phenomene; on peut s'en passer lorsque la theorie est entierement d e v e ~ o ~ ~ e e . ~ ~ Le r61e de I'hypothese se rattache a I'intuition centrale du fondateur du positivisme: la science consiste en la recherche des lois, non en celle des causes. Comte veut rejeter de la science les fluides et les substances fictifs imagines par les scientifiques de son epoque, autant de speculations qui nous entrainent sur le terrain de la metaphysique. Or Neurath formule une critique judicieuse a I'encontre de cette theorie:
Auguste Comte, dans sa Philosophie positive, est alle beaucoup trop loin, dans son aversion e x t r h e pour les hypotheses. D'ailleurs il n'a pas ete parfaitement consequent, puisqu'il a admis la theorie des atomes. Nous trouvons une attitude semblable chez Mach, qui considerait avec scepticisme toutes les theories atomiques contemporaines, de meme que la theorie de la relativite d'Einstein, qu'il a pourtant contribue a fonder. Peut-Qtre la prudence excessive de Comte et de Mach tient-elle a ce que, de leur temps, on ne disposait pas encore des instruments logiques permettant de commencer a sly retrouver dans la redoutable confusion des enonces plus stables et moins stables, des formules plus ou moins indeterrninee~.~'

Histoire et logique dans I'bcriture encyclopbdique 97
Le Cercle de Vienne cherche a depasser ce premier stade de la doctrine positiviste qui inclut Mill, Comte et mQme Mach. Sur ce point, Neurath et les positivistes logiques heritent d'une critique deja formulee dans le cadre du conventionnalisme autour de Poincare. En effet, les avancees de la science et I'approfondissement de la reflexion philosophique font surgir, des la fin du XlXe siecle, un sentiment d'insatisfaction a I'egard des diverses theories de la science qui avaient ete proposees. Ce sentiment trouve une expression particulierement nette chez les conventionnalistes: leur volonte d'innover s'accompagne de nombreuses objections a I'encontre d'Auguste Comte et des conceptions anterieures. Tel est le sens du positivisme nouveau formule par ~douard Le Roy et par Abel Rey, que le Cercle de Vienne reprendra a son c ~ m ~ t e . * ~
Une nouvelle encyclopedie
Lorsque le Manifeste aborde le probleme des fondements de la physique, il donne cette caracterisation:
A I'origine, le Cercle de Vienne s'interessait surtout aux problemes methodologiques de la science du reel. Les idees de Mach, Poincare et Duhem nous ont incites a debattre des problemes relatifs a la maitrise du reel par des systemes scientifiques, en particulier par des systemes d'hypotheses et d'axiomes. Tout d'abord un systeme d'axiomes, entierement separe de toute application empirique, peut Qtre considere comme un systeme de definitions implicites (...). Les modifications entrainees par de nouvelles experiences peuvent affecter soit les axiomes, soit les 'definitions de coordination'. On touche la au probleme des conventions qu'a tout particulierement traite ~oincare.~'
Ce qui est decrit ici est ce qu'on appelle la conception canonique: une theorie scientifique est un systeme axiomatique dont I'application a la realite sleffectue au moyen de definitions de coordination ou regles de c~rres~ondance.~' En effet, le probleme qulaffronte le Cercle de Vienne est d'expliquer le caractere mathematique des theories des parties avancees de la science, sans renoncer a leur soubassement empirique. En introduisant la notion de convention, Poincare permet de rendre compte des termes theoriques. Le langage mathematique est choisi a cause de sa puissance et de sa commodite. Les principes de la

98 Anastasios Brenner
mkanique sont des conventions, c'est-a-dire une certaine maniere de parler des phenomenes. Ce qui retient particulierement I'attention des positivistes logiques c'est la question de la maitrise du reel a travers les systemes formels.
Mais Duhem parait encore plus proche de la conception canonique, lorsqu'il ecrit en 1906, dans La theorie physique:
Le developpement mathematique d'une theorie physique ne peut se souder aux faits observables que par une traduction. Pour introduire dans les calculs les circonstances d'une experience, il faut faire une version qui remplace le langage de I'observation concrete par le langage des nombres; pour rendre constatable le resultat que la theorie predit a cette experience, il faut qu'un theme transforme une valeur numerique en une indication formulee dans la langue de I'experience. Les methodes de mesure sont (...) le vocabulaire qui rend possible ces deux traductions en sens inverse.32
Carnap ado tera cette perspective, et le Cercle de Vienne retiendra sa formulation.' Sans doute les recherches axiomatiques et logiques permettent-elles de proposer une formulation plus nette. On separe categoriquement trois sortes de termes: logico-mathematiques, theoriques et observationnels. Les conditions qui s'appliquent a la theorie sont decortiquees: les termes observationnels renvoient a des objets physiques directement observables ou a des attributs directement observables de ces objets; les termes theoriques reqoivent une definition explicite en fonction des observables gr5ce a des regles de correspondance. II n'en demeure pas moins qu'on trouve chez Poincare et chez Duhem toute une serie de themes qui vont reapparaitre: I'interpretation des systemes formels, la traduction entre les differents langages de la science, les definitions operationnelles.
II s'ensuit que la conception canonique n'est pas le resultat de I'emploi de la logique mathematique; mQme si cet instrument permet d'en preciser remarquablement le sens. La conception de la theorie en tant que systeme deductif est nee d'une epistemologie qui fait appel a I'histoire des sciences. On s'explique alors pourquoi cette conception a survecu au positivisme logique; elle ne h i est pas consubstantielle. Meme I'ecole historique de Kuhn ne I'a pas entierement renversee; elle a simplement montre la necessite de prendre egalement en compte une structure profonde, sous-jacente aux theories, le paradigme.

Histoire et logique dans I'ecriture encyclopedique 9 9
Conclusion
Nous avons note chez les positivistes logiques de nombreux emprunts a la pensee fran~aise et une certaine communaute d'esprit entre I'Autriche et la France au debut du XXe siecle. A Vienne comme a Paris, se faisait sentir alors le mQme besoin d'instaurer une reflexion sur la science, appuyee sur les developpements recents, notamment dans les domaines des mathematiques, de la psychologie et de la sociologie.
On peut encore faire etat d'un developpement simultane. Neurath ne manque pas de signaler ceux qui ceuvrent dans une direction analogue a la sienne:
C'est donc sur cette base commune du langage vulgaire que s'est formee toute la bigarrure des sciences, que seule I'histoire peut nous faire comprendre. Quelle variete de "decoupages", quelle richesse en differenciations! C'est pas a pas seulement que I'on commence a mettre de I'unite entre les sciences particulieres, debut que nous pouvons considerer comme "le prologue necessaire de I'unification de la science". Que ce processus d'unification doive se poursuivre, pour ainsi dire, a tous les echelons de la formulation scientifique et que de plus le travail collectif seul rende possible cette oeuvre de synthese, semblable a celle qu'Henri Berr, Abel Rey et d'autres preconisent, c'est justement ce que nous cherchons a montrer i ~ i . ~ ~
En effet, Henri Berr promeut, au moyen de nouvelles revues et du Centre international de synthese, un projet ambitieux, qui vise a resserrer les liens entre les differentes sciences; il exerce une influence feconde sur Lucien Febvre et sa nouvelle ecole historique. Quant a Abel Rey, dont la these sur les conceptions philosophiques des physiciens eut un impact sur le Cercle de Vienne, il joue un r61e de premier plan dans I'etablissement institutionnel de la philosophie des sciences.35 La chaire qu'il occupe a la Sorbonne, que I'on peut comparer a celle de Schlick a IIUniversite de Vienne, est associee a I'lnstitut de philosophie et histoire des sciences. L'objet de cet institut est de favoriser la collaboration entre specialistes des differentes disciplines.
Pourtant il faut reconnaitre une divergence qui se creuse. Le discours philosophique finira par se diviser en deux traditions antagonistes. La tradition continentale, representee par la pensee

100 Anastasios Brenner
franqaise et allemande, preconisera une methode historique; la tradition anglo-saxonne, heritant de la pensee autrichienne, pr6nera une methode logique. II semble que nous soyons aujourd'hui en presence de deux manieres differentes de philosopher.
Essayons d'en cerner les causes. II faut rappeler tout d'abord le developpement specifique de I'ecole franqaise. La philosophie des sciences en France se caracterise par une approche principalement historique. L'une de ses sources est I'ceuvre de Comte, qui donne lieu, on le constate, a des formes de positivisrne quelque peu differentes. L'ecole franqaise est egalement marquee par une mefiance a I'egard de la logique, qui se manifeste de maniere particulierement nette dans la controverse entre Poincare et Russell. Or I'evolution ulterieure de la logique permet de mieux comprendre la nature de cette discipline et son rapport avec les mathematiques. II n'y a pas de systeme logique unique, mais une pluralite de logiques possibles. Et la frontiere entre logique et mathematiques est permeable et mouvante.
Revenons une derniere fois aux positivistes logiques. II pourrait sembler qu'a un moment donne la logique passe au premier plan au detriment de I'histoire. En fait, le projet encyclopedique, qui comporte un volet historique, est ancien, et Neurath ne I'a jamais perdu de vue. Dans un passage autobiographique, il nous explique que ce projet precede la fondation du Cercle de Vienne:
J'essaierai de decrire comment, en tant qu'empiriste logique, j'ai forge mon attitude a I'egard les sciences et de leur unite. Plusieurs d'entre nous, outre moi-mQme, ont ete eleves dans une tradition machienne (...). Nous avons egalement ete influences par des scientifiques tels que Poincare, Duhem, Abel Rey, William James, Bertrand Russell, et, en ce qui me concerne, par Gregorius ~ t e ~ s o n . ~ ~
Et il ajoute: J'ai le souvenir que Poincare et Duhem m'ont aide a comprendre que la oir une hypothese peut Qtre elaboree, il est possible d'en elaborer plusieurs. D~~ Le holisme que Neurath developpe sous I'influence de Duhem, des avant la Premiere guerre mondiale, a sans aucun doute joue un r61e. L'encyclopedie avait sa place dans la definition de la conception scientifique du monde, car I'analyse Iogique du langage de la science va de pair avec I'effort d'organisation des sciences. Ainsi que I'ecrit Neurath: (( Le processus d'organisation logique d'une science particuliere ne peut Qtre separe du processus

Histoire et logique dans I'ecriture encyclopedique 101
d'etablissement de passerelles ou connexions entre les differentes sciences. ))38
Le positivisme logique est un mouvement riche et complexe; nous pouvons en proposer diverses lectures. En mettant I'accent sur Neurath, et en privilegiant le theme de I'histoire, j'espere avoir montre que I'on touche a des preoccupations actuelles. Neurath et son projet encyclopedique nous aident a voir plus clair dans la tsche, qui nous incombe aujourd'hui, d'articuler convenablement histoire et logique.
Notes
Jean Le Rond dlAlembert, Discours preliminaire de I'Encyclopedie (1751). Paris: J. Vrin 1989, p. 13. Ibid., p. 75. On sait que ces trois condisciples de I'universite de Vienne avaient pris I'habitude de se reunir, avant la Premiere Guerre mondiale, au sein d'un groupe de discussion. Rudolf Haller, qui en a souligne I'importance, a denomme ces echanges cc le premier Cercle de Vienne N. On decouvre effectivement ici ~lusieurs theses aui annoncent la doctrine du Cercle qui se formera autour de ~chlick. Voir Rudolf ~Aller, (c The first Vienna Circle )), in: Thomas Uebel (Ed.), Rediscovering the forgotten Vienna Circle. Dordrecht: Kluwer 1991, pp. 95-108. On peut signaler deux articles du jeune Neurath, qui appartiennent a I'histoire des sciences: d u r Klassifikation von Hypothesensystemen D (1914-1915) et ccPrinzi- pielles zur Geschichte der Optikn (1915), in: OttoNeurath, Gesammelte philosophische und methodologische Schriften, 2 Bde. Wien: Holder-Pichler- Tempsky 1981, vol. I. Par exemple, Neurath se souvient de ces travaux, lorsqu'il ecrit: cc Supposons que nous puissions deduire d'une theorie determinee un groupe de predictions assurees et d'une autre theorie un autre groupe de predictions assurees; eh bien, nous considererons comme un progres scientifique de reussir a creer une troisieme theorie, d'oh I'on puisse deduire I'un et I'autre de ces groupes de predictions. L'histoire de la science nous montre qu'il n'est pas rare que de telles tentatives aient BtB puissamment stimulees par I'intuition speculativem, cc L'encyclopedie comme 'modele' D, in: Revue de synthese 12, 2, 1936, pp. 187-201, p. 190. L'original allemand ayant BtB perdu, la traduction franpise sert de reference. Marcelin Berthelot (Cd.), Grande encyclopedic. 31 vol., Paris: Lamirault 1886-1902. Lucien Febvre (Ed.), Encyclopedic frangaise. 21 vol., Paris: Larousse 1935-1966. Henri Berr et Abel Rey figurent sur le comite d'honneur de I'Encyclop6die frangaise, a cbte de Bergson et de Brunschvicg. Otto Neurath, cc Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis D, in: Gesam- melte philosophische und methodologische Schriften, vol. 1. (Trad. fr. u La conception scientifique du monde: le Cercle de Vienne a, in: Antonia Soulez (ed.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres Bcrits. Paris: Presses universitaires de France, 1985). Ibid., p. 303 (trad. fr., p. 113). Si les Lumieres, ou Aufklarung, sont un mouvement europeen, il semble bien que les membres du Cercle designent par la principalement les penseurs franpis du XVllle siecle. En effet, Voltaire est cite juste

102 Anastasios Brenner
avant ce passage. Par ailleurs, Neurath Bvoque plus en detail la pensee franpise: Le developpement du Cercle de Vienne et I'avenir de I'empirisme logique. Paris: Hermann, 1935.
10. Voir egalement Philipp Frank, Between physics and philosophy, Cambridge (Mass.): Haward University Press, 1941.
11. Otto Neurath, Le developpement du Cercle de Vienne, p. 27. 12. cc Den Terminus 'Enzyklopadie' habe ich in erster Linie im Gegensak zum Terminus
'System' vorgeschlagen, durch den eine Art axiornatisierter Gesamtwissenschaft als vorhanden unterstellt wird, die man gewisserrnassen zu entdecken habe. Solche Vorstellung ist insbesondere dann bedenklich, wenn man daran geht, ein solches System ~"skizzieren - ein Umstand, auf den schon der Fuhrer der franzosischen Enzvklooadisten D'Alembert hinaewiesen hat P. Otto Neurath, cc Phvsikalismus und ~rkenntksforschun~ II n, in: 6esammelte philosophische "nd keth~dolo~ische Schriften, vol. 2, p. 757. Je traduis. Ailleurs, Neurath evoque cc la Science totale D de Comte, cc L'encyclopedie wrnme 'rnodele' n, op. cit., p. 200. D'Alembert, op. cit., p. 30. EmileLittre, Dictionnaire de la langue franpaise (1863-1872). Chicago: Encyclopaedia Britannia 1978, entree cc systeme )). Pour une etude plus detaillee de ce point, voir Anastasios Brenner, c( La notion de revolution scientifique selon les encyclopedistes )), Kairos, 18,2001,25-35. D'Alembert, op. cit., p. 11 7. Ibid., pp. 99, 107. Ibid., pp. 100-101. Ibid., p. 104. Ibid., p. 58. lbid., p. 61. Neurath critique expressement la classification d'Ampere, Gesammelte Schriften, vol. 2, p. 818. Auguste Comte, Cours de philosophie positive (1830-1842), 2 vol. Paris: Herrnann, 1975, 2* lepn, p. 43. Otto Neurath, (( L'encyclopedie wmme 'modele' a, op. cit., p. 195. Sur la redecouverte de Cournot, voir le numero thematique de la Revue de metaphysique et de morale, 13, 1905, pp. 293-543. cc In Anlehnung an Comte denken sich namlich viele die Wandlung menschlichen Denkens so, dass eine religios-theologische Periode den Anfang bilde, der dann eine metaphysisch-philosophische folge, bis sie durch eine wissenschaftlich-posi- tivitische abaelost werde. Aber es aibt Griinde fur eine andere Vorstelluna von der geschichtlicien Wandlung, was p~dagogisch-psychologisch nicht gleich$ltig ist. Sind Grundelemente der wissenschaftlichen Weltauffassung schon in der Fruhzeit der Menschen dagewesen, dann haben wir grossere ~ussicht, sie wiederbeleben zu konnen n. Otto Neurath, ct Wege der wissenschaftlichen Weltauffassung n, in: Gesammelte, vol. 1, p. 372. Je traduis.
26. Auguste Cornte, op. cit., vol. 2, 51" lepn, oir il developpe une conception wntinuiste de I'evolution humaine.
27. Ibid., vol. 1, 28" lepn. 28. Otto Neurath, (( L'encyclopedie wmme 'modde' a, op. cit., p. 195. 29. Voir Edouard Le Roy, cc Un positivisme nouveau n, Revue de metaphysique et de
morale, 1901, pp. 138-1 53 et Abel Rey, La theorie de la physique chez les physiciens contemporains, Paris: F. Alcan, 1907. Cf. Philipp Frank, Modern science and its philosophy, Cambridge (Mass.): Haward University Press, 1949.

Histoire et logique dans I'ecriture encyclopedique 103
(( Urspriinglich galt das starkste lnteresse des Wiener Kreises den Problemen der Methode der Wirklichkeitswissenschaft. Angeregt durch Gedanken von Mach, Poincare, Duhem, wurden die Probleme der Bewaltigung der Wirklichkeit durch wissenschaftliche Systeme, insbesondere durch Hypothesen- und Axiomensysteme, erortert. Ein Axiomensystem kann zunachst, ganzlich losgelost von aller empirischen Anwendung, betrachtet werden als.ein System impliziter Definitionen (...). Die durch neue Etfahrungen erforderlichen Anderungen konnen entweder an den Axiomen oder an den Zuordnungsdefinitionen vorgenommen werden. Damit ist das besonders von Poincare behandelte Problem der Konventionen beriihrt)). Otto Neurath, (c Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis n, op. cit., vol. 1, p. 310 (trad. fr., p. 122). Conception canonique est utilisee ici pour traduire ce que les commentateurs anglophones appellent standard view ou received view. Par exemple, Frederick Suppe (ed.), The structure of scientific theory. Urbana; London: University of Illinois Press 1977. Pierre Duhem, La thhorie physique, son objet et sa structure (1906). Paris: Vrin, 1981, p. 199, je souligne. Au sujet de la reception du conventionnalisme dans le Cede de Vienne, voir Anastasios Brenner, Les origines franpaises de la philosophie des sciences, Paris: Presses universitaires de France, 2003, 2" partie. Otto Neurath, c( L'encyclopedie wmme 'modele'n, op. cit., pp. 198-199, souligne dans le texte. II est significatif que deux ouvrages aussi differents que ceux de Hempel et Kuhn aient trouve place dans I'lnternational encyclopedia of unified science: Carl G. Hempel, Fundamentals of concept formation in empirical science, Chicago: University of Chicago Press, 1952 et Thomas S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 1962. Abel Rey, op. cit. cc I shall try to describe how I myself, as a logical empiricist, developed my attitude towards the sciences and their unity. Many of us, besides myself, have been brought up in a Machian tradition (...). We were also influenced by scientists such as Poincare, Duhem, Abel Rey, William James, Bertrand Russell, and I, in particular, by Gregorius Itelson n. Otto Neurath, ct The orchestration of the sciences by the encyclopedism of logical empiricismn, in: Philosophical papers (Dordrecht: Reidel, 1983), p. 230. L'original allemand ayant ete perdu, la traduction anglaise sert de reference. (( I think that Poincare and Duhem made me realize that wherever one hypothesis can be elaborated, it is possible to elaborate any number n. lbid., p. 230. cc The process of the logical organization of a single science cannot be divorced from the process of building up bridges or connections between the different sciences n, cc Unified science and its encyclopedia P, in: Philosophicalpapers, p. 175.

HANS-JOACHlM DAHMS
DIE ,,ENCYCLOPEDIA OF UNIFIED SCIENCE" (IEUS). IHRE VORGESCHICHTE UND IHRE BEDEUTUNG F~JR DEN LOGISCHEN EMPlRlSMUS
1. Zur Vorgeschichte und Entstehung der IEUS
Die historische Forschung hat sich der Geschichte der .International Encyclopedia of Unified Science" (IEUS) erst relativ spat angenornrnen, teils wohl, weil sie ein Torso geblieben ist,' teils auch, weil ihre Publikationsgeschichte bis in die jungere Gegenwart hineinragt und deshalb vielleicht weniger fur historische Studien geeignet erschien.
Ich beginne rnit der Vorgeschichte des Werks, das, wie wir sehen werden, seine Wurzeln schon zu Beginn der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte. Otto Neurath als chief editor hat daruber selbst verschiedentlich irn Briefwechsel mit seinern Mitherausgeber Charles Morris gesprochen, allerdings so, dass die Datierung und die naheren Urnstande nicht unrnittelbar hervorgehen. Er schreibt z.B. an Morris irn Vorfeld des 1. Kongresses fur Einheitswissenschaft 1935 in Paris Fol- gendes:
Ich beschaftige rnich rnit dern Plan einer Enzyklopadie - der viele Wandlungen durchgernacht hat - uber 15 Jahre. Es ist lange her, seit ich mit EINSTEIN, und HAHN, anderen Mathern. und Physi- kern hoch uber Wien, am Kahlenberg den Plan zurn ersten Ma1 entwickelte. Darnals in anderern Zusarnrnenhang. Mehr als AUFKLARUNG gedacht, wie die alten Enzyklopadisten, von EINSTEIN auch in diesern Sinn ... aufgefal3t. Alles kornrnt rnal an die Reihe.
Was Einstein ihrn darnals rnitgeteilt haben soll, geht aus einern weiteren Brief Neuraths an Morris hervor, in dern Neurath Einstein wie folgt zitiert:
Sie haben rnich davon uberzeugt, dass Ihr Plan zur Herstellung einer Volksbibliothek geeignet ist, dazu zu fuhren, dern tiefen Bildungsbedurfnis zahlreicher Menschen in wirklich wirksamer Weise entgegenzukornrnen. Ihr Unternehrnen kann fur die breite Masse eine ahnliche Bedeutung gewinnen wie die Enzyklopadie irn

106 Hans-Joachim Dahrns
18. Jhd. fur das gebildete Frankreich. Ich bin gerne bereit, nach besten Kraften mitzuarbeiten und werde bemuht sein, tuchtige und wohlgesinnte Fachgenossen fur lhren Plan zu intere~sieren.~
Hier stellen sich sofort eine ganze Reihe von Fragen, denen ich im Folgenden nachgehen werde: - Wann sol1 das gewesen sein? - Was waren das fur Plane? - Was haben Neurath und Einstein daruber auf dern Kahlenberg diskutiert bzw. davor undloder danach schriftlich ausgetauscht? - Welche weiteren Stadien haben diese Plane durchlaufen?
1.1 Der Plan einer Volksbiicherei (1 921)
Zunachst zur Datierung: Einstein ist insgesamt viermal in Wien gewe- sen13 und zwar 1910, 1913, 1921 und 1931. Beim ersten Termin 1910 ging es um Verhandlungen mit dern ~sterreichischen Unterrichts- ministerium wegen seiner Berufung an die deutsche Universitat in Prag, beim zweiten 1913 besuchte er die Jahresversammlung deutscher Naturforscher und ~ r z t e . Diesen beiden Daten liegen offenbar zu fruh, da Neurath im Brief an Morris m a r von Jber funfzehn Jahre" schrieb, aber vermutlich .uber zwanzig Jahre" geschrieben hatte, wenn er 1910 oder 1913 gemeint hatte. Zum letzten Mal war Einstein 1931 fur einen Vortrag am physikalischen lnstitut der Universitat in Wien. Dies Datum liegt aus entsprechenden Grunden offenbar zu spat.
Dazwischen aber akzeptierte Einstein fur den Januar 1921 eine Einladung der Urania sowie der Chemisch-Physikalischen Gesellschaft in Wien. Dabei gab er zunachst einen mehr technischen Vortrag fur Wissenschaftler und am 13. Januar einen fur das allgemeine Publikum im grol3en Konzerthaussaal vor 3000 Menschen. Davon hat Philipp Frank, sein Nachfolger auf dern Lehrstuhl fur theoretische Physik in Prag, der ihn kurz zuvor dorthin eingeladen hatte und ihn nun nach Wien begleitete, in seiner Einsteinbiographie beri~htet.~ In einem Zeitungsbericht eines insiders in der Neuen Freien Presse vom 5. Februar wird aul3erdem von einem anschlieflenden Treffen Einsteins .in kleinstem Kreise" gesprochen, der in Franks Buch nicht erwahnt ist. Ob damit allerdings das oben genannte Zusammensein Einsteins mit den ehemaligen Mitgliedern des so genannten Ersten Wiener ~ r e i s e s ~ und zukunftigen Mitgliedern des Schlick-Zirkels Frank, Hahn und Neurath auf dern Kahlenberg oberhalb Wiens gemeint ist, geht aus dern Bericht nicht hervor. Dies ist aber unwahrscheinlich, weil das Treffen, wie wir sehen werden, schon vor dern Vortrag stattgefunden

Die ,,Encyclopedia of Unified Science" 107
haben soll. Aber ganz offensichtlich hat es ein solches Treffen rnit Einstein gegeben, bei dern auch die Grundung einer neuen Volks- bucherei im Sinne der franzosischen Aufklarung zur Sprache karn. Denn aus dieser Zeit datiert ein entsprechender Briefwechsel Neuraths rnit Einstein. Aus diesern Briefwechsel hat Neurath gegenuber Morris ijbrigens auch ganz korrekt zitiert.
Worum geht es nun in diesem Briefwechsel aus dern Jahre 1921 im Einzelnen? Er beginnt mit einern Brief Neuraths vorn 12. Januar 1921, in dern dieser sich auf ein Treffen vom Vortag bezieht und Einstein bittet,
lhre Zustirnrnung zu dieser Fassung (der Unterredung, Dahrns) moglichst ausfuhrlich rnir zukornrnen zu lassen, damit ich gestutzt darauf, die Verhandlung rnit anderen Mitarbeitern und Verlegern in Angriff nehmen kann.6
Das inhaltliche Ergebnis der Besprechung selbst fasst Neurath so zusarnmen:
Sie haben sich bereit erklart, als Herausgeber einer Sarnrnlung wissenschaftlicher Volksbucher zu zeichnen, welche dazu bestimmt ist, weiteren Kreisen der Bevolkerung, vor allern der Arbeiterschaft, Wissen aller Art zu verrnitteln. Es sol1 dabei das Ziel verfolgt werden, nach dern Bildungsgrad abgestufte Reihen von Bandchen rnit einander zu verknupfen und uberhaupt die Sarnmlung syste- matisch zu gestalten ... Ein urnfassendes Sachregister sol1 die vollstandige Sarnmlung zurn Ersatze eines Konversationslexikons machen.
Der ins Auge gefasste Adressatenkreis wird auch irn letzten Satz des Briefes noch einrnal genannt, wo davon die Rede ist, man konne einen Teil der Sarnrnlung .fur Zwecke des Betriebsrateunterrichts und des Arbeiterunterrichts uberhaupt" ausgestalten, urn so ,,eine bedeutsarne Anregung fur die Zukunft" zu erhalten.
Fur die Redaktion der physikalischen Abteilung der Volksbiicherei werden schon die Narnen Frank (Prag) und Lowy (Wien) genannt, die in der vorangegangenen Diskussion Einsteins placet erhalten hMten. Im letzten Absatz des Schreibens spricht Neurath die Hoffnung aus, dass nicht nur Physiker, sondern auch Manner anderer Wissensgebiete als Mitarbeiter leichter zu gewinnen sein wurden, wenn Einstein als Herausgeber einer solchen Sarnrnlung zeichnen wurde.

108 Hans-Joachim Dahms
Es scheint nun aber, dass gerade dieser - sicher fur Werbungs- zwecke hochst wichtige Punkt - wahrend der Besprechung so noch nicht erwahnt worden war, denn schon auf Neuraths Brief findet sich der - vermutlich von einer Sekretariatskraft Einsteins angebrachte - handschriftliche Vermerk Anfrage wer ausser Prof. E. als Herausgeber figurieren soll", welche Verpflichtungen gegenuber einem Verlag Einstein daraus erwachsen konnten, und wie lange ihn eine solche Zusage binden wurde.
In seinem Antwortbrief an Neurath vom 3. Marz 1921' nennt Einstein den von Neurath ins Auge gefassten Plan zunachst .sehr wertvollu. Er sei bereit, ihn nach besten Kraften als Mitarbeiter zu unterstutzen. Seine wissenschaftlichen und anderen Tatigkeiten rnach- ten es ihm aber unmoglich, sich auch als Herausgeber zur Verfugung zu stellen: .dies ware eine Vorspiegelung falscher Tatsachen und muss unterbleiben.'
lmmerhin nennt er weitere potentielle Mitarbeiter und fugt auch einen Werbebrief fur potentielle Verleger bei. Als Mitarbeiter fuhrt er den Gestaltpsychologen Max Wertheimer, den (falschlich mit dem Initial .W." statt .H.") abgekurzten Hans Reichenbach von der Universitat Stuttgart als Experten fur Physik, Technik und Erkenntnistheorie und den spater auch als pazifistischen und demokratischen Kampfer an der Universitat Heidelberg hervorgetretenen (und deshalb von ihr ver- wiesenen) Ludwig Gumbel als Experten fur Physik und Mathematik an. Sollten ihm noch andere potentielle Autoren einfallen, werde er Neurath ihre Adressen mitteilen.
Nun aber der .fur Werbe-Zwecke" beigelegte Brief: es handelt sich (bis auf orthografische Varianten) um genau dasselbe Schreiben, mit dem Neurath 15 Jahre spater Charles Morris zu beeindrucken suchte (ohne freilich den Entstehungskontext dieses Schreibens dabei zu nennen).
Wir konnen also festhalten, dass der - nach seiner Verurteilung wegen .Hochverrat" in Munchen zu einer Gefangnisstrafe verurteilte und im Anschluss als unerwunschter Auslander abgeschobene und zum Zeitpunkt des Briefwechsels mit Einstein vermutlich noch arbeitslose - Neurath schon 1921 den Plan einer Volksbucherei zum Zwecke der Aufklarung weiterer Bevolkerungskreise erwogen hat und in diesem Zusammenhang von Einstein auf das Vorbild der fran- zosischen Aufklarungsenzyklopadie hingewiesen wurde.' Der Enzy- klopadieplan, wie er in den 30er Jahren von Neurath und anderen verfolgt wurde, geht insofern zwar auf Plane Neuraths zuruck, die ldee aber, ihn in die Traditionslinie der Aufklarung einzuordnen, stammt

Die ,,Encyclopedia of Unified Science" 109
nicht von Neurath, sondern von Einstein. Der Plan karn ubrigens auf, Jahre bevor Neurath uberhaupt in Kontakt rnit dern 1921 ja uberhaupt noch nicht existierenden Wiener Kreis und dessen logischen Empi- risrnus kam.
Warurn aus diesem ersten Plan nichts geworden ist, kann man nur vermuten: die .Zugnurnmer" Einstein war als Herausgeber und darnit als Reklarneschild des ganzen Unternehrnens weggefallen, und schon bei der Auswahl von Mitarbeitern fur den Bereich der Physik zeichneten sich divergierende Personalvorstellungen ab. Nicht zuletzt durfte die sich verscharfende Wirtschaftskrise der friihen Nachkriegszeit in Osterreich und Deutschland dern Plan den Garaus gemacht haben.
Von den fruhen Planen Neuraths einer Zusarnmenarbeit rnit Einstein blieb aul3er dern irn "Werbebrief" hervorgehobenen Anknup- fung an die franzosische Aufklarung auch spater nichts uber. Denn Einstein, zusarnmen rnit Russell und Wittgenstein einer der Saulen- heiligen des Wiener ~ r e i s e s , ~ wurde zwar 1935, als es rnit der empiristischen Enzyklopadie ernst wurde, zum ersten Kongress fur Einheit der Wissenschaften in Paris eingeladen. Er gab Neurath aber rnit Hinweis auf Terrninschwierigkeiten in einern ganz unpersonlichen Brief eine Absage und hielt sich auch aus allen anderen Beteiligungen an der IEUS heraus. An seiner Stelle wurde als reklametrachtiger .big name" von dern in Dingen der Werbung erfahrenen Neurath dann Niels Bohr gewonnen.1°
1.2 Der Plan eines Leselexikons (1 928)
Ungefahr in die Mitte dieser beiden Ereignisse, also dern Auftauchen erster Plane fur eine rnoderne Enzyklopadie 1921 im Sinne der Aufklarung einerseits und dern ersten Kongress fijr Einheit der Wissenschaft 1935 in Paris, auf dern das Projekt der IEUS beschlossen wurde, andererseits, namlich ins Jahr 1928, fallt ein erneuter Anlauf Neuraths fur eine Art von Enzyklopadieprojekt. Es stand nun nicht rnehr unter dern Arbeitstitel .VolksbuchereiU, sondern wurde von Neurath .LeselexikonU genannt. Man fragt sich vielleicht, was man denn rnit einern Lexikon noch anderes als Lesen veranstalten kann (vielleicht ein defektes Mobelstuck abstutzen). Aber das Wort war darnals von Neurath offenbar so gemeint, dass keine alphabetische, sondern eine systematische Ordnung der einzelnen Teile des Lexikons vorgesehen war, so dass eine kontinuierliche zusammenhangende Lekture errnog- licht wurde.

110 Hans-Joachim Dahms
Die Plane dafur sind wesentlich detaillierter uberliefert als die ldeen fur die vorhergehende .VolksbuchereiU. Als Aufgabe des Leselexikons gab Neurath an:
einerseits in zusammenhangenden Darstellungen, die auf eine lange Reihe von Bandchen zu verteilen waren, einen [Jberblick uber den heutigen Stand des Wissens zu geben, gleichzeitig aber auch durch einen General-Register und mehrere Spezialregister diese Sammlung einzelner Bandchen zu einem Konversations- lexikon im alten Sinne zu machen."
Fur dieses Unternehmen hoffte Neurath mit 100 Bandchen im Roman- Format zu je etwa 7 Bogen .das Auslangen finden" zu konnen.
Als Adressaten war wie bei der nicht zu Stande gekommenen Volksbucherei zunachst einmal wieder an Arbeiter und Angestellte, dann aber auch an jene burgerlichen Kreise" gedacht, .welche mit der Vergangenheit zu brechen bereit sind". Es ist charakteristisch fur die Gedankenrichtung Neuraths auch nach dem gescheiterten Projekt von 1921, dass er fur die Begrundung der Aktualitat des Leselexikons die von Einstein aufgebrachte Parallele zur franzosischen Aufklarung und ihre Enzyklopadie suchte. Sein neues Projekt sei jetzt zeitgemal3, so fuhrte er aus, denn:
Das Zeitalter der franzosischen Revolution hat in der grande encyclopedie eine Zusammenfassung der neuen Denkrichtung gefunden. Wir haben nur Herders Lexikon, das auf katholischer Grundlage beruht, Brockhaus, Meyer, welche durchaus nationalis- tischen und reaktionaren Tendenzen huldigen.
Wenngleich sein Leselexikon .frei von aller Politik" sein solle, musse es doch .im Sinne der kommenden Weltanschauung empiristisch, unmeta- physisch gerichtet seinU.l2
Der Inhalt und Aufbau der geplanten Bandchen entspricht dem Adressatenkreis und der Zielsetzung:
I. Sterne und Steine (Astronomie, Geologie, Mineralogie) 5 Bandchen II. Wanzen 3 Bandchen Ill. Tier ohne Mensch 10 Bandchen IV. Der Mensch (dazu gehort Gesellschaft und Wirtschaft, Technik, Kunst, Religion, Wissenschaft, Betrieb usw. 60 Bandchen)

Die ,,Encyclopedia of Unified Science"
V. Logik und Mathematik 2 Bandchen VI Geometrie, Physik, Chemie 10 Bandchen VII. Allgemeine Biologie und Physiologie 10 Bandchen.
Man erkennt hier leicht, wie sich das Verhaltnis zwischen den Schwerpunkten im ljbergang von diesem Leselexikon zur spateren IEUS verandert, um nicht zu sagen: fast umgekehrt hat (Man denke: 60 Bande .Der Mensch" gegenuber 2 fur Logik und Mathematik!). Auch war noch an Erganzungsbandchen etwa uber Kino, Theater, Woh- nungseinrichtung, bis hin zu Kleingarten und Kleintierzucht gedacht. Wie dann auch spMer fur die IEUS sollte .Bildstatistik - wo irgend moglich zur Anwendung zu bringen" sein.
Der Zeitplan sah so aus, dass mit den redaktionellen Arbeiten im Oktober 1928 begonnen, fruhestens im Herbst 1930 mit der Publikation (und m a r moglichst mit den ersten 15 Bandchen auf einmal) ange- fangen und bis 1938 jahrlich etwa 5-6 Bandchen erscheinen sollten, also genau zu jenem Zeitpunkt, als dann die ersten Monographien der IEUS tatsachlich erschienen. Dann waren aber nach Neuraths Planen auch schon Neuausgaben von Heften fallig gewesen, wobei ein lnnovationszyklus fur die Hefte iiber Physik alle 6-7 Jahre, uber Technik alle 3-5 Jahre, uber Gesellschaft und Wirtschaft alle 1-2 Jahre vorgesehen wurde. Hier begegnen wir einem deutlichen Bewusstsein davon, dass eine Enzyklopadie kein .Mausoleumn nur bisheriger wis- senschaftlicher Ergebnisse sein durfe, sondern jenes "living thing", von dem Neurath spater hinsichtlich der IEUS so oft gesprochen hat, allerdings, ohne dort aber noch an lnnovationszyklen zu denken, geschweige denn, sie explizit fur verschiedene Wissenschaftsbereiche festzulegen.
Wie er sich die Rekrutierung von Mitarbeitern und dann vor allem die Organisation der standigen [Jberarbeitung ihrer Beitrage vorgestellt hat, weis ich nicht. Das ganze Projekt hat sich jedenfalls nicht reali- sieren lassen, vermutlich nicht zuletzt auch deshalb nicht, weil zwi- schen dem Arbeitsbeginn der Redaktion und dem geplanten Publi- kationsstart der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Oktober 1929 lag, die ja auch so vie1 anderen hoffnungsvoll begonnenen Kooperationen auf wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet den Garaus gemacht hat.

112 Hans-Joachim Dahrns
2. Die Enzyklopadie der Aufklarung als Vorbild fiir die IEUS
lrgendwelche lndizien dafur, dass sich Neurath vor jenem Pariser Kongress fur Einheit der Wissenschaft 1935, als das Projekt der IEUS beschlossen wurde, genauer rnit der franzosischen Enzyklopadie aus- einandergesetzt hatte, habe ich nicht gefunden. Aber im Briefwechsel mit Morris, rnit dem er uber die historische Einbettung der IEUS offenbar lieber korrespondierte als mit dern anderen Mitherausgeber Carnap, schrieb er im Marz 1936:
Es ist nicht leicht in diesem Moment der Krise auch nur so ein "Gerust" der Gesamtwissenschaft aufzubauen. Ich las jetzt einiges uber die Entstehung und die Einzelschwierigkeiten der gronen Enzyklopadie. Da gab es noch ernstere Widerstande - inklusive der Todesstrafe - aber auch eine lebendigere Anhangerschaft. Aber das Werk war vie1 umfangreicher und kostspieliger herzustellen, als unser ~ 1 a n . l ~
Spater, als die ersten Spannungen unter den ins Auge gefassten Mitarbeitern der neuen Enzyklopadie sich abzeichneten, schrieb er wie zurn Trost an Morris:
Oh, welcher Jammer wars, als die GRANDE ENCYCL. im 18. Jahrhundert erschien. Trostlos. Der Drucker hat nach der letzten Korrektur noch alle Aufsatze geandert und die Manuskripte ver- nichtet, so dass wir nicht ma1 wissen, was die Autoren geschrieben haben. Wie herrlich werdet Ihr in Chicago (gemeint sind Morris und Carnap, Verf.) alles begutachten; aber vielleicht sind wir auch nicht so urnsturzend, wie die darnals waren.
Was Neurath da irn einzelnen gelesen hat, ist rnir nicht bekannt. Die einzigen Bucher, die ich in seinern Nachlass zu diesem Therna erwahnt gefunden habe, sind Morley, John: Diderot and the Encyclopaedists und Rosenkranz, Karl: Diderot's Leben & Werke. Darin finden sich auch die von Neurath genannten Episoden. Dafur, dass sich irgend einer der anderen Beitrager der IEUS jernals fur die Enzyklopadie der Aufklarung interessiert hat, geschweige denn ihre Geschichte studiert hat, habe ich keinen Beleg finden konnen.
Neurath hat dann in seinem Beitrag zum ersten Heft der IEUS an rnehreren Stellen die Verpflichtung auf die Tradition der franzosischen Aufklarungsenzyklopadie betont. So heiM es dort:

Die ,,Encyclopedia of Unified Science" 113
The International Encyclopedia of Unified Science aims to show how various scientific activities such as observation, experimen- tation, and reasoning can be synthesized, and how all these to- gether help to evolve unified science. These efforts to synthezise and systematize whereever possible are not directed at creating the system of science; this Encyclopedia continues the work of the famous French Encyclopedie in this and other respects.14
Die Ablehnung eines abschlieaenden Systems wird auch sonst verschiedentlich als hauptsachliche Gemeinsamkeit zwischen der IEUS und der Enzyklopadie der Aufklarung im Negativen genannt. Anderer- seits scheint es aber, dass die Aufklarungsenzyklopadie Neurath in Richtung von Synthese und Systematisierung nicht weit genug ge- gangen ist. Denn er schreibt uber sie u.a.:
This encyclopedia had no comprehensive unity despite the expres- sion of a certain empirical attitude; it was organized by means of a classification of sciences, reference and other devicest5
oder, dass die Enzyklopadisten .made no attempt to organize a logical synthesis of science". Das war aber nun ein Ziel, auf das Neurath mit seiner IEUS besonders hinauswollte, wenn er schrieb: .This Encyclo- pedia (d.h.: die IEUS, Dahms) will show modern attempts to reform generalization, classification, testing, other scientific activities, and to develop them by means of modern logic."16
Als eine weitere Gemeinsamkeit wird ohne Einschrankung eine relativ offene Attitude der alten Enzyklopadisten gelobt. An dlAlembert wird etwa jene Toleranz und Kooperationsbereitschaft hervorgehoben, die ihn dazu gebracht habe, etwa Rousseau als vehementen Kritiker der Wissenschaft desungeachtet groaere Teile der Enzyklopadie schrei- ben zu lassen.17 Diese Haltung sollte auch in der IEUS nachgeahmt werden.
lndes gibt es auch deutliche Abgrenzungen gegenuber der alten Enzyklopadie. Dies sind aufler der schon erwahnten zu geringen Integ- ration ihrer einzelnen Bestandteile: - eine zu lasche Einstellung gegenuber Religion und ~ e t a ~ h ~ s i k ' ~ , - der alphabetische Aufbau. Neuraths Einstellung gegenuber der alten Enzyklopadie ist also nicht ganzlich positiv. Dass er von allen Vorganger-Enzyklopadien am meis- ten an sie anknupft, hangt wohl auch damit zusammen, dass er von den Enzyklopadien bzw. den entsprechenden Projekten von Comenius,

114 Hans-Joachim Dahms
Leibniz, Hegel, Comte und Spencer, die er auch in seinem Einleitungs- beitrag zur IEUS kursorisch diskutiert,lg noch weitaus weniger halt. Alles in allem reichen ihm die Vorbildfunktionen der alten Enzyklopadie aber aus, um von sich und seinen Mitstreitern als .Neuen Enzyklo- padisten" (im Sinne der Aufklarung) zu reden.
Neuraths Betonung der Aufklarung als Ziel der neuen Enzyklopadie konnte sein Mitherausgeber Morris nun ebenso wenig abgewinnen wie Neuraths Charakterisierung der Mitarbeiter des neuen Projekts als .neuen Enzyklopadisten". So schrieb er Neurath am 13. Juli 1937:
It seems to me that the phrase 'Neue Enzyklopadistenn should be your own private one, rather than an official title, because such a title has connotations which many persons otherwise interested in the movement are not inclined to accept. Thus many persons' interest is going to be purely scientific. Furthermore I think that while there are some real relations to the french encyclopedists, I think that our movement is wider and with a somewhat different orientation - at least for many members. Thus our Enc. is really addressed to a different reading public than the French Enc. was.
Am Unterschied bei den Adressaten der alten und der neuen Enzyklopadie ist ja durchaus etwas daran. Und dieser Unterschied wird noch plastischer, wenn man zum Vergleich noch jene Arbeiter und Angestellte sowie die fortschrittlichen burgerlichen Kreise mit heran- zieht, die Neurath zuvor fur seine Volksbibliothek sowie sein Lese- lexikon und dessen aufklarerische Ziele hatte begeistern wollen. Die Gewichte hatten sich auf dem Wege zur IEUS ganz in Richtung eines wissenschaftlichen Publikums verschoben. Aber es ist die Frage, ob Morris sich bei seiner Ablehnung des Terminus .Neue Enzyklopadisten" sich nicht implizit auch gegen die bei der alten Enzyklopadie mitschwingende ldee der Aufklarung hat wenden wollen, wenn er von den .connotationsu schrieb, die einige an reiner Wissenschaft inter- essierte Anhanger der empiristischen Bewegung vielleicht nicht akzep- tieren konnten.
Und die Frage ist ja tatsachlich die: steht eine sich auf die Wissenschaft beschrankende und nur an Wissenschaftler sich wenden- de Enzyklopadie nicht schon per se einem aufklarerischen Anspruch im Wege?

Die ,,Encyclopedia of Unified Science" 1 15
3. Schlussbetrachtungen
Statt mich nun mit dieser Frage auseinanderzusetzen, mochte ich mich in zwei abschliehenden thesenartig formulierten Gedankengangen auf Themen konzentrieren, die durch die obige Schilderungen besonders nahe gelegt werden, namlich - das Verhaltnis der logischen Empiristen zu Geschichte und Tradition einschliefilich historischer Vorbilder fur das eigene wissen- schaftliche und philosophische Schaffen und - das Verhaltnis der synthetischen Tendenzen, wie sie durch den Plan und die partielle Durchfuhrung einer Enzyklopadie ja ips0 facto gegeben sind, zur sonst immer als Charakteristik fur den neuen logischen Empirismus herausgestellten analytischen Haltung.
3.7 Das Verhaltnis des logischen Empirismus zur Geschichte und zu historischen Vorbildern
Sowohl in den Eigendarstellungen als auch bei den Kritikern des logischen Empirismus findet sich durchweg eine antihistorische Hal- tung. Man denke nur etwa an jene plakative Formulierung in der Pro- grammschrift des Wiener Kreises, der zufolge sie sich .mit Vertrauen an die Arbeit" machen wollten, den .metaphysischen und theologischen Schutt der Jahrtausende aus dem Wege zu r a ~ m e n " . ~ ~
Da die Tendenz zumindest in den Anfangsjahren des logischen Empirismus sehr stark war, den Begriff der Metaphysik und damit auch den Bereich des aus dem Weg zu raumenden Schutts sehr weit zu fassen, muss man sich nicht daruber wundern, wenn Kritiker wie Max Horkheimer den .Positivistenu eine barbarische Haltung zu Geschichte und Tradition attestierten und gelegentlich in ihrer Polemik so weit gin- gen, ihre Einstellung mit jener gleichzusetzen, wie sie sich .bei nationa- len Freudenfeuern" (gemeint sind damit die nationalsozialistischen Bucherverbrennungen) zeige.
Dazu mochte ich nun zwei Bemerkungen machen: Erstens ist die antihistorische Haltung der logischen Empiristen eine, die auch sonst in jenen kulturellen Kreisen, in denen sie sich bewegten und als deren Teil sie sich im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Weltauffassung fuhl- ten, sehr weit verbreitet gewesen ist. Ich meine insbesondere die moderne Malerei und Architektur der 20er ah re.*' In den Publikations- organen der damaligen Architektenszene wie der .Formu oder dem "Neuen Frankfurt" findet man immer wieder plakative Gegenuber- stellungen von modernen Bauten und Einrichtungsgegenstanden mit traditionellen, bei denen die letzteren nicht im Detail kritisiert, sondern

116 Hans-Joachim Dahms
mit dicken roten Balkenkreuzen schlichtweg durchgestrichen werden. Von ahnlicher Art scheinen mir nun auch viele Auseinandersetzungen des Wiener Kreises mit der .Metaphysik" zu sein.
Einer ausgesprochen antihistorischen Haltung scheint die Berufung auf die Tradition der franzosischen Aufklarung und ihre Enzyklopadie nun zu widersprechen. Denn damit legte die IEUS sich ja auf eine bestimmte fortschrittliche historische Traditionslinie fest. Ich glaube aber, dass dieser Widerspruch nur ein scheinbarer ist. Denn wie wir gesehen haben, stiel3 Neuraths Versuch, die Mitarbeiter der IEUS als .Neue Enzyklopadistenu zu bezeichnen, schon bei seinem Mitheraus- geber Morris auf keine Gegenliebe. Und in den erschienenen Monogra- phien der IEUS habe ich vergeblich nach Berufungen auf die Tradition der Aufklarung und ihre Enzyklopadie gesucht. Man muss aus diesen negativen Befunden wohl schliehen, dass Neuraths Versuch, der Bewegung des logischen Empirismus ein gewisses historisches Be- wusstsein und Traditionsverstandnis einzuhauchen, im Wesentlichen gescheitert ist.
3.2 Synthese als Ziel des logischen Empirismus
Das Zerrbild vom logischen Empirismus als .Positivismus", wie er von vielen Kritikern kultiviert worden ist, sieht in ihm nun nicht nur eine antihistorische Bewegung, sondern auch eine, die sich das Sammeln einzelner Fakten zum einzigen Ziel gesetzt habe und sich jede Vorstellung von jenem Ganzen, als dessen Teile diese Einzelheiten nur einen Sinn machen, ersparen wolle.
Auch diese Vorstellung bedarf nach der Kenntnisnahme von der IEUS und ihren Zielen einer kritischen Diskussion.
Comprehensiveness arises ... as a scientific need and is no longer a desire for vision only. The evolving of all such logical connections and the integration of science is a new aim of science.22
Diese und ahnliche ~uherungen Neuraths zu den Zielen der IEUS zeigen, dass er die Charakterisierung des logischen Empirismus durch die analytische Methode, wie sie schon in der erwahnten Pro- grammschrift des Wiener Kreises prominent auftritt, durch eine synthetische Tendenz erganzen wollte. Hatte es dort noch geheihen, dass es die .Methode der logischen Analyse" sei, .die den neuen Empi- rismus und Positivismus wesentlich von dem fruheren unterscheidet, der mehr biologisch-psychologisch orientiert war",23 so ruckt durch die Arbeit an der IEUS die Tatigkeit des Zu-einander-in-Beziehung-Set-

Die ,,Encyclopedia of Unified Science" 117
zens, des Bruckenbauens, des lntegrierens verschiedener Wissen- schaftszweige, Teildisziplinen und Theorien in den Vordergrund.
Diese Synthese erstrebte eine Art von Gesamtwissenschaft. Und da Synthesen in der zeitgenossischen Philosophie sehr haufig ange- strebt wurden, ist der logische Empirismus mit dem Aufbau der IEUS traditionellen Vorstellungen von Philosophie, die sie als umfassende Weltanschauung ansahen, nun scheinbar vie1 naher als fruher.
Die entscheidende Differenz zwischen Weltanschauung und wis- senschaftlicher Weltauffassung, wie sie sich in der IEUS manifestieren sollte, fallt naturlich bei der Ausgestaltung des Programms der Gesamtwissenschaft. Was ist das eigentlich: Gesamtwissenschaft? Es konnte ein merkwurdiges Zwitterding zwischen Wissenschaft und Philo- sophie sein. Das schlient Neurath aber explizit aus:
The historical tendency of the unity of science movement is toward a unified science departmentalized into special sciences, and not toward a speculative juxtaposition of an autonomous philosophy and a group of scientific disciplines.24
lnsbesondere schlient er ein comeback der Philosophie als eine Art von Superwissenschaft, etwa in Form einer .science of science" aus.
Das bedeutet aber dann einen ungeheuren Transformationsauf- wand besonders fur die bisherige Philosophie, aber auch fur weite Bereiche einzelwissenschaftlicher Disziplinen. Im Fall der Philosophie mussten diesem Umformungskonzept zufolge alle ihre ehemaligen Teilbereiche entweder integral ubernommen (wie die moderne Logik), aufgegeben (wie z.B. Metaphysik oder Religionsphilosophie) oder, soweit sie noch immerhin aufhebenswerte Bestandteile enthalten, in spezielle Wissenschaften uberfuhrt werden (wie etwa Ethik oder ~sthetik, die als neue Bestandteile in eine empirische Psychologie zu integrieren waren).
Aber die Gesamtwissenschaft konnte auch die bestehenden Wissenschafien nicht einfach in sich aufnehmen und zueinander in Beziehung setzen, weil einzelne davon entweder noch nicht restlos metaphysikfrei seien (wie etwa die Soziologie oder die Psychologie), oder noch nicht den bestmoglichen Systematisierungsgrad erreicht hatten. lnsofern setzt das Geschaft der Synthese zur gesamtwissen- schaftlichen Enzyklopadie eine ganzliche Umformung fast aller jener Bestandteile voraus, die dann erst synthetisiert werden konnten.
Das Programm dieser Synthese enthalt insofern nicht ein zuwenig an Gesamtschau und .Totalitat", wie die Kritiker des .Positivismusu

118 Hans-Joachim Dahms
gemeint haben, sondern im Gegenteil den Vorsatz einer geradezu utopischen Umwalzung alles bisherigen Wissens.
Die IEUS ist bekanntlich Torso geblieben.25 Die Frage ist: war das Zufall oder sozusagen Notwendigkeit, also bedingt durch Mangel ihrer Konstruktion? Gewiss, die IEUS hatten unter den denkbar unguns- tigsten Zeitumstanden zu leiden. Sie reichen von mehr personlichen und kontingenten Ursachen wie etwa der Saumigkeit von Beitragern, die zum Teil durch Vertreibung, Emigration, Arbeitslosigkeit verscharft wurden, bis zum Einbruch zeitgeschichtlicher Grollereignisse wie dem Beginn des Zweiten Weltkriegs mit seinen Folgen fur die IEUS. Neurath als Hauptherausgeber fand sich nach seiner Flucht aus den Nieder- landen plotzlich in einem britischen lnternierungslager wieder, einige seiner Beitrager waren zum Kriegsdienst bzw. anderweitigen kriegs- bedingten Beschaftigungen eingezogen. Schliel3lich gehort zu diesen Widrigkeiten auch der Tod des Hauptherausgebers Neurath im Dezem- ber 1945 (mit einigen Nachfolgewirren um die Regelung der juristischen Nachfolge).
Meine These ist nun aber, dass die IEUS nicht nur an historischen Umstanden gescheitert ist, sondern auch an einer eingebauten Fehlkonstruktion, namlich an ihrer vie1 zu rigiden Programmatik, eben dem Programm der .Gesamtwissenschaft". Wenn man das Gesamt der Wissenschaft nicht nur zusammenstellen und die dazu gehorenden Disziplinen miteinander verknupfen will, muss man sich genauso vor utopischen Vorgriffen auf ein vielleicht einmal dereinst erreichbares Stadium von deren Transformation - etwa im Sinne des Physikalismus - hiiten wie vor dem Gespenst des endgultigen Systems, das der Aufklarungs-Enzyklopadie als negatives Beispiel vor Augen stand. Sonst bleibt man im Programmatischen stecken (exemplifiziert etwa durch Neuraths eigenen Beitrag zur IEUS) oder stoat solche po- tentiellen Mitarbeiter ab, die geeignet waren, sich der Umsetzung einer solchen Programmatik zu nahern. Und das ist Neurath im Verlaufe der Arbeit an der IEUS mehr als einmal passiert.
Unveroffentlichte Quellen
Nachlass Otto Neurath (Harlem, NL) Briefwechsel NeurathlCharles Morris Entwurf zu einem Leselexikon (Sign:193 K 15)
Nachlass Albert Einstein (Pasadena, USA) Briefwechsel Einstein1 Neurath

Die ,,Encyclopedia of Unified Science" 119
Literatur*
Bohr, Niels (1938/1969), "Analysis and Synthesis in Science," in: Neurath u.a. (1 938169) 28.
Dahms, Hans-Joachim (1999), .Otto Neuraths ,International Ency- clopedia of Unified Science' als Torso. Bemerkungen uber die geplanten, aber nicht erschienenen, Monographien der Enzyklo- padie", in: Elisabeth NemethIRichard Heinrich (Hrsg.) Otto Neurath: Rationalitat, Planung, Vielfalt, W ien-Berli n, 1 84-227.
ders. (2001), .Neue Sachlichkeit in der Architektur und Philosophie der 20er Jahre", in: arch+. Zeitschrift fur Architektur und Stadtebau, Mai 2001, engl. Version: "Neue Sachlichkeit in the Architecture and Philosophy of the 1920s," in: Steve Awodey I Carsten Klein (eds.) Carnap Brought Home. The View from Jena, Chicago / La Salle (Illinois), 357-375.
Frank, Philipp (1949), Einstein. Sein Leben und seine Zeit, Munchen- Leipzig-Freiburg i. Br.
Neurath, Otto (1938169), "Unified Science as Encyclopedic Integration," in: ders./Bohr u.a. (1 938/69), 1-27.
ders. I Carnap, Rudolf / Hahn, Hans (1929), Wissenschaftliche Welt- auffassung. Der Wiener Kreis, Wien, abg. in: Neurath, Otto (1981), Gesammelte philosophische und methodologische Schriften (2 Bande), Hrsg. Rudolf Haller / Heiner Rutte, Wien.
ders. 1 Niels Bohr / John Dewey / Bertrand Russell 1 Rudolf Carnap I Charles W. Morris (1 938/69), Encyclopedia and Unified Science, Chicago
Uebel, Thomas (2000), Vernunftkritik und Wissenschaft: Otto Neurath und der erste Wiener Kreis, Wien-New York.
Anmerkungen
1. siehe Dahms (1999). 2. Einstein hat ubrigens an der seit 1938 erschienenen IEUS nicht mitgearbeitet, weder
als Beitrager noch als Vermittler zu Juchtigen und wohlgesinnten Fachgenossenu, obwohl er eigens (wie auch Niels Bohr, der anders als Einstein dann mitmachte) um einen kutzen Beitrag zurn ersten Heft gebeten worden war. W a r m es dazu nicht gekommen ist, weik ich nicht. Wahrscheinlich ist die Erklarung schon frijher zu suchen, da Einstein schon erfolglos zur Teilnahme am Pariser Kongress fur Einheit der Wissenschaft von 1935 eingeladen worden war (Neurath an Morris, 11.3.1935).

120 Hans-Joachim Dahms
Fur diese Information und weitere freundliche Hilfen danke ich Dr. Tilmann Sauer, Einstein-Edition-Project, PasadenalCal. (USA). Frank (1 949), 287ff. siehe zu dieser Gruppierung, aus der spater der bekannte Wiener Kreis hervorging, Uebel (2000). Neurath an Einstein, 12.1.1921 (ale Briefe aus der Korrespondenz EinsteinINeurath befinden sich im Einstein Edition Project (PasadenalUSA), nicht dagegen im Neurath-Nachlass (HaarlemlNL). Von diesem Brief existiert im Einstein-Nachlass nur ein handschriftlicher Entwurf (nebst Transkription) und keine Kopie. Aus einem Brief Neuraths an Niels Bohr aus dem Jahre 1937 geht ubrigens eben- falls hervor, dass es tatsachlich Einstein und nicht Neurath war, der zuerst diese Parallele gesehen hat. Man denke etwa an die Programmschrift des Wiener Kreises: Neurath (192911981) 332ff. Dessen Beitrag zum ersten Heft der IEUS bleib allerdings schon vom Umfang her eher symbolisch: Bohr (1938). Neurath-Nachlass 193 K 15: Entwurf zu einem Leselexikon. Als Beispiel fur eine solche unmetaphysische Ausrichtung wird genannt, dass der Mensch als Lebewesen unter anderen Lebewesen behandelt werden wurde, ein spateres Standardbeispiel Neuraths fur disziplinubergreifende Querverbindungen (etwa von Biologie und Soziologie) in der neuen Enzyklopadie. Neurath an Morris, 31.3.1936. Neurath (193811970), 2. ebenda, 8. ebenda, I 0 Das ist vielleicht ein Wink Neuraths an die Adresse der Frankfurter Schule gewesen, sich vielleicht trotz aller Wissenschaftskritik an dem Unternehmen der IEUS zu beteiligen. Bekanntlich hatte er sie fur eine Mitarbeit an der IEUS gewinnen wollen. Sie wird zumindest angedeutet, wenn von .not a few metaphysical and theological explanations in the work" die Rede ist. Neurath (1 93811 970), 5f., 15f. Neurath (192911981), 314. Dahms (2001). Neurath (I93811 969). Neurath (192911981), 305. Neurath (1 93811 969) 20. siehe fur einen Vergleich der publizierten mit den geplanten Teilen sowie fur einen Uberblick uber diejenigen nicht-publizierten Monographien, von denen wenigstens Archivalien vorliegen: Dahms (1999). Die Seitenzahlen der Beitrage zur IEUS werden nach der zweibandigen Ausgabe von I969 angegeben.

ANTONIA SOULEZ
DER NEURATH-STIL, ODER: DER WIENER KREIS, REZEPTION UND REZEPTIONSPROBLEME AUF DEN KONGRESSEN VON 1935 UND 1937 IN PARIS*
Bereits vor der Emigration der Mitglieder des Wiener Kreises in die USA waren dessen Thesen dort von philosophischer Seite vereinzelt zur Kenntnis genommen und diskutiert worden: Moritz Schlicks Kon- takte in die USA in den manziger Jahren sowie die Freundschaft mi- schen Ernst Mach und William James zeugen von gewissen Affinitaten zwischen dem amerikanischen Pragmatismus und den philosophischen Stromungen, die sich seit Ende des 19. Jahrhunderts in Zentraleuropa entwickelt hatten.' Seinen Weg nach England fand der logische Posi- tivismus - dank Alfred Ayer und Gilbert Ryle - in den fruhen dreil3iger ~ a h r e n . ~ Es erstaunt nicht, dass eine Bewegung, die sich ebenso auf Hume wie auf die neue Logik Russells und Whiteheads bezog, dort Ful3 fassen konnte.
ljber die Situation in Frankreich konnen wir offensichtlich nichts dergleichen sagen. Es sieht vielmehr so aus, als hatte sich hier nichts oder fast nichts getan. Dabei hat sich die Bewegung des Wiener Krei- ses zwei Mal an der Sorbonne vorgestellt, und m a r in den Jahren 1935 und 1937. Der erste Pariser Kongress von 1935 war ein Jahr zuvor in Prag - anlasslich einer Tagung unter dem Vorsitz des tschechischen Prasidenten Tomas Masaryk - sorgfaltig vorbereitet worden. Jean Ca- vailles hatte diese Tagung rnit grofier Aufrnerksamkeit verfolgt. Seine unter dem Titel .L1ecole de Vienne au congres a Prague" (Cavailles 1935) in der Revue de Metaphysique et de Morale erschienenen Beo- bachtungen zeugen von groaer Hellsichtigkeit und einem fur diese Epoche ungewohnlich weit gehenden Bemuhen um Verstandnis - ei- nem Bemuhen, das freilich ohne Wirkung blieb. Die Bewegung der ,,wissenschaftlichen Weltauffassung" zog in den dreiniger Jahren uber Frankreich hinweg, ohne irgendwelche - oder jedenfalls sehr wenige - Spuren zu hinterlassen.
Dabei scheint es fur diese Philosophie, als deren Quelle schon damals Wittgenstein galt, durchaus ein gewisses lnteresse gegeben zu haben. Eine kurze Bemerkung in der Revue de Metaphysique et de Morale von 1937 bespricht den Kongress desselben Jahres in England rnehr als nur zustimmend, vor allem das Expose von Schlick, der, so heint es hier, m a r nicht von der ,,Zukunft der Philosophie" spricht, dafur

122 Antonia Soulez
aber die .Philosophie der Zukunft" entwirft. Vorbehaltlos wird hier von einer .iJbergangsepocheU gesprochen, die von einem ,,Missverhaltnis zwischen der Metaphysik von gestern und der Reflexion von heute" gekennzeichnet sei. Es stellt sich freilich heraus, dass die Philosophen in Frankreich im allgemeinen an den ,,atten Prinzipien" hangen. Sie bleiben auf Distanz zur aktuellen Forschung in der Physik, weil sie mit der Beobachtung der Sachverhalte in der Natur nichts anzufangen wissen; sie schreiben noch Bucher uber die Philosophie anstatt - wie Wittgenstein empfohlen hatte - auf philosophische Weise zu schreiben. Man hatte gut daran getan, Lalande zu folgen, der schon vor diesen Tagungen die Bedeutung der formalen Gesetze des Denkens erkannt hatte und dessen Name gemeinsam mit Enriques, Joergensen oder Schlick genannt werden muss.
Dennoch: vieles, was im Jahr 1930 aut3erhalb Frankreichs gesche- hen ist, ist hier nicht unbemerkt geblieben. In einer weiteren, bereits 1914 erschienenen Nummer der Revue de Metaphysique et de Morale wird - in der Rubrik ,Informationsn - von der Entwicklung einer noch nie da gewesenen Bewegung in Deutschland gekundet, deren Existenz hinlanglich beweise, dass selbst in Deutschland die Philosophie nicht (wie in Frankreich iiblich) vorschnell mit dem ,,traditionellen Idealismus" identifiziert werden durfe. Ein Beweis fur diese .intensiveu Bewegung war die 191 1 erfolgte Formierung einer .positivistischen Gesellschaft" in Berlin, die sich zunachst um Ernst Mach (der damals schon in Wien war) gebildet hatte. Sie zahlte mehr als 50 Mitglieder und gab drei Mal jahrlich die "Zeitschrift fur positivistische Philosophie" heraus. Die Gruppe, ist hier zu lesen, sei vom Geist des Empiriokritizismus Avena- rius' gepragt. Unter den Unterzeichnern des Manifests finden sich Jo- seph Petzoldt, David Hilbert, Georg Helm, Sigmund Freud und Albert Einstein.
Eine solche .BewegungU hat als solche noch nichts Erstaunliches an ~ i c h . ~ lnsbesondere die Beziehungen zwischen Mach und Einstein sowie ihr Briefwechsel gehoren zum Abenteuer der Relativitatstheorie, die Mach vorbereitet, spater aber bekanntlich heftig angegriffen hat4 Den Charakter eines .Manifestsu jedoch - und als solches wird es hier angesprochen - hat das Programm eigentlich nichta5 Das Dokument des ersten offentlichen Auftretens der positivistischen Gruppierung in Berlin enthalt eine Liste von Mitgliedern, kundigt ihre Vortrage an und nennt die grot3en Fragen dieser europaischen Bewegung, die Wissen- schaftler aus allen Bereichen der Naturwissenschaft zusammenfuhrt im gemeinsamen Wunsch, den .wissenschaftlichen Geist in der Philoso- phie zu fordern". Ob in der Mathematik, der Geometrie, der Mengen-

Der Neurath-Stil 123
theorie, Physik oder Optik, ausnahmslos alle teilen sie Fragestellungen wie: Was ist Denken? Was sind Begriffe? 1st die Erkenntnis relativ oder absolut? Welche Verbindungen bestehen zwischen der Biologie, der Physik und der Psychologie? Zwar sucht der Leser hier tatsachlich vergeblich nach einem geschlossenen programmatischen Text wie im Manifest des Wiener Kreises .Wissenschaftliche Weltauffassung - der Wiener Kreis" von 1929; das einheitliche Anliegen jedoch, das all diese Wissenschaftler unterschiedlicher Herkunft zusammenfuhrt und das 18 Jahre spater in Wien proklamiert werden sollte, ist bereits da, sogar dringlich. Aber kehren wir zuruck ins Frankreich der 1930er Jahre.
Der Wiener Kreis auf dem Kongress von 1935 in Paris
Als sich 1935 der 1. Kongress fur wissenschaftliche Philosophie trifft - es handelt sich dabei um eine grol3e Premiere - hat der Wiener Kreis seine Bewegung ein Jahr zuvor im zentraleuropaischen Raum bekannt gemacht. Nach Paris kommt man in vollstandiger Besetzung, wenn auch - einmal mehr - Wittgenstein der grol3e Abwesende ist. Der fran- zosischen ~ffentlichkeit sol1 eine nie da gewesene philosophische Stromung vorgestellt werden, die freilich im Ausland bereits Aner- kennung gefunden hatte. Dennoch hatte sich der Wiener Kreis bislang noch nirgends so geschlossen prasentiert wie hier in Paris: fast vollzah- lig, wie eine Familie und in gemeinsamer Front. Den Organisatoren war sehr wohl bewusst, dass ihnen die philosophische ~ffentlichkeit, der sie sich zu stellen hatten, weitgehend fremd gegenuberstand. Und wenn man die Kongressakten liest, spurt man sehr deutlich die Burde, die sie mit der Einfuhrung dieser Bewegung in ein wenig freundliches Milieu auf sich genommen hatten.
Das Programm wird von seinen Vertretern in einem Stil vor- getragen, wie er von Philosophen nicht erwartet wird: es beansprucht, Resultate erzielt zu haben und in die Zukunft zu schauen. Man distan- ziert sich entschieden vom Konzept eines Kongresses der Spezialisten, die jeweils nur fur ihren Bereich sprechen. Und es gibt ein lebhaftes Gefiihl dafur, dass eine derartige Stromung erstmals im Lande Des- cartes' eingefuhrt wird. Das Bewusstsein um die Schwierigkeit dessen, was auf dem Spiel steht, ist in den Eroffnungsansprachen spurbar. Einzig Russell ist ganz wurdige Ruhe und Zuruckhaltung; als Meister der neuen Logik ist er unumstritten und hat (in Rougiers worten6) die .moralische Prasidentschaft" des Kongresses inne. Fur ihn lost dieser Kongress von 1935 das Versprechen des Kongresses von 1900 ein, als

1 24 Antonia Soulez
sich ihrn das Werk Peanos offenbart hatte. Frege und Peano, aber auch Leibniz, dessen Logik zu lange durch die Kant'sche Philosophie in den Hintergrund gedrangt war, kornmen hier nun endlich zu Ehren. Philipp Frank, der groneren Wert darauf legt, die Verwandtschaft der Mach'schen Erben rnit Poincare, Pierre Duhern und Abel Rey ins Ge- dachtnis zu rufen, stofit diejenigen vor den Kopf, die sich allzu gern auf Bergson, Meyerson und Boutroux berufen rnochten: Lagerstirnmung rnacht sich breit. Woher komrnt in Frankreich das neue lnteresse am Wiener Kreis? Philipp Frank liefert die ~ n t w o r t : ~ von Louis Rougier, Marcel Boll und General Vouillernin - die beiden letzteren waren die wichtigsten ijbersetzer bei Herrnann; ferner vorn Verlag Hermann (in der Person seines Direktors Paul Freyrnann, einern Freund von Paul Valery), dern Centre de Synthese und seiner Revue sowie von dessen Leitern Abel Rey und Bouvier. Der Autor des Vocabulaire technique de la philosophie (1968), Andre Lalande, nimrnt ebenfalls Stellung, insbe- sondere zu allem, was .logische Analyse der Sprache bzw. der Linguis- tik" betrifft.
Den Wiener Kreis, wie er sich hier in Frankreich vorstellt, wird es allerdings bald nicht rnehr geben. Zu diesern Zeitpunkt, da die Vertrei- bung durch den Nazisrnus fur einige schon begonnen hat, sind seine Mitglieder bereits auf der Durchreise. Unter diesen prekaren Bedingun- gen politischer Instabilitat ist es schwierig, im Land des cartesianischen Rationalisrnus Anerkennung zu gewinnen: das Unternehmen an der Sorbonne stellt eine gewisse Herausforderung dar. Bei der Jogischen Rekonstruktion des Gebaudes der Wissenschaften, ausgehend von erlebten Erfahrungen" - so Rougier in seiner Eroffnungsansprache - ginge es darum, an die von Poincare eingeleitete Tradition anzuknup- fen.
Obwohl der Kongress von Rougier und Neurath sorgfaltig vorberei- tet worden war, fand die Philosophie aus Wien nicht das erhoffte Echo. Eine gewisse Unruhe hinsichtlich der zu erwartenden Rezeption der Bewegung ist vielleicht schon in Rougiers Eroffnungsansprache spur- bar. Dieser Kongress, sagt er, sei kein Kongress wie andere auch. Es sei notig, sich abzugrenzen von "internationalen Philosophie- kongressen, die einer Auffassung von Philosophie entsprechen, die wir fur uberholt halten" und gernal3 der die ,,Philosophie eine Disziplin" sei. Irn Wissenschaftlichwerden der Philosophie setze der Wiener Kreis seine Hoffnung auf eine Syntax und Sernantik der Wissenschaft, wo- durch den Philosophen die undankbare Rolle von "Grammatikern der Wissenschaft" zukame. Rougiers Stellungnahrne fur den ,,logischen Empirisrnus, die Zersetzung des Apriorismus" (siehe Reichenbachs

Der Neurath-Stil 125
Vortrag) ist letztlich nicht dazu angetan, allen zu gefallen. Allerdings ist es, wie Robert ~ l a n c h e ~ betont, gerade der zuruckweisende Gestus dieser Stellungnahrne, durch den Rougier dem Wiener logischen Empi- risrnus nahe rikkt.
Der Wiener Kreis auf dem Kongress Descartes 1937 in Paris
1937 steht etwas vollig anderes auf dem Spiel. Es handelt sich um den 9. Philosophiekongress, der anlasslich des 300. Jahrestages von Des- cartes' Discours de la Methode organisiert worden warg. Und hier ge- winnt der Stil Jnternationaler Kongress fur Philosophie", dern der Kon- gress von 1935 ja keinesfalls ahnlich sein wollte, die Oberhand uber die wissenschaftliche Philosophie. Auch die Rahrnenbedingungen des Kreises selbst haben sich inzwischen vollig verandert. Die meisten seiner Mitglieder sind bereits im Exil. Neurath ist in Holland, Carnap ist 1936 von Prag nach Chicago gegangen, Reichenbach lehrt in Istanbul, Herbert Feigl ist in den USA. Moritz Schlick ist ein Jahr zuvor ermordet worden. 1937 ist der Wiener Kreis nur rnehr durch eine Hand voll Philo- sophen vertreten und tritt nicht rnehr so einig auf wie irn Jahr 1935. Der rnilitante Ton ist verschwunden. Statt dessen zeigen sich Risse, in de- nen alte Bruche sichtbar werden. Unter dern Einfluss Neuraths hatte es im Kreis einige Krisen gegeben, welche die .Einheit der Wissenschaft" auf die Probe gestellt hatten. Im Jahr 1937 kann man sich fragen, wel- che Philosophie der bereits in Auflosung begriffene Wiener Kreis auf einern Kongress zu Ehren Descartes' eigentlich vertreten kann.
Der rnilitante Ton von 1935 hatte verdeckt, dass die Kritik, die Neu- rath seit einigen Jahren (etwa 1931) an Carnap geubt hatte, zu einer Art "zweitern Physikalisrnus" gefuhrt hatte, wie es Maurice Clavelin (1973) genannt hat.'' Aul3erdem waren Schlick und Waismann im Lauf der 30er Jahre Wittgenstein gefolgt und hatten sich von den rnetho- dologischen Arbeiten des Kreises distanziert. Auch das wirkte sich wohl indirekt auf die Doktrinen des Kreises aus - denken wir nur daran, wie sehr sich Waismann darurn bernuhte, die Philosophie Wittgensteins als Herzstuck der Wiener Lehren zu erhalten."
Folgende Fragen zu Sprache und Methodologie standen zur Debat- te: die Basis des Systems der Einheit der Wissenschaft, die Sprache, in der sie ausgedruckt werden kann, welcher Natur ihre ,,GrundlagenU sind, die Reinheit oder Nicht-Reinheit der als fundamental begriffenen Aussagen, deren Unterscheidbarkeit von anderen Aussagen, der Empi-

126 Antonia Soulez
rizitatsgrad der Basis-Sprache, die Natur der Verifikationsmethode und der Aussagen, auf die sie sich stutzt etc.
Entgegen dem ersten Anschein hat sich Carnap von Neuraths Ar- gurnenten, die eher soziologisch als physikalistisch waren, nie ganz uberzeugen lassen. Schon 1937 wendet er sich gegen den sozialen Behaviorismus Neuraths und halt ihm wenigstens zwei Punkte ent- gegen: den empirischen Charakter einer Basissprache, die sich in ers- ter Linie in beobachtbaren Pradikaten ausspricht, und die Elernentaritat der Aussagen, die sie enthalten. Unter dern Titel .Die Methode der logischen Analyseu zeichnet sich schon der Carnap von .Testability and Meaning" (1936-37) ab. Die Existenz eines bezeichneten Begriffs hangt von der empirischen Verifizierbarkeit ab, die freilich durch die Hypothesen und die Beobachtungen, die der Physiker aus seinen Er- fahrungen bezieht, selbst stark geformt ist. Die Logik ist eine Mathe- matik oder Syntax der Sprache, die als Regelsystem verstanden wird. Zwar pladierten sowohl Carnap als auch Neurath fur ein erweitertes Bedeutungskriterium, aber sie verstehen darunter nicht dasselbe. Neu- rath weist die beiden Schritte, die Carnap uber das ursprijngliche Pro- gramm hinaus macht, zuruck, weil die Einheitssprache der Wissen- schaft, wie er sie konzipiert, sogar auf die ldee der Begrundung der Wissenschaft verzichten muss - also auch auf die Protokollsatze und daher letztlich sogar auf die ldee der Zuruckfuhrung der Sprache auf das Gegebene, die fur Neurath einen rnetaphysikverdachtigen Dualis- rnus enthalt. Die .Zuruckweisung der Metaphysik", die zunachst einfach als eine Folge des logischen Empirismus als Methode gelten konnte, mutiert zur zentralen .Behauptung6' des Programms, das so eine eher soziale Wendung nimmt. Sie ruft aber auch die Reaktion ~djukiewiczs'~ hervor, der Neurath fragt, ob seine .Einheitswissenschaft" nun ,,Be- hauptungu oder .Programmu sei, und ob es sich insgesamt um eine Sprache oder eine Methode handleq3. Diese Zuspitzung der Fragen, die auf eine interne Klarung der Begriffe abzuzielen scheint, trennt jedoch die Mitglieder des Kreises starker voneinander als bisher und isoliert sie aul3erdem von der wissenschaftlichen Gerneinschaft des Des- cartes-Kongresses.
In seinem Vortrag .La philosophie scientifique, une esquisse de ses traits principaux" geht auch Reichenbach auf Distanz, insbesondere zu Carnap. Er ist eben dabei, eine Wahrscheinlichkeitslogik der Quanten- mechanik auszuarbeiten und verijffentlicht 1937 die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Fur ihn enthalt Carnaps Begrundungs- projekt ,einen Rest von cartesianischem Rationalismus". Noch strenger verfahrt er mit Neurath, dessen Enzyklopadismus ihm vom Wiener logi-

Der Neurath-Stil 127
schen Empirimus - wenn nicht vom Empirismus uberhaupt - weit ent- fernt zu sein scheint.
Neurath wiederum stellt die Sache der Wiener auf dem Kongress von 1937 in der fur ihn charakteristischen Weise dar. Sein Artikel .Prognosen und Terminologie in Physik, Biologie, SoziologieK ist, wie er nicht ohne ein gewisses Sendungsbewusstsein mitteilt, Teil einer brei- ten Bewegung, die das schon 1935 vorgeschlagene Enzyklo- padieprojekt vorantreiben solle. Die folgende Passage aus den Kon- gressakten rekapituliert die Gesamtheit der Beitrage in diesem Sinn.
Der Kongress von 37 fuhrte die Arbeiten zu der irn Aufbau befindli- chen Enzyklopadie zusammen, ebenso wie diejenigen Arbeiten, die vom Komitee fur symbolische Logik, das auf dem Kongress von 35 eingerichtet worden war, durchgefuhrt wurden. Neurath sprach uber die Enzyklopadie im allgemeinen, [Egon] Brunswik lenkte die Dis- kussion auf die Eingliederung der Psychologie in die exakten Wis- senschaften und unterstutzte den Vorschlag, in Zukunft den Aus- druck .Behavioristik" zu verwenden. Enriques forrnulierte das Prob- lem, welche Stellung der Geschichte der Wissenschaften in der En- zyklopadie zukame. Unter den Teilnehmern interessierten sich vor allem Ayer und Woodger fur die Formalisierung der Biologie, Clark Hull ... fur die der Soziologie. Arne Naess, Hempel, Oppenheim, Helmer, Durr, Gonseth, Kraft, Scholz aus der Munsteraner Schule, Behmann, Bernays diskutierten intensiv uber Logik. Carnap und Neurath diskutierten uber den semantischen Wahrheitsbegriff, Car- nap und Reichenbach fuhrten eine Debatte uber Semantik und Wahrscheinlichkeit, an der vor allem Tarski und Kokoszynska aus der polnischen Logikschule teilnahmen, ebenso wie Rougier, der die Konferenz eroffnete, Richard von Mises, Philipp Frank, der die Schlussworte sprach ... 14
Neurath sieht in den verschiedenen Beitragen nichts anderes als Hin- weise auf eine enzyklopadische Bewegung. In Wirklichkeit sieht man, dass der sehr reduzierte Kreis mit vielen anderen Gruppen von Philo- sophen aus aller Welt vermischt ist, wobei die Descartes-Spezialisten, die grot3en Philosophie-Historiker und Mathematiker in der ~berzahl sind. Im Vergleich zu 1935 belegt der Kreis unter dem Titel ,,Einheit der Wissenschaft" tatsachlich nur noch eine kleine Sektion, die blot3 ein Drittel des vierten und letzten Teils des gesarnten Kongresses aus- macht.I5 Philipp Frank scheint unabhangig davon in der Sektion ,,Kau- salitat und Determinismus" auf, einer Unterabteilung der ,,modernen

128 Antonia Soulez
Physik". Noch charakteristischer ist die Abteilung, die der Geschichte der Philosophie gewidmet ist. Unter dern Titel .Etudes Cartesiennes" scheinen die Namen von Milhaud, de Broglie, Koyre, Canguilhem, Abel Rey und Destouches auf. Diese Abteilung nimmt die Halfte des zweiten Teils des Kongresses in Anspruch - als hatte sie mit der wissenschaft- lichen Philosophie nichts gemein.
Das Therna "Einheit der Wissenschaft" muss also vollkomrnen an- ders verstanden werden als im Sinn von Descartes. Diesen Bruch, der sich auch in der Trennung der Teile der Kongressakten spiegelt, pran- gert Reichenbach auf seine Weise an. Descartes, so sagt er, verfolge ein einziges Ziel:
eine wissenschaftliche Philosophie zu schaffen, aber mit dem Un- terschied, dass Descartes die Mathernatik zum Vorbild nahrn, wah- rend heute, trotz der engen Beziehungen zwischen Logik und Ma- thematik, eine andere Wissenschaft das Modell und den Gegen- stand der Erkenntnistheorie unserer Gruppe darstellt, namlich die Physik. Es ist freilich die mathematische Physik, die theoretische Physik, mit der sich die erkenntnistheoretischen Arbeiten unserer Gruppe beschaftigen, aber man darf nicht aus dem Blick verlieren, dass es sich bei dem, was den philosophischen Forderungen unse- rer Gruppe zugrunde liegt, urn eine empirische, eine auf Erfahrung begrundete Wissenschaft handelt.I6
Darnit spielt Reichenbach in eleganter Weise darauf an, dass die .Ein- heit der Wissenschaft", auch wenn sie ein cartesianisches Motiv in Er- innerung ruft, zu diesem Zeitpunkt einen ganz anderen, in gewisser Weise anti-cartesianischen Sinn erhalt: in Wirklichkeit sind die .wissen- schaftlichen Aussagen nicht sicher" (ibid.), und insofern ist die Theorie der Erkenntnis eine Theorie der Voraussage. Sicher ist nur die Mathe- matik, deren Wahrheiten freilich rein analytisch sind. Diese stellt die Regeln zur Verfugung, nach denen die Formeln der Naturgesetze auf die physikalische Welt bezogen werden, und zwar in der Form von Beziehungen, die sich uneingeschrankt erweitern lassen. Wenn also das Empirische das Reich des Ungewissen ist, kornmt das Analytisch- Gewisse ausschliel3lich der Sprache zu.
Es ware richtiger gewesen den Tatsachen ins Auge zu sehen und zuzugeben, dass sich die "Bewegung der zweiten Revolution in der Philosophie" im Jahr 1937 bereits in einer schlechten Lage befindet. Die Hoffnung des Kongresses von 1935, den Geist der internationalen Philosophiekongresse zuruckdrangen zu konnen, entbehrt 1937 Iangst

Der Neurath-Stil 129
jeder Grundlage. Was 1935 uberholt zu sein schien, ist 1937 uber- machtig geworden. Was kann der Geist der Neurath'schen Enzyk- lopadie gegen die Institution des internationalen Kongresses ausrich- ten? Es ist, als wurde ein virtueller Hegelianismus sich gegen einen Hegelianismus der Tatsachen richten. Ein Widerspruch in der an- geblichen ljberwindung des Vaters des ldealismus mitten im Des- cartes-Kongress?
Woher die Probleme der franzosischen Rezeption ?
Kommen wir nun zur Untersuchung jener Ursachen, die Quellen fur gewisse Fehlschlage, aber auch fur Versprechen auf spatere An- naherungen waren. Wir konnen hier drei davon festhalten. Die erste ist die franzosische Allergie gegen die mathematische Verfahrensweise, der die negative Beurteilung der logischen Algebra seit Kant entspricht. Die ~sterreicher hatten ihr anti-kantisches Zwischenspiel vie1 fruher als die ~ranzosen." Eine zweite Art von Ursachen besteht darin, dass man damals in Frankreich unter "Logik der Sprache" eher eine linguistische als eine logische Substruktur verstand. Eine dritte Art von Ursachen ist, was ich hier .StilU nennen will: der Physikalismus Neuraths, der En- zyklopadismus, der nicht frei war von einem gewissen planerischen, visionaristischen Millenarismus. Ich lasse beiseite, dass die Tatsache, dass Louis Rougier als Vermittler gewahlt wurde, eine weitere Ursache gewesen sein konnte.
Die erste Ursache: die Allergie gegeniiber dem Symbolismus
1934, in Prag, macht der Kreis seine Auffassungen bekannt. Jean Ca- vailles ist anwesend und beschreibt seine Eindrucke bald darauf in einem der ersten franzosischen Artikel, die iiber den Wiener Kreis ge- schrieben worden sind. In einer intellektuellen Landschaft, die der Ein- fuhrung einer Denkrichtung wie der des Wiener Kreises nicht gerade positiv gegenuber stand, blieb er eine Ausnahmeerscheinung, wie Jean-Toussaint Desanti in Souvenir de Jean Cavailles erklartl*:
Die mathematische Logik hat in unserem Land zwischen den bei- den Kriegen kein Gliick gehabt. Louis Couturat starb 1914 ohne Nachfolger zu hinterlassen. J. Herbrand ist ganz jung bei einem Un- fall ums Leben gekommen, kurz nach der Veroffentlichung seiner heute als klassisch geltenden Dissertation Recherches sur la theo- rie de la demonstration (1930). Die franzosischen Mathematiker

130 Antonia Soulez
haben sich diesen Untersuchungen nicht spontan zugewendet. Sie tendierten damals dazu, sie als Randerscheinungen zu betrachten, auch wenn viele von ihnen durchaus neugierig waren ...
Auf Seiten der Philosophen, so Desanti weiter, ist die Situation kaum besser. Leon Brunschvicg kannte die .ganze von Russell ausgehende Bewegung" nicht und erwahnte den Namen Frege nicht ein einziges Mal (ibid.). Der Philosophiehistoriker Brunschvicg ist eine fur das philo- sophische Milieu im Frankreich der Zwischenkriegszeit typische Figur. Bekannt als jemand, der den Entwicklungen in Mathematik und Physik eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt, sieht er sich als Vorreiter der Versohnung von Philosophie und Wissenschaft. Man sollte von einem solchen Geist mehr Offenheit gegenuber der .neuen Logik" erwarten - wie also sind seine Vorbehalte ihr gegenuber zu erklaren? Einen Grund konnte der so genannte .Brunschvicg'sche Idealismus" liefern: er war beseelt von den groflen Systemen Platons und Kants, und von einer gewissen Wesensart, die typisch ist fur den franzosischen Rationalis- mus, mit dem man seit drei Jahrhunderten den Namen Descartes', des ,,Vaters des franzosischen Idealismus" verbindet. Die Offenheit fiir die Wissenschaften bringt also in Frankreich keineswegs auch eine Offen- heit fur die neue Logik des Wiener Empirismus mit sich.
Zweite Ursache: die ,,neue Logik" (Carnap 1931)
Es ist kein Phanomen der Geschichte der Logik, fur das die Franzosen damals empfanglich sein hatten sollen, sondern eine Herausforderung, die sich der Philosophie von auflerhalb stellte. Denn die moderne Logik ist - entgegen Bochenski (1956) - nicht Teil einer als Kontinuum ge- dachten Geschichte der Vielfalt von Formalismen, von Aristoteles uber Kant bis hin zu Frege. Sie ist, in den Worten von Scholz, nicht eine Version des Formalismus unter anderen, sondern .eine experimentie- rende Logik" (Scholz, 1931, S.66). Wir rufen diesen Punkt in Erinne- rung, um zu unterstreichen, dass die franzosische Allergie nicht nur von einer Modernisierung der Leibniz'schen These des .penser c'est calcu- ler" ausgelost wurde, sondern von der Vorstellung, dass die Logik zu einer wissenschaftlichen Methode des Philosophierens werden sollte, im Sinn einer Analyse der Aussagen und Begriffe der empirischen Wis- senschaft, kurz: eine "angewandte Logik (Carnap).
Bereits das Ansinnen, dass die Logik die Sprache der Arithmetik auf einige logische Begriffe und Gesetze reduzieren sollte, konnte das Missfallen von Mathematikern wie Poincare hervorrufen. Der wirkliche ~ r g e r beginnt aber dort, wo die Debatte zwischen Logikern und Ma-

Der Neurath-Stil 131
thematikern sich in den Bereich der Philosophie verlagert und eine Methode der "rationalen Rekonstruktion" vorschlagt, die beansprucht, .unsere Erkenntnis der aul3eren Welt" auf logischer Basis begrunden zu konnen (Russell 1914). Denn bei diesem erweiterten Projekt handelt es sich nun nicht rnehr nur um logische Ableitung auf dern Gebiet der Mathematik, sondern darum, dieses Verfahren der Ableitung zur Unter- suchung samtlicher Aussagen und Begriffe der Wissenschaften anzu- wenden, urn so mittels eines einheitlichen Formalismus zur Vereinheit- lichung zu gelangen. Eben dadurch ist die Metaphysik bedroht, und m a r in ihrer Existenz: Sie muss einer neuen, von allen Zweideutigkei- ten befreiten Sprache weichen, einer Art ,,Pasigraphieu, wie Peano es ausdr~ckte.'~
Es sieht in der Tat ganz so aus, als sei diese .von neueren Logi- kern" wie Leibniz und Wolf angewandte Manier, Buchstaben an die Stelle von Dingen zu setzen, die von Kant als .sinnverkehrender, un- rechter Gebrauch des Wortes symbolisch"20 bezeichnet worden war, von Russell und Carnap wiederbelebt, wenn nicht gar in Mode gebracht worden. Mit der Einfuhrung der neuen Logik verandert sich die Be- deutung von .ErkenntnisU von Grund auf. Sie besteht nicht mehr darin, die lnhalte der Erfahrung durch einen geistigen Akt zu erfassen, son- dern darin, die Strukturen jener Beziehungen zu bestirnmen, die bei der Syrnbolisierung der Erfahrung irn Spiel sind. So beschlieat Couturat bereits urn 1905 seinen Appendix zu den Principes des mathematiques (1904) wie folgt: .Kurz: die Fortschritte der Logik und Mathernatik im 19. Jahrhundert haben die Kant'sche Theorie aul3er Kraft gesetzt und Leibniz Recht gegeben." - An Leibniz knupfen zwei verschiedene Zu- gangsweisen zu Logik und Sprache an. Couturat fasst die Logik der Mathematik als eine .Logik der Relationenii auf, die, wie er sagt, .von Leibniz vorhergesehen, von Peirce und Schroder begrundet und von Peano und Russell anscheinend auf ihrer endgiiltigen Basis aufgebaut wurde" (Couturat 1914). Die Logik der Relationen ist genau jene, die Carnap 1931 die .neueU nennt und der die traditionelle aristotelische Pradikatenlogik den Platz raumen muss. Wenn sie als Theorie der Er- kenntnis ausbuchstabiert wird, hat die Logik, so Couturat, wesentlich bessere Aussichten auf Erfolg. Tatsachlich ist es nicht ubertrieben, hier sogar das Aufkeimen der Neurath'schen Version der Einheitswissen- schaft auszumachen. In La philosophie des mathematiques de Kant schreibt Couturat, dass die Logik, wenn sie sich aus ihrer zu engen Bindung an die Mathematik lost, ihre universelle Berufung wiederfinden wird, die darin besteht, .Wahrheiten auf forrnale und notwendige Weise rniteinander zu verketten", in einer Art, die der Mathematik koextensiv

132 Antonia Soulez
ist. Dank ihrer also nimmt jede Wissenschaft in dem Man mathemati- sche Form an, in dem sie exakt, rational und deduktiv wird (Couturat pp. 306-307).
Verbluffender Weise spricht Couturat in dieser Passage - die der Mathematik in ihrer universellen Anwendbarkeit zuschreibt, die "wahr- hafte Logik der Naturwissenschaften" zu sein - bereits die Sprache der "Einheit der Wissenschaft" der Positivisten der letzten Generation, das heifit derjenigen, die seit 1920 der Generation Russells, Machs, Poin- cares und Duhems nachfolgt. Hinter dem vorlaufigen Ausdruck "Logik der Naturwissenschaften" verbirgt sich jedoch eine - fur die franzosi- sche Leibniz-Rezeption charakteristische - eher linguistische als logi- sche Sicht. Dies bestatigt sich auch in der Bedeutung, die Couturat selbst der "Logik der Spracheu in diesen Jahren zuschreibt. Nach einem Pendant zu Russell wird man also in Frankreich vergeblich suchen.
Zwar hat Carnap in Der Logische Aufbau der Welt von 1928 (§§ 73 und 77) Couturats Principes philosophiques des mathematiques zwei Mal sehr lobend erwahnt. Dennoch sind es letztlich die Principia ma- thematica von Russell und Whitehead (1910-1913), in denen die Land- schaft der "neuen Logik" fur eine wissenschaftliche Philosophie entwor- fen wird.
Die Russell'sche Logik ist also weit davon entfernt, die Anhanger- schaft der franzosischen Logiker zu gewinnen. Als Paul Valery in einem unveroffentlichten Brief von 1932 seine Zeitgenossen zu deren Entde- ckung auffordert, ruft er auf der einen Seite die wohlbekannten Vorbe- halte Poincares gegen den Logizismus auf den Plan, und beunruhigt auf der anderen Seite Cavailles. Die Befurchtung der beiden ansonsten so unterschiedlichen Mathematiker besteht darin, dass die Logik eine Waffe gegen die Philosophie selbst werden konnte. Sehen wir uns das genauer an.
In seinem Vortrag .Le predicat dans la logique d'inherence et dans la logique de la relation" schatzt Charles Serrus (Serrus 1837) den Beitrag der neuen Logik ganz richtig ein. Diese bringe die substan- zialistische Illusion zu Fall, indem sie das ,,logische Scheitern des Sub- jekts" aufzeige. Doch die Logik stellt letztlich die Moglichkeit dar, die "pradikativen Relationen und die Ordnung der Begriffe im Urteili' als Formeln aufzuschreiben. Serrus stellt die klassische Logik lediglich in Frage, um eine Logik voranzutreiben, die im Stande ist, neue, in der Grammatik nicht wahrnehmbare Beziehungen zwischen dem Gedan- ken und seinem Gegenstand zu entdecken. Und er fugt hinzu, dass .dies bedeutende Konsequenzen fur die Philosophie selbst haben" wird (S. 52-57).

Der Neurath-Stil 133
lnteressant ist in Frankreich das Zusammenflieaen von Entdeckun- gen in Linguistik und Logik, die dazu fuhren, dass die Universalitat der Aristotelischen Pradikatenlogik in Zweifel gezogen wird. In beiden Be- reichen entdeckt man, dass die vermeintliche Transparenz der Bezie- hungen zwischen grammatikalischer und logischer Struktur der Spra- che nicht existiert und dass folglich eine kunstliche Sprache vonnoten ist, um die .logische Struktur der Sprache" zu Tage treten zu lassen, da diese sich in der aut3eren Form der Sprache (langage) eben nicht zeigt.
Den Ausdruck .Struktur der Sprache" finden wir in Frankreich also bei Autoren, die sich wie Couturat seit dem Beginn des Jahrhunderts fur die Sprache interessieren, jedoch in einem anderen Sinn als dies bei den Wienern der Fall ist. In seinem Artikel .Sur la structure logique du langage" (1912) weist Couturat - gefolgt von Serrus 1933 - zu- nachst ebenso wie die englischen und osterreichischen Logiker die Auffassung zuruck, dass die Formen der Sprache die Formen des Denkens in direkter Weise spiegeln. Manche in Frankreich machen freilich noch eine den Einzelsprachen immanente Logik geltend; so etwa greift Antoine Meillet auf allgemeine morphologische Kategorien zuruck, Poincare auf eine interne Fahigkeit des Geistes, aber keiner unter diesen franzosischen Linguisten-Logikern oder Mathematikern - nicht einmal Couturat, fur den Leibniz der grol3e Meister bleibt - greift auf die Leibniz'sche Erklarung des Ausdrucks der Sprache durch den Gedanken zuruck. Sie stimmen mit den Logikern uberein, dass in der neuen Logik ebenso wie in einer kunstlichen Sprache nutzliche Hilfsmit- tel zur Erkennung der Struktur zu sehen sind, die in den naturlichen Sprachen nicht direkt zum Ausdruck kommt. Man endet schliel3lich bei symmetrischen Positionen, indem man fordert, dass die kunstlichen Sprachen demselben logischen Ideal (Couturat) zu entsprechen hatten, das die Logiker mittels des - gleichsam als .Interlinguau verwendeten - logischen Symbolismus verwirklichen wollten. (Carnap verwendet hier einen Ausdruck des Linguisten Otto Jespersen). Auf beiden Seiten je- denfalls erwartet man von der Mathematik, dass sie uns .das Bild des befreiten Denkens zur Verfugung stellt" (Serrus, ibd.). Die Mittel sind verschieden, aber das Ziel ist dasselbe. Es erstaunt daher nicht, dass Couturat in Richtung der neuen Logik blickt, wahrend wiederum Carnap in seiner intellektuellen Autobiographie den Beitrag Couturats erwahnt, des franzosischen Spezialisten fur die Logik von Leibniz, dem er sich besonders nahe fuhlte.

134 Antonia Soulez
3. Ursache: ,, Wissenschaflliche Philologie" sta tt Theorie der Einheit der Wissenschafl (Cavailles)
Einen franzijsischen Philosophen gibt es dennoch, der, nachdem er 1934 in Prag den Wiener Kreis entdeckt hat, der Logik der Sprache eine Wurdigung aus Sicht des Logikers zuteil werden Iasst, im Sinne einer invarianten Struktur logischer Art: Jean Cavailles.
Die Bedeutung von Cavailles' bereits zu Beginn erwahntem Beitrag in der Revue de Metaphysique et de Morale besteht darin, dass er den Formalismus in Frage stellt, und m a r im Rahmen von [Jberlegungen zur Wissenschaftstheorie als Theorie der Einheit der Wissenschaft. ("Eine Theorie der Wissenschaft kann nur eine Theorie der Einheit der Wissenschaft sein", heil3t es in Sur la logique et la theorie de la scien- ce, 1960, S.22).
Der Formalismus war vor allem der Beitrag Wittgensteins. Doch ist es Carnap, der mit seiner formalen Syntax eine Theorie der Einheit der Wissenschaft als Einheit eines vollstandigen formalistischen Systems vorschlagt. Dieses hat zwei Seiten: Eine syntaktische, die auf die Ver- knupfungsregeln der Operationen achtet und eine semantische Seite, die die Verwendungsregeln der Symbole fur die innerhalb bereits for- malisierter Operationen thematisierten Objekte enthalt. Drei kritische Fragen stellt Cavailles dem Verfechter des formalistischen Ansatzes der Einheit: Wie steht es darin mit der Etfahrung? Den Objekten in der Beweisfuhrung? Der gedanklichen Handlung, die sich in der Operation des formalisierenden Logikers vollzieht?
Da Cavailles die empiristische Losung kritisiert, kann er den forma- len Ansatz der invarianten Struktur, die zu jedem Bild-Modell-Paar ge- hort und wie sie bereits der Tractatus bietet, tatsachlich nur begrul3en. In der Kritik der Bewusstseinsphilosophien stimmt er ebenfalls dem Wiener Kreis zu, dem es gelingt, sich vom Begriff der kantischen syn- thetischen Handlung zu losen und der kantischen Trennung - zwischen dem formalen Abstrakten und dem Erfassen des Gegebenen in einer synthetischen Handlung - ein Ende zu setzen. Bezuglich der Objekte handelt es sich nun nicht mehr um jene "noetischen Inhalte", denen sich - nach Husserl - das Bewusstsein als .Etfahrung, etwas im Be- wusstsein zu haben" zuneige und die zu einer transzendentalen Logik zurijckfuhren wurden.
Durch das Umgehen all dieser empiristischen, kantischen und Hus- serl'schen Klippen wurde der Wiener Kreis zur herrschenden Philoso- phie seiner Zeit, gabe es da nicht in jedem einzelnen dieser Punkte eine Schwierigkeit. In der Gesamtheit der Schriften Cavailles' findet man dies wie folgt dargelegt:

Der Neurath-Stil 135
1. Der Wiener Kreis Iasst die Erfahrung auaerhalb des Systems der wissenschaftslogischen Theorie. Die These der Elementarsatze, die auf das Gegebene hinweisen, birgt somit die Gefahr eines "naiven Realis- musu (mit dem Cavailles merkwurdigerweise die Position Wittgensteins in Verbindung bringt) in sich. Im Bemuhen, diesen Ruckfall zu vermei- den, degeneriere der Wiener Kreis unvermeidlich zum .Pragmatismusn (was, wie Cavailles meint, die Position Schlicks sei). 2. lndem er jedweder subjektivistischen Philosophie den Rucken kehrt, weicht der Wiener Formalismus dem Aspekt der Handlung, welche die Operationen des Logikers kennzeichnet, aus, wodurch sich das Augen- merk ausschlieRlich auf die Symbole richtet. Diese aber, so fuhrt Ca- vailles mit franzosischer Heftigkeit aus, seien nicht vie1 mehr als die fluchtigen Spuren der indifferenten Substitutionsoperationen des logi- schen Kalkuls, ohne Rucksicht auf die Bedeutung. 3. Hinsichtlich der Darstellungsweise von Tatsachen durch Symbole prangert Cavailles schlienlich die deskriptive Illusion als Makel des logischen Empirismus an.
Daraus ergeben sich drei grundlegende Einwande gegen die for- malistische Konzeption des Symbolismus: 1. Wie kann ein Zeichen- system sich in sich selbst einheitlich schlienen, wenn es nicht in der Lage ist, seine Objekte zu umschlie~en? Diese, da sie auf interne Wei- se durch die Mittel des Symbolismus selbst thematisiert werden, sind von keiner Referenzhandlung betroffen. Fur Cavailles ist ein Symbolis- mus ohne Referenzialitat inakzeptabel. 2. In dem Man, als daraus ein leerer Formalismus ohne Bezug zur Wirklichkeit entsteht, muss man sich fragen, wie eine rein formale Untersuchung den Anspruchen einer Wahrheitslogik gerecht werden kann. 3. Schlussendlich bleibt der Car- nap'sche Formalismus aunerstande, von der Anwendung der Mathe- matik auf die Physik Rechenschaft zu geben. Er kann lediglich "kodifi- zieren, was in den Schriften der Physiker tatsachlich realisiert worden ist". Womit also in Wirklichkeit kein Schritt in Richtung einer neuen Theorie der Physik getan worden ware (Cavailles, 1981, S. 169).
Fur Cavailles ist es also vie1 mehr ein Programm "wissen- schaftlicher Philologie" als eine Bewegung zu einer .logischen Fundie- rung", womit man es hier zu tun hat (ibid.) - was logisch gesprochen bedeutet, dass der logische Formalismus sein Ziel verfehlt. Das Wort .PhilologieU ist hier bezeichnend fur eine enttauschte Erwartungshal- tung an die Philosophie: Die formale Syntax sei eine ,,Art leeres Auf- fangbecken fur alle Sprachen". Cavailles merkt an, dass die ,,Einheits- spracheu sich letztlich immer als ,,Hierarchic von Sprachen mit unter- schiedlicher Syntax" prasentiere und verweist diesbeziiglich auf Neuraths

136 Antonia Soulez
.~hysikalismus".~~ Tatsachlich stellt fur Neurath die physikalische Spra- che die wahre .UniversalspracheU dar: Die ldee besteht darin, den Witt- genstein'schen Gedanken, wonach es nur eine Sprache gibt, und die ihm entgegen gesetzte Carnap'sche Auffassung, es gabe ebenso viele Sprachen wie "Systeme festgelegter Regeln", in einem einzigen Pro- gramm zu verschmelzen. Cavailles halt dem entgegen, dass, wenn die Mathematik als ein formales System unter anderen betrachtet wird, die Einheitswissenschaft aus der Gesamtheit der Syntaxen all dieser Sys- teme bestunde und die Physik darin blot3 noch .ein gewisses logico- linguistisches System" sei, .das dank eines Prinzips ausgewahlt wird, welches durch die Erfahrung konstituiert wird" (Cavailles, 1960, p. 33). Hierin zeigt sich Cavailles' doppelter Vorwurf an den Wiener Formalis- mus: leerer Formalismus ohne objektive Referenz, optionale Auswahl der logischen Regeln, denen sich die konventionelle Auswahl einer physikalischen Theorie aus schierer sprachlicher Bequemlichkeit unter- ordne: In einer .wissenschaftlichen Philologie" wurde zwischen jener Physik, deren Sprache vereinheitlichend sein solle, und der Physik als in eine Enzyklopadie der Wissenschaften integriertes System nicht mehr unterschieden.
Vierte Ursache: Der Geist der sozialen Aufklarung oder: Der synoptische Stil Neuraths
Von franzosischer Seite wurde der Wiener Kreis nicht so sehr durch das Comte'sche Erbe des Positivismus gepragt, sondern vielmehr durch Duhem und Poincare - zusammen mit Helmholtz, Riemann, En- riques, Boltzmann, Einstein und selbstverstandlich Mach. Angesichts der Konstellation jener Ideenherde, die sich seit Ende des 19. Jahr- hunderts in Europa gebildet hatten, sollte nicht von franzosischen .Ein- flussen" im engeren Sinn gesprochen werden - denn die Einflusse verliefen in samtliche Richtungen -, sondern vielmehr von einem fran- zosischen Beitrag. In Berlin, Prag, Wien, Paris und Oxford wehte der- selbe "Geist" - ein Wort, das im Manifest mehrmals auftaucht und die Konvergenz der Einflusse erklart. Was also tragen die Franzosen kon- kret zu diesem .Geist" bei?
Unter dem Titel .AufklarungU, der explizit auf das franzosische 18. Jahrhundert Bezug nimmt - hier erkennt man die Handschrii Neuraths -, muss der soziale Aspekt der Bedeutung, die der Sprache wissen- schaftlicher Theorien beigemessen wird, verstanden werden, sowie des linguistischen Charakters der empirischen Erkenntnis, der Verwendung der neuen Russell'schen Logik und des Fortschritts der Menschheit durch eine Volksbildung, deren Versprechen in der Verbreitung der

Der Neurath-Stil 137
Naturwissenschaften liegt. Das sol1 heinen: der soziale Aspekt all des- sen, aber nichts davon im speziellen. Neurath selbst hat dies in rnehre- ren seiner Schriften .soziale ~u fk la rung"~~ genannt.
Als der Wiener Kreis sich 1935 in Paris trifft, ist etwas von diesem Geist noch vorhanden. Auf osterreichischer Seite geht die Initiative auf Otto Neurath zuruck, der sich, obschon kein Pazifist wie Carnap es in seiner Jugend war, dem enormen Projekt einer ,,internationalen En- zyklopadie der Einheitswissenschaft" verschrieben hatte.
John Somrnerville, beeindruckt von diesern aufierordentlich .sozi- alen" Zug des logischen Ernpirisrnus, wie er sich in Frankreich prasen- tiert hat, streicht in einern 1936 im Journal of Philosophy erschienen Beitrag die Bedeutung von Neuraths Bezugnahrnen auf die franzosi- sche Aufklarung des 18. Jahrhunderts heraus. Mit diesen Bezug- nahrnen, die zu jener Zeit nur er macht - darunter auf die Tafeln der Enzyklopadie von Diderot und d'Alernbert -, reicht Neurath irn selben Ausrnal3 den Franzosen die Hand, wie er sich zugleich von seinen Wiener Kollegen distanziert. Neurath treibt unter dem Titel ,,Einheits- wissenschaft" sein Enzyklopadieprogramrn voran: die Verwirklichung des Leibnizschen Ideals rnittels Russellscher Logik. So zumindest fasst Russell seine Eindrucke nach dern Kongress zusarnrnen: "Ware Leibniz noch am Leben, so hatte er die gesarnte von Neurath geforderte En- zyklopadie geschrieben." 23
Paradoxerweise ist es gerade seine Nahe zum Geist der franzo- sischen Aufklarung, die Neurath der franzosischen Philosophie der dreiniger Jahre am rneisten entfrerndet - obschon er in Lalande rnit seinern Vocabulaire einen Verbundeten findet, mit dessen Werk sich das Enzyklopadieprojekt zusarnrnenschliel3en konnte. Das physika- listische Projekt einer "Mathematik der Formen der Sprache" (Neurath) wurde der franzosischen ~ffentlichkeit 1935 rnittels des Modells (oder auch .StilsU) einer Enzyklopadie der Einheitswissenschaft vorgestellt, wobei die Anfange des Projekts bis in die 1920er Jahre zuruck- r e i ~ h e n . ~ ~ Ziel dieses rnonurnentalen Ganzen sei es, so Neurath, den Massen in derselben Weise als .WorterbuchU zu dienen wie die .fran- zosische Enzyklopadie dazu bestimrnt war, den intellektuellen Gruppie- rungen Frankreichs irn 18. Jahrhundert zu dienen." Die Neurath'sche .EnzyklopadieU ist die sozialistische osterreichische Version des alten Projekts der .kulturellen Gerneinschaft der Gelehrten" des 18. Jahr- hunderts - rnit einern einzigen, aufsehenerregenden Unterschied: An die Stelle der ,,universellen Sprache" ist der Ausdruck "internationale Enzyklopadie" getreten.25

138 Antonia Soulez
Entgegen der anti-aufklarerischen ldee einer ,,Kultur- und Schick- salsgemeinschaft" (Otto Bauer) scheint die Wissenschaft eben gerade allen zu gehoren und niemandes Privileg zu sein - ein Grundgedanke, der sich in den Schriften des Wiener Kreises immer wieder findet. Zwar woke sich Neurath zunachst auf die vereinheitlichende Macht der Bil- der (im Gegensatz zu "Worten, die trennen", wie er gern sagte) stutzen, um .den ~sterreichern ~sterreich zu zeigen". So charakterisiert er die Bestimmung des 1925 in Wien gegrundeten .Gesellschafts- und Wirt- schaftsmuseums". Aber dies war doch ein erster Schritt zu einer Form der lnternationalisierung der wissenschaftlichen Kultur, wie sie durch seine Enzyklopadie realisierbar werden sollte.
Es ist klar, dass der Kongress vom September 1935 Neurath in Wirklichkeit als Sprungbrett fur dieses ihm so sehr am Herzen liegende Enzyklopadieprojekt dienen sollte. Die Dinge entwickelten sich jedoch nicht wie vorgesehen, und es scheint, als sei das Projekt von Kongress zu Kongress irgendwie zuruckgedrangt worden. Der Elan von Neurath selbst ist 1937 allerdings keineswegs gebrochen, ganz im Gegenteil; eine Korrespondenz zwischen Neurath und Morris legt Zeugnis davon ab, dass Neurath gegenuber dem Scheitern der Rezeption in Frank- reich blind und von einem Optimismus war, den Morris selbst - der an der Durchfuhrbarkeit eines so riesigen Projekts seine Zweifel hatte - fiir ubertrieben hielt. Neuraths Vortrag von 1937 Iasst eine Art Programm der .Enzyklopadisierung" all dessen erahnen, was in das System der Einheit der Wissenschaften Eingang fande, in samtlichen Disziplinen, Landern und Sprachen, da sich die Gesamtheit all dessen ja in einem "logischen Gerust" ausdrucken liefie.
Neurath war also weit davon entfernt auf seine grofie Enzyklopadie zu verzichten, der er jetzt auch einen visuellen Thesaurus der Art bei- fugen wollte, wie Diderot und d'Alembert ihn in ihren Bildtafeln realisiert hatten. Neurath hijrte nicht auf die Sache weiterzutreiben, fasziniert von der ldee einer .lJbersicht in Bildern", die er "Isotype Thesaurus" nennt.26
Diese .iJbersicht in Bildernu war als ein riesiges Album von allen mit der Erkenntnis in Verbindung stehenden Merkmalen konzipiert, deren samtliche Sektoren untereinander verbunden waren, vergleichbar einer .Physiognomik", wie der Cousin Charles Darwins, Francis Galton sie erstellen wollte.*' Hinsichtlich ihrer Darstellungsmethode verdankt die Enzyklopadie der ldee eines symbolischen visuellen [Jberblicks der sprachlichen Formen sicherlich ebenso vie1 wie den Tafeln der fran- zosischen Enzyklopadie. Zweck der visuellen Darstellung bleibt stets die Prasentation von symbolisch zum Ausdruck gebrachten Korrela-

Der Neurath-Stil 139
tionen, und nicht etwa von Erklarungen aus dem Ursprung, durch wel- che positive oder negative Entwicklungsgesetze in den Vordergrund treten wurden. In seinem beruhmten Aufsatz .Anti-Spenglef (1921) ist Neuraths Ablehnung der Genealogie kultureller Phanomene aus ur- sprunglichen Symbolen nicht zuletzt durch die ljberzeugung motiviert - und das ist fur das Verstandnis zentral -, dass eine solche Methode einem kulturalistischen Historizismus Vorschub leistet. Er teilt hierin die Vorbehalte Robert Musils: Ungeachtet der Tatsache, dass beide Auf- satze im selben Jahr entstehen, ist die Nahe zu Musils .Geist und Er- fahrung' dennoch frappierend. Dasselbe Misstrauen gegenuber dem Spengler'schen Analogiekult, der zu einem .fakchen Skeptizismusu (Musil) fuhre und damit jede ernsthafte Epistemologie ruiniere. Von einer .Morphologie der ~eltgeschichte'~~ a la Spengler kann bei Neurath also keine Rede sein: Ganz im Gegenteil, so Neurath, miisse eine "Physiognomik" uns vielmehr aus dieser regressiven Sichtweise einer Menschheitskindheit herausfuhren. In dieser Hinsicht will die Enzyklo- padie eine modernisierte Physiognomik sein, wobei das einzige was von Spengler bleibt, die .Orchestralitat" der Darstellung ist. Der grol3e Unterschied besteht darin dass eine Beurteilung des lnhalts der Begrif- fe fehlt, sowie darin, dass die Aufmerksamkeit ausschliel3lich auf die Zeichen gerichtet wird, die von den Eigenschaften der Dinge wohl un- terschieden ist.
Es ist zweifelsohne diese eigentiimliche Auffassung von einer En- zyklopadie, die als immenses, zu erzieherischen Zwecken bestimmtes terminologisches Ganzes begriffen wird, sowie deren programma- tischer Charakter, was in Frankreich am wenigsten leicht Eingang fand. Denn so sehr diese auch von der franzosischen Aufklarung durch- drungen war, mischte sich doch ein utopisch-sozialplanerischer Zug hinein, der eher typisch osterreichischen Ursprungs ist. Tatsachlich hat Neurath hier einen Vorganger, auf den er sich gern beruft: den osterrei- chischen Ingenieur, Gelehrten und 0konomen Josef Popper-Lynkeus.
Der amerikanische Historiker William Johnston (Johnston, 1972, S. 233) weist auf die Bedeutung dieses Erbes eines "Geistes der prak- tischen Utopieu hin: Auf die reprasentativen Gestalten, deren .aster- reichische Begabung fur totalisierende Gedanken" sie in der Zwischen- kriegszeit von einen okonomisch wie jurstisch rationalen System Jrau- men und wachen" liel3. In dieser Tradition ist auch Popper-Lynkeus zu sehen, Autor der .Phantasien eines Realisten" (1899), der Freud zu dessen Theorie der Traumentstellung inspiriert hatte.

140 Antonia Soulez
Schlussfolgerung: Neurath und Couturat
Aus den bereits angefuhrten Grunden wurde ich meinen, dass Couturat vie1 mehr als Lalande oder Rougier als das franzosische Pendant zu Neurath zu sehen ist. Beiden ist ein eher linguistischer als logischer Esperantismus gerneinsarn; in ihrem Logico-Linguistizismus ist es die jeweilige Dosis an Linguistik und Logik, die sie unterscheidet. Couturat legte Wert darauf, die .logische Vernunft" rnit der .linguistischen Ver- nunft" in Einklang zu bringen, was ihm ubrigens von Antoine Meillet in der Sitzung vom 25. Januar 1912 zum Vorwurf gemacht wurde." Er dachte sogar, dass "linguistische [Jberlegungen es erlauben wurden die wirklich logischen Kategorien der Sprache zu entratseln", und von die- sem Standpunkt aus betrachtet existiert fur ihn nur eine einzige Logik, als Tendenz zur Regelrnaaigkeit (Eindeutigkeit der Bezeichnung), aus der heraus die Verwirklichung des Ideals in einer kunstlichen Sprache moglich ist. Jene Linguisten, die darauf Bezug nehmen, sind aus seiner Sicht die interessantesten.
Gewiss, doch sind im Frankreich von 1912 - wie Michel Vendryes in derselben Diskussion einwarf - ,,philosophische Linguisten sehr rar". Vendryes gab damit einer gewissen Skepsis Ausdruck, zumal es, wie er meint, .sehr schwierig ist, das Wort .SpracheU (langue) genau zu definieren."
Zwischen Neurath und Couturat bleibt letztlich ein wesentlicher Unterschied bestehen. Um zu einem Wiener logischen Positivisten zu werden, reicht es - so Lalande - tatsachlich nicht aus, ein linguisti- sches Ideal und logisches Ziel zu verfolgen, indem man ,,Russells und Whiteheads Aussagefunktionen sowie die formalen Eigenschaften der Relationsaussagen" studiert (ibid.) Zweifelsohne hatte der kantianische Pazifist Couturat, der Kants Schrift zum ewigen Frieden sorgfaltig gele- sen hatte, dieser Humanist, der von der Versohnung der Geister mittels einer Universalsprache traurnte, nicht daran gedacht, den logischen Symbolismus in den Dienst der logischen Analyse der Sprache (langa- ge) zu stellen, also in den Dienst einer Bedeutungskritik, die auf eine Zensur der philosophischen Terminologie hinauslaufen wurde.
Denn dieser Art ist das Neurath'sche Projekt eines lndex verborum prohibitorum letzlich wohl: geman dem Prinzip eines solchen lndex wurde man sich auf eine ljbereinkunft verpflichten, bestimmte Termini und Formulierungen in der Enzyklopadie zu vermeiden. Neuraths anti- metaphysische Devise stellt bedeutungslose und metaphysische Aus- sagen einander gleich, eine Synonymie, die er gerechtfertigt sieht durch die Tatsache, dass .die Vetwendung unkontrollierbarer Behaup-

Der Neurath-Stil 141
tungen" mit Verbrechen gegen die Menschheit in Verbindung stehen konne, wie ein von ihm gern zitierter Satz Voltaires nahe legt: ,,Wer euch dazu bringt, Absurditaten zu glauben, kann euch dazu bringen, Grausamkeiten zu begehen.u30
Bezuglich der Bedeutung des Wortes .langue'' - um auf das von Vendryes aufgeworfene Problem zuruck zu kommen - so bewegt man sich, folgt man der Entwicklung der naturlichen Sprachen, vie1 mehr in Richtung von Logiken als in Richtung einer Logik (des Geistes, wie Couturat sagt, im Gegensatz zurn Herzen). Das logische ~konomie- prinzip scheint uberdies - und zum Gluck - von den sich entwickelnden Einzelsprachen kaum beachtet zu werden. Wie also konnte eine von diesen ausgehend konstruierte internationale Sprache das angestrebte logische Ideal verwirklichen?
Das Problem der ,langueu findet seinen Niederschlag in der ljber- setzung. Der Wiener Kreis von Paris 1935 und 1937 war auch ein iJbersetzungsproblem. In Wien herrschte, verglichen mit dem der fran- zosischen .Philosophen der logischen Struktur der Sprache", tatsach- lich ein ganz anderes Verstandnis von der Beziehung zwischen kunstli- cher und naturlicher Sprache. In Frankreich verstand man unter ,,langue naturelle" die grammatikalisch verschiedenen Einzelsprachen, und das ist genau nicht das, was ein Englander oder Osterreicher unter ,,naturli- cher Sprache" oder .Umgangsspracheu verstand, die als das Gegen- stuck zu einer konstrurierten Sprache oder einer technischen Experten- sprache aufgefasst wurde. Dieser Unterschied, der sich uns Franzosen als Unterschied zwischen nationalen Kulturen darstellt, von den Eng- Iandern und ~sterreichern dagegen als ein Unterschied zwischen zwei Formen des Sprachgebrauchs angesehen wird, bewirkt, dass die lingu- istische Variante eines logischen Ideals in keiner Weise mit der symbo- lischen Variante desselben Ideals zusammenfallt.
Der Grund, warum Couturat der beste Ansprechpartner fur den Wiener Kreis von 1935 und 1937 gewesen ware, ist vielleicht seine von franzosischen Linguisten wenig beachtete Art, sich hinsichtlich der Jogischen Struktur der Sprache" (langage) auf Russell zu berufen. Die lronie der Geschichte ist, dass dieser (franzosische) Unterschied zwi- schen .langueu und .langageU - eine Unterscheidung, die weder das englische Wort .languageu noch das deutsche ,,SpracheU leisten konnen - zweifelsohne ein wichtiger Grund dafur ist, dass der .Geist" des Wie- ner Kreises in Frankreich nicht so wehte wie in Wien. Durch die franzo- sische Nuancierung von .langage6' als Ausdrucksmittel im Allgemeinen und .langue particuliereu - Einzelsprache - ist uns der englisch- deutsche Gegensatz zwischen ,,naturlicher spracheU3' bzw. Umgangs-

142 Antonia Soulez
sprache und kunstlicher Sprache verborgen geblieben. Das Jogische Ideal" kann, je nachdem, ob man es auf die Einzelsprachen oder auf die als mangelhaft bewertete Umgangssprache anwendet, nicht diesel- be Bedeutung haben.
Anmerkungen
Dem Text liegt eine gekurzte Fassung des folgenden Artikels zugrunde: Antonia Soulez: .Le Cercle de Vienne A Paris aux Congres de 1935 et 1937 et le r61e d'Otto Neurath: quelques reflexions sur les problemes de sa reception", erscheint in: Epis- t6rnologie franpaise 1850-1950, hg. von J. Gayon et M. Bitbol, Paris: Presses Uni- versitaires de France (voraussichtlich 2005). Der ursprungliche Text wurde von Nico- las Roudet und Aurelie Jardin gekiirzt und redigiert, und von Heidi Konig und Elisa- beth Nemeth ins Deutsche ubersebt. Siehe Christiane Chauvire in: Manifeste du Cercle de Vienne (Paris: PUF. 1985). Ayer hatte Moritz Schlick dank Gilbert Ryle 1932 in Wien ietroffen. Ryle sbricht dariiber in: .Wittgensteinu, in: Analysis, XII, 1951, s.1-9 Siehe Sebestik und Soulez 1999. Siehe Holton 1988, Kapitel 7: "Mach, Einstein, and the search for reality" (orig. 1968), S. 269, Fn. 31. Holton verweist darin auch auf die Arbeiten Frederick Her- necks. Ich verdanke Francoise Balibar eine Kopie dieses 42-Seiten-Dokuments (M.H. Bae- ge ... 1913) aus dem Berliner Einstein-Archiv. Siehe auch .Notes and News" der Zeitschrift .Psychology and Scientific Methods", Bd. IX, Nr. 16, 1912, S. 419, wo der Text dieser Deklaration in englischer Ubersebung zu finden ist. Seit der Zeit als Carnap in Prag eine Wiener Kreis Gruppe ins Leben rief, hatte Rougier, Professor an der Universitat von Besanpn und an der Universitat von Kai- ro, Kontakte mit der Gruppe. Aus diesen Kontakten entstand die Initiative, die zu den Kongressen von 1934 und 1935 fuhrten. Vgl. dazu Viktor Kraft 1953, S.6. In seinem Vortrag "Theorie de la connaissance et physique moderne", Kongressak- ten 1935. Blanche (1961). Vgl. auch: Robert Blanche: "Louis Rougier" (ubers. ins Englische: Albert E. Blumberg), in: Paul Edwards, Encyclopaedia of Philosophy, pp. 17-18. Auf ~runschvicgs~eranlassun~ 1934 in prag entschieden, war die diganisation der Societe franpise de philosophie unter der Ehrenprasidentschaft von Henri Bergsons ubertragen worden. Siehe dazu Soulez / Sebestik 1985. Soulez, Dictees 1997-1998, insbesondere die Einleitung von G. Baker, Bd. 1. Adjukiewicz gehorte wie Twardowski der Schule von Lemberg an. Beide waren 1934 bei dem Kongress in Prag anwesend, in dem Otto Neurath (der zu dieser Zeit schon in Den Haag war) den Wiener Kreis als das Projekt der .Einheitswissenschaft" vor- gestellt hat. Halten wir fest, dass in Lemberg, am Rand der dortigen philosophischen Gemeinde, ein Kritiker des Positivismus lebte: Ludwik Fleck, dessen Arbeiten spater, vor allem dank Thomas Kuhn, bekannt geworden sind. Siehe seinen Kongressvortrag ,,Uber die Anwendbarkeit der reinen Logik auf philo- sophische Probleme". Dieses Zitat stammt aus den Kongressakten von 1937, siehe: Actes du IXieme ..., pp. 265-277 (~bersebung ins ~ e u k c h e EN).

Der Neurath-Stil 143
Wozu anzumerken ist, dass die Beitrage der Vertreter des Wiener Kreises -den es, nebenbei bemerkt, in Osterreich 1937 offiziell nicht mehr gibt - nur ein Funfzigstel von Teil II des 4. Heftes der Kongressakten von 1937 ausfullen. .La philosophie scientifique ...", op. cit., p. 86 (Ubers. : E. Nemeth). Hienu sei auf die Arbeiten von Jacques Laz (1993) und Jan Sebestik (1992) zu Bolzano verwiesen, der eine sehr heftige und in Frankreich kaum bekannte Kant- Kritik in die Wege leitete. Dieser Text steht am Anfang von Cavailles: "Methode axiomatique et formalisme (1981). Vgl. hienu einen Artikel von Louis Couturat zur logischen Mathematik Peanos. (Couturat 1899, 616-46). Kritik der Urteilskrafl§ 59. Von der Schonheit als Symbol der Sittlichkeit. Cavailles, 1935, S 142. Cavailles spielt hier ausdrucklich auf das berijhmte cc Tole- ranzprinzip D an, das die Wahl einer Sprache auf die Brauchbarkeit der syntak- tischen Regeln grijndet (Carnap 1934). Siehe z.B. Neurath: "Soziale Aufklarung nach Wiener Methodeu (1933), in Neurath, 1983, S. 231-239. Dass die wiederholte Bezugnahme auf die franzosische Aufklarung den cc Leibniz- schen Mythos einer Universalsprache a bemuht, ist nicht weiter erstaunlich. Haben doch die Enzyklopadisten selbst gem eine Vielzahl von Ausdrucken und Gedanken von Leibniz ubemommen, manchmal auch ohne dass sie zu den ursprunglichen Werken Zugang gehabt haben, wie etwa im Fall der Nouveaux Essais, die erst 1765 erschienen sind. Darauf hat Sylvain Auroux aufmerksam gemacht (Auroux, 1973. Siehe vor allem S. 171 und seine FuRnote 72 zum Leibniz'schen Mythos einer Uni- versalsprache und dessen Weiterschreibung durch die ~nz~klopadisten.) Der Artikel cc S~rache N Ice Lanaue D). aezeichnet B.E.R.M. und von Beauzee (vielleicht auch von' ~ouchetjverfa&t, d& auch der Autor einer cc Grammatik n in d& Enzyklopddie von Diderot und D'Alembert war (T.9, 1765, pp. 245-266) macht diese Linie sichtbar, die auf eine Universalsprache abzielt, die als cc Idiom der Gelehrten Europas N die- nen soll. Wenn das Franzosische nach dem Muster des Lateinischen dafur am bes- ten geeignet erscheint, dann aus einem Grund, der, wie es am Ende des Artikels heiRt, mit dem cc Einfluss unserer Reg ie~ng auf die allgemeine Politik Europas D zu tun hat. Trotzdem ist die Bezugnahme auf Leibiz widerspruchlich. Die Enzyklopadis- ten vertraten eher die Auffassung, dass die Sprache willkiirlich ist, wahrend Leibniz im Gegenteil dachte, dass zwischen den Beziehungen zwischen den Worten und den Beziehungen zwischen den Dingen eine naturliche Korrespondenz besteht, was er "connexio inter res et verba " nannte. Die erstere Auffassung, die z.B. auch von Condillac verteten wurde, stutzt sich eher auf die Sprachtheorie von Hobbes. Siehe dazu den Beitrag von Dahms in diesem Band. Zum Leibniz'schen Mythos einer der universellen Sprache siehe FuRnote 22. Nach Marie Neurath, in einem Gesprach, das ich kurz vor ihrem Tod in London mit ihr fuhren durfte. Dabei ging es darum, bestimmte Zuge und ihre Beziehungen zueinander ans Licht zu bringen und anthropometrisch zu erklaren, wie Unterschiede zwischen den Cha- rakteren und ihre Varianten zustandekommen. Das ursprungliche Ziel bestand darin, die Vererbung intellektueller Fahigkeiten zu erfassen, die dem Auftreten von Genies zugrundeliegen.
28. Der die Spengler'sche Vorstellung einer ,,PhysiognomikU entsprach, Anm. d. iJ. 29. Sitzung der franzosischen Gesellschaft fur Philosophie am 25 Januar 1912 (Couturat
1912). 30. In Lebensgestaltung und Klassenkampf, worauf Uebel 1992, S. 260, verweist.

144 Antonia Soulez
31. Obwohl hier noch einmal zwischen "ordinary language" und .Umgangsspracheu unterschieden werden miisste.
Bibliographie
Actes du congres international de philosophie scientifique. Tome 2, L'Unite de la science [organise par Otto Neurath et Louis Rougier, Paris, Sorbonne, 19351. Paris: Hermann, 1936 (Actualites scienti- fiques et industrielles ; 389).
LIUnite de la science, la methode et les methodes ; a I'occasion du tricentenaire du Discours de la methode de Descartes [Actes du IXe Congres International de Philosophie de 19371 ; ed. Raymond Bayer. Paris: Hermann, 1937. (Actualites scientifiques et indus- trielles ; 533).
Les congres de 1935 et 1937 ont ete annonces ou synthetises. Celui de 1935 par exemple dans la Revue de Metaphysique et de Mo- rale, nO1, 1936 (par Albert Lautman).
Auroux, Sylvain (1 973): L'Encyclopedie, grammaire et langue au W l l l e siecle. Tours: Mame.
Baege, M. H. (1913), hrsg., Zeitschriff fiir Positivistische Philosophie, Bd. 1. Berlin: A. Tetzlaff.
Bauer, Otto (1987), La question des nationalites et la social- democratie, 2 vol. ; tr. fr. revisee avec une introduction de Claudie Weill. Paris: Arcantere ; Montreal: Guerin.
Blanche, Robert (1961), Compte-rendu de I'aeuvre de Louis Rougier, Revue Liberale, n033.
Bochenski, Jan (1956), Formale Logik. Freiburg ; Miinchen: K. Alber. Carnap, Rudolf (1928), Der Logische Aufbau der Welt. Berlin: Berna-
ry (Engl. ~ b e r s , von Rolf George. Berkeley: Univ. of California Press, 1967).
Carnap (1 936-37), (( Testability and Meaning N, Philosophy of Sci- ence 111, 420-468 [repr. in: Feigl et Brodbeck (eds), Readings in Phi- losophy of Science, 1 9531.
Carnap, Rudolf (1 934), Die logische Syntax der Sprache. Wien (Schrif- ten zur wissenschaftlichen Weltauffassung ; 8).
Cavailles, Jean (1 935), L'Ecole de Vienne au Cercle de Prague, Revue de Metaphysique et de Morale, 137-149.
Cavailles (1960), Sur la logique et la theorie de la science. Paris: Presses universitaires de France. (Bibliotheque de philosophie con- temporaine).

Der Neurath-Stil 145
Cavailles (1981), Methode axiomatique et formalisme; intr, de Jean- Toussaint Desanti. Paris: Herrnann. [these que Jean Cavailles soutint en 19371.
Cavailles (1994): CEuvres completes de philosophie des sciences. Paris: Hermann.
Celeyrette-Pietri, Nicole & et Soulez, Antonia (1988), Valery et la logique du langage. Actes d'une Journee tenue a IfUniversite de Paris-XII-Val-de-Marne, Creteil ( pu blie dans la revue Sud).
Chauvire, Christiane (l985), (( Note sur Peirce et I'Aufhebung de la metaphysique n, in: Manifeste du Cercle de Vienne, pp. 287-293 [cf. Soulez, 19851.
Clavelin, Maurice (1973), (( La premiere doctrine de la signification du Cercle de Vienne D, Etudes Philosophiques, 4.
Clavelin, Maurice (1980), (( Les deux positivismes du Cercle de Vi- enne D, Archives de philosophie, 43, 1980, 33-35.
Couturat, Louis (1899), (( La logique mathematique de Peano B, Revue de Metaphysique et de Morale 7 (1 899), 61 6-646.
Couturat (1901), Logique de Leibniz d'apres des documents inedits. Paris: F. Alcan.
Couturat (1 9O5), Les Principes des mathematiques. Paris: F. Alcan [avec un "Appendice sur la philosophie des rnathematiques de Kantn (1 904)l.
Couturat (1912), (( Sur la structure logique du langage D, Revue de Metaphysique et de Morale.
Couturat (1914), Algebre de la logique, 2e ed. Paris: Gauthier-Villars. [ l e ed. 19051.
Desanti, Jean-Toussaint (1 98l), c( Souvenir de Jean Cavailles N, preface a: Jean Cavailles, Methode axiomatique et formalisme. Paris: Herrnann.
Duhem, Pierre (1906), La theorie physique. Son objet, sa structure. Paris: J. Vrin, 1981. (L'histoire des sciences. Textes et etudes).
Edwards, Paul (ed.), Encyclopedia of Philosophy. New York: MacMil- Ian.
Feigl, Herbert (1968), (( Wiener Kreis in America n, in: The Intellectual Migration, Europe and America, 1930-1960. Harvard Univ. Press.
Frege, Gottlob (1971), Ecrits logiques et philosophiques; pres. par Claude Irnbert. Paris: Seuil. (L'ordre philosophique).

146 Antonia Soulez
Freud, Sigmund (1985), Resultats, idees, problemes (1921-1938), tome 2. Paris: Presses universitaires de France, 1985. (Bibliotheque de psychanalyse).
Holton, Gerald (1 988), Thematic Origins of Scientific Thought. Harvard University Press. [ch. 7: "Mach, Einstein, and the search for reality1' (publ. orig. 1968)l.
Imbert, Claude (1999), Pour une histoire de la logique. Paris: Presses universitaires de France.
Jacob, Pierre (1980), De Vienne a Cambridge. L1'heritage du positiv- isme logique de 1950 a nos jours. Paris: Gallimard. (Bibliotheque des sciences hurnaines).
Johnston, William (1 972), L 'esprit viennois. Paris: Presses universi- taires de France.
Kraft, Viktor (1953), The Vienna Circle. New York: Greenwood Press. Lalande, Andre (1914), A propos de Couturat, Revue de Metaphysique
et de morale. Lalande (1 902-1 923), Vocabulaire technique et critique de la philoso-
phie; l oe ed. revue et augmentee, avec un supplement. Paris: Presses universitaires de France, 1968.
Laz, Jacques (1993), Bolzano critique de Kant; pref. Jacques Bouver- esse. Paris: J. Vrin.
Marty, Anton (1 908), Zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik, in: Gesammelte Schriffen.
Morris, Charles (1960), (( On the History of the International Encyclope- dia of Unified Science )), Synthese 12, no 4. Dordrecht: Reidel, De- cem ber 1 960.
Nemeth, Elisabeth & Neurath, Paul (1994), Otto Neurath. Wien: Bohlau. Neurath, Otto (1 921), Anti-Spengler. Miinchen: Callway. cf. 1973. Neurath (1937), (( Unified Science and its Encyclopedia N, in: Philoso-
phy of Science 4, 1937 [cf. 1 9831. Neurath (1937), (( The New Encyclopedia of Scientific Empiricism D, en
tr. angl. cf. 1983. Neurath (1937), (( On the history of the International Encyclopaedia of
Unified Science D, in Synthese 12, n04 , Reidel publ., Dordrecht, cf. Neurath [ I 9731.
Neurath (1 973), Empiricism and Sociology, ed. Robert S. Cohen et Marie Neurath. Dordrecht ; Boston: Reidel.

Der Neurath-Stil 147
Neurath (1981), Gesammelte philosophische und methodologische Schriffen; hrsg. Rudolf Haller & Heiner Rutte, 2 Bde. Wien: Holder- Pichler-Tempsky.
Neurath, Otto (1 983), Gesammelte bildpadagogische Schriffen, hrsg. von Rudolf Haller und Robin Kinross, Wien: Holder - Pichler - Tempsky.
Neurath (1983), Philosophical Papers, 1973-1946, ed. Robert S. Cohen & Marie Neurath. Dordrecht-Boston: Reidel.
Proust, Joelle (1 986), Questions de forme. Logique et proposition ana- lytique de Kant a Carnap. Paris: Fayard.
Reichenbach, Hans (1937), << Fondements logiques du calcul des probabilites D, Annales de I'lnstitut Poincare vol. 7, partie 5, pp. 267-348.
Rorty, Richard (1967), ed., The Linguistic Turn. Chicago: Univ. of Chi- cago Press.
Russell, Bertrand (1900), Expose critique de la philosophie de Leibniz, tr. fr. Paris: Alcan, 1908.
Russell (1 91 0-1 91 3) & Whitehead, Principia rnathematica. Cam bridge Univ. Press. [2d ed, 19251.
Russell (1914), Our Knowledge of the External World. Chicago ; Lon- don: Open court.
Russell (2001), Correspondance sur la philosophie, la logique et la politique avec Louis Couturat (1897-1913); ed. et cornmentaire par Anne-Franqoise Schmid. Paris: Kime.
Schilpp, Arthur (1 963), Philosophy of Rudolf Carnap. La Salte: Open Court. (The library of living philosophers ; 1 I ) .
Schlick, Moritz (1930), (( The Future of Philosophy B, hrsg. in: Philos- ophy of the College of the Pacific (1932). Neudr. in: Gesammelte Aufsatze, 7926-7936 (Vdien: Gerold, 1 938) und in: Rorty (Richard), The Linguistic Turn (Chicago 1 967).
Schlick (1 938), Gesammelte Aufsatze, 19X-1936. Wien: Gerold. Scholz, Heinrich (1 931 ), Geschichte der Logik, Berlin. Sebestik, Jan & Soulez, Antonia (1 986), Le Cercle de Vienne, doctrines
et controverses. Paris: Klincksieck. [reed. Paris: L'Harmattan, 20021.
Sebestik (1 992), Logique et mathematique cher Bernard Bolzano. Pa- ris: J. Vrin.
Sebestik & Soulez (1 999), Science et philosophie, au tournant du siec- le, en France et en Autriche. Paris: Kime. (Philosophia scientiae).

148 Antonia Soulez
Serrus, Charles (1 933), Le parallelisme logico-grammatical. Paris: F. Alcan.
Serrus (1937), cc Le predicat dans la logique d'inherence et dans la logique de la relation >), in: Actes du IXeme Congres lnternational de Philosophie. Paris: Hermann.
Somerville, John (1936), (( The social ideas of the Wiener Kreis's >>, International Congress, Paris, sept. 1935, Journal of Philosophy, 11, 21 mai.
Soulez, Antonia (1985), dir., Manifeste du Cercle de Vienne et autres ecrits. Paris: Presses universitaires de France. (Philosophies d'aujourd'hui).
Soulez (1 993), (( The Vienna Circle in France (1 935-1 937) >>, in: Scien- tific philosophy, origins and developments; hrsg . Fried rich Stadler. Dordrecht: Kluwer, 1993. (Vienna Circle Institute Yearbook ; 1 ), pp. 95-1 12.
Soulez (1994), Die Enzyklopadie und der Geist des Wiener Kreises, ran kreich-~sterreich hin und zuriick n, in: Frankreich-Osterreich. Wechselseitige Wahrnehmung und wechselseitiger Einfluss seit 1918; hrsg. Friedrich Koja & Otto Pfersmann (Wien: Bohlau), 138- 158.
Soulez (1996), cc Otto Neurath or the Will to Plan >>, in: Encyclopedia and Utopia. The life and work of Otto Neurath (1882-1945); hrsg. Elisabeth Nemeth & Friedrich Stadler. Dordrecht: Kluwer. (Vienna Circle lnstitute Yearbook ; 4).
Soulez (1 997-1 998), dir., Dictees de Wittgenstein a Friedrich Wais- mann et pour Moritz Schlick. Paris: Presses universitaires de France ; 2 vol. (Philosophie d'aujourd'hui).
Soulez (1999): (( Does understanding mean forgiveness ? >> (Otto Neurath and Plato's Republic in 1944-45) >>, in: Otto Neurath, Ra- tionalitat, Planung, Vielfalt; hrsg. Elisabeth Nemeth und Richard Heinrich, mit Antonia Soulez. Wien: R. Oldenbourg. (Wiener Reihe ; 9). [Version anglaise d'une conference publiee dans Otto Neurath, un philosophe entre science et guerre. Actes reunis en hommage a Philippe Soulez; ed. Fran~ois Schmitz, Jan Sebestik, Antonia Soulez, avec la collab. dlElisabeth Nemeth. Paris: IIHarmattan, 1997. (Cahiers de philosophie du langage ; 2).
Soulez (2001): (( LYEncyclopedie et 'l'esprit du cercle de Vienne' >>, in: Sciences et philosophie en France et en ltalie entre les deux guer- res; ed. Jean Petitot et Luca Scarantino. Napoli: Vivarium.

Der Neurath-Stil 149
Spengler, Oswald (1 91 9), Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Wien-Leipzig: W . Braumijller.
Uebel, Thomas (1 992), Overcoming Logical Positivism from Within. The emergence of Neurath's naturalism in the Vienna Circle's protocol sentence debate. Amsterdam ; Atlanta: Rodopi. (Studien zur oesterreichischen Philosophie ; 17).
Wittgenstein, Ludwig (1922), Tractatus Logico-philosophicus, intr. B. Russell, tr. Brian McGuinness & D. Pears. London: Routledge & Kegan Paul. [tr. fr. Gilles-Gaston Granger. Paris: Gallimard, 19931.

MATHIEU MARION
LOUIS ROUGIER, THE VIENNA CIRCLE AND THE UNITY OF SCIENCE
Louis Auguste Paul Rougier (1889-1982) was the only French associ- ate of the Vienna Circle. Today, he has almost disappeared from his- tory books.' Reasons for this are complex; they have to do, to a large extent, with his political involvement, on the extreme-right of the French political spectrum. That he deserved or not his reputation is a question that cannot be debated here.' Since facts about Rougier are largely unknown, I shall first give as detailed as possible a picture of Rougier's links within the Vienna Circle. I shall then give a brief presentation of Rougier's own version of logical empiricism, in order to conclude with a discussion of his views on physicalism and the Unity of Science.
1. A Forgotten Associate
As far as I can tell, Rougier earliest mention in print of Reichenbach's and Schlick's work dates from 1931, in a short article on the develop- ment of scientific philosophy since 1900 for the Larousse mensuel illus- tre (Rougier 1931). He was already more than 40 years old. He had obtained a doctorat from the Sorbonne in 1920 and he had already published five books on epistemological matters (Rougier 1920a, 1920b, 1920c, 1921 b, 1921c) along with a number of papers. As I shall argue in the next section, Rougier's philosophical outlook was already fully developed by the time he discovered the writings of the members of the Gesellschaft fiir empirische Philosophie and the Verein Ernst Mach. But his outlook was very close to that of the early Vienna Circle and, in his first letter to Schlick, in November 1931 ,3 Rougier expressed his enthusiasm and his wish to become a member of the Verein. Re- turning from a trip to the Soviet Union in 1932, Rougier stopped in Ber- lin to meet Reichenbach and to give a paper for the ~esellschafi.~ Ac- cording to him, the idea of an international congress of scientific phi- losophy occurred for the first time in conversations with Reichenbach on that occasion (Rougier 1936b, 3). He was only to meet Schlick for the first time in 1934, on the occasion of a trip to central Europe. On that occasion, he spoke in front of Schlick's Circle on Poincare's phi-

152 Mathieu Marion
losophy of ~c ience.~ During his stay in Vienna, he witnessed the violent repression of the Socialists by the Dollfuss regime.
Later in the same year, Rougier presented a paper at the Prager Vorkonferenz on "La scolastique et la logiquen (Rougier 1935a), which presents in a condensed form some of the conclusions of his lengthy study, La Scolastique et le thomisme (Rougier 1925). This book was not written as a piece of historical scholarship but in order to show that the scholastic attempt to reconcile the revealed truths of Christian relig- ion with Greek rationalism was a complete failure. His peculiar ap- proach was to 'axiomatize' scholastic philosophy and to show that the conclusions derived by scholastic philosophers did not follow from their premises, unless one committed one of a number of 'paralogismes', i.e., fallacies that are committed in good faith and not with the intention to mislead. (Rougier's book was very controversial, he was accused of plagiarism and ~t ienne Gilson and Jacques Maritain became bitter enemies.) At the Eight lnternational Congress of Philosophy, immedi- ately following the Vorkonferenz, Rougier gave a paper on "De I'opinion dans les democraties et dans les gouvernements autoritaires", which contains a clear statement of his liberal standpoint (Rougier 1936a).~
During the Vorkonferenz Rougier was nominated to the organisa- tional committee of the First lnternational Congress of Scientific Phi- losophy, which was to take place in 1935 at the Sorbonne. There is evidence that Rougier had lobbied for Paris at an early stage, even as a possible venue for the Vorkonferenz. It looks as if Rougier and Neurath organized alone the First lnternational Congress of Scientific Philoso- phy. Their correspondence contains more than 500 pages and it is almost exclusively concerned with organizational matters.' One finds, reading it, that the congress was almost postponed as Rougier almost gave up, devastated as he was by the sudden death, in Cairo, of his second wife.
Rougier played a leading role within the First lnternational Con- gress, giving the opening (Rougier 1936c) and closing lectures (Rougier 1936d), and by further contributing with a paper on the "Pseudo-problemes resolus et soulevees par la Logique d'Aristoten (Rougier 1936e). He edited afterwards the proceedings in eight vol- umes at Hermann in Paris, under the title Actes du Congres interna- tional de philosophie scientifique, Sorbonne, Paris, 1935. Rougier was hoping to use the congress to promote logical empiricism in France. For this purpose, he published in the Revue de Paris, which reached an audience not confined to academia, a paper entitled "Une philosophie nouvelle: I'empirisme logique, a propos d'un Congres recent". This

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 153
paper contains an amazing tour de force, a summary of logical empiri- cism in one sentence:
These are the key ideas of the Viennese School: the syntactic character of the laws of logic and mathematics and, hence, the dis- appearance of the problem of their applicability to nature; the tauto- logical character of pure thought and, hence, the denial of any ma- terial a priori and of the possibility of a radical form of empiricism; the reduction of philosophy to the study of the formal structure of science, to the syntax of its scientific language, such that philoso- phy becomes an integral part and cannot be distinguished from sci- ence; the reduction of metaphysical problems to meaningless statements, condemned by the logical syntax but explainable by the grammatical syntax of ordinary languages, and, hence the mutual dependence of metaphysics and linguistics; the reduction of most problems concerning the material content of scientific statements to syntactical questions relative to the choice of language and, hence, the elimination of a large number of pseudo-problems; the attempt to unify the language of science by a physicalisation of its state- ments, and, hence, the creation of an unified science covering all meaningful statements. (Rougier 1 936f, 192-1 93)
During the congress, Rougier was elected member of the organisa- tional committee for the International Encyclopaedia of United ~ c i e n c e , ~ along with Carnap, Frank, Jargensen, Morris and Neurath (Carnap et alii 1936). Rougier's reputation within the Circle was largely due to his book on Les paralogismes du rationalisme (1920b), and it is probably for this reason that he was asked to write a monograph on the history of rationalism for the Encyclopaedia. For reasons that are unknown to me, it was never published. In the late 1930s, Rougier got involved in politi- cal matters and his writings and activities in 1938 and 1939 were, with a few exceptions, entirely devoted to political philosophy and political economy.g I surmise that he simply had no time during those years to sit down and write his monograph on rationalism. On the other hand, Rougier managed to contribute to Erkenntnis, in the late 1930s, with papers on "Le langage de la physique est-il universe1 et autonome?" (Rougier 1937138) and "La relativite de la logique" (Rougier 1939140), which will be discussed below. At any rate, there are no traces in the correspondence between Rougier and Neurath, at least until early 1940,1° of any dispute, such as the notorious one surrounding Rei- chenbach's contribution the Encyclopaedia. On the contrary, the ex-

154 Mathieu Marion
change of letters shows that Rougier was quite conciliatory and that he adjusted the plan of his monograph in order to make room for a further a pair of monographs by Santillana and Zilsel, which were eventually published (Santillana & Zilsel 1941).11
After Schlick's murder, Rougier also organized, again with help from Neurath, a further Parisian meetin the Third lnternational Con- gress for the Unity of Science of 1937.1Q'This was another Vorkonfer- enz, which took place immediately before the Ninth lnternational Con- gress of Philosophy, also known as the Congres Descartes, within which there was also a special section on the 'Unity of Science', which was, once again, organized by Rougier and Neurath. Rougier partici- pated in further Congresses for the Unity of Science in Cambridge (1 938) and Harvard (1 939). The meeting in Oslo (1 940) was cancelled and Rougier withdrew at a late date from the last meetin in Chicago in ,941, although he was in the United States at the time.19'So, Rougier's collaboration with the Circle faded away with the Circle itself.
The congresses of 1935 and 1937 provided a wonderful showcase for the logical empiricism in France 'our philosophy', as Rougier called it. In an effort to promote logical empiricism, Marcel Boll and Ernest Vouillemin had a number of short monographs by Carnap, Hahn, Frank, Neurath, Reichenbach, and Schlick published in French; Rougier ap- pears to have been closely involved in that project.14 In his correspon- dence with Schlick, Rougier had mentioned the idea of a Societe Henri Poincare that would emulate the Verein Ernst ~ a c h . ' ~ Rougier tried indeed to muster around him a number of philosophically minded scien- tists (e.g., Jean-Louis Destouches, Maurice Frechet, Paul Langevin, or Charles Rist). For First lnternational Congress of 1935, he was able to rally the support of institutions such as the lnstitut d'histoire des tech- niques et des sciences (the ancestor of the current lnstitut dJhistoire et de philosophie de sciences et des techniques) and Abel Rey's Centre de synthese, whose journal, la Revue de synthese, also published pa- pers by members of the Vienna Circle in 1935. As is well known, these efforts failed to create an institutional breakthrough (as opposed to, e.g., English-speaking and Scandinavian countries). The reasons for this are well worth an investigation, but this is outside the scope of this paper. I should at least point out that Rougier's isolation within French academia was not caused merely by mepris from more traditional quar- ters (e.g., the neo-Thomists or the philosophie reflexive) but also from lack of solidarity, if not plain hostility, from other French-speaking phi- losophers of science. One early example of this is the Colloque des philosophes scientifiques de langue fran~aise, which took place in Brit-

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 155
tany, on September 10-17, 1938: Rougier tried without success to con- vince his colleagues (e.g., G. Bachelard, J.-L. Destouches, F. Gonseth, R. Wavre) to publish their papers in Erkenntnis; his correspondence at the time with Neurath shows that Gonseth doctrinal opposition to logical empiricism carried the day.16
Rougier was not merely an active associate of the Circle but also a close friend of some of its members. He was especially close to Moritz Schlick. Rougier's most important post-war publication - arguably his most important book -, the Traite de la connaissance (Rougier 1955), published in 1955, is dedicated to his memory. Rougier was also close to Hans Reichenbach. As with Schlick, their correspondence is of a more personal nature; at times they would, for example, share opinions about their situation, Rougier's appointment in Cairo (1931-1936) over- lapping with Reichenbach's in Istanbul (1933-1938). Rougier helped one of Reichenbach's sons to secure a visa prior to the war. As a mat- ter of fact, Rougier was active in a Comite de defense des israelites prior to the war and he was able through his connections within the French government,17 to obtain visas and facilitate the transit of numer- ous intellectuals from central Europe. For example, the Fonds Rougier at the Chateau de Lourmarin contain a letter of thanks by Friedrich Waismann which implies that Rougier helped him (among others) to find his way to England; information recently resurfaced that shows that Rougier also helped Ludwig von Mises (along with other Jews who had been arrested as they were travelling in a bus from Switzerland to Spain) to obtain a visa to the United States in July 1940.18
On a more personal note, Rougier went on vacation on the shores of an Austrian lake with Schlick in 1935. Schlick had left his wife behind in Vienna and was joined by his assistant, Lucy Friedmann (nee Herzka). She was married at the time to a Viennese lawyer and had obtained a Ph.D. from the University of Vienna, something unusually avant-garde for a Viennese woman in the 1930s. After the Anschluss, the Friedmanns eventually moved to New York and Rougier obtained a fellowship from the Rockefeller Foundation, along with a position at the New School of Social Reseach, that allowed him to join her in January 1941. Lucy eventually obtained a divorce and they married in Decem- ber 1942, in New York. They went back to France in 1947 and lived together until Rougier's death in 1982 at the age of 94.

156 Mathieu Marion
2. From Conventionalism to Logical Empiricism
Because of his enthusiastic support of the Circle's Weltauffassung, Rougier was perceived by his French colleagues as a "disciple of strict obediencen (Rougier 1960, 55).19 But it would be wrong to derive from this the idea that he was an unoriginal philosopher, a mere passeur wishing to import foreign ideas into France. By the early 1930s, Rougier had published almost all of his work in scientific philosophy and he had developed all the main theses that were to characterize his philosophy: his understanding of the modern axiomatic method and interpretation of Poincare's conventionalism, and his criticism of the paralogismes, pseudo-problemes and mystiques of 'school philosophy'. So, although Rougier may be correctly pictured as rather orthodox associate of the Circle, he came to the Circle and contributed to it from an independent standpoint. Members of the Circle were perfectly aware of this. Philipp Frank noticed that
Rougier started his philosophic work on a basis similar to that of Schlick. He took his start from Poincare, tried to integrate Einstein into the "new positivismn, and wrote the best all-round criticism of the school philosophy that I know of, "The Paralogisms of Rational- ism". (Frank 1949, p. 48)
Reviewing the Traite de la connaissance in the 1950s, Victor Len- zen wrote:
By dedicating his book to the memory of Moritz Schlick, M. Rougier acknowledges the contributions to his theory by the Vienna Circle. He recognizes as a decisive influence in the new developments, Wittgenstein's doctrine that the rules of logic are tautologies which are true by virtue of form alone. M. Rougier, however, has been an independent contributor to logical empiricism in his own right. An early work by him was devoted to the geometric philosophy of Henri Poincare, whose discovery of the role of conventions in science contributed a basic element in philosophy of science. An early work of M. Rougier on the structure of deductive theories provided the outline for the present extended treatment. In Paralogismes du ra- tionalisme he anticipated Carnap's Scheinprobleme with an un- equalled wealth of examples. A work on Scholasticism and Thom- ism further prepared him to place the new theory of knowledge in its historical setting. (Lenzen 1956, 125)

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 157
It seems right to describe Rougier as "an independent contributor to logical empiricism in his own right". I shall give some evidence for this, while introducing some background elements for my discussion of his views on physicalism and the unity of science.
First, one should note that Rougier had already published as early as the 1910s an enormous amount in the philosophy of physics. His first paper on the use of non-Euclidean geometry in relativity theory was published in L'enseignement mathematique in 1914, when he was only 25 (Rougier 1914). Rougier's most important paper in the philosophy of physics was on 'La materialisation de I'energie"; it appeared under three different formats (Rougier 191 711 8, 191 9a, 1921 b) and it was also translated into English in 1921 (Rougier 1921~). '~ In that text, Rougier showed how recent developments in physics had undermined the tradi- tional conceptual opposition between energy, which was said to have no inertia and heaviness, and matter, which was supposed to possess mass. Metaphysical problems originating in this dualism, e.g., that of their interaction, were described by Rougier as "pseudo-problemes'?
It is a general truth that the majority of philosophical problems are insoluble because the problems do not properly exist. The subjec- tivism of our senses, the anthropomorphism of our reasoning by analogy, the substantialistic tendency to realize our ideas and to take purely logical distinctions as objects lead us to conceive ficti- tious problems, or pseudo-problems, that have no more meaning than the insolubilia on which the eristics of the ancient sophists [...I were exercised. To solve them is always to show that they were problems which have been badly stated. (Rougier 1921a, 1)
It was Rougier's belief that problems linked with the metaphysical dis- tinction between matter and energy would 'vanish' as the result of ad- vances in modern physics:
[...I it is shown to be true that the two terms, taken to be diametri- cally opposite, enjoy such properties in common as explain their in- teraction; energy appears to be endowed with inertia, weight, and structure, like matter. [...I the metaphysical problem [...I vanishes of itself. (Rougier 1921c, 3)
There is nothing new here, this anti-metaphysical approach has it roots in Comte's positivism and it has antecedents in the German- language philosophy of science (L. Boltzmann, H. Hertz, C. Menger).

158 Mathieu Marion
But it is quite striking that Rougier wrote about pseudo-problemes more than ten years before Carnap wrote about Scheinprobleme.
Secondly, Rougier's doctoral theses, published in 1920 as La phi- losophie geometrique de Poincare (Rougier 1920a) and Les paralogis- mes du rationalisme (Rougier l92Ob), already contained the fundamen- tal tenets of his philosophy. The study on La philosophie geometrique de Poincare (Rougier 1920a) ought to be read in conjunction with La structure des theories deductives, published a year later (Rougier 1921a). Rougier believed that the influence of mile Boutroux on Poin- care had been deleterious (Rougier 1947, 15); he believed that Poin- care wrapped his ideas a neo-Kantian garb that do not fit them. These two books contain a study of the notion of an axiomatic theory, follow- ing the then recent results of Hilbert, Peano, Padoa, Russell etc., which form the background for a new and fruitful interpretation of Poincare's conventionalism, disentangled from its neo-Kantian garb. Rougier was able to provide a sharp characterization of the conventional part of a scientific theory and thus to provide an interpretation of Poincare's con- ventionalism." In a nutshell, since the axioms of a formal system are assumed but not proven, they can be taken to be conventional; they are the result of "tacit agreement", or as he would put it, of "decree resulting from a free decision" (Rougier l92Oa, 121 ) or "decisions volontaires" (Rougier 1960, 51). According Rougier, a particular type of convention is relevant here: "optional conventions" (conventions facultatives), i.e., conventions that "can always be replaced by a contrary convention, without causing more than a simple modification of the scientific lan- guage" (Rougier l92Oa, 122 & 200). Poincare's 'geometric' philosophy could thus be seen as a special case of this general form of conven- tionalism, where alternative geometries are construed, through term by term translation, as isomorphic models of a more general axiomatic system. This view was to be popularized afterwards by Jean Nicod (Nicod 1930)) Ernst Nagel (Nagel 1961, chap. 9) and Max Black (Black 1942), who explicitly discusses Rougier. However, it is recognized to- day as partly inaccurate.*'
Rougier believed this conventionalism to be the solution to the deadlock that traditionally opposed rationalism and empiricism. The conclusion to La philosophie geometrique de Poincare begins with these words:
It will turn out that the discovery of non-Euclidean geometry has been the origin of a considerable revolution in the theory of knowl- edge and, hence, in our metaphysical conceptions about man and

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 159
the universe. One can say, briefly, that this discovery has suc- ceeded in breaking up the dilemma within which epistemology has been locked by the claims of traditional logic: the principles of sci- ence are either apodictic truths (analytic or synthetic a priori judge- ments) or assertoric truths (empirical or intuitive judgements). Poin- care, taking his inspiration from the work of Lobatchevski and Rie- mann, pointed out in the particularly significant case of geometry that there is another solution: the principles may be simple optional conventions. (Rougier 1 WOa, 199)
To this Rougier adds, a little bit further:
A series of statements hitherto conceived of by rationalists as abso- lutely necessary truths, independent of our mind and of nature, by criticists, as a priori laws of our sensibility or of our understanding, by empiricists, as truths of experience, are seen, after Poincare's critique, as mere conventions. These conventions are not true but practical, they are not necessary but optional, they are not imposed by experience but merely suggested by it. Far from being inde- pendent from our mind and nature, they exist only by tacit agree- ment of all minds and depend strictly upon external conditions in the environment in which we happen to live. (Rougier 1920a, 200- 201)
Principles "exist only by tacit agreement" and they "depend strictly upon external conditions in the environment in which we happen to live". This was Rougier's "third solutionn, which is the key to his entire philosophical work. One should notice that it is at one with both Corn te's notion of 'I 'esprit positif' and the 'wissenschaftliche Weltauffas- sung' of the Vienna Circle. Later, Rougier extended this "third solution" by arguing, on the basis of the tautological character of logical truth and of the existence of non-classical logics, that even logical necessity is the result of conventions (Rougier 1939140, 1940, 1941). In the Traite de la connaissance, he expressed the view in these terms:
The origin of logical necessity resides, therefore, in the definitions which result from our linguistic conventions. The tautological char- acter of the laws of logic is simply a special case of the general principle that what is true by definition cannot at the same time be held to be false. In a word, it rests on the necessity of giving univo- cal meanings to our conventions in order to be able to communicate

160 Mathieu Marion
with others and with ourselves. Conventions are not cognitive acts, they are decrees of our will. We are not bound in our conventions except by the necessity of being consistent. (Rougier 1955, 125)
There are many difficulties with Rougier's conventionalist stance, some of them raised by Arthur Pap in his critical study of the Traite de la con- naissance (Pap 1956). 1 shall briefly mention Pap's criticisms in the next section but a full discussion falls outside the scope of this paper.
The book on Les paralogismes du rationalisme (Rougier 1920b), can be seen as the development of this viewpoint into a detailed cri- tique of traditional forms of a priori rationalism. The target of Rougier's critique is a pair of claims that are said to characterize rationalist doc- trines, over and above some key disagreements:
Rationalism admits the existence of truths that are objective, a pri- ori, unconditionally necessary, independent from our mind and from nature, that are at the same time laws of our thought and laws of being, such that our mind has no choice but to submit to them and nature to conform to them. To these truths, one give the names of rational or eternal truths. The faculty that grasps them, which is dis- tinct from perception and empirical understanding, is reason. This faculty is sui generis and it is one and indivisible. It is in equal amount in all men and pertains to them in virtue of their essence. (Rougier 1 92Ob, 437)
Rougier's main line of attack consisted of pointing out that state- ments that were held by rationalists to be 'eternal truths' either turned out to be mere empirical truths or optional conventions (Rougier 1920b, 439). Rougier also tried to show that attempts at giving rational grounds for the above pair of theses were based on para~ogisms.~~ One should note that Rougier's critique of the belief in the existence of eternal truths was an open attack on scientific and mathematical realism, and his anti-realism was not limited to a critique of traditional forms of ra- tionalism, such as Thomism or the various post-Cartesian systems of the eighteenth century: among the variants of realism also criticized are Cantor's Platonism as well as Russell's "analytic realismn (Rougier 1 92Ob, chap. x ) . ~ ~
Rougier further concluded from his rejection of the concept of uni- versal, eternal, a priori truths that the traditional concept of an universal reason, "naturellement egale en tous les hommes", as Descartes had written in Le discours de la methode, had to be thrown away and re-

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 161
placed by a conception of the "plasticity" of mind. This idea of "plastic- ity" was not new to French philosophy; it had been championed by ma- jor figures of the previous generation, such as ~douard Le Roy and Leon Brunschvicg, to whom Rougier owes this basic orientation of his philosophy. Rougier wanted to replace the Cartesian concept of reason by that of mentalite (mentality), taken from French anthropologist and sociologist, Lucien Levy-Bruhl (Levy-Bruhl 1922a, 1922b). The unique- ness of 'reason' was thus to be replaced by the variety of mentalities, and Rougier called repeatedly for a science of "mental structuresn, which he never really developed (Rougier 1921 d; 1924, 209-21 3; 1960, 30-34). Incidentally, it is very curious that, although he recognized that a precise definition of the concepts of 'mentality' or 'mental structure' is not an easy matter (Rougier 1921d, 209), Rougier never fully realized that "mentalite" is a rather likely candidate for Neurath's index verborum prohibitorum. At any rate, Rougier's rejection of the belief in a faculty of reason "one and indivisible" should be kept in mind when trying to un- derstand his anti-physicalist stance. But before doing so, I should like to make two brief comments.
First, this critique of the universalist conception of reason led many, mainly within literary circles across Europe, to believe that Rougier defended a form of relativism. This is why Les paralogismes du ration- alisme was praised by Aldous Huxley (Huxley 1927, xviii) but criticized by Julien Benda (Benda 1950). Adriano Tilgher even compared him with Spengler (Tilgher 1922). It is true that reasons for which Rougier should not be seen as a full-blooded relativist were not made explicit until later, e.g., when Rougier defended in the Traite de la connais- sance a position analogous to Friedrich von Hayek's idea that there could be a form of natural selection for cultural roups analogous to natural selection for species (Rougier 1955, 426). 2 P
Secondly, Rougier's criticism of the belief in a faculty of reason 'one and indivisible' is linked in the introduction to Les paralogismes du ra- tionalisme with a lengthy and virulent critique of political egalitarianism, which is said to have its origin in rationalist principles (Rougier 1920b, 13-21). This remarks should be read in conjunction with Rougier first book in political philosophy, La mystique democratique, ses origines, ses illusions (Rougier 1929). In that book, Rougier developed what could arguably be seen as a political philosophy for the early Vienna Circle. According to Rougier, the legitimacy of any form of power, in- cluding democracy, is based on belief in what he called "mystiques". These "mystiquesJJ are nothing but the nonsensical propositions of ra- tionalist metaphysics; potentially dangerous ones, according to

162 Mathieu Marion
Rougier, because they are adhered to with a quasi-religious, fanatical fervour. So, no form of power can be justified on a priori grounds; de- mocratic conventions, however, are suggested from experience and thus to be adopted on pragmatic grounds, because properly democratic institutions allow for the freedom necessary for market economy, which is in turn claimed to be the only system empirically proven to bring about an improvement in the living standards. The egalitarian mystique is portrayed as leading to state intervention and to the ultimate disap- pearance of democracy and civil rights, with no improvements in stan- dards of living in exchange. So, Rougier is unique in having derived from an epistemology very close to that of the early Circle, a political philosophy which far more closer to that of von Mises' circle than to the political schemes elaborated by Neurath. But there is no hint that these diverging political views were the cause of animosity between Rougier and any member of the Circle; they nearly always display mutual re- spect in their correspondence
It should be clear by now that Philipp Frank was right to point out that Rougier came to logical empiricism from an independent stand- point. The latter is, of course, that of the French positivist tradition inau- gurated by Auguste Comte. It is clear, for example, that Rougier's con- ventionalist alternative between empiricism and a priori rationalism is but a variant of I'esprit positif as defined by Comte. Indeed, Comte de- fined the latter in the Discours sur I'esprit positif, as an alternative to empiricism and 'mysticism'. Rougier's reliance on ideas taken from great figures of the positivist tradition, from Comte, Taine and Renan to Abel Rey and Lucien Levy-Bruhl, is everywhere apparent. What is fas- cinating in the case of Rougier is precisely how close his positions were to logical empiricism when he first contacted Schlick in 1931. He had almost all elements in his possession in the early 1920s. As Rougier himself recognized later on, in his 'Itineraire philosophique' (Rougier 1960), which is still the best available introduction to his philosophy, the most important lesson he learned from the Vienna Circle was their use of Wittgenstein's notion of tautology as the linchpin in their renovation of empiricism.26
3. Controversies: Physicalism and the Unity of Science
Now, not only Rougier was an intellectually independent associate, his role within the Circle was not limited to that of an organizer: he also participated in their internal debates. When compared to central figures

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 163
such as Carnap or Neurath, Rougier was of course a minor figure, an outsider without much real, historical influence on the Circle. But his contributions are not for that reason lacking in intrinsic interest.
On some of the controversies, Rougier took sides without bringing new elements to the debate. For example, on the notorious dispute between Neurath and Schlick on truth, he was one of those, such as Waismann and von Juhos (Juhos 1935), who sided with Schlick:
One cannot describe the anatomy of science without reintroducing the classical notion of truth as one-to-one correspondence between a system of symbols and a given. [...I But, as soon as your re- establish the notion of correspondence with a given [...] a series of acts of thought become possible without committing the mortal sin of metaphysics. We can quietly compare the menu with what the waiter brings us on his tray or the sentences of our Baedecker with the monuments which it describes. (Rougier 1936d, 88-891~~
As a matter of fact, Rougier is more often than not siding with Schlick. For example, Rougier remained committed to a form of verificationism and he adopted Schlick's Konstatierungen and his thesis of the com- municability of the structure of sensations (e.g., in (Rougier 1955, 188)) as well as the Wittgenstein-Schlick notion of Hypothesen. These last two elements are still present as late as the 'Itineraire philosophique' of 1960.~' Clearly, Rougier belonged to the 'right wing' of the Circle, in more than one sense of the expression.
Rougier's more substantial contributions to the debates within the Circle, as witnessed by his articles in Erkenntnis, were about physical- ism (Rougier 1937138) and the relativity of logic (Rougier 1939140, 1940, 1941). On this later topic, I should briefly mention Pap's criti- cisms. When the Traite de la connaissance appeared in 1955, Arthur Pap wrote a lengthy critical study, the only serious critical discussion of Rougier's logical empiricism in the secondary literature. Pap's judge- ment was very negative. According to him,
... it is clear that [Rougier] is not sufficiently conversant with the more refined techniques of logical analysis that have developed in English and American analytic philosophy [...I His treatise, pub- lished in 1955, is not up to date as regards analytical sophistication. [...I Accordingly, the treatise under review contains more informa- tion about the work done by logical empiricists before world war II

164 Mathieu Marion
than new insights [...I Some serious inaccuracies are simply per- petuated ... (Pap 1956, 149)
Indeed, elements taken by Rougier from Schlick such as the thesis of the communicability of the structure of sensations or the notion of Kon- statierungen and the strict criteria of verifiability had all been aban- doned by logical empiricists (Pap 1956, 159-1 62). Pap further accused Rougier of committing technical mistakes, such as confusing quantifiers with propositional functions (Pap 1956, 160n.). But Pap's main argu- ment is against Rougier's argument in favour of conventionalism from the plurality of logics. As Pap argues, Rougier's argument is vitiated by confusion between 'sentence' and 'proposition' (Pap 1956, 154). Some of these accusations are a trifle unfair; for example, Rougier also wanted to liberalize the criterion of verifiabi~it~.~' The accusation of hav- ing confused 'sentence' and 'proposition' stands and falls with Quine's rejection of 'propositions', so the matter is not that simple. As for the alleged confusion of quantifiers with propositional functions, it refers to Rougier's use of the Wittgenstein-Schlick interpretation of laws as An- weisungen zur Bildung von Aussagen or 'hypotheses' (Schlick 1979, 188), (Rougier 1955, 21 9); this interpretation, originates in Hermann Weyl's account of quantifiers and it was also taken up by Frank Ram- sey;30 it involves no logical howler and it is part of an elaborate anti- realist conception of the laws of physics (Rougier 1955, 218 & 407).
The idea of the unity of science requires a 'unified language of sci- ence', in which every scientific assertion could be expressed. This lan- guage had to be both intersubjective and universal. Under the name 'physicalism', Carnap and Neurath proposed in a series of papers, in the early 1930s, a 'physicalist' language as a candidate for the unified language. This proposal became the source of a debate among mem- bers of the Circle. In "Le langage de la physique est-il universe1 et autonome?", which is his contribution to the Fourth International Con- gress of Scientific Philosophy in Cambridge, Rougier rejected physical- ism by providing a number of arguments to the effect that physicalist language is neither universal nor autonomous. He does not seem to have had qualms with the claim that it is intersubjective. One should note at the outset that in a letter to Neurath dated November 14, 1938, Rougier had already set out four points about which he disagreed with "le Wiener Kreis premiere maniere", as he called it in another letter (March, 26, 1939).~' These are the relativity of the analytic-synthetic distinction, the possibility of languages with domains of intersubjectivity narrower than that of the physicalist language,32 the relativity of the

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 165
distinction between meaningful and meaningless terms,33 and the ne- cessity of ordinary language in psychology and sociology, i.e., the lack of universality of the physicalist language. This last point is argued for in "Le langage de la physique est-il universe1 et autonome?". Moreover, Rougier repeated arguments laid out in this paper in the Traite de la connaissance (Rougier 1955, 296-305) in 1955 and in his "Itineraire philosophique" (Rougier 1960, 56-58) in 1960. They are therefore a basic feature of Rougier's philosophy, not some set of remarks quickly repudiated or simply forgotten. Rougier was anxious to point out that he was able to participate in the debates between members of the Circle and that he was his own man, and his discussion of physicalism was essential to that self-portrayal.
I should make two preliminary remarks. The first concerns Rougier's notion of empirical knowledge. According to him, the exis- tence in the stream of sensations of invariants allows for the constitu- tion of an intersubjective language and it is a fact that qualitative varia- tions are correlated with quantitative variations; such coincidences open the door to a mathematical treatment. Thus one can move from the Aristotelian, qualitative physics to a metric or quantitative physics:
To the qualitative description of the physical world one thus substi- tutes the quantitative description of the spatio-temporal order of co- incidences which can always be made to correspond, in accor- dance to invariable physical laws, to quantitative changes first no- ticed by our senses. (Rougier 1937138, 190-1 91 ).34
My second preliminary remark concerns the definition of 'physical- ism'. As I see it, the term was ambiguously defined in the writings of Neurath and Carnap. Indeed, at times Neurath presented the universal language as the 'language of physics' simpliciter (Neurath 1983, 54- 55). But a language that would contain only metrical concepts would not be suited for the job and Carnap weakened the physicalist thesis and developed in The Unity of Science (Carnap 1995) a 'thing- language' which would contain also qualitative concepts provided that they "refer to observable properties of things and observable relations between thingsn (Stegmuller 1969, 293).35 Neurath also spoke at times of the unified language as a purified version of everyday language, which he identifies with the language of physics (Neurath 1983, 62 & 91 ).
Rougier's understanding of 'physicalism' is slightly different. Ac- cording to him, it is the thesis that

166 Mathieu Marion
... any psychological statement can be translated, in virtue of corre- spondence laws, into a statement of physics. (Rougier 1955, 298- 299)
Therefore, Rougier was aiming at the stronger form of 'physicalism', not the weaker. In a nutshell, Rougier will argue that there are no such invariable correspondence laws, analogous to the invariable laws of physics just mentioned in my first remark.
The content of Rougier's paper "Le langage de la physique est-il universe1 et autonome?" can be reduced to arguments in support of three claims. The first claim is that the language of physics is not autonomous but needs to be supplemented by other languages, such as the language of introspection, in the case of psychology, or simply everyday language. Rougier provides in support an argument from analogy between physicalism and formalism:
Physicalism would be, for sciences of reality, what formalism has been for logico-mathematical sciences. However, it seems that physicalism can no more be rigorously justified than formalism. The failure of Hilbertism, as seen in light of Godel's research, estab- lishes that we could not prove, with help of reasonings that can be formalized within a deductive theory, the non-contradiction of that theory. In order to prove it, we must interpret it within another and, from one reduction to another, we must appeal to intuition, which means that one cannot establish a consistent formal language without using ordinary language. Formalism is not autonomous. (Rougier l937/38, 189)
This argument can be easily dismissed. First, the presentation of Godel's theorems is wildly inaccurate. Secondly, these theorems do not demonstrate the need for intuition and/or ordinary language. The basis for the analogy thus disappears. Moreover, it is easy to find other rea- sons why it would be a false analogy.
Rougier's second claim is against the claim to universality. It is not possible translate the language of psychology into that of physics. His argument is more interesting. Rougier first gives a few examples from clinical psychology, which purportedly show that
Simple nervous habits, simple social customs link, with no other necessity than habit and custom, a given behaviour instead of an-

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 167
other one to a given state of mind, individual or collective, describ- able in the language of introspection. (Rougier 1937138, 192)
To this, Rougier gives the expected reply from the behaviourist, namely that it is not surprising that a given stimulus would provoke different responses in different persons, since one could always distinguish be- tween normal and abnormal cases. To this, Rougier answers that the very possibility of distinguishing between normal and abnormal cases requires the language of introspection, because
... there exists no set of invariable psycho-physical laws which would relate one-to-one a given state of mind to a given group of individual or collective responses. (Rougier 1937138, 192)
There is no invariable psycho-physical laws. This is the heart of Rougier's position. Alas, he appears merely to state his claim rather than argue for it. At least, one should note here that the impossibility of finding such invariable psycho-physical laws is closely connected with Rougier's defence of the 'plasticity' of mind, discussed in the previous section. With hindsight, it is clear that the latter served as a strong mo- tive for Rougier's anti-physicalist stance.
Rougier's third claim is, to my mind, the most interesting one. It concerns the nature of explanations. Rougier argues once more from analogy. A mathematician can read a physics book, axiomatize it, verify the deductions, etc. And
He [...I will understand the logical syntax of the language that is be- ing used, but he will be incapable to give it any physical meaning until he will be given the rules of correspondence between a given symbol and the indications of a given instrument. Now one cannot describe an instrument and its functioning without using the de- scriptive language of qualities. A purely mathematical language is insufficient to build up physics. (Rougier 7937138, 193)
We may leave aside, however, the analogy with physics and concen- trate on the argument against behaviourism:
Similarly, the behaviourist can describe the behaviour of Socrates in his prison. He will find out that, although the door is open and de- spite his friends advice, Socrates remains seated on his bed. But if he limits himself to the following minutes: "the bones are hanging in

168 Mathieu Marion
their sockets, the relaxation and contraction of the sinew enable Socrates to bend his limbs" and to remain seated on his bed, he would not have explained Socrates' attitude [...I He will explain it only if Socrates explains to him, in psychological language, his rea- sons for not taking flight. Physicalism is thus refuted in the well- known page of the Phaedo. (Rougier 1937138,193)
To understand the point of the argument, it is worth citing the page from the Phaedo alluded to:
This wonderful hope was dashed as I went on reading and saw that the man made no use of Mind, nor gave it any responsibility for the management of things, but mentioned as causes air and ether and water and many other strange things. That seemed to me much like saying that Socrates' actions are all due to his mind, and then in try- ing to tell the causes of everything I do, to say that the reason that I am sitting here is because my body consists of bones and sinews, because the bones are hard and are separated by joints, that the sinews are such as to contact and relax, that they surround the bones along with flesh and skin which hold them together, then as the bones are hanging in their sockets, the relaxation and contrac- tion of the sinew enable me to bend my limbs, and that is the cause of my sitting here with my limbs bent.
Again, he would mention other such causes for my talking to you: sounds and air and hearing, and a thousand other such things, but he would neglect to mention the true causes, that, after the Athenians decided it was better to condemn me, for this reason it seemed best to me to sit here and more right to remain and to en- dure whatever penalty they ordered. For, by the dog, I think these sinews and bones could long ago have been in Megara or among the Beotians, taken there by my belief as to the best course, if I had not thought it more right and honourable to endure whatever pen- alty the city ordered rather than escape and run away. To call those things causes is too absurd. If someone said that without bones and sinews and all such things, I should not be able to do what I decided, he would be right, but surely to say that they are the cause of what I do, and not that I have chosen the best course, even though I act with my mind, is to speak very lazily and carelessly. (98 b-99 b)36

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 169
Reading this passage with Rougier's eyes, it looks as if Plato is clearly pointing out that there are two irreducible modes of explanation: ex- plaining by citing reasons and causal explanations. And Rougier makes explicit that actions can only be satisfactorily explained by citing rea- sons. (This is of course a deviant use of Plato, whose dialogue was written in order to defend the thesis of the immortality of the soul.) This position effectively undermines the universality of physicalism and it is not prima facie implausible; it has its defenders todaya3' One alternative to Rougier's position, which was, of course, not envisaged by him, is Davidson's anomalous monism and the claim that "a reason is a ra- tional cause" (Davidson 1980, 233). At any rate, it seems to me that all Rougier did was to provide, with Plato's vivid example, an illustration of that thesis. He does not show, for example, how an analysis of reasons in terms of causes is imp~ausible.~~ Therefore, it would be correct to say that Rougier succeeded more in stating his position than in providing a cogent argument in support of it. At least he could have simply pointed out that, from his standpoint, the onus is on the physicalist to provide a reduction of reasons to causes. At any rate, one should notice that this stance coheres well with the remark in the preface to the Traite de la connaissance, on the methods of the social sciences; there, Rougier refers to Weber, Pareto and Rueff in support of the idea that the social sciences must take into account a 'teleological causality', that of the representation of ends and the choices of means as causes for actions. Even though his arguments cannot be seen as convincing, he at least succeeded in stating a prima facie viable anti-reductionist position.
In closing, one may ask if there are elements in Rougier's back- ground that may explain his radically anti-physicalist stance. Surely, Rougier must have known about Auguste Comte's classification of the sciences. Comte's anti-reductionism is based on a classification of phenomena, which are ranked from the simplest to the more complex; it is claimed that there are both new qualitative elements at each new stage that are not reducible to those of lower stages and that new methods for the study of phenomena appear at each new stage (Levy- Bruhl 1913, 90-93). There are no traces of this in Rougier's writings in the 1930s but the Traite de la connaissance contains a description of the universe as a 'stratified reality' (Rougier 1955, 404), the study of which requires, when moving from one stratum to another requires a 'complete change of logic and method' (Rougier 1955, 406).
This is, again, quite in line with Rougier's brief remarks in that book on the distinctive nature of the methods of the social sciences (Rougier 1955, 25, 305, 406n.). It is a pity that Rougier appears never to have

170 Mathieu Marion
developed his views on the methodology of social sciences. All signs indicate that they were akin to those of Hayek, although there are some obvious differences (e.g., Hayek was influenced by Popper on the sci- entific method and his critique of 'scientism' in the social sciences owes a lot to Popper, while there are no traces of falsificationism in Rougier, who remained a verificationist). A comparative study of Rougier's and Hayek's anti-physicalism (along with Popper's view on methodological dualism)39 would shed further light on this q~estion.~'
Bibliography
Allais, M., 1990, Louis Rougier prince de la pensee, Lourmarin de Provence, les terrasses de Lourmarin, 1990.
Armstrong, D. M., 1968, A Materialist Theory of the Mind, London, Routledge & Kegan Paul.
Benda, J., 1950, De quelques constantes de I'esprit humain. Critique du mobilisme contemporain (Bergson, Brunschvicg, Boutroux, Le Roy, Bachelard, Rougier), Paris, Gallimard.
Black, M., 1942, "Conventionalism in Geometry and the Interpretation of Necessary Statements", Philosophy of Science, vol. 9, 335-349.
Carnap, R., 1933, L'ancienne et la nouvelle logique, Paris, Hermann. Carnap, R., 1934, La science et la metaphysique devant IJanalyse
logique du langage, Paris, Hermann. Carnap, R., 1967, The Logical Structure of the World, Berkeley & Los
Angeles, University of California Press. Carnap, R., 1995, The Unity of Science, reprint, Bristol, Thoemmes. Carnap, R., & P. Frank, J. Jorgensen, C. W. Morris, 0. Neurath, H.
Reichenbach, L. Rougier, L. Stebbing, 1936, "Introductionn, Actes du Congres international de philosophie scientifique, Sorbonne, Paris, 1935, Paris, Hermann, vol. 1, 1-2.
Davidson, D., 1980, Essays on Actions and Events, Oxford, Clarendon Press.
Denord, F., 2001, "Aux origines du neo-liberalisme en France. Louis Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938", Le Mouvement social, n. 195, 9-34.
Frank, P., 1934, Theorie de la connaissance et physique moderne, Paris, Hermann.

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 171
Frank, P., 1950, Modern Science and its Philosophy, New York, Arno Press.
Gillett, G., 1993, "Actions, Causes, and Mental Ascriptions", in H. Rob- inson (ed.), Objections to Physicalism, Oxford, Clarendon Press, 81-1 00.
Goblot, E., 1917, Traite de logique, Paris, Armand Colin. Hahn, H., 1935, Logique, mathematiques et connaissance de la realite,
Paris, Hermann. Huxley, A., 1927, Proper Studies, London, Chatto & Windus. Jarvie, I. C., 1982, "Popper on the Difference Between the Natural and
the Social Sciencesn, in P. Levison (ed.), In Pursuit of Truth, Atlantic Highlands N. J., Humanities Press, 83-107.
Juhos, B. v., 1935, "Empiricism and Physicalism", Analysis, vol. 2, 81- 91.
Lecoq, T., 1989, "Louis Rougier et le neo-liberalisme de I'entre-deux- guerres", Revue de synthese, vol. 1 10, 241 -255.
Lenzen, V., 1956, "Review of Traite de la connaissance. Louis Rougier. Paris, Gauthier-Villars, 1955", Philosophy and Phenomenological Research, vol. 1 7, 125-1 27.
Levy-Bruhl, L., 1913, La philosophie d'Auguste Comte, Paris, Felix Alcan.
Levy-Bruhl, L., 1922a, Les fonctions mentales dans les societes in- ferieures, 5th ed., Paris, Felix Alcan.
Levy-Bruhl, L., l922b, La mentalite primitive, Paris, Felix Alcan. Marion, M., 2002, "Carnap, lecteur de Wittgenstein; Wittgenstein, lec-
teur de Carnap", in F. Lepage, M. Paquette & F. Rivenc (eds.), Carnap aujourd'hui, MontrealIParis, BellarminNrin, 87-1 11.
Nadeau, R., 2001, "Sur I'antiphysicalisme de Hayek. Essai d'elucidation", Revue de philosophie economique, vol. 3, 67-1 12.
Nagel, E., 1961, The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation, New York, Harcourt, Brace & Co.
Neurath, O., 1935, Le developpement du Cercle de Vienne et I'avenir de I'empirisme logique, Paris, Hermann.
Neurath, O., 1983, Philosophical Papers 1913-1946, Dordrecht, D. Reidel.
Nicod, J., 1930, Foundations of Geometry and Induction, New York, Harcourt, Brace & Co.
Pap, A., 1956, "Logical Empiricism and Rationalism", Dialectica, vol. 10, 148-1 66.
Poincare, H., 2002, Scientific Opportunism / L'opportunisme scienti- fique. An Anthology, L. Rollet (ed.), Boston-Zurich, Birkhauser.

172 Mathieu Marion
Pirou, G., 1938, "Jugements nouveaux sur le capitalismen, Revue dJeconomie politique, vol. 52, 1097-1 120.
Reichenbach, H., 1939, Introduction a la logistique, Paris, Hermann. Rougier, L., 1913, "Henri Poincare et la mort des verites necessairesn,
La phalange, July 191 3, 1-20. Rougier, L., 1914, "L'utilisation de la geometrie non-euclidienne dans la
physique de la relativite", L'enseignement mathematique vol. 16, 5- 18.
Rougier, L., 1916, "La demonstration geometrique et le raisonnement deductif", Revue de metaphysique et de morale, vol. 23, 809-858.
Rougier, L., 1917a, "La symetrie des phenomenes physiques et le prin- cipe de raison suffisante", Revue de metaphysique et de morale, VOI. 24, 165-1 98.
Rougier, L., 1917b, "De la necessite d'une reforme dans I'enseignement de la logique", Revue de metaphysique et de mo- rale, vol. 24, 569-594.
Rougier, L., 191 711 8, "La materialisation de I'energie", Revue philoso- phique, vol. 84, 473-526 & vol. 85, 28-64.
Rougier, L., 191 8a, "Encore la degradation de I'energie: I'entropie s'accroit-elle?", Revue philosophique, vol. 85, 189-1 97.
Rougier, L., 191 8b, "Reflexions sur la thermodynamique, a propos d'un livre recent", Revue philosophique, vol. 85, 435-478.
Rougier, L., 191 9a, La materialisation de I'energie. Essai sur la theorie de la relativite et la theorie des quantas, Paris, Gauthier-Villars.
Rougier, L., 1919b, "A propos de la demonstration geometrique: re- ponse a M. Goblot", Revue de metaphysique et de morale, vol. 26, 51 7-521.
Rougier, L., 191 9c, "Les erreurs systematiques de I'intuition", Revue de metaphysique et de morale, vol. 26, 596-61 6.
Rougier, L., 1920a, La philosophie geometrique dlHenri Poincare, Paris, Alcan.
Rougier, L., 1920b, Les paralogismes du rationalisme. Essai sur la theorie de la connaissance, Paris, Alcan.
Rougier, L., 1920c, En marge de Curie, Carnot et d'Einstein. Etude de philosophie scientifique, Paris, Chiron.
Rougier, L., 1921 a, La structure des theories deductives. Theorie nou- velle de la deduction, Paris, Alcan.
Rougier, L., 1921 b, La matiere et I'energie, selon la theorie de la rela- tivite et la theorie des quantas, Paris, Gauthier-Villars.
Rougier, L., 1921c, Philosophy and the New Physics, Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 173
Rougier, L., 1921d, "Le mythe de la raison pure et la science des struc- tures mentales", Logos, July 1921, 21 7-229.
Rougier, L., 1924, "La mentalite scolastique", Revue philosophique, vol. 87, 208-232.
Rougier, L., 1925, La scolastique et le thomisme, Paris, Gauthier-Villars Rougier, L., 1929, La mystique democratique, ses origines, ses illu-
sions, Paris, Flammarion. Rougier, L., 1931, "La philosophie scientifique. Son developpement
depuis le debut du XXe siecle", Larousse mensuel illustre, vol. 8, n. 293, 752-755.
Rougier, L., 1935a, Les mystiques politiques et leurs incidences inter- nationales, Paris, Sirey,
Rougier, L., 1935b, "La scolastique et la logique", Erkenntnis, vol. 5, 100-111.
Rougier, L., 1936a, "De I'opinion dans les democraties et dans les gou- vernements autoritairesn, Actes du huitieme congres international de philosophie a Prague. 2-7 septembre 1934, Liechtenstein, Kraus Reprint, 593-600.
Rougier, L., 1936b, "Avant-Propos", Actes du Congres international de philosophie scientifique, Sorbonne, Paris, 1935, Paris, Hermann, VOI. 1, 3-6.
Rougier, L., l936c, "Allocution d'ouverture du Congres", Actes du Con- gres international de philosophie scientifique, Sorbonne, Paris, 1935, Paris, Hermann, vol. 1, 7-1 1.
Rougier, L., 1936d, "Allocution finale", Actes du Congres international de philosophie scientifique, Sorbonne, Paris, 1935, Paris, Hermann, VOI. VIII, 88-91.
Rougier, L., 1936e, "Pseudo-problemes resolus et souleves par la logique d'Aristoten, Actes du Congres international de philosophie scientifique, Sorbonne, Paris, 1935, Paris, Hermann, vol. 11 1, 35-40.
Rougier, L., 1936f, "Une philosophie nouvelle: I'empirisme logique, a propos d'un Congres recent", Revue de Paris, vol. 43, t. 1, 182-1 95.
Rougier, L., 1937138, "Le langage de la physique est-il universe1 et autonome?", Erkenntnis, vol. 7, 189-1 94.
Rougier, L., 1938, Les mystiques economiques. Comment Iron passe des democraties liberales aux etats totalitaires, Paris, Editions de Medicis.
Rougier, L. (ed.), 1939, Le Colloque Walter Lippmann, Paris, ~dit ions de Medicis
Rougier, L., 1939140, "La relativite de la logique", Erkenntnis, vol. 8, 193-21 7.

174 Mathieu Marion
Rougier, L., 1940, "La relativite de la logique", Revue de metaphysique et de morale, vol. 47, 305-330.
Rougier, L., 1 941 , "The Relativity of Logic", Philosophy and Phenom- enological Research, vol. 2, 137-1 58.
Rougier, L., 1947, "La philosophie dlHenri Poincare", in H. Poincare, La valeur de la science, Geneva, Constant Bourquin, 13-55.
Rougier, L., 1949, "lhonces indetermines, indecidables, contradictoires et vides de sensn, Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam, North-Holland, vol. 11, 610-61 7.
Roug ier, L., 1 955, Traite de la connaissance, Paris, Gauthier-Villars. Rougier, L., 1960, "Itineraire philosophique", Revue liberale, October
1960,6-79. Santillana, G. de & E. Zilsel, 1941, The Development of Rationalism
and Empiricism, Chicago, University of Chicago Press. Schlick, M., 1934, Les enonces scientifiques et la realite du monde
exterieur, Paris, Hermann. Schlick, M., 1935, Sur les fondements de la connaissance, Paris,
Hermann. Schlick, M., 1979, Philosophical Papers. Volume 11 [1925-19361,
Dordrecht, D. Reidel. Stadler, F., 2001, The Vienna Circle. Studies in the Origins, Develop-
ment, and Influence of Logical Empiricism, Vienna-New York, Springer.
Stegmiiller, W., 1969, Main Currents in German, British and American Philosophy, Bloomington, Indiana University Press.
Stump, D., 1991, "Poincares Thesis of the Translatability of Euclidean and Non-Euclidean Geometries", Noes, vol. 25, 639-657.
Tilgher, A., 1922, Relativisti contemporanei: Vaihinger, Einstein, Rougier, Spengler, I'idealismo attuale, relativismo e rivoluzione, Rome, Libreria di Scienze e Lettere.
Vouillemin, E., 1935, La logique de la science et 1'~cole de Vienne, Paris, Herrnann.

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science
Notes
For example, Rougier is the only major figure of the Circle's periphery to have re- ceived less than full attention in Friedrich Stadler's monumental study, The Vienna Circle (Stadler 2001). For these delicate matters, see M. Marion, "Investigating Rougier", Cahiers d'6pistemologie, no 2004-02, Departement de philosophie, Universite du Quebec a Montreal. An electronic version (PDF format) available at http://www.philo.uqam.ca/recherche/gredgl. Some material from the present paper is taken from this preprint. In what follows, I shall refer to unpublished material for which there are two sources. Rougier's papers were deposited at the Chateau de Lourmarin in Provence by his widow, in the 1980s. The Fonds Rougier is, however, not yet catalogued, except for the papers in political economy. Copies of parts of Rougier's correspondence with Carnap, Neurath, Reichenbach and Schlick are at the philosophischen Archivs of the Universitat Konstanz. Rougier's earliest letter to Schlick is dated November 27, 1931. A copy is available at the philosophical archives at Konstanz. Photocopies (not the originals) of parts of the correspondence with Schlick that are not in Konstanz are in the archives at Lourmarin. See the letter to Schlick dated November 6, 1932, available in Konstanz. Evidence for these claims is found in (Rougier 1960, 53) and in a letter from Rougier to his mother reproduced in (Allais 1990, 60-61). See footnote 9 below. The correspondence between Neurath and Rougier is available in the philosophical archives at the University of Konstanz. In the earliest letter, dated November 14, 1933, Rougier asked, on the behalf of a number of French organizations, that the Vorkonferenz takes place in Paris instead of Prague. Incidentally, a project which was very different in nature from that of the Ency- clopedie fran~aise, which was set up in the 1930s. The French equivalent of the 'heart' of Neurath's Encyclopaedia was a introductory volume, to the elaboration of which Abel Rey was involved, on 'the mental equipment' (I'outillage mental), from primitive to modem societies. Some of Rougier's suggestions to Neurath on the proper plan for the Encyclopaedia, e.g., in the letter dated January 12, 1938 (in the archives at Konstanz), suggest that Rougier thought this introductory volume to the EncyclopBdie fran~aise worth imitating. Along with the French economists Jacques Rueff and Maurice Allais, the American journalist Walter Lippmann, and other European economists such as Sir Lionel Rob- bins, Wilhelm Ropke, Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek, Louis Rougier was part of this first generation of 'neo-liberals' in the twentieth-century. He published ex- tensively on political philosophy and political economy, including La mystique d6- mocratique, ses origineq ses illusions (Rougier 1929), Les mystiques politiques et leurs incidences internationales (Rougier 1935a), and Les mystiques Bconomiques. Comment I'on passe des democraties liberales aux etats totalitaires (Rougier 1938). Rougier also took part in the organization of the first international congress of neo- liberal thought in the twentieth century, the Colloque Walter Lippmann, which took place in Paris, in August 1938, and he edited the proceedings (Rougier 1939). In the same year, he took part with Louis Marlio and others in the foundation of the Centre international d'etudes pour la renovation du lib6ralisme. Through such activities, Rougier was at the centre of a network, in Paris and Geneva, of industrialists, politi- cians, economists, and publishers whose task was to promote liberalism, and, through friends such as Marlio, he had links with members of the Daladier-Reynauld

176 Mathieu Marion
government which succeeded to the Front populaire and adopted a liberal economic agenda. Rougier's role has been documented in (Denord 2001) and his views on po- litical economy are critically assessed in (Lecoq 1989). For a different reaction, from a leading French economist in the 1930s, see (Pirou 1938). See also (Marion 2004), section 3, for more details on Rougier and political liberalism. The last letter in the archives at Konstanz, from Neurath to Rougier, dates from April 24, 1940 and it indicates that Neurath is still waiting for Rougier's contribution. There is no reason to believe that Neurath and Rougier stopped corresponding in April 1940, but I am not aware of any other letters. The surviving letters from 1938 and 1939 indicate that Rougier kept postponing the submission date because he was in- volved in what looked to him as the more pressing matters at the time, namely his activities promoting neo-liberalism as the alternative to the ideologies of central planification (socialism and corporatism) and as the only solution for peace in Europe. I refer here in particular to the letters, in the archives at Konstanz, dated May 30, 1938, which shows that Rougier and Santillana established the plans of their mono- graphs together, and from June 19, 1938, where Rougier even suggested editorial revisions to Zilsel's monograph. Rougier gave the opening lecture but it remained unpublished. I have no explanation for Rougier's withdrawal. See (Carnap 1933, 1934), (Frank, 1934), (Hahn 1935), (Neurath 1935), (Reichen- bach 1939), (Schlick 1934, 1935). To these, one must add an introduction to logical empiricism by Ernest Vouillemin (Vouillemin 1935). In the letter mentionned in footnote 32, above. See especially the letters dated September 22, 1938 and November 14, 1938, in Konstanz. Rougier kept suggesting conciliatory gestures towards Gonseth, to no avail. See footnote 9, above. Le Monde, October 7,2003. For example, Rougier is mentioned as the main French representative of 'logical positivism' in Andre Lalande's Vocabulaire technique et critique de la philosophie (Lalande 1968, 1268). This was the standard dictionary in France until the late 1990s. Other papers include (Rougier 191 7a), (Rougier 191 8a), (Rougier 191 8b), (Rougier 191 9c). Rougier's interpretation of Poincare was already set out in what appears to be his very first publication, "Henri Poincare et la mort des verites necessaires" (Rougier 1913). In parallel with his interpretation of Poincare, Rougier engaged in a contro- versy on the nature of logic with his teacher, Edmond Goblot, who believed errone- ously that "reasoning is never independent from the objects about which one is rea- soning" and that "formal logic is absolutely sterile" (Goblot 1917, xxii-xxiii). For the Rougier-Goblot exchange, see (Rougier 191 6, 810-81 3), (Goblot 191 7, xvii-xxiii), (Rougier 1919b). Rougier, who was not a logicist, was nevertheless one of the first in France to take up the cause of new formal logic, after Louis Couturat but before Jean Nicod. Rougier was indeed asking for a reform of the teaching of logic as early as 1917 (Rougier 1917b). Since Poincare's opinion on logic was not very far from Goblot's, Rougier, who was better informed about recent progress, did not follow his word faithfully. See (Stump 1991). In connection with Poincare, one should note Rougier's failed editorial project for a fifth, posthumous, volume of writings by the French mathemati-

Louis Rougier, the Vienna Circle and the Unity of Science 177
cian entitled L'opportunisme scientifique did not materialize. Apparently, Poincares family objected to it and the volume appeared only in 2002 (Poincarb 2002).
23. The four main paralogisms are described in (Rougier 1960,25). 24. See also the end of "La matbrialisation de 1'6nergien, where Rougier takes a finitist,
empiricist, pragmatic stance against Cantorians from the standpoint of philosophy of physics (Rougier 191 711 8, 60-61).
25. Incidentally, the passage in question at (Rougier 1955, 426), contains an ambiguous reference to 'la race blanche". It is allusions such as this one which support the claim that Rougier was a racist. Again, on these matters, see (Marion 2004).
26. Incidentally, Rougier's understanding of Wittgenstein is close to the conventionalist reading of Carnap. Recall the Logical Structure of the World "Logic consists solely of conventions concerning the use of symbols, and of tautologies on the basis of these conventions" (Carnap 1967, 107). As for Rougier on Wittgenstein: "[Logic] is a set of tautologies that teaches how to remain consistent with the linguistic conven- tions we edict, to recognize the equivalence of different sentences in virtue of the same conventions [...In (Rougier 1960, 48).
27. See also (Rougier 1936f 193). 28. Respectively, (Rougier 1960, 63-65) and (Rougier 1960. 17). 29. See (Rougier 1949) (Rougier 1960, 58-59). 30. 1 have discussed this last point in many places, see, e.g., (Marion 2002). 31. Both letters available at the archives in Konstanz. 32. This point is argued in the Traite de la connaissance, (Rougier 1955, 190-192). 33. On this point see (Rougier 1949). 34. See also (Rougier 1955, 184-1 87,215). 35. On this terminological matter, I relied on (Stegmiiller 1969, 292-295). 36. The translation quoted here is from Plato, Five Dialogues, sec. ed., Indianapolis,
Hackett, 2002. 37. See, e.g., (Gillett 1993). 38. For an example of such reduction, see (Armstrong 1968,200-204). 39. On Hayek, see (Nadeau 2001), on Popper, (Jamie 1982). 40. 1 would like to thank above all Claudia Berndt for countless conversations on
Rougier's life, about which she knows so much, and Kevin Mulligan for so many il- luminating suggestions. I also benefited much from conversations with Michel Bour- deau, Steven Davis, Pascal Engel, Jan Lacki, Jean Leroux, Robert Nadeau, and Jean-Claude Pont. Finally, I should thank Elisabeth Nemeth and Friedrich Stadler for their kind invitation to the colloquium Paris-Wien. Enzyklopadien im Vergleich, which took place in Vienna, in October 2003.

PETER SCH~TTLER
13, RUE DU FOUR - DIE ,,ENCYCLOPEDIE FRANCAISE" ALS MlTTLERlN FRANZOSISCHER WISSENSCHAFT IN DEN 1930ER JAHREN
Mitten im Quartier Latin, unweit der Metro-Station Mabillon, steht ein wuchtiges Gebaude, uber dessen Portal die lnschrift Jniversite de Parisii eingemeiaelt ist. Im Erdgeschol3 befindet sich eine Buchhand- lung; daruber liegen Buroetagen, in denen Wissenschaftler ihrer Arbeit nachgehen. Die Adresse lautet: 13, rue du Four. Heute befindet sich hier unter anderem der Sitz des lnstitut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques der Universitat Paris I.
Doch wir wollen nicht von der Gegenwart sprechen, sondern von 1935. Schon darnals war "Treize. rue du Four" eine wichtige Adresse. In der Buchhandlung zur StraBe hin, im Treppenhaus und in den Buros begegneten sich sehr verschiedene Menschen, deren Namen uns noch heute rnanchrnal etwas sagen. Doch haben sie auch miteinander ge- sprochen? Oder sind sie blot3 aneinander vorbeigegangen - wie Frern- de? Hoflich vielleicht, den Hut luftend und rnit einem ,,Bonjour", ohne zu wissen, dass sie sich etwas zu sagen gehabt hatten?
Das ist nicht bloB eine rhetorische Frage. Bis heute wurde von Be- gegnungen, die im .Treize, rue du Four" moglicherweise stattfanden, wenig berichtet. Entweder, weil es nichts zu berichten gab oder, weil der Blick der Betrachter allzu einseitig ausgerichtet war: Die einen inte- ressierten sich nur fur die Welt der Naturwissenschaften, die anderen nur fur die der Geisteswissenschaften, die einen nur fur Philosophie, die anderen nur fiir Geschichtsschreibung oder Ethnologie, Literatur oder Psychoanalyse. Und aufgrund dieser gleichsam ,,schielendenU Perspektive entging den Betrachtern womoglich genau das, was sich zwischen diesen scheinbar weit auseinanderliegenden Feldern abge- spielt haben mag.
Was also war in diesem Gebaude? Zum einen war darin das lnstitut fur Wissenschaftsgeschichte der Sorbonne untergebracht, das unter der Leitung des Philosophen Abel Rey stand; zum anderen aber auch eine Institution, von der im weiteren die Rede sein soll: die Ency- clopedie Fran~aise. In der Tat, irn Erdgeschot3 des "Treize, rue du Fourn befanden sich die Buchhandlung und das Sekretariat der Encyc- lopedie, und im 1. Stock lagen die Buros ihrer Herausgeber und Redak- teure.' Eine blol3e Koinzidenz? Oder eine Nachbarschaft, die eine per-

180 Peter Schottler
sonelle und intellektuelle Verknupfung signalisierte? Wir werden sehen. Jedenfalls ist die Sache um so interessanter, als derselbe Ort 1938 zur Adresse noch eines weiteren ernblematisches Projekts werden sollte, namlich der Zeitschrift Annales d'histoire economique et sociale von Marc Bloch und Lucien Febvre. Also: Philosophen und Wissenschaftler, Enzyklopadisten und Historiker unter einern Dach - eine erstaunliche Konstellation.
I. Die ,,Encyclopedic Fran~aise" als Projekt
Was war uberhaupt die Encyclopedie Fran~aise? Diese banale Frage ist heute um so notiger, als nur noch wenige ihren Namen kennen, und noch geringer durfte die Zahl derjenigen sein, die einen ihrer immerhin 20 Bande (plus Registerband) jernals konsultiert haben. Denn heute gilt die Encyclopedie Fran~aise weithin als veraltet. Meist steht sie unbe- nutzt in den Regalen der Bibliotheken - ein blofies Dokurnent ver- gangener Wissenschaftspolitik. Sogar unter Historikern, die es besser wissen mussten, gilt das Projekt dieser Encyclopedie als gescheitert.
Erst in den letzten Jahren hat sich das Bild ein wenig geandert, und m a r aufgrund neuer Forschungen uber den Historiker Lucien Febvre sowie einer Tagung, die 1997 irn lnstitut M6moire de IJEdition Con- temporaine in Paris stattfand und deren Beitrage kurzlich erschienen sind.* Irn folgenden werde ich rnich, was die rnaterielle und politische Seite des Projekts angeht, gelegentlich darauf stutzen; dagegen wer- den rneine Hypothesen zu den intellektuellen Beruhrungspunkten m i - schen Encyclopedie Fran~aise und "Wiener Kreis" verrnutlich auch franzosische Leser uberraschen.
Kulturgeschichtlich steht das Projekt der Encyclopedie Fran~aise irn Zusarnrnenhang mit der Aufbruchsstimrnung des Front ~ o ~ u l a i r e . ~ Doch die ldee wurde bereits irn Juli 1932 lanciert, und m a r von Anatole de Monzie, dern damaligen Erziehungsrninister der Regierung von Edouard Herriot. Anlafi war ein internationaler Padagogenkongress in Nizza. Die geplante Encyclopedie sollte gleichsarn eine franzosische oder wie man darnals sagte: eine .republikanischeU Antwort und Alter- native zu den grofien Enzyklopadien des Auslandes darstellen, nicht zuletzt in Deutschland, ltalien und der Sowjetunion. De Monzie suchte daraufhin nach einem Herausgeber, der das Projekt gestalten und betreuen sollte. Unter rnehreren Kandidaten wahlte er schliefilich Febv- re aus, der damals in Strafiburg lehrte und sich als Autor zahlreicher Biicher (u.a. uber die Franche-Cornte, uber Luther, aber auch uber das

13, rue du Four 181
Verhaltnis von Geographie und Geschichtswissenschaften oder uber den Rhein in der europaischen Geschichte) einen Narnen gernachte hatte.4 Daruber hinaus gab Febvre seit 1929 zusammen mit seinem Kollegen Bloch die Zeitschrift Annales d'histoire economique et sociale heraus, die in fortschrittlichen Kreisen grot3es Ansehen genoss, weil sie nicht blot3 ein akademisches Fachorgan war, sondern versuchte, neue Fragestellungen einem breiteren Publikurn zu vermitte~n.~ Febvre, da- mals 54 Jahre alt, galt als besonders vielseitig, offen und produktiv, und als er im November 1932 ans College de France berufen wurde, besta- tigte dies sein hohes Ansehen, das weit uber den Kreis der Fachge- nossen hinausreichte.
Dennoch, indem der Minister einen Stranburger Historiker an die Spitze eines gronen, quasi-staatlichen Projekts stellte, ging er einen ungewohnlichen Weg. Zwar hatte sich Febvre immer wieder fur Inter- disziplinaritat eingesetzt, doch konnte man sich fragen, ob er diesen Anspruch auch im grot3en Maastab einer Enzyklopadie und nicht zu- letzt gegenuber den Naturwissenschaften wurde einlosen konnen. Dar- uber hinaus hatte er seinem Auftraggeber einen Typus von Enzyklopa- die vorgeschlagen, fur den es bislang kein Vorbild gab. Worin bestand sein neues Konzept? Obwohl sich Febvre zur Tradition von Diderot und d'Alembert bekannte, brach er mit dem uberlieferten Genre des alpha- betisch gegliederten Konversationslexikons:
Ni dictionnaire alphabetique, ni bibliotheque de traites dogmatiques,
heil3t es in einer Broschure von 1933,
I'Encyclopedie [Fran~aise], usant d'une formule nouvelle, realisera sous forme d'un ouvrage rnethodique redige par des hornmes de premier plan, I'inventaire total d'une civilisation a une epoque determinee.6
Dementsprechend sollte die Enzyklopadie, die er anfangs auch als .Encyclopedic du monde moderne" oder .Encyclopedic 1935" bezeich- nete, thematisch gegliedert und problemorientiert sein. Sie sollte nicht allein .informierenu (renseigner), sondern vor allem ,,bildenU (enseigner). Das aber sei ohne ein Minimum an vorausgehenden Ideen, ohne Ma&- stabe, ohne einen bestimmten "Geist" nicht moglich. Fur ihren .tour d'horizon" brauche die Enzyklopadie einen Mittelpunkt, und dieser .centre cornmun" sei .ni la Race, ni I1Etat1 ni la Classe", sondern allein der Mensch, ,,l'Hommeu. Die neue Encyclopedie verstand sich also

182 Peter Schottler
ganz explizit als .hurnanistischesU Projekt. Und zugleich als ein rationa- listisches:
Pas de complications vaines,
heil3t es im Programrn,
pas de coupures plus ou moins arbitraires dans le plan. Unite de I'univers, unite de la Science, double postulat de toute I'entreprise. Donc, entre le domaine de la matiere inanirnee et celui de la Vie, point de fosse proclame infranchissable; rnais point non plus de reduction brutale et forcee de I'anime a I'inanirne. Unite ne veut dire ni confusion, ni violence arbitraire.'
Man kann sich leicht denken, dass allein schon diese Akzentuierung in den Augen mancher (konservativen) Kritiker eine gefahrliche Tendenz darstellte.
In einern eigenen Beitrag iiber die Enzyklopadie als literarische Gattung, der irn sechsten Band erschien,' versuchte Febvre sein Pro- jekt gleichsarn idealtypisch zu situieren. Er unterschied dabei vier Arten von Enzyklopadien, die jeweils verschiedenen Epochen entsprachen: - zunachst die Enzyklopadien im Zeitalter gottlicher Gewissheiten (au temps des certitudes divines); - dann die Enzyklopadien irn Zeitalter der certitudes lai'ques, und hier dachte er naturlich in erster Linie an Diderot; - schliefilich die Enzyklopadien irn Zeitalter der certitudes sommaires, jener ~ r a , in der man sich weitgehend mit der positiven Prasentation eines akkurnulierten Wissens zufriedengab und meinte, sich dieses definitiv aneignen zu konnen; - derngegenuber entspreche die neue Encyclopedie Fran~aise einern weiteren Zeitalter, namlich dern der ,,gelehrten Ungewissheit", der sav- ante incertitude. Mit den wissenschaftlichen Urnwalzungen seit der Jahrhundertwende habe sich auch das Wissenschaftsverstandnis ge- wandelt und dern entspreche das Konzept einer Enzyklopadie, von der Febvre verlangte, dass sie es verstehen musse, "nicht alles zu wissen": .Une encyclopedie qui sait ne pas tout avo it‘.^
In dieser scheinbar paradoxen Forderung, einerseits die Einheit, die "unite profonde de I'univers" und aller Wissenschaften zu attestieren und andererseits die Problerne und Widerspruche dieser Wissenschaf- ten ausdrucklich zu benennen, liegt verrnutlich die eigentliche Inno- vation und das grol3e Wagnis des Projekts. Auch ergibt sich aus dieser

13, rue du Four 183
Verknupfung eine standige Prioritat des Neuen gegenuber dem Be- kannten, der Wissenschaft im Entstehen gegeniiber den Gewissheiten der Vergangenheit. Oder, um mit Febvre zu sprechen:
Voici sur le vieux tronc de I'arbre encyclopedique, ce rejeton origi- nal et qu'on n'a pas encore vu: une encyclopedie d'inventeurs, de chercheurs et, si I'on peut dire, de producteurs. Voici une encyclo- pedie qui ne se vante pas candidement de dire tout, et donc de sa- voir tout, mais qui accepte de dire, modestement, I'essentiel de ce qui vaut la peine d'Qtre dit - c'est-a-dire de ce qui n'est point encore connu d'une connaissance devenue scolaire et classique. Voici I'encyclopedie qui ose, et sait, et peut valablement dire: c<~'i~nore>>.''
Was dieses Programm bedeutete, Iasst sich sowohl an den Starken als auch an den Schwachen der zwischen 1935 und 1939 erschienenen Bande ablesen: immerhin elf von zwanzig geplanten Banden; die restli- chen neun erschienen zwischen 1954 und 1966.
Schaubild 1: Geplante und realisierte Bande der ,,Encyclopedic ~ ran~a ise""
VI L'Btre humain
VII L'espBce hurnaine. Les
L'espece hu-
L'Btre humain. Sant6, maladie
P. Rivet
R. Leriche H. Wallon
1936
1936

Peter Schottler
Bien-&re, hy- Bien-&re, J. Sion La civilisation gibne sociale, hygibne, sports quotidienne loisirs
Instruction, Education et C. Bougle 1939 Lecture, radio instruction
Arts & Litteratures Arts et litteratu- P. Abraham 1935 d'aujourd'hui res dans la
soci6tb conternporaine I
Arts et litteratu- P. Abraham 1936 res dans la soci6t6 contemporaine II
E. Faure, 1964 L. Trotabas
(VIII Religions et La civilisation J. Cain 1939 philosophies Bcrite
XIX L'hornrne, la terre, A. Allix Philosophie.
7 bon Busset
XX
XXI
P. q Chouard
'. G+ Renouvin 1959
la matibre
Bibliographie et repertoires des noms propres
RBpertoire alpha- betique des matibres
Religion
Le rnonde en devenir. Histoire, 6volution, perspective
Repertoire general

13. rue du Four 185
Fur viele Betrachter liegen heute die Schwachen der Enzyklopadie weit offener zutage als ihre Starken: Da ist zum einen die Unvollstandigkeit, also das unerfullte Programm. Nicht alle angekundigten Bande sind erschienen. Ausgerechnet die beiden geplanten Bande zur Geschichte, der Band uber .Religionen und Philosophien", der Band ,,L9homme, la terre, la machine" oder auch zwei Bande zur .Organisation eco- nomique" wurden - zumindest in der geplanten Form - nie publiziert. Auch der Band zur Physik, von Paul Langevin betreut, konnte erst 1957 unter der Herausgeberschaft von Louis de Broglie erscheinen.
Kaum erfullt blieb ferner die Ankundigung, dass die Enzyklopadie eine .permanenten sein wurde. Durch ihre Prasentation in Form von Heften, die durch leicht zu offnende Einbanddeckel zusammengehalten wurden, sollte eine standige Aktualisierung moglich sein. Jeder Sub- skribent sollte regelmanig neue oder uberarbeitete Hefte zugeschickt bekommen, die er selbst an die Stelle der alten einsetzen konnte. Zu diesem Zweck erschien ab 1936 eine Zeitschrift, die Revue trimestrielle de I'Encyclopedie Fran~aise. Doch schon nach vier Heften musste sie aus finanziellen Grunden ihr Erscheinen einstellen. Erst nach dem Krieg, ab 1954, kam es zu einem neuen Anlauf, und nun wurden so- wohl die fehlende 9 Bande - wenngleich mit anderen Schwerpunkten - als auch einige Erganzungshefte und ein Registerband geliefert. Damit war das Projekt offiziell zu einem guten Ende gefuhrt. In Wahrheit be- steht allerdings zwischen diesen spaten Banden und jenen der 30er Jahre eine Kluft. Die intellektuelle Atmosphare und der Mitarbeiter- stamm waren eben nicht mehr dieselben.12
Dass dieses Projekt, das als ein dauerhaftes, ja unendliches Fort- setzungswerk konzipiert war - fast konnte man es mit einer Zeitschrift vergleichen -, dermanen ins Stocken geriet und uns heute als Torso erscheint, hangt entscheidend mit finanziellen Schwierigkeiten zusam- men. Die Herausgabe einer so anspruchsvollen Enzyklopadie war ein groRes okonomisches Wagnis, das kein gewohnlicher Verlag je einge- gangen ware. Allein die staatliche Protektion, die Anerkennung der Gemeinnutzigkeit durch den Conseil d'Etat und die Forderung durch die Universitaten gaben dem Projekt eine Chance. Doch angesichts der Wirtschaftskrise und der harten Konkurrenz von Larousse und Quillet erwiesen sich diese Startvorteile als unzureichend. Hinzu kommt, dass das Unternehmen von Anfang an unterfinanziert war, und dass seine Leitung sowohl bei der Auftragsvergabe als auch bei der Rekrutierung von Personal nicht immer eine gluckliche Hand hatte. lnsgesamt drangt sich daher der Eindruck auf, dass das Projekt eher wie ein subventio- niertes Kulturunternehmen und nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen

186 Peter Schottler
betrieben wurde. So rutschte die Enzyklopadie schon nach wenigen Jahren in die roten Zahlen. Sie wurde damit immer abhangiger vom Verlag Larousse, der anfangs nur den Vertrieb in die Hand nahm und schliet3lich das ganze Unternehmen aufkaufte (und abwickelte). Die Bilanz: Im Vergleich zu anderen Enzyklopadien, die im selben Zeitraum uber 100 000 Exemplare absetzten, erreichte die Encyclopedie Fran~aise nicht einmal 10 000 ~bonnenten.'~ Man muss sich also fra- gen, ob die Verantwortlichen, und an erster Stelle naturlich Lucien Febvre, nicht zumindest als Unternehmer versagt haben. Doch der Buchhistoriker Jean-Yves Mollier, der gerade diese okonomische Seite genau untersucht hat, gibt zu bedenken:
Rien n'etait joue a I'avance, aucune fatalite ne pesait sur les epau- les de Lucien Febvre, et il est aise d'imaginer que si le Front Popu- laire avait dure et decide d'inscrire la promotion de cette entreprise parmi ses priorites, elle eQt connu une prosperite immediate qui amenerait probablement a la considerer, aujourd'hui, avec d'autres yeux et sans le mepris ou le dedain dont elle a ete largement victi- me depuis la Seconde Guerre ~ond ia le . ' ~
Den Schwachen (und man konnte noch weitere nennen: etwa den Eu- rozentrismus oder die Prasenz von politisch rechtslastigen Autoren wie Charles Maurras oder Hubert Lagardelle, doch das waren eben die politischen Zugestandnisse, die ein Minister verlangen und durchsetzen konnte) sind nun freilich die Starken gegenuberzustellen, die teilweise jene Schwachen erst bedingt oder doch begleitet haben, weil diese Enzyklopadie eben kein gewohnliches, profitorientiertes Unternehmen war:
An erster Stelle ist erneut die intellektuelle und wissenschaftliche Offenheit des Projekts zu nennen, die strukturell auch seine Unab- schlieabarkeit bedingte. Dies kam schon in der materiellen Prasentati- on zum Ausdruck, also in dem flexiblen System der Hefte und Klemm- rucken: .Nos reliures enserrent le present", heifit es in einer Werbung. .Elles s'ouvrent a I'avenir. Les pages changent, le livre reste."15 Doch dahinter steckte nicht blot3 ein Verkaufsargument - im Gegenteil: diese Einbande und die Erganzungshefte waren aut3erst kostspielig und tru- gen erheblich zum spateren Defizit bei. Worauf es Febvre und den Autoren ankam, war die Offenheit und Ungewissheit aller Forschung, und die Encyclopedie sollte diese Wissenschaftsphilosophie demonst- rieren. Daher das Bemuhen, neben dem Gewussten auch das Unbe- kannte zu umschreiben, um sich fiir kunftige Entdeckungen bereitzuhal-

13, rue du Four 187
ten. So erklarte Febvre im Vorwort zum sechsten, der Medizin gewid- meten Band, von dem besonders klar war, dass er schnell veralten wurde:
Pour nous, une fois de plus, nous avons cherche dans ce volume, difficile a asseoir sur de fortes bases, le veritable esprit du savant: s'inquieter de la verite. Tout faire pour I'etablir. Mais ne jamais Qtre de ceux qui, mettant I'ceil a une serrure sans trou, s'ecrient, halluci- nes: je vois tout!16
lndem die Enzyklopadie so offen sagte, dass sie vieles nicht wusste, stellte sie einen ungewohnlichen Anspruch. Die Wissenschaft in ihrer Aktualitat zu dokumentieren, bedeutete, dass man einerseits die kom- petentesten und innovativsten Autoren gewinnen, zugleich aber auch, dass man ihnen die Moglichkeit einraumen musste, neue, komplizierte Fragestellungen zu referieren. Das ging nicht ohne Risiko. Und es be- deutete, dass ein Teil des Publikums - und der potentiellen Kaufer - von diesen forschungsnahen Fragestellungen uberfordert sein wurde. Febvre und seine Mitstreiter nahmen dies gelassen:
LIEncyclopedie Fran~aise ne se propose pas d'atteindre a tout prix et par tous les moyens un public d'incompetents,
heil3t es im Vorwort zum Band uber die neue Physik.
Assez de livres, de repertoires, d'essais [. ..] donnent de I'effort sci- entifique contemporain des interpretations, philosophiques ou methodologiques, accessibles au lecteur commun, pour que I'Encyclopedie refuse de justifier sa raison d'exister qui est d'introduire, dans le cortege des encyclopedies, une 'encyclopedie de producteurs', puisee aux sources mQmes de la production.''
Damit war allerdings kein volliger Verzicht auf padagogische Bemu- hungen verbunden. Im Gegenteil: Gleich zu Anfang hatte Febvre in einer Broschure allen Autoren den ,,Geist" der neuen Enzyklopadie skizziert und ihnen folgende Prinzipien eingescharft:
Viser un large public de non-specialistes; regarder au present et non au passe; n'enoncer de faits qu'en fonction des idees; s'attacher aux problemes, non aux doctrines; au sens scientifique du mot, rester objectif.18

188 Peter Schottler
Daraus leitete er eine bestimmte Gliederungs- und Darstellungsform ab, die er in folgenden Sentenzen resumierte:
Adopter I'ordre de difficulte croissante ou I'ordre chronologique. Pas plus d'une division et de deux subdivisions par page. Pas de pa- ragraphes de plus de 210 mots. Une idee par paragraphe, un ar- gument par phrase. Aucun abus de termes savant^.'^
Kurzum, die Autoren und auch die Leser der Enzyklopadie mochten m a r zu einer Elite gehoren, das Projekt selbst war aber keineswegs elitar.
Wer waren die beteiligten Autoren? Es wurde zu weit fuhren, an dieser Stelle eine genaue Analyse vorzunehmen. Allein in den elf Ban- den, die bis 1939 erschienen sind, lassen sich 533 Namen ermitteln - von Marcel Abraham bis Jean ~ a ~ . ~ ~ Febvre und de Monzie ist es nam- lich tatsachlich gelungen, auf allen Gebieten die besten Fachleute zu gewinnen, wobei vor allem die Hochschulen und Universitaten stark vertreten waren. Dass es demgegenuber nur sieben Mitglieder der Acadernie Fran~aise unter den Autoren gab, angefuhrt von Paul Valery, kann man als Symptom dafur deuten, dass dieses Projekt gerade nicht ein traditionelles, geisteswissenschaftliches Weltbild vertrat, sondern die neuen Natur- und Sozialwissenschaften privilegierte. Neben den Beruhmtheiten der 30er Jahre (Antoine Meillet, Paul Rivet, Paul Lange- vin, Rene Leriche usw.) wurden ganz bewusst jungere Autoren ange- sprochen, die m a r hochqualifiziert waren, Doktoren, Agreges de IJUniversite usw., aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg allgemein be- kannt wurden. In einem Brief an de Monzie forderte Febvre einen Wechsel der Generationen: "Evitons de confier I'inventaire du monde contemporain a des hommes qui realiseraient trop bien en 1935 I'Encyclopedie de 1914; evitons, au regard d'une jeunesse inquigte et chatouilleuse, de prendre trop figure de burgraves, ou, ce qui est pire, de philoburgraves ...u.21 Ein Name mag diese 0ffnung veranschau- lichen: Jacques Lacan, der Psychoanalytiker, veroffentlichte 1938 im achten Band der Enzyklopadie seinen beruhmten Aufsatz uber die Familie, der in der Redaktion zunachst auf heftigen Widerstand stiel3 und fur den sich Febvre erst stark engagieren m u s ~ t e . ~ ~
Um sichtbar zu machen, worin die lnnovationsleistungen der Enzy- klopadie konkret bestanden, musste man eigentlich jeden Band aus- fuhrlich vorstellen und einer kritischen Lekture unterziehen. Das ist an dieser Stelle nicht moglich. Statt dessen mochte ich mich auf ein Bei- spiel beschranken, namlich die von Pierre Abraham herausgegebenen

13, rue du Four 189
Bande Arts et litteratures dans la societe contemporaine. Denn gerade diese beiden Bande stehen fur die Orientierung der Enzyklopadie an schwierigen Wissensfeldern, die in dieser Form erst im Entstehen wa- ren.23 Das zeigt schon die Gliederung: Obwohl die Bande ganz konven- tionell mit Texten beruhmter Autoren wie Valery und Maurras - beide Mitglieder der Academie Fran~aise - einsetzen, skiuieren sie nicht etwa das traditionelle Spektrum von Kunstlern und Kunsten in der Ge- schichte, sondern folgen einer ungewohnlichen Struktur: 1. Teil: I'ouvrier, ses materiaux, [et] ses techniques - der Kunstler wird also als Arbeiter und Produzent betrachtet - , wobei unterschieden wird zwischen "techniques de I'espace" (wie etwa Photographie) und .tech- niques du temps" (wie Musik, Theater, Kino); 2. Teil: IJusager - der Kunstkonsument - , wobei erst die (( besoins collectifs et sociaux )) nach der Kunst und dann die (( besoins indivi- duels D untersucht wurden; 3. Teil schliel3lich: le dialogue entre I'ouvrier et I'usager, wobei zunachst die (( realisations contemporaines D in den verschiedenen Kunstberei- chen skiuiert werden und anschlienend die Interpretationsformen so- wie die Berufsstrukturen und Kunstlerorganisationen in den verschie- denen Landern der Erde.
So ergibt sich ein vollig verandertes Bild der Kunst, von dem da- mals nicht wenige Kritiker meinten, dass es sich allzu sehr an szientifi- schen, objektivistischen Begriffen orientiere, ja die Kunst an den .Mate- rialismus" verrate.
Besonders interessant und symptomatisch durfte in diesem Zu- sammenhang die Lekture eines Walter Benjamin sein, der ursprunglich seinen beruhmten Aufsatz uber das Kunstwerk im Zeitalter seiner tech- nischen Reproduzierbarkeit fur diese Bande schreiben s o ~ l t e ~ ~ und statt dessen spater eine lobende Rezension fur die Zeitschrifl fijr Sozialfor- schung verfasste - die leider nie erschienen ist. Darin heil3t es in der fur Benjamin typischen Diktion:
Mit der Konfrontation von producteur und usager hat die Enzyklo- padie Begriffe sich einverleibt, in denen einer der wichtigsten Kri- senprozesse in der Funktion der Kunst zur Formulierung kommt. Sie belegt damit, wie wertvoll gerade vorgeschobenste theoretische Fragestellungen fur eine allgemeinverstandliche Abhandlung be- stimmter Wissensgebiete werden k ~ n n e n . ~ ~

190 Peter Schottler
II. Die Encyclopedie Fran~aise als Netzwerk
Die Encyclopedie Fran~aise war aber nicht nur ein ungewohnliches Projekt auf dem Hintergrund der ~olksfront-~ra; sie bildete auch ein Netzwerk mit weiten Verbindungen in fast alle Bereiche der franzo- sischen Wissenschaft und Kultur, teilweise sogar uber deren Grenzen h i n ~ e ~ . ~ ~ Dies liefie sich zeigen, indem man neben den Herausgebern und Autoren auch die Mitglieder des .EhrenkomiteesU mit seinen 150 illustren Namen einmal naher betrachten wiirde. Desgleichen waren die zahllosen mondanen Veranstaltungen, mit deren Hilfe de Monzie und Febvre vor allem in den ersten Jahren das Wohlwollen von Forderern und Prominenten wachzuhalten suchten - ob Portwein-Empfange in den Raurnen der Redaktion oder festliche Diners in einem Restaurant - soziologisch intere~sant.~' An dieser Stelle sol1 der Blick jedoch nicht nach innen, sondern nach aufien, also auf die Kontakte, Verbindungen und [Jberschneidungen gerichtet werden, die zwischen der Encyclope- die Fran~aise und anderen, vergleichbaren lnstitutionen und Netzwer- ken bestanden, die sich alle innerhalb derselben ,Galaxiei bewegten und deren Personal entweder identisch oder miteinander gut bekannt war.
Was gemeint ist, wird deutlich, sobald wir einen Blick auf das fol- gende Schaubild werfen. Neben der Encyclopedie Fran~aise sind darin eine Reihe von Instituten, Buchreihen, Zeitschriften und Projekten auf- gefuhrt, die standig oder punktuell miteinander in Verbindung standen:
Schaubild 2: Das Netzwerk der ,,Encyclopedic Fran~aise"
Institutionen und Projekte Direktoren oder Herausgeber
Encyclop6die Franpaise Anatole de Monzie, Lucien Febvre Bulletin [bi-lmensuel de I'Encyclop6die Franpaise [l 934-1 9351 Lucien Febvre Revue trimestrielle de I'Encyclop6die Franpaise [I 936-1 9381 Lucien Febvre Cahiers d'actualit6 et de synthhse de I'Encyclop6die Franpaise Lucien Febvre [I9541
Commission des recherches collectives de I'Encyclop6die Fran- Andre Varagnac qaise

13, rue du Four
Fondation a Pour la Science D. Centre International de Synthhe
Revue de Synthdse [historique] [ab 19001 Sektion nSynth6se historiquen Sektion wSynth6se scientifiquen Sektion uSynth6se g6n6ralen
Bulletin du Centre international de synthese [Beilage zur Revue, ab 19261
nL'bv01uti0n de I'humanit.5~ [Buchreihe, ab 19201 1. Teil: Introduction (prbhistoire, protohistoire, antiquitb) 2. Teil: Origines do christianisme et moyen Bge 3. Teil: Le monde moderne 4. Teil: Vers le temps prBsent Erganzungsbande: Synthdse collective
Semaines internetionales de synthdse [Jahrestagungen, ab 19291
Projekt: Vocabulaire historique Projekt: Rbpertoire mbthodique de synthdse scientifigue Projekt: R6pertoire m6thodique d'histoire des sciences
Science. L'Encyclopbdie annuelle [Wochenzeitung, 1936- 19381
Centre lnternatlonal de Synthhse. Section dlHistoire des Sciences
Archeion. Archives pour I'histoire de la science [ab 19291
Revue d'histoire des sciences et de leurs applications [ab 19471
Henri Berr
Henri Berr Lucien Febvre Paul Langevin Abel Rey
Henri Berr
Henri Berr
Henri Berr
Henri Berr Henri Berr Aldo Mieli
Henri Berr
Aldo Mieli
Aldo Mieli
Pierre Brunet
lnstitut d'Histolre des Sciences et des Techniques (Sor- Abel Rey bonne)
Thal.5.s. Recueil annuel des travaux et bibliographic [Jahrbuch, Abel Rey ab 19341
Annales d'histoire Bconomique et sociale [ab 19291 Marc Bloch, Lucien Febvre
Beginnen wir unseren Kornrnentar mit Lucien Febvre: Er war, wie er- wahnt, seit 1933 Professor am College de France, einer kleinen, aber prestigetrachtigen Hochschule ohne Fakultaten. Jeder kannte also jeden, und Febvre hatte zwangslaufig Kontakt zu Naturwissen- schaftlern, wie dern Physiker Paul Langevin oder dern Mathernatiker Jacques Hadarnard. 1937 wurde auch Febvres engster Freund, der Psychologe Henri Wallon (1879-1962), an das College berufen, ein weiterer Band-Herausgeber der ~ncyclopedie.~~ ljber Wallon verliefen

192 Peter Schottler
damals Febvres Kontakte zum Netzwerk der kommunistischen Wissen- schaftler, die ihn 1934135 zweimal zu den grof3en Podiumsdiskussionen der Gruppe .Russie nouvelle" ein~uden.*~ Ferner war Febvre an zwei Zeitschriften beteiligt: den Annales d'histoire economique et sociale und der Revue de Synthese, zu deren Mitarbeitern er seit 1905 gehorte.30
Wahrend die wissenschaftshistorische Bedeutung der Annales heute allgemein bekannt ist, hat sich das Profil der Revue de Synthese, die ebenfalls noch existiert, so weit verandert, dass einige Stichworte nutzlich sein durften: Im Jahr 1900 von dem Philosophen Henri Berr (1 863-1 954) gegrundet, entwickelte sich die Zeitschrift bald zu einem der wichtigsten Foren theoretischer Diskussion mit einem besonderen Schwerpunkt bei den Geschichts- und ~ulturwissenschaften.~~ Dies schlug sich auch in einer universalgeschichtlichen Buchreihe nieder, in der Berr unter dem Titel L'evolution de I'humanite viele bahnbrechende Darstellungen herausgab: ob von Febvre oder Bloch, von Mauss oder ~ r a n e t . ~ ~ Doch seine Ambitionen reichten weit uber die Geschichts- schreibung hinaus. Sein Begriff der ,Syntheses zielte auf die Einheit aller Wissenschaften. Und so grundete er 1925 mit Unterstutzung eini- ger Mazene und Politiker (er war z.B. eng mit dem damaligen Prasiden- ten der Republik, Paul Doumer, befreundet) ein eigenes Institut, das Centre International de ~ ~ n t h e s e . ~ ~ Es nahm seinen Sitz zuerst im Palais-Royal und ab Mai 1929 in einem Nebengebaude der Bibli- otheque Nationale, dem Hdtel de Nevers in der rue Colbert. Dies war ein hochsymbolischer Ort, denn einst hatte hier der Salon der Madame de Lambert stattgefunden, in dem die Enzyklopadisten verkehrten. Drei Jahre spater veranstaltete Berr in der Bibliotheque Nationale eine Aus- stellung L'Encyclopedie et les encyclopedistes, die daran erinnerte, und der Gedanke, selbst eine Enzyklopadie herauszugeben, begleitete ihn wohl schon viele ahr re.^^ Als daher Febvre - und nicht er - mit der Konzeption und Leitung der Encyclopedic Fran~aise beauftragt wurde, bedeutete dies fiir Berr eine herbe Enttauschung, ja Krankung. Obwohl der Historiker ihn dann sofort in den Aufsichtsrat berief, lief3 sich Berr deshalb nicht davon abhalten, 1936 eine Art Konkurrenzunternehmen zu lancieren, das Wissenschaftsjournal Science. Jede Ausgabe enthielt zwei herausnehmbare Hefte, die sich am Jahresende zu einer Encyc- lopedie annuelle zusammenbinden lieBen. Nun war es Febvre, der gekrankt war und spontan seine Mitarbeit beim Centre de Synthese a ~ f k u n d i ~ t e . ~ ~ Dass er diesen Bruch am Ende dann doch nicht vollzog, hatte zum Teil sentimentale Grunde - immerhin war Berr seit Jahrzehn- ten sein Mentor -, vor allem aber hatte er damit Vernetzungen zerstort,

13, rue du Four 193
von denen auch die Encyclopedie Fran~aise und die Annales profitier- ten.36
In der Tat bildete das Centre de Synthese nicht nur eine eigene Welt am Rand des Pariser Universitatsbetriebes, es war auch einer der wenigen Orte, wo Etablierte und Aufienseiter, Human- und Natur- wissenschaftler, Einheimische und Auslander regelmafiig miteinander in Kontakt traten. Einige dieser Zusammenhange und Begegnungen lassen sich an unserer Aufstellung ablesen. An erster Stelle ist die Re- vue de Synthese zu nennen.37 Nach der Grundung des Centre anderte die Zeitschrift ihre Ausrichtung, was im modifizierten Titel zum Aus- druck kam: Das einschrankende Adjektiv .historiqueu wurde gestrichen. Ab 1930 erschienen die Hefte jeweils abwechselnd mit den Schwer- punkten "Synthese historique" oder "Synthese generaleu, also Ge- schichts- und Humanwissenschaften auf der einen Seite, Natur- wissenschaften und Philosophie auf der anderen. Damit bekamen nicht nur die neuen Co-Direktoren, namlich Febvre, Langevin und Rey, ein gewisses Mitspracherecht, auch der Schwerpunkt der Zeitschrift ver- schob sich: Naturwissenschaften und allgemeine Wissenschaftstheorie bekamen erheblich mehr Gewicht. So kam es dann auch, dass die Revue de Synthese, die sich schon immer mit epistemologischen Fra- gen beschaftigt hatte - wie etwa dem Methodenstreit in den Ge- schichts- und ~ozialwissenschaften~~ -, ab Mitte der dreifiiger Jahre zum vergleichsweise wichtigsten franzosischen Vermittlungsorgan der neuen Thesen des ,Wiener Kreises' avancierte: Hier erschienen Be- richte uber Kongresse und Veranstaltungen, hier wurden einschlagige Bucher rezensiert und hier erschienen auch eine Reihe programma- tischer Aufsatze von Schlick, Carnap, Hempel, Frank usw. - bis hin zu Neuraths Text uber die .Neue ~ n z ~ k l o ~ a d i e " . ~ ~
Das war kein Zufall: Berrs Wissenschaftsauffassung, sein Konzept der Synthese sowie auch sein Projekt, die Sprache der Geschichts- wissenschaft mit Hilfe eines Begriffslexikons - des sogenannten Voca- bulaire historique4' - zu vereinheitlichen, kamen den Vorstellungen des Wiener Kreises entgegen. Und nachdem sich Berr und Neurath im Septem ber 1935 am Rand des Kongresses fiir wissenschaftliche Philo- sophie kennengerlernt hatten, standen sie in regelmalligem ~ontakt .~ '
Aufier seiner Hauszeitschrift, zu der 1936 noch die Monatszeitung Science hinzukam, gab Berr, wie erwahnt, die Buchreihe L'Evolution de I'humanite heraus und veranstaltete die sogenannten Semaines inter- nationales de synthese, an denen jedes Jahr prominente Philosophen, Natur- und Sozialwissenschaftler teilnahmen, urn uber Themen wie ,,ZivilisationU, ,,Der Ursprung der Gesellschaft", ,,Relativitat", ,,lndivi-

194 Peter Schottler
dualitat", "Physik und Philosophie", .Die Menge", .Wissenschaft und Gesetz", .Der Forschrittsbegriff", .Der Himmel in Geschichte und Wis- senschaft", .Sensibilitat beim Menschen und in der Natur" zu debat- tieren.42 Die entsprechenden Tagungsbande dokumentieren einen in Frankreich einzigartigen Dialog mit dem Ziel, die Mauern zwischen den Disziplinen e inzure i~en.~~ Auch ein anderes Projekt des Centre, eine allumfassende, interdisziplinare Bibliographie zu erstellen, das Rdper- toire methodique de synthese scientifique, weist in diese ~ i c h t u ng.44
Neben Berr kommen aber noch weitere Personen ins Spiel. So war einer der standigen Mitarbeiter des Centre, Robert Bouvier (1886- 1978), der sich z.B. um philosophische Rezensionen kummerte, zahl- reiche Beitrage fur das Vocabulaire historique verfasste oder Berichte anfertigte - etwa uber den Kongress von 193545 - , nicht nur einer der besten franzosischen Kenner der Philosophie von Ernst ~ a c h , ~ ~ son- dern auch einer der [Jbersetzer von Neurath, Frank, Carnap und ande- ren.47 Wie aus dem Briefwechsel zwischen ihm und Neurath her- vorgeht, war er standig darum bemuht, die Verbindungen zwischen dem Centre und den Wiener Philosophen zu inten~ivieren.~~
Der einfluareichste Vermittler innerhalb des Centre de synthese (und daruber hinaus) war jedoch zweifellos Abel Rey (1 873-1 940).~' Er war ein enger Freund von Berr und, wie erwahnt, einer der stell- vertretenden Herausgeber seiner Zeitschrift. Als lnhaber des Lehrstuhls fur Wissenschaftsphilosophie an der Sorbonne leitete er auch das Insti- tut d'histoire des sciences et des techniques in der Rue du Four; ab 1934 gab er dort das Jahrbuch Thales heraus, dessen wissenschaftli- chem Beirat sowohl Berr als auch Febvre angehorten.50 Nicht zufallig erschien dort 1935 eine ausfuhrliche - und durchaus nuanciert-kritische - Darstellung des Wiener Kreises aus der Feder des Emigranten Alfred Stern (1898-1980).~' Rey war aber nicht nur an fast allen Projekten des Centre de Synthese sowie an Febvres Encyclopedie Fran~aise beteiligt - dazu weiter unten -, sondern als Sorbonne-Professor einer der Mit- veranstalter der internationalen Philosophen-Kongresse von 1935 und 1937, auch wenn er selbst nicht als Referent a~ftrat.~'
SchlieGlich ist noch der dritte stellvertretende Herausgeber der Revue de Synthese zu erwahnen, Paul Langevin (1 872-~946) .~~ Wah- rend Rey anz offen mit den Thesen des Wiener Kreises syrn- pathisierte,5' orientierte sich der beriihmte Physiker, der schon damals der Kommunistischen Partei nahestand, auch wenn er ihr erst nach dem Krieg offiziell beitrat, am sowjetischen ,dialektischen Materia- lismus'. Folglich kritisierte er bei verschiedenen Gelegenheiten den ,,Subjektivismus" und .Negativismusn der ,,ecole de ~ i e n n e " . ~ ~ Dennoch

13, rue du Four 195
gehorte er dern Komitee der einheitswissenschaftlichen Kongresse an.56
So lassen sich allein schon auf der institutionellen und personlichen Ebene nicht wenige Verbindungslinien zwischen dern Centre de Synthese und dern Wiener Kreis erkennen, deren Orientierungen - lnterdisziplinaritat (TransdisziplinaritW?), Internationalitat (Transnatio- nalitat?), Einheitswissenschaft und Einheitssprache - zumindest ver- wandt waren. ijberraschenderweise wurde dies in der einschlagigen Literatur bislang kaum bea~htet.~' Wie diese Verbindungen konkret verliefen und wie sich die Beruhrungs- oder Reibungspunkte im ein- zelnen verhielten, bleibt allerdings noch genauer zu erforschen.
I l l . Encyclopedie Fran~aise und Wiener Kreis - eine Hypothese
Gilt dies etwa auch fur die Encyclopedie Fran~aise? Kehren wir noch einmal in die Rue du Four zuriick. Im Erdgeschofi und in der 1. Etage residierte die Encyclopedie; einige Stockwerke hoher lag das lnstitut von Rey. Er war nicht nur ein Kollege von Febvre im Centre de Synthese und mit dern Historiker seit langem gut bekannt,58 sondern auch einer der Band-Herausgeber der Enzyklopadie - und m a r des programmatischen ersten Bandes, der im Januar 1937 unter dern Titel L'outillage mental de facto als sechster Band herauskam. Rey selbst verfasste davon den ersten Teil, der etwa 100 zweispaltige Druckseiten umfasste und den Titel trug: De la pensee primitive a la pensee actuel- I ~ . ~ ~
Was vielleicht nur ein philosophiegeschichtlicher Abriss hatte wer- den konnen, war - dern Gesamtkonzept entsprechend - eine program- matische Einfuhrung in die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkens. Nach oder neben dern magischen Denken der ,Primitivenl, das Rey v.a. im Anschluss an die Forschungen von Levy-Bruhl skiz- zierte, unterschied er drei grofie Stadien: den ,qualitativen1 Rationa- lismus des antiken Griechenland, den ,quantitativen' Rationalismus der fruhen Neuzeit und schliefilich den ,experimentellen1 Rationalismus der Gegenwart:
En examinant I'evolution logique de la pensee occidentale on peut noter trois grandes tendances. D'abord, I'ascension vers la clarte. Ensuite I'action de plus en plus profonde de cette logique sur le reel, par des outillages appropries et progressifs: rationalisme quali- tatif, puis quantitatif, puis experimental. Enfin un souci de plus en

196 Peter Schottler
plus marque, apres I'enthousiasme hellenique, de passer de la con- templation a I'action, d'agir sur la nature a I'aide du savoir: ccLe sa- voir et le pouvoir humains c6incident identiquement)), dit Bacon dans un celebre aphor i~me.~
Hieran schloss sich eine ausfuhrliche Darstellung der modernen Logik, Mathematik und Naturwissenschaft an, in deren Mittelpunkt die im fru- hen 20. Jahrhundert heftig diskutierten Fragen nach dem Verhaltnis von Erfahrung und Hypothese, Intuition und Konstruktion, Unscharfe, Wahrscheinlichkeit und Determinismus standen. Fur Rey, der sich an anderer Stelle selbst als .Szientist" und ,Experimentalist" bezeich- nete,61 fuhrte die sogenannte .Krise der Wissenschaften" keineswegs zu einem Verschwinden von .Tatsachenu und .KausalitatenU, vielmehr scharfte sie das Bewusstsein dafur, dass Intuition, Erfahrung und .Lo- gistik" miteinander in Wechselwirkung stehen ("chasse-croise) und bei der Suche nach "positiver Erkenntnis" zu verknupfen ~ i n d . ~ *
Auffallig ist, dass Rey in diesem Text der "Ecole de Vienne" und ihren Thesen relativ breiten Raum ~ i d r n e t e . ~ ~ Spatestens hier durfte also Febvre, der alle Texte ,seiner1 Enzyklopadie mit Argusaugen las - und Reys Beitrag spater als Grundlagentext verwendetes4 - , mit den Namen Schlick, Carnap, Frank usw., ja sogar Wittgenstein, konfrontiert worden sein. Oder geschah dies etwa schon fruher? lmmerhin ist es denkbar, ja sogar wahrscheinlich, dass der Historiker als Mitheraus- geber der Revue de Synthese - und folglich als deren Bezieher - die darin publizierten Beitrage uber und aus dem Wiener Kreis spatestens seit 1934 zur Kenntnis genommen hatte. (Von anderswo publizierten Buchern oder Aufsatzen ganz zu s~hweigen.~~) Ferner scheint es kei- neswegs ausgeschlossen, dass Febvre als standiger Bewohner der Rue du Four auch in informellen Gesprachen mit Rey und dessen Mit- arbeitern, ja vielleicht sogar mit dessen auslandischen Gasten, also den Teilnehmern der beiden Pariser Kongresse - zu deren Sponsoren nicht nur das Centre de Synthese, sondern auch die Encyclopedic Fran~aise gehorte66 - etwas iiber die neue philosophische Bewegung, das Konzept der ,Einheitswissenschaft' oder das Projekt einer neuen, internationalen Enzyklopadie erfahren haben konnte.
Die Verwendung des Konjunktivs ist durchaus angebracht. Denn beim gegenwartigen Kenntnisstand handelt sich lediglich um eine Ver- mutung. Berr und Rey standen mit den Wienern nachweislich in Kon- takt, und beide waren enge Kollegen, ja sogar Freunde von Febvre. Als fuhrendes Mitglied des Centre de Synthese, als assoziiertes Mitglied von Reys lnstitut d'histoire des sciences und als Hauptherausgeber der

13, rue du Four 197
Encyclopedie Fran~aise konnte Febvre gar nicht anders, als von der Existenz der ,Ecole de ~ i e n n e ' ~ ~ Kenntnis zu nehmen. Doch als positi- ver Beleg fur eine Rezeption oder gar lnteresse und Sympathie reicht dies alles nicht aus, zumal es auch lndizien gibt, die eher Distanz an- deuten. Dazu ebenfalls einige Stichworte. Erstens: Das einzige Buch eines Mitglieds des Wiener Kreises, das vor dem Krieg in den Annales rezensiert wurde, war Neuraths Bildstatistisches Elementarwerk; Febv- re selbst hat es 1931 recht kritisch be~prochen.~~ Zweitens: Etwa zur selben Zeit geriet Marc Bloch im Rahmen des Centre de Synthese in einen Konflikt uber den Artikel Cornparaison, den er fur das Vocabulai- re historique verfasst hatte;69 die Redaktion hielt ihm vor, dass er die theoretischen Aspekte des Vergleichs nicht genugend berucksichtigt habe. Deshalb gab sie einen zweiten Artikel in Auftrag, dessen Vetfas- ser der oben erwahnte Bouvier war.70 Drittens: Es bestand noch eine weitere personliche Misshelligkeit. Ausgerechnet der Philosoph Louis Rougier, der einige Jahre spater bei der Rezeption des Wiener Kreises in Frankreich eine wichtige Rolle spielen sollte, veroffentlichte 1925 in der Revue de Synthese eine weitschweifige Rezension des Buches von Bloch uber die Rois tha~rnatur~es,~' die diesem Meisterwerk histori- scher Religionssoziologie kaum etwas abgewinnen k~nnte .~* Bloch durfte den Namen Rougier also nie vergessen haben, und dies hat ihn spater sicher nicht ermuntert, jener philosophischen ,Schulel besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die in Frankreich, wie es schien, von diesem Mann reprasentiert wurde.
Der in Besanqon lehrende Louis Rougier (1889-1982) trat in den dreiniger Jahren in der Tat als ,Botschafterl des Wiener Kreises auf, und es gelang ihm auch, seinen osterreichischen und deutschen Ge- sprachspartnern gegenuber den Eindruck zu erwecken, er sei der bestmogliche Reprasentant der neuen Auffassungen. Dabei war Rou- gier keineswegs der einzige, der den Wiener Kreis in Frankreich be- kanntmachte oder fur ihn eintrat: Man denke nur an den Physiker Mar- cel Boll (1 886-1 958) oder den pensionierten General Ernest Vouillemin (1865-1954) - beides auch rijhrige [Jbersetzer -, ferner an die Mathe- matiker Jacques Hadamard (1 865-1 963) und Maurice Frechet (1 878- 1973), an Pierre Lecomte du Nouy (1883-1947) vom lnstitut Pasteur und nicht zu vergessen: Abel Rey. Doch Rougier, dessen wechselhafte Biographie noch ungenugend erforscht ist - parallel zu seinem philoso- phischen Engagement trat er z.B. fur eine unternehmerfreundliche, ,neoliberalei ~irtschaftspolit ik~~ ein, kokettierte spater mit der Vichy- Regierung und endete schliel3lich als Anhanger der ,Nouvelle Droite' von Alain de ~ e n o i s t ~ ~ -, hat es stets verstanden, sich in den Vorder-

198 Peter Schottler
grund zu schieben. Als Person, als Politiker und wohl auch als Philo- soph war diese schillernde Figur jedenfalls vollig ungeeignet, dem Wie- ner Projekt neue Mitstreiter zuzufuhren und gerade jene progressiven Akademiker anzusprechen, die dafur hatten empfanglich sein mus- sen.75 Um kunftig daher etwas Genaueres sowohl uber die Rezeption des Wiener Kreises als auch uber dessen Verbindungen zu Netzwer- ken wie der Encyclopedie Fran~aise oder dem Centre de Synthese zu erfahren, sollte man versuchen, von Rougier gleichsam zu abstrahieren oder vielrnehr sein Wirken von vornherein als Negativfaktor in Rech- nung zu stellen.
Dies konnte am Ende auch einen neuen Blick fur die intellektuellen Gerneinsamkeiten zwischen der Wissenschaftsauffassung der Wiener Neopositivisten und der Historiker- und Soziologengruppe im Umkreis der Annales ermoglichen. Denn auch deren Erforschung leidet seit langem unter einern ,Tunneleffekt' (Jack Hexter). Weil jede Generation ihre theoretischen Praferenzen auf Autoren wie Bloch, Febvre, Halb- wachs usw. projiziert, haben sich immer neue Rezeptionsschichten gebildet. Andere Lekturen, die nicht dem Zeitgeist entsprechen, haben es demgegenuber schwer. So wurde das Projekt der Annales je nach Kontext ma1 als ,strukturalistisch' oder ,anti-strukturalistisch', ,marxis- tisch' oder ,anti-marxistisch', ,subjektivistisch' oder ,objektivistischl pra- sentiert, wahrend Differenzierungen und gegenlaufige Thesen kaum wahrgenomrnen ~ u r d e n . ~ ~ Nur eine kritische Historiographie-Geschich- te, die nichts ungepruft ubernimmt und alle Texte neu liest, kann hier weiterhelfen. Auf diesem Hintergrund frage ich mich schon seit Iange- rem, ob nicht auch das besondere Verhaltnis der Annales-Historiker zum Neopositivismus der Zwischenkriegsjahre - und insofern auch zum Wiener Kreis - durch einen solchen Tunnelblick verstellt worden ist. Ich kann das an dieser Stelle nicht weiter ausfuhren, doch konnte man zeigen, dass zwischen den epistemologischen Positionen, die dem Projekt der fruhen Annales zugrunde lagen, und den zentralen Thesen des Wiener Kreises keine tiefe Kluft bestand. Trotz alter Diffe- renzen waren dies keine verschiedenen Welten. Auch Febvre und Bloch, die die grol3en Umwalzungen irn wissenschaftlichen Weltbild sehr genau verfolgten, grundeten ihre Arbeit auf ein anti-spiri- tualistisches, neo-positivistisches und letztlich szientistisches Konzept. Und noch wahrend des Zweiten Weltkrieges wiederholte Bloch in sei- ner Apologie pour I'histoire nicht nur dieses Credo, sondern auch seine standige Forderung nach einer Einheitssprache der Geschichts- wissenschaft, wobei er sich bezeichnenderweise auf das Vorbild der ,,PhysikerM berief, die daruber Kongresse abgehalten hatten.77

13, rue du Four 199
Damit breche ich ab. Um Missverstandnisse zu vermeiden, will ich meine These noch einmal zusarnmenfassen: Sie lautet keineswegs, dass die Encyclopedie Fran~aise als Projekt der franzosischen Wis- senschaft ein direktes Pendant oder ein Relais des Enzyklopadie- Projekts des Wiener Kreises bildete. Allerdings scheint mir, dass es auffallige intellektuelle und personelle Verbindungen zwischen diesen Projekten gab, die sich beide auf eine szientistische Philosophie berie- fen. Diesen Szientisrnus wird man heute zweifellos kritisieren. Aber wohl kaum, um dahinter zuruckzufallen. In diesem Sinne konnte man die Encyclopedie Fran~aise als einen der grol3en Versuche bezeichnen - und interessanterweise von einem ,Geisteswissenschaftler6 unter- nornrnen - samtliche Wissenschaften, also Natur- und So- zialwissenschaften, unter dem gemeinsamen Singular von la Science zusarnmenzufuhren. Das war tatsachlich revolutionar.
Anmerkungen
Vgl. den atmospharischen Bericht in den Memoiren von Henriette Psichari: Des jours et des hommes (1890-1961), Paris: Grasset, 1962, S. 155ff. ( a La boutique de la rue du Four n). Jacqueline Pluet-Despatin I Gilles Candar (Hg.), Lucien Febvre et I' ccEncyclopedie Franpaise)). Schwerpunktheft der Zeitschrift Jean Jaures. Cahiers trimestriels, no. 1631164, 2002 (erschienen: 2003), 159 S. Aus der alteren Literatur siehe: Jacques Robichez, ctL'Encyclopedie Franpisen, in: Cahiers d'histoire mondiale, 9, 1965, S. 819-831 ; Giuliana Gemelli, .L'Encyclopedie Franpise e I'organizzazione della cultu- ra nella Francia degli anni trenti", in: Passato et presente, 1, 1986, 11, S. 157-89; Hebe Carmen Pelosi, .La coyuntura enciclopedica del period0 entreguerras. El mo- dela de Lucien Febvre", in: Rivista di storia di storiografia moderna, 16, 1995, 1-3, S. 97-1 15; Henri-Jean Martin, ((Esprit de synthese et encyclopedisme. Henri Berr, Ana- tole de Monzie, Julien Cain, Lucien Febvren, in: Roland Schaer (Hg.), Tous les sa- voirs du monde. Encyclopedies et bibliotheques de Sumer au XXle siecle, Paris: Flarnmarion, 1997, S. 442-449. Vgl. Pascal Oly, La belle illusion. Culture et politique sous le signe du Front popu- laire 1935-1938. Paris: Plon, 1994. Vgl. bes. S. 60f. u. 184f. Eine Biographie von Febvre fehlt bislang. Vgl. statt dessen mit weiterer Literatur: Bertrand Muller, Lucien Febvre, lecteur et critique. Paris: Albin Michel, 2003 (zur En- cyclopedic Fran~aise: S. 109ff.). Aus der umfangreichen Literatur vgl. bes. Peter Burke, Die Geschichte der ,Anna- les'! Die Entstehung der neuen Geschichtsschreibung. Berlin: Wagenbach, 2004. [Lucien Febvre], Ce qu'est I'Encyclop6die Fran~aise. o.O., 0.D. [Paris 19331, S. 5. Zu Febvres Konzept siehe bes. Bertrand Muller: ((Entre science et culture: I'Encyclo- pedie Fran~aise dans I'ceuvre de Lucien Febvre)), in: Jean Jaures, op. cit., S. 33-63, sowie ders. (Hg.), Marc Bloch, Lucien Febvre, Correspondance. 3 Bde, Paris: Fay- ard, 1994-2004, hier bes. Bd. 2, S. XXVllff. Ibid., S. 8.

200 Peter Schottler
Lucien Febvre, ((Encyclopedic et encyclopbdies)), in: Encyclopbdie Fran~aise, VI, 1936, S. 18-24-6 bis 18-24-11. [Die besondere Paginierung der Encyclop6die Franpaise macht dlese Zitlerweise erforderlich.] Ibid., S. 18-24-10. Ibid., S. 18-24-1 1. Leicht modifizierte ijbersetzung eines Schaubilds in: Muller, ((Entre science et cultu- re,, loc. cit., S. 62-63. Schon bald nach der Befreiung kam es zum Bruch zwischen Febvre und einigen seiner kommunistischen Freunde, als die KPF - unter Berufung auf Diderot und dlAlembert - das Projekt einer Encyclopedie de la Renaissance franpaise [Enzy- klopadie der franzosischen Wiedergeburt] lancierte, an dem sich u.a. Langevin und Wallon beteiligten. Siehe: Manifeste de I'Encyclopbdie de la Renaissance franpaise. Toulouse 1945, sowie Wallons programmatischen Aufsatz: ((Pour une encyclopbdie dialectique. Sciences de la nature et sciences humainew, in: La Pensbe, Nr. 4, Juli 1945, S. 17-22. Febvre betrachtete das als personlichen Verrat und Aufkundigung einer intellektuellen Allianz. Daher musste seine eigene wieder aufgenommene En- cyclopbdie Franpaise im Zeichen des Kalten Krieges und des von der KPF prokla- mierten Kampfes zwischen ,burgerlicher und proletarischer Wissenschaft' auf viele ehemalige Mitarbeiter ve~ichten. Nach Febvres Tod 1956 verschob sich unter dem nachfolgenden Herausgeber, Gaston Berger (1896-1960), einem Philosophen und Wissenschaftspolitiker, der intellektuelle und politische Schwerpunkt des Projekts noch weiter nach rechts. Vgl. Jean-Yves Mollier, ((La fabrique editorialel), in: Jean Jaures, op. cit., S. 11-31 (hier: S. 24). Allerdings schloss diese Abonnentenzahl nicht aus, dass einzelne Ban- de eine hohere Auflage erreichten und nachgedruckt werden mussten. Ibid., S. 12. Archives Nationales, Paris, Nachlass L. Febvre, Werbebroschure: L'Encyclopedie Fran~aise permanente, o. 0. o. D. [1933], S. 5. Encyclopbdie Franpaise, VI , 1936, S. 6-04-1 1. Encyclopbdie Franpaise, 11, 1955, S. 2-04-5. Archives Nationales, Paris, Nachlass L. Febvre, M6mento du collaborateur, 0.D. [1933], S. 3. Ibid., S. 6. Nach einer 1997 von Jacqueline Pluet-Despatin angefertigten Aufstellung. Lucien Febvre an Anatole de Monzie, o. D. (Sommer 1933); Archives Departementa- les du Lot, Cahors, Nachlass A. de Monzie, 52 J 28. Vgl. Peter Schoffler, ,Mentalitatengeschichte und Psychoanalyse. Lucien Febvres Begegnung mit Jacques Lacan 1937138", in: Osterreichische Zeitschrift fur Ge- schichtswissenschaften, l l, 2000, 3, S. 135-146. Als ein weiteres Beispiel besonderer Innovation siehe Bd. VII, L'espece humaine, mit dem Schwerpunkt SoziologieIEthnologie. Die darin enthaltene Studie von Maurice Halbwachs zur Bevolkerungsentwicklung wurde jetzt in einer mustergultigen Edition wieder zuganglich gemacht: Maurice HalbwachsIAlfred Sauvy, Le point du w e du nombre 1936, hg. v. Marie Jaisson u. Eric Brian, Paris: INED, 2005. Brief an Gretel Karplus [Adorno], ca. 6.5.1934, in: Walter Benjamin, Briefe, IV, FrankfurVMain: suhrkamp 1998,S. 415ff. Der ~unstwerk-~ufsag, der 1936 zuerst auf Franzosisch 1!1 in der Zeitschrift fur Sozialforschuna erschien, firrnierte in Benia- mins Notizen zunkhst unter dem Stichwort .~nz~clo~&ieartikel".'
25. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. Ill, FrankfurVMain: Suhrkamp, 1972, S. 579-585 (Zitat: S. 582).

13, rue du Four 20 1
26. Dies gilt auch im wortliche Sinne: So reiste Febvre auf Einladung des franzosischen AuRenministeriums mehrfach ins Ausland, um fur die Enzyklopadie zu werben. Am 5. April 1935 hielt er 2.0. im Johannes-Saal der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften einen Vortrag uber .Das Programm der neuen franzosischen Enzy- klopadie". Veranstalter waren-das jnstitut ranp pis und der ,Verein der Freunde fran- zosischer Studien' lArchiv der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, Sign. 20711935). Vgl. Peter Schottler (Hg.), Lucie Varga, Zeitenwende. ~en ta : litatsgeschichtliche Studien 193t2-1939, FrankfurtIMain: Suhrkamp, 1991, S. 35f.
27. Vgl. Martin, loc. cit., S. 447. 28. Eine Biographie von Wallon fehlt bislang. Vgl. Emile Jalley, Wallon, lecteur de Freud
et Piaget, Paris: Editions Sociales, 1981. 29. Beide Tagungen fanden im groRen Saal der ,Mutualit& im Quartier Latin statt und
zogen Hunderte von Zuhorern an. AnschlieRend wurden die Vortrage in zwei Sarn- melbanden unter dem Titel A la lumiere du marxisme publiziert. Den ersten hat Feb- vre in den Annales rezensiert: cdJn debat de methode: techniques, sciences et mar- xisme)), in: Annales d'histoire Bconomique et sociale , 7, 1935, S. 615-623.
30. Vgl. Bertrand Muller, "Lucien Febvre et Henri Berr: de la synthese A I'histoire- probkme)), in: Agnes Biard I Dominique Bourel 1 Eric Brian (Hg.), Henri Berr et la culture d u n e siecle. Paris: Albin Michel, 1997, S. 39-59.
31. Eine Biographie von Berr fehlt bislang. Zu Werk und Wirkung vgl. BiardlBourellBrian, Henri Ben; op. cit.
32. Vgl. Jacqueline Pluet-Despatin, ctHenri Berr Bditeur. Elaboration et production de 'L'Evolution de I'humanite')), in: BiardlBourellBrian, Henri Berr, op. cit., S. 241-267.
33. Vgl. Giulliana Gernelli, ccCommunaute intellectuelle et strategies institutionnelles: Henri Berr et la fondation du Centre international de synthese,, in: Revue de Syn- these, 108, 1987, S. 225-259; Martin, ((Esprit de synthese et encyclopedisme ... )), loc. cit.
34. Vgl. Giuliana Gemelli, uL'encyclopedisme au XXe siecle: Henri Berr et la conjoncture des annees vingt)), in: BiardlBourelIBrian, Henri Berr, op. cit., S. 280ff.
35. Vgl. Febvres Brief an Berr v. 15.10.1936, in: Lucien Febvre, De la ((Revue de Syn- these)) aux ((Annalesw: Lettres a Henri Berr 1911-1954, hg. v. Gilles Candar u. Jac- queline Pluet-Despatin, Paris: Fayard, 1997, S. 529.
36. Berr versuchte seinerseits, den Konflikt zu uberbrijcken, indem er in seinem Blatt beide Projekte als einander erganzend darstellte: .Si certaines modalites en sont dif- ferentes, elle [scil. I'Encyclopedie Fran~aise] repond B une conception semblable de I'unite et de I'efticacite de la Science. Au surplus, le r61e de Lucien Febvre sumt a prouver qu'il y a, entre ces deux formes d'encyclopedie, parallelismes, amnites et non concurrence" (Science, 1, 1936, Nr.1, S. 6). Auch enthielt bereits die 2. Ausgabe eine groRe Werbeanzeige der EncyclopBdie Fran~aise.
37. Vgl. William R. Keylor, Academy and Community. The Foundation of the French Historical Profession. CambridgelMass.: Harvard UP, 1975, S. 125ff.; Bianca Ar- changeli 1 Margherita Platania (Hg.), Metodo storico et scienze sociali. La Revue de synthese historique (1 9O&l93O). Roma: Bulzoni. 1 981 .
38. Vgl. die Dokumentation bei ArchangeliIPlatania, op.cit., sowie: Lutz Raphael, "Histo- rikerkontroversen im Spannungsfeld zwischen Berufshabitus, Facherkonkurrenz und sozialen Deutungsmustern. Lamprecht-Streit und franzosischer Methodenstreit der Jahrhundertwende in vergleichender Perspektive", in: Historische Zeitschrift, 251,1990, S. 325-363.
39. Otto Neurath, ((L'Encyclopedie comme 'modele'n, in: Revue de Synthese, 12, 1936, 2, S. 187-201. An einer Stelle bezieht sich der Autor auch explizit auf das Centre (S. 199). Vgl. ferner die Beitrage von Franck in Jg. 1934, Schlick, Hernpel und Carnap in

Peter Schottler
Jg. 1935 sowie einen weiteren Beitrag von Frank in Jg. 1936 der Zeitschrift. Zwi- schen 1934 und 1939 publizierte die Revue de Synthese daruber hinaus mehrere einschlagige Rezensionen, einen Nachruf auf Hans Hahn (Jg. 1935, S. 118) sowie Berichte uber die Kongresse fiir Einheitswissenschaft. Eine griindliche Untersuchung dieses Projekts stets noch aus. Vgl. Margherita Pla- tania (Hg.), Les mots de I'histoire. Le vocabulaire historique du Centre international de synthese. Napoli: Bibliopolis, 2000; Enrico Castelli Gattinara, Strane alleanze. Storici, filosofi e scienziati a confronto nel Novecento. Milano: Mimesis, 2003, S. 37ff. Otto Neurath an Henri Berr, 4.6.1937 (Wiener Kreis Stichting, Amsterdam, Nachlass 0. Neurath, Nr. 214; Kopie im lnstitut Wiener Kreis, Wien). Allerdings haben sich in den jeweiligen Nachlassen nur drei Briefe aus den Jahren I937138 erhalten (Institut Memoire de \'Edition Contemporaine, Paris-Caen, Fonds H. Berr, A 40-03.1 1). Vgl. Marina Neri, ttVers une histoire psychologique: Henri Berr et les Semaines intemationales de synthese (19241947)n, in: BiardlBourellBrian, Henri Berr, op. cit., S. 205-218; Bernadette Bensaude-Vincent, ttPr6sences scientifiques aux Semaines de synthese (1929-1939))), in: ibid., S. 219-230. Es ware interessant, Ausrichtung und Verlauf dieser Tagungen etwa mit den Eranos- Tagungen in Ascona oder den Decades de Pontigny zu vergleichen. ctlnstructions relatives au repertoire methodique de synthese scientifique du Centre international de Synthesen, in: Revue de Synthese historique, 44, 1927, 4, S. 41-47. Das einheitswissenschaftliche Ziel wird deutlich angekundigt: .L1objet du Centre in- ternational de Synthese est de travailler & I'unification des sciences historiques, & I'unification des sciences de la nature, I'unification enfin de ces deux ordres de connaissance ..." (S. 41). Er veroffentlichte u.a. auch einen begeisterten Bericht uber den Kongress von 1935: Robert Bouvier, ttLe congrhs international de philosophie scientifique. Paris, sep- tembre 1935~, in: Revue de Synthese , 10, 1935, S. 229-231. Vgl. Robert Bouvier, La pensee de Ernst Mach. Essai de biographie intellectuelle et critique, Paris: Velin !'or, 1923. Haufig mussten die Ubersetzungshonorare - etwa fur die in Anm. 65 zit. Broschu- ren, nicht aber fur die Aufsatze in der Revue de Synthese von den Autoren selbst aufgebracht werden. Vgl. Robert Bouvier an Otto Neurath, 3.4.1936 (Wiener Kreis Stichting, Amsterdam, Nachlass 0. Neurath, Nr. 216; Kopie im lnstitut Wiener Kreis, Wien). Wiener Kreis Stichting, Amsterdam, Nachlass 0. Neurath, Nr. 216; Kopien im lnstitut Wiener Kreis, Wien. Der Briefwechsel betrifft die Jahre 1935-1 938. Eine Biographie von Rey fehlt bislang. Vgl. Pietro Redondi, Epistemologia e storia della scienza. Le svolte teoriche da Duhem a Bachelard. Milano: Feltrinelli, 1978, S. 88ff.; Enrico Castelli Gattinara, Les inquietudes de la raison. Epistemologie et his- toire en France dans I'entre-deux-guetres. Paris: Vrin, 1998, S. 79ff. Febvre hat zwei Bande von Thales rezensiert: Annales d'histoire Bconomique et sociale , 10, 1938, S. 154f.; Annales d'histoire sociale, 2, 1940, S. 58. Vgl. allg. Pietro Redondi, "French Journals of the History of Science: The Checking of a Defi- cit", in: Marco Beretta I Claudio Popliano I Pietro Redondi (Hg.), Journals and History of Science. Firenze: Olschki, 1998, S. 167-187 ( S. 179ff.). Alfred Stern, ttLe Cercle de Vienne et la doctrine neopositivistea, in: Thales, 2, 1935, S. 211-227. Vgl. Actes du Congres international de philosophie scientifique. Sorbonne, Paris 1935. Paris: Herrnann, 1936, S. 5. Erwahnt werden sollte auch, dass eines der ers- ten Bucher von Rey, La theorie de la physique chez les physiciens contemporains

13, rue du Four 203
(Paris: Flarnmarion, 1907), das zurn ersten Mal in Frankreich uber das Werk von Mach inforrnierte, bereits 1908 von Rudolf Eisler ins Deutsche ubertraqen wurde. Als Autor war Rey also schon vor dem Weltkrieg in Deutschland und Osterreich be- kannt.
53. Vgl. Bernadette Bensaude-Vincent, Langevin 1872-7946. Science et vigilance. Paris: Belin, 1987.
54. Dies geht auch aus einigen in den Nachlassen von Schlick und Neurath erhaltenen Briefwechseln hervor (Institut Wiener Kreis, Wien).
55. Siehe Bensaude-Vincent, Langevin, op. ut., S. 173ff. Vgl. auch den Nachlass von Langevin, der in der Pariser Ecole de Physique et de Chemie aufbewahrt wird; dort u.a. ein Vortragsmanuskript mit dem Titel ((Les courants positivistes et rbalistes dans la ~h i loso~h ie de la ~hvsiauen v. 2.6.1938 (Kasten 97, fol. 3ff.). . . .
56. vgl. ~ried'rich Stadler, Studien zum Wiener Kreis. ~ . r s~ run~ , . Enlwicklung und Wir- kung des Logischen Empirismus im Kontext, Fran kfurtlMain: Suhrkarnp, 1 997, S. 406.
57. Zur bisherigen Forschung uber die Rezeption des Wiener Kreises in Frankreich, die auf die aukerst pessimistische These hinauslauft, dass "since 1935 [...I the Vienna Circle did not make new adepts nor generate any French neo-positivist offspring", vgl. Antonia Soulez, 'The Vienna Circle in France (1935-1937)", in: Friedrich Stadler (Hg.), Scientific Philosophy: Origins and Developments, Dordrecht: Kluwer, 1993, S. 95-112 (Vienna Circle Yearbook, 1); hier: S. 109. Uber das franzosische Syrn- pathisantennetzwerk heikt es allerdings nur vage: .In his opening speech Ph. Frank adds that the Center and the Review .SyntheseU (sic!) were also very active in the propagation of logical empiricism" (S. 101). Mag sein, dass hier die Ubersetzung ins Englische zu Ungenauigkeit gefuhrt hat; jedenfalls durfte kaum ein Leser einen Zu- samrnenhang rnit dern Centre und der Zeitschrift von Berr erkannt haben, zurnal es auch in Holland eine Zeitschrift mit dern Titel Synthese gab (und gibt), an der Neu- rath beteiligt war. Abel Rey, Febvre oder die Encyclopedie Fran~aise werden in die- ser rein philosophischen Rezeptionsgeschichte uberhaupt nicht erwahnt. Vgl. ahn- lich: Jan Sebestik I Antonia Soulez (Hg.), Le Cercle de Vienne. Doctrines et contro- verses. Paris: Klincksieck, 1986. Eine analoge Blindheit herrscht ubrigens auch in den Forschungen zur Geschichte des Centre de Synthese, wo die Nahe zum Wiener Kreis bestenfalls gestreift wird: vgl. z.B. BiardlBourellBrian, Henri Berr, op. ut., S. 208 u. 271. Eine bernerkenswerte Ausnahrne stellen dagegen die Studien von Enri- co Castelli Gattinara dar, der sich seit langerern fur die Verbindungen zwischen Phi- losophen, Geistes- und Naturwissenschaftlern interessiert (Les inquietudes de la rai- son, op. cit.; Strane alleanze, op. cit.).
58. Schon 1912 bis 1914 waren Febvre und Rey Kollegen an der (kleinen) Universitat von Dijon, wo der eine Neuere Geschichte, der andere Philosophie und Psychologie lehrte.
59. Encyclopedie Fran~aise, I, Paris 1937, S. 1-10-1 bis S. 1-20-11. 60. Rey, De la pensee primitive a la pensee actuelle, S. 1-1 8-1. 61. Ders., La philosophie moderne. Paris : Flarnrnarion, 1908, S. 367. Zur rationa-
listischen und .sz/entistischenU ldeologie jener Jahre vgl, auch Dorninique Pestre, Physique et physiciens en France 1918-1940. Paris: Edition des archives contern- poraines, 1984, S. 171ff.
62. Rey, De la pensee primitive B la pensee actuelle, S. 1-1 8-1 4ff. 63. Vgl. ibid., S. 1-18-4, 1-18-7 bis 1-18-9. 64. Vgl, u.a. das posthum publizierte Vorwort zur Neuauflage des ersten Bandes: Lucien
Febvre, ((Avant-propos)), in: Encyclopedie Fran~aise, 1, '1957, S. 1-04-3 bis S. 1-04- 6, sowie ders., Combats pour I'histoire. Paris: Armand Colin, 1953, S. 289 u. 340. In

204 Peter Schottler
Febvres Nachruf auf Rey heiRt es: "Jamais ce bon geant, au sourire tout jeune dans une barbe sans austerite, n'aura donne au public de plus satisfaisant que cette his- toire de la raison hurnaine que je suis heureux de lui avoir fourni I'occasion, toute re- cente, d'ecrire au tome I de I'Encyclopedie Franpaise" (Annales d'histoire sociale, 2, 1940, S. 55). Siehe etwa die vom Pariser Verlag Hermann publizierte Buch- und Broschijrenreihe Actualit& scientifiques et industrielles, in der u.a. folgende Titel erschienen sind: Hans Reichenbach, La philosophie scientifique (1932); Rudolf Carnap, L'ancienne et la nouvelle logique (1933); Philipp Franck, La causalite et ses limites (1934); Char- les-Ernest Vouillemin, La logique de la science et I'6cole de Vienne (1 935); Rudolf Carnap, Le probleme de la logique de la science (1 935); Hans Hahn, Logique, ma- thbmatiques et connaissance de la realite (1935); Otto Neurath, Le developpement du Cercle de Vienne et I'avenir de I'empirisme logique (1935) ; Moritz Schlick, Sur le fondement de la connaissance (1935); Philipp Frank, La fin de la physique m6ca- niste (1936) usw. Vgl. Stadler, Studien, op. cit., S. 404. Oder des ,Groupe Viennois', wie eine andere ljbersetzung lautete: Revue de Syn- these, 8, 1934, 2, S. 142ff. Lucien Febvre, (tun album de statistique figureen, in: Annales d'histoire economique et sociale, 3, 1931, S. 587-390 (Rez. von Otto Neurath, Gesellschaff und WirtschaR Bildstatistisches Elementarwerk, Leipzig 1930). Allerdings muss man wissen, dass sich Febvre in jenen Jahren immer wieder gegen drastische Schaubilder nach Art der deutschen ,Geopolitikl wandte - und nun Neuraths Methode damit identifizierte (S. 389). Vgl. Marc Bloch, ((Cornparaison.?), in: Bulletin du Centre international de synthese, Nr.9, Juni 1930, S. 31-39 ; dt. Ubers. in: ders., Aus der Werkstatt des Historikers. Zur Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft, hg. v. Peter Schottler. Frank- furVMain: Campus, 2000, S. 11 3-121. Vgl. Platania, Les mots, op. cit., S. 169f. Dagegen hatte sich Bloch den Sinologen und Durkheimianer Marcel Granet als Rezensenten gewunscht. Louis Rougier, ctLes rois thaumaturges dlapr&s un ouvrage recent)), in: Revue de Synthese historique, 39, 1925, 1 1511 17, S. 96-1 06. Vgl. Franqois Denord, ~ A u x origines du neo-liberalisme en France: Louis Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938)), in: Le Mouvement Social, 195, 2001, S. 9- 34. Vgl. Maurice Allais, Louis Rougier, prince de la pensbe. Lourmarin de Provence 1990. Symptomatisch sind hier die beiden Venisse des Buches von Rougier La mystique d6mocratique (Paris: Flammarion, 1929) durch Maurice Halbwachs in den Annales (2, 1930, S. 630) und Henri See in der Revue de SynthBse (47, 1929, S. 145f.). Vgl. 2.B. das Klischee, wonach Febvre sein Leben lang die Psychoanalyse abge- lehnt habe. Eine genauere Studie hat dagegen einen Wandel seiner Haltung zu Freud - vom negativen zurn positiven Vorurteil - nachweisen konnen. Siehe meinen in Anm. 22 zit. Aufsatz. Vgl. mein Nachwort zu Marc Bloch, Apologie der Geschichtswissenschaff oder Der Beruf des Historikers, hg. v. Peter Schoffler. Stuttgart: Klett-Cotta, 2004, S. 215- 280. hier: S. 256ff.

M~LIKA OUELBANI
CARNAP UND DIE ElNHElT DER WISSENSCHAFT
Wenn wir von der Einheit der Wissenschaft als einem neo- positivistischen Projekt sprechen, beziehen wir uns in der Regel auf Carnap und Neurath, zwei der bedeutendsten Vertreter des Wiener Kreises. lhre Projekte konnen den Eindruck vermitteln, vollkommen identisch zu sein, obwohl mindestens zwei wichtige unterschiedliche Auffassungen bestehen, die ein Streitthema zwischen ihnen darstellten. Ich werde sie im Folgenden untersuchen, um herauszufinden, inwieweit ein solcher Eindruck begrundet sein kann.
Der erste Unterschied besteht darin, dass Carnap zu Beginn, d.h. in seinem Logischen Aufbau der welt,' im Gegensatz zum Physi- kalismus Neuraths einen Phanomenalismus vertreten hatte. Zwei Jahre nach diesem Hauptwerk schloss Carnap sich jedoch dem Physika- lismus an, wobei er betonte, dass der Unterschied zwischen den bei- den Thesen unbedeutend sei und dass sein Projekt unverandert beste- hen bleibt, unabhangig davon ob er Phanomenalist oder Physikalist ist.
Man kann sich nun fragen, worin diese beiden Thesen bestehen und insbesondere, ob Carnaps ~bernahme des Physikalismus es er- moglicht hat, dass sein Projekt sich dern neurathschen Projekt an- geschlossen hat und mit ihm verschmolzen ist. Dies wurde den Gedan- ken zulassen, dass die Projekte Carnaps und Neuraths grundsatzlich ubereinstimmen, d.h. dass ihre Vorstellungen von der Einheit der Wis- senschaft identisch sind. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, muss man sich fragen, ob die ~bernahme der physikalistischen These durch Carnap zu einer Annaherung der beiden Projekte gefuhrt hat.
Der zweite Unterschied zwischen den beiden Projekten liegt in der von Neurath vertretenen enzyklopadischen Vorstellung von der Einheit der Wissenschaft im Gegensatz zu der von Carnap vertretenen Sys- tem-Vorstellung. Schlienen sich diese beiden Vorstellungen ge- genseitig aus?
Ich werde mich mit den folgenden Fragen beschaftigen: 1) Reicht die ~bernahme des Physikalismus aus, urn die Unterschiede zwischen Carnap und Neurath zu verwischen? 2) Schlient die neurathsche Vor- stellung von der Einheit der Wissenschaft als Enzyklopadie das System aus? und 3) Wenn sich der Gegensatz zwischen beiden ab 1934 mit dem Artikel ,,Einheit der Wissenschaft als Aufgabeu, in dem Neurath seine Ablehnung des Systems expliziter zum Ausdruck bringt, weiter

206 MBlika Ouelbani
verscharft hat, wie erklart es sich dann, dass Carnap sich am Neu- rathschen Enzyklopadieprojekt beteiligt hat?
Wir wissen, dass Carnap in Der logische Aufbau der Welt eine Methode vorgestellt hat, nach der es moglich ist, eine Einheit der Wissenschaft herzustellen und somit das Projekt des Wiener Kreises, wie im Manifest von 1929 angekundigt, zu verwirklichen. Schon im ersten Absatz ist das Projekt Carnaps eindeutig: .das Ziel der vorliegenden Unter- suchung ist die Aufstellung eines erkenntnismanig-logischen Systems der Gegenstande oder der Begriffe, des ,Konstitutionssystems'". Auch seine Methode ist eindeutig, da das System der Wissenschaftsbegriffe ein deduktives, ja sogar eher noch ein reduktives System ist. Das Kon- stitutionssystem setzt sich, mit anderen Worten, aus Stufen zusammen. Die Gegenstande jeder Stufe konnen mit Hilfe der Gegenstande der untergeordneten Stufen gebildet oder definiert werden. Denn: ,,Wegen der Transitivitat der Zuruckfuhrbarkeit werden dadurch indirekt alle Gegenstande des Konstitutionssystems aus den Gegenstanden der ersten Stufe konstituiert; diese ,Grundgegenstandei bilden die ,Basis1 des ~~s tems . " * Der Begriff der Basis des Systems ist sehr wichtig, da die Verschiedenheit der Wissenschaften, insbesondere der Natur- und der Geisteswissenschaften, dank der Ruckfuhrung auf eine einzige Basis uberwunden werden kann. Sie wird dann direkt oder indirekt fur alle Wissenschaften gleich und taut Carnap phanomenalistisch sein.
Er stellt somit eine stufenformige Ordnung der Gegenstande (oder Wissenschaftsbegriffe) in Form einer Art Stammbaum auf. Jeder Begriff hat demzufolge einen ganz bestimmten Platz in diesem verein- heitlichten System der Wissenschaft. Die Wissenschaft beinhaltet vier Arten von Gegenstanden: eigenpsychische, die die Basis des Systems darstellen, physische, fremdpsychische und geistige. Diese vier Be- reiche werden im Verhaltnis zueinander zweitrangig sein, und m a r insofern als sie dank einer Definitionskette voneinander abgeleitet wer- den konnen.
Die Konstitution wird somit dank einer Methode der Ableitbarkeit erreicht. Anhand dieser Methode werden wir definieren konnen, was Carnap unter Konstitutionstatigkeit versteht. ,,Ein Gegenstand (oder Begriff) heint auf einen oder mehrere Gegenstande ,zuruckfuhrbar', wenn alle Aussagen uber ihn sich umformen lassen in Aussagen uber diese anderen ~ e ~ e n s t a n d e . " ~ Somit konnen alle Gegenstande auf die

Carnap und die Einheit der Wissenschaft 207
Gegenstande der Basis des Systems zuruckgefuhrt werden, die ihrer- seits phanomenalistisch sein wird.
Diese Wahl einer eigenpsychischen Basis rechtfertigt sich durch die erklarte Absicht Carnaps, ein System zu schaffen, das nicht nur die logische, sondern auch die erkenntnismanige Ordnung der Gegen- stande ~ i d e r s ~ i e ~ e l t . ~ Es ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass die Wahl einer solchen Basis keineswegs eine philosophische Not- wendigkeit, sondern lediglich eine ~ o ~ l i c h k e i t ~ darstellt, da die Konsti- tutionstheorie metaphysisch neutral ist.
Carnap unterstreicht eindringlich den Gedanken, dass sein Phano- menalismus nur ein Vorschlag ist, der auch andere Gestalt hatte an- nehmen konnen. Er tut dies sowohl im Nachhinein in seiner Auto- biographie: .The system of concepts was constructed on a phenome- nalistic basis, the basis elements were experiences. ... However, I indi- cated also the possibility of constructing a total system of concepts on a physical basisu6, als auch de facto, da er in § 62 des Aufbaus schon von der Moglichkeit einer physikalischen Basis spricht, wobei er sogar drei verschiedene Moglichkeiten dafur vorstellt. Dadurch verfiigt man uber mehr Moglichkeiten bei der Auswahl einer Basis fur die Konstituti- on.
Die Diskussionen im Wiener Kreis haben ihn ubrigens sehr schnell dazu veranlasst, sich fur den Physikalismus zu entscheiden. Fur ihn ist der Physikalisrnus nichts weiter als eine .HaltungU, insofern als seine Wahl auf praktischen ljberlegungen, auf Grunden der Praferenz und nicht auf theoretischen ljberlegungen beruht.' Welchen Vorteil bietet seiner Meinung nach der Physikalismus im Vergleich zum Phano- menalismus?
Der Hauptvorteil liegt darin, dass eine physikalistische Sprache intersubjektiv ist. Dies bedeutet, dass die beschriebenen Tatsachen grundsatzlich von all jenen beobachtet werden konnen, die diese Spra- che verwenden.' Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Phanornenalisrnus, wenn man die Vorstellung carnapsg richtig ver- steht, letztendlich gar nicht so viele Probleme hinsichtlich der beiden Charakteristika der Protokollsatze aufwarf, namlich der Universalitat und der Intersubjektivitat. Denn letztendlich hat sich gezeigt, dass seine Vorstellung mehr logisch denn erkenntnismanig war. Dies bestatigt eigentlich nur, dass es fur Carnap letztlich gleichgultig war, ob die Basis phanomenalistisch oder physikalistisch ist. Das eigentliche Ziel Car- naps ist in Wirklichkeit vie1 allgemeiner. Er wollte ganz allgemein die Moglichkeit eines Konstitutionssystems aufzeigen, und theoretisch die Moglichkeit alle wissenscha~lichen Aussagen in Aussagen dieses Sys-

208 MBlika Ouelbani
tems zu ubersetzen.l0 Sein Ziel geht also weit uber dieses besondere phanomenalistische System hinaus," fur das er sich aus praktischen Grunden entschieden hatte.
Kann man behaupten, dass Carnap und Neurath sich zu diesem Zeitpunkt lediglich bezuglich dieser physikalistischen oder phanomena- listischen Haltung voneinander unterschieden, dass ihre Projekte also wirklich identisch waren? Man kann tatsachlich annehmen, dass die Vorstellung Neuraths anfanglich rnit der Carnaps ubereinstimmte. Dies komrnt auch irn Manifest des Wiener Kreises zurn Ausdruck, das ein Jahr nach der Veroffentlichung des Aufbaus von Carnap, Neurath und Hahn gemeinsam verfasst und unterzeichnet wurde. Fur sie ist das Ziel der wissenschaftlichen Auffassung der Welt die Einheitswissenschaft. Diese Harmonisierung der Wissenschaften wird dank eines Ruck- fuhrungssystems erreicht und es hat in diesem Zusamrnenhang den Anschein, als sei das Projekt so ubernommen worden, wie Carnap es 1928 vorgestellt hatte. Dort werden die Begriffe Konstitutionssystem, Gesamtsystem der Begriffe sowie die entscheidende Rolle der syrn- bolischen Logik hervorgehoben.
Es hat sich jedoch schnell gezeigt, dass Carnap und Neurath sich hinsichtlich ihrer Vorstellung von den Protokollsatzen nicht einigen konnten. Dies kornrnt in ihrem Streit aus den Jahren 1931 bis 1933 zum Ausdruck, dem Neurath scheinbar sehr vie1 mehr Wichtigkeit und Be- deutung beirnal3 als Carnap. Als er sich der physikalistischen These anschloss, hat Carnap namlich seine Vorstellung von der Einheit der Wissenschaft in keinster Weise geandert. Es ging fur ihn weiterhin dar- urn, alle Aussagen der Wissenschaft auf Basissatze zuruckzufuhren. Es geht rnit anderen Worten darum, die Wissenschaften in eine univer- selle, intersubjektive Sprache, namlich die physikalistische Sprache, zu ubersetzen. Es handelt sich noch imrner um eine Frage der Methode. In seinem Artikel .Die physikalische Sprache als Universalsprache der ~issenschaft '"~ weist Carnap darauf hin, dass so wie der Phanomena- lisrnus ein "methodischer Solipsismus" ist, der Physikalisrnus ein .me- thodischer Materialisrnus" ist. Dies bedeutet, dass die Einheit der Wis- senschaft in beiden Fallen eine theoretische Frage der Sprache und ljbersetzung ist. In § 7 des gleichen Artikels schreibt er narnlich: .Durch den Zusatz ,methodischl sol1 zurn Ausdruck gebracht werden, dass es sich hierbei urn Thesen handelt, die nur von der logischen Moglichkeit gewisser sprachlicher Umformungen und Ableitungen reden, und nicht etwa von der ,Realitat' oder ,Nichtrealitatt (,Existenzl, ,Nichtexistenzi) des Gegebenen, des Psychischen, des Physischen". Laut Carnap hatte jede beliebige andere universelle Sprache diesern Zweck dienen und

Carnap und die Einheit der Wissenschaft 209
die Einheit der Wissenschaft herstellen konnen, allerdings ist der Phy- sikalismus derzeit die einzige bekannte, hierzu dienliche Sprache. Car- nap nimmt die Kritik Neuraths scheinbar nicht ernst. Fur ihn handelt es sich lediglich um .zwei verschiedene Methoden zurn Aufbau der Wis- senschaftssprache, die beide moglich und berechtigt sind".
In seiner Antwort auf diesen Artikel warf Neurath Carnap jedoch in Wirklichkeit dessen Vorstellung von den Protokollsatzen vor, unab- hangig davon ob sie phanomenalistisch oder physikalistisch sind. Er kritisiert, dass Carnap sie als urspriinglich ansieht und dass sie, im Gegensatz zu den anderen Aussagen, die sich aus ihnen ableiten, folglich keiner Bestatigung oder Rechtfertigung bedurfen.
Die Kritik Neuraths greift also nicht eigentlich den Phanome- nalisrnus als solchen an. Er lehnt hauptsachlich Carnaps Philosophie der Letztbegrundung ab sowie das allgemeine Prinzip des Neo- positivismus, namlich den Verifikationismus. Er ist namlich der Auf- fassung: .so werden immer Aussagen mit Aussagen verglichen, nicht etwa mit einer ,Wirklichkeit', mit ,Dingen1, wie es bisher auch der Wie- ner Kreis tat",13 obwohl gleichzeitig ,die Einheitswissenschaft auf dem Boden des Physikalismus ... nur Aussagen mit raumlich-zeitlichen Be- ~ t immun~en" '~ kennt. Aus diesem Grund verwendet er auch den Begriff physikalistisch statt physikalisch, ein Begriff, der in einem engeren Sin- ne benutzt wird.
Da nun die Protokollsatze nach seiner Auffassung Teil des Systems sind und die Wahrheit jeder Aussage von der Wahrheit der anderen Aussagen abhangt, kann man sich folglich durchaus vorstellen, dass Protokollsatze falsch sein konnen. Wenn das der Fall ist, konnen sie keine unumstol3liche Grundlage darstellen. Somit gibt es also keine absolute Gewissheit. In Radikaler Physikalismus und wirkliche Welt, vertritt Neurath, in direkter Anlehnung an Poincare und Duhem, die Moglichkeit, uber mehrere miteinander konkurrierende Systeme zu verfugen, unter denen wir eines auswahlen konnen.15
Die beiden unterscheiden sich somit scheinbar weniger darin, dass ihre Basis phanomenalistisch oder physikalistisch ist, sondern vielmehr durch ihre Vorstellung von den Basissatzen. Sie stellen fur Carnap eine Grundlage dar und heben sich somit von den anderen begrundeten Satzen ab. Fur Neurath hingegen gehoren sie zum System und unter- scheiden sich nicht von den anderen Satzen. In dieser Hinsicht ist der Unterschied, wie Carnap unterstreicht, nicht sehr bedeutsam. Wir wis- sen namlich einerseits, dass die Protokollsatze, selbst 1928 im Aufbau, nicht unveranderlich und sogar fast beliebig sind. Andererseits hat Car- nap sehr schnell die koharentistische Vorstellung von der Wahrheit

210 MBlika Ouelbani
ubernommen, die ihm ubrigens nicht vollkommen fremd war. In diesem Zusammenhang kann man namlich darauf hinweisen, dass die Realitat in den § 170 bis 178 als das definiert wird, was seinen Platz im Konsti- tutionssystem findet. Die Moglichkeit einer Vielfalt von Systemen scheint also eher Schlick denn Carnap zu widersprechen.
Was sie jedoch unterscheidet und worin ihre Auffassungen sogar vollkommen auseinandergehen, ist die Tatsache, dass die physika- listische, wie ubrigens auch die phanomenalistische Sprache, fur Neu- rath nicht ideal sein kann. In diesem Zusammenhang schreibt er: .Die Fiktion einer aus sauberen Atomsatzen aufgebauten idealen Sprache ist ebenso metaphysisch."16 Die Sprache der Einheit der Wissenschaft ist keine prazise, reine Sprache. Es handelt sich um eine Art Universal- slang, der durchaus auch unprazise Begriffe enthalten kann. Die Uni- versalsprache kann im ubrigen nicht formalisiert sein, wahrend sie fur Carnap eine Kunstsprache bleibt.
Carnaps Artikel .Die physikalische Sprache als Universalsprache der ~issenschaft" '~ hilft uns, ihre unterschiedlichen Auffassungen deut- lich zu machen. Obwohl Carnap den Physikalismus ubernomrnen hat, sowie den Gedanken, dass die Verifikation in der Wissenschaft keine isolierten Aussagen, sondern ein ganzes ~ussagens~s te rn~~ betrifft, be- halt er meiner Ansicht nach Schlusselgedanken seiner ersten Vor- stellung und somit die Hauptmerkmale seiner Erkenntnistheorie bei, namlich:
1) Die Verifikation beruht auf ~rotokollsatzen~~. Wir konnen also sagen, dass die physikalistische These Carnaps eine logische, nicht deskriptive These ist, was auch von F. Barone unterstrichen wurde.
2) Er warnt vor jeglicher Art von materieller Redeweise und ent- scheidet sich fur eine formale sprache:'' .Wir sehen, dass die Ver- wendung der inhaltlichen Redeweise uns zu Fragen fuhrt, bei deren Behandlung wir in Widerspruche und unlosbare Schwierigkeiten gera- ten. Die Widerspruche verschwinden aber, sobald wir uns auf die kor- rekte formale Redeweise beschrankenu. Dies entspricht exakt seiner im logischen Aufbau der Welt vertretenen Auffassung. Der logische Auf- bau der Welt war namlich alles in allem eher logisch als erkennt- nismafiig.
Carnap hat immer zwischen dem lnhalt und der Form der Sprache unterschieden. Dabei hat er, zumindest bis 1936, darauf hingewiesen, dass der lnhalt zur Beseitigung der Pseudoprobleme vernachlassigt werden muss.
3) Bei der Einheit der Wissenschaft geht es um die Ruckfuhrung auf physikalistische Bestimmungen: ,,Bei diesen Gebieten (Chemie,

Carnap und die Einheit der Wissenschaft 21 1
Geologie, Astronomie ...) wird man wohl keinen Zweifel an der An- wendbarkeit der physikalischen Sprache haben. Man verwendet m a r vielfach eine andere Terminologie als in der Physik. Aber es ist klar, dass jede hier vorkommende Bestimmung auf physikalische Bestim- mungen zuruckfuhrbar ist", er fugt hinzu, dass .. .. jeder Satz der Biolo- gie in die physikalische Sprache ubersetzt werden kannaU2' Als einzig neue Entwicklung kann man wahrend dieser Periode ein wachsendes lnteresse an der Biologie feststellen.
4) In einem Brief an Neurath vom 2.6.1935 definiert er den Physika- lismus als eine These nach der "jeder Satz (der Wissenschaft) in die physikalische (oder besser in eine physikalische Sprache) ubersetzt werden kann". Es ging Carnap nie darum, Aussagen nachzuprufen, sondern wissenschaftliche Satze einheitlich zu formulieren und auszu- drucken. Das ist nur durch die Ruckfuhrung moglich.
Man muss jedoch darauf hinweisen, dass der Begriff der Ruck- fuhrung in seinem Artikel &ber Einheitssprache der Wissenschaft" aus dem Jahr ~ 9 3 5 ~ ~ im Vergleich zu 1928 weiter gefasst ist. Hierin kann man vielleicht den Beginn einer Abwendung von seinem ursprunglichen Projekt erahnen. Carnap unterscheidet in diesem Artikel namlich m i - schen Definition und Ruckfuhrung. Es geht dabei nicht mehr darum, die Definitionsmethode beispielsweise auf das anzuwenden, was er Dispo- sitionsbegriffe nennt. Diese Dispositionsbegriffe kann man zwar auf eine Beobachtung zuruckfuhren, jedoch nicht anhand empirischer Beg- riffe definieren. Es gibt namlich Begriffe fur Dispositions-Eigenschaften, wie zum Beispiel sichtbar, Ioslich, etc. Sie drucken eine bestimmte, unter bestimmten Bedingungen auftretende Reaktion aus, die nicht konstitutionell definiert werden kann. Carnap nennt eine andere Metho- de, die nicht auf Definitionen, sondern auf die Reduktion mit Hilfe von Reduktionssatzen zuruckgreift.
Es hat somit den Anschein, dass der ~bergang vom Phanomena- lismus zum Physikalismus an Carnaps ursprunglicher Vorstellung nicht vie1 geandert hat. Dies erklart auch, dass er die zwischen ihm und Neu- rath bestehenden Meinungsverschiedenheiten herunterspielt und glaubt, dass sie sich grundsatzlich einigen konnten. Gleichzeitig wird dadurch klar, dass die Vorbehalte Neuraths weiterhin bestehen bleiben mussten.
Es liegt mir fern, die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Autoren minimisieren zu wollen. Ich bin im Gegenteil sogar der Meinung, dass sie recht bedeutsam sind und dass ihre Ansichten ins- besondere bezuglich der Einheit der Wissenschaft auseinander gingen. Neuraths Definition von der Einheitswissenschaft besagt, sie ,,umfasst

21 2 MBlika Ouelbani
alle wissenschaftlichen Gesetze, diese konnen ausnahrnslos miteinan- der verbunden ~ e r d e n " ~ ~ . Carnap hingegen stellt sogar in .Die physika- lische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft" im Gegensatz dazu fest, dass es bei der Ruckfuhrung der Biologie auf die Physik keineswegs darurn geht, die Gesetze einer Disziplin auf eine andere zuruckzufuhren. Fur ihn handelt es sich dabei urn eine Ruckfuhrung der Begriffe: ,Bei dieser These handelt es sich nicht um die Zuruckfuhrbar- keit der biologischen Gesetze auf die physikalischen, sondern urn die Zuruckfuhrbarkeit der biologischen Begriffe auf die physika~ischen."~~ Dieser Unterschied erklart sich durch einen vie1 grundlegenderen Un- terschied. Fur Neurath hat narnlich die Einheit der Wissenschaft einen praktischen Nutzen, denn sie .ist die Sprache der ~ o r a u s s a ~ e n " . ~ ~ Die Einheitssprache dient fur Voraussagen. Er schreibt: .Man kann ver- schiedene Arten von Gesetzen gegeneinander abgrenzen, zum Bei- spiel: chernische, biologische, soziologische, man kann aber nicht von der Voraussage eines konkreten Einzelvorgan s sagen, dass sie von einer bestimmten Art von Gesetzen abhange. u 2 f
Man kann sogar von einer pragmatischen Vorstellung von der Ein- heit der Wissenschaft sprechen, da wir anhand der Voraussage von Tatsachen, unser Handeln entsprechend darauf abstirnrnen konnen. Die Einheitswissenschaft wird zu einer Art Instrument. Neurath geht es darurn, die Gesetze zu systernatisieren, urn Voraussagen zu treffen. Fur Carnap hingegen ist der Nutzen der Einheit der Wissenschaft eher theoretisch. Es handelt sich in gewisser Hinsicht urn eine Erkennt- nistheorie. Am Ende des zweiten Teils seines Artikels widerspricht Neu- rath Carnap ganz deutlich:
Es ist die physikalistische Sprache, die Einheitssprache, das Um und Auf aller Wissenschaften: keine phanomenale Sprache neben der physikalischen Sprache, kein methodischer Solipsisrnus neben einern anderen moglichen Standpunkt; keine Philosophie, keine Er- kenntnistheorie, keine neue Weltanschauung neben anderen Welt- anschauungen; nur Einheitswissenschaft mit ihren Gesetzen und Voraussagen.
Irn Zusarnmenhang rnit den Vorstellungen von Protokollsatzen kann man insbesondere ab 1935 im Wiener Kreis zwei Denkansatze unter- scheiden, die vor allern von Carnap und Neurath vertreten wurden. Sie

Carnap und die Einheit der Wissenschaft 213
betreffen die Einheit der Wissenschaft, die entweder als System oder als Enzyklopadie verstanden wird. Neurath entscheidet sich definitiv fur den Enzyklopadismus wobei er sich gleichzeitig jedoch von seinen Vorgangern unterscheidet. Seine Enzyklopadie sol1 sich namlich nicht darauf beschranken, die verschiedenen Wissenszweige als eine aus- fuhrliche [Jbersicht darzustellen.
Wahrend die anderen Enzyklopadien in gewisser Weise eine retro- spektive Synthese darstellen, sol1 dieses neue Werk vor allem auf- zeigen in welche Richtung sich neue Wege offnen, wo die Proble- me liegen und wo sich, vom Standpunkt der Einheitswissenschaft, neue, ungeahnte Moglichkeiten abzeichnennZ7
Sein Projekt besteht vielmehr darin, anhand einer logisch-wissen- schaftlichen Analyse aufzuzeigen, .bis zu welchem Punkt man die der- zeitige Wissenschaft vereinheitlichen kann und ihre inneren Zusam- menhange sichtbar zu machen". Nach dieser Definition scheint Neurath seine Enzyklopadie im Sinne von Leibniz zu verstehen, denn sein Ziel besteht darin, das .Gerust" der Wissenschaft darzustellen sowie auch .neue Wege zu bahnen".
In diesem Fall kann man sich fragen, ob sich die neurathschen und carnapschen Vorstellungen gegenseitig ausschliel3en. Wie kann man die Vorstellung von der Enzyklopadie als einer Koordination der ver- schiedenen Wissenschaften mit der Ablehnung des Systems als sol- chem in Einklang bringen? Ab seinem Artikel .Einheit der Wissenschaft als Aufgabe" lehnt Neurath das System ganz offensichtlich und definitiv ab. Er legt grol3en Wert auf den Gedanken, dass die Einheit der Wis- senschaft kein deduktives System darstellt, im Sinne des von Carnap und auch Leibniz entworfenen Systems. Fur beide geht es namlich darum, die Ableitbarkeit aller Wahrheiten aus ursprunglichen Grund- wahrheiten zu beweisen. Neurath hingegen ist der Ansicht: .Das Sys- tem ist die grol3e wissenschaftliche ~ u ~ e . " ~ * Wie kann er das System verleugnen und gleichzeitig das Gerust der Wissenschaft und ihre inne- ren Zusammenhange aufzeigen wollen, indem er, laut seiner eigenen Aussage, fur eine .logische Ausgestaltung der ~ i ssenscha f t "~~ arbei- tet?
Fur ihn ist nicht die Tatsache uber ein System an sich zu sprechen absurd, sondern die Tatsache uber ein einziges System der Wissen- schaft zu sprechen, denn er vertritt die Ansicht ,,ales bleibt mehrdeutig und in vielem unbe~timrnt."~~ Die Enzyklopadie ist zunachst einmal pluralistisch. Mehrere Formen sind gleichzeitig moglich. In diesem Zu-

21 4 MBlika Ouelbani
sammenhang muss man meiner Ansicht nach daran erinnern, dass das von Carnap beabsichtigte System immer nur ein Vorschlag war und dass der Physikalismus lediglich eine Wahl und keine Notwendigkeit darstellte. Auaerdem ist die neurathsche Enzyklopadie provisorisch, evolutiv und im Gegensatz zu Carnaps System und seiner vereinheitli- chenden Sprache nicht rein, denn die Alltagssatze gehoren dazu und konnen nicht entfernt werden. Die Enzyklopadie ist folglich weder ein- zigartig noch rein. Neurath strebt die Vereinheitlichung der Wissen- schaftsterminologie in einen Universalslang an, der sowohl wis- senschaftliche als auch alltagliche Begriffe enthalt. In .Die Enzyklo- padie als Modell", lehnt Neurath 1936 den Begriff des antizipierten Sys- tems ab und stellt irn Gegenteil fest: Jnser Prograrnm ist das folgende: Kein System von oben, aber eine Systematisierung, die von unten ihren Ausgang nirnmt."31
Es geht also nicht nur darum, die verschiedenen Wissenszweige in einer ljbersicht darzustellen, sondern vorrangig darurn zu beweisen, inwieweit man die derzeitige Wissenschaft vereinheitlichen kann, indem man ihre inneren Verflechtungen aufzeigt. Neurath stellt fest, dass die Mittel der Logik und die rnodernen Mittel der bildlichen Darstellung hier- zu unumganglich sind. Sie hatten A. Comte und H. Spencer gefehlt. Sie hatten m a r an den Gedanken eines Gesamtbildes der empirischen Wissenschaften gedacht, konnten diese Arbeit jedoch nicht bewerk- stelligen.
In seinem Text .Die neue Enzyklopadie" aus dem Jahr 1937, erlau- tert Neurath sein Enzyklopadieprojekt naher und nimmt vielleicht deutli- cher Abstand von Carnaps Vorstellung. Er tritt mit seinem Projekt das Erbe der franzosischen Enzyklopadisten an, mit dem Anspruch ihr Werk fortzufihren. Neurath distanziert sich in diesem Artikel deutlich von seiner fruheren Vorstellung. Es geht fur ihn nicht mehr wie in seiner ursprunglichen Auffassung darum, Schritt fur Schritt ein System zu schaffen oder zu erstellen. Diese Enzyklopadie besteht vielmehr aus einzelnen Artikeln, die dank eines Meinungsaustausches zwischen den verschiedenen Mitarbeitern soweit wie moglich miteinander in Be- ziehung stehen. Die Terminologie muss ihrerseits selbstverstandlich vereinheitlicht ~ e r d e n , ~ ~ was bei seinen Vorgangern nicht der Fall war.
Es uberrascht, dass Carnap, obwohl er damals mit Neurath und Morris zusammenarbeitet, zur gleichen Zeit in "Logical foundation of the unity of science" weiterhin daran festhielt, dass die Einheit der Wis- senschaft eine theoretische, logische Einheit darstellt, d.h. dass sie ausschliel3lich die logischen Beziehungen zwischen den Begriffen be- trim. Er hat offenbar also seinem Reduktionismus nicht abgeschworen.

Carnap und die Einheit der Wissenschaft 21 5
Der Artikel enthalt jedoch einige neue, bedeutende Gedanken. So wird z.B. die Reduktion der Gesetze als denkbar angesehen, selbst wenn sie zur Zeit noch nicht machbar ist. Oder die praktische Rolle, die die Einheit der Wissenschaft ubernehmen kann. Dieser Gedanke kommt im folgenden Absatz, der wie eine Paraphrase Neuraths klingt, zum Ausdruck: .The practical use of laws consists in making predicti- ons with their help. The important fact is that very often a prediction cannot be based on our knowledge of only one branch of science.u33
In dern Text .Zur Klassifikation von ~ ~ ~ o t h e s e n s ~ s t e m e n " ~ ~ aus dern Jahr 1915, dessen Stil an Leibniz erinnert, bedauerte Neurath schon, dass uns eine Darstellung fehlt, dank derer wir unsere Kennt- nisse maximal nutzen konnen. Es wurde, wie Leibniz vorgeschlagen hatte, ausreichen, die uns zur Verfugung stehenden Wahrheiten besser zu ordnen. Dann waren wir in der Lage das Wesentliche unserer Kenntnisse besser zu erkennen, die dazugehorigen Zusammenhange schnell aufzuzeigen und sogar neue Kenntnisse zu entwickeln.
Die Vorstellung von den Zusammenhangen zwischen den verschie- denen Wissenschaften ist sicherlich von Leibniz, hauptsachlich aber auch von Diderot und dSAlembert beeinflusst, denn Leibniz' Projekt von der Ableitbarkeit der Wahrheiten aus den gleichen Grundwahrheiten entspricht meiner Ansicht nach eher dern Projekt Carnaps. Die von Neurath entworfene Enzyklopadie ist pluralistisch und nicht definitiv, was in seiner Kritik an Carnaps System zur Vereinheitlichung der Wis- senschaften zum Ausdruck kommt. Was bedeutet das?
Die franzosische Enzyklopadie war nicht einfach nur ein Worter- buch. Sie beschrankte sich namlich nicht nur darauf das Wissen ihres Zeitalters zu sammeln. Sie hatte auch hauptsachlich zum Ziel, es in geordneter Form darzustellen, d.h. in Form eines koharenten Ganzen. Diderots Artikel Encyclopedic definiert sie klar als .Verkettung von Wis- senu. Diesen Gedanken findet man sowohl bei Neurath als auch bei Carnap oder Schlick wieder. Das Wesentliche, das von Neurath uber- nommen wurde, ist die von d9Alembert in Le discours preliminaire un- terstrichene Tatsache, dass es nicht nur eine einzige Verkettung, son- dern mehrere gibt. Dabei ist keine dieser Verkettungen vorrangig. Dies hat Neurath zu der Aussage veranlasst, dass nicht das System, son- dern die Enzyklopadie als Modell ubernommen wird. Er spricht von einem Stammbaum, der alles Wissen unter einem bestimmten Ge- sichtspunkt zusammenfasst, mit dern Ziel, seine sehr komplexen Ur- sprunge und Verflechtungen aufzuzeigen. Diesen Gedanken findet man auch bei Leibniz. Er vergleicht unser Wissen mit einer unaufgeraumten Bibliothek. Fur Leibniz kann

21 6 MBlika Ouelbani
die gleiche Wahrheit, je nach den verschiedenen Zusammenhan- gen, in die sie eingebettet sein kann, an vielen Platzen eingeordnet werden. Diejenigen, die eine Bibliothek einraumen, wissen oftmals nicht, wo sie einige Bucher einordnen sollen, da sie sich nicht mi- schen zwei oder drei gleichermal3en angemessenen Platzen ent- scheiden k ~ n n e n . ~ ~
D'Alembert spricht auch von einem Labyrinth, das uber mehrere Ein- gange verfugt. Dadurch sind gleichzeitig mehrere Systeme moglich, je nachdem welche Sichtweise man wahlt.
Man kann sich folglich so viele Systeme menschlichen Wissens vorstellen, wie es Weltkarten mit verschiedenen Projektionen gibt. Jedes dieser Systeme kann sogar, abgesehen von den anderen, besondere Vorteile bieten.36
lnsofern kann es fur Neurath keine bevorzugten Protokollsatze geben, die eine Sonderstellung einnehmen, da sie in gewisser Weise aul3er- halb des Systems stehen, und auf die alle anderen Satze mit Hilfe von iJbersetzungsregeln zuruckgefuhrt werden konnen.
Zusammenfassend mochte ich feststellen, dass man nicht von einer neopositivistischen Philosophie oder einer Lehre sprechen kann, die von allen Mitgliedern des Wiener Kreises vertreten wurde. Sie vertraten in Wirklichkeit einige Grundprinzipien, die man auf genau m e i Theo- reme zuruckfiihren kann: das Sinntheorem, fur das der Wahrheitswert ein Pradikat der empirischen und analytischen Satze ist, und das Basis- theorem, das das Erkenntnisprinzip ausspricht, demzufolge jegliche Erkenntnis nur durch Erfahrung gewonnen wird. lnsofern kann man auch nicht von einer einzigen Vorstellung der Einheit der Wissenschaft sprechen, obwohl es Aufgabe der Philosophie ist, diese Einheit herzu- stellen.
Man konnte annehmen, dass die Unterschiede zwischen den ak- tivsten Mitgliedern des Wiener Kreises, Carnap und Neurath, ihre jewei- ligen Vorstellungen von den Protokollsatzen betraf und dass ihr Streit sich auf die Verteidigung einer phanomenalistischen oder physi- kalistischen These beschrankte. Carnap selbst scheint dies geglaubt zu haben. Wenn dies der Fall gewesen ware, hatten ihre Meinungsver-

Carnap und die Einheit der Wissenschaft 21 7
schiedenheiten mit Carnaps Anschluss an den Physikalismus beigelegt sein mussen. Dies war jedoch nicht der Fall, denn ihre Ziele stimmten in Wahrheit namlich ganz und gar nicht iiberein. Carnap wollte die Wis- senschaftssatze einheitlich formulieren oder neu formulieren. Diese ~bersetzung ermoglicht eine Art philosophische, d.h. erkenntnismafiige Rechtfertigung nicht jedoch die empirische ijberprufung der Aussagen. Diese Vorstellung ging selbstverstandlich mit einer Vorstellung der Protokollsatze einher, die sich von der Neuraths unterschied. Fur Car- nap ist die Einheit der Wissenschaft theoretisch, rational und schema- tisch3' und die gegenseitige Ableitung der Begriffe aus anderen Begrif- fen entspricht nicht der Realitat. Die Vorstellung von der Einheit der Wissenschaft als einer Enzyklopadie hingegen hat eine praktische, padagogische Dimension, da eines ihrer Hauptanliegen darin bestand, die Wissenschaftssprache der Alltagssprache an~unahern .~~ lnsofern hat die Enzyklopadie keinerlei logische Grundlage, .es ist", laut Neu- rath, ,die Lebenspraxis, die uns eine bestimmte Enzyklopadie auf- zwingt".
Wie kann man angesichts dieser Tatsachen erklaren, dass Carnap tatsachlich eine internationale Enzyklopadie der Einheitswissenschaft mit 0. Neurath plante? Carnap hat meiner Ansicht nach 1936 sein Pro- jekt scheinbar aufgegeben. Er hatte es ohnehin offenbar immer von allen anderen Vereinheitlichungsprojekten unterschieden. Dies kommt in seiner Autobiographie klar zum ~usdruck,~' als er schreibt, dass niemand aufier Nelson Goodman in The Structure of Appearance aus dem Jahre 1951 im Sinne seines Aufbaus gearbeitet hatte. Mit dieser Behauptung muss er gleichzeitig zugeben, dass sein Projekt nie das Projekt Neuraths gewesen ist, obwohl er versucht hatte, ihre Diffe- renzen zu minimieren. Er erklart im ubrigen, dass er sich selbst nicht mehr mit den in diesem Werk behandelten Problemen beschaftigt hat- te, da er seinen Phanomenalismus, aus ubrigens nicht ganz ein- deutigen Grunden, zugunsten des Physikalismus aufgegeben hatte. Der tatsachliche Grund bestand jedoch hauptsachlich darin, dass die Probleme des im Aufbau behandelten Systems jegliches lnteresse fur ihn verloren hatten. In seinem Artikel .On testabilityu aus dem Jahr 1936, hebt er den offenen Charakter der wissenschaftlichen Begriffe, ihre unvollstandige Interpretation und insbesondere die Unmoglichkeit der ~bersetzung wissenschaftlicher Aussagen in Beobachtungstermini hervor.
Aus der Tatsache, dass er sich den Enzyklopadieprojekten Neu- raths anschloss, kann man folgern, dass er sich fur ein Projekt ent- schieden hatte, das sich vollkommen von dem Projekt unterschied, das

21 8 MBlika Ouelbani
bis etwa 1935 mehr oder weniger sein Projekt gewesen ist, auch wenn er dies offenbar ohne groBe ijberzeugung getan hatte. Das ehrgeizige Monumentalprojekt Neuraths seinerseits ging mit ihm unter.
Anmerkungen
1. R. Camap, Der logische Aufbau der Welt, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1961. - 2. Idem., 92. 3. Ibidem und §35 .Ein Gegenstand heiRt auf andere ,zurijckfuhrbarl, wenn alle Satze
iiber ihn ubersetzt werden konnen in Satze. die nur von den anderen GegenstSnden sprechen."
4. Idem., 964 .Der wichtigste Grund hierfur liegt in der Absicht, durch dieses Konstituti- onssystem nicht nur eine logisch-konstitutionale Ordnung der Gegenstande zur Dar- stellung zu bringen, sondern auRerdem auch ihre erkenntnismaRige Ordnung."
5. Idem., $60 und 175-178. 6 . R. Camap, "Autobiography", in: Schilpp, The Philosophy of R. Carnap, La Salle,
London, Cambridge Uni. Press, 1963, S. 51. 7. Idem. 8. Idem., S. 51-52. 9. Siehe M. Ouelbani, .Von einigen Problemen in Carnaps Der logische Aufbau der
Welt", in: Grazerphilosophische Studien, Vol. 58159, 2000. 10. Carnap, Idem., S.16-20. I I . Siehe M. Friedman, Reconsidering logical positivism, Cambridge Uni. Press, 1999,
S. 94. 12. R. Carnap, .Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft", in:
Erk. 111, 1932. 13. 0. Neurath, .PhysikalismusU (in Scienta, Milano, 1931), in: Otto Neurath oder die
Einheit von Wissenschaff und Gesellschaft, Hg. Paul Neurath und Elisabeth Nemeth, Bohlau Verlag, Wien-Koln-Weimar, 1994, S. 369.
14. Idem., S. 372. 15. 0. Neurath, "Radikaler Physikalismus und wirkliche Welt", in: Erk. Bd. 4 , 1934, 92. 16. 0. Neurath, Protokollsatze, in: Erk. 1932133, in: H. Schleichert, Logischer Empiris-
mus. Der Wiener Kreis, W. Fink Verlag, Munchen, 1975. 17. R. Carnap, .Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft", in:
Erk. 1932. 18. Idem., 93. 19. Ibidem., .Die Nachprufung geschieht an Hand der Protokollsatze." 20. Idem., 92 et 7. 21. Idem. $5. 22. In: Actes du congr& international de philosophie scientifique de 1935, Hermann,
Paris, 1936. 23. 0. Neurath, .Soziologie im Physikalismus", in: Erk.1931, S. 398. 24. R. Carnap, ,,Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft", ox.,
95. 25. 0. Neurath, Idem., S. 402. 26. Idem., S. 395: .Ob z.B. die Verbrennung eines Waldes an einer bestimmten Stelle
der Erde in bestimmter Weise erfolgen werde, hangt ebenso vom Wetter wie davon ab, ob die Menschen Eingriffe vomehmen werden oder nicht. Diese Eingriffe kann

Carnap und die Einheit der Wissenschaft 21 9
man aber nur aussagen, wenn man Gesetze menschlichen Verhaltens kennt. Das heist, man muss unter Umstanden alle Arten von Gesetzen miteinander verbinden konnen. Alle, ob es nun chemische, klimatologische Gesetze sind, miissen daher als Teile eines Systems, namlich der Einheitswissenschaft, aufgefasst werden." Neurath greift genau den gleichen Gedanken mit dem gleichen Beispiel iiber die Vorhersage eines Waldbrandes beim Congres international de philosophie scientifique de 1935,, Einzelwissenschaften, ~inheitswissenschaft, ~seudorationalismus, I, S. 58 auf. 0. Neurath. .Une encvclo~&lie intemationale de la science unitaire", in: Conclr6s de philosophie' scientifiqbk d i 1935, O.C.
- 0. Neurath, "Einheit der Wissenschaft als Aufgabeu, in: Otto Neurath oder die Einheit von Wissenschaft und Gesellschaft, Hg. Paul Neurath und Elisabeth Nemeth, o.c., S. 376. Idem., S. 381. Ibidem. 0. Neurath, .Die Enzyklopadie als Modell", in: Otto Neurath oder die Einheit von Wissenschaft und Gesellschaft, ox., S. 393. Idem., S. 372. 0. Neurath, .Die neue Enzyklopadie", in: Einheitswissenschaft, Hrg. J . Schulte und B. McGuinness, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992. S. 209: .Die Enzyklopadie wird aus einzelnen Arbeiten bestehen, die durch Meinungsaustausch der Mitarbeiter in moglichst nahe Beziehungen gebracht werden sollen. Die Terrninologie ... sol1 ... vereinheitlich werden.' R. Carnap, 'Logical foundation of the unity of science", in : Foundation of the Unity of Science, Ed. 0. Neurath, R. Camap and C. Morris, The Uni. Chicago Press, Chi- cagolondon, 1938, S. 61-62. In: 0. Neurath, in: Jahrbuch der philosophischen Gesellschaft an der Uni. Wen, 1914-1915, oder 'On the classification of system of hypothesis" in: Philosophical papers 1913-1946, Ed. R.S. Cohen and M. Neurath, Vienna Circle collection, V.6, Dordrecht-Boston-Lancaster, 1983. Leibniz, Nouveaux Essais, Gamier Flammarion, 1966, Ch. 21. D'Alembert, Discours prhliminaire. Siehe Carnap, Der logische Aufbau der Welt, o.c., 354 und Scheinprobleme in der Philosophie, F. Meiner Verlag, Hamburg, 1961, 32. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich dieser Aspekt auch im Manifest des Wiener Kreises wiedertindet. R. Carnap, Autobiography, in : Schilpp, o.c., S. 19.

THOMAS UEBEL
SOCIAL SCIENCE IN THE FRAMEWORK OF PHYSICALIST ENCYCLOPEDISM: SOME ANTI-REDUCTIONIST CONCERNS ALLAYED
1. Introduction
1932 was the year in which, under the banner of "unified science", Neurath started his public criticism of what he deemed to be the meta- physical deviations of Schlick and his followers in the Vienna Circle. Unified science, for Neurath, replaced philosophy. Since Neurath's version of this unity is, as he was soon to add, an "encyclopedic" con- ception, we may expect his replacement of philosophy also to have a characteristic Aufhebung. And since unified science was also "physical- istic" we must ask for the meaning both of encyclopedism and physical- ism.
Neurath's allusion to the great project of the French philosophes was wholly intended, of course, and at the time he was by no means the only Central European philosopher who considered the enlighten- ment a beacon in politically ever darkening days. Also in 1932, Ernst Cassirer published his own The Philosophy of the Enlightenment in which he made the following observations about the enlightenment conception of the role of unity in science.
The method of reason is thus exactly the same in this branch of knowledge [law, society] as it is in natural science and psychology. It consists in starting with solid facts based on observation, but not in remaining within the bounds of bare facts. The mere together- ness of the facts must be transformed into a conjuncture; the initial mere co-existence of the data must upon closer inspection reveal an interdependence; and the form of an aggregate must become that of a system. To be sure, the facts cannot simply be coerced into a system; such form must arise from the facts themselves. The principles, which are to be sought everywhere, and without which no sound knowledge is possible in any field, are not arbitrarily cho- sen points of departure in thinking, applied by force to concrete ex- perience which is so altered as to suit them; they are rather the general conditions to which a complete analysis of the given facts themselves must lead. The path of thought then, in physics as in

222 Thomas Uebel
psychology and politics, leads from the particular to the general; but not even this progression would be possible unless every particular as such were already subordinated to a universal rule, unless from the first the general were contained, so to speak embodied, in the particular. The concept of the "principle" in itself excludes that abso- lute character which it asserted in the great metaphysical systems of the 17C. It resigns itself to a relative validity; it now pretends to mark only a provisional farthest point at which the progress of thought has arrived - with the reservation that thought can also abandon and supercede it. According to this relativity, the scientific principle is dependent on the status and form of knowledge, so that one and the same proposition can appear in one science as a prin- ciple and in another as a deduced corrolary. "Hence we conclude that the point at which investigations of the principles of a science must stop is determined by the nature of the science itself, that is to say, by the point of view from which the particular science ap- proaches its object ... I admit that in this case the principles from which we proceed are themselves scarcely more than very primitive derivations from the true principles which are unknown to us, and that, accordingly, they would perhaps merit rather the name of con- clusions than that of principles. But it is not necessary that these conclusions be principles in themselves; it suffices that they be such for us." [fn.] Such a relativity does not imply any skeptical per- ils in itself; it is, on the contrary, merely the expression of the fact that reason in its steady progress knows no hard and fast barriers, but that every apparent goal attained by reason is but a fresh start- ing point. (1932 [IgSI, 21-2, italics added]. The quote is footnoted: "DIAlembert, "Elements des Sciences," Encyclopedie, Paris, 1755, V, 493. Cf. Elements de Philosophie, IV, Melanges de lift&ature, d'histoire et de philosophie IV, 35f.)
Noting that "The self-confidence of reason is nowhere shaken. The rationalistic postulate of unity dominates the minds of this age. The concept of unity and that of science are mutually dependent." (ibid., 22- 3), Cassirer portrayed the enlightenment stance as the joint affirmation of the theses of methodological monism accros the sciences, anti- conventionalist realism, and a somewhat underspecified unification of the different disciplines. What he called "relativism" is the provisionality of any result on the forward and presumably cumulative march of rea- son. While this is not simple-minded inductivism, it's not fallibilism ei- ther.

Social Science in the Framework 223
What Cassirer ascribed to the enlightenment mind then is, from our contemporary point of view, despite the liberation from the dogmatic traditions which it promises, a fairly traditional conception of scientific knowledge. It is not far off from the epistemic idol of modernity, that very conception which entered a period of severe crisis around the previous fin-de-siecle from which it never recovered. Cassirer's enlight- enment mind rejected the claim of previous philosophies or metaphysi- cal systems to completeness, but not yet their aim of being built on certain and universal principles. Whether therefore the enlightenment rejected the idea and ambitions of "first philosophyn, is despite its mostly robust empiricism, far from clear. By contrast, many twentieth century philosophers of science gave up on certainty and came to relax its demands on the explanatory tools of science and proudly claimed their naturalistic emancipation from first philosophy.
While Cassirer celebrated the philosophy of the enlightenment as a propaedeutic to transcendental idealism and rejected its naturalistic tendencies, Neurath promoted his own conception of the unity of sci- ence as fortifications of the empiricist spirit against all idealisms, includ- ing Kant's. Since, as noted, Neurath also appealed to the great histori- cal example of the French Encyclopedic of the eighteenth century, it is only natural to ask: how far did he seek to emulate their ideal of scien- tific knowledge and how far did he himself press the agenda of the twentieth century? We know that he was a fallibilist of the first genera- tion and his opposition to first philosophy and his sponsorship of natu- ralistic empiricism was proclaimed loud and clearly. But what of his idea of the unity of science? Was his a methodological monism and would his conception of the unification of the sciences allow different disci- plines sufficient autonomy?
Here I wish to pursue this question by considering the fate of social science in Neurath's physicalistic encyclopedism. My thesis is that it was to a large part precisely his concern with social science that prompted Neurath to develop his encyclopedic conception and to insist on the constraints of physicalism. Far from making it difficult to pursue social science, the framework of physicalist encyclopedism was de- vised in order to allow social science to take its place in unified science.
2. Encyclopedism
Neurath - and in this he was largely joined by Carnap, Frank and Hahn - intended philosophy to join science as its metatheory. Science retains

224 Thomas Uebel
its autonomy from speculative philosophy by recognizing that reflection about its own procedures and principles belongs to itself as its metatheory. Neither does science remain merely positive, nor is all philosophy discarded. Philosophy is retained as second-order reflec- tion, even though its former claim to a separate source of knowledge was rejected most energetically. What remains of philosophy becomes either a formal reconstruction of scientific reason, what Carnap called the "logic of science", or an empirical theory of science, what Neurath called its "behavioristics". This suggests that we take as the Leitmotiv for encyclopedism an anti-reductionistic conception of unity, unity in diversity. Accordingliy, unified science encompassed distinct inquiries at different levels and thereby retained what was retainable of philoso- phy.
But what was the internal structure of the unification of the first- order sciences? The standard conception of the unity of science envis- aged this unity as a pyramid of reductively related disciplines with phys- ics at the base. Accordingly it demanded, at least in principle, the re- duction of sociological laws to those of physics (such that sociological laws are but shorthand for a complex amalgam of physical laws). By contrast, already in 1931 Neurath rejected the pyramid model:
The development of physicalistic sociology does not mean the transfer of the laws of physics to living things and their groups, as some have thought possible. Comprehensive sociological laws can be found as well as laws for definite narrower social areas, without the need to be able to go back to the microstructure, and thereby to build up these sociological laws from physical ones. (1932a [1983, 751)
Two things are important here: the rejection of the postulate of the re- ducibility of the laws of social science to those of physics and the rejec- tion of the postulate of methodological individualism (in one of its guises).
Systematically speaking, the rejection of the reducibility of the laws of social science follows from the rejection of the reducibility of the indi- vidual terms of social science to those of physics. Even though he does reject term-by-term reduction (I discuss this below), Neurath owes us an explicit argument to this effect. Yet significantly enough he also wrote: "One can understand the working of a steam engine quite well on the whole without surveying it in detail. And indeed, the structure of a machine may be more important than the material of which it con-

Social Science in the Framework 225
sists." (1 931 a [ I 973, 3331) The explanatory kinds or principles invoked in social science need not be reducible to those concerning material constituents. By stressing this, Neurath sought to allow for the possibil- ity of functional and structural analyses and explanations that were being explored at the time in Durkheimian sociology and anthropology and that had long been a mainstay of Marxist analysis. (How precisely legitimate forms of such explanations would go is another matter, of course.)
It is also highly significant that Neurath recognised a variety of types of scientific laws. First, all along Neurath accepted both determi- nistic and probabilistic or stochastical laws. "We are always searching for correlations between magnitudes that occur in the physicalist de- scription of events. It makes no difference in principle whether the de- scriptions are statistical or non-statistical." (1932a [1983, 681) On this point, of course, he was in agreement with other logical empiricists, then and later. Second, Neurath did not require that laws across the sciences be the same in their scope. When he spoke of "laws for defi- nite narrower social areas" (1 932a [1983, 751) he consciously endorsed a pluralist position on the question of the nature of scientific laws them- selves. For him they could range from the (quasi-) universal laws of physics to what Merton was to call "theories of the middle range". Thus he wrote: 'Let us not start from what one tends to call a 'law of nature', but those less demanding generalisations which are common in the social sciences. Results gained from a rather restricted range of exam- ples are extended to a further set of cases that also are fairly re- stricted." (1937 [1981, 7881) This allows for non-universal laws that are limited to certain spatio-temporal domains: "To be sure, most of the sociological regularities that help us in deriving predictions are formu- lated in such a way that they are valid only for relatively complex struc- tures in certain spatio-temporal areas." (1936b [1981, 7711; cf. 1932a [1983, 851) When expressing this view in the early 1930s - e.g., soci- ologists "can speak of 'social laws' which are valid for distinct social formationsn (1931a [1973: 3711) - he added: "We cannot yet indicate precisely on what certain correlations depend: 'historical period' = non- analysed complex of conditions." (1932a [1983, 851) Quite generally, given the associations of the term 'law' with exceptionless strictness, Neurath in fact preferred the generic term 'correlations'.
In arguing for non-universal laws, Neurath's background in the so- cial sciences is evident. Yet it is also on this point that a central dis- agreement obtains with Menger and the school of Austrian economics as well as with popper.' It is important to note that Neurath issued this

226 Thomas Uebel
pluralist ruling for more reasons than the beneficial consequence it has for the inclusion of social science in unified science. Quite generally, applying laws or lawlike generalisations, for Neurath meant to presume as constant certain background conditions. For this reason the social sciences cannot claim the same degree of universality as physics or even biology: the boundary conditions of its generalisations are them- selves more likely to undergo alteration. That, however, does not lessen the participation of the social sciences in unified science (the connectability of its generalisations with those of other disciplines): astronomical laws too presume the constance of certain boundary con- ditions (1 936b [ I 981, 7721). With full generality therefore Neurath stated that "our scientific practice is based on local systematizations only, not on overstraining the bow of deduction." (1 946a [1983, 2321)
Neurath, this suggests, argued from the variety of explanatory prin- ciples and the heterogeneity of laws to the nomological irreducibility of social science. He did not only invoke the distinction between the con- texts of discovery and justification such that only in the latter intertheo- retic reductions of laws are required (as may be suspected), when he noted: "The sociological laws found without the help of physical laws in the narrower sense must not necessarily be changed by the addition of a physical substructure discovered later." (1932a [1983, 751) Indeed, he even declared cautiously: "According to physicalism, sociological laws are not laws of physics applied to sociological structures, but they are also not simply reducible to laws about atomic structures." (1933, 106) Later, in his opening article in the International Encylopedia, he re- marked again: "Another question is to what extent one can reduce the statements or laws of biology, behaviouristics or sociology to physical statements or laws."* Whatever Neurath's encyclopedic unity was, it was not a reductive hierarchy of laws.
Yet nornological antireductionism also has a still more specific di- mension of relevance to social science, namely, the rejection of meth- odological individualism in its (conceptual and) nomological sense. Concerning sociological laws Neurath wrote: "Naturally certain correla- tions result that cannot be found with individuals, with stars or ma- chines. Social behaviourism establishes laws of its own kind." (1932a [1983, 751) Given the strenuous opposition to metaphysical social sci- ence in his Empirical Sociology (sect. V), where he explicitly opposed the invocation of the supra-individual entities that populated the rising vdkisch ideologies, it is clear that Neurath did not aim to support onto- logical holism of any kind. If anything, he too was an ontological meth- odological individualist. Rather, he stressed the nornological autonomy

Social Science in the Framework 227
of sociology or any other social science by pointing to the irreducibility of their laws to those of psychology. (Conceptual methodological indi- vidualism foundered on the irreducibility of social scientific concepts to psychological ones.)3
So much for the structure of encyclopedic unity, what about the qualitative difference between the sciences? Neurath did not require that social science be conducted just like natural science. "The pro- gramme of unified science does not presuppose that physics can be regarded as an example for all the science to follow." (1937 [1981, 7881) As noted above, social science has laws of varying scope and may have distinctive principles of explanation. Clearly, research ori- ented to non-universal generalisations may be of a different kind than that aiming for universal laws. Neurath's recognition of methodological pluralism finds expression in his stress that it would be mistake to hold social science to the standard achieved by physics and his admonition of collegues to also investigate sciences that do yet meet those exact- ing standards.
Sometimes one tends to prefer handling precise terms to such a degree that certain problems are avoided which are still structured less clearly. Certain phrases characteristic of the appreciation of art or of sociological considerations are thus discarded too quickly as being too vague and still too indeterminate and containing poten- tially metaphysical terms. But such incomplete reflexions often con- tain all the scientific results that so far achieved in this field and one should rather try to build on this. Of course, rigorous analysis by means of the logic of science is more satisfying when one turns to physics. (1 936c [ l98 l , 71 21)
Of course, in his Foundations of the Social Sciences he reemphasized his monistic conviction that the "procedure in all empirical sciences is the samen, but this simply expressed his widely shared empiricist con- viction, for immediately he went on: "yet there are questions of degree: some techniques may be applied more frequently in one science than in anothern (1944: 37). Whether these techniques included interpretive ones is an interesting question to which I turn below. (Just how exten- sive is Neurath's methodological pluralism?)
In sum, the encyclopedic unity envisaged by Neurath did not re- quire a reductive hierarchy of homogeneous laws (neither with physics nor psychology at its base). Nor did he require a strong form of meth- odological monism. For Neurath, the claim of unified science was mini-

228 Thomas Uebel
malist: "all laws of unified science must be capable of being linked with each other, if they are to fulfill the task of predicting as often as possible individual events or groups of events." (1932a [1983, 681) From this pragmatical base, Neurath's "encyclopedism" developed under its own name from the mid-1930s, characterised by the slogan "No s stem from above, but systematisation from below" (1 936a [1983, 1531). 2'
3. Physicalism
Physicalism has a number of different meanings in Neurath, but here we need to consider only what I call the metalinguistic n ~ t i o n . ~ Physi- calism in this sense concerns the language of unified science. It is im- portant to see the difference between Neurath and Carnap. For Carnap, "physicalismn meant that every language of science, that is the lan- guages of all its different disciplines, can be translated into the lan- guage of physics (1932a, 1932b). Importantly, Carnap never intended physicalism to make an ontological claim. Soon, of course, Carnap learnt that the original criteria of translatability had been conceived of too narrowly (1936). Originally, however, Carnap's physicalism required the complete translatability of the languages of all the sciences into that of physics, but this was gradually relaxed.
From the start, Neurath's metalinguistic physicalism was centered differently and linked closely to the empiricist criterion of meaningful- ness. Already at an early stage Neurath sought to allow for non- reductive forms of this criterion: "Physicalism ... only makes pro- nouncements about what can be related back to observation state- ments in some way or other." (1 931 a [ I 981, 425, italics added]) Beyond this, Neurath determined meaningfulness as inextricably linked to the availability of intersubjective evidence and he rejected the possibility of private protocol languages already in 1931 .6 In addition, he determined that the language in which such test procedures are formulated was to be not the language of physics itself, but the "physicalistically cleansed" everyday language. Neurath's conception of the physicalist language was not bound to the language of physics as such.
In place of Carnap's original criterion of translatability Neurath all along put testability. For him, physicalism did not represent a logical condition on the relation of individual expressions of high theory in the different disciplines of unified science, but an epistemological condition on the admissability of whole statements into unified ~c ience .~ Two points are notable here. First, Carnap's physicalism required the trans-

Social Science in the Framework 229
latability of individual terms. Originally, this amounted to the reducibility of all the terms of the special sciences to the terms of the language of physics. Neurath required only that admissable statements be logically related to statements that can be correlated as wholes with statements of the physicalistic common language of observation. From Neurath's physicalism therefore does not follow what follows from Carnap's: that all the individual terms admissable into unified science be definable (more or less directly) in the terms of physical theory.' Clearly, Neurath granted different disciplines - and so also the social sciences - their conceptual autonomy.
Second, for Neurath, physicalism expressed the condition of em- piricism. For him, physicalistic statements are statements about "spatio- temporal structures" (1 931 a [ I 981, 4251. Only those statements are admissable, that can be tested - or, as Neurath put it, "controlled" - by direct or indirect reference to intersubjectively available observational facts. It follows that also social scientific theories must allow for deriva- tions that can be formulated in the everyday language speaking of spa- tio-temporal structures and can be tested as such.
Physicalism encompasses psychology as much as history and eco- nomics; for it there are only gestures, words, behaviour, but no "mo- tives", no "ego", no "personality" beyond what can be formulated spatio-temporally. It is a separate task to ascertain what part of the traditional material can be expressed in the new strict language. Physicalism does not hold the thesis that "mind" is a product of "matter", but that everything we can sensibly speak about is spatio- temporally ordered. (Ibid. [1973, 3251)
Note that even though he spoke less carefully than Carnap, Neurath also sought to avoid ontological claims concerning the constitution of mental phenomena. Rather, he characterised admissable languages in terms of their domain. When Neurath claimed that "physicalism" repre- sented the "heirn and "logically consistent development of materialismn (1 932c [ l98l , 568]), he similarly meant a materialism cleansed of onto- logical claims, seeking to uphold some continuity with the philosophical tradition that was historically dominant in the workers' movement (1931a [198l, 467 only]).g But what of Neurath's seeming acceptance of the ontological version of methodological individualism - does this not make an ontological claim? Here it all depends how Neurath's re- jection of talk of Volksgeist etc. and his acceptance of talk of class is to be understood. I suggest that these need not be read as ontological

230 Thomas Uebel
claims, but again as characterisations of admissable and unadmissable languages by their domain. Languages that speak of supernatural forces or supraindividual agents simply will not be admitted into unified science for the reason that it is entirely unclear how such statements could be tested.
If this is right, then Neurath's physicalism too is anti-reductionist. Physicalism does not require a reductive hierarchy of concepts with physics at its base. Importantly, Neurath's adoption of the term "behav- iourism" is also to be understood in this spirit.
There is no longer a special sphere of the 'soul'. From the stand- point advocated here it does not matter whether certain individual tenets of Watson, Pavlov or others are maintained or not. What matters is that only physicalistically formulated correlations are used in the description of living things, whatever is observed in these beings. (1 932a [1983, 731)
"Behaviourism" for Neurath meant simply the limitation to physicalistic statements, that is, to statements about human activities as taking place in space and time.'' While he did not stress it early on, we may note that this includes talk of many of the 'intervening variables' which for the psychologists mentioned had become illegitimate. Thus note not only that Neurath was open in principle to Freud's psychoanalysis - he headed a working group dedicated to the 'physicalisation' of Freud's texts - but that his own theory of protocol statements makes explicit reference to intentional phenomena, not only via behaviourist circumlo- cutions like "speech thinkingn, but also directly "thinking person" etc.ll
This is not to deny that at some stages Neurath did flirt with a more traditional conception of behaviourism (or at least sounds like it). Even then, however, the intention was to make intentional phenomena ame- nable to empirical and non-metaphysical theorising.I2 Neurath was happy to follow Carnap's liberalisation of his earlier reductionist stric- tures and from about 1936 Neurath tended to prefer the term 'behav- iouristics' for its presumably less restrictive associations (19364 [1983: 1641; cf. 1944: 17, 51).13 By then he also stated:
While avoiding metaphysical trappings it is in principle possible for physicalism to predict future human action to some degree from what people "plan" or "intend1' ("say to themselves"). But the prac- tice of individual and social behaviourism shows that one reaches far better predictions if one does not rely too heavily on these ele-

Social Science in the Framework 23 1
ments which stem from "self-observation" but on others which we have observed in abundance by different means. (1936c [1981, 71 41)
In later years, Neurath made his anti-reductionist intention ever more explicit. Thus he noted that "[s]tatements of the type 'this entrance hall of a building thrills me' can be regarded as physicalist ones because they are observation statementsn (1941 [1983, 2211) and pointed out that "[hlistorians of human social life are highly interested in descriptive terms such as deal with the feeling-tone of persons, their devotion, their fear and hopesn (1 944, 1 5).
It was in this inclusive sense that Neurath continued to expound a "social behaviourismn that, as he put it early on, "ultimately compre- hends all sociology, political economy, history etc." (1932c [ l98l , 5651).
We can discuss historical and sociological problems in all details without being forced to use the terms "inner experience" and "outer experiencen or "oppositesn of equivalent scientific significance in forming boundary lines between sciences. That does not mean that we exclude what is called "inner experiencen. (1 939 [l983, 2091)
We may rightly be sceptical about the value of exclusive use of overtly behaviouristic procedures, of course; the point here is that Neurath's physicalism was not limited in this fashion.
I believe we do not overextend our sympathy if we interpret Neurath's physicalism as at least in intention a partial form of what nowadays is called "non-reductive physicalismn (that is, minus the lat- ter's unabashed 'metaphysical' dimension). Of course, Neurath did not employ many of the terms used in the exposition of the latter like 'su- pervenience' (ontological dependence without reducibility), but a careful assessment of his admittedly contrapuntal writings strongly supports what his intellectual biography suggests (from early on he was familar with the rough and nonformal functional definitions of social kinds that characterise Simmel's socio~ogy).'~ Neurath's physicalism allowed for the conceptual autonomy of the special sciences - within the frame- work of empiricism. For him the way was open to conduct social sci- ence in terms that transcend many of the limitations of mid-century social science that helped to turn "positivist" into the term of abuse it currently is.I5

232 Thomas Uebel
4. Neurath vs. Kaufmann on the Probity of Physicalist Social Sci- ence
I conclude by considering a criticism of Neurath's physicalism from a theorist of social science who was in fact loosely associated with the Vienna Circle. This episode is of significance beyond the rather puz- zling fact that these criticisms were published despite Neurath's patient efforts to show that they did not apply.I6 Incidentally, their author, Felix Kaufmann, was also a member of the Viennese Geistkreis other mem- bers of which took themselves to be well informed about the goings on in the Vienna Circle precisely because of Kaufmann's reports. One of these other members was F. A. Hayek whose own criticisms of Neurath's physicalism perpetuate Kaufmann's confusions."
Kaufmann objected to the "over-extensionn of the unity of science thesis due to the thesis of physicalism (1936, 139).18 AS a thinker deeply influenced by Husserl, he could not but object to determinations of cognitive probity that would rule out of bounds Wesensschau, the intuitive grasp of essences. Moreover, his conception of social science as "essentially" concerned with the interpretation of the actions of oth- ers required access to meanings (ibid., 167). Accordingly, he objected to physicalism, like behaviourism, as a form of naturalism that wrongly discounts "introspective experiencen for the reason that it is intersubjec- tively uncontrollable and therefore unscientific because it is not open to external observation (1 936, 132, 137). By contrast, Kaufmann held that the statements by which psychological assertions can be controlled are not exclusively physicalistic ones, i.e. about the behaviour of physical bodies. But neither did it require a scientifically inexplicable process of empathy. Rather, what's required to afford control of statements arrived by empathy is a type of generalization that parallels those of natural science and in part relies on them, namely, "generalizations which con- cern empirical correlations between physical (outer) and psychological facts". It is reliance on this type of correlations that "distinguishes the methods of natural science from those of GeisteswissenschafY' (ibid., 138).
Two things are notable here. First, that Kaufmann's concept of Geisteswissenschaft did not require the radical separation of social science from natural science, but only demanded stressing methodo- logical differences. Second, that the correlations whose employment accounts for that difference make an irreducible reference to psycho- logical states and treat them not as names for behavioural dispositions but as (theoretical) entities in their own right. The question of the valid-

Social Science in the Framework 233
ity of Kaufmann's critique of Neurath's physicalism and the unity of science thesis thus turns on how reductive Neurath's physicalism is understood to be.''
Now if it is correct to view Neurath - in the light of both his later statements and his earlier examples (which would be ruled out were one to adopt a restrictive readingl2' - as aiming for a version of non- reductive physicalism, then Kaufmann's objections are answered. That it is correct to read Neurath in this way is also shown by his correspon- dence with Kaufmann in 1935, commenting on a draft of Kaufmann's book on the methodology of social science. There Neurath stressed explicitly that his physicalism allowed for talk of thoughts and other intentional states; moreover, it allowed it not only in the first person case but in the case of other minds as well. Furthermore, his physical- ism allowed not only conscious but also unconscious intentional states: "'Unconscious thinking' - a physicalistic term."21 Relatedly he wrote to ~ a r n a p : ~ ~
"Formulations" are not speech movements. I chose this term in place of speech-thinking in order to allow of all sorts of states to be designated thereby, as long as spatio-temporal processes [are in- volved]. That's what matters and only that. For instance, [formula- tions may designate] a representational state, a feeling state etc. And just that is what Kaufmann can't agree to.
In a later letter Neurath addressed Kaufmann's concerns about the supposedly special problems of intentiona~ity.~~ Again he stressed that he intended intentional states - under their intentional description - to figure in physicalist social science. There does not therefore appear to remain disagreement about physicalism between Neurath and Kauf- mann, despite the claims of the latter. (Unless we were to attribute to him the metaphysical ambitions of dualism or disembodied meanings, it is difficult to see what more Kaufmann could have wanted.) Of course, this de facto agreement need not have reached far, for this is not yet to say that Kaufmann's own conception of social science was acceptable by Neurath's standards.
As for Kaufmann, in turn, it is difficult to say why he did not accept Neurath's rebuttal of his criticism. It has been noted in the literature that his Methodenlehre attacked early positions which by the mid-30s had been given up by Carnap and I may add that he did not follow the de- velopment of Neurath's thinking on the methodology of social science beyond the early 3 0 s . ~ ~ Yet for some interpreters, a letter to Carnap

234 Thomas Uebel
shows Kaufmann expressing disdain at the supposed "trivialisation" of physicalism by what Carnap called its "~iberalisation".~~ If physicalism did not deny any evidential probity to introspection, but only demanded "special care in using introspection statements", Kaufmann would not, of course, object, since then "even the (later) Husserl, Max Weber, indeed all serious scientists and philosophers would be This judgement overshoots the mark, however, for there is more to physicalism than its view on whether introspection statements may count as evidence statements for science. Given physicalism's com- mitment to empiricism, Husserl's enthusiasm for it may be doubted and given its practical convergence (but not identity) with the ontological version of methodological individualism, Weber's controversial study of protestantism is ruled out on at least one reading. Once this is noted, it becomes more than dubious whether, as Kaufmann had it, "all serious scientists and philosophers would be physicalists". Moreover, it also is not trivial at all that the views on social science by, on the one hand, ontological holists like Othmar Spann and, on the other, anti-causalist interpretivists like the early Peter Winch are rejected still by non- reductivist physicalist encyclopedism.
It is true, of course, that my reconstruction of what physicalism means for Neurath and how it joins forces with his encyclopedism dif- fers from how his writings of the early 1930s were read by Kaufmann (and Hayek) and widely are read still today. But that only shows that contextualisation is required even and especially for his remarks from that period so as to reveal his intent, which his later, more accomodat- ing statements about physicalism make explicit. Furthermore, it need not be denied that Neurath, like Carnap, underwent a learning process in this regard. Yet the continuity of purpose cannot be denied that unites Neurath's thought about physicalism early and late. For typically, it was the restrictive versions of behaviourism - never the appeals to intentional phenomena - that were given up, once it was found that the reductive criteria failed by which the recourse to intentional phenomena was to be safeguarded from metaphysics. Thus, just as we can read Cassirer as endeavoring all along to cleanse transcendental idealism from its more or less accidental limiting accretions, so we can read Neurath (and some of his Vienna Circle colleagues) as trying through- out to cleanse empiricism of limiting but inessential accretions of its own.

Social Science in the Framework 23 5
Bibliography
Cassirer, E, 1932, Die Philosophie der Aufklarung, Mohr, Tiibingen, trans. The Philosophy of the Enlightenment, Princeton University Press, Princeton, 1951.
Carnap, R., 1932a, "Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft", Erkenntnis 2, 432-465, trans. The Unity of Sci- ence, Kegan, Paul, Trench and Teubner & Co., London, 1934.
Carnap, R., 1932b, "Psychologie in physikalischer Sprachen, Erkenntnis 3, 107-1 42, trans. "Psychology in Physicalist Languagen, in A.J.Ayer (ed.), Logical Positivism, Free Press, New York, 1959, 165-1 98.
Carnap, R. 1938, "Logical Foundations of the Unity of Sciencen, in In- ternational Encyclopedia of Unified Science , vol. 1 no.1, University of Chicago Press, Chicago, 42-62.
Carnap, R., 1963, "Intellectual Autobiography", in P.A. Schilpp (ed.), The Philosophy of Rudolf Carnap, Open Court, La Salle, 111. 3-84.
Dahms, H.-J., 1997, "Felix Kaufmann und der Physikalismus", in F. Stadler (ed.), Phanomenologie und Logischer Empirismus. Zente- narium Felix Kaufmann, Wien: Springer, 97-1 14.
Frenkel-Brunswik, E., 1954, "Psychoanalysis and the Unity of Science." In: Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 80.
Hajek, F.A., 1941-1944, "Scientism and the Study of Society", Economica 9-1 1, repr. as Part One of The Counter-Revolution of Science. Studies in the Abuse of Reason, Free Press, New York, 1952, 2nd ed. Liberty Fund, Indianapolis, 1979.
Hempel, C.G., 1969, "Logical Positivism and the Social Sciences", in P. Achinstein and S.F. Barker (eds.), The Legacy of Logical Positiv- ism, John Hopkins Press, Baltimore, 163-1 94.
Helling, I., 1985, "Logischer Positivismus und Phanomenologie: Felix Kaufmanns Methodologie der Sozialwissenschaftenn, in Dahms (ed.), Philosophie, Wissenschaft, Aufklarung, De Gruyter, Berlin, 1985, 237-256.
Kaufmann, F., 1936, Methodenlehre der Sozialwissenschaften, Wien: Springer.
Kaufmann, F., 1944, Methodology of the Social Sciences, New York: Oxford University Press.
Neurath, O., 1931, Empirische Soziologie. Der wissenschaftliche Ge- halt der Geschichte und Nationalokonomie, Wien: Springer, repr. in Neurath 1981, 423-527, excerpts trans. "Empirical Sociology" in Neurath 1973, 31 9-421.

236 Thomas Uebel
Neurath, O., l932a, "Soziologie im Physikalismusn, Erkenntnis 2, trans. "Sociology in the Framework of Physicalism" in Neurath 1983, 58- 90.
Neurath, O., 1932b, "Protokollsatze", Erkenntnis 3, trans. "Protocol Statementsn, in Neurath 1983, 91 -99.
Neurath, O., 1932c, "Sozialbehaviorismus", Sociologicus 8, repr. in Neurath 1981, 563-570.
Neurath, O., 1933, "Das Fremdpsychische in der Soziologie" [unsigned abstract], Erkenntnis 3, 106-7.
Neurath, O., 1935, "Einheit der Wissenschaft als Aufgabe", Erkenntnis 5, repr. in Neurath 1983, 1 15-1 20.
Neurath, O., l936a, "L'encyclopedie comme 'modele'", Revue de Syn- these 12, trans. "Encyclopedia as 'Model"', in Neurath 1983,145- 158.
Neurath, O., 1936b, "Soziologische Prognosenn, Erkenntnis 6, repr. in Neurath 1981, 771 -776.
Neurath, O., 1936c, "Mensch und Gesellschaft in der Wissenschaft", in Actes du Congres International de Philosophie Scientifique, Sor- bonne, Paris 1935, Fasc. II, Unite de la science, Herrmann, Paris, repr. in Neurath 1981, 71 1-718.
Neurath, O., 1936d, "Physikalismus und Erkenntnisforschung", Theoria 2, trans. "Physicalism and the Investigation of Knowledge" in Neurath 1983, 159-1 71.
Neurath, O., 1937, 'Prognosen und Terminologie in Physik, Biologie, Soziolog ien, in Travaux du IXe Congres lnternational de Philoso- phie, Herrmann, Paris, repr. in Neurath 1981, 787-794.
Neurath, O., 1938a, "Unified Science as Encyclopedic Integrationn, in lnternational Encyclopedia of Unified Science, vol. 1, no.1, Univer- sity of Chicago Press, Chicago, 7-27.
Neurath, O., 1939, "The Social Sciences and Unified Sciencen, Journal of Unified Science (Erkenntnis) 9, repr. in Neurath 1983, 209-21 2.
Neurath, O., 1941, "Universal Jargon and Terminology", in Neurath 1983, 21 3-229.
Neurath, O., 1944, Foundations of the Social Sciences. lnternational Encyclopedia of Unified Science, vo1.2 no.1, Chicago.
Neurath, 0 , 1973, Empiricism and Sociology (M. Neurath and R.S. Cohen, eds), Reidel, Dordrecht.
Neurath, O., 1981, Gesammelte philosophische und methodologische Schriften (R. Haller, H. Rutte, eds.), Holder-Pichler-Tempsky, Wien.
Neurath, O., 1983, Philosophical Papers 1913-1946 (R.S. Cohen and M. Neurath, eds.) Reidel, Dordrecht.

Social Science in the Framework 237
Uebel, T. E., 1 992, Overcoming Logical Positivism rom Within. The Emergence of Neurath's Naturalism in the Vienna Circle's Protocol Sentence Debate, Rodopi, AmsterdamIAtlanta.
Uebel, T. E., 1993, "Neurath's Protocol Statements: A Naturalistic The- ory of Data and Pragmatic Theory of Theory Acceptance", Philoso- phy of Science 60, 587-607.
Uebel, T. E., 1995, "Physicalism in Wittgenstein and the Vienna Circlen, in K. Gavrolgu, S. Schweber, M. Wartofsky (eds.), Physics, Phi- losophy and the Scientific Community, Kluwer, Dordrecht, 327-356
Uebel, T.E., 2000, "Some Scientism, Some Historicism, Some Critics: Hayek's and Popper's Critiques Revisitedn, in M. Stone and J. Wolff (eds.) The Proper Ambition of Science, Routledge, London, 151 - 173.
Uebel, T.E., 2003, "20th Century Philosophy of Social Science in the Analytical Tradition", in P.A.Roth and S.T. Turner (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Social Science, Blackwell, Ox- ford, 64-88.
Zilian, H.-G., 1990, Klarheit und Methode: Felix Kaufmann's Wissen- schaftstheorie, Rodopi, Amsterdam - Atlanta.
Notes
For some discussion see Uebel(2000). Neurath (1938, 19); 1 have replaced 'physicalistic" with "physical" since the latter seems clearly meant and the originally published text is likely to have been a transla- tion from the German to start with. According to Hempel, Neurath "refrained from making any general claims on the realizability of the program of methodological individualism" (1969, 174). My argu- ment suggests that, on the contrary, he did pass a differentiated judgement on dif- ferent aspects of methodological individualism. See also Neurath (1935, 115) for the first explicit proclamation of encyclopedism: "After the removal of traditional metaphysics, in constant struggle against meta- physical leanings, positive work could be our occupation, namely the creation of an encyclopedic synthesis of the sciences on uniform logical foundations." The ency- clopedic motive itself is already in evidence in (1931 (1973, 4041): "Everything does go in the direction of widening the scope of 'laws' and 'order' as nuch as possible, but without having any ideal situation as measure or goal." For some discussion of the other senses of physicalism see Uebel (2003). What I discussed as "encyclopedism" in the previous section amounts to the nomological sense of physicalism. A third, "meta-epistemologicaI" sense of physicalism is that of naturalism. For reconstructions of the latter argument in context, see Uebel(1992, 1995).

23 8 Thomas Uebel
That Neurath took entire statements as units of analysis in the early 1930s is re- vealed by an anecdote in Carnap (1963); still in his Foundations of Social Science Neurath stated that "whole sentences have to be translated into whole sentences" (1 944, 7). Incidentally, this difference also anticipates disputes between Carnap and Quine. Neurath's endorsement of Carnap's pyramidal system of concepts in (1931 [1973, 3901) was his last. It seems the consequences of his own contemporaneous argu- ments against Camap's methodological solipsism in the protocol sentence debate were not immediately obvious to him (see Uebel 1992, Ch. 6). Thus Neurath also sometimes spoke of "sociology on a materialistic basis" about which he also remarked that its main points can be communicated by a rendition of the materialistic conception of history (1931 (1973, 3631). Note that this interpretation is intended to be much more liberal than Hempel's read- ing: 'In Neurath's science of behavioristics, statements about phenomena of con- sciousness and about mental processes would be replaced by statements about spatio-temporally localizable occurrences such as macroscopic behaviour (including gestures and speech acts) and about physiologically and physiochemically de- scribed processes in the brain and the central nervous system" (1969, 170-1). As far as I can see, Neurath did not require the replacement of physicalistically understood psychological termini of the everyday language. For Neurath on psychoanalysis see Neurath (1932a [1983, 80]), (1939 [1983, 2101) and Frenkel-Brunswick (1954). On the intentional load of his protocol statements in (1 932b) and later, see Uebel (1993). Hempel rightly notes that "Neurath put mentalistic terms like 'mind' and 'motive' on the Index on the grounds that they tended to be construed as standing for immaterial agencies.." (1969, 169). Hempel rightly notes also that Neurath did not "explicitly offer [a Rylean] kind of dispositional construal" of psychological terms - even though "[slome of his sugges- tions are strikingly suggestive and remind one of ideas that Gilbert Ryle was later to develop much more subtly and fully ..." (1969, 170, 169). For instance, Neurath's ar- gument against hypostasizing the running of a watch (e.g., 1932a [1983, 731) ap- pears to anticipate Ryle's objections to invoking Cartesian ghosts in the body ma- chine. - . . . . . - . Attendance of Simmel's seminars is noted in a letter from Neurath to Ferdinand Tonnies. 31 October 1903. Tonnies Nachlass. Schleswia-Holsteinische Landesbib- liothek, ~ i e l .
- Just how much of 21st century sensibilities Neurath anticipated we may leave open. For example, we need not here adjudicate the seeming nomornania of his "Every scientific statement is a statement about a lawlike order of empirical facts" (1931 [ I 981, 4241). See the correspondence between Neurath and Kaufmann in the Neurath papers in the Vienna Circle Archives, Rijksarchif Noord-Holland, Haarlem (VCA). See Hayek (1 942-44 [ 1952,78,87-9, Ii'On). For present purposes I must disregard Kaufmann's English version of his mono- graph (1944) which was radically rewritten (and his phenomenological sympathies toned down) in the attempt to build a bridge to Deweyan pragmatism. It may be noted, though, that the anti-physicalist argument of (1936) is preserved in basic out- line in Chapter XI of (1944). Kaufmann was aware that physicalism was in a state of progressive liberalization; thus he noted an early use of Carnap's so-called reduction sentences and took this

Social Science in the Framework 239
to be a 'decisive turn" to the better. In his (1944) he explicitly comments to this effect on Carnap (1 938).
20. Consider, e.g., Neurath's talk of 'the very complex 'stimulus' of the way of life with slavery and .. the 'response' - keeping or freeing slaves - ..." or his pondering "how far the theological teachings concerning the emancipation of slaves can be taken into account as 'stimulus' and how far as 'response"' (1932a [1983,85]).
21. Letter Neurath to Kaufrnann of 21 June 1935 (VCA). 22. Letter Neurath to Carnap of 15 July 1935, in Carnap papers, Archives of Scientific
Philosophy, University of Pittsburgh (ASP). 23. Letter Neurath to Kaufrnann of 24 July 1935, (VCA). 24. See Helling (1985, 254); Zilian (1990,24) and Dahms (1997, 110). 25. Zilian (1990, 171), endorsed in Dahms (1997). 26. Letter quoted without date in Zilian (1990, 171).

GEORGEA. REISCH
DOOMED IN ADVANCE TO DEFEAT? JOHN DEWEY ON LOGICAL EMPIRICISM, REDUCTIONISM, AND VALUES
Abstract: This essay describes correspondence in the late 1930s among John Dewey, Charles Morris, Otto Neurath and Rudolf Carnap concerning Dewey's contributions to Neurath's International Encyclo- pedia of Unified Science. The essay argues that Dewey especially viewed the Encyclopedia as a socially and culturally important project, even though he had reservations about logical empiricism's approach to understanding values in science and scientific method. Around Dewey's specific objections to intertheoretic reductionism, this paper argues, were clustered more general concerns about values in science, in culture, and the need to oppose the popular neo-Thomist critique of science and scientific philosophy.
There was a moment in the history of Otto Neurath's International En- cyclopedia of Unified Science during which the project actually began to fulfill some of the Enlightenment-ideals it shared with its older French counterpart. I emphasize that it began to fulfill these ideals because this moment did not last long. Only several of the encyclopedia's mono- graphs had appeared when war broke out in Europe. Soon after the war had ended, the project was mortally wounded by Neurath's death and the culture of the Cold War in North America. In this culture, anti- communist sentiments were as dominant as contemporary anti-terrorist sentiments, and they had, arguably, equally destructive effects. In the case of Neurath's Unity of Science Movement, I believe, its leftist orien- tation - its hopes for popular enlightenment and scientific reforms of education and culture - made it unpopular or, at least, less attractive to philosophers of science than the more professional, apolitical, or - in some cases - right-wing, anticommunist postures available to Cold War philosophers.
Before all this, in 1938 and 39, the Encyclopedia was a successful, international forum for philosophers who believed that science, as or- ganized, collective inquiry into the nature of the world and of society, was the supreme tool with which civilization could possibly build a world more humanistic, peaceful and economically just. Part of this interna- tional collectivism involved the subject of this paper - the convergence

242 George A. Reisch
of American pragmatism and European logical empiricism in the col- laboration between America's most prominent philosopher, John Dewey, and Neurath and his co-editor of the International Encyclope- dia, Rudolf Carnap. The American pragmatist Charles Morris, who also co-edited the Encyclopedia, worked hard to make this convergence seamless and productive. In some respects it was; in others it was not. The various arguments, perceptions, misperceptions and accomrnoda- tions made among Dewey, on the one hand, and the editors of the En- cyclopedia, on the other, show that this hoped-for convergence was no mere synthesis of philosophical doctrine or theory. Dewey and his logi- cal empiricist colleagues had different ideas not only about science and its epistemological content, but also about the status and role of sci- ence and scientific philosophy in North American culture and how they would be best cultivated and defended against their anti-scientific crit- ics.
Neo-Thomism and Values
One of these critics of science and scientific philosophy was neo- Thomism, then enjoying a revival in North America. Philosophically, the revival embraced thinkers like Etienne Gilson and Jacques Maritain. Publicly, the revival was led by prominent figures like University of Chi- cago President Robert Maynard Hutchins. Hutchins was young, photo- genic, and celebrated as a Wunderkind in the American press. He was also devoted to Thomism, largely due to the persuasive powers of his good friend Mortimer Adler, an even more devoted Thomist for whom Hutchins secured employment at his university. With Hutchins, Adler, Carnap and Morris working at the University of Chicago in the mid-to- late 1930s, that university was one arena in which science and its crit- ics engaged in battle for the hearts and minds of North American cul- ture. Hutchins and Adler were then waging war against Dewey's educa- tional theories that, for Hutchins' and Adler's taste, were all too scien- tific and pragmatic. Instead, Hutchins and Adler promoted "great books" education through which students read the classics of philosophy and literature and absorbed the great ideas and values of western civiliza- tion. Dewey, on the other hand, saw schools as educational laborato- ries in which students engaged in active, practical inquiry and were thus steeped in Dewey's conception of knowledge as a public and collective, dynamic and progressive.

Doomed in Advance to Defeat? 243
The dispute between Dewey and Hutchins distinctly involved phi- losophy of science. Neo-Thomists believed that science was value-free, or "positivisticn - as Mortimer Adler sneered - and therefore deserved, at best, a second-tier role in western culture. Aristotelian and Thomist metaphysics, on the other hand, happily and comprehensively accom- modated all our knowledge and, most importantly, the values upon which liberal democracy rests as a priori truths or commitments. These values made Western intellectual history possible, Hutchins and Adler believed, and - properly safeguarded against threats from fascism - they would make possible the future of the West, as well. But if the pragmatists and logical positivists had their way, as Adler would bluster in an infamous, incendiary lecture he delivered in 1940, then the West would rapidly decline into barbarism and chaos that positivists could merely describe but never evaluate or, with any intellectual foundation, regret.'
Dewey in the Encyclopedia
This conflict between Dewey and Hutchins is one possible reason for why Dewey was not at first very excited about participating in the new Encyclopedia project. Dewey was then teaching at Columbia in New York City and he knew that Morris and Carnap were both at the Univer- sity of Chicago, whose Press would publish the Encyclopedia and where Dewey himself had been chairman of the philosophy department from 1894 to 1904. With his own legacy under attack from Chicago, Dewey perhaps did not recognize at first that Neurath's project was a willing ally. It was only when he met Neurath personally in his apart- ment in New York City that Dewey agreed to participate.
In his first contribution, Dewey signaled his intent to enlist the Ency- clopedia and the Unity of Science Movement in his battle against neo- Thomism and other critics of science and scientism. He titled his contri- bution "The Unity of Science as a Social Problem." The social problem was not poverty or disease (something Dewey knew much about through his good friend Jane Addams and her settlement houses) but rather the social problem of widespread opposition to science. With enemies like the neo-Thomism at home and fascism in Europe, Dewey warned, science was at "a critical juncture" (Dewey 1938, 33). In order to respond most effectively to this situation, he emphasized, the Unity of Science Movement had to remain flexible, open and democratic. It "need not and should not lay down in advance a platform to be ac-

244 George A. Reisch
cepted." Rather, "detailed and specific common standpoints and ideas must emerge out of the very processes of co-operation" (Dewey 1938, 34). The Unity of Science Movement, in other words, must not become slaves to any particular metaphysical tradition, much less an ancient one worshiped in the present and accepted a priori. For Dewey, neo- Thomists were "a priorists."
As Dewey's manuscript made its rounds among the Encyclopedia's editors, everyone was happy. Morris was pleased because Dewey was one of his heroes - he kept photographs of Dewey and William James on the wall of his office - and Dewey was indispensable to his hopes to integrate pragmatism and logical empiricism in the general program he called "scientific empiricism" (see Morris 1937). Carnap was pleased, for he also wished to learn more about pragmatism and whatever in- sights it might offer scientific philosophy. Neurath was also happy be- cause he fully agreed with Dewey's view of the Encyclopedia as open- ended and not wedded to any constrictive philosophical platform or a priori truths.
But, there was a comment in Dewey's manuscript that upset each of the editors. When issuing his warning about preconceived platforms, Dewey trampled unnecessarily on some ideas Carnap had been work- ing on since the early 1930s. Dewey wrote,
But the needed work of co-ordination [of the sciences] cannot be done mechanically or from without. It, too, can only be the fruit of cooperation among those animated by the scientific spirit. Conver- gence to a common center will be effected most readily and most vitally through the reciprocal exchange which attends genuine co- operative effort. The attempt to secure unity by defining the terms of all the sciences in terms of some one science is doomed in ad- vance to defeat. (Dewey 1938, 34)
Morris, it appears, objected to the original version of the sentence which rejected the attempt to define all scientific terms on the basis of physics. In a letter to Dewey, he urged him to revise the statement and make it more general; Carnap's physicalistic view of the unity of sci- ence, he apparently reminded Dewey, was more liberal and permissive than Dewey's words suggested. Dewey replied that he was not thinking of Carnap "at all in that sentence, but rather of some psychologists and sociologists who think everything should be reduced to terms of phys- i c ~ . " ~ Nevertheless, Dewey rewrote his claim as it appears here and in the monograph.

Doomed in Advance to Defeat? 245
Carnap also supposed that readers would take the remark to be directed against his views about unity of science. His work on the topic was highly visible because his major article "Testability and Meaningn had recently appeared in Philosophy of Science (Carnap 1936137). Here, Carnap distinguished different kinds and degrees of intertheoretic unity that different theories might enjoy. In particular, Carnap distin- guished between defining concepts of one theory in terms of those in another and the weaker, more practicable condition of reducing con- cepts using devices he called "reduction sentences."
After reading Dewey's manuscript, Carnap sent him a copy of "Testability and Meaning" and explained,
I distinguish reducibility from definability; it is at the present time not possible to define terms of biology in terms of physics or terms of psychology in terms of biology and physics. But, on the other hand, I do not see a reason for assuming that the present impossibility of such definitions should hold in all future.
Indeed, Carnap must have seen the irony: Dewey's larger point was that no preconceived, apriori intuitions, expectations or platforms should be brought to the task of unifying the sciences. On what grounds, then, could he confidently assume that such definitions will be impossible to achieve and "doomed in advance to defeat"? Irony aside, agreement was at hand, Carnap su gested, if only Dewey would redi- B rect his claim to the 'present state" of the sciences and write some- thing like, "At present, the attempt to secure unity by defining the terms of all the sciences in terms of some one science is doomed to defeat." But Dewey was resolute and did not change the statement.
Neurath found the statement puzzling, as well. A few months after the essay had been published, he sat down at his typewriter and rec- ommended a different distinction to Dewey - not Carnap's distinction between definition and reduction, but rather his distinction between physics and physicalism. Indeed, Neurath had to defend his physical- ism to Dewey because it was a kind of "programn for the Unity of Sci- ence Movement. But unlike some restrictive, a priori program, it was designed rather to make possible the kind of democratic collaboration Dewey had called for. Neurath urged Dewey to see the physicalist light:
I should appreciate it if, if you could let [sic] open the answer whether it might be possible to reduce the scientific terms of the dif- ferent sciences to the terms of this universal slang ('thing language'

246 George A. Reisch
according to Carnap) in concordance with the 'program' of physical- ism or not. This program is not exactly identical with 'defining the terms of all the sciences in terms of some or one science' and I cannot see that such a program even in the narrow sense you ex- plain 'is doomed in advance to defeatea4
But Dewey was again resolute and questioned Neurath's physicalism. It did not do justice to the valuational aspects of science, he replied two weeks later, and warned that the Encyclopedia must address "socio- moral" issues on their own terms, instead of attempting to reduce them to other areas of knowledge. Reducing them, for Dewey, was tanta- mount to ignoring them:
In virtually leaving out a large field - the socio-moral - I think that in the end this course will produce a reaction to the a priori, while an operational language in enabling the field to be brought under the empirical cuts completely under the a priori.=
Dewey could have been clearer at this point; I am not certain that Neurath understood it. This "reaction to the a priori" was not only a philosophical or logical rebound, but also (or, perhaps, primarily) a so- cial reaction involving the nefarious "a priorists," Adler, Hutchins and their followers. Dewey worried that Neurath's physicalism would invite a popular social reaction away from modernity, science and progress and towards the past and the false security of ancient metaphysics pro- moted by the neo-Thomists.
Dewey's Theory of Valuation
Several months later, Dewey's second contribution to the Encyclopedia, his monograph "Theory of Valuation," circulated among the editors. This chain of events nearly repeated themselves. The monograph de- fended a scientific approach to normative judgments of value by con- struing them behaviorally and operationally as versions of "liking and disliking." Dewey argued against any sharp and robust distinction be- tween ends and means and argued instead that a "continuum of ends- means" must be a cornerstone for any theory of value. For our distinc- tions between ends and means are in fact shifting and "temporal and relational" (Dewey 1939, 423) and not absolute. Means towards an end

Doomed in Advance to Defeat? 247
are, as means, desired as ends; while ends achieved typically become instrumentalities for yet further and different goals.
What stood in the way of any such future theory of value, however, was the dominant "ejaculatory" and non-cognitive view of value- statements. It holds, Dewey wrote, that value-expressions communi- cate only subjective "feelingsn or moods. Dewey cited several examples of this view from a source which Dewey emphatically disagreed with. If non-cognitivism was correct, after all, there could be no genuinely sci- entific theory of valuation. He devoted about one tenth of his mono- graph to attacking it.
Once again, Carnap liked Dewey's manuscript. But he objected to Dewey's dismissal of non-cognitivism. Once again, he urged Dewey to make some important distinctions:
I suppose that your criticism of the "ejaculatory" view is especially meant against Schlick. But Schlick and the others of us do not mean to say that value expressions have no meaning at all, but only that they have no cognitive content. You say yourself that value statements are not derivable from factual statements. There- fore, I suppose that you agree with us in the view that there is a non-cognitive component ... . We certainly agree with you that be- sides this non-cognitive component there is also a cognitive factual component, if the value statements are interpreted in your way ... . Certainly we do not deny, but rather admit explicitly the great psy- chological and historical effect of metaphysical statements. ... You understand that it is not at all my intention to censor your ms ... My concern is only to prevent the reader from etting a not quite adequate picture of the views which you criticize. B
Neurath also weighed in on the question. "Maybe it is our fault that you got the impression we underestimate the importance of verbal expres- sions which are not 'statements' -we do not, not at
It is not clear whether it was Carnap or both Carnap and Neurath that persuaded Dewey to adjust his manuscript. Whichever was the case, Dewey drafted a long footnote and added it to his manuscript. It reads:
The statement, sometimes made, that metaphysical sentences are 'meaningless' usually fails to take account of the fact that culturally speaking they are very far from being devoid of meaning, in the sense of having significant cultural effects. Indeed, they are so far

248 George A. Reisch
from being meaningless in this respect that there is no short dialec- tic cut to their elimination, since the latter can be accomplished only by concrete applications of scientific method which modify cultural conditions. The view that sentences having a nonempirical refer- ence are meaningless, is sound in the sense that what they purport to mean cannot be given intelligibility, and this fact is presumably what is intended by those who hold this view. Interpreted as symp- toms or signs of actually existent conditions, they may be and usu- ally are highly significant, and the most effective criticism of them is disclosure of the conditions of which they are evidential. (Dewey 1 939,444)
This note proves that Carnap (and possibly Neurath) were beginning to impress Dewey. For he now agreed with the hard-line anti-verificationist and syntactic critiques of metaphysics. But he was wrestling with how to both accept these critiques yet remain strongly against the view (of Ayer, at least) that value statements were noncognitive and as empty as metaphysical statements. The target of the note had changed, after all, from "value statements" to "metaphysical statements," and Dewey placed it not next to his criticism of Ayer, but rather at the close of his monograph where he made a final argument for the importance of a scientific theory of value.
At this point, the discussion was becoming confused and disorgan- ized. Necessary distinctions between value statements and metaphysi- cal statements were becoming blurry in Dewey's monograph and Dewey contributed other confusions, as well. He rejected Neurath's physicalism, for example, on the grounds that it excluded valuational language:
In a strict sense of thing language there can be no genuine evalua- tion propositions or sentences. In terms of a behavior or operational language I think the case can be clearly made out in behalf of the genuinely logical character of some - though not all - value- expressions.
But what does "genuinely logical character" mean? For Dewey, appar- ently, "logic" did not mean "formal logic" as it did for most logical empiri- cists. Another irony is that Dewey rejected Neurath's physicalism at the same time that he effectively appealed to it: he explained to Neurath that values in science must be talked about, "but in the ordinary use of the English language they are not 'things' nor yet '~bjects." '~ Talking

Doomed in Advance to Defeat? 249
about science in "ordinaryn - i.e. empirical, not metaphysical - lan- guage is all that Neurath's physicalism demanded. Dewey also took a physicalist posture towards Carnap's concept of "reduction" when he refused to alter his statement "doomed in advance to defeat:"
My belief that the categories of sociology and biology cannot be "reduced" in the sense in which the english reader naturally under- stands the word to physical categories (i.e. categories of physical science) is so firm that I do not see how I can alter my revised statement.'
Perhaps without being aware of it, therefore, these philosophers were coming close to understanding each other and realizing, as Morris in- sisted all along, pragmatism and logical empiricism were complemen- tary parts of a larger view of knowledge and language. If so, there were significant obstacles in the way of any such realization. Dewey's letters suggest often a degree of defensiveness about his views - as if he knew that Carnap and Neurath knew science very well and that Car- nap, in particular, was nearly without peer in technical logic.
In any case, this was not a contest; it was a collaboration. And Dewey had certain insights that the logical empiricists did not have. Mainly, he was more familiar with the American intellectual and cultural landscape and the threat of anti-scientific forces quite unlike those Neurath and Carnap saw in 1920s Vienna. Thus, part of Dewey's con- fusion can be explained by the fact that he struggled in this dialogue to be both 100% philosophical and, at the same time, 100% strategic in his writing for the Encyclopedia. Consider what he told Morris when discussing the footnote he added to his monograph Theory of Value.
Of course I agree that "metaphysical" statements in the sense of non- or anti-empirical are unverifiable. But I think the attempt to dismiss them entirely at one swoop by calling them "meaningless" is a serious tactical mistake.''
Dewey knew, that is, that if the Unity of Science Movement was to ac- cept its role in the "social problem" of the unity of science, then it had to balance its narrower philosophical concerns with broader "tactical1' pos- tures and maneuvers. For if logical empiricism's hard line against metaphysics and value statements helped Adler and Hutchins success- fully fool the world into believing that science was truly value-free, then they could more easily persuade the world that Thomism (or some

250 George A. Reisch
other nonscientific, rationalistic system) had to be embraced as a source of values and guidance for contemporary life. In that case, both the pragmatists and the logical empiricists would be on the losing side in the war over science.
In light of the subsequent history of the Unity of Science Movement during the Cold War, there is something tragic about this conversation among Dewey, Neurath and Carnap. In a way, Dewey's fears were realized. To be sure, neo-Thomism did not conquer North American intellectual life as Adler and Hutchins would have wished. But the im- age of science which prevailed in the 1950s - both in popular culture and in philosophy of science - was one that rigidly distinguished sci- ence and scientific philosophy from questions and inquiry about values. A popular dichotomy between facts and values was omnipresent during the cold war and helped cultivate postwar logical empiricism as an en- tirely non-political project. Had this conversation gone on longer, how- ever, I wonder if Dewey, Neurath, Carnap, Morris and others might have seen each other's concerns better, learned from each other even more than they did, and perhaps agreed upon some new language and new strategy to join pragmatism and logical empiricism across that dichotomy. If so, the varieties of analytic philosophy that in fact thrived in the decades after the war might not have had to wait for Rorty and others to begin conceiving a rapprochement with pragmatism."
References
Adler, Mortimer. 1941. "God and the Professors" in Science, Philosophy and Religion: A Symposium. New York: Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., 120-38.
Carnap, Rudolf. 1936137. "Testability and Meaning." Philosophy of Sci- ence. v. 3, 419-471; v. 4: 1-40.
Dewey, John. 1938. "Unity of Science as a Social Problem" in Neurath, et al. 1938, 29-38.
Dewey, John. 1939. "Theory of Valuation." International Encyclopedia of Unified Science, v. 2, n. 4, Chicago: University of Chicago Press, 380-447 (in two-volume edition).
Morris, Charles. 1937. Logical Positivism, Pragmatism, and Scientific Empiricism. Actualites Scientifiques et Industrielles, 449, Paris: Hermann et tie.

Doomed in Advance to Defeat? 25 1
Neurath, Otto, Niels Bohr, John Dewey, Bertrand Russell, Rudolf Car- nap & Charles Morris. 1938. "Encyclopedia and Unified Science." lnternational Encyclopedia of Unified Science, v. 1, n. 1, Chicago: University of Chicago Press.
Notes
Adler claimed in 1940 that "the most serious threat to democracy is the positivism of its professors, which dominates every aspect of modern education and is the central corruption of modem culture. Democracy has much more to fear from the mentality of its teachers than from the nihilism of Hitlet" (Adler 1941, 128). Dewey to Morris, Dec. 7, 1939. This and other correspondence is contained in the Neurath Nachlass at the Rijksarchief, Noord-Holland (a copy of which is owned by theVienna Circle Institute) and the Camap Papers in the Archive of Scientific Phi- losophy at the University of Pittsburgh. I thank these institutions for permission to quote from their holdings. Carnap to Dewey, Dec. 28, 1937. Neurath to Dewey, Aug. 3, 1938. Dewey to Neurath, Aug. 17, 1938. Carnap to Dewey, March 11,1939. Neurath to Dewey, March 24, 1939, Dewey to Neurath, Aug 17, 1938. Dewey to Carnap, Dec. 30,1937. Dewey to Morris, March 24, 1939. Emphasis added. This research was supported in part by National Science Foundation (grant number SES0000222). For a fuller account of the International Encyclopedia of Unified Sci- ence and related topics, see the author's How the Cold War Transformed Philosophy of Science (Cambridge University Press, 2005) from which the present essay is ex- tracted.

Abraham, M. 188 Abraham, P. 188 Addams, J. 243 Adler. F. 26 Adler, M. 242,243, 246, 249, 250 Adomo, T. W. 30 Ajdukiewicz, K. 28, 126 Ampere, A.-M. 94 Aristoteles 33, 46, 130 Avenarius, R. 122 Ayer, A. J. 121, 127,248 Bachelard, G. 155 Bacon, F. 34, 35, 38-40,42, 44, 49,
50, 52, 56, 66, 68, 70,83,94, 95 Barone, F. 210 Barthes, R. 71 Bauer, 0. 138 Bayle, P. 92 Behmann 127 Belaval, Y. 69 Benda, J. 161 Benjamin, W. 29, 189 Bergson, H. 124 Bemays, P. 127 Berr, H. 13, 18, 19,20, 91, 99, 192,
193, 194, 196 Berthelot, M. 13, 91 Black, M. 158 Blanch& R. 125 Bloch, M. 180, 181, 192, 197 Bochenski, J. 130 Boll, M. 26,27,29, 124, 154 Boltzmann, L. 136, 157 Bonnet, H. 29 Borges, J.L. 33, 50 Boutroux, E. 124, 158 Bouvier, R. 18, 124, 194, 197 Brecht, 6. 29 Brenner, A. 12, 13 Broglie, L. de 128, 185 Brunschvicg, L. 130, 161 Brunswik, E. 127 Burke, P. 45 Canguilhem, G. 128 Cantor, G. 160 Carnap,R. 11, 15, 16, 19,21,22,24-
26, 29, 35, 37, 38, 48-55, 57, 59, 90, 98, 125-127, 130-134, 137, 153, 154, 156, 158, 163-165, 193, 194,
196, 205-21 7, 223, 224,228-230, 233, 234, 242-250
Cartan, E. 29 Cassini 14,45,46 Cassirer, E. 221-223 Cavailles, J. 16, 121, 129, 132, 134-
I36 Chabot, P. 70 Chambers, E. 34 Clairaut, A.C. 79 Clavelin, M. 125 Comte, A. 12, 18, 26, 27, 92, 94, 95-
97,100, 157,159,162,169,214 Cournot, A. 95 Couturat, L. 17, 129, 131-133, 140,
141 dlAlembert, J, le Rond 9, 10, 12-14,
19, 30, 34, 37-41,44,45, 50, 52, 54, 65, 68, 73-79,8244, 87-90, 92-95, 137,138,181,215,216,222
Dahms, H.-J. 15, 16 Darnton, R. 42-44 Darwin, Ch. 138 Davidson, D. 169 Desanti, J.-T. 129, 130 Descartes, R. 78, 94, 123, 125, 127,
128,130,160 Destouches, J.-L. 128, 154, 155 Dewey, J. 23-25, 242-250 Diderot, D. 9, 10, 13, 14, 19, 30, 34,
37, 38, 44,45, 50, 52, 65-71, 73-77, 81-85, 87-90, 92, 137, 138, 181, 182,215
Doumer, P. 192 Duhem, P. 12, 13,25-27, 56, 57,92,
97,98,100, 124, 132,136,209 Durkheim, E. 22 Diirr 127 Einstein, A. 15,26, 82, 96, 122, 136,
I56 Enriques, F. 28, 122, 127, 136 Epicure 92 Feigl, H. 25, 125 Febvre, L. 13, 19, 20, 91, 99, 180-1 83,
186-1 88, 190-1 97 Fontenelle, B. 69 Frank,Ph. 11,17,18,19,20,21,24-
26, 28, 29, 74, 82, 90, 124, 127, 153, 154, 156, 162, 193, 194, 196, 223

Namenregister 1 Index of Names
Frbchet, M, 29, 154 Frege, G. 13, 16, 28, 124, 130 Freud, S. 22, 122, 139,230 Freymann, P. 124 Friedman, L. 155 Galton, F. 138 Gilson, E. 152,242 Godel, K. 166 Gonseth, F. 127, 155 Goodman, N. 43,50,217 Granet, M. 192 Grimm, J. 65 Hadamard, J, 29, 191 Hahn, H. 11,21,74,90,154,208,223 Halley, E. 79 Hayek, F. v. 161, 170,232,234 Helm, G. 122 Helmer 127 Helmholtz, H. 136 Hempel, C. G. 19,127, 193 Herbrand, J. 129 Herriot, E. 180 Hertz, H. 157 Hilbert, D. 26, 51, 53, 122, 158 Holton, G. 20 Homere 65 Hook 24 Horkheimer, M. 30, 115 Hume, D. 49, 52, 121 Hull, C. 24, 127 Husserl, E. 134,232, 234 Hutchins 25 Hutchins, R. M. 242,243,246, 249,
250 Huxley, A. 161 Itelson, G. 100 James, W. 100,121,244 Janet, P. 29 Javas, 106 Jespersen, 0. 133 Joergensen, J. (=Jargemen, J.) 29,
122,153 Johnston, W. 139 Juhos, 6. v. 163 Kaufmann, F. 23 Kant, 1. 26, 46, 47, 129, 130, 131, 140,
223 Kaufmann, F. 232-234 Klein, F. 53 Kokoszynska 127 Koyre, A. 128 Kraft, V. 127 Kuhn, T. S. 98 Lacan, J. 188
La Condamine 79 Lagardelle, H. 186 Lalande, A. 17, 29, 122, 124, 137, 140 Langevin, P. 29, 154, 185, 188, 191,
193,194 Lecourt, D. 9 Leibniz, G.W. 44, 70, 94, 114, 124,
131-133, 137,213,215 Lenin, W.I. 25 Lenzen, V. I56 Leriche, R. 188 Le Roy, t. 97,161 Le~y-Br~hl, L. 161, 162, 169, 195 LittrB, I& 93 Locke, J. 94 Lowy 107 Luther, M. 180 Mach, E. 25.26, 56, 81, 90, 96, 97,
121,122, 132,136,194 Madame de Lambert 192 Marion, M. 17, 18 Maritain, J. 152, 242 Marx, K. 22 Masaryk, T. 121 Maupertuis, P.L. 79 Maurras, Ch. 186,189 Mauss, M. 192 Meillet, A. 133, 140, 188 Menger, C. 157,225 Merton, T. 225 Meyerson 124 Milhaud 128 Mill, J S t 97 Mises, L. v. 155, 162 Mises, R. v. 127 Mollier, J.-Y. 186 Monzie, A. de 180, 188, 190 Motley, J. 112 Mormann, T. 13, 14, 15, 51, 55 Morris, Ch. 15, 16, 23, 24, 27-29, 1 05-
108, 112, 114, 116, 138, 153, 214, 242-244, 249, 250
Musil, R. 29, 139 Naess, A. 127 Nagel, E. 24, 158 Necker, S. 65 Neurath, 0. 7-12, 14-30, 35, 37, 38,
47, 48, 50, 51, 55, 58, 74, 81, 88; 90, 92, 94-97, 99-101, 105-1 14, 116- 118, 124-127, 129, 135-140, 152- 155, I61 -1 65, 193, 194, 197, 205, 208-218, 221, 223-234, 241- 250
Newton, 1, 79,94 Nicod, J. 158

Namenregister I Index of Names
Nicolle, C. 29 Ouelbani, M. 21, 22 Oppenheim 127 Padoa 158 Panckoucke, C. J. 70,75 Pap, A. 160, 163,164 Pareto, V. 169 Pavlov, 1. 230 Peano, G. 124,131,158 Peirce, Ch. S. 131 Perrin 29 Petzoldt, J. 122 Plato (Platon) 130, I69 Poincare, H. 12, 13,25-27, 51,53, 90,
92, 97, 98, 100, 124, 130, 132, 133, 136, 151, 156, 158,209
Popper. K. 47, 170, 225 Popper-Lynkeus, J. 139 Proust, J. 68 Quine, W.V.O. 81,164 Ramsey, F. 164 Reichenbach, H. 12,26,28, 108, 124,
125-128, 151, 153-155 Reisch, G. 23,24 Riemann, 6. 53 Renan, E. 162 Rey, A. 12, 13, 18, 19,25, 26,29,91,
97, 99, 100, 124, 128, 154, 162, 179, 193-196
Riemann, 6. 136 Ringer, F. 11 Rist, Ch. 154 Rivet, P. 188 Rorty, R. 250 Rosenkranz, K. 112 Rougier, L. 17-20,26-30, 123, 124,
127, 129,140, 151-170, 197 Rousseau, J.-J. 113 Rueff, J. 169 Russell, B. 13, 16,28, 81, 100, 109,
121, 123,130-132,137, 140, 141, 158, 160
Ryle, G. 121 Saint-Simon, C. H. 95 Santillana, G. di 154 Schlick, M. 18, 19, 21, 26, 74, 81, 99,
106, 121, 122, 125, 135, 151, 154- 156, 162-164, 193, 196, 215,221, 247
Schlogel, K. 45 Scholz, H. 127, 130 Schottler, P. 17, 19, 20 Schroder 131 Seneque 68
Serrus, Ch. 132, 133 Sirnmel, G. 231 Sirnondon, G. 70 Sobel, D. 46 Socrate (Socrates) 67, 167, 168 Somrne~ille, J. 137 Soulez, A. 16, 17,23 Spann, 0. 234 Spencer, H. 114,214 Spengler, 0. 139, 161 Stegmiiller, W. 165 Stern, A. 194 Taine, H. 162 Tarski, A. 127 Tilgher, A. 161 Uebel, T. 22, 23 Valery, P. 124, 132, 188, 189 Vendryes, M. 140, 141 Virgile 65 Voltaire 69, 141 Vouillemin, C. E. 27, 124, 154 Wagner, P. 9-12 Waisrnann, F. 125, 155, 163 Waldheim, K. 31 Wallon, H. 191 Watson, J. 230 Wavre, R. 155 Weber, M. 169,234 Werthsimer, M. 108 Weyl, H. 164 Whewell, W. 86 Whitehead, A. N. 121, 132, 140 Winch, P. 234 Wittgenstein, L. 13, 52, 92, 109, 121-
123, 125, 134, 135, 156, 162-164, 196
Wolf 131 Woodger, J.H. 127 Yeo, R. 34 Zay, J. 188 Zilsel. E. 154

DIE AUTOREN
Anastasios Brenner (Montpellier)
Anastasios Brenner est professeur au Departement de philosophie de I'Universite Paul Valery - Montpellier Ill. 11 a publie notamment Duhem: science, realife et apparence (Vrin, 1990), L'aube du savoir: epitome du Systeme du monde de Pierre Duhem (Hermann, 1997) et, touchant plus particulierement au theme de ce volume, Les origines fran~aises de la philosophie des sciences (PUF, 2003) dont une partie est consac- ree a la reception de la philosophie fran~aise dans le Cercle de Vienne.
Hans-Joachim Dahms (Berlin)
Geboren 1946, Studium der Philosophie, allgemeinen und verglei- chenden Sprachwissenschaft und Soziologie in Gottingen, M.A. Gottin- gen, Doktor der Philosophie in Bremen, Habilitation in Osnabruck. Ve- roffentlichungen: Positivismusstreit, Frankfurt am Main 1994; Heraus- geber und KO-Autor von Philosophie, Wissenschafi, Aufklarung. Bei- trage zur Geschichte und Wirkung des Wiener Kreises, Berlin-New York 1985 und von Die Universitat Gottingen unfer dem National- sozialismus, Miinchen etc. 1987 (zweite, erweiterte Auflage 1998); ungefahr 50 Aufsatze ijber Wissenschaftstheorie und Geschichte der Philosophie und Wissenschaft sowie Geschichte der Universitaten im 20. Jahrhundert.
Dominique Lecourt (Paris)
Ancien Recteur dlAcademie, Dominique Lecourt est Professeur de philosophie a I'Universite Denis Diderot - Paris 7, Directeur du Centre Georges Canguilhem (Paris 7), President du Comite d'ethique de I'lnsti- tut de Recherche pour le Developpement (IRD), Delegue General de la Fondation Biovision de I'Academie des Sciences et President du Conseil de Surveillance des Presses Universitaires de France (PUF). Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont certains traduits dans de nom- breux pays. Parmi ses derniers livres on peut citer ((Promethee, Faust, Frankenstein: Fondements imaginaires de I'ethique)) (reed. Livre de Poche / Biblio Essais, 1998), ((L'Amerique entre la Bible et Darwin)) (reed. PUF 1998), ((Centre la peurn (reed. PUF, 1999), le ((Dictionnaire

258 Die Autoren
d'histoire et philosophie des sciences)) (reed. PUF, 2005) couronne par I'lnstitut de France, le ((Que sais-je?)) sur ((La philosophie des ciencesn (reed. PUF, 2005), c<Hurnain Post-humainn (PUF, 2003) et le ((Diction- naire de la pensee medicale)) (reed. PUF, 2004).
Mathieu Marion (Montreal)
Mathieu Marion holds the Canada Research Chair in Philosophy of Logic and Mathematics at the Universite du Quebec a Montreal. He obtained the D. Phil. from Oxford in 1992, was a research fellow at the University of St. Andrews, at the Center for the Philosophy and History of Science (Boston University) and at the Universite de Montreal. He has been teaching at the University of Ottawa from 1994 to 2003. He is the author of Wittgenstein, Finitism, and the Foundations of Math- ematics (Oxford University Press, 1998) and Ludwig Wittgenstein. Une introduction au Tractatus logico-philosophicus (Presses Universitaires de France, 2004).
Thomas Mormann (San Sebastian)
Thomas Mormann studierte Mathematik, Linguistik und Philosophie in Munster und Freiburg. Er promovierte in Mathematik und kam spater zur Philosophie. Nach der Habilitation in Philosophie, Logik und Wis- senschaftstheorie in Munchen arbeitet er zur Zeit als Professor fur Lo- gik und Wissenschaftsphilosophie an der Universitat des Baskenlandes in Donostia-San Sebastian in Spanien. Zahlreiche Publikationen zur Wissenschaftsphilosophie und Erkenntnistheorie.
Elisabeth Nemeth (Wien)
A.o. Univ. Professorin am lnstitut fur Philosophie der Universitat Wien. Forschungsschwerpunkte: Philosophie und Geschichte des Wiener Kreises (besonders Otto Neurath, Edgar Zilsel und Philipp Frank), er- kenntnistheoretische Aspekte der Sozial- und Kulturforschung (beson- ders Ernst Cassirer und Pierre Bourdieu). Veroffentlichungen zum the- ma des Bandes: 1981: Otto Neurath und der Wiener Kreis. Revolutio- nare Wissenschafilichkeit als politischer Anspruch, Frankfurt-New York: Campus. Herausgeberin: 1994: (mit Paul Neurath): Otto Neurath oder Die Einheit von Wissenschafi und Gesellschafi, Wien: Bohlau. 1996: (mit Friedrich Stadler): Encyclopedia and Utopia. The Life and Work of Otto Neurath (1882-1945), Vienna Circle Institute Yearbook

Die Autoren 259
4/96, Dordrecht-Boston-London: Kluwer. 1999: (mit Richard Heinrich): Otto Neurath: Rationalitat, Planung, Vielfalt. Wien-Berlin: Oldenbourg- Akademie Verlag.
Melika Ouelbani (Tunis)
Professeur a la Faculte des Sciences Humaines et Sociales, Universite de Tunis. Publications (livres): Le projet constructionniste de Carnap: ses critiques et ses limites, pub. F.S.H.S.,Tunis, 1992. Le dicible et le connaissable: Kant et Wiftgenstein, Tunis, Ceres-production, 1996. Experience et connaissance chez B. Russell, Tunis, C.P.U., 1999. In- troduction a la logique mathematique, Tunis, CPU, 2000. L'ethique dans la philosophie de Witfgenstein ( a paraitre).
George Reisch
George Reisch's research concerns the history of logical empiricism in North America and, in particular, the career of the Unity of Science Movement. He was graduated in 1995 from the University of Chicago with a Ph.D. in Philosophy and History of Science and presently works as an independent scholar. His book How the Cold War Transformed Philosophy of Science was published by Cambridge University Press in 2005 and he is currently editing for publication an unfinished mono- graph by Philipp Frank about political interpretations of 20th-century philosophies of science.
Peter Schottler (ParisIBerlin)
Geb. 1950, Dr. phil., Directeur de recherche am Centre National de la Recherche Scientifique in Paris (Institut d'histoire du temps pre'sent) und Honorarprofessor an der Freien Universitat in Berlin. Neuere Verof- fentlichungen u.a.: (Hg.) Geschichtsschreibung als Legitimationswis- sensehaft 1918-1945, FrankfudMain 1997; (Hg.) Marc Bloch - Histori- ker und Widerstandskampfer, FrankfurtlMain 1999; (Hg.) Marc Bloch, Aus der Werkstaft des Historikers. Zur Theorie und Praxis der Ge- schichtswissenschaft, FrankfudMain 2000; (Hg.) Marc Bloch, Apologie der Geschichtswissenschaft oder Der Beruf des Historikers, Stuttgart 2002.

260 Die Autoren
Antonia Soulez
Professor of philosophy, director of researches, University of Paris-8, specialized in philosophy of language and constructive aesthetics (mu- sic and architecture), 20th century, Viennese cultural context. Member of the Institute of history and philosophy of sciences and techniques (IHPST, Paris) I first studied Greek philosophy, and passed a state thesis on Plato's middle-dialogues philosophy of language (from the Cratylus to the Sophistes with a modern part in the light of G. Ryle's reading) published in PUF 1991. Then around early 19803, I shifted towards contemporary philosophy of language, especially the Vienna Circle (Manifeste du cercle de Vienne, PUF 1985, to be republished 2005) and co-organized a number of international colloquia on the Vi- enna Circle with Jan Sebestik (all republ. 2002). 1 have also become a specialist of Wittgenstein's middle period (19301s), and published "Witt- genstein et le tournant grammatical" (PUF, 2003). 1 am the author of: Comment ecrivent les philosophes? (Kime, 2003). On Wittgenstein, I have also directed collective work on unpublished material: Dictations to Waismann and on Schlick, PUF 1997-98, 2 vol., in collab. with Gordon Baker, and translated Lectures on the freedom of the Will (Wittgenstein), PUF, 1998, with a commentary under the title: Essai sur le libre jeu de la volonte (coll. Epimethee). I have co-founded 1) a re- view with Jan Sebestik and Fr. Schmitz (Cahiers de philosophie du langage, publ. L'Harmattan), and 2) a collection on philosophy and music with a composer and a musicologist (same publ.). I am now in the Centre national de recherche scientific (CNRS) on a musical pro- ject: from controversies in history of sciences: Mach and Helmholtz on dissonance, onto 20th century theories of composition, namely the Vi- ennese school and the raise of timbre music.
Friedrich Stadler (W ien)
Studium der Geschichte, Philosophie und Psychologie in Graz und Salzburg. 1994 Habilitation fur Wissenschaftsgeschichte und Wissen- schaftstheorie an der Universitat Wien. Seit 1997 aul3erordentlicher Professor an der Universitat Wien, Zentrum fur uberfakultare For- schung und ab 2001 Vorstand des lnstituts fur Zeitgeschichte. 1991 Grunder und seitdem Leiter des lnstituts Wiener Kreis. Mitarbeiter des Ludwig-Boltzmann-lnstituts fur Geschichte und Gesellschaft. Zahlreiche Publikationen zur History and Philosophy of Science und zur Emigra- tionsforschung. Veroffentlichungen u.a.: Vom Positivismus zur ,,Wissen-

Die Autoren 261
schaftlichen Weltauffassung" (1 982); Vertriebene Vernunft. 2 Bde (1 988, Neuauflage 2004); Studien zum Wiener Kreis., 1997 (englische iJ bersetzung : The Vienna Circle. 2001 ); Hg .: Elemente moderner Wis- senschaftstheorie (2000); gem. m it P. Wei bel, The Cultural Exodus from Austria (1995); gem. mit M. Heidelberger, Wissenschaftsphilo- sophie und Politik (2003); Induction and Deduction in the Sciences (2004, = Vienna Circle Institute Yearbook 11103).
Thomas Uebel (Manchester)
Thomas Uebel teaches philosophy at the University of Manchester, England. His research concerns the history of philosophy of science, of analytic philosophy and of Austrian philosophy as well as epistemology and philosophy of social science. He is the editor of Rediscovering the Forgotten Vienna Circle (Kluwer, 1 991 ), co-editor (with R.S. Cohen) of Neurath, Economic Writings: Selections 7904-1 945 (Kluwer, 2004) co- author (with N. Cartwright, J. Cat, L. Fleck) of Otto Neurath: Philosophy between Science and Politics (Cambridge, 1996), and the author of Overcoming Logical Positivism from Within (Rodopi, 1992), Ver- nunffkritik und Wissenschaft (Springer, 2000) and numerous articles.
Pierre Wagner (Paris)
Pierre Wagner was born in France in 1963. He has studied logic and philosophy and in 1994 he obtained a PhD in philosophy with a thesis about the relationships between machine and thought. Since 1994, he has been <( maitre de conferences )) at the department of philosophy at the university Paris 1 (Sorbonne) where he teaches logic and philoso- phy of science. His main areas of research is now history of the phi- losophy of science and history of logical empiricism. He published a book (La Machine en logique, Paris, PUF, 1998), and edited two others (Les Philosophes et la science, Paris, Gallimard, 2002, and, with San- dra Laugier, Philosophie des sciences, Paris, Vrin, 2004, 2 vol.). He is preparing, with Christian Bonnet, an anthology of 15 introduced and annotated papers by Carnap, Schlick, Neurath, Frank, Reichenbach, Hempel, Blumberg and Feigl, all translated in French, age d'or de I'empirisme logique. Vienne - Berlin - Prague: 7929- 1936, Paris, Gal- limard, to appear).

Der Wiener Kreis, eine Gruppe von rund drei Dutzend Wissen- schafterlnnen aus den Bereichen der Philosophie, Logik, Mathernatik, Natur- und Sozialwissenschaften im Wien der Zwischenkriegszeit, zahlt unbestritten zu den bedeutendsten und einflussreichsten philo- sophischen Strtirnungen des 20. Jahrhunderts, speziell als Weg- bereiter der (sprach)analytischen Philosophie und Wissenschafts- theorie.
Den Kern dieser rnodernistischen Bewegung, die im Jahre 1929 erstrnals mit der Prograrnmschrift ,,Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis" in die Offentlichkeit getreten war, bildete der so genannte ,,Schlick-Zirkel".
Die Narnen seiner Mitglieder, wie auch jene der dern Wiener Kreis nahe stehenden Personlichkeiten, haben bis heute nichts von ihrer Ausstrahlung und auch nichts von ihrer Bedeutung fur die rnoderne Philosophie und Wissenschaft verloren: Schlick, Carnap, Neurath, Kraft, Godel, Zilsel, Kaufrnann, R. von Mises, Reichenbach, Wittgen- stein, Popper, Gornperz - urn nur einige zu nennen - zahlen bis heute unbestritten zu den gronen Denkern des 20. Jahrhunderts.
Gerneinsames Ziel dieses aufklarerischen und pluralistischen Diskussionszirkels war eine Verwissenschaftlichung der Philosophie rnit Hilfe der modernen Logik auf der Basis von Alltagserfahrung und einzelwissenschaftlicher Ernpirie. Aber wahrend ihre ldeen im Ausland breite Bedeutung gewannen, fielen sie in ihrer Heirnat dem Faschisrnus und Nationalsozialismus aus so genannt ,,rassischenW undloder politisch-weltanschaulichen Grunden zurn Opfer und blieben in Osterreich wie in Deutschland oft auch nach 1945 in Vergessenheit.
Die im Springer-Verlag fortgefuhrte Reihe der ,,Veroffentlichungen des lnstituts Wiener Kreis" hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Denker und ihren vor allern irn angloamerikanischen Raum bis heute ungebrochenen Einfluss auch auf die zeitgenossische Wissenschaft wieder ins offentliche Bewusstsein des deutschsprachigen Raurnes zuruckzuholen.

WWien, Österreich, Fax +43.1.330 24 26, [email protected], springer.at
Heidelberg, Deutschland, Fax: +49.6221.345-4229, [email protected]
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Friedrich Stadler (Hrsg.)
Österreichs Umgang
mit dem Nationalsozialismus
Die Folgen für die naturwissenschaftliche und humanistische Lehre
In Zusammenarbeit mit Eric Kandel, Walter Kohn,
Fritz Stern und Anton Zeilinger.
2004. IV, 283 Seiten. 14 Abbildungen.
Format: 14,5 x 21 cm. Text: deutsch/englisch
Gebunden EUR 49,–, sFr 83,50
ISBN 3-211-21537-9
Dieser Band fasst ein hochrangig und international besetztes Sym-posium zusammen, welches unter großem öffentlichen Interesse im Juni 2003 an der Universität Wien stattfand. Es wurde auf Initiative des aus Wien stammenden Neurobiologen Eric Kandel veranstaltet – anstatt von geplanten Ehrungen anläss-lich seiner Auszeichnung mit dem Nobelpreis für Medizin im Jahre 2000. Das Ziel war, der breiteren Öffentlichkeit und Scientific Com-munitiy den Umgang Österreichs mit der nationalsozialistischen Herrschaft und dessen Auswirkungen auf das intellektuelle Leben in Österreich bis zur Gegenwart zu thematisieren. Die persönliche Teilnahme der zwei aus Österreich vertriebenen Wissenschafter und späteren Nobelpreisträger Eric Kandel und Walter Kohn, sowie einer Reihe weiterer renommierter ForscherInnen und Zeitzeu-genInnen war Anlass für diese einmalige und einzigartige zeitge-schichtliche Dokumentation.
SpringerPhilosophie

WWien, Österreich, Fax +43.1.330 24 26, [email protected], springer.at
Heidelberg, Deutschland, Fax: +49.6221.345-4229, [email protected]
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
SpringerPhilosophie
Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis
K. R. Fischer, F. Stadler (Hrsg.)„Wahrnehmung und Gegenstandswelt“Zum Lebenswerk v. Egon Brunswik (1903-1955)
1997. 187 S. 15 Abb. 1 Frontispiz. Text: d/eBroschiert EUR 30,–, sFr 51,–
ISBN 3-211-82864-8. Band 4
Friedrich Stadler (Hrsg.)Bausteine wissenschaftlicher WeltauffassungLecture Series/Vorträge des
Instituts Wiener Kreis 1992–1995
1997. 231 Seiten. Text: deutsch/englisch Broschiert EUR 33,–, sFr 56,50
ISBN 3-211-82865-6. Band 5
Friedrich Stadler (Hrsg.)Phänomenologie und logischer EmpirismusZentenarium Felix Kaufmann (1895-1949)
1997. 163 S. 1 Frontispiz. Text: d/eBroschiert EUR 28,–, sFr 48,–
ISBN 3-211-82937-7. Band 7
Friedrich Stadler (Hrsg.)Elemente moderner WissenschaftstheorieZur Interaktion von Philosophie,
Geschichte und Theorie
der Wissenschaften
2000. XXVI, 220 Seiten. 16 Abb. Broschiert EUR 34,90, sFr 59,50
ISBN 3-211-83315-3. Band 8
Thomas UebelVernunftkritik und Wissenschaft: Otto Neurath und der erste Wr. Kreis2000. XXI, 432 Seiten. Broschiert EUR 54,–, sFr 89,50
ISBN 3-211-83255-6. Band 9
C. Jabloner, F. Stadler (Hrsg.)Logischer Empirismus und Reine RechtslehreBeziehungen zwischen dem
Wiener Kreis und der Hans Kelsen-Schule
2001. XXI, 339 Seiten. Broschiert EUR 54,95, sFr 91,–
ISBN 3-211-83586-5. Band 10
E. Timms, J. Hughes (Hrsg.)Intellectual Migration and Cultural TransformationRefugees from National Socialism
in the English-Speaking World
2003. VI, 267 S. Text: englisch Broschiert EUR 34,24, sFr 58,50
ISBN 3-211-83750-7. Band 12
Friedrich StadlerThe Vienna Circle – Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism2001. Gebunden EUR 85,55, sFr 135,50ISBN 3-211-83243-2. Sonderband
A. Müller, K. H. Müller, F. Stadler (Hrsg.)Konstruktivismus und Kognitionswissenschaft2001. Broschiert EUR 38,–, sFr 65,–ISBN 3-211-83585-7. Sonderband