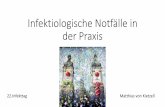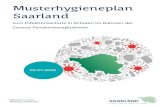Richtige Chemoprophylaxe bei Verdacht auf Meningokokkenexposition
Transcript of Richtige Chemoprophylaxe bei Verdacht auf Meningokokkenexposition

Notfall Rettungsmed 2014 · 17:253–254DOI 10.1007/s10049-014-1845-8Online publiziert: 2. Mai 2014© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
Richtige Chemoprophylaxe bei Verdacht auf Meningokokkenexposition
Leserbrief
PD Dr. S. Schulz-StübnerDeutsches Beratungszentrum für Hygiene
(BZH GmbH), Freiburg
Ventzke u. Lampl berichten in ihrem sehr eindringlichen Fallbericht vom Transport einer neurochirurgischen Intensivpatien-tin in Bosnien-Herzegowina unter extrem erschwerten Bedingungen [1]. Im Fallbe-richt wird die Verdachtsdiagnose einer (nosokomialen) bakteriellen Meningitis mit schwerer Sepsis gestellt und der Ver-dacht auf MRSA als Erreger geäußert.
Dennoch wurde beim medizinischen Personal und beim Piloten des RTH eine Chemoprophylaxe mit Ciprofloxacin durchgeführt. Bei postoperativen, noso-komialen Meningitisfällen kommen Me-ningokokken als Erreger praktisch nicht vor (kein Treffer in Medline). Eine Indika-tion zur postexpositionellen Chemopro-phylaxe bezieht sich jedoch ausschließlich auf den Verdacht auf eine Meningokokke-nerkrankung.
Enge Kontaktpersonen haben ein er-höhtes Risiko, an einer Meningokokken-infektion zu erkranken. Insgesamt sind je-doch nur 1–2% aller Fälle sekundär. Das höchste Risiko haben enge Haushaltskon-taktpersonen, deren Erkrankungsrisiko in verschiedenen Studien zwischen 400-
bis 1200-fach gegenüber der Allgemein-bevölkerung erhöht ist, wenn keine Che-moprophylaxe erfolgt. Krankenhausper-sonal (analog Rettungsdienstpersonal) hat nach Kontakt nur dann ein erhöhtes Ri-siko, wenn Kontakt mit respiratorischen Sekreten stattfindet, z. B. durch Mund-zu-Mund-Beatmung oder wenn ohne Atem-schutz intubiert oder tracheal abgesaugt wurde [2]. Nur dann wird eine postexpo-sitionelle Chemoprophylaxe angeraten, die, sofern der Indexfall an einer impfprä-ventablen Serogruppe erkrankte, zusätz-lich durch eine postexpositionelle Menin-gokokkenimpfung mit einem Impfstoff, der die entsprechende Serogruppe ent-hält, ergänzt werden sollte.
Die Chemoprophylaxe muss schnellst-möglich durchgeführt werden. Sinn-voll ist eine solche Maßnahme maximal bis 10 Tage nach dem letzten Kontakt zu einem Erkrankten. Mittel der Wahl für Kinder ist Rifampicin. Es wird bei Säug-lingen, Kindern und Jugendlichen bis 60 kg über 2 Tage in einer Dosierung von 2×10 mg/kg KG/Tag gegeben (maxi-male ED 600 mg). Jugendliche ab 60 kg und Erwachsene erhalten 2×600 mg/Tag für 2 Tage. Bei Neugeborenen im 1. Le-bensmonat beträgt die Dosis 2×5 mg/kg KG/Tag ebenfalls für 2 Tage. Für Erwach-sene ist Ciprofloxacin (einmalige Dosis 500 mg p. o.) für die Chemoprophylaxe zugelassen. Weiterhin ist eine Prophyla-xe mit Ceftriaxon (nur i.m.-Applikation) mit einer einmaligen Gabe von 125 mg bei Kindern unter 12 Jahren und 250 mg bei Kontaktpersonen über 12 Jahren möglich. Bei Schwangeren ist Ceftriaxon das Mittel der Wahl [2, 3]. Bei der Auswahl des zur
Prophylaxe verwendeten Antibiotikums sollte die regionale Resistenzsituation be-achtet werden [4].
Korrespondenzadresse
PD Dr. S. Schulz-StübnerDeutsches Beratungszentrum für Hygiene (BZH GmbH)Schnewlinstraße 10, 79098 [email protected]
Literatur
1. Ventzke MM, Lampl L (2013) Medizin unter beson-deren Umständen. Eine schwierige Mission. Notfall Rettungsmed 16:637–642
2. RKI Ratgeber für Ärzte (Stand September 2011) Meningokokken-Erkrankungen. http://www.rki.de
3. Deutsche Gesellschaft für Neurologie. S1-Leitlinie Ambulant erworbene bakterielle (eitrige) Menin-goenzephalitis. Stand September 2012, AVMF-Re-gisternummer 030/089
4. Zalmanovici Trestioreanu A, Fraser A, Gafter-Gvi-li A et al (2013) Antibiotics for preventing menin-gococcal infections. Cochrane Database Syst Rev 10:CD004785. doi:10.1002/14651858.CD004785.pub5
Erwiderung
Dr. M.-M. Ventzke, L. LamplAbteilung X – Anästhesie und Intensivmedizin,
Bundeswehrkrankenhaus Ulm
Wir danken Herrn Kollegen Schulz-Stüb-ner für sein Interesse an unserem Fall-bericht. Leider ließ die Kasuistik keinen weiteren Raum für die Diskussion der auf dem Balkan vorherrschenden Keimpro-blematik im Allgemeinen und in diesem Fall im Speziellen. Daher begrüßen wir es ausdrücklich, dass Herr Schulz-Stüb-ner die Chemoprophylaxe bei bakteriel-
Zum Beitrag
Ventzke MM, Lampl L (2013) Medizin unter besonderen Umständen. Eine schwierige Mission. Notfall Rettungsmed 16:637–642. doi:10.1007/s10049-013-1757-z
253Notfall + Rettungsmedizin 3 · 2014 |
Leserbriefe

ler Meningitis in seinem Leserbrief aufge-griffen und somit die Möglichkeit weite-rer Ausführungen eröffnet hat.
Schulz-Stübner führt in seinem Leser-brief die Empfehlungen des Robert Koch Instituts [1] und die Leitlinien der Deut-schen Gesellschaft für Neurologie [2] be-züglich der durchzuführenden Chemo-prophylaxe bei Kontaktpersonen zu Pa-tienten mit ambulant erworbener, eitriger Meningitis aus. Hätte es sich um eine der-artige Meningitis gehandelt, so wäre eine Chemoprophylaxe tatsächlich nur beim intubierenden Notarzt erforderlich ge-wesen [2]. Betrachtet man den deutschen Rettungsdienst, so herrscht dort in allen Berufsgruppen teilweise erhebliche Ver-unsicherung über die Virulenz des Erre-gers, sodass dort häufig eher großzügig Chemoprophylaxe ohne hinreichende In-dikation betrieben wird (eigene Beobach-tungen).
Mit an Sicherheit grenzender Wahr-scheinlichkeit handelte es sich jedoch bei der Patientin um eine, wie Schulz-Stübner ausführt, postoperative, nosokomiale Me-ningitis, wo bei den Kontaktpersonen kei-ne Chemoprophylaxe erforderlich wäre. In der Regel handelt es sich bei den Erre-gern um Enterobacteriaceae, Pseudomo-naden oder Staphylokokken [3]. Relevant für deren Behandlung wäre die aktuelle Resistenzlage in Bosnien. Hier herrscht ein hohes Vorkommen multiresistenter Erreger (gramnegative und Staphylokok-kus aureus) vor, was die Antibiose im Fal-le einer Infektion erschwert. Dies war je-doch nicht Gegenstand des Fallberichts, da die Patientin von einer zivilen Einrich-tung in die universitäre Klinik in Sarajevo verlegt wurde.
Letztlich muss angemerkt werden, dass die (multiresistente) Erregersituation in Bosnien nicht hinreichen bei der Vorbe-reitung des Transports antizipiert wurde und die Durchführung diesbezüglich hät-te verbessert werden können.
Korrespondenzadresse
Dr. M.-M. VentzkeAbteilung X – Anästhesie und Intensivmedizin, Bundeswehrkrankenhaus UlmOberer Eselsberg 40, 89081 [email protected]
Literatur
1. RKI Ratgeber für Ärzte (Stand September 2011) Meningokokken-Erkrankungen. http://www.rki.de
2. Deutsche Gesellschaft für Neurologie. S1-Leitlinie Ambulant erworbene bakterielle (eitrige) Menin-goenzephalitis. Stand September 2012, AVMF-Re-gisternummer 030/089
3. Prange H, Bitsch A (Hrsg) (2001) Infektionserkran-kungen des Zentralnervensystems, 2. Aufl. Wissen-schaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart