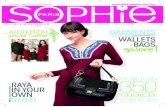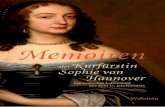Sophie Wolfrum: Performativer_Urbanismus
-
Upload
johannes-knesl -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of Sophie Wolfrum: Performativer_Urbanismus
-
1
Sophie Wolfrum
PERFORMATIVER URBANISMUS
SPIELE DER SCHRITTTE
Stadt und Bewegung werden schon seit langem gemeinsam gedacht, es gibt eine reiche Geschichte
an produktiven konzeptionellen Allianzen. Nikolai Anziferow, Geograf in St. Petersburg, betreibt
Anfang der 1920er Jahre Stadtexkursionen als Exkursionswissenschaft. Die sinnliche Erfahrung des
stdtischen Raums liefert ebenso wichtige Erkenntnisse wie die Recherche in Bibliotheken und
Kartenwerken. Sein Buch Die Seele Petersburgs (1922) wird zum Kultbuch in der spten
Sowjetunion. Man kann in ihm einen der Vorlufer der urban und cultural studies sehen, fr die das
Reisen, das sorgfltige Beobachten des Alltags, das intensive Sich-Einlassen auf den Ort und die
Banalitt transitorischer Orte wichtig werden. John Brinckerhoff Jackson fhrt mit seinem Motorrad
von der Ost- zur Westkste der USA und alles, was er sieht, ist wichtig. Fr diese Art der
Wahrnehmung kann man nicht in den Bibliotheken sitzen bleiben. Lucius Burckhardt greift spter in
Kassel die Exkursionswissenschaft als Spaziergangs-Wissenschaft oder Promenadologie auf.
Stadtspaziergnge sind heute eine Unterrichtsform in der Architekturlehre.
Michel de Certeau schreibt 1980: Der Akt des Gehens ist fr das urbane System das, was die
uerung (der Sprechakt) fr die Sprache oder fr formulierte Aussagen ist. ... Die Spiele der
Schritte sind Gestaltungen von Rumen. Sie weben die Grundstruktur von Orten. In diesem Sinne
erzeugt die Motorik der Fugnger eines jener realen Systeme, deren Existenz eigentlich den
Stadtkern ausmacht, die aber keinen Materialisierungspunkt haben. Sie knnen nicht lokalisiert
werden, denn sie schaffen erst den Raum. (Certeau 1988, 188,189) In der Sprache der Gegenwart
nennt Francesco Careri das Gleiche walkscapes, Gehen als sthetische Praxis, und auch er bezieht
sich natrlich auf die Situationisten, radikale Aktionisten der 1960er Jahre, die heute wieder
auerordentliche Beachtung finden.
Die Situationisten um Guy Debord entwickeln mit la drive, dem ziellosen Umherschweifen, der
Bewegung als Wahrnehmung und als Produktion von Raum, eine urbanistische Methode. Die
Absichtslosigkeit des Flaneurs, der zur Jahrhundertwende die Passagen von Paris durchschlendert,
findet sich ein halbes Jahrhundert spter in ihrem ziellosen Umherschweifen wieder. Weitere fnfzig
Jahre spter ist die Rezeption der Situationistischen Internationale ungebrochen. Diese bt mit dem
Konzept der psychosozialen Produktion des Raumes, der Psychogeografie, groen Einfluss in der
Urbanistik aus, und ihre Radikalitt macht sie zum immer wiederkehrenden Bezugspunkt in der
Bildenden Kunst.
In der Kunst gibt es in den 1960er und 1970er Jahren eine aktive Phase der ffentlichen
Performance, die in jngster Zeit in einer Reihe von Ausstellungen wieder ins Bewusstsein gerufen
wird. Performing the city, 2008 von Heinz Schtz kuratiert, ist ein Beispiel dafr. Oder die Szene um
die Wiener Aktionisten, gezeigt in Occupying Space Sammlung Generali im Haus der Kunst 2004,
oder in Wien im MUMOK 2008 mind expanders performative Krper utopische Architekturen um
68. Gordon Matta Clark wird 2008 in Chikago mit einer groen Werkschau geehrt, ein ausgebildeter
-
2
Architekt, der als Knstler in vielen seiner Aktionen als Urbanist bezeichnet werden knnte. Dies
sind nur einige Beispiele fr einen deutlichen Trend zu Retrospektiven, die von einer erneuten Welle
an performativen Aktionen begleitet werden.
Offensichtlich gibt es verschiedene Kulturen, die hinter dem gegenwrtigen Interesse an Gehen und
Reisen, leiblicher Erkenntnis und gelebtem Raum, kultureller Produktion des Raumes, situativem
oder performativem Urbanismus stehen.
RAUM
Das wieder aufgeflammte Interesse fr Henri Lefvbres Raumtheorie zeigt in diesem
Zusammenhang, dass Raum, so auch der gesellschaftliche Raum der Stadt, als kontinuierlich
produziert verstanden wird: la production de lespace. Auch ber den sozialen Aspekt hinaus
definieren wir Raum als leiblich produziert. Was Lefbvre in seiner komplexen Raumtheorie l`espace
vcu nennt, entspricht im Deutschen in etwa dem Begriff des gelebten Raumes, der den aktiven
Prozess von Wahrnehmung und Produktion zugleich beschreibt.
Foucault berhmter Vortrag Andere Rume aus dem Jahr 1967 leitet die Raumorientierung der
Gegenwart ein: Unsere Zeit liee sich dagegen eher als Zeitalter des Raumes begreifen. Wir leben
im Zeitalter der Gleichzeitigkeit, des Aneinanderreihens, des Nahen und Fernen, des Nebeneinander
und des Zerstreuten. Spt publiziert und spt ins Deutsche bersetzt wird er in den 80er Jahren ein
Schlsseltext in einem Diskurs, der etwa 1990 zum so genannten spatial turn der Kultur- und
Geisteswissenschaften fhrt. Die Vormachtstellung der Zeit in der Moderne wird relativiert, sogar die
Historiker wenden sich dem Raum zu. Im Raume lesen wir die Zeit lautet ein bekannter Buchtitel des
Historikers Karl Schlgel. Das Vergangene, das Heutige und das Zuknftige findet an einem Ort
statt. Es schreibt sich ihm ein. Das macht Stdte so spannend fr Bewohner und Besucher und dem
gehen Historiker nun nach. Aber Raum speichert nicht einfach nur verschiedene Zeiten, die sich
dann wie in einem Geschichtsbuch im Ort lesen lassen. In der Reflexiven Moderne oder Zweiten
Moderne hat vielmehr die Vorstellung der Gleichzeitigkeit von Prozessen und Modellen, des
Nebeneinanders und des Sowohl-als-auch gegenber den alten Hierarchien, Ausschlielichkeiten
und Eindeutigkeiten Vorrang gewonnen. Im Raum knnen sich diese Heterogenitten berlagern, in
denen wir heute denken, die wir wahrnehmen und akzeptieren. Nach Bruno Latour zeichnet sich
Raum durch das Vermgen aus, Komplexitt zu bergen: Philosophen definieren Zeit als eine
Ordnung der Aufeinanderfolge und Raum als eine der Gleichzeitigkeit. Solange wir alles unter der
Macht des Fortschritts zu den Akten nahmen, lebten wir in der Zeit der Aufeinanderfolge. Kronos
fra alles Archaische und Irrationale in seiner Nachkommenschaft auf und verschonte nur jene
Nachkommen, denen eine strahlende Zukunft bestimmt war. ... Die revolutionre Zeit, der groe
Vereinfacher, ist ersetzt worden durch die Zeit des Zusammenlebens, die alles kompliziert macht.
Anders gesagt, der Raum hat die Zeit als prinzipielles Ordnungssystem abgelst. (Latour 2005) Das
ist schn gesagt und Bruno Latour bezieht sich offensichtlich auf Leibniz, der an Samuel Clarke
schrieb: Was meine eigene Meinung anbetrifft, so habe ich mehr als einmal gesagt, dass ich den
Raum ebenso wie die Zeit fr etwas rein Relatives halte, nmlich fr eine Ordnung des
-
3
Nebeneinanderbestehens, so wie die Zeit eine Ordnung der Aufeinanderfolge ist. Nmlich als Raum
bezeichnet man eine mgliche Ordnung der Dinge, die gleichzeitig existieren, wobei man sie als
gemeinsam existierend betrachtet, ohne dabei nach ihrer besonderen Art und Weise des Existierens
zu fragen. (Leibniz 1715)
Es ist also eigentlich nichts Neues im Grundsatz des Denkens ber Raum, neu ist allerdings, dass
man die Gegenwart in der Kategorie Raum angemessen reflektiert sieht, nachdem Raum lange
berhaupt als reaktionre Kategorie, als irrelevante Vorstellung oder gar als eine Schimre
angesehen wurde. Raum wird in seiner ganzen Komplexitt, die in der Philosophie und
Naturwissenschaften schon lange gedacht wird, nun auch in der Urbanistik konzeptionell entfaltet.
Whrend wir durch die Stadt gehen oder fahren oder skaten, haben wir nicht nur unterschiedliche
Erfahrungen, je individuelle Sichtweisen, sondern das Spiel der Schritte schafft den Raum. Die
Kultur des Raumes wird wieder als entscheidend fr die Kultur der Stdte angesehen. Eine Kultur
der Bewegung und des Performativen ist damit eingeschlossen.
ARCHITEKTUR
Im gleichen Zuge wird auch Architektur als die Kunst, Raum zu artikulieren (Eco, 1968) in der
Urbanistik wieder aktuell. Die Architekturtheorie pflegt ebenfalls eine Diskurslinie, die den
performativen Aspekt des Architektonischen hervorhebt, eine spezifische sthetische Begabung von
Architektur, die als eine sthetik des Performativen beschrieben wird. Architektur unterscheidet sich
darin grundstzlich von andern gestaltenden Kulturtechniken: Wir selbst sind in Architektur
Bestandteil der sthetischen Realitt. Wir knnen nicht einfach nur distanzierter Beobachter sein,
denn wir sind mit unserem Krper Teil des Raumes, den wir erfahren. Es ist immer eine komplexe
architektonische Situation, in der wir uns befinden, in der man Architektur erlebt und sie nicht
lediglich betrachtet. Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur mit den Augen,
sondern mit allen Sinnen und erst in der Bewegung vollstndig wahrgenommen werden kann. Wir
sind also immer zugleich Akteur. Da die Rezeption von Architektur heute so stark an die Bildmedien
gebunden ist, tritt dann oft diese schale Enttuschung ein, wenn wir vor Ort sind und die so
geweckten sthetischen Vorstellungen durch die Wirklichkeit nicht eingelst werden. Architektur
entfaltet sich in der Wirklichkeit erst in einem kulturellen Ereignis - in einer Situation des Gebrauchs.
In der Architektur sind wir Mitspieler, so beschreibt Dagobert Frey schon in den 1920er Jahren diese
spezifische Begabung von Architektur. (Frey 1926) Es ist dies also auch keine neue Erkenntnis,
sondern eine in der Architekturtheorie seit langem gepflegte. Sie bekommt jedoch in der Parallelitt
der anderen Diskurse des Performativen eine neue Aktualitt, die Architektur und Urbanistik wieder
produktiv aufeinander beziehen kann, nachdem sich in der Moderne die Urbanistik als
Sozialwissenschaft und Planungstheorie von der Architektur entfernt hatte.
Der performative Aspekt betont die Komponente des rumlichen Erlebens, Erfahrens und Handelns,
die unabdingbar in die architektonische Wirklichkeit eingeschlossen ist. Architektur verfgt demnach
ber ein Repertoire von spezifisch architektonischen Mitteln und Strukturen, die erst in einem
kulturellen Ereignis, in einer Situation des Gebrauchs, der Bewegung und des Darin-Seins whrend
-
4
der Rezeption Wirklichkeitscharakter entfalten. In diesem performativen Akt unterscheidet sich
Architektur von den Bildenden Knsten einerseits und von systematischer Planung andererseits.
Szenischer Raum, Baudrillard benutzt diesen Ausdruck fr eben diesen Sachverhalt, ist ein
entscheidender Aspekt entfalteter Architektur. [...] szenischer Raum, ohne den, wie wir wissen, die
Gebude nur Konstruktion wren und die Stadt nur eine Agglomeration. (Baudrillard 1999, 12)
PERFORMATIVER URBANISMUS
Das Konzept von szenischem Raum will ich deutlich unterscheiden von dem der Szenographie.
Dann nmlich werden stdtische Sujets nicht als Rume, sondern als Bilder konzipiert, um in einer
konomie der Aufmerksamkeit beachtet zu werden. Die Bilder werden zu den eigentlichen
Attraktoren: hher, einmaliger, aufflliger, eleganter, authentischer, lokaler, globaler ... sie sollen sich
angesichts eines gigantischen Bilderrauschens einbrennen. Als szenographische Bilder bertragen
sie die Flachheit und Gerichtetheit des Bhnenbildes auf die Stadt. Architektur muss in diesem
Dienste Superzeichen liefern, welche Bedeutung anzeigen und die auch auf schlechten
Reproduktionen leicht wieder erkennbar sind. Stdte sollen in der Form von Palmen, Seepferdchen
oder Tropfen schon aus dem Flugzeug erkannt werden. Der Standpunkt des Betrachters wird bei
dieser Strategie vorgegeben: Die Palme aus der Luft, Pudong vom Bund, Heidelberg vom
Philosophenweg. Touristen streben zielgerichtet auf diese Orte zu, von denen aus ihre Erwartung
besttigt wird, von denen aus das schon lngst medial vermittelte Bild wahrhaftig zu werden scheint.
Verlsst man diesen Standort des inszenierten oder des tradierten Blicks, sieht man gar nichts mehr,
man durcheilt Niemandsland. Stdte reduzieren sich auf eine Kulisse, die hinter Hochzeitsfotos oder
Touristenfotos aufscheint. In einer visuell dominierten Kultur besteht auch allseits die Tendenz,
Architektur und Stadt auf bildmchtige Klischees zu reduzieren. Es sind die so genannten
Erlebniswelten, die eine Einkaufspassage als ein Village, ein Casino als ein Stck Venedig, eine
Altstadt als Relikt aus dem Mittelalter in Szene setzen.
Performativer Urbanismus will die Architektur der Stadt weit ber ihre objekt- oder bildhaften
Eigenschaften hinaus bewerten. Im Vordergrund dieses Verstndnisses von Architektur und Stadt
stehen die Prozesshaftigkeit der rumlichen Erfahrung, die Ereignisstruktur von rumlichen
Zusammenhngen, die Offenheit von rumlichen Strukturen. Die architektonische Substanz ist
Voraussetzung und Komponente von Ereignissen, aber in performativen Akten erst kommt sie zur
Entfaltung, erst dann bekommt sie soziale und sthetische Relevanz. Es geht also um beides, um
die architektonische Substanz und um das Ereignis, um Kontingenz. Mit dem Blick auf das
Performative und Kontingenz wre es jedoch ein Irrtum zu glauben, der materielle Aspekt der
Architektur wre nun irrelevant, sie solle lediglich neutraler Hintergrund und bloe Folie sein. Im
Gegenteil wird hier die berzeugung vertreten, dass Architektur Prgnanz aufweisen muss, um
Spielrume im Handeln erffnen zu knnen. Prgnanz bedeutet: Artikulierte Rume, dichte
Atmosphre, sthetische Komplexitt, Form und Material, architektonisches Repertoire. Auf der
Seite von Kontingenz stehen: performativer Aspekt, Offenheit, Variabilitt im Gebrauch,
Verschiebung von Bedeutung, Aneignungsmglichkeiten, Spielraum, Performance.
-
5
Performativer Urbanismus bleibt nicht bei einer psychogeografischen Rezeption von Stadt stehen,
sondern sieht zugleich die Dringlichkeit von architektonischem Entwurf.
Anmerkung
Der Gedankengang beruht den Arbeiten von Alban Janson, Architekt und Sophie Wolfrum,
Urbanistin, und wurde in hnlicher Form bereits formuliert in:
Janson, Alban / Wolfrum, Sophie, Leben bedeutet zu Hause sein, wo immer man hingeht. In: Jrgen
Hasse (Hg.), Die Stadt als Wohnraum. Freiburg Mnchen 2008
Janson, Alban / Wolfrum, Sophie, Kapazitt - Spielraum und Prgnanz. In: Der Architekt. Der unsichtbare Kern. Heft 5-6/ 2006
Literatur
Anziferow, Nikolai, Die Seele Petersburgs, Petersburg 1922; Mnchen 2003
Baudrillard, Jean, Architektur. Wahrheit oder Radikalitt?, Graz/Wien 1999
Borden, Iain, Skateboarding, Space and the City. Architecture and the body, Oxford/New York 2001
Careri, Francesco, Walkscapes. Walking as an Aesthetic Practice, Barcelona 2002
Certeau, Michel de, Gehen in der Stadt, in: Ders., Kunst des Handelns, Berlin 1988, S. 179209
Eco, Umberto, La struttura assente, Mailand 1968; Einfhrung in die Semiotik, Mnchen 1972
Fischer-Lichte, Erika, sthetik des Performativen, Frankfurt a. M. 2004
Frey, Dagobert, Wesensbestimmung der Architektur, (1926), in: Kunstwissenschaftliche Grundfragen
Prolegomena zu einer Kunstphilosophie, Baden bei Wien 1946, S. 93106
Gosztonyi, Alexander, Der gelebte Raum, in: Der Raum. Geschichte seiner Probleme in Philosophie
und Wissenschaften, Freiburg/Mnchen 1976, S. 943971
Lefebvre, Henri, La Production de lespace, Paris 1974
Situativer Urbanismus, Arch+ Nr. 183, 2007
Soja, Edward W., Thirdspace, Blackwell 1996