Stundenbild Psychologie: Sprache & Denken –...
Click here to load reader
Transcript of Stundenbild Psychologie: Sprache & Denken –...

Judith Mayr
1
Stundenbild: Sprache & Denken – Automatismen / Stroop-Effekt
Schulstufe: 7. Klasse AHS, Pflichtfach, ca. 25 SchülerInnen
Lehrplanbezug: Kognitive Prozesse reflektieren – Sprache und Denken
Lehrziel: Die SchülerInnen sollen durch das Experiment (Stroop-Test) für
Automatismen sensibilisiert werden, beziehungsweise über die enge Verbindung von
Sprache und Denken lernen.
Fächerübergreifende Bezüge: Philosophie, Deutsch, Biologie
Quellen:
• Anderson, John R. Kognitive Psychologie. Heidelberg, 2001.
• Hofbauer, Stefan. Stroop Interferenz und DC-Potentiale. Wien, 1998.
• http://www.farbimpulse.de/farbwirkung/detail/0/25.html
• http://www.wikipedia.org
Zeit Inhalt Methode Medium / Materialien
5’
Begrüßung,Organisatorisches,Wiederholung der
letzten Stunde
L-S Gespräch
10’ ExperimentL – S
(s. Beschreibung desExperiments, unten)
PC + Beamer, wennnicht vorhanden: OH
10’Nachbesprechung,
Ergebnisse, Erklärungdes Experiments
L – S
15’ Theorie, andereBeispiele Frontalunterricht OH, Tafel, Heft
10’ Schluss
Zuordnungsaufgabezur Festigung dessoeben Gelernten,
abschließendesVergleichen
Partnerarbeit

Judith Mayr
2
Vorbereitung:
Der/die LehrerIn muss drei Präsentationstafeln bereithalten. Für die Präsentation
selbst eignet sich meiner Meinung nach am besten ein PC und Beamer, weil die drei
Tafeln somit groß und für alle in der Klasse gut sichtbar sind und somit auch die
SchülerInnen, die nicht am Experiment beteiligt sind, den Ablauf gut mitverfolgen
können. Per OH-Folie müsste es aber notfalls genau so gut funktionieren.
Experiment:
Für den ersten Durchgang soll sich eine Versuchsperson freiwillig melden. Diese wird
eventuell gebeten, sich nach vorne zu setzen, um die Tafeln so gut wie möglich
ablesen zu können. Außerdem wird eine Person benötigt, die die Zeit mitstoppt,
sowie eine weitere Person, die die Fehler (Versprecher) der Vp notiert. Nun beginnt
die Präsentation der Versuchstafeln.
Tafel 1 – „Farbwörtertafel“:Auf der Tafel sind schwarz gedruckt Farbwörter
ersichtlich (s. Bild 1).
Anweisung an die Vp:Lies die Wörter so schnell wie möglich laut vor!
Beginne dabei bei der linken Spalte und lies
von oben bis unten (dann die mittlere, dann die
rechte Spalte)!
Bild 1

Judith Mayr
3
Tafel 2 – „Farbfeldertafel“:Auf der Tafel sind Farbfelder ersichtlich (s. Bild 2).
Anweisung an die Vp:Benenne die Farben so schnell wie möglich laut!
Beginne wieder bei der linken Spalte, von oben
nach unten, etc.
Bild 2
Tafel 3 – „inkongruente Farbwörter“:Auf der Tafel sind inkongruente Farbwörter
ersichtlich.
(inkongruent = nicht übereinstimmend)
z.B. das Wort „gelb“ in grüner Schriftfarbe, das
Wort „grün“ in roter Schriftfarbe, etc.
(s. Bild 3)
Anweisung an die Vp:Lies NICHT das Wort, sondern benenne die Farbe
in der es geschrieben ist, so schnell wie möglich!
Bild 3

Judith Mayr
4
Nacharbeit:
Nach den drei Durchgängen werden die beiden HelferInnen gebeten, sowohl die
längste beziehungsweise kürzeste Zeit als auch die Anzahl der Versprecher bekannt
zu geben. Es wäre bestimmt interessant, den Test mit mehreren Versuchspersonen
durchzuführen, man hätte somit auch mehr Vergleichsmöglichkeiten. Der Vorteil bei
diesem Test liegt meiner Meinung nach darin, dass es egal ist, wenn andere
Versuchspersonen ihn auch noch probieren, obwohl sie vorher bereits zugesehen
haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen sogar motiviert werden, die erste
Versuchsperson zu überbieten, und es selbst ausprobieren wollen in der Hoffnung,
weniger Fehler zu machen. Weiters glaube ich nicht, dass man mit diesem
Experiment Gefahr läuft, jemand bloßzustellen oder durch Nennen der Fehleranzahl
zu beleidigen. Es ist besonders wichtig, schon im Vorhinein klarzustellen, dass dieser
sogenannte Test nichts mit Intelligenz der einzelnen Person zu tun hat (im
Gegensatz zu der Auffassung des Begriffes „Test“, den die SchülerInnen sonst
gewohnt sind).
Zu erwartendes Ergebnis:
Die Interferenzwirkung äußert sich üblicherweise als Verzögerung der Reaktionszeit,
mit der die Versuchsperson reagiert. Folglich wird die Versuchsperson bei Tabelle
am längsten brauchen und auch die meisten Fehler machen. Dadurch wird
unterstrichen, wie sehr Sprache und Denken vernetzt sind bzw. wie sehr das Lesen
eines Wortes in unserem Gedächtnis automatisiert ist. Trotz der Aufforderung (vgl.
Tafel 3) die Wörter NICHT zu lesen, sondern nur die Schriftfarbe zu benennen, lesen
wir eigentlich automatisch das Wort zuerst. Daher fällt es oft schwer, die Schriftfarbe
zu nennen, wenn sie nicht dem Wort selbst entspricht, und es kommt deshalb zu
häufigeren Versprechern. Der Weg von einem Farbeindruck zum sprachlichen
Output ist demnach länger als vom Wort zum sprachlichen Output.

Judith Mayr
5
Theorie und weitere Beispiele:
Das so genannte Stroop-Verfahren ist ein Verfahren zur Messung der individuellen
Interferenzneigung (Farb-Wort-Interferenz). Die Versuchspersonen bekommen Worte
in verschiedenen Druckfarben dargeboten und sollen die Druckfarbe nennen:
NEUTRALE Wörter: „Lob“ = grün gedruckt
KONGRUENZwörter: „grün“ = grün gedruckt, oder
KONFLIKTwörter: „rot“ = grün gedruckt
Das Phänomen des Stroop-Effekts zeigt sich auch bei Dingen, denen eine Farbe
ziemlich eindeutig zugeordnet werden kann, wie z. B. „Kohle“ (schwarz) oder „Gras“
(grün). Auch bei anderen inkongruenten Reizen funktioniert der Stroop-Effekt, etwa
beim Hören: Wenn jemand das an eine Tafel geschriebene Wort „leise“ laut
ausspricht, ist ein Beobachter ebenfalls beim Lesen schneller als bei der
Bezeichnung der Lautstärke.
Was sich beim Stroop-Effekt genau abspielt, ist nicht geklärt. Es gibt auch keine
einfache Erklärung – über die Komponenten, die eine Rolle spielen, ist man sich
einig, aber nicht über ihre Gewichtung. Man weiß beispielsweise, dass auf der
Bedeutungsebene länger verarbeitet wird als auf der Klangebene. Soll man
beispielsweise bei zwei angegebenen Farben benennen, ob sie jeweils eher „warm“
oder „kalt“ sind, dann dauert dies länger, als die Farbe zu benennen, obwohl in
anderen Versuchsanordnungen die Benennung der Farbe länger dauert. Lesen aber
lässt sich in dieses Muster nicht so einfach anpassen. Obwohl manche Reize
schneller verarbeitet werden als Lesen, lässt sich Lesen fast nicht stören. Wenn man
zu jemandem sagt: „Lies das nicht!“ und dabei auf ein Wort zeigt, dann geht das gar
nicht, weil es der-/diejenige im selben Moment schon liest.
Verschiedene Einzel-Vermutungen mussten schon verworfen werden. So nahm man
an, dass der Stroop-Effekt auf die Geübtheit des Lesens zurückgehe. Es zeigte sich
aber in Experimenten, dass der Stroop-Effekt selbst bei Kindern mit geringen
Lesekenntnissen zu beobachten ist – allerdings natürlich nicht bei Analphabeten.
Dann gab es die Vermutung, dass Wörter schneller identifizierbar seien als andere

Judith Mayr
6
Reize. Hier konnte Paul Fraisse 1964 jedoch experimentell nachweisen, dass Bilder
schneller erkannt werden als Wörter.
Versuche, gegen den Stroop-Effekt anzukämpfen, sind wenig wirkungsvoll: Wer etwa
20.000 Mal Inkongruenzen im Bereich Farbwahrnehmung versus Farbwort
verarbeitet, verringert den Stroop-Effekt tatsächlich etwas. Der Effekt bleibt aber im
Prinzip bestehen.
Der Stroop-Effekt tritt in vielen Versuchsanordnungen auf, z. B.:
- Ziffernfolgen, bei denen die Anzahl der Ziffern zu benennen ist, z. B.:
222
333
444
Die Antwort wäre für jede Zeile „drei“, weil überall drei Ziffern zu sehen
sind. Bei 222 und 444 ist man jedoch eher verleitet die Ziffern selbst zu
benennen.
- Orts- u. Richtungsangaben in Relation zum Gesichtsfeld, z.B.:
das Wort „links“ am rechten Rand der Tafel – verwirrend, weil man im
Gedächtnis die Seite eingespeichert hat
Abschließende Partnerarbeit zur Festigung des soeben Gelernten:
Bezeichne gemeinsam mit deinem/r NachbarIn die folgenden Sätze mit richtig (R)
oder falsch (F)!
1. Volksschulkinder machen beim Stroop-Test verhältnismäßig mehr Fehler als
Erwachsene. ……………………. (F)
2. „Grün“ ist ein Beispiel für ein inkongruentes Farbwort. ……………………. (F)
3. Wörter sind nicht schneller identifizierbar als andere Reize ..………………. (R)
4. Die Interferenzwirkung äußert sich nicht in der Reaktionszeit der
Versuchsperon ……………………. (F)
5. Kongruenz bedeutet, dass ein Wort und seine Schriftfarbe gleich sind. (z.B.
„rot“ – rot gedruckt) ……………………. (R)
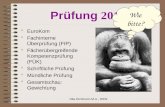

![ASTROID [1][2] [1] Asteorideneinschlag (künstlerischer Eindruck) [2] Arizona-Krater, Arizona, USA Stundenbild Guided Research Model MMag. Matthias Kittel.](https://static.fdokument.com/doc/165x107/55204d6f49795902118c08d8/astroid-12-1-asteorideneinschlag-kuenstlerischer-eindruck-2-arizona-krater-arizona-usa-stundenbild-guided-research-model-mmag-matthias-kittel.jpg)











![Stundenbild Project-based Learning Dr. Christian Reimers reimers@astro.univie.ac.at ASTROID [1] Künstlerische Darstellung.](https://static.fdokument.com/doc/165x107/55204d7549795902118ca7a7/stundenbild-project-based-learning-dr-christian-reimers-reimersastrounivieacat-httpwwwvirtuelleschuleatcosmos-astroid-1-kuenstlerische-darstellung.jpg)




