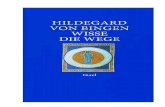Suhrkamp Verlag · 2015. 10. 25. · Unser Mann meidet Holocaust-Bcher und lßt sich bei...
Transcript of Suhrkamp Verlag · 2015. 10. 25. · Unser Mann meidet Holocaust-Bcher und lßt sich bei...
-
Louis BegleyLügen in Zeiten des Krieges Roman
Suhr
kam
pG
roßd
ruck
-
suhrkamp taschenbuch 4092
-
L�gen in Zeiten des Krieges erz�hlt die Geschichte einer Kindheitin Polen. Maciek, Sohn j�discher Eltern, w�chst – in den dreißi-ger Jahren unseres Jahrhunderts – beh�tet in einemwohlhaben-den Arzthaushalt auf, bis der Herbst 1939 mit einem Schlag dasSchicksal seiner Familie ver�ndert. Louis Begley erz�hlt in sei-nem ersten Roman die Geschichte unseres Jahrhunderts, eineGeschichte, die hier mit den mal m�rchenhaft, mal brutal ein-fachen Worten des jungen Maciek geschildert wird.
Marcel Reich-Ranicki lobte den Roman im ›LiterarischenQuartett‹: »Ein gewissenhafter Berichterstatter und ein n�ch-terner Chronist hat das Buch L�gen in Zeiten des Krieges geschrie-ben. Doch zugleich stammt es aus der Feder eines temperament-vollen Geschichtenerz�hlers. So ist es beides zugleich und aufeinmal; ein einzigartiges Zeitdokument und ein ergreifenderRoman.«
Louis Begley, 1933 in Polen geboren, studierte Literaturwis-senschaft und Jura in Harvard und arbeitete von 1959 bis 2004als Anwalt in New York. Als Schriftsteller wurde er mit seinemersten RomanL�gen in Zeiten des Krieges auf Anhieb internationalbekannt. Louis Begley lebt in New York. Zuletzt erschien vonihm im Suhrkamp Verlag Der Fall Dreyfus: Teufelsinsel, Guant�na-mo, Alptraum der Geschichte.
-
Louis BegleyL�gen in Zeiten des Krieges
RomanAus dem Amerikanischen von
Christa Kr�ger
Suhrkamp
-
Die Originalausgabe erschien 1991 unter dem TitelWartime Lies
bei Alfred A. Knopf, New York.
� Louis Begley, 1991
Umschlagfoto: Joe J. Heydecker,Warschau 1941
F�r meine Mutter
suhrkamp taschenbuch 4092Erste Auflage 2009
� der deutschen AusgabeSuhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1994
Suhrkamp Taschenbuch VerlagAlle Rechte vorbehalten, insbesondere das
der �bersetzung, des çffentlichen Vortrags sowie der �bertragungdurch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systemeverarbeitet, vervielf�ltigt oder verbreitet werden.
Satz: H�mmer GmbH,Waldb�ttelbrunnDruck: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in GermanyUmschlag: Gçllner, Michels, Zegarzewski
ISBN 978-3-518-46 092-4
1 2 3 4 5 6 – 14 13 12 11 10 09
-
L�gen in Zeitendes Krieges
-
Ein Mann von f�nfzig Jahren kçnnte er sein, oderauch etwas �lter, schon leicht gebeugt, ein Mannmit freundlichemGesicht und traurigen Augen; sa-genwir, er lebt verh�ltnism�ßig angenehm in einemfriedlichen Land. Er umgibt sich gernmit B�chern,arbeitet womçglich in einem angesehenen Verlagoder lehrt an einer Provinzuniversit�t, wie man Li-teraturenmiteinander vergleicht. Vielleicht vermit-telt er auch Autoren, Manuskripte von Dissidentenliegen ihm besonders am Herzen, Texte, die Zeug-nis ablegen gegen Unterdr�ckung und Unmensch-lichkeit. Abends liest er manchmal lateinische Klas-siker. R�ck�bersetzen kann er nicht mehr – dieZeiten sind vorbei. Latein hat er bloß l�ckenhaftgelernt, immer nur, wenn ihm wieder einmal einExamen bevorstand, und auch dann erst in letzterMinute; gr�ndlich sind seine Kenntnisse nie gewe-sen. Aber zum Gl�ck kann er die Bedeutung einesTextes noch erfassen; auch sein Erinnerungsver-mçgen ist ihm erhalten geblieben. Er bewundertdie �neis. In ihr fand er zum ersten Mal literarischausgedr�ckt, was ihn qu�lte: die Scham, am Leben
7
-
geblieben, mit heiler Haut, ohne T�towierung da-vongekommen zu sein, w�hrend seine Verwandtenund fast alle anderen im Feuer umgekommen wa-ren, unter ihnen so viele, die das �berleben eherverdient h�tten als gerade er.Er achtet darauf, die Metapher nicht zu nahe an
sich heranzulassen. Seine Heimatstadt in Ostpolenwar kein Ilium. Ein SS-Mann, der unger�hrt mitder Reitpeitsche auf einen alten Mann einschl�gt,auch wenn der schon nicht mehr wie ein Menschaussieht, kçnnte zwar gut f�r Pyrrhus’ blutigenMord an Priamus stehen – aber wo bleiben in die-sem sinnlosen Tableau die mitstreitenden goldhaa-rigen Gçtter und Gçttinnen? Er hat gesehen, wieein alter Mann gnadenlos totgeschlagen wurde; derkahlkçpfige Alte hatte sich hinknien m�ssen, diePeitschenhiebe zielten nur auf seinen blanken Sch�-del, das Blut strçmte ihm�bers Gesicht, abwischenkonnte er es nicht, die H�nde waren ihm auf demR�cken zusammengebunden. Welche Gçttin h�ttedurch diese Greueltat ger�cht werden sollen, undwodurch h�tte man sie beleidigt? War es etwa derz�rnende Jupiter gewesen, der den Sondertruppvon alten Juden zu der �beraus n�tzlichen Arbeitder Gullyreinigung abkommandiert hatte, die sie,auf den Knien liegend, absolvierten, bewacht vom
8
-
j�dischenOrdnungsdienst mit schlagbereitenGum-mikn�ppeln?Jetzt aber werden unseremMann dieMetaphern
vertrauter: Als �neas, von seiner unsterblichenMut-ter vorsorglich in dichten Nebel geh�llt, in Kartha-go den Touristen spielt, sehen seine erstaunten Au-gen an den W�nden von Didos Palast kunstvolleBilder mit blutigen Schlachtszenen aus dem Tro-janischen Krieg. Hat unser Mann nicht auch gleichnach dem Ende seines Krieges die ersten Bildb�n-de mit Photos von Auschwitz, Bergen-Belsen undBuchenwald betrachtet, nackte, zu Skeletten abge-magerte M�nner und Frauen gesehen, die nochlebten und in die Kamera starrten? W�st auf einenHaufen geworfene Leichen? Warenlager von Bril-len,Uhren und Schuhen? Welchen Sinn hat da sein�berleben? Wenn Vater �neas mit dem kleinenJulus aus Troja flieht, erf�llt er damit ein bindendesVersprechen: Er wird das ewige Rom gr�nden;kraft Jupiters Willen und mit etwas Zungenakro-batik wird Ascanius-Julus zum Ahnherrn der Ju-lischen C�saren. Unser Mann, Treibgut, unterge-taucht und hochgesp�lt, ausgelaugt und gestrandet,kann keine Bestimmung f�r sich erkennen. SeineErinnerungsbilder sind Stoff f�r Alptr�ume, mitMythen haben sie nichts gemein.
9
-
Unser Mann meidet Holocaust-B�cher und l�ßtsich bei Essenseinladungen nicht auf Plaudereien�ber Polen im Zweiten Weltkrieg ein, auch wenndie schçnen Augen seiner Tischdame ihm parf�-mierten Trost versprechen. Berichte �ber Folterun-gen von Dissidenten und politischen Gefangenendagegen liest er wieder und wieder, jedes Verhçrstellt er sich bis in alle Einzelheiten vor. Wie langeh�tte es wohl gedauert, bis er schreiend zusammen-gebrochen und zu Kreuze gekrochen w�re? Ob ersofort weich geworden w�re oder erst, nachdemsie ihm die Finger gebrochen h�tten? Wen h�tteer verraten und wie schnell? Er ist ein Voyeur desBçsen geworden, starrt gebannt auf die grauenhaf-ten Szenen, die vor seinem inneren Auge abrol-len; manchmal weiß er nicht, welchen Part er darinspielt. Mußte das Kind, das er einmal war, sich soentwickeln, ist das der Preis f�r seine Weise des�berlebens?F�r Catull empfindet er eine Affinit�t anderer
Art, die aufblitzt wie ein Leuchtfeuer �ber schwar-zem Wasser. Er malt sich die Kindheit des Dich-ters aus, das Leben in der Umgebung von Verona,das anheimelnde Landhaus amGardasee, die schnit-tige Jacht. Ein g�tiger Vater begleitet Catull nachRom und ebnet ihm die Wege. Der Dichter liebt
10
-
Lesbia, die schçne Nymphomanin Lesbia, nichtbegehrlich, wie jedermann Frauen liebt, sondernmit der Liebe, die ein Rçmer f�r seine Sçhne undSchwiegersçhne empfindet. Leider ist die Liebe zuLesbia eine Krankheit. Diese treulose Lesbia, dieCatull mehr als sich und seine Sippe liebt, spielt�ble Spiele – »an Kreuzwegen, in schmutzigen Sei-teng�ßchen rupft sie die hochgeborne Rçmerju-gend!« Nun will der Dichter nicht mehr, daß sietreu ist, selbst wenn das mçglich w�re. Er mçchtenur selbst gesunden, die qu�lende Krankheit ab-sch�tteln, die ihm alle Freude verg�llt hat. Ipse va-lere opto et taetrum hunc deponere morbum . . . DieseZeilen haben unseren Mann jahrelang verfolgt, ermeint Catulls Krankheit bis auf den Grund zu ken-nen, auch er wollte nichts anderes mehr, bloß nochgesunden, um jeden Preis. Nur trifft auch dieseMe-tapher nicht. Seine Krankheit geht tiefer als diedesDichters. Catull zweifelt keinen Augenblick dar-an, daß er geboren ist, um gl�cklich zu sein undFreude zu empfinden angesichts der guten Taten,die er fr�her begangen hat, benefacta priora voluptas.Das sind die Gçtter ihm schuldig, da er ihnen treuwar. O di, reddite mi hoc pro pietate mea. Der Mannmit den traurigen Augen ist �berzeugt, daß er f�ralle Zeiten ver�ndert ist, wie ein gepr�gelter Hund,
11
-
und daß kein Gott ihn heilen kann. Gute Taten,auf die er zur�ckblicken kçnnte, hat er nicht getan.Trotzdem, es hilft ihm, das Gedicht wieder undwieder zu sagen. Heulen vor Verzweiflung wird ernicht.Er denkt an die Geschichte des Kindes, aus
dem so ein Mann geworden ist. Maciek soll dasKind heißen, wie der kleine Maciek in dem altenLied, der feine Kerl, der unerm�dlich immer wei-tertanzt, solange die Musik spielt.
12
-
I
Geboren bin ich ein paarMonate nach demReichs-tagsbrand, in T., einer Stadt mit ungef�hr vierzig-tausend Einwohnern in einem Teil Polens, der vordem Ersten Weltkrieg zur K. u. k.-Monarchie ge-hçrt hatte. Mein Vater war der angesehenste Arztin T. Keiner konnte ihm das Wasser reichen, we-der der Chef des Krankenhauses, ein katholischerChirurg, noch die beiden praktischen �rzte, mei-nes Vaters Kollegen. Nur mein Vater hatte Diplo-me von der Universit�t Wien; nur er hatte vom er-sten gimnazjum-Jahr an als zeller gegolten und diein ihn gesetzten Erwartungen gl�nzend erf�llt, in-dem er eine jener goldenen Uhren gewann, dieKaiser Franz Joseph jedes Jahr an die besten Abi-turienten im Kaiserreich verteilen ließ; und kei-ner tat es ihm gleich an aufopfernder Freundlich-keit und F�rsorge f�r die Patienten. Meine Mutter,eine Schçnheit aus Krakau, war viel j�nger als er;sie starb im Kindbett. Die Heirat war durch einenEhevermittler zustande gekommen, aber der Dok-tor und die Schçnheit verliebten sich so schnellund heftig ineinander, daß man in der Familie die
13
-
Geschichte wie einM�rchen erz�hlte, undmein Va-ter schwor, er werde den Rest seiner Tage nur derErinnerung an meine Mutter und dem Leben mitmir widmen. Er hielt sein Wort sehr lange.Meine Mutter hatte eine �ltere Schwester, die
noch schçner als sie war und jetzt als einziges Kindauch viel reicher; alle waren sich einig, daß dieseSchwester wohl nie heiraten w�rde, auch nicht ih-ren verwitweten Schwager. In der hermetischenWelt reicher galizischer Juden hing ihr ein Ger�chtan: Man munkelte, sie habe sich mit einem katholi-schen Maler eingelassen, und bei dem Versuch aus-zureißen seien die beiden erwischt worden. DerK�nstler habe sich in seinem Verhalten offenbarvon der angenehmen Aussicht auf ihre Mitgift lei-ten lassen; als aber mein Großvater einschritt undseinen lodernden Zorn gleichm�ßig auf die Reli-gion und das Boheme-Leben des Freundes meinerTante verteilte, sei dessen Hoffnung auf die Mitgiftzerronnen, und er habe sein Verhalten dementspre-chend ge�ndert. W�re es um eine andere Frau ge-gangen, dann h�tten akzeptablere Liebhaber vonSchçnheit und Geld und erst recht ihre M�tterund alle weiblichen Verwandten, die sonst nochnach Br�uten Ausschau hielten, derlei Geschichtenwohl geflissentlich vergessen. Aber Tanja, so hieß
14
-
meine Tante, Tanja konnte auf soviel Nachsichtnicht hoffen. Ihre Respektlosigkeit und ihre uner-bittlich scharfe Zunge waren genauso Stadtgespr�chwie ihr Eigensinn und J�hzorn. Man bezeichnetesie als weibliche Variante ihres Vaters: Der war einMann, den sich zwar jeder zum Gesch�ftspartnerw�nschte, den aber kein denkender Mensch ernst-haft als Ehemann oder Schwiegersohn in Betrachtgezogen h�tte.Dazu kam der Schatten, der auf der Familie lag –
Ungl�ck oder schlechtes Blut, was wußte man –, je-denfalls waren die gl�nzenden Aussichten meinerMutter und Tanjas getr�bt, seit ihr j�ngerer Bru-der sich einige Jahre zuvor das Leben genommenhatte. Er war nicht zur Universit�t zugelassen wor-den (damals f�hrten die polnischen Universit�tengerade eine Quotenregelung f�r Juden ein), w�h-rend das M�dchen, das er liebte, die Studienerlaub-nis bekommen hatte. In den Sommerferien ritt erviel durch den Wald, der an den Besitz meinesGroßvaters grenzte. Bei einem dieser Ausfl�ge wur-de er von einem heftigen Gewitter �berrascht. Erstieg vom Pferd, suchte Schutz unter einem Baum,hielt das Pferd am Z�gel und versuchte es zu be-ruhigen, indem er ihm die N�stern streichelte undk�ßte. Da schlug dicht neben ihm ein Blitz ein.
15
-
Das Pferd geriet in Panik und biß meinen Onkelmehrmals ins Gesicht. Die Wunden vernarbtenschlecht und sahen sehr h�ßlich aus. Seine Freun-din zog sich zur�ck; mein Onkel wußte nicht, obdie Ablenkungen des Lebens an der Universit�tder Grund daf�r waren oder ob sie ihn abstoßendfand. Das eine war so schlimm wie das andere.Man bem�hte sich, einen Platz an einer ausl�n-dischen Universit�t f�r ihn zu finden, aber nochvor dem Ende des Herbstsemesters ging er einesNachmittags in den Stall und erschoß sein Pferdund sich selbst.So kam es, daß Tanja zu uns zog, meinem Vater
den Haushalt f�hrte und sich um mich k�mmerte.Wir wohnten weiter in dem Haus, in dem ich
geboren war; meine Eltern hatten es gleich nachder Hochzeit von der Mitgift meiner Mutter ge-kauft. Das Haus stand in einem Garten an derHauptstraße von T. Unsere Wohnung und die Pra-xis meines Vaters waren in dem einstçckigen Fl�-gel untergebracht, der parallel zur Straße lag. Derandere Fl�gel, im rechten Winkel zu unserem ge-legen, mit Eingang zum Hof, war vermietet: ImErdgeschoß wohnten ein Gymnasiallehrer und sei-ne Frau, im ersten Stock Pan Kramer, der Besit-zer einer Schreibwarenhandlung, mit Frau und
16
-
Tochter Irina, die zwei oder drei Jahre �lter alsich war. Bis die Deutschen kamen, spielten Irinaund ich nie zusammen; mein Vater fand das un-passend.Wie jeder Mann in Polen, sobald er sich rasieren
muß,wurde auch Vater Kramer mit Pan angeredet;nur Diener, Bauern und Arbeiter hatten keinen An-spruch auf diese Ehrensilbe. Mutter Kramer hießf�r jeden außer der Familie und engen FreundenPani Kramerowa oder Pani Renata. W�re Irinaerwachsen geworden, h�tte man sie Panna Krame-r�wna oder Panna Irina oder auch, weil die pol-nische Sprache f�r Essen und Trinken und f�r Na-men Diminutive bevorzugt, Panna Irka genannt.Unser Wohnzimmer lag hinter dem Sprechzim-
mer meines Vaters; die Patienten gingen, wenn siean der Reihe waren, durch eine große, weiße Pol-stert�r zur Untersuchung zu ihm hinein. Nebender T�r stand ein riesiger weißer Kachelofen. Derfahle Riese mit den breiten Schultern, der michin einen n�chtlichen Alptr�umen heimsuchte, kammanchmal durch diese T�r oder aus der Nischezwischen Kachelofen und Wand, wo Feuerholzund ein paar Spielzeuge verstaut waren.Dann schrieich laut und erstarrte vor Angst, und es n�tzte garnichts, daß mein Kinderm�dchen die T�r çffnete
17
-
und mich in die vertraute Umgebung des Sprech-zimmers trug, die Nische hinter dem Ofen leerr�umte und alle Holzscheite und alle Spielzeuge,die Sandschaufeln und Holzautos einzeln auf demTeppich vor mir ausbreitete, damit ich sehen konn-te, daß nichts hinter ihnen versteckt war, ein Rieseschon gar nicht. Mein Entsetzen wuchs nur, ichschrie immer lauter, aber es half alles nichts: Manmußte eine Pferdedroschke losschicken und Tanjaoder meinen Vater aus dem Restaurant oder Caf�holen lassen, in dem sie gerade saßen.An diese Zeit der Ungeheuer und anderer Er-
eignisse meiner Kindheit habe ich die ersten eige-nen Erinnerungen – andere als die schçngef�rbtenGeschichten aus unserem idyllischen Leben, dieTanja mir sp�ter w�hrend der Kriegsjahre erz�hl-te. Ich erinnere mich, daß Tanja und mein Vaterabends meistens ausgingen. Mein Vater war fr�hmit seinen Hausbesuchen fertig. Dann spielte ermit mir, bis es Zeit f�r die Verabredung mit sei-nen beiden j�dischen Kollegen und deren Frauenwar; sie gingen zusammen zum Essen oder zumKaffeetrinken. Das Kaffeehaus galt als wienerischund war in T. eine sehr beliebte Einrichtung. Mankam nie zu fr�h oder zu sp�t, um dort einen Freundvorzufinden. Man blieb eine Weile oder ging auch
18
-
in ein anderes Caf� oder in ein Restaurant mit Tanz.Manchmal begleitete Tanja meinen Vater. H�ufigeraber ging sie mit Bern aus, dem reichsten j�dischenRechtsanwalt in T., einem eingefleischten Jungge-sellen. Anders als mein Vater war Bern ein Bonvi-vant, der sich viel auf seine beinahe unbegrenzteF�higkeit, Tokajer undWodka zu konsumieren, zu-gute hielt. Er war auch ein hervorragender T�nzer.Wenn er abends kam, um Tanja abzuholen, ver-suchte sie manchmal, mich von meiner Angst vordem drohenden Alleinsein abzulenken, und batihn, das Grammophon aufzuziehen; dann legtensie eine Platte auf und f�hrten mir seine Spezial-t�nze vor, langsamen Walzer und Tango.Im Sommer traf sich mein Vater nach der Mit-
tagsruhe mit Bern, dem katholischen Chirurgenund dem einen oder anderen seiner j�dischen Kol-legen zum Tennis. Tanja und ich sahen oft beiden Spielen zu. An anderen Nachmittagen gingenwir zum Strand – ein Uferstreifen, der jeden Som-mer sorgf�ltig mit einer dicken Schicht von wei-ßem Sand bedeckt wurde. Manmußte Eintritt zah-len, um den Strand benutzen zu d�rfen, und kamdann in den Genuß von Liegest�hlen, Sonnen-schirmen und Umkleidekabinen. Nur unerschrok-kene Schwimmer wagten sich in die Strçmung
19