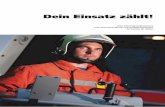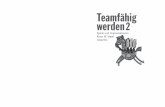KOMPETENZKARTEN F£“R DIE MIGRATIONSBERATUNG Warum ... Tak¤±m £§al¤±¥mas¤± becerileri Teamf£¤higkeit
TeamFünf
-
Upload
ralf-reuter -
Category
Documents
-
view
244 -
download
10
description
Transcript of TeamFünf

TEAM FÜNFMedizin
Die Volkskrankheit arterielle Hypertonie
ist Hauptrisikofaktor für Nierenversagen
BAuMASSnAhMen
Sanierung der Kreisklinik Trostberg geht
in die Schlussphase
RuheStAnd
Chefarzt Dr. Hans-Michael Schwab aus
Berchtesgaden
Leute von unS
Prof. Ketterl abseits des Klinikalltags
unterwegs auf dem Jakobsweg
Mitarbeiterzeitschrift der Kliniken Südostbayern AG Ausgabe 18 - Nummer 4 / 2011

4/2011
Editorial
Ach, da war ja noch was….
iMPReSSuM
herausgeber:
Redaktionsteam der Mitarbeiterzeitschrift
der Kliniken-Südostbayern AG
v.i.S.d.P.: Ralf Reuter
Fotos: Redaktionsmitglieder sowie fotolia.com
Gestaltung und Layout: Ralf Reuter
Produktion & druck: Chiemgau Druck - Vogel
Auflage: 3800 Expl.
erscheinungsweise: drei- bis viermal jährlich
Redaktion:
+ Dr. Herbert Bruckmayer (TB) Innere Medizin
+ Günter Buthke (TB) Verwaltung
+ Hermann Dengl (TS) Fachweiterbildung
Anästhesie/Intensiv
+ Manfred Geiler (TB) Stat. 1B
+ Erika Kutlay (Rei) Innerbetr. Fortbildung
+ Angelika Meier (BGD) Verwaltung
+ Wolfgang Raufeisen (TB) BIG
+ Ralf Reuter (TS) Information - Kommunikation
+ Evelyn Tauber (Rei) Öffentlichkeitsarbeit
+ Christian Schuster (TS) BIG
+ Helmut Weiß (Rei) Schule
Anschrift der Redaktion:
team fünf, Klinikum Traunstein, Ralf Reuter
Cuno-Niggl-Str. 3, 83278 Traunstein
t 0861/705-1530
F 0861/705-1532
Die Mitarbeiterzeitung wird auf FSC-zertifiziertem
Papier gedruckt (www.fsc-deutschland.de)
Gehen Sie gerne auf Christkindlmärkte oder haben Sie schon genug? Lassen Sie sich mit
einem ruhigen Gang über einen romantischen Christkindlmarkt auf die „staade“ und be-
sinnliche Zeit einstimmen? (dieser Satz wird immer gern genommen!)
Einen Christkindlmärktemangel können wir ja nicht beklagen. Von groß, überfüllt in Salz-
burg, bis urig und noch überfüllter auf der Fraueninsel oder verzaubert und mittlerweile
noch voller in Halsbach bis romantisch und bescheiden auf Schloss Gruttenstein in Bad
Reichenhall und viele, viele weitere, haben wir im Chiemgau und Rupertiwinkel in der Vor-
weihnachtszeit ganz gut zu tun, möchten wir diese alle besuchen.
Die „Krönung“ für mich persönlich waren heuer die Märkte in Berlin. Da ich im November
sowieso dort war, klapperte ich als Fan mal einige Christkindlmärkte, falsch – es heißt
dort „Weihnachtsmärkte“ - also klapperte ich einige Weihnachtsmärkte ab. Der Erste
wurde bereits am 21. November (!!) mit großem Medienaufwand, mit Bürgermeister und
einem Schlag auf den roten Knopf eröffnet. Unter „Ah-“ und „Oh“-Rufen erleuchteten
auch sofort 250.000 Glüh-, Blink- und LED-Lämpchen und mit gefühlten 10.000 Watt
sang eine brasilianische Sängerin „White Chrismas“ und läutete somit die besinnliche Zeit
ein. …………..!! Na ja – Großstadt eben - und wir vom Land!
Der Knaller war der Weihnachtsmarkt, eher ein Wintermarkt, am Potsdamer Platz. Dort
hat die Tourismus GmbH aus dem Salzburger Land eine 20 Meter hohe Schipiste aufge-
stellt und von irgendwoher Schnee herbekommen. Am Fuße dann ein kleines Weihnachts-
dorf mit Currywurst und weiteren, tatsächlich Salzburger, Leckereien. Unter Laserlicht und
mit Bassbooster unterstützter Musik (als ich da war, erklang
„Ich hab’ ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner“ !!!!!),
konnten die Besucher mit Reifen die Piste hinunter in die Ro-
mantik des Alpendorfes rutschen.
Es gibt übrigens 95 Weihnachtsmärkte nur allein im Stadtge-
biet von Berlin und auf denen, die die ich besucht hatte,
häufig gleiche Produkte. Nicht unbedingt Schund, das kann
man wirklich nicht sagen.
Als ich auf einem der schönsten meiner Marktauswahl so
dahinschlenderte, umspielt von zarten Klängen aus den
oben erwähnten Lautsprechern, entdeckte
ich was. An der Rückseite eines Glühwein-
standes, und in diesem Fall reichte wohl
auch die Beleuchtung nicht mehr aus,
stand da was – eine fast mannshohe Dar-
stellung der Heiligen Familie! Und jetzt fiel
es mir wieder ein – ach ja, da war doch
noch was!
Und hier wäre wieder die neueste Mitarbei-
terzeitung – noch mit altem Namen.
Eine ruhige Weihnachtszeit und das Beste
für 2012 wünscht die Redaktion von
TeamFünf
Ralf Reuter
2
einsendeschluss von Beiträgen für die nächste Ausgabe von team Fünf: 29. Februar 2012

4/2011
Inhalt
In eigener Sache
Herzlichen Dank für die vielen Vorschläge für den neuen
Namen unserer nächsten Mitarbeiterzeitung. Sie können
uns noch gerne bis Ende Januar 2012 Ihre Vorschläge mit-
teilen.
Aus der Führung
4 . . . . . . . . . Rückblick und Ausblick
Medizin
6 ......... Die Volkskrankheit arterielle Hypertonie ist Haupt -
risikofaktor für Nierenversagen
Fortbildungen, Symposien, veranstaltungen
8 . . . . . . . . . Über 300 Teilnehmer kamen zum 13. „Chiemgauer
Intensivtag“
10 . . . . . . . . . Traunsteiner Palliativstation stellte sich vor
11 ......... Kinderintensivstation und „Bunter Kreis“ in-
formierten am „Tag des Frühgeborenen“
der Betriebsarzt informiert
12 . . . . . . . . . Gefährdungsbeurteilung im Krankenhaus
Baumaßnahmen
14 ......... Sanierung der Kreisklinik Trostberg geht in die
Schlussphase
Abschied
16 ......... Mit Prof. Ketterl abseits des Klinikalltags unterwegs
auf dem Jakobsweg
umweltmanagement
20 . . . . . . . . . 78 neue Schülerinnen und Schüler erlernen den
Pflegeberuf
die Personalabteilung informiert
22 ......... Die elektronische Lohnsteuerkarte und ELStAM,
.........Sozialausgleich, usw.
Betriebsausflug
24 . . . . . . . . . Traunsteiner und Trostberger besuchten die „Goldene
Stadt“ an der Moldau
Glosse
25 . . . . . . . . . Sie haben Post! oder Brave new world
Sucht
26 . . . . . . . . . Onlinesucht = „Verhaltenssucht“
neue Gesichter
30 . . . . . . . . . Michael de Jesus Pereira, Oberarzt Unfallchirurgie, Bad
Reichenhall
. . . . . . . . . Dr. Andrea Streicher, Oberärztin – Kardiologie, Klinikum
Traunstein
31 . . . . . . . . . Alexandra Wedler, Assistentin der Geschäftsführung
28 ......... Herzlich willkommen Kolleginnen und Kollegen aus
Ruhpolding
29 ......... Siegel der Qualitätsoffensive „Premium Region Ber ch -
tesgadener Land“ für die Kreisklinik Berchtesgaden
31 ......... Elektronische Zeitschriftenbibliothek
32 ......... Neue Mitarbeiter
34 ......... Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen
3

4 Aus der Führung 4/2011
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,wie jedes Jahr möchte ich in der letzten Mitarbeiterzeitung vor
Weihnachten traditionell einen kurzen Rückblick auf das vergan-
gene Jahr 2011 und einen Ausblick auf das kommende Jahr
2012 werfen.
Insgesamt bin ich mit der Entwicklung der Kliniken Südostbay-
ern AG zufrieden. Auch wenn einige Dinge noch nicht erreicht
sind, so sind wir mit unserer Kliniken SOB AG im Jahr 2011 ins-
gesamt doch einen großen Schritt weitergekommen.
In Bad Reichenhall haben wir uns medizinisch weiterentwi-
ckelt und das erste "Volljahr" mit der übergeordneten kardiologi-
schen Abteilung Traunstein – Bad Reichenhall mit Linksherzka-
thetermessplatz mit einer sehr guten Fallzahlentwicklung hinter
uns. Gleichzeitig konnten wir neue Honorarärzte gewinnen und
die Stroke Unit aufbauen. Insgesamt sind unsere Fallzahlen in
Bad Reichenhall deutlich angestiegen.
In Berchtesgaden konnten wir ebenfalls ein erstes komplettes
Jahr der Geriatrischen Rehabilitation erfolgreich zu Ende bringen
sowie mit dem lang ersehnten Bauabschnitt beginnen. Auch
wenn wir zurzeit überwiegend noch Lärm und Dreck haben, so
ist die Sanierung des Berchtesgadener Hauses ein gutes Signal,
dass die Kliniken SOB AG zu Berchtesgaden steht.
In Freilassing haben wir eine neue medizinische Mannschaft,
die sich aktiv um die Patienten und das Haus kümmert. Die Ak-
zeptanz und die Fallzahlen haben sich sehr gesteigert, worüber
wir froh sind.
In traunstein hat der Bauabschnitt 7 das Jahr geprägt, wobei die
Belastungen im Jahr 2011 deutlich geringer waren als im Vorjahr.
Im Oktober ist das Ambulante Operationszentrum in Betrieb ge-
gangen, welches wir nun zunehmend mehr auslasten. Die Fallzah-
len sind deutlich gestiegen, wenngleich uns die Neurochirurgie im
Jahr 2011 doch erhebliche Sorgen gemacht hat. Dieses Problem
werden wir im kommenden Jahr lösen.
Das trostberger haus hat sich sehr gut stabilisiert. Mit dem letz-
ten Bauabschnitt haben wir begonnen, so dass Trostberg auch
baulich ein attraktives Krankenhaus bleibt.
Nun möchte ich noch kurz auf zwei übergeordnete Themen einge-
hen. Die Übernahme des Krankenhauses vinzentinum in
Ruhpolding durch die Kliniken SOB AG hat uns durch das ge-
samte Jahr 2011 begleitet. Nach umfangreichen Vorarbeiten
konnten die Verträge unterzeichnet werden und der Übernahme
des Krankenhauses Vinzentinum zum 1. Januar 2012 steht nun
nichts mehr im Weg. Zahlreiche Mitarbeiter und Arbeitsgruppen
bereiten die Integration von Ruhpolding in die Kliniken SOB AG vor.
Wir freuen uns auf Ruhpolding und sind froh, dass die Zeit des
Übergangs nun endlich vorbei ist. Ich hoffe, dass sich das Kran-
kenhaus mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Klini-
ken SOB AG gut aufgehoben fühlt und uns das bringt, was wir uns
von Ruhpolding erhoffen.
Im Jahr 2011 hatten wir in unseren jährlichen Budgetverhandlun-
gen doch erhebliche Schwierigkeiten. So konnten wir uns mit den
Krankenkassen bis jetzt noch nicht auf neue Krankenhausbud-
gets für traunstein und Bad Reichenhall / Freilassing eini-
gen. Kurz vor Weihnachten werden wir in der sogenannten
Schiedsstelle sein. Wir hoffen, dass die Schiedsstelle unsere Ar-
gumentationen nachvollziehen kann, damit wir etwas auskömm-
lichere Budgets für die beiden größten und in den Fallzahlen dy-
namischsten Häusern der Kliniken SOB AG erhalten.
Trotz mancher Misserfolge und noch einiger offener Fragen,
glaube ich, dass wir insgesamt mit der Entwicklung unserer Häu-
ser der Kliniken SOB AG im Jahr 2011 zufrieden sein können.
Stefan nowack
Vorstand der Kliniken Südostbayern AG

5Aus der Führung4/2011
Was erwartet uns im Jahr 2012?
Das Jahr 2012 wird für die Kliniken SOB AG – wie für alle deut-
schen Kliniken – erheblich schwieriger werden als das Jahr 2011.
Dies hat mehrere Gründe. Zum einen werden unsere Budgets im
Jahr 2012 lediglich um 1,48 Prozent steigen. Gleichzeitig laufen
zurzeit die Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund für die
Ärzte und ab März 2012 mit ver.di für alle Krankenhausmitarbei-
ter. So sehr jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sich über
hohen Lohnzuwachs freut, die Krankenhäuser müssen zu erwar-
tende höhere Personalkosten durch Einsparungen ausgleichen.
Auch die Ausgaben für Energie sind für unsere Kliniken – wie für
jeden von uns – extrem stark angestiegen. Hier müssen wir wie-
derum die wesentlich höheren Kosten durch Einsparungen kom-
pensieren, wobei wir hier auch über eine neue Energiepolitik für
unsere Kliniken nachdenken müssen. Von der Öffentlichkeit weit-
gehend unbeachtet, wurden bereits im Jahr 2011 neue wirtschaft-
lichere Kühlaggregate in Traunstein aufgestellt. Für die Zukunft
gilt, dass wir auch in unseren Kliniken unser Hauptaugenmerk auf
Einsparpotentiale bei der Energie richten. Dies ist kurzfristig nicht
lösbar, ist jedoch mittel- und langfristig von großer Wichtigkeit.
Im Jahr 2012 wird sich die Schere zwischen unseren Erlösen ei-
nerseits und unserer Kosten andererseits weiter vergrößern. Des-
halb ist ein erweitertes Programm zur Stabilisierung und Defizitbe-
grenzung kurz "SuD-Paket" notwendig. So wichtig konkrete Einspa-
rungen zur Verbesserung unserer Rentabilität sind, so wichtig ist
auch gleichzeitig die Weiterentwicklung der Kliniken SOB AG und
seiner Standorte sowie die Integration der Standorte. Hierzu ei-
nige Beispiele:
+ Das alte Annette-Kolb-Gymnasium wird gegenwärtig durch den
Landkreis Traunstein für unser Bildungszentrum umgebaut und
geht im Sommer 2012 in Betrieb. Damit haben wir erstklassige
Möglichkeiten, unsere Aus- und Weiterbildung weiter voran zu
bringen.
+ Die Baumaßnahmen an den Standorten Berchtesgaden, Traun-
stein und Trostberg gehen auch im Jahr 2012 weiter, damit un-
sere Standorte auch in Zukunft attraktiv sind.
+ Besonderes Augenmerk gilt der Integration und Weiterentwick-
lung von Ruhpolding als sechster Standort der Kliniken SOB
AG. Der Startschuss ist gegeben, nun gilt es die medizinischen
Möglichkeiten, insbesondere aber die Patientenzahl von Ruh-
polding positiv weiter zu entwickeln.
Die Integration der Kliniken SOB AG mit den einzelnen Abteilungen
wird uns auch im Jahr 2012 beschäftigen. Ziel dabei ist: so viel In-
tegration wie möglich bei bester Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Für
uns gilt es im Jahr 2012 die Balance zwischen notwendigen Ein-
sparungen einerseits und Realisierungen von Zukunftsinvestitio-
nen andererseits zu finden. Durch Sparen alleine werden wir die
Zukunft ebenso wenig positiv gestalten wie eine Außerachtlassung
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ausschließliche
Konzentration auf Investitionen ohne Berücksichtigung der ent-
sprechenden Kosten.
Die Kliniken SOB AG ist mittlerweile einer der größten Arbeitgeber
der Region und hat sich insgesamt bei Patienten und niedergelas-
senen Ärzten einen positiven Ruf erarbeitet.
Zum Abschluss danke ich Ihnen, auch im Namen unserer Land-
räte Hermann Steinmaßl und Georg Grabner sowie unseres Auf-
sichtsrates, für die geleistete Arbeit im Jahr 2011 sehr herzlich!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familienangehörigen ein friedliches
und schönes Weihnachtfest und für das Jahr 2012 Ihnen und uns
alles Gute, Glück, Gesundheit und Erfolg.
Ihr
Stefan Nowack
Vorstand

6 Medizin 4/2011
■ in deutschland leiden ca. 25 bis 30
Prozent der erwachsenen unter hohem
Blutdruck. dieser liegt dann vor, wenn
wiederholt Blutdruckwerte über 140/90
mmhg gemessen werden. die arterielle
hypertonie ist weltweit der hauptrisiko-
faktor für ernste herz-Kreislauf-Komplika-
tionen und eine der hauptursachen der
Gesamtsterblichkeit der Weltbevölke-
rung. häufige Komplikationen, die das
Patientenschicksal entscheidend beein-
flussen, sind Schlaganfall, herzinsuffi-
zienz, Gefässerkrankungen und cerebrale
durchblutungsstörungen. vor allem aber
schädigt ein hoher Blutdruck die nieren
und bewirkt unbehandelt oft eine entste-
hung oder verschlechterung einer niere-
ninsuffizienz bis hin zum völligen nieren-
versagen und notwendigkeit der dialyse-
behandlung. das Fatale beim Bluthoch-
druck dabei ist: die wenigsten Patienten
haben Beschwerden durch den erhöhten
Blutdruck. die hypertensiven endorgan-
schädigungen entwickeln sich schlei-
chend und meist ohne Warnsymptome.
darüber hinaus hat die arterielle hyperto-
nie auch durch die hohe Komorbidität
von 80 Prozent bei Patienten mit diabe-
tes mellitus eine herausragende medizi-
nische und gesundheitspolitische Bedeu-
tung.
Vorbeugung durch Blutdruck-kontrolle:Schützen Sie Ihre Nieren – messen Sie
Ihren Blutdruck!
Die Nieren spielen eine zentrale Rolle in
der Steuerung des Blutdrucks. Insbeson-
dere durch das Renin-Angiotensin-Aldoste-
ron-System mit Regulation des Kochsalz-
und Wasserhaushalts des Organismus
sowie Interaktionen zum sympathischen
Nervensystem wird der Blutdruck reguliert.
Nierenerkrankungen führen sehr häufig zu
einer Bluthochdruckentstehung, und zwar
unabhängig von der Ursache der Nieren-
krankheit (renoparenchymatöse Hyperto-
nie). Umgekehrt führt ein hoher Blutdruck
sehr oft zu einer schweren Schädigung der
Nierenglomeruli als den kleinsten renalen
Filterkörperchen mit Entwicklung einer Glo-
merulosklerose, Nierenfunktionssein-
schränkung und Eiweißverlust über den
Harn. In Bezug auf die arterielle Hypertonie
ist die Niere also Opfer und Täter zugleich.
Im Vordergrund steht daher das rechtzei-
tige Erkennen von erhöhten Blutdruckwer-
ten, um hypertensiven Endorganschäden
an Herz, Hirn, Gefäßen und der Niere vor-
beugen zu können. Neben der Blutdruck-
messung durch den Arzt sind Selbstmes-
sungen des Blutdrucks durch den Patien-
ten mit validierten vollautomatischen oszil-
lometrischen Meßgeräten eine wichtige Er-
gänzung. Eine besondere Bedeutung hat
die ambulante 24-Stunden-Butdruckmes-
sung (ABDM) mit einer 15-minütigen Mess-
dichte tags und 30-minütig nachts als eine
wichtige komplementäre Meßmethode, um
den Schweregrad des Bluthochdrucks zu
erfassen. Zusätzlich korrelieren die Resul-
tate sehr gut zur Endorganschädigung und
erfassen damit das individuelle Patienten-
Risiko sehr gut. Damit kann eine bestmög-
liche medikamentöse individuelle Thera-
piestrategie gewählt und gesteuert werden.
Diagnostik bei der arteriellen Hypertonie
Die Diagnostik bei Bluthochdruck umfasst
+ die Klärung, ob eine organische, sog.
Die Volkskrankheitarterielle Hypertonieist Hauptrisikofaktorfür Nierenversagen

7Medizin4/2011
sekundäre Hochdruck-Ursache vorliegt
+ die Diagnose, ob bereits hypertensive
Endorganschädigungen vorliegen
+ die Prüfung, ob weitere kardiovaskuläre
Risikofaktoren bestehen.
Bei 90 Prozent der Patienten mit erhöhtem
Blutdruck ist keine organische Ursache
fassbar; man spricht von einer sog. „essen-
tiellen Hypertonie“. Ca. 10 Prozent der Pa-
tienten haben eine sekundäre Hochdruck-
form. Hierbei spielen vor allem endokrine
Ursachen eine Rolle (Hyperaldosteronis-
mus; Überfunktion der Schilddrüse und
Nebenschilddrüse). Zusätzlich führen ver-
schiedene Formen einer Nierenarterienste-
nose (fibromuskuläre Dysplasie; häufigere
Form: atherosklerotisch bedingt) zu einer
renovaskulären Hypertonie. Im Rahmen
eines rationellen diagnostischen Stufen-
programms müssen bei entsprechenden
Hinweisen auf das Vorliegen einer sekun-
dären Hypertonie weiterführende Untersu-
chungen erfolgen. Bei Patienten mit einer
sekundären Form der Hypertonie kann die
Behandlung der auslösenden Ursache (wie
operative Entfernung eines Drüsenade-
noms bei Hyperaldosteronismus) eine Blut-
drucknormalisierung bewirken.
Für die Auswahl der individuell besten me-
dikamentösen Therapie soll geprüft wer-
den, inwieweit der hohe Blutdruck beim Pa-
tienten bereits zu einer Schädigung an ver-
schiedenen Organsystemen geführt hat.
Hierbei gehört insbesondere die Messung
der Nieren-Retentionsparameter und eine
Urintestung auf eine Eiweißausscheidung.
Denn durch eine moderne antihyperten-
sive Therapie wird nicht nur der Blutdruck
auf den Zielbereich gesenkt, sondern auch
eine individuell bestmögliche Organprotek-
tion für Herz, Hirn und Nieren ermöglicht.
Zur Ursachenklärung und Einstellung der
arteriellen Hypertonie, insbesondere bei
schweren Formen des Bluthochdrucks,
kann ein kurzer stationärer Aufenthalt sinn-
voll sein.
Therapie der arteriellen Hyper-tonie und welcher Zielblutdruckfür welchen Patienten?
Basismaßnahmen bei Patienten mit Blut-
hochdruck sind: Gewichtsnormalisierung,
Nikotinverzicht, regelmässige körperliche
Aktivität und Sport, Stressabbau sowie die
Einhaltung einer relativ kochsalzarmen
Kost. Vor allem die mediterrane Küche
scheint Vorteile unter den flankierenden
Allgemeinmaßnahmen zur Blutdrucksen-
kung zu haben.
In der Auswahl von Medikamenten zur
Blutdrucksenkung spielt zum einen das
Vorliegen weiterer kardiovaskulärer Risiko-
faktoren wie Diabetes mellitus oder Über-
gewicht eine Rolle. Die arterielle Hyperto-
nie wird zunehmend als „progressives kar-
diovaskuläres Syndrom“ mit der Notwen-
digkeit einer Risikostratifizierung in Abhän-
gigkeit weiterer Risikofaktoren gewertet.
Zum anderen bestimmen etwaige Begleit-
erkrankungen wie koronare Herzkrankheit
oder bereits eingeschränkte Nierenfunk-
tion die Wahl der Medikamenten-Klasse.
Das primäre Ziel und die hauptsächliche
therapeutische Wirkung der antihypertensi-
ven Therapie ist die Blutdrucksenkung per
se. Neben der Blutdruckeinstellung soll
durch die Wahl der antihypertensiven Me-
dikamente ein bestmöglicher Schutz der
Organfunktionen für jeden Patienten indivi-
duell erreicht werden (Nephro- und Kardio-
protektion). Selbstverständlich ist eine opti-
male Verträglichkeit Voraussetzung in der
Behandlung des Bluthochdrucks, denn nur
dann ist eine Einnahmetreue gewährleis-
tet. In Abhängigkeit von weiteren Begleiter-
krankungen sollte der sog. Zielblutdruck
für jeden Patienten definiert werden. Bei
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion (diabetische oder nicht-diabetische
Nephropathie) ist eine Senkung des Blut-
drucks auf 130/80 mmHg empfehlens-
wert. Zwischen der Höhe des Blutdrucks
und dem jährlichen Verlust der glomerulä-
ren Filtrationsrate besteht ein direkter Zu-
sammenhang.
“Protect the Kidney to Save theHeart”war das Motto des Weltnierentages 2011.
Das Vorliegen einer eingeschränkten Nie-
renfunktion ist ein erheblicher Risikofaktor
für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Kom-
plikationen. Durch eine optimale Blutdruck-
therapie kann die Nierenfunktion ge-
schützt und das Fortschreiten einer Nie -
reninsuffizienz verzögert werden. Damit
wird durch eine Blutdruckkontrolle die le-
benswichtige Funktion der Nieren stabili-
siert und darüber hinaus möglichen kardio-
vaskulären Komplikationen vorgebeugt.
Prof. Dr. Helga Frank
Nephrologie, Klinikum Traunstein
Der Blutdruck ist der zentrale Progressions-
faktor für das Fortschreiten einer Nierenin-
suffizienz unabhängig von der Genese der
Nierenerkrankung.
Prof. Dr. Helga Frank
ist spezialisiert auf
die Behandlung von
hypertensiv beding-
ten Nierenerkran-
kungen und
schwere Formen
des Bluthochdrucks.
Sie wurde laut aktueller Focus-Ärzte als
eine der Besten auf dem Gebiet der Blut-
hochdruckerkrankungen gelistet (FOCUS
Spezial November 2011).

8 Fortbildungen, Symposien, Veranstaltungen 4/2011
Viele Themen der IntensivmedizinbeleuchtetÜber 300 Teilnehmer kamen zum 13. „Chiemgauer Intensivtag“ im KlinikumTraunstein
■ zum 13. Mal fand im Klinikum traun-
stein der „Chiemgauer intensivtag“ statt.
der 1999 ins Leben gerufene Kongress
für intensivpflegepersonal und intensiv-
mediziner ist eine feste einrichtung ge-
worden, wie das große interesse der über
300 Besucher, überwiegend aus der Re-
gion, jedoch auch aus ganz Bayern und
dem angrenzenden Salzburger Land,
zeigte. Angesichts des großen Andrangs
wurden die vorträge der experten wieder
in den Seminarräumen sowie in dem zum
vortragsraum umfunktioniertem vorraum
der Krankenhauskapelle abgehalten, um
den teilnehmern die Möglichkeit zu
geben, ihr intensivmedizinisches Wissen
auf den aktuellen Stand zu bringen.
Das Klinikum Traunstein ist mit seinen 18
Intensiv- und 25 Überwachungsbetten und
zusätzlich 19 Betten auf der Kinderinten-
sivstation als Schwerpunktkrankenhaus
maßgeblich an der regionalen und teils
überregionalen Versorgung schwerstkran-
ker sowie schwerstverletzter Patienten be-
teiligt. Um den hohen Anforderungen bei
ihrer Versorgung gerecht zu werden, ist
eine umfassende Aus- und Weiterbildung
sowie kontinuierliche Fortbildung aller im
Intensivbereich arbeitender Mitarbeiter un-
erlässlich. Dass sich die Mitarbeiter dieser
Verantwortung bewusst sind, haben sie mit
ihrer zahlreichen Teilnahme am Traunstei-
ner Intensivkongress bewiesen.
Peter Nydahl, Intensivpfleger am Neurozen-
trum der Uniklinik Kiel, referierte anschau-
lich und praxisnah, dass auch Patienten,
die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung
auf ein Beatmungsgerät angewiesen sind,
nicht zwangsläufig ans Bett gefesselt sein
müssen. Eine personell zwar aufwendige,
aber mitunter machbare frühzeitige Mobili-
sierung des Patienten unter Beatmung
wirkt dem bei zu langer Bettruhe drohen-
den Muskelschwund entgegen, der eine
Entwöhnung von der Beatmung erschwe-
ren würde.
Der Vortrag von Prof. Dr. Wilfried Druml,
Nierenspezialist und Intensivmediziner in
der Uniklinik Wien, befasste sich mit der
Niere und dem Versagen des Organs bei
schwerer intensivpflichtiger Erkrankung. Er
stellte die Niere als „Sensibelchen“ heraus,
also als Organ, das auf zahlreiche Störun-
gen oft mit einer Funktionseinschränkung
reagiert, die die Prognose der Patienten
wesentlich verschlechtert und der im
schwersten Falle mit einer Blutwäsche
(Dialyse) entgegengewirkt werden muss.
Mehrere Referenten behandelten den The-
menbereich „Infektionen in der Intensivme-
dizin“. Infektionen stellen neben Erkran-
kungen der Herz-Kreislauf-Organe mit die
häufigsten Gründe für eine Aufnahme von
Patienten in der Intensivstation dar. Ferner
erleiden zahlreiche Patienten während
ihres Aufenthaltes in der Intensivstation in-
fektiöse Komplikationen, da ihr Organis-
mus wegen der schweren Erkrankung ge-
schwächt ist. Prof. Dr. Martin Brunkhorst,
Intensivmediziner in der Uniklinik Jena, Se-
kretär der Deutschen Sepsisgesellschaft
und Koordinator des Kompetenznetzwerk
Sepsis, stellte die Leitlinien zu Diagnose-
stellung und Therapie der Sepsis als
schwerster Verlaufsform von Infektionser-
krankungen dar.
Prof. Dr. Eckhard Müller, Intensivmediziner
vom Thoraxzentrum Ruhrgebiet in Herne,
beleuchtete das zunehmende Problem von
Pilzinfektionen im Intensivbereich. Ergänzt
wurde der Themenbereich Infektionen
durch den Vortrag von Prof. Dr. Ines Kapp-
stein, Chefärztin der Abteilung für Kranken-
haushygiene im Klinikum Traunstein, über
die auf dem Vormarsch befindlichen, teils

9Fortbildungen, Symposien, Veranstaltungen4/2011
gegen Antibiotika nicht mehr empfindliche
(„multiresistente“) Problemkeime. Dabei
wies sie auf den Stellenwert penibelster
Hygienemaßnahmen, insbesondere der
Händehygiene, und sorgfältiger Indikati-
onsstellung bei der Verschreibung von Anti-
biotika hin.
Wie bei jedem „Chiemgauer Intensivtag“
kamen auch medizin-ethische Fragen nicht
zu kurz. Schwerpunkt war die Intensivmedi-
zin am Lebensende. Dr. Gregor Scheible,
Intensivmediziner und Sprecher des Ethik-
kommittees im Klinikum München-Schwa-
bing, ging auf wichtige Aspekte bei der in-
tensivmedizinischen Begleitung Todkran-
ker bzw. Sterbender ein. Die Intensivmedi-
zin befindet sich häufig im Spannungsfeld
zwischen Patientenautonomie, ethischen
Überlegungen, juristischen Zwängen und
Erwartungen bzw. Hoffnungen der Angehö-
rigen.
Mit Prof. Dr. Klaus Lewandowski, Chefarzt
der Anästhesie im Elisabeth-Krankenhaus
Essen, konnte ein richtiger „Beatmungs-
Guru“ gewonnen werden. Er stellte die ver-
schiedenen Formen der Beatmung sowie
Anhaltspunkte für die optimale Einstellung
des Beatmungsgeräts bei Patienten mit
Beatmungspflicht infolge Lungenversagens
dar. Ein weiteres Thema waren Aspekte,
die sich bei der Beatmung bei Patienten
mit Übergewicht ergeben. Übergewicht ver-
langt dem Intensivpersonal oftmals
Höchstleistungen in der Bewältigung pfle-
gerischer und ärztlicher Aufgaben ab.
Den „Chiemgauer Intensivtag“ rundeten
wieder mehrere Workshops ab, bei denen
die Teilnehmer durch
Fragen und prakti-
sches Üben ihre
Kenntnisse in The-
mengebieten wie
Wiederbelebungs-
techniken, Erstellung
eines Patiententage-
buches oder die Er-
zeugung eines künst-
lichen Tiefschlafs mit
Gasnarkose vertiefen
konnten
Dr. Markus Barth
Das absolute Pausenhighlight war die zu einer überdimension-alen Kaffeemaschine umgebaute italienische Piaggio Ape

10 Fortbildungen, Symposien, Veranstaltungen 4/2011
Traunsteiner Palliativstationstellte sich vorDer Tag der offenen Tür im Klinikum Traunstein war ein überwältigender Erfolg
■ trotz des schönen Wetters war die
Resonanz beim tag der offenen tür der
Palliativstation des Klinikums traunstein
überwältigend. die überaus interessier-
ten Besucher nahmen die veranstaltung,
bei der sich die vor zwei Jahren eröffnete
Abteilung einer breiten Öffentlichkeit vor-
stellte, zum Anlass, um sich eingehend
bei den Ärzten und Pflegekräften zu infor-
mieren. Bei vorträgen rund um das
thema Palliativmedizin und hospizbeglei-
tung, an den informationsständen, in per-
sönlichen Gesprächen mit den Mitarbei-
tern und bei geführten Besichtigungen
durch die Palliativstation konnten sich
die zahlreichen Besucher einen umfang-
reichen einblick in der Arbeit der Pallia-
tivstation verschaffen.
Das große Interesse und die vielen Fragen
zeigten einmal mehr, dass gerade bei An-
gehörigen, die Betroffene selbst pflegen,
oder beim Personal von Pflegeheimen ein
großes Interesse bezüglich der palliativen
Begleitung herrscht, aber auch ein großes
Informationsdefizit darüber besteht. Bei
den zahlreichen Führungen durch die Pal-
liativabteilung waren die Besucher sehr an-
getan und beeindruckt von der wohnlichen
Atmosphäre, wobei der Aussichtsbalkon
der Abteilung große Bewunderung fand.
Ferner konnten sie spüren, dass die Pa-
tienten in ihrem letzten Lebensabschnitt
dort sehr gut behütet und aufgehoben
sind.
Auch die Vorträge wurden von den Besu-
chern sehr gut angenommen. Sie erfuhren
dabei, was Palliativmedizin heißt, wie eine
Palliativstation aufgebaut ist und welche
Angebote sie hat, was palliative Bestrah-
lung bewirkt, wo der Sinn und Unsinn in
schwierigen Lebensphasen liegt und wie
die ambulante Palliativversorgung über die
Brückenschwestern abläuft. Die Referate
spiegelten die gute, fachübergreifende
Teamarbeit wider, bei der der Patient stets
im Mittelpunkt steht. Zugleich wurde die
gute Zusammenarbeit mit den Brücken-
schwestern des „Netzwerks Hospiz - Verein
für Hospizarbeit und Palliativbetreuung
Traunstein e.V.“ und mit den ehrenamtli-
chen Hospizbegleitern des Ambulanten
Hospizdienstes des Caritas-Zentrums
Traunstein deutlich. Mehr Leute als erwar-
tet interessierten sich für den Workshop
„Aus-Zeit - eine ‚zeitlose’ Reise zum inne-
ren Ort der Achtsamkeit“ der Kunstthera-
pie.
An den sehr gut angenommenen Informati-
onsständen gab der Sozialdienst des Klini-
kums Auskunft über seine Aufgaben. Die
Brückenschwestern des „Netzwerks Hos-
piz“ stellten sich und ihre Arbeit vor. Die
Hospizhelfer des Ambulanten Hospizdiens-
tes der Caritas informierten über ihre eh-
renamtliche Arbeit. Weitere Themen waren
Angebote der Physiotherapie, kreative Me-
thoden, Aromapflege, Rituale als Sorge für
die Seele und das Erstellen einer Patien-
tenverfügung.
Günter Buhtke
Reges Interesse fanden die geführten Besichtigungen der Palliativstation, bei denen die Oberärztinder Palliativstation, Monika Kinne (2. von rechts), den Besuchern die Abläufe erklärte
Foto
s: C
hris
tine
Lim
mer
Infostände vor der Klinikkapelle
Andrea Marghescu überzeugte bei ihrem Vor-trag über die Ambulante Palliativversorgung
Geführte Besichtigungen durch die Palliativstation

11Fortbildungen, Symposien, Veranstaltungen4/2011
Wenn Kinder zu früh auf die WeltkommenKinderintensivstation und „Bunter Kreis“ des Klinikums Traunstein in-formierten am „Tag des Frühgeborenen“
■ Am „internationalen tag des Frühge-
borenen“ haben Fachpflegekräfte der
Kinderintensivstation und der nachsorge-
einrichtung für frühgeborene Kinder
„Bunter Kreis“ in der eingangshalle des
Klinikums traunstein mit einem Stand
über dieses thema informiert. dort erfuh-
ren die Besucher, dass nahezu jedes
zehnte Kind in europa zu früh, also als
„Frühchen“, zur Welt kommt und dies
etwa 400 000 Babys pro Jahr entspricht.
die Früh- und neugeborenen stellten in
europa die größte Gruppe von kindlichen
Patienten dar, so Anita Wimmer von der
Pädiatrischen intensivstation.
Am Informationsstand konnten ein Inkuba-
tor (Brutkasten) und ein „Babytherm“ (be-
heizbares Pflegebett für Frühchen) mit
Puppen als originalgetreue Nachbildungen
von frühgeborenen Kindern besichtigt wer-
den. Die meisten Besucher waren über die
Größenverhältnisse überrascht, da sie
noch nie ein Frühchen „in Natura“ gesehen
haben. Wände mit Fotos zeigten den Ar-
beitsalltag in der Kinderintensivstation des
Klinikums.
Dabei wurde deutlich, dass im Klinikum
Traunstein der Schwerpunkt der Patienten
der Kinderintensivstation in der „Neonato-
logie“ (Früh- und Neugeborenenmedizin)
liegt. Seit über 20 Jahren werden in der
Kinderintensivstation unter der Leitung von
Prof. Dr. Ulrich Bürger auch kleinste Früh-
geborene, die bis zu 17 Wochen zu früh
auf die Welt kommen können und deren
Geburtsgewicht unter 500 Gramm sein
kann, umfassend versorgt.
Seit 2010 bilden die Kinderkliniken Traun-
stein und Rosenheim das „Perinatalzen-
trum Südostbayern“, wodurch für betrof-
fene Familien in unserer Region eine wohn-
ortnahe und qualifizierte Versorgung von
Frühgeborenen sichergestellt werden kann.
Dies leistet ein Team von erfahrenen Kin-
derärzten, Fachkinderkrankenpflegekräf-
ten, Physiotherapeuten und Psychologen in
Zusammenarbeit mit der Klinikseelsorge.
Wochen und oft sogar Monate verbringen
die Familien in der Kinderintensivstation.
„Für viele eine lange, schwere Zeit, aber
auch voll schöner Momente, wie zum Bei-
spiel das Erreichen der 1000-Gramm-Ge-
wichtsgrenze, die ersten Still- und Fütter-
versuche oder das erste Bad“, sagt Anita
Wimmer.
Ein besonderes Anliegen ist dem Team der
Kinderintensivstation die entwicklungsför-
dernde Pflege der kleinen empfindsamen
Babys. Die Eltern werden bereits von An-
fang ermutigt, so oft und so lange wie mög-
lich bei ihren Kindern zu sein und zum Bei-
spiel durch das „Känguruhen“(die Kinder
liegen dabei den Eltern auf der Brust) in
Hautkontakt zu treten. Ebenso werden die
Eltern so früh wie möglich in die Pflege
ihrer Kleinen eingeführt und angeleitet.
Wenn nach dieser langen Zeit endlich die
Entlassung ansteht, blicken die Eltern die-
sem Termin mit großer Freude, aber auch
oft mit großer Unsicherheit entgegen.
Dafür wurde Anfang 2009 aus dem Team
der Kinderintensivstation die Nachsorge-
einrichtung „Bunter Kreis“ gegründet.
Nachsorgeschwestern, die die Eltern be-
reits von ihrem Klinikaufenthalt gut ken-
nen, betreuen die Frühchen auch noch die
ersten zwölf Wochen zuhause. Sie beraten
bei Pflege, Ernährung und begleiten bei Be-
darf zu Kontrollterminen und Therapien.
Schon vor der Entlassung wird ein dichtes
Netz aus weiter betreuenden Ärzten, Thera-
peuten, Kinderkrankenschwestern und
Psychologen geknüpft, um den Übergang
nach Hause möglichst optimal zu gestal-
ten. Für die Bewältigung von oft hinzukom-
menden finanziellen und sozialrechtlichen
Problemen bietet der Bunte Kreis seine
Hilfe an.
Anita Wimmer, Günter Buhtke
In der Traunsteiner Eingangshalle konnten sich am „Internationalen Tag des Frühgeborenen“ die Be-sucher über das Thema „Frühchen“ informieren

12 Der Betriebsarzt informiert 4/2011
Der Betriebsarzt informiert
Gefährdungsbeurteilung imKrankenhausWas ist eine „Gefährdungs-beurteilung“?
An dieser Stelle sollen einige Begriffe erläu-
tert werden, die zwar ziemlich trocken sind,
jedoch von großer Bedeutung sein können.
Es geht um das vom Gesetzgeber vorgege-
bene Prinzip, wie Arbeitsschutz funktionie-
ren soll.
War es früher Sache der Fachleute, vor
allem der Berufsgenossenschaften, genau
vorzuschreiben, was zu tun oder zu lassen
sei, so hat man – sicher auch auf Wunsch
der Wirtschaft – den Spieß umgedreht.
Nun müssen durch den Arbeitgeber die Ge-
fährdungen am Arbeitsplatz ermittelt und
beurteilt, die sich daraus ergebenden Ar-
beitsschutzmaßnahmen eigenverantwort-
lich festgelegt und deren Wirksamkeit
überprüft werden.
Das Arbeitsschutz-Gesetz (ArbSchG 1996)
in Umsetzung europäischer Rahmenrichtli-
nien (1992) und der Berufsgenossen-
schaftlichen Vorschrift BGV A1 verpflichtet
den Arbeitgeber dazu, für alle Arbeitsplätze
eine Gefährdungsbeurteilung durchzufüh-
ren.
Es kann sich dabei um Gefährdungen me-
chanischer, elektrischer oder biologischer
Art handeln, um Temperatur, Lärm, Strah-
lung, Gefahrstoffe, physische oder psy-
chische Belastungen, einfach um alles,
was einen Schaden beim Angestellten her-
vorrufen kann.
Der Arbeitgeber oder von ihm beauftragte
und befähigte Personen müssen grund-
sätzlich vor Beginn der Arbeiten und in aus-
reichenden Abständen die Arbeitsbedin-
gungen bewerten, Gefährdungen minimie-
ren und Maßnahmen zur Verbesserung
durchführen. Dabei sollen sie sich von Ex-
perten, insbesondere einer Fachkraft für
Arbeitssicherheit, einem Brandschutzbe-
auftragten und einem Betriebsarzt unter-
stützen lassen.
An dieser Stelle muss nochmals darauf
hingewiesen werden, dass es hierbei zwar
um eine umfangreiche Beratung und Un-
terstützung geht, die Verantwortlichkeit
aber bei der Abteilungsleitung liegt. Es han-
delt sich um eine Führungsaufgabe, die
sich aus dem Weisungsrecht und der Ver-
antwortung für die einer Leitungsperson
unterstellten Mitarbeiter und Arbeitsberei-
che ergibt.
Statt bis ins Detail gehender Regulierung
muss der Arbeitgeber die Erfüllung seiner
Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Arbeits-
mittel oder Gefahrstoffe nachweisen.
Damit dies juristisch nachvollziehbar
bleibt, werden aber natürlich weiter fach-

13Der Betriebsarzt informiert4/2011
kundige Meinungen die Grundlage sein,
der sogenannte „Stand der Technik“ muss
erfüllt werden.
Der Betriebsrat hat dabei das Recht zur
Mitbestimmung, aber auch alle Beschäf-
tigten sind aufgefordert, sich an Fragen der
Sicherheit im Betrieb zu beteiligen.
Wenn die Gefährdungsbeurteilung durch-
geführt ist, sollte sie in Ihrer Abteilung ein-
sehbar sein.
Besondere Bedeutung kann eine individu-
elle Gefährdungsbeurteilung bei besonders
gefährdeten Gruppen erlangen, wie Frauen
in der Schwangerschaft, Jugendlichen oder
Menschen mit Behinderung.
„Biologische Arbeitsstoffe“,Risikogruppen und Schutzstufen
Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroor-
ganismen (Bakterien, Viren, Pilze, Parasi-
ten, etc.), die Infektionen, sensibilisierende
(allergische) oder toxische (giftige, schädi-
gende) Wirkungen hervorrufen können.
Man unterscheidet nach „gezieltem“ (z.B.
Labore) und „ungezieltem“ Umgang (z.B.
Pflege) mit den Stoffen.
Nach der Biostoffverordnung werden sie
nach ihrem Infektionsrisiko in vier Risiko-
gruppen eingeordnet:
Risikogruppe 1:
Erreger verursachen beim Menschen wahr-
scheinlich keine Krankheit (z.B. Bäcker-
hefe)
Risikogruppe 2:
Erreger können beim Menschen eine
Krankheit hervorrufen; Gefahr für Beschäf-
tige möglich; eine Verbreitung in der Bevöl-
kerung ist unwahrscheinlich; eine wirk-
same Vorbeugung oder Behandlung ist nor-
malerweise möglich (z.B. Masern)
Risikogruppe 3:
Erreger können eine schwere Krankheit
beim Menschen hervorrufen; ernste Gefahr
für Beschäftigte möglich; Gefahr einer Ver-
breitung in der Bevölkerung kann beste-
hen, doch gibt es normalerweise eine wirk-
same Vorbeugung oder Behandlung (z.B.
Tuberkulose)
Risikogruppe 3**:
wie RG 3, jedoch normalerweise keine Infi-
zierung über den Luftweg (z.B. Hepatitis C)
Risikogruppe 4:
Erreger können eine schwere Krankheit
beim Menschen hervorrufen; die Gefahr
einer Verbreitung in der Bevölkerung ist
unter Umständen groß; normalerweise ist
eine wirksame Vorbeugung oder Behand-
lung nicht möglich. (z.B. Ebola)
Es sollte dann aus der Gesamtgefährdung
die Schutzstufe 1 bis 4 bestimmt wer-
den.
Dabei bedeutet (vereinfacht)
+ Schutzstufe 1 - die allgemeinen Hygie-
neregeln
+ Schutzstufe 2 - wie Stufe 1, zusätzlich
eine erhöhte Sorgfalt, Planung und Un-
terweisung, Vorsorge-Untersuchungen
und Impfangebote
+ Schutzstufe 3 - wie Stufe 2, zusätzlich
einem Notfallplan, die Kennzeichnung
der Arbeitsplätze mit dem "Symbol für
Biogefährdung", Anzeigepflicht und Ver-
zeichnis der Beschäftigten
+ Schutzstufe 4 - bedeutet „Einzelfallana-
lyse“, in der Regel wohl Katastrophen-
fall.
Für Krankenhaustätigkeiten trifft in der
Regel Schutzstufe 2 zu, d.h. dies ist Stan-
dard.
Für den ungezielten Umgang genügt näm-
lich in der Regel eine Schutzstufe niedriger,
also für Hepatitis C (RG 3**) die Schutz-
stufe 2.
Die Schutzstufe 3 wird lt. Auskunft der Ge-
werbeaufsicht allenfalls beim regelmäßig
geplanten ungezielten Umgang mit RG3 er-
reicht, z.B. bei der geplanten Behandlung
von Lungentuberkulose in Isolierung und
speziellen Abteilungen.
Wir haben die Einstufung der wichtigsten
Erreger und unsere Vorschläge für die Ein-
ordnung je nach Tätigkeiten in Schutzstu-
fen im Intranet/ Betriebsarzt/„ 1.9.1 Infek-
tionserreger von A-Z mit Risikogruppen und
Schutzstufen“ veröffentlicht (Aufstellung
angelegt nach dem Muster der Kranken-
haushygiene/ Frau Prof. Kappstein).
Die Aufstellung soll bei der Gefährdungsbe-
urteilung der Abteilungen behilflich sein.
Sie kann in speziellen Situationen z.B. für
die Frage „Darf eine Schwangere zu dem
Patienten mit dem Erreger xy?“ von beson-
derer Bedeutung sein.
Was bedeutet das alles für deneinzelnen Klinikmitarbeiter?
+ unterweisung: Jeder muss regelmä-
ßig (jährlich oder bei Veränderung) über
den Umgang mit den wichtigsten Gefah-
ren unterwiesen werden, er muss sich
auskennen.
+ Schutzmassnahmen: Es muss ihm
z.B. eine kostenlose persönliche Schutz-
ausrüstung („PSA“, z.B. Masken,
Schutzbrillen) soweit sinnvoll, möglich
und vertretbar zur Verfügung gestellt
werden.
+ Beteiligung: Obwohl Unternehmer
oder dessen Abteilungsvertreter verant-
wortlich zeichnen, hat jeder Mitarbeiter
das Recht, selbst auf mögliche Gefah-
ren hinzuweisen, bei der Abwendung
großer Gefahren sogar die Pflicht.
+ Kontinuität: Die Gefährdungsbeurtei-
lung ist als ein ständiger Prozess ge-
dacht, der nie abgeschlossen ist, da
jeden Tag neue Arbeitsweisen, Erreger
oder Probleme auftauchen können, auf
die reagiert werden muss.
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie
sich an die Arbeitssicherheit (Herr Roth
und Herr Irlinger) oder den Betriebsärztli-
chen Dienst der Kliniken (Herr Eckert und
Herr Dr. Larisch); Informationen dazu fin-
den Sie wie immer auch im Intranet.
Bernhard Eckert, Betriebsärztlicher Dienst
Quellen: Arbeitsschutzgesetzgebung und TRBAs,
Umwelt-online; Hofmann, Merkblätter Biologische Ar-
beitsstoffe 1-3, ecomed 2010

Bettenhaus
Geriatrische RehaÄrztehaus
Atrium
OP-Trakt
Notfallbehandlung& Internistische Diagnostik
14 Baumaßnahmen 4/2011
■ Mitte November wurde mit dem 5. und letzten Bauabschnitt
der Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahme in der Kreisklinik
Trostberg begonnen. Die Kosten für die Sanierung betragen 5,16
Millionen Euro. Hinzu kommt eine knappe Million für die Errich-
tung einer Kälteanlage, die Verlegung des Zentrallagers und not-
wendige Installationen im Untergeschoss. Von den insgesamt 6,13
Millionen Euro werden 3,19 Millionen Euro vom Freistaat Bayern
gefördert, so dass die Kliniken Südostbayern AG 2,94 Millionen
Euro an Eigenmitteln aufwenden muss.
Der Bauabschnitt ist wiederum in drei Bauphasen unterteilt. In der
ersten Bauphase entsteht die neue Endoskopie in den Räumen
der ehemaligen Geburtshilfe im Erdgeschoss. In den gegenüber
liegenden Räumen (bisher Tagesklinik) kommen EKG, UKG, Sono-
graphie usw. unter. Die Fertigstellung ist für den April 2012 vorge-
sehen. Ab April 2012 erfolgt in der zweiten Phase die Sanierung
des OP 4. Im Bereich der ehemaligen Endoskopie werden die
neue Tagesklinik und internistische Abklärungsplätze errichtet. Au-
ßerdem wird die Notfallambulanzspange saniert. Mit dem Ende
dieser Bauphase wird im September 2012 gerechnet. Von Sep-
tember 2012 bis März 2013 werden in der letzten Phase die Sa-
nierung der Ambulanzspange, die Neugestaltung der Liegendkran-
kenzufahrt und die Einrichtung des neuen Zentrallagers in Angriff
genommen.
Im Zuge des 5. Bauabschnitts wird die Kälteanlage durch einen
zusätzlichen Kühlturm erweitert. Die ehemalige Trostberger Be-
rufsfachschule für Krankenpflege wird zwischen November 2011
und Februar 2012 zu einem provisorischen Verwaltungsgebäude
umgebaut. Zudem müssen die Versorgungs- und Sanitärleitungen
im Unter- und Kellergeschoss saniert und der Brandschutz auf den
neuesten Stand gebracht werden. Ebenso werden die Räume der
Geschäftsführung bzw. Verwaltung umgebaut, da diese künftig
von Chefarzt Prof. Dr. Thomas Glück von der Inneren Medizin als
Büroräume genutzt werden. Im Zuge der Maßnahme wird das Zen-
trallager vom Kopfbau Ost (Untergeschoss) in die ehemalige Wä-
scherei beim Wirtschaftshof verlagert. Der durch die Verlegung im
Kopfbau Ost gewonnene Raum wird dazu genutzt, um die Zen -
tralumkleiden für unsere Mitarbeiter zu erweitern.
Günter Buthke
Sanierung der Kreisklinik Trostberg geht in die SchlussphaseMitte November wurde mit dem letzten Bauabschnitt der Sanierung begonnen

15Abschied4/2011
Sag zum Abschied leise ServusChefarzt Dr. Hans-Michael Schwab im Krankenhaus Berchtesgaden feierlichverabschiedet
■ nach 31 Jahren wurde Chefarzt dr.
hans-Michael Schwab ende oktober im
Berchtesgadener Krankenhaus offiziell
verabschiedet.
dr. Schwab war ein sehr beliebter Medizi-
ner, der im Krankenhaus Berchtesgaden
eine große Lücke hinterlässt. Gleichwohl
kann diese Lücke noch einige zeit ge-
schlossen werden, da dr. Schwab ver-
sprochen hat auszuhelfen, wenn es nötig
ist.
Vorstand Stefan Nowack lobte Dr. Hans-Mi-
chael Schwab als angenehme und ausglei-
chende Persönlichkeit.
Privat sei bekannt, dass Dr. Schwab den
schönen Dingen des Lebens aufgeschlos-
sen gegenübersteht, gerne Sport treibt, viel
liest und reist, sowie die Musik liebt. Auch
pflege der Mediziner einen großen Freun-
deskreis und habe ein offenes und oft vol-
les Haus. „Dies alles können Sie künftig
ohne die vielen Dienste wesentlich selbst-
bestimmter genießen“, dankte Nowack.
In seiner Dienstzeit habe Dr. Schwab den
gesamten Wandlungsprozess, den die
Krankenhauslandschaft in den letzten drei
Jahrzehnten in Deutschland durchlebt hat,
am eigenen Leib erfahren. So sei er am
Aufbau einer eigenständigen Anästhesie-
abteilung und Intensivstation ebenso betei-
ligt gewesen wie an der umfassenden Sa-
nierung und Erneuerung der Freilassinger
Kreisklinik, sowie der
Zusammenlegung der
Kreiskliniken Berchtes-
gaden und Freilassing
zu einer gemeinsamen
GmbH im Jahr 1997.
Insbesondere habe der
Mediziner aber den
tiefgreifenden Struktur-
wandel miterlebt, den
die Freilassinger Kreis-
klinik ab dem Jahr
2005 mitgemacht
habe. Seit 2002 zeich-
nete Dr. Schwab gemeinsam mit seinem
langjährigen Weggefährten Dr. Franz Män-
ner für die Anästhesieversorgung in Berch-
tesgaden verantwortlich.
Nur lobende Worte fanden auch Landrat
Georg Grabner und Dr. Claus Clasen für
das Lebenswerk von Dr. Schwab. „Ich habe
als aufrichtigen, sehr zuverlässigen, ein-
fühlsamen, sympathischen, hilfsbereiten
Kollegen, ganz einfach als „Team-Player“
kennen und schätzen gelernt“ so Clasen.
Dr. Schwab habe in diesen hektischen Zei-
ten nie das Menschliche vermissen lassen,
der auch deutlich machte wie anders doch
die Arbeit des Mediziners vor der Zeit der
großen technischen Errungenschaften ge-
wesen sei, aber auch funktioniert habe.
Abschied von einem treuenWeggefährtenAls längstjähriger Mitarbeiter, Mitstreiter
und Weggefährte von Dr. Schwab hielt Dr.
Franz Männer eine Rückschau auf 31
Jahre gemeinsamer Arbeit im Dienste der
Gesundheit des Menschen. Mit launigen
Worten erinnerte Dr. Männer an die An-
fänge beim Aufbau einer Anästhesieabtei-
lung: „Zwei vorhandene Narkosegeräte hät-
ten damals schon dem Ingolstädter Mu-
seum für Medizingeschichte zur Ehre ge-
reicht“, so Dr. Männer süffisant. Doch Dr.
Männer berichtete auch über die gemein-
same Aufbauarbeit in Freilassing und die
letzten neun Jahre in Berchtesgaden, wo
sich eine weit über Landkreisgrenzen hi-
naus anerkannte chirurgische Orthopädie
entwickelt hatte.
Als eine gute Entscheidung erachtet es Dr.
Männer, dass die Kliniken aus dem Berch-
tesgadener Land in den Verbund der Klini-
ken Südostbayern AG eingebracht worden
sind. Abschließend hob Dr. Männer all die
angenehmen Wesenszüge seines langjäh-
rigen medizinischen Partners und auch
Freundes hervor.
Dr. Hans-Michael Schwab war bei seinen
Abschiedsworten an die Ärzteschaft und
die weitere Belegschaft des Berchtesgade-
ner Krankenhauses, sowie Abordnungen
aus den Kliniken Südostbayern deutlich
eine Ergriffenheit anzumerken.
C. Wechslinger
Landrat Georg Grabner (l.) ließ es sich nicht nehmen den nach 31 Dienstjahren scheidenden Anästhesie-Chefarzt Dr. Hans-Michael Schwab (2.v.l.) aus dem Dienst zu verabschieden. Auch Dr. Franz Männer (2.v.r.)und der Vorstand der Kliniken Südostbayern Stefan Nowack erwiesen dem Mediziner die Ehre.

16 Leute von uns 4/2011
■ einer Statistik des Pilgerbüros zu-
folge waren im Jahr 2010 272.134 Pil-
ger in Santiago de Compostella ange-
kommen und hatten dort ihren Pilgeraus-
weis abgeholt. 69 Prozent gingen dabei
den „Camino francese“. Auch wir waren
auf diesem Weg unterwegs. Meine Frau
und ich starteten dabei in Leon und gin-
gen zu Fuß die 320 Kilometer bis Santi-
ago de Compostella in 13 etappen. die
meisten teilstücke waren 20 bis 25 Kilo-
meter lang mit Ausnahme der ersten mit
38 Kilometer und der letzten mit 10 Kilo-
meter.
Bei der Vielzahl an Menschen auf dem
Jakobsweg fragt man sich, was treibt sie
dazu, die Strapazen des Weges und die
tägliche Suche nach einer Nächtigungs-
möglichkeit, zum Teil in überfüllten
Schlafsälen, auf sich zu nehmen? Wollen
sie billig Urlaub machen oder sind sie auf
der Suche nach Gott? Oder kommen sie,
weil es eben modern ist, dasselbe nach-
zuahmen wie es Paulo Coelho, Tim Moore
oder Harpe Kerkeling beschrieben
haben? Wir haben als Vorbereitung zum
Jakobsweg lediglich unsere körperliche
Fitness sowie die geeignete Ausrüstung,
insbesondere das Schuhwerk, getestet.
Wir wussten nicht was uns erwartet. Um
so mehr waren wir beeindruckt von der
Vielzahl von überraschenden Begegnun-
gen sowie von der reizvoll blühenden
Landschaft und den angenehmen Tempe-
raturen, auch wenn in den Bergen kühle
Teiletappen zu bewältigen waren.
Beeindruckende BegegnungenWir haben einen idealen Zeitraum ge-
wählt. Im Mai ist die Schönheit der Natur
mit vielen Blumen und blühenden Ginster-
und Erikabüschen, die viele Hügel bede-
cken, überwältigend. In Nordspanien sind
in diesem Monat vorwiegend angenehme
Temperaturen vorzufinden, wobei uns Pil-
ger berichteten, dass sie im Jahr 2010 in
dieser Zeit den Pilgerweg im Schnee, bei
Dauerregen und schlammigen Untergrund
bewältigen mussten. Auf dem „Camino“
sind in dieser Zeit weniger Pilger unter-
wegs, und es überkommt einem gelegent-
lich das Gefühl, sich verlaufen zu haben.
Jeder geht dabei sein eigenes Tempo,
trotzdem trifft man immer wieder die glei-
chen Pilger auf dem Weg oder in den ein-
zelnen Etappenorten. Es gab eine Reihe
von besonderen Begegnungen. So trafen
wir in Rabanal Pater Pius Mühlbacher, der
aus Waging stammt. Er war gerade dabei,
den Blumenschmuck in der Kirche zu er-
neuern. Dies war für uns eine willkom-
mene Abwechslung und Gelegenheit, uns
Nützlich zu machen. Wir stehen mit ihm
seither auch weiterhin in Kontakt und wer-
den somit über den „Camino francese“ in-
formiert.
Wir mussten wohl den Jakobsweg gehen,
um in einem Straßencafé den Wirt von der
Sonnenalm auf Winkelmoos kennen zu ler-
nen. Ulli Becker war im Jahr 2010 auf dem
Jakobsweg erstmalig unterwegs und war
dabei so fasziniert, dass er über seine Er-
fahrungen aktuell ein Buch herausgege-
ben hat.
Beeindruckend waren zwei weitere Begeg-
nungen. So mühte sich ein beidseits Bein-
Der Weg ist das Ziel Prof. Ketterl abseits des Klinikalltags unterwegs
auf dem Jakobsweg
Mit dem aus Waging stammende Pater PiusMühlbacher stehen wir noch heute inregelmäßigem Kontakt

17Leute von uns4/2011
amputierter in seinem handangetriebenen
Rollstuhl auf dem für pilgernde Radfahrer
vorgesehenen Wegen und wollte sich auch
bei anstrengenden Passagen nicht helfen
lassen. Bemerkenswert war auch die Leis-
tung einer Frau aus Aachen, die offen-
sichtlich bei nicht optimalen körperlichen
Voraussetzungen und mit eingeschränkter
Fitness ihren eigenen Weg ging. Sie hatte
sich kleinere Etappen vorgenommen und
erzählte uns, dass sie beim Erreichen
eines ihrer Ziele mit Applaus empfangen
wurde. Sie fühlte sich dabei wie ein sieg-
reicher Marathonläufer und trat gestärkt
ihren weiteren Weg an.
Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ der
abendliche Besuch einer kleinen Kirche, in
der zwei französische Pilger spontan Cho-
räle anstimmten.
Immer ein Lächeln im GesichtZwischen den Menschen, die den Jakobs-
weg gehen, entsteht eine besondere Stim-
mung. Alle haben das gleiche Ziel. Es zeigt
sich eine spürbare Hilfsbereitschaft. Ein
Lächeln im Gesicht hebt alle Sprachbarrie-
ren auf. Der Weg macht alle gleich – das
soziale Umfeld ist unwichtig. Gegen Ende
der Strecke sieht man immer mehr Pilger,
die ihre Füße pflegen und findet häufig
durchgetretenes, unbrauchbares Schuh-
werk am Wegesrand. Leider ist für einige
diese Reise die letzte in ihrem Leben. Eine
Reihe von Gedenktafeln erinnert an Men-
schen, die auf dem Jakobsweg verstorben
sind.
ResümeeFür uns selbst war der Jakobsweg ein über-
aus positives Erlebnis. Wenn man an den
Pilgerandachten teilnimmt, spürt man,
dass man nicht wandert sondern pilgert.
Dass man auf Wegen geht, die seit 1 200
Jahren von Menschen – aus welchen Grün-
den auch immer – begangen werden. Für
uns war es nicht die letzte Pilgerreise, so-
dass wir für das Jahr 2012 ein Teilstück
des portugiesischen Weges geplant haben.
Für Nachahmer: Durch das monotone
Gehen findet man schnell zu sich selbst.
Mit ein bisschen körperlicher Fitness ist
auch der Weg nicht zu anstrengend. Zwar
gehen viele den „Camino“ alleine, aber
empfehlenswerter in vielerlei Hinsicht ist
ein verlässlicher Partner an der Seite. Wer
sich dennoch dazu entschließt, den Weg
alleine zu gehen, findet durch den großen
Zusammenhalt unter den Pilgern immer
Hilfe und Unterstützung, sowie Freund-
schaften, die über das Ende des „Camino“
hinaus bestehen bleiben. Diese Erfahrung
durften wir selbst machen.
Prof. Dr. med. R. Ketterl
Chefarzt Unfallchirurgie - Traunstein
Gutes Schuhwerk ist der wichtigste Ausrüstungs-gegenstand. So mancher Schuh hielt die Pilger-reise nicht durch
Der „Camino Francés“, die französische Variantedes Jakobswegs, startet in Saint-Jean-Pied-de-Port am Fuße der Pyrenäen. Wir starteten dabeiin Leon und hatten noch 320 Kilometer bis San-tiago des Compostela zu gehen.
„Kein Weg ist ewig“ Markierungsstein in der wunderschönenHügellandschaft Galicien um den Ort Ó Cebreiro
Spanier 188 089
Deutsche 14 503
Italiener 14 222
Franzosen 9 140
US Amerikaner 3 334
Iren 2 696
Brasilianer > 2 000
Niederländer > 2 000
Polen > 2 000
Engländer > 2 000
Canada 1 877
Koreaner 1 500
Skandinavier > 1 000
Insgesamtder 272 134
Pilger auf dem Jakobsweg 2010

18 Umweltschutz 4/2011
■ eine hochrangige Praktikantin war
im herbst im Klinikum traunstein im ein-
satz. Kathie Jansen aus der Provinz Gau-
teng in Südafrika, ist Master für umwelt-
management und -gesundheit und für
das Abfallmanagement in 49 Kranken-
häusern, 260 zahnartpraxen und 12 Poli-
kliniken in ihrer Provinz zuständig.
Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich
dabei mit der entsorgung von infektiö-
sem Müll, dessen Recycling sowie Müll-
verbrennung und Mülldeponierung.
Warum ist sie ausgerechnet in den Klini-
ken Südostbayern? Kathie Jansen nimmt
gerade an einem staatlichen Austausch-
programm mit entsprechenden Kursen
zum Thema Abfallmanagement teil und
musste sich dafür einen Praktikumsplatz
suchen. Speziell wollte sie mehr über
unser Abfallsystem und Abfallmanagement
kennen lernen. Insbesonders interessierte
sie, wie ein Unternehmen mit mehreren
Kliniken mit der Abfallentsorgung umgeht.
Die Regierung von Oberbayern vermittelte
sie dafür unter Anderem auch an unsere
Kliniken.
Wie müssen wir uns die Abfall-entsorgung in für medizinischeEinrichtungen in Südafrikavorstellen?
Südafrika wird sich erst langsam der Pro-
blematik einer ungeregelten Abfallentsor-
gung bewusst. Nach und nach beginnen
die Bemühungen zu wirken, eine geregelte
Abfallbeseitigung zu etablieren.
Es gibt zwar Regelungen im Umgang mit
Krankenhausmüll, trotzdem müssen Un-
mengen von Krankenhausabfällen depo-
niert werden. Speziell für den Kranken-
hausmüll stehen jedoch nur vier Deponien
in ganz Südafrika zu Verfügung. Deshalb
wird wegen dieser eingeschränkten Mög-
lichkeit viel Augenmerk auf Recycling und
natürlich Vermeidung von Müll gelegt. Die
Wiederverwendung von Wertstoffen
(Kunststoff, Papier, Glas und Metall) ist in
etwa vergleichbar wie bei uns in Deutsch-
land. Der auch in Südafrika immer mehr
anfallende Elektroschrott stellt jedoch ein
großes Problem dar. Allein in Südafrika fal-
len jährlich etwa 100.000 Tonnen Elektro-
schrott an. Mehrere nichtstaatliche Organi-
sationen und private Unternehmen befas-
sen sich dort bereits mit dem Problem und
versuchen, brauchbare Geräte zu recyceln.
Die grundsätzliche Mülltrennung muss im
Vergleich zu uns sehr
sortenrein sein, das
heißt Glas- und
Kunststoffverpackun-
gen, in denen bei-
spielsweise flüssige
Medikamente waren,
werden nicht recycelt.
Damit selbst mit
einer noch so kleinen
Restmenge in diesen
Verpackungen kein
Missbrauch getrieben
wird, müssen dort solche Glas- und Kunst-
stoffflaschen anderweitig vernichtet wer-
den.
Ein weiteres Problem stellen zurzeit die Kü-
chenabfälle dar. Ein Teil davon wird noch,
Abfallmanagement Südafrikameets SüdostbayernKathi Janson lernte Unterschiede in den Abfallsystemen kennen
Kathie Jansen im Gespräch mit der TeamFünf-Redaktion
Das Kollegenteam mit dem Kathie Jansen in Südafrika zusammenarbeitet

Derzeitiger Stand der Abfallentsorgung inSüdafrika
Bei der Entsorgung der Abfälle in Südafrika gibt es deutliche Unterschiede. In den
reichen Bezirken der großen Städte existiert ein beinahe westliches Holsystem,
wohingegen die ärmere Bevölkerung ihren Abfall zu Sammelstellen bringen muss,
wo er von der städtischen Müllabfuhr abgeholt wird. Insbesondere aufgrund des
damit verbundenen Aufwands für die Bürger ist die Rücklaufquote für wertlose Ab-
fälle sehr gering. Außerhalb der großen Städte gibt es keine geregelte Entsorgung.
Insgesamt gibt es über 700 ungeregelte Deponien in Südafrika, die alle über keine
Sickerwasserreinigung oder Abdeckung verfügen. Mehr als die Hälfte dieser Depo-
nien wird zudem ohne Erlaubnis betrieben. Der Hausmüll wird zu 95 Prozent auf
diesen Deponien entsorgt.
Aufgrund der gravierenden Armut, vor allem der schwarzen Bevölkerungsschicht,
hat sich in Südafrika ein Recyclingsystem abseits der Behörden entwickelt. Soge-
nannte „waste pickers“ sortieren auf Müllkippen und bei den Sammelstellen die
leicht recycelbare Bestandteile des Abfalls aus und verkaufen diese an Zwischen-
händler. In Südafrika stammen etwa 94 Prozent des für die Wiederverwertung ge-
sammelten Materials aus diesem informellen Sektor. Daneben gibt es Kampagnen
zur Aufklärung der Bevölkerung über Mülltrennung und Recycling, die bspw. durch
die staatliche Organisation Keep South Africa Beautiful durchgeführt werden.
Mit Ausnahme von sehr rückständigen Verbrennungsöfen für Abfälle auf sehr nied-
rigem technischem Level in ländlichen Regionen gibt es in Südafrika bis dato noch
keine Hausmüllverbrennungsanlagen. Dagegen gibt es einige Anlagen zur Verbren-
nung von Krankenhausabfällen, die nahe bei den Krankenhäusern der großen
Städte errichtet wurden. Sie dienen vor allem dazu, eine Ausbreitung von Seuchen
und Krankheiten über den Abfall zu verhindern. Es gibt mehrere Gründe, warum
die Müllverbrennung in Südafrika nur schwer zu verwirklichen ist: niedriger Heiz-
wert, hohe Kosten der Technik verbunden mit hohen Finanzierungskosten für Anla-
gen in Südafrika, begrenzte Verfügbarkeit von Personal mit den erforderlichen
Qualifikationen sowie sind Fertigungsstätten der notwendigen Anlagenkomponen-
ten in Südafrika bislang nicht vorhanden
Quelle: bifa Umweltinstitut
19Umweltschutz4/2011
wie auch bei uns vor vielen Jahren auch
noch üblich, verfüttert. Der Großteil wird je-
doch auf großflächige Deponien verteilt!
Es gibt zwar ein neues Gesetz mit Regelun-
gen zum Umgang mit Krankenhausabfäl-
len, jedoch fehlen in Südafrika gewisse In-
frastrukturen wie geeignete Müllwagen
und Müllcontainer, geregelte Abholzeiten
usw. „Auch haben wir immer wieder mal
Energieprobleme, so dass in Abständen
der Strom bei uns ausfallen kann. Das hat
freilich wesentlich gravierende Auswirkun-
gen in der medizinischen Versorgung, eine
geregelte Müllverbrennung kann da aber
auch nicht stattfinden“, so Kathi Janson.
Trotz der oben erwähnten Regelungen zur
Abfallentsorgung gibt es allerdings zu viele
Sondergenehmigungen zu sogenannten
„alternativen“ Entsorgungen. Die Regie-
rung in Südafrika traut seinen Leuten
wenig zu und hat auch kaum Vertrauen,
deshalb wird zu viel nachgeprüft, ob alles
wirklich so gemacht wird wie es vorgese-
hen ist, bedauert Kathie Jansen.
Sie hatte in ihrer Praktikumszeit im Klini-
kum Traunstein als Aufgabe gestellt be-
kommen, das Abfallwesen aller fünf Häu-
ser zu untersuchen, Standards festzustel-
len, Optimierungpotential herauszufinden
und eine Stellenbeschreibung eines Abfall-
beauftragten zu erarbeiten. Als Ergebnis
stellt sie fest, dass die Abfallentsorgung in
unseren Häusern unterschiedlich gehand-
habt wird. In ihrem Bericht machte sie kon-
krete Strukturvorschläge für ein homogeni-
siertes Abfallwesen, mit denen sich unser
Umweltmanagement beschäftigen wird.
Ralf Reuer
Gauteng ist eine der neun Provinzen Südafrikasmit knapp 11 Millionen Einwohnern. Ihre Haupt-
stadt ist Johannesburg. Das Wort Gautengstammt aus dem Süd-Sotho (eine spezielle
Sprache in den Südafrikanischen Provinzengesprochen) und bedeutet „Ort des Goldes“. Der
Name bezieht sich auf die frühere Bedeutungdes Gebiets im Goldbergbau.
Gauteng

20 Aus den Schulen 4/2011
Wer gut sät, kann auch kräftigernten78 neue Schülerinnen und Schüler erlernen den Pflegeberuf
■ Wir freuen uns, an den Berufsfach-
schulen für Krankenpflege des Bildungs-
zentrums für Gesundheitsberufe der Klini-
ken Südostbayern AG traunstein und
Bad Reichenhall 78 neue Schülerinnen
und Schüler begrüßen zu dürfen. die
Klassenstärke liegt erstmals bei 26
Schülern, zwei Klassen in traustein und
einer in Bad Reichenhall. um es genau
zu nehmen, starteten 68 Schülerinnen
und 10 Schüler. Bei einem knapp 13-po-
zentigen Anteil der Schüler wird wieder
deutlich, dass der Frauenanteil im ange-
strebten Pflegeberuf klar dominant ist.
Ein weiterer Blick auf die Statistik bezüg-
lich des topographischen Einzugsberei-
ches: 48 Schülerinnen/er kommen aus
dem Landkreis Traunstein, 26 aus der Re-
gion Berchtesgadener Land, drei aus Öster-
reich und eine Schülerin aus dem Land-
kreis Altötting.
„Mit dem Start der neuen Klassen ver-
zeichnen die Schulen die höchste Schüler-
zahl in der jetzt 50-jährigen Schulge-
schichte Traunstein und Bad Reichenhall“,
wie Rupert Übelherr betont. Eine Steige-
rung der Schülerzahl steht für das kom-
mende Schuljahr 2012 an, in dem für die
Krankenpflegeschule Bad Reichenhall eine
zusätzliche Klasse geplant ist.
Ein analytischer Blick auf die Motivation
der Berufswahl unserer neuen Klassen in
Traunstein zeigt ein Novum. Es sitzen sie-
ben Pflegefachhelferinnen in den Reihen,
die in der in der 2010 gegründeten Kran-
kenpflegehilfeschule Traunstein ihren Ab-
schluss gemacht haben.
Kräftig ernten konnten wir auch durch die
Arbeit von Bernhard Wendl, stellvertreten-
der Schulleiter der Krankenpflegeschule
Traunstein, und Hermann Dengl, der Leiter
der Abteilung Fort- und Weiterbildung,
deren Betreuung und Beschulung der
Langzeitpraktikanten dazu führte, dass 13
Praktikanten den Zugang zur Ausbildung
geschafft haben.
Weitere 13 Schüler absolvierten Ausbildun-
gen zum Teil im medizinischen und sozia-
len Bereich, vier weisen andere Berufsaus-
bildungen vor. Die übrigen Schüler kom-
men von verschiedenen Schularten und
haben alle ein mindestens einwöchiges
Praktikum in unterschiedlichen pflegeri-
schen Bereichen abgeleistet.
Um den Schülerinnen und Schülern an bei-
den Standorten eine inhaltlich abge-
stimmte und standardisierte Ausbildung in
ihrem angestrebten Beruf zu ermöglichen,
wurde im letzten Jahr von den Lehrkräften
der Schulen Bad Reichenhall und Traun-
stein ein gemeinsames Curriculum erar-
beit. Die Ausbildungsinhalte wurden fä-
cherübergreifend geordnet und an Pflege-
situationen ausgerichtet. Unter dem Leit-
satz „ Lernen als Prozess“ wird an bisheri-
ges Wissen angeknüpft und neues Wissen
durch problemorientiertes und problemlö-
sendes Denken erworben. Die Auszubil-
denden sollen zur aktiven Auseinanderset-
zung mit Pflegesituationen aus der Praxis
angeleitet werden. Im ersten Unterrichts-
block stehen folgende Unterrichtsinhalte
im Mittelpunkt:
Grundlagen der Pflege mit den Themen:
„Das Menschsein erfassen“
Gesundheits- und Krankenpflege (Theorie

21Aus den Schulen4/2011
und Praxis): „Gesundheitserhaltende und
gesundheitsförderndes Verhalten entwi-
ckeln und praktizieren.“
Der Startschuss in Traunstein erfolgte An-
fang Oktober mit einer Begrüßung durch
Dr. Claus Clasen, Pflegedirektor Jürgen Ba-
cher mit seinem Stab der Pflegedienstlei-
tungen, dem Leiter des Bildungszentrums
Rupert Übelherr und den Klassleitungen
Evelyn Gröbner und Christian Schuster. In
Bad Reichenhall übernahm Heike Schlegl-
Becker die Klassenleitung. Wir wünschen
unseren Schülerinnen und Schülern ein
gutes Gelingen und viel Spaß in den drei
Jahren!
Christian Schuster
Grüß Gott, ich darf mich als „Neue“ im Bil-
dungszentrum für Gesundheitsberufe vor-
stellen.
Ich bin gebürtige Traunsteinerin und ging
nach dem Abitur am Annette-Kolb-Gymna-
sium nach Bayreuth zur Ausbildung als
Krankengymnastin. Im Anschluss daran
absolvierte ich das Anerkennungsjahr in
der physikalischen Abteilung des damali-
gen Stadtkrankenhauses Traunstein. Da-
nach zog es bzw. er mich ins Berchtesga-
dener Land. Dort arbeitete ich in der neuro-
logischen Reha-Klinik Loipl, und in Berch-
tesgaden sind auch unsere Kinder geboren, inzwischen 17 bzw. 19 Jahre alt.
Die letzten 14 Jahre war ich als Lehrkraft an einer Physiotherapieschule tätig, studierte
berufsbegleitend Medizinpädagogik an der Charité in Berlin und suchte dann nach einer
neuen beruflichen Herausforderung, die ich hier im Bildungszentrum gefunden habe. Ich
unterrichte die medizinischen Fächer in der Krankenpflegehelferschule und in den Kran-
kenpflegeschulen in Traunstein und in Bad Reichenhall und möchte mich auf diesem Weg
auch für die sehr offene Aufnahme und die kompetente Unterstützung bei allen Kollegin-
nen und Kollegen bedanken.
elisabeth WildmoserNeue Lehrkraft in Traunstein
Ich bin 45 Jahre alt und in Gießen geboren.
Aus persönlichen Gründen bin ich im Juni
mit meinen Kindern von Hessen nach Bay-
ern gezogen.
Seit Juli arbeite ich als Lehrerin für Pflege-
berufe in der BFSK Bad-Reichenhall und
bin sehr unterstützend von meinen neuen
Kollegen aufgenommen worden.
Seit Sommer 1987 bin ich examinierte
Pflegekraft, und habe bis 1992 primär auf
Intensivstationen gearbeitet. 1992 fasste
ich den Entschluss, die Weiterbildung Leh-
rerin für Pflegeberufe beim Berufsbildungs-
werk (DGB) in Frankfurt zu absolvieren.
Seit 1995 habe ich als Lehrerin für Pflege-
berufe im Bildungszentrum für Pflegebe-
rufe an der Uni-Klinik in Gießen gearbeitet. Meine Tätigkeitsschwerpunkte waren Ausbil-
dung in Theorie und Praxis sowie Leitung und Gestaltung von Fort- und
Weiterbildungen.Selbst weitergebildet habe ich mich im Bereich Kinästhetik in der Pflege
(Trainerin) und Palliativ-Care. Durch diese beiden Pflegeschwerpunkte bin ich die ganzen
Jahre stark mit der praktischen Pflege verbunden.
Ich freue mich auf die neuen Eindrücke und Begegnungen, ganz nach dem Leitgedanken
der BFSK Bad-Reichenhall "Im Mittelpunkt steht der Mensch".
Mein persönliches Anliegen für die Ausbildung: „Verantwortung für sein Tun zu überneh-
men“
Ihre Heike Schlegl-Becker
heike Schlegl-BeckerLehrerin für Pflegeberufe der BFSK Bad-Reichenhall
Viel Freude und Erfolg
in den kommenden
drei Jahren von der
Redaktion TeamFünf

■ Die bisherige papiergebundene Lohn-
steuerkarte wird zum 01.01.2012 endgül-
tig der Vergangenheit angehören. Zu die-
sem Zeitpunkt wird die neue elektronische
Lohnsteuerkarte ihren Dienst antreten.
Dabei ergeben sich eine Vielzahl umfas-
sender Neuregelungen, über die wir hier
berichten möchten.
Mit Einführung der elektronischen Lohn-
steuerkarte soll die elektronische papier-
lose Kommunikation zwischen Arbeitneh-
mer, Arbeitgeber, Finanzamt und Meldebe-
hörden erheblich vereinfacht und be-
schleunigt werden.
Zuständigkeit für die ELStAM-DatenKünftig sind allein die Finanzämter für die
Änderungen der Lohnsteuerkarten zustän-
dig, so dass den Arbeitnehmern der Weg
zu den jeweiligen Meldebehörden erspart
bleibt. Die Stadt- oder Gemeindeverwaltun-
gen sind künftig nur noch für rein melde-
rechtliche Änderungen, z.B. Heirat, Geburt
eines Kindes sowie Kirchenein- und -aus-
tritte zuständig.
Bislang haben die Arbeitnehmer regelmä-
ßig zum Jahresende eine papiergebun-
dene Lohnsteuerkarte erhalten. Diese
Lohnsteuerkarte enthielt die persönlichen
Besteuerungsgrundlagen. Diese Lohnsteu-
erkarte musste der Arbeitnehmer bei sei-
nem Arbeitgeber einreichen, damit dieser
die Lohnsteuereinbehaltung im Rahmen
der Lohn- und Gehaltsabrechnung durch-
führen kann.
Künftig werden die persönlichen Besteue-
rungsgrundlagen, die für die Lohn- und Ge-
haltsabrechnung erforderlich sind, nicht
mehr auf einer papiergebundenen Lohn-
steuerkarte mitgeteilt. Der Arbeitgeber ist
künftig dazu verpflichtet, diese persönli-
chen Besteuerungsgrundlagen von einer
Datenbank beim Bundeszentralamt für
Steuern abzurufen. Hierbei handelt es sich
um folgende Daten:
+ Steuerklasse
+ Kirchensteuermerkmal
+ Kirchensteuermerkmal des Ehegatten
+ Zahl der Kinderfreibeträge und evtl.
+ persönliche Frei- und Hinzurechnungs-
beträge.
Mit der elektronische Lohnsteuerkarte soll
das Verfahren erheblich vereinfacht und an
den technischen Fortschritt angepasst wer-
den. Wenn ein Arbeitnehmer sich beispiels-
weise einen Freibetrag auf der Lohnsteuer-
karte eintragen lassen möchte, braucht er
nicht mehr, wie bisher, die Lohnsteuerkarte
von seinem Arbeitgeber abzufordern und
bei seinem Wohnsitzfinanzamt einzurei-
chen. Künftig stellt der Arbeitnehmer einen
entsprechenden Antrag bei seinem Wohn-
sitzfinanzamt, welches die geänderten Be-
steuerungsgrundlagen auf elektronischem
Wege an die ELStAM-Datenbank übermit-
telt. Der Arbeitgeber ruft diese Daten dann
ab und legt Sie der Lohn- und Gehaltsab-
rechnung zugrunde.
Mitteilung über die gespeichertenLohnsteuerabzugsmerkmaleIm Vorfeld der ELStAM-Einführung haben
alle unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tigen Arbeitnehmer im Herbst 2011 im
Rahmen eines gesonderten Anschreibens
durch das jeweilige Wohnsitzfinanzamt
eine Mitteilung über die gespeicherten
Lohnsteuerabzugsmerkmale erhalten.
Jeder Arbeitnehmer hat darüber hinaus die
Möglichkeit, seine Daten über das Elster-
Online-Portal einzusehen. Während bislang
für jedes neue Kalenderjahr eine neue
Lohnsteuerkarte bereitgestellt wurde, wer-
den die Lohnsteuerabzugsmerkmale künf-
tig nur noch dann mitgeteilt, wenn sich Ver-
änderungen ergeben. Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen darf der Arbeitgeber
nur die Daten der Arbeitnehmer abrufen,
die in einem aktiven Beschäftigungsver-
hältnis stehen. Zur Authentifizierung benö-
tigt der Arbeitgeber
+ den Namen des Arbeitnehmers,
+ sein Geburtsdatum und die
+ Steueridentifikationsnummer (StId-Nr.).
Mitteilung der Steueridentifika-tionsnummerDie Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet,
ihrem Arbeitgeber die Steueridentifikati-
onsnummer mitzuteilen. Wenn dem Arbeit-
geber die Steueridentifikationsnummer
nicht vorliegt, kann dieser entsprechend
keine elektronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmale abrufen. In diesem Fall ist
grundsätzlich die Steuerklasse VI zugrun-
dezulegen. Dies gilt auch dann, wenn der
Arbeitnehmer sich weigert, seine Steuer -
identifikationsnummer mitzuteilen. Aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen ist der Ar-
beitgeber nicht berechtigt, die Steueridenti-
fikationsnummer seines Arbeitnehmers bei
dessen Wohnsitzfinanzamt zu erfragen.
Verschiebung bei der Einführungder elektronischen Lohnsteuer -karte und ELStAMKurz vor Redaktionsschluss erhielen wir
noch die Information, dass aufgrund von er-
heblichen Problemen bei der technischen
Erprobung des Abrufverfahrens zur Bereit-
stellung der Elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (ELStAM) die Einführung der
22 Personalabteilung 4/2011
Die Personalabteilung informiert1. Die elektronische Lohnsteuerkarte und ELStAM(Elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale)

23Personalabteilung4/2011
elektronischen Lohnsteuerkarte nicht, wie
ursprünglich beabsichtigt, zum 01.01.2012
erfolgen werden kann. Nachdem in den ver-
gangenen Wochen eine Vielzahl von Steuer-
bürgern ein Informationsschreiben ihres Fi-
nanzamtes mit unrichtigen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen (z.B. falsche Steuerklas-
sen, fehlerhafte oder fehlende Berücksichti-
gung von persönlichen Steuerfreibeträgen)
erhalten haben, hat die Finanzverwaltung
die Einführung der elektronischen Lohn-
steuerkarte auf unbestimmte Zeit verscho-
ben. Derzeit sind der Bund und die Länder
dabei, einen neuen Termin und die weitere
Vorgehensweise für die Einführung der
elektronischen Lohnsteuerkarte abzustim-
men.
Quelle: Online-Redaktion Verlag Dashöfer, Diplom-Fi-
nanzwirt (FH) Volker Hartmann, Hamburg
2. Sozialausgleich Als Arbeitgeber müssen wir prüfen, ob un-
sere Arbeitnehmer einen Anspruch auf So-
zialausgleich haben und diesen dann auch
durchführen. Eine wichtige Größe ist dabei
der durchschnittliche Zusatzbeitrag. Dieser
beträgt für das Jahr 2012 null Euro, wie
das Bundesministerium für Gesundheit ak-
tuell bekannt gegeben hat. Damit findet
auch im kommenden Jahr kein Sozialaus-
gleich statt.
Am 1. Januar 2011 ist das sogenannte
GKV-Finanzierungsgesetz in Kraft getreten.
Seit diesem Zeitpunkt dürfen die gesetzli-
chen Krankenkassen einen Zusatzbeitrag
nur unabhängig vom Einkommen ihrer Mit-
glieder festlegen. Sie erheben einen sol-
chen kassenindividuellen Zusatzbeitrag
also in festen Eurobeträgen. Gleichzeitig
wurde auch der Sozialausgleich eingeführt.
Er soll verhindern, dass Arbeitnehmer fi-
nanziell überfordert werden und setzt
daher in bestimmten Fällen den Kranken-
kassenbeitrag des Arbeitnehmers herab.
Wer hat Anspruch auf Sozialausgleich?Der Sozialausgleich gilt grundsätzlich für
alle Arbeitnehmer. Er ist unabhängig
davon, ob die jeweilige Krankenkasse
einen Zusatzbeitrag erhebt oder nicht.
Bestimmte Personen haben keinen An-
spruch auf Sozialausgleich, da die Kran-
kenkassen von ihnen auch keinen Zusatz-
beitrag verlangen dürfen. Darunter fallen
beispielsweise:
+ Auszubildende mit einem Entgelt bis zu
325 Euro
+ Personen, die Kranken-, Mutterschafts-
oder Elterngeld beziehen
+ Teilnehmer am Bundesfreiwilligen-
dienst.
Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbei-
trag die individuelle Belastungsgrenze des
Arbeitnehmers, hat dieser einen Anspruch
auf Sozialausgleich. Die Belastungsgrenze
liegt bei zwei Prozent der beitragspflichti-
gen Einnahmen des Arbeitnehmers.
Wer prüft den Anspruch aufSozialausgleichIm Regelfall prüft der Arbeitgeber, ob ein
Anspruch auf Sozialausgleich besteht. Bei
unständig Beschäftigten und Arbeitneh-
mern, die ihren Krankenkassenbeitrag
selbst zahlen, prüft die Krankenkasse, ob
ein Anspruch auf Sozialausgleich besteht
und führt diesen auch durch. Bei Arbeit-
nehmern mit mehreren Beschäftigungen
oder mehreren beitragspflichtigen Einnah-
men koordiniert die Krankenkasse das Ver-
fahren.
3. Resturlaub aus 2011
Prinzipiell ist ein Urlaub in dem Kalender-
jahr zu nehmen, in dem der Anspruch ent-
steht.
Ausnahmsweise kann der übertragene
Resturlaub in den ersten drei Monaten des
folgenden Kalenderjahres angetreten wer-
den. Ausreichend ist, wenn der 31. März
der erste Urlaubstag ist. Kann der Beschäf-
tigte seinen Urlaub bis zu diesem Zeitpunkt
nicht antreten, verfällt der Resturlaubsan-
spruch aus dem vergangenen Jahr. Dies
gilt auch für ev. Zusatzurlaub aus Schicht-
bzw. Wechselschichtarbeit.
4. Vorläufige Rechen-größen in der Sozialver-sicherung 2012Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung in
2012 jährlich 45.900 Euro ( monatlich
3.825 Euro).
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung in 2012 jährlich 67.200 Euro (monat-
lich 5.600 Euro).
5. Anhebung des soge-nannten Arbeitnehmer-pauschbetrags
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird ab
dem Jahr 2011 von 920 Euro auf 1.000
Euro angehoben. Beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn ist der erhöhte Pauschbetrag in
Höhe von 80 Euro einmalig bei der Dezem-
berabrechnung 2011 zu berücksichtigen.
Es ist keine zeitanteilige Berücksichtigung
vorgesehen. Die Lohnsteuerberechnungen
für die Lohnabrechnungszeiträume Januar
2011 bis November 2011 bleiben folglich
unverändert.
Durch diese Besonderheit erhalten alle
steuerpflichtigen Arbeitnehmer im Dezem-
ber 2011 ein höheres Nettogehalt.
6. Neuer Reise -kostenantrag
Ab 2012 wird ein einheitlicher Reisekos-
tenantrag in unserer AG verwendet. Die An-
träge sind in der Personalabteilung erhält-
lich bzw. können aus dem Intranet herun-
tergeladen werden (siehe Personalabtei-
lung/Formulare).
Die Personalabteilung der Kliniken Süd-
ostbayern AG wünscht allen Mitarbeitern
einen guten Rutsch und ein erfolgreiches,
gesundes Jahr 2012!

24 Mitarbeiter unterwegs 4/2011
■ Rund 90 Mitarbeiter aus dem Klinikum Traunstein und der
Kreisklinik Trostberg beteiligten sich am Betriebsausflug nach
Prag. Mit zwei Bussen fuhren sie über Linz, Budweis und Tabor
(Mittagspause) in die „Goldene Stadt“ an der Donau. Dort ging es
sogleich in kleineren Gruppen aufgeteilt auf den Hradschin, die
Prager Burg, mit dem Veitsdom, dem Goldgässchen, der Georgs-
kirche und dem Sitz des tschechischen Präsidenten. Zu Fuß ging
es dann hinunter zur Kleinseite, wo die Ausflügler einen Blick in
den schönen „Waldsteingarten“ werfen konnten. Der Oberbefehls-
haber der kaiserlichen Truppen im Dreißigjährigen Krieg, Albrecht
Wenzel Eusebius von Waldstein, den wir von Schiller als „Wallen-
stein“ kennen, hat dort neben seinem Palast einen riesigen Gar-
ten anlegen lassen. Da im ursprünglich gebuchten Hotel „Radli-
cka“ die Aufzüge repariert wurden, wurde die ganze Gruppe an-
schließend im Nobel-Hotel „Hilton“, dem früheren Hotel „Forum“,
nahe der Moldau untergebracht.
Am nächsten Tag wurden die Prager Alt- und Neustadt, die von
Gotik, Barock und Jugendstil geprägt sind, wiederum „per pedes“
erkundet. Die Führung begann am rund 700 Meter langen Wenzel-
platz mit dem monumentalen Reiterstandbild des Heiligen Wenzel
von Böhmen. Weiter ging es am Ständetheater, eines der schöns-
ten Theatergebäude Europas, vorbei zum Altstädter Ring mit dem
Denkmal des christlichen Reformers Jan Hus, das 1915 anlässlich
seines 500. Todestags errichtet wurde. Am Altstädter Ring steht
auch das Rathaus mit der historischen astronomischen Uhr, die
außer der Uhrzeit auch die Lage von Sonne und Mond, die Mond-
phasen oder die Stellungen der großen Planeten anzeigt. Der
nächste Punkt war die Josefstadt mit ihren Jugendstilhäusern und
dem jüdischen Viertel. An der Karlsbrücke, die die Altstadt mit der
Kleinseite verbindet, ging der sehr informative Stadtrundgang zu
Ende. Da die Karlsbrücke von Menschenmasse überlaufen war, er-
kundete auf Vorschlag der Stadtführerin jeder für sich als „Einzel-
kämpfer“ die älteste über die Moldau erhaltene Brücke mit 30 ba-
rocken Skulpturen. Die Freizeit am Nachmittag nutzte jeder, wie er
wollte, sei es mit einer individuellen Stadtbesichtigung, einem Ein-
kaufsbummel oder einer Schifffahrt auf der Moldau.
Auf der Rückfahrt nach Traunstein machte die Gesellschaft am
dritten Tag Zwischenstation in Klattau, ein bedeutendes Verwal-
tungs-, und Wirtschafts- und Kulturzentrum Südwestböhmens, das
von König Premysl Otakar II. um das Jahr 1260 gegründet wurde.
Die Innenstadt dominieren der 76 Meter hohe Schwarze Turm und
die zweitürmige barocke Jesuitenkirche. Unter der Jesuitenkirche
befinden sich Katakomben, die Begräbnisstätte der Jesuiten, rei-
cher Bürger und des Adels. Ein System von Luftkanälen hielt stän-
dig Temperatur und Feuchtigkeit gleich, so dass die Toten mumifi-
ziert wurden. Im historischen Teil der Stadt befinden sich etwa 80
denkmalgeschützte Objekte, zum Beispiel die Stadtbefestigung
mit Rundtürmen und über zehn Meter hohe Wällen, der Weiße
Turm und Bürgerhäuser verschiedener Baustile. Zum Bedauern
aller war die Barockapotheke „Zum weißen Einhorn“ leider ge-
schlossen. Mit einem gehaltvollen böhmischen Mittagessen und
einem kühlen Pilsener Bier gestärkt traten die Traunsteiner und
Trostberger die letzte Etappe des von unserem Betriebsrat hervor-
ragend organisierten Betriebsausflugs an. Alle waren der Mei-
nung: Prag war wieder eine Reise wert. Und Klattau natürlich
auch.
Günter Buthke
Prag war wieder eine Reise wertTraunsteiner und Trostberger besuchten die „Goldene Stadt“ an der Moldau
Die Kollegen auf dem Altstädter Ring in Prag
Bild ganz oben: Die Karlsbrücke mit dem erhaltenen Südturm vom Schiffaus betrachtet

254/2011
■ Ist es nicht wunderbar? Mit den neuen Techniken und dem In-
ternet kann ich fast jeden Menschen auf der Welt zu jeder Zeit er-
reichen. Oder zumindest eine Nachricht hinterlassen. Mit den
neuen Smartphones geht es noch ein wenig besser. Kein Ärger
mehr mit der Post, die immer, wenn`s eilig ist, besonders lange
braucht. Keine dicken Din A4 Briefe mehr mit Übergewicht und
Eilpost. Kein ewiges Warten mehr bei belegten Telefonen oder ab-
wesenden Menschen. Man schickt einfach seinen Termin, seine
Unterlagen, alles was immer man möchte, mittels E-Mail an den
Partner. Der antwortet dann, sobald es in seinen Tagesplan passt.
Unterlagen können schnell am Computer verbessert, ergänzt und
zurückgesandt werden. Alles geht schneller, einfacher, bequemer.
Soweit die Theorie.
Aber wie sieht es denn wirklich aus. Die Mitmenschen wagen es,
in Urlaub zu gehen. Nun gut, wenn der Mensch da wenigstens so
nett ist, eine Abwesenheitsnotiz in eine E-Mail-Account einzustel-
len, weiß man dies wenigstens. Aber einige elektronische Nean-
dertaler wissen gar nicht, wie das funktioniert. Und Du wartest
auf eine Antwort – nichts passiert. Vielleicht ist die Mail ja nicht
angekommen, soll`s auch schon mal gegeben haben, also noch-
mals geschickt. Gleiche Reaktion. Das macht einen so richtig zor-
nig. Was tun? Nun ja, eventuell mal – per Telefon- bei dessen Ar-
beitsstelle nachfragen? Aber telefonieren wegen so etwas ist ein-
fach uncool. Also zähneknirschend warten, vielleicht kurz noch ein
drittes Mal mailen – ist ja nur ein Knopfdruck.
Und so hat auch der Urlauber seine Freude. Kommt er zurück und
öffnet sein Account, findet er dort ganze Kohorten von Mails. Da
kann er sich doch gleich die ersten Stunden bis
Tage mal durchwühlen, so kommt er gleich
richtig in Schwung.
Es soll ja auch schon Leute geben, die
das als Maß ihrer Bedeutung für den Be-
trieb die Zahl der Mails bewerten, die sich
im Urlaub angesammelt haben. Es soll allerdings viel mehr geben,
denen es vor der Mailflut nach dem Urlaub graust und die kaum,
dass sie diese abgearbeitet haben, wieder urlaubsreif sind.
Und auch was da alles kommt. Wie bei der Bundeswehr: Melden
macht frei. Ich schick einfach mal eine Mail, am besten kurz vor
dem Wochenende, in dem ich Unangenehmes weitermelde. Mein
Gewissen ist entlastet, der Chef kann nicht toben – ich bin ja
nicht da - und bis Montag hat er sich dann schon beruhigt. Auch
Aufträge an andere weitergeben, kurz vor Dienstschluss und dann
den Computer aus – damit hat der andere keine Chance zu rea-
gieren, fast wie das alte `Nach Diktat verreist‘.
Blöd nur, man sieht sich kaum mehr. Es hat sich eingebürgert, zu-
mindest bei Mitmenschen, die den ganzen Tag am Computer sit-
zen, alle Kommunikation per E-Mail zu treiben. Das geht so weit,
dass mir ein Bekannter erzählt hat, er habe jetzt auch mal seinen
Kollegen persönlich kennengelernt. Mails haben die schon ein hal-
bes Jahr ausgetauscht. Der Kollege hat sein Büro zwei Türen wei-
ter.
Ich weiß, ich bin altmodisch, aber wäre es nicht oft viel sinnvoller,
einfach mal wieder zum Kollegen zu gehen, ein paar Worte zu
wechseln und so viele E-Mails zu sparen?
Dr. Herbert Bruckmayer
Sie haben Post!oder Brave new world
Glosse

26 Sucht 4/2011
■ die nutzung des Computers und des
internets kann zu einem stark exzessi-
ven, selbstschädigenden Problemverhal-
ten führen.
Scheinbar haben doch viele Menschen ein
Problem mit der maßvollen Nutzung von
Chatrooms, Musikbörsen und Erotikange-
boten etc. Vor allem der Umgang mit On-
line-Spielen führt bei vielen Jugendlichen
zu einem exzessiven „Computermiss-
brauch“, so dass man von einer „Verhal-
tenssucht“ sprechen kann. Computerspiel-
und Internetsüchtige verbringen bis zu 18
Stunden täglich im Netz, vernachlässigen
die Schule, den Beruf und die sozialen
Kontakte. Diese relativ neue Form der Ab-
hängigkeit wurde jetzt erstmals im Drogen-
und Suchtbericht der Bundesregierung be-
rücksichtigt.
Das Computerspielen wird zur wichtigsten
Aktivität des Betroffenen und dominiert
sein Denken, seine Gefühle und sein Ver-
halten. Durch die beim Spielen verspürte
Erregung (sog. Kick- oder Flow-Erlebnisse)
oder Entspannung werden negative Ge-
fühlszustände im Sinne einer vermeiden-
den Stressbewältigungsstrategie verdrängt.
Wird der Betroffene am Spielen gehindert
oder bleibt das Spielen aus, treten diese in
Form von unangenehmen emotionalen
und körperlichen Zuständen (z. B. Reizbar-
keit, Nervosität, Ruhelosigkeit, Niederge-
schlagenheit) auf. Die Betroffenen können
ihr Spielverhalten in Bezug auf zeitliche Be-
grenzungen und Umfang nicht mehr kon-
trollieren. Trotz des bestehenden Wun-
sches, nicht zu spielen, können sie dieses
nicht reduzieren.
Nach Zeiten der Abstinenz
oder Phasen kontrollierten
Computerspielens kommt es
beim Betroffenen zu einer Wiederauf-
nahme des unkontrollierten, exzessiven
Computerspielens.
Die Computerspielsucht ist bisher keine ei-
genständige Diagnose und geht in vielen
Fällen einher mit weiteren Problemen oder
psychischen Störungen wie: Depressionen,
Angststörungen oder Suchtmittelmiss-
brauch oder –abhängigkeit. Häufig findet
sich bei den Betroffenen eine Unfähigkeit
zu entspannen, ein ausgeprägt niedriger
Selbstwert sowie depressives Erleben.
Verlässliche Zahlen, wie viele Menschen
sich wegen problematischen Internetkon-
sums in Beratung und Behandlung bege-
ben haben, liegen bislang nicht vor. Ver-
schiedenen Studien zufolge gelten aber
schon heute drei bis sieben Prozent der In-
ternetnutzer als onlinesüchtig, ebenso
viele werden als stark suchtgefährdet ein-
gestuft. Vor allem männliche Jugendliche
und junge Erwachsene sind betroffen.
Gesetze helfen gegen diese Form der Ab-
hängigkeit nicht weiter. Präventiv müssen
die Medienkompetenz bei Kindern und Ju-
gendlichen, aber auch bei den Eltern, ge-
fördert werden, damit die Gefahr rechtzei-
tig erkannt und eingegriffen werden kann.
Nur eine individuelle Betrachtung der Pro-
blematik des Einzelnen kann zeigen, inwie-
weit das exzessive Computerspielen Aus-
gangspunkt für die sich darstellende Pro-
blematik ist. Deshalb ist eine gründliche
Diagnostik unbedingt erforderlich. Ein Ziel
der Behandlung der „Onlinesucht“ ist eine
starke Reduzierung der Nutzungsgewohn-
heiten. Zudem müssen alternative Verhal-
tensweisen geschaffen werden. Die zuvor
vernachlässigten Aktivitäten und sozialen
Kontakte müssen wieder hergestellt bzw.
aufgebaut werden. Erkannte, psychische
Störungen müssen natürlich parallel be-
handelt werden.
Wer zu dieser Thematik mehr erfahren
möchte, sollte sich einen der beiden Fort-
bildungstermine notieren. Der Arbeitskreis
„Sucht im Betrieb“ bietet zusammen mit
der Abteilung Fort- und Weiterbildung am
13. März 2012 im Klinikum Traunstein und
am 21. März 2012 in der Kreisklinik Trost-
berg eine innerbetriebliche Fortbildung
zum Thema Onlinesucht an.
Ein junger Mann aus unserem Betrieb wird
seinen persönlichen „Fall“ vorstellen und
Dr. Alexander Lohmeier (Dipl. Sozialpäda-
goge) von der Suchtberatungsstelle der Ca-
ritas Traunstein stellt sich als Fachmann
für Ihre Fragen zu Entstehungsursachen,
Symptomatik, Behandlungsmöglichkeiten
etc. zur Verfügung.
Wolfgang Raufeisen
Suchtbeauftagter
Onlinesucht = „Verhaltenssucht“ein Suchtverhalten ohne drogenkonsum
„Drei bis sieben Prozent der Internetnutzersind süchtig“

27Leute von uns4/2011
Monika Auer
Salzzug
Monika Auer, Chefarztsekretärin in der Allgemeinchirurgie in Traunstein hat ihren ersten
Roman veröffentlicht. Hermann Dengel sprach mit der jungen Autorin über ihr literari-
sches Debüt.
Zum Inhalt:
Durch das gegenwärtige Chiemgau zieht ein historischer Salzzug. Eine junge Graphikde-
signerin erlebt mit ihrer besten Freundin ein wunderschönes Fest mit den Fremden, auf
dem sich die Protagonistin und einer der Säumer näherkommen. Am nächsten Morgen ist
der Salzzug weitergezogen und plötzlich ist nichts mehr, wie es schien.
Wichtiger Hinweis für den Leser; die Handlung wird auf Hochdeutsch beschrieben – die
Dialoge sind auf Bayerisch!
Wie kamen Sie auf die Idee diesen Roman
zu schreiben?
Im August 1995 haben 20 Männer einen
historischen Salzzug von Bad Reichenhall
nach Samerberg nachgestellt. Authentisch
im Auftreten und mit viel Wissen über
diese Zeit verbrachten diese einen schö-
nen und interessanten Abend mit den Ein-
heimischen. Der Roman war geboren und
bereits wenige Tage danach mit dem ers-
ten Personal-Computer meines Bruders ge-
schrieben.
Sie haben in ihrem Roman den Wechsel
zwischen Schriftdeutsch und Bayerisch.
War dies von Ihnen beabsichtigt, wenn ja
warum?
Seit dem Film „Wer früher stirbt ist länger
tot!“, habe ich die Scheu vor einer Veröf-
fentlichung in Mundart verloren. Ich denke,
dass ein Roman, dessen Geschehen in un-
serer Gegend handelt, sollte bayerische Ak-
zente haben.
Haben Sie weitere Gedanken zu einem
neuen Buch?
Ich würde gerne einen Krimi schreiben,
dessen Handlung sich in unseren Kranken-
häusern spielt. Aber schon mit dem ersten
schriftlichen Entwurf, ergab sich für mich,
dass es sehr schwierig ist, die richtigen
Spuren zu legen und dann aufzuklären.
Darum wird der Krimi wohl noch lange auf
sich warten lassen.
Haben Sie einen „Lieblingsschriftsteller“
oder eine bestimmte Richtung in der
Literatur, die Sie gerne lesen?
Einen Lieblingsschriftsteller habe ich nicht
auch keine bestimmte Richtung in der Lite-
ratur, aber ich mag gerne Bücher, welche
in der Seitenanzahl nicht unbedingt die
400 sprengen. Für mich sind kurz gesetzte
und geschriebene Bücher spannender und
interessanter.
Vielen Dank Frau Auer, wir warten trotz-
dem auf das nächste Buch!
Ihnen Alle viel Spaß beim Lesen des Bu-
ches unserer Mitarbeiterin.
Dieses Buch kann auch an den Kiosken in
Traunstein und Trostberg gekauft werden!
Hermann Dengl, Gesamtbetriebsrat
Buchvorstellung

28 Willkommen 4/2011
Ayse Aydin Gülsüm Aydin Blanka Basic Simone Biberger Aneta BierGabriele Biermaier Petra Birkenmaier Sabrina Böttcher Ursula Bogner-Sanchez
Erika Braun Zrinka Bugarski Wolfgang Burghartswieser Renate Bußl
Gabriele Czerwek Anton Datz Markus Datz Sabine DaumRegina Dentgen Ramona Dießlin Dr. Hans-Peter DoepnerEdeltraud Ebner Katrin Ecke Martha Egger Michaela Eisenberger
Klaus Fladischer Antonia Flechsenhar Inge Frankenberger Rita Frauendienst Christine Freimoser Martina FreimoserThomas Fritscher Helena Funkner Olga Geier Michael Geraschenko Simone GimplGerhard Gläser Mathilde Glück Rosemarie Gnadl Birgit Görisch Mechthild Goggitsch
Mirna Grafina Jacqueline Grander Anette Grill Maria GstatterBrigitte Gugg Therese Guggelberger Silvia Haberlander Sabine Hallweger
Sonja Heckmann Andrea Heim Martina Heitauer Ilka Henning Sandra Hirtelreiter
Manfred Hölzle Marion Horlacher Dr. Gottfried Huber Elfriede IlligenElfriede Kamml Ruth Karius Marianne Kecht Monika Kessler Doris Klement
Günther Klitzpera Stephanie Kloiber Petra Koch Dr. Thomas Koch Sören KrausMartin Kutz Christine Lanzinger Josefa Laschinger Sabine LehrbergerErika Maedler Gloria Maier Dr. Wolfgang Maier Annemarie MatheislElisabeth Meier Marion Möller Elisabeth Moser Waltraud Moser
Dr. Gabriele Moultrie Sabine Neugebauer Regina Obermayer Fatma ÖnderRita Pfeifer Nadine Pilgram Rita Plereiter Angela Pletschacher Gabriele Plut
Petra Ramstoetter Irene Rausch Kerstin Reinhold Christa Reiter-Schikora
Ulrike Rieder Sabine Sandner Peter Scheck Dr. Christiane SchinabeckAzra Schloßhauer Gordana Schneider Katharina SchneiderMaria Schneider Heike Schröder Andrea Schulz Daniel Schulz Andreas Schwedler
Marianne Seilinger Nadine Sieber Ewa Skurzok Dr. Eveline SpeedMartina Stawny-Wenta Roswitha Steffens Dogdan TorlakJulia Wacker Stephan Wacker Margarete WittscheckChristoph Woernle Angelika Woinar Simone WolfAnneliese Zenz Robert Zollner Eva Zürcher
Herzlich willkommen Kolleginnen und Kollegen aus Ruhpolding

29kurz Notiert4/2011
KuRz notieRt
„Bufdi“in der Kreisklinik Berchtesgaden begrüßtStationsleitung Sabine Stecher (li.) von der Station 1 in Berchtes-
gaden und Pflegedienstleitung Gabriele Beyer-Müssiggang be-
grüßten Florian Lorenz aus Berchtesgaden, der Anfang November
dort seinen Bundesfreiwilligendienst antrat. Bewogen hat Florian
Lorenz das Interesse am Beruf des Krankenpflegers. Lorenz war
bereits vorher bei der Bundeswehr im Sanitätsbereich tätig und
hat vor, ab nächstem Jahr die Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger bei den Kliniken Südostbayern zu beginnen. „Die
Zeit im Bundesfreiwilligendienst ermöglicht einen guten Einblick
in die Struktur des
Berufes des Ge-
sundheits- und
Krankenpflegers
und der Kliniken“ so
Lorenz.
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit 2011“
Großartige Leistung der KlinikmitarbeiterAn der diesjährigen Sommeraktion der AOK „Mit dem Rad zur Ar-
beit“ nahmen 61 Mitarbeiter des Klinikums Traunstein teil, von
denen 45 Teilnehmer ihre Kilometerabrechnung an den Betriebs-
rat weitergaben. Die zurückgelegte Strecke lag bei 13 168 Kilome-
ter. Bei der Einzelwertung erreichte ein Teilnehmer 1092 Kilome-
ter. Die Gesamtleistung aller Teilnehmer ergab an CO2-Einsparung
ca. 2,1 Tonnen.
Viel interessanter ist aber die Frage: Was haben die Radler an Ka-
lorien verbraucht? Es waren ca. 230 400 kcal. Dies entspricht ca.
310 Portionen Schweinsbraten mit einer Halben Bier oder ca. 500
Stück Sahnetorte. Freuen wir uns schon auf die Aktion “Mit dem
Rad zur Arbeit 2012“ und hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung.
Den bisherigen Rekord von 61 Teilnehmern werden wir doch lo-
cker knacken.
Wolfgang Obermeier; BR TS
■ die Mitarbeiterinnen des Ambulanzsekretariates, Archivs,
der information und Patientenaufnahme nahmen an der Quali-
tätsoffensive „Premium Region BGL“ teil und dürfen nun das
Qualitätssiegel der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berch-
tesgadener Land tragen.
Die offizielle Übergabe des Qualitätssiegels erfolgte Anfang Okto-
ber durch Landrat Georg Grabner in einem fahrenden Sonderzug
der Berchtesgadener Land Bahn. 17 Unternehmer aus dem Land-
kreis konnten das Siegel in Empfang nehmen. Die Abteilungen
Ambulanzsekretariat, Archiv, Information und Patientenaufnahme
der Kreisklinik Berchtesgaden beteiligten sich zum ersten Mal an
der Qualitätsoffensive. „Es hat uns viel Spaß gemacht und zu eini-
gen Verbesserungen geführt“, so Catharina Strobl, Abteilungsleite-
rin. Mit auf die „große Fahrt“ der Siegelübergabe gingen neben
Catharina Strobl auch Gitti Jockisch und Manuela Bachmach und
freuten sich über das von Landrat Grabner überreichte Siegel.
Durch den Besuch von Vorträgen und Teilnahme an Seminaren
konnten die Mitarbeiterinnen des Ambulanzsekretariates, Archivs,
der Information und Patientenaufnahme das Qualitätssiegel erar-
beiten und dürfen in Zukunft das Siegel in ihrer Abteilung führen.
2007 startete die Qualitätsoffensive Berchtesgadener Land, um
insbesondere im Dienstleistungsbereich von Tourismus, Handel
und Service Qualitätssteigerungen voranzutreiben. Das Projekt
wurde von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berchtesgade-
ner Land in Kooperation mit der GLT GmbH, der IHK
München/Oberbayern und fast allen Kommunen des Landkreises
ins Leben gerufen. Das Projekt ist branchenübergreifend und be-
schäftigt sich mit dem Image des Berchtesgadener Landes.
Evelyn Tauber
Siegel der Qualitätsoffensive„Premium Region Berchtes-gadener Land“ für dieKreisklinik Berchtesgaden
von links nach rechts: Christiane Eisenreich, CatharinaStrobl (Abteilungsleitung), Andrea Maltan, Gitti Jockisch,Gabriele Schilling, Alexandra Hölzl, Sandra Besele,Manuela Bachmann

30 Neue Gesichter 4/2011
Neue Gesichter
Michael de Jesus PereiraOberarzt Unfallchirurgie, Bad Reichenhall
Seit Mitte November bin ich als neuer
Oberarzt der Abteilung Unfallchirurgie und
Sporttraumatologie in der Kreisklinik Bad
Reichenhall tätig und möchte diesen Rah-
men nutzen um mich vorzustellen.
Meine Kindheit verbrachte ich sowohl in
Norddeutschland/ Bremerhaven wie auch
an der sonnigen Algarve/ Portugal. Mein
Studium brachte mich 1996 nach Essen.
Dort studierte ich Medizin und eine län-
gere Zeit Sportwissenschaften. Nach
meinem Abschluss wechselte ich zunächst
an die Unfallchirurgische Klinik der RWTH
Aachen. Am Dreiländereck verbrachte ich
schöne dreieinhalb Jahre. Danach zog es
mich in das Berchtesgadener Land, wo ich
zwei Jahre als Assistenzarzt in der Un-
fallchirurgie der Kreisklinik Bad Reichen-
hall tätig war. Die weitere orthopädische
Ausbildung absolvierte ich in dem
Kinderorthopädischen Behandlungszen-
trum Aschau im Chiemgau. Danach wech-
selte ich an die Unfallchirurgische Klinik
des Klinikums Worms, wo ich meinen
Facharzt der Orthopädie und Un-
fallchirurgie erlangte.
Bereits in meiner vorherigen Zeit im
Berchtesgadener Land lernte ich die re-
gionalen Vorzüge kennen und schätzen.
Somit freue ich mich sehr, wieder in der
Region zu sein. Die Unfallchirurgische und
Sporttraumatologische Abteilung bietet ein
sehr interessantes Spektrum der Trauma-
tologie in einer wunderschönen Region.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in der
Natur, vor allem in den Bergen. Ferner
beim Fußballspielen, Mountainbiken oder
Skifahren. Sportmedizinisch betreute ich
in den letzten Jahren mehrere
Mannschaften bzw. Vereine. Darunter die
Turmspringer vom SV Neptun Aachen, die
Reiter des CHIO Aachen und die Boxer
vom MTK Aachen. Zuletzt war ich als
Mannschaftsarzt der Fußballer von Wor-
matia Worms/ RGL Süd wirkend.
Ich freue mich auf eine kollegiale Zusam-
menarbeit und eine interessante Tätigkeit.
Ihr
Michael de Jesus Pereira
dr. Andrea StreicherOberärztin – Kardiologie, Klinikum Traunstein
Seit August ergänze ich das kardiologische
Team um Prof. Dr. Werner Moshage. Ich
bin Internistin mit Schwerpunkt Kardiolo-
gie sowie Intensiv- und Notfallmedizinerin.
Meine internistisch-kardiologische Ausbil-
dung habe ich im Krankenhaus Schwabing
und im Klinikum Freising absolviert, wo ich
auch den Facharzt für Innere Medizin
sowie die Weiterbildung spezielle in-
ternistische Intensivmedizin erlangte. Zur
invasiven kardiologischen Weiterbildung,
das heißt zum Erlernen der Koronaran-
giographie und Koronarinterventionen, bin
ich ins St. Josefs-Hospital in Wiesbaden
gewechselt, wo ich auch die Schwerpunkt-
bezeichnung Kardiologie erlangte.
Parallel bin ich seit vielen Jahren begeis-
tert als Notärztin tätig. Zwischenzeitlich
habe ich im Ambulanzflugdienst Repatri-
ierungen durchgeführt.
Zuletzt war ich als Oberärztin in der in-
ternistischen Abteilung der Kreisklinik
Ebersberg mit der Leitung der internistis-
chen Intensivstation sowie als eine von
drei interventionellen Kardiologen im
Herzkatheterlabor tätig.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Bad
Kreuznach/Rheinland-Pfalz. Mein Medi-
zinstudium absolvierte ich in Ulm, Freiburg
und der LMU München.
Ich freue mich, in der kardiologischen
Abteilung des Klinikum Traunstein auf
hohem Niveau und mit breitem Spektrum
in einem äußerst qualifizierten netten
Team arbeiten zu dürfen.
Ihre
Dr. Andrea Streicher

31Neue Gesichter4/2011
Seit dem 1. Oktober ist Alexandra Wedler
bei der Fachärztezentrum für Strahlenthe-
rapie und Nuklearmedizin GmbH be schäf -
tigt. Die Fachärztezentrum für Strahlenther-
apie und Nuklearmedizin GmbH ist ein Un-
ternehmen der Kliniken Südostbayern AG
und soll ab 1. Januar 2012 ein Medizi -
nisches Versorgungszentrum am Klinikum
Traunstein betreiben. Alexandra Wedler
wird unseren stellvertretenden Vorstand
Robert Betz vorrangig beim Aufbau des
MVZ für Strahlentherapie und Nuk-
learmedizin unterstützen. Bis zum 1. Ja -
nuar sollen die Nuklearmedizin von Che-
farzt Jürgen Diener und die Strahlenthera-
pie von Chefarzt Dr. Thomas Auberger den
Betrieb im Fachärztezentrum aufnehmen.
Bis dahin gibt es für Alexandra Wedler
noch viel zu tun, wie zum Beispiel Ausar-
beiten der Anstellungsverträge, Kosten-
und Erlösplanung, Erstellen von Mietverträ-
gen, Beschaffung der notwendigen Unterla-
gen bei der Kassenärztliche Vereinigung
Bayern usw. Darüber hinaus sind zahlrei-
che Gespräche mit den betroffenen Ärzten
notwendig. Wenn das MVZ einmal läuft, ist
der Aufbau eines Controllings geplant. Per-
spektivisch ist auch vorgesehen, dass sie
Prokurist Andreas Lange, Abteilungsleiter
Verwaltung unserer Kliniken im Berchtes-
gadener Land, bezüglich der MVZ’s in
Freilassing, Bad Reichenhall und Berchtes-
gaden unterstützt und entlastet.
Alexandra Wedler hat eine dreijährige Aus-
bildung in der medizinischen Dokumenta-
tion absolviert und berufsbegleitend Be-
triebswirtschaft mit dem Schwerpunkt
Krankenhausmanagement an der Fach-
hochschule in Mainz studiert. Sie hat über
sechs Jahre Berufserfahrung als Assis-
tentin der kaufmännischen Geschäfts-
führung von hessischen Krankenhäusern.
Bedingt durch einen beruflichen Wechsel
ihres Mannes ist sie im Juli dieses Jahres
mit ihrem Mann und Tochter nach Traun-
stein gezogen. Alexandra Wedler hat bei
uns wieder eine passende Aufgabe in
ihrem bisherigen Betätigungsfeld gefun-
den.
Alexandra Wedler Assistentin der Geschäftsführung
Wir haben unsere elektronische Zeitschrif-
tenbibliothek etwas umgestaltet und erwei-
tert. Über unser Intranet-Portal erreichen
Sie die Startseite. Auf der linken Seite sind
etliche Links eingefügt:
ezB: Hier gelangen Sie zu den Zeitschrif-
ten, die für unsere Häuser frei geschaltet
wurden, insbesondere gibt es einige neue
Titel aus der uptodate-Reihe von Thieme.
Darunter sind einige Datenbanken zur Lite-
raturrecherche verlinkt:
Über Mepilot kann man auch Artikel be-
stellen, die man nicht über unsere Biblio-
thek erhält, allerdings kostenpflichtig. Dazu
muss man sich einmalig registrieren. Als
Lehrkrankenhaus gehören wir der Nutzer-
gruppe Universitäten an und erhalten die
Artikel zum Preis von 6 Euro per E-Mail
oder 7,50 Euro per Post.
Weiter haben wir Zugang zu uptodate –
eine aktuelle Datenbank.
Neu ist unser Zugang zu doctor Consult:
Hier haben wir Zugriff auf etliche Journals,
aber auch online-Bücher. Das Besondere
an dieser Datenbank ist, dass wir diese
auch von zu Hause aus nutzen dürfen. Die
entsprechenden Zugangsdaten finden Sie
wie gewohnt in der „Readme-Datei“ in der
EZB. Diese Daten dürfen nicht an Außen-
stehende weitergegeben werden.
Sollte es mal Zugangsprobleme geben,
können Sie unter „Ansprechpartner“ Hilfe
bekommen. In erster Linie hilft uns da die
Firma Frohberg weiter, die diese Seite für
uns betreut:
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Angebot die
Suche nach Literatur zu erleichtern.
Dr. Tobias Trips - Oberarzt Pädiatrie TS
Ralf Reuter - PR
Elektronische Zeitschriftenbibliothek

32 4/2011Neue Mitarbeiter
Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Bad Reichenhall:+ Sabine Abfalter, Pflegedienst,
Station 3 B
+ Stephanie Aichinger, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Christina Bauregger, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Sigrid Bienek, Pflegedienst, Station 3 A
+ Julia Böhm, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Thomas Bremhorst, Krankenpflege-
schüler, Schule
+ Dusan Dovecar, Pflegedienst, Intensiv
+ Johann Fischer, Funktionsdienst,
Zentrale Sterilisation
+ Katharina Gebhardt, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Lilian Gichuhi, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Michaela Gillitz, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Monique Günthel, Pflegedienst,
Station 2 B Chirurgie priv.
+ Alexander Gura, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Theresa Hasselberger, Pflegedienst,
Station 4 A
+ Andrea Herbst, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Arta Ilazi, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Shirley Jangk, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Christiane Keitel, Pflegedienst,
Station 2 B Chirurgie priv.
+ Elena Kusnezow, Med.-Techn.-Dienst,
Sozialdienst
+ Melanie Leikermoser, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Eva-Maria Lex, Pflegedienst, Station 4 A
+ Jutta-Susanna Luncan, Pflegedienst,
Station 3 B
+ Christine Maier, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Stefan Muck, Pflegedienst,
2 B Chirurgie priv.
+ Sabrina Anna Nagl, Krankenpflegeschü-
lerin, Schule
+ Sophie Nestle, Krankenpflegeschüler,
Schule
+ Vanessa Ogorzelec, Krankenpflegeschü-
lerin, Schule
+ Astrid Quetscher, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Stephanie Reichenberger, Krankenpfle-
geschülerin, Schule
+ Susanne Renoth, Funktionsdienst, An-
ästhesiepflege
+ Leila Said, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Franziska Schönheim, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Stefanie Steinmaßl, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Dr. Jan Stejskal, Ärztlicher Dienst,
Innere Abt.
+ Julia Vogt, Pflegedienst, Station 3 A
+ Stefan Wiedenhofer, Krankenpflege-
schüler, Schule
+ Jeslin Wiening, Funktionsdienst,
Notaufnahme
+ Lena Sabina Wimmer, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Marina Wimmer, Krankenpflegeschüler,
Schule
+ Melanie Wimmer, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Martina Wirnstl, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Jennifer Wunderle, Pflegedienst, Station
2 A Chirurgie/Urol.
Berchtesgaden:+ Elena Brinckmann, Med.-Techn.-Dienst,
Physik. Therapie
+ Christina Friebel, Med.-Techn.-Dienst,
Physik. Therapie
+ Madeleine Pohl, Pflegedienst, III. Stock
+ Evamaria Storsillo, Pflegedienst, Geri-
atrie
+ Andreas Zillmann, Pflegedienst, I. Stock
Freilassing:+ Barbara Ganser, Funktionsdienst,
Ambulantes Operieren
Traunstein:+ Carolin Adler, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Beate Ammer-Schönhaar, Med.-Techn.-
Dienst, Strahlentherapie
+ Karin Amort, Verwaltungsdienst, Pforte
+ Bettina Aschauer, Med.-Techn.-Dienst,
Kinder-Jugendmedizin
+ Ramona Auer, OP
+ Wolfgang Babl, Technik
+ Tamara Bankosegger, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Helena Verena Bauer, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Jana Pauline Bauer, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Laura Bissen, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Karoline Böhm, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Annemarie Coring, Pflegedienst, St. III/3
+ Johanna Maria Dimpflmaier, Wirtsch.-
Versorgungsdienst, Küche
+ Nancy Dreißig, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Sarah Eicken, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Dr. Michael Eisert, Ärztlicher Dienst, AOZ
TS/FRL
+ Martina Fickel, Päd-Tagesklinik
+ Dr. Ivo Franceschini, Ärztlicher Dienst,
CH-Unfall
+ Prof. Dr. Helga Frank, Ärztlicher Dienst,
Nephrologie
+ Monika Gaisreiter, Krankenpflegeschü-
lerin, Schule
+ Dr. Florian Gapp, Ärztlicher Dienst, Kin-
der-Jugendmedizin
+ Tatjana Gick, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Melanie Gmeindl, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Franziska Gollinger, Krankenpflegeschü-
lerin, Schule
+ Maria Grassl, Wirtsch.-Versorgungs-
dienst, Küche
+ Kevin Grießenböck, Krankenpflegeschü-
lerin, Schule
+ Elisabeth Hallweger, Med.-Techn.-
Dienst, Kardiologie
+ Sophie Hechenbichler, Operat. Intensiv-
station
+ Valentin Hechenbichler, Int-Überwa-
chung

334/2011
Herzlich Willkommen
Neue Mitarbeiter
+ Veronika Hinterreiter, St. IV/2
+ Marcus Hrgovic, Krankenpflegeschüler,
Schule
+ Katharina Huber, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Maximilian Huber, Krankenpflegeschü-
ler, Schule
+ Emre Inat, Krankenpflegeschüler,
Schule
+ Susanne Keinath, Ärztlicher Dienst,
Kinder-Jugendmedizin
+ Wolfgang Kienzl, Ärztlicher Dienst,
Neurologie
+ Stephanie Kirner, Funktionsdienst,
AOZ TS/FRL
+ Nicole Kotzulla, Verwaltungsdienst,
Rechnungswesen
+ Monika Kowaltschick, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Karin Kracher, Pflegedienst, St. III/1
+ Markus Landinger, Ärztlicher Dienst,
CH-Gefäß
+ Elisa Langer, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Aline Larbig-Herbiet, Med.-Techn.-
Dienst, Neurologie
+ Melanie Doris Lederer, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Maximilian Liebhart, Krankenpflege-
schüler, Schule
+ Dominik Luginger, Krankenpflegeschü-
ler, Schule
+ Franziska Mattner, CH-Unfall
+ Sonja Mayer, Funktionsdienst,OP
+ Michael Meinlschmidt, Krankenpflege-
schüler, Schule
+ Michaela Mohrin, Krankenpflegeschü-
ler, Schule
+ Verena Musial, Pflegedienst, St. 0/1
+ Magdalena Nachtmann, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Simone Namberger, Funktionsdienst,
AOZ TS/FRL
+ Julia Neudorfer, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Regina Neuwieser, Pflegedienst, St. I/3
+ Roland Oberleitner, Verwaltungsdienst,
EDV
+ Lydia Ochs, Med.-Techn.-Dienst,
Nuklearmedizin
+ Tanja Ortner, Pflegedienst, St. V/1
+ Natassa Pfeiffer, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Stephanie Pscherer, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Sonja Puziewicz, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Maria Rauscher, Päd-Tagesklinik
+ Sarah Riedl, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Anna Lena Roth, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Sabrina Rudolf, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Katja Schallinger, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Alexandra Scheck, Med.-Techn.-Dienst,
Diabetologie
+ Nina Scheuerecker, Krankenpflegeschü-
lerin, Schule
+ Hannelore Schick, Kinder-Jugendmedi-
zin
+ Katrin Schrobenhauser, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Christina Schroll, Pflegedienst, Med-In-
tensiv
+ Luise Schroll, Pflegedienst,
+ Barbara Sichler, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Monika Stalleder, Krankenpflegeschü-
ler, Schule
+ Katharina Stanggassinger, Krankenpfle-
geschülerin, Schule
+ Julia Staudhamer, Krankenpflegeschü-
lerin, Schule
+ Christine Staufer, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Christina Strohmayer, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Marta Szpaczko, Krankenpflegeschüle-
rin, Schule
+ Simone Thaler, Krankenpflegeschülerin,
Schule
+ Manuela Wagenbauer, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Marina Wambach, Krankenpflegeschü-
lerin, Schule
+ Stefanie Wiesenegger, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Anna-Lena Wilhelmy, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Ramona Teresa Wörndl, Krankenpflege-
schülerin, Schule
+ Elisabeth Zeilinger, Funktionsdienst, OP
+ Katharina Zimmermann, Krankenpfle-
geschülerin, Schule
Trostberg+ Claudia Darge, Pflegedienst, Stat. 2 A
+ Melanie Ebermann, Pflegedienst,
Stat. 3 B
+ Alina Fominich, Pflegedienst, Stat. 3 B
+ Stephanie Lihotzky, Verwaltungsdienst,
Schreibbüro
+ Andreas Maximilian Meitinger, Ärztlicher
Dienst, Innere Medizin
+ Anna-Maria Otto, Pflegedienst, Stat. 3 B
+ Sabrina Schiller, Pflegedienst, Stat. 1 A
+ Tobias Schimmer, Technischer Dienst,
Werkstätten

34 Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen 4/2011
dr. Christian StöberlFacharztanerkennungHämatologie und in-ternistische Onkologie(REI)
dr. thomas Bunse Ernennung zum Funk-tionsoberarzt, Med. Int. (TS)
dr. Markus MundelErhalt Zertifikat„Schrittmacherthera-pie“ (EHRA) Kardiologie (TS)
dr. Mattias Gotthardt Promotion, Innere Medizin (FRL)
dr. Ralf BrangenbergSchwerpunktbezeich-nung Neonatologie (TS)
Promotionen und Facharztanerkennungen
Sr. Siv Maikenilewski-MaierFacharztanerkennungKinder- u. Jungend-medizin (TS)
dr. tanja Pinter FacharztanerkennungAnästhesie (TS)
dr. Jutta KrahmerZusatzbezeichnungIntensivmedizinKardiologie (TS)
Haben wir versehentlichin der letzten Ausgabezum Nephrologengemacht.
Herzlichen Glückwunsch
Bestandene Prüfungen
erfolgreicher Abschluß des Stations -
leitungskurses:
von links: Stefan Tautz, PDL (REI), Daniela
Mandrysch, OP (REI), Andreas Bloch, Not-
aufnahme (REI), Daniela Rupp,EKG/HKL
(TS), Ruth Wiedemann-Ruf Palliativstation
(TS), Gabi Beyer-Müssiggang PDL (BGD),
Blazenka Nakic Station 2 (BGD), Hildegard
Mauer PDL (TS), Larissa Kajsler, Kreißsaal
(TS), Willi Stettner PDL (TS)
Annemarie emmervom BrustzentrumTraunstein, hat erfol-greich die Ausbildungzur „Breast CareNurse“ (BCN)abgeschlossen
erfolgreicher Praxisanleiterauf-
baukurs:
von links: Andreas Schuster, OP (REI),Ste-
fan Fuchs, OP-Int (TS), Katharina Krämer,
Päd. Int (TS), Karina Hoch, Med. Int (TS),
Sandra Mix Med. Int (TS), Elisabeth Wim-
mer, Anaesthesie (TB)
Markus Gastagervon der Apotheke inTraunstein, hat erfol-greich die Ausbildungzum Fachapothekerfür klinische Phar-mazie abgeschlossen

35Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen4/2011
Herzlichen Glückwunsch
oA dr. WolfgangSchleiferAnästhesie (REI)
Angelika BertgesFrauenklinik (TS)
Monika SchuhmacherPatientenabrechnung(TS)
ihr 25-jähriges dienstjubiläum feierten:
Rita MaierPflegedienst, Station 3A (TB)
Astrid MollPflegedienst, Station 1A (TB)
Johann WeinmaierPforte (TB)
Annemarie FreiSomatik (FREI)
Rosa MuxenederPflegedienst, Station 3A (TB)
Petra KosneyPflegedienst, Station 3a (REI)
Martina neuhoferPflegedienst, Intensiv (Frei)
doris BilgerSchreibbüro (TB)
dr. George PutzAnästhesie (REI)
in den Ruhestand wurden verabschiedet:
Claudia PoppBetriebswirtschaftl.Abt., (TS)
erika RögerSekretariat PDL (TS)
Katrin henningsPflegedienst, Anästhesie (TS)
leider ohne Bild:+ Dr. Johann Sirtl, Chirurgie (REI) + Mara Koturic, Reinigungsdienst (REI)
Brigitte GschreySchreibbüro (TB)
eduard huberPflegedienst, Abulanz (TB)
Rita MaierPflegedienst, Station 3A (TB)
Annemarie osenstätterPatientenaufn. (TS)
Maria AignerPflegedienst, Chir. Notaufnahme(TS)
Sabine Schimmer-WeißPflegedienst, Station 3.3 (TS)
Maria Krammer-MayerApotheke. (TS)
irmgard dandlPflegedienst, Station 4.1 (TS)
Sybille hechtPflegedienst, Station 4.2 (TS)
helga KönigPflegedienst, Station 4.2 (TS)
Manfred KrausHaustechnik (TS)
...und 40 Jahre
Herzlichen Glückwunsch

... zum Schluß3/2011
Echt. Gut.
www.bergbauernmilch.deFair aus Tradition.
„Liebt die Kuh ihr schönes Leben,wird sie beste Milch nur geben.“
Bergbauernregel Nr.1:
■ Mitte November fand in der Kreisklinik
Trostberg wieder das traditionelle Herbst-
Schafkopfrennen statt. Die positive Nach-
richt: Es war mit 32 Teilnehmern sehr gut
besucht, so dass zusätzliche Tische aufge-
stellt werden mussten. Schön wäre es,
wenn künftig nicht nur Schafkopfer aus
den Kliniken in Traunstein und Trostberg,
sondern auch aus den anderen Häusern
der Kliniken Südostbayern AG zum besse-
ren Kennenlernen mitmachen würden. Die
wertvollen Pokale wurden von Chefarzt
Prof. Dr. Thomas Glück und vom Standort-
verantwortlichen Günter Buthke gestiftet.
Daneben gab es wieder schöne Sach-
preise.
Die negative Nachricht (aus Sicht der Trost-
berger): Leider konnten die Trostberger
Schafkopfer ihren Heimvorteil nicht nutzen
und daher ihrer Favoritenrolle nicht gerecht
werden. War es fehlendes Kartenglück?
Oder doch einfach Pech? Aber das war
nicht das Entscheidende, denn schließlich
standen die Gaudi und der Spaß im Vorder-
grund und das ist das Wichtigste.
Sieger mit 65 Punkten wurde Fritz Klauser
vom Klinikum Traunstein. Er spielte den
einzigen Tout und wird immer mehr zum
Seriensieger. Einen hervorragenden zwei-
ten Platz mit nur drei Punkten Rückstand
belegte Conny Zitzelsberger, ebenfalls vom
Klinikum Traunstein, vor Gastspieler
Roman Petri (57
Punkte).
Konrad Raspl konnte
als bester Trostberger
wenigstens noch den
Trostberger Wander-
pokal, der nur unter
den Spielern aus der
Kreisklinik Trostberg
ausgespielt wird, in
Empfang nehmen. Er
war allerdings der
einzige Pokal, der
in Trostberg ver-
blieb. Sogar der Schneiderpreis, ein köstli-
cher Wurstkranz für den Vorletzten, ging an
den Traunsteiner Sebastian Rockel.
Auf die nächste Chance warten wir Trost-
berger nun aufs Frühjahr, wenn es dann in
Traunstein wieder heißt: „ Ober sticht
Unter“!
Konrad Raspl, Stat. 0 A (TB)
Doppelsieg für die Traunsteiner SchafkopferBeim Schafkopfrennen in Trostberg fehlte den Gastgebern das Kartenglück
Die Traunsteiner Schafkopfer hatten die Nase vorn. Unser Foto zeigt vonlinks: Roman Petri (3. Platz), Konrad Raspl (Wanderpokal), Conny Zitzls-berger (2. Platz), Fritz Klauser (1. Platz) sowie den Vorletzten SebastianRockel mit Wurstkranz.