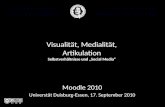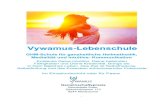Tsvasman Medialität
-
Upload
leon-tsvasman -
Category
Education
-
view
465 -
download
6
description
Transcript of Tsvasman Medialität
233
Schmitz, Münster. ZSCHABER, T. (1993): Manipulati-
on und Indoktrination durch Sprache. Eine Literatur-
analyse mit einer anschließenden Untersuchung von
pädagogisch-psychologischen Doktrinen. Bern, Stutt-
gart, Wien. [Internetquelle] SCHMIDT, S. J. (1998): Im
Gespräch mit Wedel, C. und Ebner, F. Der Radikale
Konstruktivismus: http://www.uni-essen.de/~bj0063/
archiv/interview/i-schmidt.html (Stand: 20.08.2006).
Medialität [mediality]
[M. als interdisziplinäres Konzept] Je mehr sich der Medienbegriff von seiner hist. Bedeutung emanzipiert, die ihn auf die techn.-apparativen Medien beschränkt, desto offensichtlicher wird die transdiszi-plinäre Relevanz der medienphilos. Per-spektive, die M. als wesentl. Eigenschaft der intersubjektiven Wirklichkeit auffasst. Der funktionelle Begriff der M. ist im in-terdisziplinären Diskurs vor allem dafür geeignet, die potentielle Fähigkeit von Phänomenen oder Ereignissen [der an-thropogenen Erlebenswelt] zu beschrei-ben, die als strukturierte oder instituti-onalisierte Mittler der intersubjektiven Geltung agieren.
[Systemphilos. Medienbegriff ] Der Begriff „ Medium“ wird in Bezug auf M. vor allem im Sinne von Niklas ↑ Luh-mann als ein Mittel erfasst, mit dem Un-wahrscheinlichkeit (des Verstehens: hier im Bezug auf Sprache als Medium) in Wahrscheinlichkeit transformiert werden kann, indem sie Sinn (die Einheit der Differenz von ↑ Aktualität und Potentiali-tät) durch einen konventionalisierten Zei-chen- bzw. Symbolgebrauch konstituiert. Durch symbolisch generalisierte Kom-munikationsmedien (Wahrheit , ↑ Liebe , Recht ) kann die „Annahme“ von Selek-tionen (Kommunikationsvorschlägen) motiviert werden. Durch die symboli-sche Generalisierung von Medien wird eine Selektion mit einer Motivation ver-knüpft, was die Annahme (und damit die intersubjektive Geltung ) der letzten wahr-
scheinlicher macht (Vgl. Luhmann 1996, 1997).
[Defi nition sdiskurs] M. kann so-mit als potentielle Fähigkeit einer Enti-tät (sei sie Phänomen, Ereignis, System oder Konstrukt) aufgefasst werden, (a) als Kommunikationsmedium zu fun-gieren oder (b) ihre Wesensart auf einer medialen Grundlage zu entfalten (M. von ↑ Wissen). In dem so aufgefassten Begriff der M. ist auch eine techn. Dimension enthalten: M. eines Rechners etwa be-steht in seiner potentiellen oder aktuellen Funktionalität, z.B. als Medium für netz-werkgestützte Komm. (über LAN oder Internet/Intranet ) genutzt zu werden. M. der ↑ Didaktik etwa besteht in ihrer we-sentl. Abhängigkeit von der method.-me-dialen Artikulation der Bildungsinhalte (Ladenthin 2006).
Im Grunde lässt sich M. vor allem dann beobachten, wenn eine „intentionale Handlung“ (vgl. Barad 1996 oder Megg-le 1991) tatsächlich ihre intersubjektive Geltung als eine Entität der anthropoge-nen Wirklichkeit erlangt. Aus epistemo-logisch-systemtheoret. Sicht besteht die M. der Wirklichkeit als anthropogene Le-benswelt in ihrer Eigenschaft, als Medium der ↑ Intersubjektivität zu agieren. Analog lässt sich in anderen theoret. Kontexten über M. der Arbeit oder der Sprache dis-kutieren. So betrachtet ↑ Habermas (1969) aus der handlungstheoret. Perspektive die „kommunikative Einigung entgegenge-setzter Subjekte“ als Medium der Inter-aktion. Sprache und Arbeit bezeichnet er dagegen als „Medien des Geistes“, wobei sich diese nach seinem Konzept nicht „auf die Erfahrung der Interaktion und der gegenseitigen Anerkennung“ (ebd. S. 23f.) reduzieren lassen.
Im Diskurs der philos. Bewusstseins-forschung hängt M. mit dem Konzept von Intentionalität (im Verständnis von Alfred Schütz und in der Tradition von Edmund Husserl s Phänomenologie) inso-fern zusammen, als sich letztere auf das Bewusstsein bezieht, das immer Bewusstsein von etwas ist. Die Intentionalität einer sol-chen Einstellung (bzw. „Gerichtetheit“)
Medialität
LEXIKONSATZ.indd 233 13.10.2006 10:13:48
234
des Bewusstseins „auf etwas“ kann die intersubjektive Funktionalität der M. im Sinne der Mittlung über Zeichen erklä-ren.
[M. und Medialisierung ] Mit dem, im Gegensatz zu M., prozessuell-diagnos-tisch angelegten Konzept der Mediali-sierung werden „Prozesse des Übergangs von Formen direkter Kommunikation in Formen indirekter Kommunikation über Medien“ (Schanze 2002) fokussiert, die etwa als Entzeitlichung oder Enträumlichung von Komm. oder als Virtualisierung der Berichterstattung beobachtet werden, u.a. durch zunehmende Verwendung se-kundärer (bereits ermittelter und damit vorstrukturierter) Inhalte bei der jour-nalistischen Recherche. Trotz der schwa-chen Nachhaltigkeit einer diagnostisch motivierten Tendenzbeschreibung wird behauptet, dass die im Diskurs der Medi-alisierung problematisierten Wirklichkeits-verluste, sowie die Ungleichverteilung von Partizipations-Chancen und pol. Interessen-vermittlung „durch die neuere Medienent-wicklung eher verstärkt als abgeschwächt werden. Damit behält auch das Mediali-sierungskonzept sein analytisches Poten-tial.“ (vgl. Schulz 2004).
[Medienübergreifende Aspekte der M.] Die um die Kategorie der M. ent-standenen diskursbezogenen Wortschöp-fungen stehen für eine Reihe systemthe-oret. inspirierter Konzepte, die − oft auf ältere Fragestellungen zurückblickend − verstärkt seit den 1990er Jahren in der wissenschaftlichen Literatur in Erschei-nung treten und medienübergreifende Aspekte konzeptualisieren. Das dialekti-sche Begriffspaar Intermedialität (als Konzeptansatz, der die Wechselwirkung zw. Medien bzw. Interferenz der Medien untereinander beschreibt) und Intrame-dialität (als die Dynamiken, die zw. Me-dienprodukten innerhalb eines Mediums beobachtbar sind) meint Wechselwirkun-gen innerhalb von Mediensystemen.
Das Konzept Transmedialität betont hingegen die Transformation der Medien oder Phänomene, die „in verschiedenen Medien mit den dem jeweiligen Medi-
um eigenen Mitteln ausgetragen werden können, ohne dass hierbei die Annahme eines kontaktgebenden Ursprungsmedi-ums wichtig oder möglich ist.“ (Rajewsky 2002, 13). Als Beispiel wird das Auftreten des gleichen inhaltlichen Musters oder die Umsetzung einer bestimmten Ästhe-tik bzw. eines bestimmten Diskurstyps in unterschiedlichen Medien genannt.
Irina Rajewsky (2002) führt den Be-griff der Interm. zunächst als Oberbegriff für die „Gesamtheit aller Mediengrenzen überschreitenden Phänomene“, welche „mindestens zwei konventionell als dis-tinkt wahrgenommene Medien involvie-ren“ (Rajewsky 2002: 12-13) an, wobei sie den Begriff der Transm. davon ableitet.
Auch wird die potentielle technische Transm. einer zukünftigen, alle traditio-nellen Medienapparate in sich vereinen-den „Metamaschine“ diskutiert.
Parallel kursiert im gegenwärtigen lite-ratur- bzw. kunstwissenschaftlichen Dis-kurs das Konzept der Metamedialität, welches eine inhaltliche Perspektive der medien über greifen den Geltung (z.B. im Bezug auf Allegorie als künstlerisches Aus-drucksmittel) anspricht.
[ Praxiskonzept der Multim.] Praxi-sorientierte Konzepte betonen eine wirt-schaftliche, pragmatische oder techn. Di-mension der M. So meint Multim. vor allem jene Fusion der traditionellen Tech-niken von Text, Illustration, Audio/Video , Animation, Interaktion und/oder ↑ Spiel , welche sich in der Digitalisierung (Um-wandlung in einen Binärcode ) sowie der multimodalen/multicodalen oder interakti-ven ggf. anwendergesteuerten Präsenta-tion des Wissens/der Inhalte äußert. Der entsprechende Sammelbegriff Multime-dia (s. ↑ Online-Medien) meint Produk-te, Inhalte und Werke, die aus mehreren Medien (im Sinne der technisch-stilisti-schen Umsetzung der Inhalte) bestehen. P. Kneisel defi niert Multimediasystem als eine „rechnergestützte, integrierte Erzeugung, Manipulation , Darstellung, Speicherung und Kommunikation von unabhängigen Informationen […], die in mindestens einem kontinuierlichen und
Medialität
LEXIKONSATZ.indd 234 13.10.2006 10:13:48
235
einem diskreten Medium kodiert ist.“ (Steinmetz 1999).
[Strategiekonzept der Crossm.] Im Geltungsbereich der Medienwirtschaft (in Bezug auf Journalismus , Public Rela-tions , Werbung, ↑ Medienrecht und Me-dienethik , s. ↑ Ethik ) meint der Begriff der Crossm. jene holistische Tendenz zu medienübergreifenden Angebotsstrategi-en und PR-Maßnahmen der Unterneh-men, die mit der Tendenz zur Medien-konvergenz (der Aufl ösung technogener Grenzen zw. verschiedenen Kommuni-kationsdiensten) in Verbindung stehen. Neuberger (2003 online) konzeptualisiert Crossm. als ein über mehrere Medien (↑ Fernsehsendung, ↑ Buch , Zeitschrift , CD , Hörkassette, Video und Internet) verteiltes Gesamtangebot, dessen Teile durch eine gemeinsame Markenidentität verknüpft sind. Die entsprechenden Ver-bindungen über Mediengrenzen hinweg bestehen dauerhaft. Auf diese Weise sol-len Rezipienten an eine Marke gebunden und von einem Medium zu einem an-deren „gelenkt“ werden (vgl. Neuberger 2003: 37-43). Als Beispiel wird „Bild“ als die „erfolgreichste Markenfamilie in Deutschland“ angeführt, welche eine Boulevardzeitung, zahlreiche Publikums-zeitschriften, eine Sonntagszeitung und ein Online-Angebot einschließt. Solch ein gemeinsames Crossmediakonzept re-guliert u. a., dass die o.g. Medien kosten-günstig angeboten werden können und inhaltlich auf ein breites Publikum ausge-richtet sind (s. Neuberger 2003 online).
Das Konzept der M. fördert eine brei-tere (medienphilos.-systemtheoret.) Auf-fassung des traditionellen Medienbegriffs im aktuellen medienwissenschaftlichen Diskurs. Es schließt die Konzepte ein, die unterschiedliche Aspekte der medienü-bergreifenden Wechselwirkung zw. den sich hist. wandelnden Medien in ihrer Abhängigkeit von Wirtschaft, Politik, Ge-sellschaft und anderen Faktoren anspre-chen.
Leon Tsvasman
>> Intersubjektivität; Orientierung; Medien-wissenschaft; Medienkonzeption; Interaktions-medien; Kommunikationspraxis; Informati-onstheorie; Objektivität; Ethik; Interkulturelle Wirtschaftskommunikation; Erlebnis; Liebe.
Literatur: BARAD, K. (1996): Meeting the Universe
Halfway: Realism and Social Constructivism Without
Contradiction, in: Nelson, L. H., Nelson, J. [Hrsg.]: Fe-
minism, Science, and the Philosophy of Science, Dor-
drecht. EICHER, TH., BLECKMANN, U. [Hrsg.], (1994):
Intermedialität. Vom Bild zum Text, Bielefeld. FRAAS,
C., BARCZOK, A., DI GAETANO, N. (2006): Intermedi-
alität – Transmedialität . Weblogs im öffentlichen Dis-
kurs, in: Androutsopoulos, J., Runkehl, J. ,Schlobinski,
P., Siever, T. [Hrsg.]: Neuere Entwicklungen in der In-
ternetforschung. Germanistische Linguistik. Im Inter-
net: http://www.tu-chemnitz.de/phil/medkom/mk/
fraas/Fraas_Barczok_06.pdf (Stand 30.06.2006). HA-
BERMAS, J. (1969): Technik und Wissenschaft als ‚Ide-
ologie‘. S. 9-47, Frankfurt a. M. HABERMAS, J. (1991),
Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort,
Frankfurt a. M. (1968). HABERMAS, J. (1995): Theorie
des kommunikativen Handelns, 2 Bde., Frankfurt a. M.
LUHMANN, N. (1996): Soziale Systeme. Grundriss ei-
ner allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M. (1984). LUH-
MANN, N. (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft,
Frankfurt a. M. MEGGLE, G. (1991): Kommunikation
und Refl exivität, in: Kienzle, B. [Hrsg.]: Dimensionen
des Selbst, S. 375-404, Frankfurt a. M. MEYER, U., SI-
MANOWSKI, R., ZELLER, CH. (2006): Transmedialität.
Zur Ästhetik paraliterarischer Verfahren, Göttingen.
MÜLLER, J. E. (1996): Intermedialität. Formen mo-
derner kultureller Kommunikation, München. NEU-
BERGER, CH. (2003 online): Crossmedialität im Jour-
nalismus. Einführungsvortrag, Deutsch-chinesischer
Mediendialog http://cms.ifa.de/tagungen/dialogfo-
ren/tagungen-2003/workshop-china/einfuehrungs-
vortrag-pdf/. NEUBERGER, CH. (2003): Zeitung und In-
ternet. Über das Verhältnis zwischen einem alten und
einem neuen Medium, in: Neuberger, Ch., Tonnema-
cher, J. [Hrsg.]: Online − Die Zukunft der Zeitung? Das
Engagement deutscher Tageszeitungen im Internet,
S. 16-109, Wiesbaden. PRÜMM, K. (1988): Interme-
dialität und Multimedialität. Eine Skizze medienwis-
senschaftlicher Forschungsfelden, in: Bohn,R., Mül-
ler, E., Ruppert, R. [Hrsg.]: Ansichten einer künftigen
Medienwissenschaft, Berlin. RAJEWSKY, I. O. (2002):
Intermedialität, Tübingen/Basel. Schiller, D. (1999):
Medialität
LEXIKONSATZ.indd 235 13.10.2006 10:13:49