Ubiquitous Computing aus betriebswirtschaftlicher Sicht
Transcript of Ubiquitous Computing aus betriebswirtschaftlicher Sicht

1 Ausgangssituationund Problemstellung
Seit etwa zwei Jahren gewinnt die DisziplinUbiquitous Computing (UbiComp) kon-tinuierlich an Sichtbarkeit [AbMy00;Norm98; Saty01; Weis91]. Ein Indiz dafursind neu gegrundete Zeitschriften (z. B.IEEE Pervasive Computing), Konferenzen(z. B. UbiComp oder Pervasive), Sommer-schulen [Midk03] und Forschungspro-gramme, in denen Forscher aus den Gebie-ten Verteilte Systeme, Human ComputerInterface, Sensorik etc. und zunehmendauch aus der Wirtschaftsinformatik ihreIdeen austauschen und messen.
Einzelne Technologien des UbiComp ha-ben heute einen Reifegrad erreicht, der dieEntwicklung von betriebswirtschaftlichenAnwendungen erlaubt. Etwa im Bereichder automatischen Identifikation ist dieStandardisierung schon weit fortgeschritten[Auto03; Forr02; Shar01; Wolf01]. Gleich-zeitig setzt die politische Diskussion zuFragen der Privatheit ein [JeRo02; Lang01].Beide Entwicklungen sind Indizien dafur,dass die Technologie in der Wirtschaft Fußfassen konnte [Utte94;Gain03; Busi00].
Die meisten anwendungsorientierten Ubi-Comp-Publikationen beschreiben bis heutekonsumentennahe Szenarien bzw. so ge-nannte „Business-to-Consumer“-Anwen-dungen. Beispiele hierzu sind der smarteToaster, der den aktuellen Wetterberichtauf Brotscheiben grillt, die intelligenteMilchflasche, die dem Kuhlschrank mit-teilt, dass sie bald leer oder abgelaufen ist,und die smarte Puppe, die gleichzeitig
Brandmelder, Sprachlehrer und Einkaufs-agent der Kinder der nachsten Generationwerden soll [KMGW00; NeSL00]. Die ers-ten Arbeitsergebnisse aus der Wirtschafts-informatik lassen jedoch parallel zu den Er-kenntnissen aus dem E-Business vermuten,dass die großen wirtschaftlichen Potenzialedes UbiComp im Bereich der „Business-to-Business“-Szenarien liegen. Entspre-chend ist auch das Interesse zahlreicherIT-Unternehmen an diesem Thema zu er-klaren [Kind01; Acce02]. So stellte IBM et-wa fur das Thema ein Forschungsbudgetvon 500 Mio. US-Dollar bereit [Bude01].
Theoretisch und empirisch abgesicherteAussagen dazu sind den Autoren jedochnicht bekannt. Sie sind aber notwendig umsicherzustellen, dass UbiComp sich nichtzu einer Modewelle – vergleichbar mitden fruher ubertriebenen Hoffnungen anKunstliche Intelligenz, Expertensystemeoder E-Business – entwickelt, die auf demPapier viel mehr verspricht, als sie in derRealitat halten kann.
Der vorliegende Aufsatz will zur Schlie-ßung dieser Lucke beitragen. Er identifi-ziert und analysiert die Quelle der be-triebswirtschaftlichen Nutzenstiftung desUbiComp, zeichnet die beobachteten Ent-wicklungsstufen von UbiComp-Anwen-dungen nach, zeigt die Potenziale fur neueGeschaftsprozesse und Modelle auf Basisdes UbiComp auf und diskutiert aus-gewahlte Auswirkungen von UbiCompauf den Entwurf von Produkten, Prozessenund Dienstleistungen.
Die Erkenntnisse in diesem Beitrag stam-men aus der Literatur und aus zahlreichen
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
Die Autoren
Elgar FleischMarkus Dierkes
Prof. Dr. Elgar Fleisch,Institut fur Technologiemanagementan der Universitat St. Gallen (HSG),Unterstraße 22,9000 St. Gallen, Schweiz,E-Mail: [email protected];Dr. Markus Dierkes,Intellion AG,Lerchenfeldstr. 5,9014 St. Gallen, Schweiz,E-Mail: [email protected]
Ubiquitous Computingaus betriebswirtschaftlicher Sicht
WI – State-of-the-Art

Forschungs- und Entwicklungsprojektender Industrie, welche die Autoren von derIdeengenerierung uber Konzeption, Wirt-schaftlichkeitsrechnung und technischeMachbarkeitsstudie bis hin zum Demons-trator, in manchen Fallen bis hin zur Pilot-implementation, wissenschaftlich begleite-ten.
Er betrachtet dabei vor allem Losungen,welche die Technologien Radio FrequencyIdentification (RFID), Automatische Iden-tifikation (Auto-ID) und Sensorik einset-zen. RFID ist eine Funktechnologie, die eserlaubt, kostengunstig kleine Datenmengen(1 Bit bis etwa 30 Kilobyte) zwischen ei-nem Transponder und einer Antenne uberdie Luft zu transportieren. Ein Transpon-der kostet 2003 zwischen 8 Eurocent und20 Euro, verfugt in Kombination mit dergeeigneten Antenne uber eine Reichweitevon 2 mm bis 100 m, ist in Großen zwi-schen Sandkorn (0.4� 0.4� 0.4 mm) undMobiltelefon erhaltlich und bezieht seineEnergie zum Rechnen, Speichern undKommunizieren von einer eingebauten Bat-terie (aktiver Transponder) oder dem elek-tromagnetischen Feld der Antenne (passi-ver Transponder) [Matt03; BCLM03].
Die Technologie Auto-ID erganzt RFIDum ein weltweit einheitliches Nummerie-rungssystem aller realen und damit poten-ziell smarten Dinge und um eine Infrastruk-tur, die es zulasst, mit RFID-Transpondernquer uber den Globus zu kommunizieren.Die Verbreitung der Auto-ID Technologiewird weltweit seit 2003 von EAN/UCCvorangetrieben, jener Organisation, die seituber 25 Jahren den Barcode-Standard etab-liert [Auto03].
Sensorik bedeutet, dass RFID-Transpon-der und Antennen mit Sensoren ausgestat-tet sind. Sensoren ermoglichen die auto-matische Messung einer Vielzahl anUmweltzustanden, wie etwa Temperatur,Feuchtigkeit, Helligkeit, Beschleunigung,chemische Zusammensetzung, Druck,Schall etc. �ber eine Auto-ID-Infrastruk-tur konnen diese Sensordaten zum Ort derEntscheidung transportiert werden.
2 Quelle der Nutzenstiftung
UbiComp ist ein logischer nachster Ent-wicklungsschritt der betrieblichen Infor-mationsverarbeitung. Integrierte Informa-tionssysteme wie R/3 von SAP haben
einzelne Funktionen und Abteilungen in-nerhalb von Unternehmen miteinanderverknupft und damit durchgangige Ge-schaftsprozesse ermoglicht. Internet undE-Business-Systeme wie Supply-Chain-Management-Systeme und elektronischeMarkte haben diese Prozesse uber die Un-ternehmensgrenzen hinweg erweitert undunterstutzen das Management von Unter-nehmensnetzwerken.
Mit UbiComp erfahrt die betriebliche In-formationsverarbeitung nun ihren nachstenIntegrationsschritt. Wahrend integrierte In-formationssysteme und E-Business-Syste-me die Verknupfung von immer mehr Ap-plikationen und Datenbanken verfolgen,strebt UbiComp die Integration dieser Ap-plikationen und Datenbanken mit der rea-len betrieblichen Umgebung wie etwa demLagerhaus an. UbiComp schließt die heutein vielen Fallen sehr kostspielige Luckezwischen Informationssystem und Realitat.Mittels Sensorik (und Aktuatorik) konnenUbiComp-basierte Systeme Zustandsan-derungen in der realen Welt automatischerkennen (bzw. herbeifuhren) [AbEG02].Sie treffen ihre Entscheidungen aufgrundfaktenbasierter Echtzeitdaten aus der Rea-litat und nicht auf Basis fortgeschriebenerbuchhalterischer Werte aus den Informa-tionssystemen. Die Folge sind neue Pro-zessfahigkeiten, die zu Kosteneinsparun-gen, Qualitatssteigerungen und neuenGeschaftsmodellen fuhren konnen.
Bis heute konzentrieren sich Forschungund Praxis primar auf die Vernetzung vonUnternehmen, Prozessen, Informations-systemen und Menschen und versuchen,mithilfe von Informationstechnologie Me-dienbruche zu eliminieren (vgl. Tabelle 1) .Ein haufig genanntes Beispiel fur einenMedienbruch ist die mehrfache Erfassung
eines Auftrags in unterschiedlichen be-trieblichen Informationssystemen inner-halb einer Wertschopfungskette. Ein Me-dienbruch ist vergleichbar mit einemfehlenden Glied einer digitalen Informa-tionskette und ist Mitursache fur Langsam-keit, Intransparenz, Fehleranfalligkeit etc.inner- und uberbetrieblicher Prozesse.
UbiComp-Technologien haben das Poten-zial, den Medienbruch zwischen physi-schen Prozessen und deren Informations-verarbeitung zu vermeiden. Sie ermoglicheneine vollautomatisierbare Maschine-Ma-schine-Beziehung zwischen realen Dingenund Informationssystemen, indem sie Ers-teren einen „Minicomputer“ zufugen. Siehelfen, die Kosten der Abbildung realerRessourcen und Vorgange in Informations-systemen zu reduzieren, sie ubernehmendie Aufgaben des Mediators zwischen rea-ler und virtueller Welt. Physische Ressour-cen konnen ohne menschliche Interventionmit den unternehmensinternen und -exter-nen Rechnernetzwerken kommunizierenund erlauben damit in letzter Konsequenzauch eine laufende Prozesskontrolle aufBasis harter, aus der Realitat gewonnener,Echtzeitinformationen [KaHo02].
3 Entwicklungsstufen vonbetriebswirtschaftlichenUbiComp-Anwendungen
Mark Weiser hat UbiComp als das Gegen-teil der virtuellen Realitat beschrieben. DasZiel der virtuellen Realitat ist die hinrei-chend genaue Abbildung eines Ausschnittsder realen Welt in digital verarbeitbarenModellen, etwa zum Zweck der Simulation[Bend98]. In der virtuellen Realitat konnen
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
Tabelle 1 Medienbruche und betriebliche Informationssysteme
Wo treten Medienbruche auf? Informationssysteme zur �berwindung derMedienbruche
In einzelnen Unternehmensfunktionen wieFinanzen oder Produktionsplanung
Funktionsorientierte Standardsoftwarepakete wiez. B. Finanzpakete oder PPS-Systeme
In unternehmensweiten Prozessen Enterprise-Ressource-Planning-Systeme wie z. B.R/3 von SAP
In unternehmensubergreifenden Prozessen Unternehmensubergreifende Systeme wie z. B.E-Procurement- und Supply-Chain-Management-Systeme
In der Verbindung der Informationssystememit Ereignissen in der realen Welt
Anwendungen des UbiComp, z. B. auf Basis vonRFID-Technologien und Sensornetzwerken
612 Elgar Fleisch, Markus Dierkes

Modell (z. B. Flugsimulator) und realeWelt (z. B. Flug) ohne Interdependenzennebeneinander existieren.
Ziel des UbiComp ist die funktionelle Be-reicherung der realen Welt mithilfe von In-formationsverarbeitung. Eine UbiComp-Anwendung besteht immer aus einem rea-len und einem virtuellen Teil, die untrenn-bar voneinander sind. Die dominierendeWelt ist hier die reale Welt, die virtuelleWelt bekommt einen unterstutzenden Cha-rakter zugewiesen. In UbiComp-Anwen-dungen haben virtuelle Welten immer ei-nen direkten, unmittelbaren Realbezug.
Beispielsweise konnen aktive, d. h. mit Bat-terie betriebene, Transponder je nach An-wendungsfall mit unterschiedlichen Senso-ren ausgestattet werden, um den Statusihres Kontextes (Mutterobjekt, Umgebungund Nachbarobjekte) direkt am Ort desGeschehens zu erfassen und weiterzumel-den. Wenn Temperatursensoren eine lu-ckenlose �berwachung einer Kuhlkette furLebensmittel ermoglichen und Beschleuni-gungssensoren in Autos bei einem Unfallautomatisch Polizei und Rettung alarmie-ren, wird die virtuelle Welt der Informati-onsverarbeitung zunehmend in die Reali-tat, beispielsweise in die sichtbare Weltphysischer Vorgange, transferiert.
Der Weg zu einer solchen Welt mit all-gegenwartigen Rechnern lasst sich in dreiStufen beschreiben (vgl. Bild 1). Kenn-zeichnend fur die erste Stufe ist die manu-elle und modellbasierte Informationsgene-rierung bzw. Entscheidungsfindung. Diezweite Stufe unterscheidet sich von der ers-ten Stufe durch die automatische Kontext-erfassung, die eine breite faktenbasierteDatenbasis zur Entscheidungsfindung ge-neriert. Die dritte Stufe steht fur die zuneh-mende Delegation der Entscheidungs-findung und -umsetzung an die um Infor-mationsverarbeitung bereicherten Objekteder realen Welt, die so genannten smartenDinge [GeSB00].
3.1 Manuelle Integration
Die erste Stufe beschreibt eine betrieblicheInformationsverarbeitung, in der die Ver-bindung zwischen virtueller und realerWelt ausschließlich der Mensch herstellt.Er definiert ein Abbild der Realitat,schreibt es in Datenbanken und Prozedu-
ren fest, gibt die Daten manuell ein und in-terpretiert die Ergebnisse.
Beispielsweise verfolgen heute Facility-Manager mithilfe von Computer-Aided-Facility-Management-Systemen (CAFM-Systemen) die Bewegungen des Inventars
in Burogebauden, die Wartungsarbeiten anHeizkorpern und Klimaanlagen und denVerbleib der Gebaudeschlussel. Die Erst-erfassung der zu verwaltenden Objekte,die Bestimmung des richtigen Standortesund die Inventur (¼ Abgleich der Realitatmit den Daten im CAFM-System) erfolgen
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
Kernpunkte fur das Management
Ubiquitous-Computing-Technologien ermoglichen die Verbesserung von Geschaftsprozessenin den Bereichen Supply-Chain-Management, Produktlebenszyklusmanagement und Custo-mer-Relationship-Management. Sie ermoglichen außerdem neue Geschaftsmodelle wie bei-spielsweise Leasing oder verursachergerechte Abrechnung.
& Ubiquitous Computing (UbiComp) ist ein logischer nachster Entwicklungsschritt der be-trieblichen Informationsverarbeitung.
& Die dazu notwendige globale Standardisierung im Bereich der Automatischen Identifika-tion (Auto-ID) schreitet zugig voran.
& Softwareunternehmen wie SAP entwickeln bereits Infrastruktursoftware zur Unterstutzungvon UbiComp-Anwendungen.
& Dem Thema Privatheit muss beim Entwurf konsumentennaher Anwendungen besondereBedeutung beigemessen werden.
Stichworte: Ubiquitous Computing, Pervasive Computing, Anwendungen, Integration
Reale Welt(z. B. Lagerhaus)
Virtuelle Welt(z. B. Lagermanagementsystem)
Informationsgenerierungvon Hand
Informationsgenerierungerfolgt automatisch über
Sensoren
Informationsgenerierungerfolgt automatisch über
Sensoren
Automatische Generierungvon Aktionen in der Realität
Dateneingabe,Dateninterpretation undEntscheidungsfindung
manuell
Dateneingabe automatisiert
Dateninterpretation undEntscheidungsfindung
manuell
Dateneingabe automatisiert
Dateninterpretation,Entscheidungsfindung und
-umsetzung dezentralautomatisiert
Inte
grat
ions
kost
enun
dIn
tegr
atio
nste
chno
logi
en
Stufe 1Manuelle
Integration
Stufe 2Automatische
Kontexterfassung
Stufe 3DezentraleSteuerung
TastaturSpracheingabe
Barcode Sensoren SensorenAktuatoren
Integration durchMensch-Maschine-Schnittstelle
Integration durchMaschine-Maschine-Schnittstelle
Bild 1 Entwicklungsstufen von betriebswirtschaftlichen UbiComp-Anwendungen
Ubiquitous Computing aus betriebswirtschaftlicher Sicht 613

nach wie vor durch menschliche Arbeits-krafte. Sie stellen die Aktualitat der Infor-mationen etwa zu einem neupositioniertenTisch sicher, pflegen das Modell der Kos-tenstellen und Standorte zur Abbildungder Zugehorigkeit des Tisches und inter-pretieren den Fehlbestand, den eine Inven-tur aufzeigt. Die Integration zwischen vir-tueller und realer Welt erfolgt manuell.
3.2 Automatische Kontext-erfassung
UbiComp ermoglicht Unternehmen, Pro-zessinformationen automatisch mit gerin-gen Grenzkosten zu erfassen. Mit sinken-den Messkosten pro Messpunkt steigt dieAnzahl der verwendeten Messpunkte,denn das fur Prozessqualitat und Prozess-verbesserungen verantwortliche Prozess-management ist an moglichst differenzier-ten, zeit- und realitatsnahen Dateninteressiert.
Statt sich darauf zu verlassen, dass Men-schen die Daten uber die Realitat in Model-len aktuell halten, generieren Data-Collec-tion-Technologien Fakten auf Basis realerDaten. Diese automatisch erfassten Faktenverleihen der Anwendung von Methoden-sets wie z. B. Six-Sigma [HaSc99], welchesflachendeckend bei General Electric, aberauch bei Ford zur Verbesserung der Pro-zesse eingesetzt wird, einen neuen Schub.Mit UbiComp-Technologien werden im-mer mehr Prozesse fuhr- und verbesserbar,da die Informationsgenerierung ohne Mo-dellbildung und aufwandige Informations-eingaben direkt an die konkreten Vorgan-gen in der realen Welt gekoppelt ist.
Beispielsweise sind im Tunnelbau fur dieoptimale Betonaushartung der Tunnelwan-de bestimmte Temperaturverlaufe erforder-lich, um die Festigkeit des Betons zu garan-tieren. Mit UbiComp kann mithilfe in denBeton eingegossener Transponder mit in-tegriertem Temperatursensor der Tempera-turverlauf kontinuierlich und ohne teureMessapparaturen uberwacht und damit dieFestigkeit der Betonwande mit wenigerAufwand sichergestellt werden. Die Ab-frage des Temperaturverlaufs kann jeder-zeit per Funk erfolgen. Prozessfehler, dieRisse im Beton zur Folge habe, werdenminimiert. Die Prozesseffizienz des Aus-hartens steigt. Beispielsweise konnenFolgearbeiten um mehrere Stunden fruherbeginnen.
3.3 Dezentrale Steuerung
Die dritte Stufe auf dem Weg zu Ubi-Comp-unterstutzten Prozessen ist durchdie Entscheidungsdelegation charakteri-siert. Smarte Dinge werden mit UbiCompin die Lage versetzt, selbst Situationen zuerfassen und entsprechend ihrer Konfigu-ration Entscheidungen zu treffen und um-zusetzen. Dies fuhrt zu einer Entlastungzentraler Ressourcen wie Datenspeicher,Prozessoren und Datenbanken.
Smarte Dinge teilen ihren Transport- oderProduktionsbedarf selbst den entsprechen-den Transportmitteln oder Produktions-maschinen mit, ohne dass immer wiederein zentraler Steuerungsrechner involviertwerden muss. Bei Seagate fuhren die Halb-fertigprodukte Transponder mit einer kun-denspezifischen Checkliste fur Produktionund Montage mit. Diese Informationenhelfen, den Produktionsablauf flexibel zusteuern, die Vollstandigkeit und Korrekt-heit der einzelnen Produktionsschritte zuprufen und auftretende Probleme in ihremUrsprung schnell zu lokalisieren [Ferg03].
Denkt man diese Entwicklung zu Ende, solassen sich die Vorgange in der realen Weltnicht mehr von den Vorgangen in der vir-tuellen Welt trennen. Beispielsweise be-wirkt eine Veranderung der Position einesLoses in einem Regal eine entsprechendeAktualisierung im Informationsspeicher.Das Regal muss eigenstandig entscheiden,ob ein Los noch zu ihm gehort oder schonso weit entfernt ist, dass eine Zuordnungunzulassig ware. Die Handhabung in derrealen Welt verschmilzt mit dem Prozessder Informationsverarbeitung in der virtu-ellen Welt. Smarte Dinge bilden in der Rea-litat beobachtbare Beziehungen zu anderensmarten Dingen – beispielsweise geogra-phische Nachbarschaft – auch informato-risch ab [Kaih01].
4 Neue Geschaftsprozesseund -modelle durchUbiComp
Der digitale Fuhrungsregelkreis liefert einModell zur Erklarung der grundsatzlichenAuswirkungen von UbiComp-Technolo-gien auf Geschaftsprozesse und -modelle.Er hilft zu erkennen, dass betriebswirt-schaftlich motivierte UbiComp-Systemeprimar eingesetzt werden, um kosteninten-
sive Daueraufgaben an der Schnittstellezwischen bereits etablierten Informations-systemen und der realen Welt zu automati-sieren, und damit nicht nur Geschaftspro-zesse zu verandern, sondern auch neueGeschaftsmodelle zu ermoglichen.
Die Klassifizierung der Daueraufgaben inBasisaufgaben ist Ergebnis einer Analysezahlreicher UbiComp-Applikationen. Siereduziert die Applikationen auf die durchUbiComp ermoglichten neuen Funktionenund strukturiert diese anhand der Stamm-und Regeldaten der zugrunde liegendenApplikationen.
4.1 Automatisationdes Fuhrungsregelkreises
Die Verschmelzung der realen mit der vir-tuellen Welt erlaubt das Schließen des digi-talen Fuhrungsregelkreises, wie im Folgen-den amModell eines Echtzeitunternehmensbeschrieben (vgl. Bild 2).
In idealtypischen Echtzeitunternehmenstehen Informationen unmittelbar nach ih-rer Entstehung am so genannten „Point-of-Creation“ (POC) sowie an den Orten ihrerVerwendung bzw. „Point-of-Action“(POA) zur Verfugung [Fl�s03]. SowohlPOC als auch POA konnen dabei unter-schiedlichen Organisationseinheiten zuge-ordnet sein und dementsprechend inner-und uberbetriebliche Informationsflussebedingen. Der POC kann beispielsweisedie Scannerkasse eines Einzelhandlers sein,die dazugehorigen POA sind neben derScannerkasse das interne Warenwirt-schafts- und Logistiksystem sowie dasuberbetriebliche Beschaffungs- und Prog-nosesystem, das den Einzelhandler mit sei-nen Lieferanten verbindet.
POC und POA konnen Teil der realenoder der virtuellen Welt sein. Wenn einVerkaufer eine Packung Kompottringeuber den Verkaufstisch schiebt oder wennsich auf einer der Autobahnen im RaumStuttgart ein Stau bildet, dann generierendie Ereignisse Informationen, die vor ihrerWeiterverarbeitung in Informationssyste-men digital erfasst werden mussen. DerPOA bleibt in der virtuellen Welt, wenndas Warenwirtschaftssystem des Einzel-handlers uber das Beschaffungssystem le-diglich eine Bestellung im Verkaufssystemdes Lieferanten auslost, die dort von Handzu einem Auftrag veredelt werden muss.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
614 Elgar Fleisch, Markus Dierkes

Wenn das Warenwirtschaftssystem hin-gegen direkt in die Produktionssteuerungdes Lieferanten eingreift, dann ist der POAdie Produktionshalle, in der sich die realeWelt aufgrund der Informationen vomPOC verandert.
Wie am Beispiel des Einzelhandels ersicht-lich, lassen sich in Wertschopfungskettenzahlreiche POC und POA identifizieren –immer genau dann, wenn eine Informationentsteht oder verwendet wird. Die Wahlder POC und POA orientiert sich an derDomane, die es zu steuern gilt – in derMess- und Regeltechnik Regelstrecke ge-nannt. In Frage kommen hier einzelneAufgaben, interne wie uberbetrieblicheProzesse, Unternehmensbereiche, Wert-schopfungsketten und Unternehmensnetz-werke.
Auf sie wirken laufend Storgroßen wieMaschinenausfalle, Schwund, Qualitats-und Nachfrageschwankungen, welche dieRegelgroßen (Ist-Großen) wie beispiels-weise Prozess- oder Unternehmenskenn-zahlen beeinflussen und ein zeitnahes Ma-nagement verlangen. Am POA vergleichtder Entscheider (Regler) Soll-Großen(Fuhrungsgroßen) mit Ist-Großen und de-finiert Maßnahmen (Stellgroßen), welchedie Regelstrecke so beeinflussen sollen,dass die Regelgroßen den Zielvorgabenbesser entsprechen.
Jede Unterbrechung des Regelkreises fuhrtzu Verzogerungen und zusatzlichen Stor-großen. Prozesse, Unternehmen und Un-ternehmensnetzwerke sind dann nicht inEchtzeit fuhrbar. UbiComp-Technologien,insbesondere Automatische Identifikation,Sensorik und Aktuatorik, sind die tech-nischen Grundlagen zur Digitalisierungund Automatisation von POC und POA.Sie sind notwendige Voraussetzungen zurSchaffung von geschlossenen digitalenFuhrungsregelkreisen.
4.2 Basisaufgaben vonUbiComp-Applikationen
Die durchgangige Digitalisierung des Re-gelkreises ermoglicht die Vollautomationeines Regelzyklus. Bei gegebener Infra-struktur sind die Kosten eines solchen Zy-klus, beispielsweise einer automatischenRegalinventur, in der Regal und Produktemiteinander kommunizieren [RFID03],niedriger als bei einer manuellen Inventur.
Diese Kostendifferenz fuhrt nicht nur zueiner Substitution des manuellen Regel-kreises durch einen automatisierten Regel-kreis, sondern aufgrund der Nachfrage-elastizitat auch zu einem Anstieg ankostengunstigen Prufzyklen [MaCr94].Wahrend die kostenintensive manuelle In-ventur je nach Anwendungsfall nur einmalpro Periode (z. B. Tag, Woche oder Jahr)stattfindet, kann die automatische Inventurlaufend erfolgen.
UbiComp-Losungen ubernehmen kosten-intensive Aufgaben an der Schnittstellezwischen Informationssystemen und derrealen Welt in eine Infrastruktur, die in derLage sein soll, dieselben Aufgaben voll-automatisch und damit kostengunstigerund laufend durchzufuhren. Diese Basis-aufgaben sind Teil zahlreicher Prozesse,welche die reale Welt, also Lebewesen undmaterielle Dinge, einbeziehen. Sie sind inder Regel Daueraufgaben, die, wenn auchmeistens im Hintergrund, standig aktivsind. Ihre Durchfuhrung ist dementspre-chend aufwandig. Daher werden dieseDaueraufgaben heute aus Kosten- undZeitgrunden nur sporadisch wahrgenom-men. Das Resultat sind beispielsweise Qua-litatsmangel und Diebstahle. Zu den wich-tigsten Basisaufgaben zahlen AutomatischeIdentifikation, Lokation / Track & Trace,Sensorik, Qualitatssicherung, Verrech-nung, Risikobewertung, Verkaufsunter-stutzung, Steuerung und Aktuatorik.
& Das Ziel der Automatischen Identifikati-on ist die automatische Verbindung zwi-schen der realen und der virtuellen Welt.
Die Automatische Identifikation (Auto-ID) eliminiert den Medienbruch zwi-schen Dingen und deren Abbildung inden Informationssystemen. Eine Stan-dardinfrastruktur zur automatischenIdentifikation befindet sich zurzeit inEntwicklung [Auto03].
& Lokation / Track & Trace verknupft dieIdentifikation mit ihrer geographischenLokation. Mithilfe der BasisaufgabeTrack & Trace erhalten alle Geschafts-prozesse laufend Transparenz uber denortlichen Verbleib ihrer smarten Dinge.
& Mittels der Basisaufgabe Sensorik sam-meln smarte Dinge Informationen uberihren Status und ihre Umgebung. Bei-spiele fur solche Sensorikdaten sind Be-schleunigung, Temperatur, Luftfeuchtig-keit und die chemische Zusammen-setzung des umgebenden Mediums.Unternehmen konnen Sensorik etwa zurlaufenden automatischen Erhebung vonNutzungsdaten einsetzen.
& Eine nachste Basisaufgabe ist die Quali-tatssicherung. Sie verknupft Informatio-nen uber smarte Dinge (z. B. Identifika-tionsnummer, Lokation, Temperatur)mit Regeln, welche einerseits Qualitats-schranken beschreiben und andererseitsfesthalten, was zu tun ist, wenn dieSchranken durchbrochen werden. AufBasis der UbiComp-Technologien kon-nen viele qualitatssichernde Aufgabenwie etwa Diebstahlsicherung, Kuhlket-tenuberwachung und Schadensvermei-dung vollautomatisiert und damit zuwirtschaftlich vertretbaren Kosten be-trieben werden: Die Prozessqualitatsteigt.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
Störgrößen, z. B.:• Maschinenausfall• Lagerschwund• Nachfrageschwankung• Disruptive Technologie
Regelgröße (Ist-Größe), z. B.:• Prozesskennzahlen• Unternehmenskennzahlen• Netzwerkkennzahlen• Kundenprozesskennzahlen
Regelstrecke (POC)• Prozess• Unternehmen• Wertschöpfungskette• Unternehmensnetzwerk
Regler (POA)• Entscheidungsfindung Stellgröße
• UnternehmerischeMaßnahmen
Führungsgröße (Soll-Größe), z. B.:• Prozesskennzahlen• Unternehmenskennzahlen• Netzwerkkennzahlen• Kundenprozesskennzahlen
Aktuatorik am„Point-of-Action“
Sensorik am„Point-of-Creation“
Bild 2 Digitaler Fuhrungsregelkreis
Ubiquitous Computing aus betriebswirtschaftlicher Sicht 615

& Die Basisaufgabe Verrechnung nutzt dievon smarten Dingen gesammelte Infor-mation zur Realisierung neuer Verrech-nungsmodelle. Erst die laufende Teil-nahme am Leben eines Produktes lasstbeispielsweise eine nutzungsbasierteAbrechnung zu. UbiComp erlaubt Pay-per-Use- und Leasingmodelle fur Pro-dukte, die bis heute nur verkauft werdenkonnten. Das Finanzierungsrisiko gehtdabei vom Kunden zum Produzentenuber, der jedoch seinerseits von laufen-den Ertragen, Nutzungsdaten und einerhoheren Kundenbindung profitiert.UbiComp ermoglicht aber auch Pay-per-Damage-Modelle, d. h. die verur-sachergerechte Verteilung von Schaden,die an einem smarten Produkt irgendwoin der Supply-Chain entstanden sind.Und UbiComp konnte letztlich auchzur verursachergerechten Verteilung ei-nes produktgebundenen Ertrages auf diean der Wertschopfung beteiligten Part-ner beitragen (Earn-by-Contribution).
& Auch die Risikobewertung erhalt neueAspekte, wenn die Bewertungsgegen-stande selbststandig Informationen sam-meln und verarbeiten. So hat etwa einUS-amerikanisches Versicherungsunter-nehmen sehr erfolgreich begonnen, diePramien abhangig von tatsachlich gefah-renen Kilometern und Straßen – die Da-ten werden vom GPS im versichertenFahrzeug erhoben – in Rechnung zustellen (Pay-per-Risk).
& Im Gegensatz zur Verrechnung verwen-det die Basisaufgabe Verkaufsunterstut-zung Identifikations-, Orts- und Sen-sorikdaten zum situationsspezifischenMarketing. Nutzer von solchen Syste-men erhalten auf sie und die aktuelle Si-tuation maßgeschneiderte verkaufsunter-stutzende Informationen [RFID03].
& Die Basisaufgabe Steuerung nutzt dieDaten uber Zustand und Umgebung zurdezentralen Steuerung von beispiels-weise Produktionsprozessen [Esor98].Smarte Halbfertigprodukte fuhren dieDaten zu den noch fehlenden und be-reits durchgefuhrten Produktionsschrit-ten mit und helfen, Verspatungen bzw.Fehlbearbeitungen zu verhindern bzw.schnellstmoglich zu erkennen. Die Ba-sisaufgabe Steuerung schließt den digita-len Regelkreis uber die Kommunikationzwischen den smarten Halbfertigpro-dukten und dem ubergeordneten Steue-rungssystem, etwa einem Produktions-planungs- und Steuerungssystem.
& Die Basisaufgabe Aktuatorik unterschei-det sich von der Steuerung nur durchdie Art der Umsetzung von Entschei-dungen. Mithilfe der Aktuatorik beein-flusst ein smartes Ding, beispielsweiseein mit Robotik angereicherter Klein-
staubsauger, seine reale Umwelt direktohne Zuhilfenahme eines ubergeord-neten Informationssystems.
Tabelle 2 zeigt die identifizierten Basisauf-gaben im Zusammenhang mit den Daten,die zu deren Erfullung benotigt werden.Die Sammlung und Verarbeitung dieserDaten ist die Aufgabe der UbiComp-Sys-teme. Die Basisaufgaben lassen sich in dreiKlassen einteilen: Fur die erste Aufgaben-klasse (Automatische Identifikation, Loka-tion und Sensorik) mussen UbiComp-Sys-teme lediglich Daten sammeln und anubergeordnete Systeme weiterleiten, wel-che diese Daten periodisch bzw. im Be-darfsfall auswerten. In der zweiten Klasse(Qualitatssicherung, Verrechnung, Ver-kaufsunterstutzung, Steuerung) erfolgt dieAuswertung unter Anwendung der Regel-daten laufend. Die UbiComp-Systeme ver-arbeiten hier betriebswirtschaftliche Logik.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
Tabelle 2 Basisaufgaben und deren Daten
Basisaufgaben Stamm- und Regeldaten
Klasse 1: Datensammlung
Automatische Identifikation
Lokation / Track & Trace
Sensorik / Marktforschung
Objekt-ID
Objekt-ID, Ort
Objekt-ID, Ort, Sensorikdaten
Klasse 2: Laufende dezentrale Auswertung
Qualitatssicherung
Verrechnung
Risikobewertung
Verkaufsunterstutzung
Steuerung
Objekt-ID, Ort, Sensorikdaten, Notifikationsregeln
Objekt-ID, Ort, Sensorikdaten, Verrechnungsregeln
Objekt-ID, Ort, Sensorikdaten, Bewertungsregeln
Objekt-ID, Ort, Sensorikdaten, Info-Push-Regeln
Objekt-ID, Ort, Sensorikdaten, Steuerungsregeln
Klasse 3: Direkte Umsetzung von Entscheidungen
Aktuatorik Objekt-ID, Ort, Sensorikdaten, Aktuator-Regeln
Tabelle 3 Auswirkungen des UbiComp auf Geschaftsprozesse
Prozess Supply-Chain-Management Produktlebenszyklusmanagement Customer-Relationship-Management
Fokus Effizienz der Wertschopfungskette Transparenz uber gesamten Lebenszyklus Effektive Kundenbetreuung
Teilprozesse,Teilprozessziele
Bestandsminimierung
Durchlaufzeitverkurzung
Flexibilisierung
Transportruckverfolgung
Risikominimierung
Schadensminimierung
Diebstahlvermeidung
Falschungsvermeidung
Produktruckverfolgung
Dekomposition
Ruckholaktionen
Wiederverwendung
Wartung
Reparatur
Abnutzungsbilanzierung
Konsumentenverhalten
Bezahlmodelle
Verkaufsforderung und ubiquitarerPoint-of-Sales
Cross-Selling
�berwachung
Marktforschung
616 Elgar Fleisch, Markus Dierkes

Die Aktuatorik bildet eine eigene Klasse.Sie unterscheidet sich von den anderenKlassen durch eine direkte Umsetzung derEntscheidungen in die reale Welt, beispiels-weise mittels Minirobotik.
Diese Basisaufgaben fuhren vor allem inden Prozessen Supply-Chain-Management(SCM), Produktlebenszyklusmanagementund Customer-Relationship-Management(CRM) zu Qualitats- und Effizienzsteige-rungen (vgl. Tabelle 3). Im Bereich SCMtragt die Transparenz uber die Gegenstan-de in einer Wertschopfungskette maßgeb-lich zur Minimierung von Durchlaufzeit,Bestand, Diebstahl, Falschungen und Scha-den, z. B. durch �berhitzung oder Verstrei-chen eines Ablaufdatums, und zur Erho-hung der Produktverfugbarkeit bei [Busi02;IDTe02]. Im Produktlebenszyklusmanage-ment sorgt die Verknupfung jedes smartenProduktes mit seiner Homepage fur verbes-serte Teilprozesse in den Bereichen Quel-lennachweis, Dekomposition, Ruckhol-aktionen, Wiederverwendung, Wartung,Reparatur, Abnutzungsbilanzierung etc. ImBereich CRM gewinnen u. a. Bezahlmodel-le, Marktforschung, Kundenanalysen undCross-Selling-Aktivitaten eine neue Quali-tat.
5 Auswirkungen aufProdukt-, Prozess- undServiceentwurf
Im Mittelpunkt der Basisaufgaben steht diefunktionelle Kommunikationsfahigkeitvon smarten Dingen. Die Nutzung dieserKommunikationsfahigkeit ist Aufgabe desEntwurfs von UbiComp-basierten Pro-dukten, Prozessen und Dienstleistungen.
5.1 Funktionelle Kommunikationauf Basis vonUbiComp-Technologien
Jedes Produkt kommuniziert mit seinemAnwender auf der Beziehungs- und Inhalts-ebene [WaBJ67]. Ein Nutzen der Kom-munikation auf der Beziehungsebene kannetwa der Effekt sein, den eine italienischeEspressomaschine auf den Anwender hat,der ihre Formen jener einer deutschen Kaf-feemaschine vorzieht. Die Maximierungdes asthetischen Nutzens ist ein klassischesZiel des industriellen Designs. Es hilft so-wohl dem Kunden, der sich in der Umge-
bung der Maschine wohl fuhlt, als auchdem Produzenten, der seine Marktpositionverteidigen bzw. verbessern kann.
Fur die Gestaltung des funktionalen Nut-zens eines Produktes ist vor allem die Pro-duktentwicklung zustandig. Ihr Ziel ist es,den vom Anwender wahrgenommenenNutzen zu maximieren. Kommunikations-design und Funktionsdesign sind dement-sprechend untrennbar. Je reichhaltiger dieFunktionalitat eines Gegenstandes, destoumfangreicher ist dessen Kommunikati-onsbedurfnis: Wahrend ein Hammer heutenoch gut ohne Leuchtdioden, Pfeiftoneoder Minibildschirm auskommt, sind funk-tional reichhaltigere Dinge wie – nebenKaffeemaschinen – Videorekorder, Mobil-telefone oder Autos auf Kommunikations-hilfen angewiesen. Dieser Zusammenhangzwischen Funktionsvielfalt und Kommuni-kationsbedurfnis ermutigt zum Umkehr-schluss: UbiComp erhoht die Kommuni-kationsfahigkeit und mit ihr auch denwahrnehmbaren Nutzen aus zusatzlicherFunktionalitat.
Damit stellt sich folgende Gestaltungsfrage:Welches sind die neuen, durch UbiCompermoglichten Nutzen stiftenden Zusatz-funktionen? Wie konnen Hersteller vonDingen solche Funktionen identifizieren?
Ein Ansatz zur Beantwortung dieser Frageist die provokante These: „Gute Produktewollen kommunizieren.“ Genauer musstesie lauten: Produzenten wollen, dass ihreProdukte durch Kommunikation Wett-bewerbsvorteile schaffen. Sie nutzen dasProdukt als Agenten, dem sie die Fahigkeitmit auf den Weg geben, seiner Umgebung,insbesondere dem Kunden, aber auch demProduzenten selber, durch Kommunikati-on Nutzen zu stiften (siehe Bild 3).
Um die neuen Funktionen abzuleiten, se-hen Produzenten ihre Produkte als Schnitt-stelle zu ihren Kunden und stellen folgendezwei Fragen: Welche Zusatzfunktionenkonnen sie dem Kunden zur Verfugungstellen? Welche Zusatzfunktionen vermit-teln Produzenten Vorteile?
Typische Informationen, mit denen einProdukt sowohl dem Kunden als auch demProduzenten Nutzen stiften kann, sindStatusinformationen wie etwa Ort undProduktidentifikationsnummer bzw. Um-gebungszustand. So konnte ein Hammerseinem Besitzer mitteilen, wo er sich befin-det, und seinem Produzenten, wie oft er
schon verwendet worden ist. Liegt dasWerkzeug in einem „fremden“ Koffer, mel-det es sich selbststandig. Auch beim Verlas-sen eines vordefinierten Raumes sendet dassmarte Werkzeug eine Meldung an die be-troffenen Parteien und tragt so beispiels-weise zur Diebstahlsicherung bei.
Im Bereich „Business-to-Business“ wen-den Unternehmen UbiComp-Technolo-gien heute i. d. R. bei Produktionsmittelnan, z. B. Maschinen, Werkzeuge, Trans-portbehalter und Regalsysteme. Der Zu-satznutzen fur den Produzenten vonProduktionsmitteln basiert auf den gewon-nenen Daten uber die Art und Weise ihrerVerwendung durch den Kunden bzw. Nut-zer. Dies ist beispielsweise der Fall, wennein Transportbehalter laufend seine Positi-on und Auslastung, eine Bohrmaschine ih-ren Betriebszustand sowie die beim Ge-brauch genutzte Funktionalitat und einRegalsystem laufend seine aktuelle Bele-gung und seinen derzeitigen Umschlagmitteilt.
Jedes Produktionsmittel wird damit zurProzessschnittstelle und „neuen“ Informa-tionsquelle fur seinen Hersteller und seineNutzer. Auf der Herstellerseite interessie-ren insbesondere Informationen uber diegenutzte Funktionalitat, Nutzungsfre-quenz und -charakteristik der Produk-tionsmittel, die in zukunftige Produktent-wicklungen und -konfigurationen sowie indie Sortimentspolitik einfließen. So konnenAuslastungen, Transport- und Stillstands-zeiten von Transportbehaltern, Palettenund Lastkraftwagen bilanziert oder Dreh-zahlen und Beanspruchungsspitzen vonBohrmaschinen mit dem Ziel erfasst wer-den, produktivere Produktionsmittel oderproduktivitatsstiftende, erganzende Pro-dukte zu entwickeln bzw. dem Nutzer bes-ser geeignete Produktionsmittel zur Ver-fugung zu stellen.
Auf der Nutzerseite interessiert z. B. derOrt, die Auslastung sowie die mit einemWerkzeug erzielte Produktivitat fur dieeingesetzte Aufgabe. Zusatzlich konnenuber mehrere Einsatze des Produktions-mittels automatisch Benchmark- und Pro-zessinformationen gewonnen und demNutzer mitgeteilt werden. Das „smarte Re-gal weiß selbst“, wie gut sein Nutzer dasLager organisiert und betreibt. Der Zusatz-nutzen wird in Form einer eingebautenAnalysefahigkeit, bei der durch Sensoren-und Kennzeichnungstechnologien kritischeProzesszustande erfasst und entsprechend
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
Ubiquitous Computing aus betriebswirtschaftlicher Sicht 617

am Objekt selbst angezeigt werden kon-nen, realisiert. So teilt ein Transportbehal-ter zukunftig selbst mit, dass er schon zulange nicht bewegt wurde oder seine La-dung uberhitzt ist. Weitere Services im Be-reich der Prozessbenchmarks werden di-rekt im Zusammenhang mit diesen smarten„Produktionsmitteln“ erbracht. Mit Ubi-Comp-Technologien versehene Transport-mittel bieten zukunftig die Moglichkeit,Auslastungsprofile im Vergleich zu ande-ren Nutzern zu erstellen und auf Prozess-ineffizienzen hinzuweisen. Die Aufgabedes „Prozessoptimierers“ und des Produk-tionsmittelherstellers fließen mit dem Ein-satz „smarter Produktionsmittel“ zuneh-mend zusammen.
Neben der Analyse ist insbesondere die�berwachung des Produktions- oderTransportprozesses fur das Qualitats- undRisikomanagement sowie fur das Control-ling von Bedeutung. Zudem konnen Sach-schaden durch die luckenlose Erfassungdes Einsatzes der Produktionsmittel, z. B.Messung der Transporterschutterungenund Temperaturuberwachung des Trans-portes, minimiert und bei Eintreten ver-ursachungsgerecht zugeordnet werden.Smarte Produktionsmittel inkludieren Ele-
mente der Begutachtung und ermoglichenz. B. eine differenziertere Aufteilung vonVersicherungspramien fur Sachschaden aufverschiedene Kunden.
Dies alles verdeutlicht, dass das smarte Ob-jekt „Produktionsmittel“ bald im Zentrumeines Netzwerks aus Nutzern, Herstellernund verschiedenen Organisationseinheitenoder Dienstleistern wie Versicherern, Con-trollern, Prozessoptimierern und Quali-tatsmanagern steht und die zukunftigeWettbewerbslandschaft rund um den Pro-duktions- und Nutzungsprozess beeinflus-sen wird [Wald02].
5.2 Verschmelzung von Produkt-,Prozess- und Serviceentwurf
Die Investition in „Smartness“ von Dingenmuss sich in einer �nderung im Prozessniederschlagen, denn Kundennutzen ent-steht nur durch Prozessverbesserungen.Eine verzahnte Betrachtung von Produkt-und Serviceentwicklung mit dem Prozess-entwurf ist daher notwendig [FaGe02].Beispielsweise unterstutzen smarte Mobelden Prozess der Montage bzw. des Zusam-
menbaus. Der Nutzer braucht hier keineBauanleitung mehr, um ein in Einzelteilezerlegtes Mobelstuck zu montieren. Durchdie Integration von UbiComp in die Ein-zelteile in Form einfacher Mikrochips ach-ten diese beim Zusammenbau darauf, dassnur die Teile verbunden werden, die zu-sammengehoren. Bei Fehlern gibt es eineWarnmeldung [AnMS02].
Ausgangspunkt einer integrierten Produkt-und Prozessentwicklung muss immer derKundennutzen sein. Er entsteht oftmalsdurch eine Vereinfachung des Prozesses,den ein Kunde durchlauft, um ein Problemzu losen, beispielsweise ein Mobelstuckzusammenzubauen oder Einzelhandler mitfrischen Waren zu versorgen.
Smarte Dinge rationalisieren einen Kun-denprozess dann, wenn sie entweder dieKoordination von einzelnen Aufgaben ausdem Prozess unterstutzen („Pick-to-Light“-Anwendung: ein Produkt zeichnetsich durch Lichtsignal aus) oder die Erful-lung ganzer Aufgaben vollstandig uberneh-men (Einbuchung eines Wareneingangs,Diebstahluberwachung, �berprufung desrichtigen Zusammenbaus etc.). Sie nutzendas Wissen uber die lokale Umgebung und
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
• Nutzungsfrequenz• Genutzte
Funktionalität• Betriebsdaten
• Produktionsmittel-management
• Online-Services• Leasing
• Produktivitäts-steuerung
• Alarmierung• Lokalisierung
• Bedienung /Gebrauch
• Stillstände /Schadensfälle
SmarteProduktionsmittel
• Entwickeln• Auslegen• Konfigurieren• Abrechnen
Hersteller
• Transportieren• Lagern• Herstellen• Montieren
Nutzer
ProzessoptimiererQualitätsmanager
ControllerVersicherer
• Prozessoptimierung• Benchmarking• Qualitätsmanagement
• Inventarisierung• Abschreibung• Schadensbewertung• Risikobewertung
Bild 3 Das smarte Ding im Netzwerk
618 Elgar Fleisch, Markus Dierkes

entscheiden dezentral mittels der vom Pro-duzenten vorgegebenen oder vom Kundenausgewahlten Routinen.
Das geschaftliche Ziel der Vereinfachungdes Kundenprozesses gilt im Bereich Spieleallerdings nur limitiert. Wie am Beispiel Ta-magotchi erfahrbar, kann ein smartes Eiauch dann Nutzen stiften, wenn es das Le-ben seines Besitzers mit sozialem Empfin-den bereichert, etwas nuchtern betrachtetjedoch erschwert.
Noch unbeantwortet scheint die Frage, obsmarte Dinge durch ihr großeres Kom-munikationsvermogen gegenuber „dum-men“ Dingen auch im geschaftlichen Be-reich eine hohere emotionale Bindungauslosen. Der Lagermitarbeiter, dessen Su-che nach Kiste A738 durch ein Blinkenderselben drastisch abgekurzt wird, freutsich uber die smarte, autonome und koope-rative Kiste und reagiert u. U. ahnlich emo-tional wie ein Konsument, z. B. ein Kind,das bei Betreten des Raumes von seinerPuppe angesprochen wird.
Wenn smarte Produkte ganze Aufgaben,z. B. Qualitatssicherungsaufgaben wieTemperaturuberwachung, ubernehmen, la-gert der Kunde eben diese Aufgaben an dieProdukte und gegebenenfalls an den Her-steller der Produkte aus. Solche auslager-bare Aufgaben sind Kandidaten fur Dienst-leistungen, die der Produzent von smartenDingen zusatzlich anbieten kann. An smar-te Dinge geknupfte Services reduzierenKomplexitat beim Kunden und verein-fachen den Kundenprozess. Auf Seiten desProduzenten konnen sie zu laufenden Ein-nahmen fuhren und erhohen die Kunden-bindung sowie die Chancen auf die Identi-fikation weiterer Geschaftspotenziale.Beispiele fur solche Services sind etwa inden Bereichen Abrechnung, Nutzungs-uberwachung, Diebstahl und Leasing zufinden.
Es ist gut vorstellbar, dass immer mehr sol-che Zusatzdienstleistungen zum vomMarkt als Standard geforderten Bestandteiletablierter smarter Produkte werden[Utte94]. Erste Anzeichen dazu liefern et-wa die Automobilhersteller, die zuneh-mend Navigations- und Diebstahlschutz-services einbauen [Kaer02].
6 Zusammenfassungund Ausblick
UbiComp erganzt die reale Welt um infor-mationsverarbeitende Einheiten und bietetdamit die Moglichkeit, die kostenintensi-ven Dinge-Mensch-Maschine-Beziehungendurch kostengunstige Maschine-Maschine-Relationen zu ersetzen. Diese Veranderungerlaubt die relativ einfache Automatisationeiniger bisher nur schwer automatisier-barer betriebswirtschaftlicher Aufgaben.Zu diesen zahlen Identifikation, Lokation,Qualitatskontrolle, Marktforschung undverursachergerechte Verrechnung.
Die Realisation der skizzierten Nutzen-potenziale hangt jedoch von der vorgangi-gen Losung zahlreicher in diesem Aufsatzausgeklammerter Problemstellungen ab[DaGe02]. Eben diese offenen Fragen zei-gen mogliche zukunftige Pfade der tech-nischen und betriebswirtschaftlichen For-schung in Bereich des UbiComp auf. Zuden mehr technischen Forschungsfragenzahlen u. a. die skalierbare Architektureiner globalen UbiComp-Infrastruktur[LyYo02; BaBe02; Pier01], die Integrationvon UbiComp-Systemen in existierendeSystemlandschaften, die Bereicherung derAuto-ID- und Lokalisationsfunktion umSensorik zu Sensornetzwerken [KhKP00]bzw. um Aktuatoren, eine Beschreibungs-sprache fur UbiComp-spezifische Daten,das Management von UbiComp-Daten, Si-cherheitsaspekte [StAn02] sowie weitereMethoden zur Verbilligung von Minicom-puter und Lesegeraten.
Zu den noch ungelosten betriebswirtschaft-lichen Fragestellungen zahlen die AspektePrivatheit, Wirtschaftlichkeit von Ubi-Comp-Anwendungen, Technologieadop-tionspfade fur eine UbiComp-Infrastruk-tur, Industrielle Dienstleistungen auf Basisvon UbiComp und Verrechnungsmodelle.
Literatur
[AbEG02] Abowd, G. D.; Ebling, M. R.; Gellersen,H.-W.: Context-Aware Pervasive Computing.In: IEEE Wireless Communications 9 (2002) 5,S. 8–9.
[AbMy00] Abowd, G. D.; Mynatt, E. D.: ChartingPast, Present, and Future Research in Ubiqui-tous Computing. In: ACM Transactions onComputer Human Interaction 47 (2000) 1, S.29–58.
[Acce02] Accenture (Hrsg.): Seize the day: The Si-lent Commerce Imperative.
http://www.accenture.com/xdoc/en/ideas/isc/pdf/SeizeTheDay.PDF, 2002,Abruf am 2003-04-22.
[AnMS02] Antifakos, S.; Michahelles, F.; Schiele, B.:Proactive Instructions for Furniture Assembly.In: The Fourth International Conference onUbiquitous Computing, UbiComp 2002, Gote-borg, Sweden, September 2002.
[Auto03] Auto-ID Center:http://www.autoidcenter.org,Abruf am 2003-04-22.
[BaBe02] Banavar, G.; Bernstein, A.: Software in-frastructure and design challenges for ubiquitouscomputing applications. In: Communications ofthe ACM 45 (2002) 12, S. 92–96.
[Bend98] Bender, K.: Ubiquitous Computing – theinversion of virtuality. In: WissenschaftlicheZeitschrift – TU Dresden 47 (1998) 4, S. 44–47.
[BCLM03] Bohn, J.; Coroama, V.; Langheinrich, M.;Mattern, F.; Rohs, M.: Allgegenwart und Ver-schwinden des Computers: Leben in einer Weltsmarter Alltagsdinge. Arbeitsbericht ETH Zurich,http://www.inf.ethz.ch/vs/publ/papers/allvercom.pdf, 2003, Abruf am 2003-04-10.
[Bude01] Buderi, R.: Computing goes Everywhere.In: Technology Review 104 (2001) 1, S. 52–61.
[Busi00] Business Week: Special report: Wireless inCyberspace. In: Business Week (2000), 2000-05-26, S. 136.
[Busi02] Business Wire: Shoplifters and DishonestEmployees Continue to Steal Profits From Uni-ted States Retailers, Says Jack L. Hayes Interna-tional. In: Business Wire (2002), 2002-06-27.http://www.businesswire.com/webbox/bw.062702/221782286.htm, Abruf am 2003-04-22.
[DaGe02] Davies, N.; Gellersen, H.-W.: BeyondPrototypes: Challenges in Deploying Ubiqui-tous Systems. In: IEEE Pervasive Computing 1(2002) 1, S. 26–35.
[Esco98] Escort Memory Systems: Fords “Qualityis Job 1” ¼ Radio Frequency Identification(RFID) from Escort Memory Systems.http://www.ems-rfid.com/apps/fordcase.html,2002, Abruf am 2003-04-22.
[FaGe02] Fano, A.; Gershman, A.: The Future ofBusiness Services in the Age of UbiquitousComputing. In: Communications of the ACM45 (2002) 12, S. 83–87.
[Ferg03] Ferguson, G. T.: Have Your Objects CallMy Objects. In: Harvard Business Review 80(2003) 6 , S. 138–143.
[Fl�s03] Fleisch, E.; �sterle, H.: Auf dem Wegzum Echtzeitunternehmen. Erscheint in: Alt, R.;�sterle, H. (Hrsg): Real-time Business. Springer,Berlin 2003.
[Forr02] Forrester Research: RFID: The SmartProduct (R)evolution. Cambridge, August 2002.
[Gain03] Gain, B.: Connecting the dots. Web-en-abled IC networks are demanding closer colla-boration between manufacturers and their sup-pliers. In: EBN Online, 2003-03-10, S. 29–33.
[GeSB00] Gellersen, H.-W.; Schmidt, A.; Beigl, M.:Adding Some Smartness to Devices and Every-day Things. In: IEEE Workshop on MobileComputing Systems and Applications 2000,7th.–8th. December, Monterrey, USA.http://ubicomp.teco.edu/index2.html, Abruf am2003-04-22.
[HaSc99] Harry, M.; Schroeder, R.: Six Sigma: TheBreakthrough Management Strategy Revolutio-
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
Ubiquitous Computing aus betriebswirtschaftlicher Sicht 619

nizing The Worlds Top Corporations. Harry1999.
[IDTe02] IDTechEx: Authentication and Counter-feiting Protection Conference Review. In: SmartLabels Analyst 2 (2002) 2, S. 1–3.
[JeRo02] Jessup, L. M.; Robey, D.: The relevance ofsocial issues in ubiquitous computing environ-ments. In: Communications of the ACM 45(2002) 12, S. 88–81.
[Kaer02] Kaerner, H.: Profitabler dank Telematik:Wenn Service neu gestaltet wird.http://www.accenture.de/4publika/4fachart/index.jsp, 2002-10, Abruf am 2003-04-22.
[KaHo02] Karkkainen, M.; Holstrom, J.: Wirelessproduct identification: enabler for handling effi-ciency, customisation and information sharing.In: Supply Chain Management 7 (2002) 4, S.242–252.
[Kaih01] Kaihla, P.: The ghosts in the machines. In:Canadian Business 74 (2001) 17, S. 24–30.
[KMGW00] Kaye, J.; Matsakis, N.; Gray, M.;Wheeler, A.; Hawley, M.: PC Dinners, Mr. Javaand Counter Intelligence: Prototyping SmartAppliances for the Kitchen. MIT Media Labora-tory, Cambridge, USA 2000.
[KhKP00] Khan, J. M.; Katz, R. H.; Pister, K. S. J.:Emerging Challenges: Mobile Networking for„Smart Dust“. In: Journal of Communicationsand Networks 2 (2000) 3, S. 188–196.
[Kind01] Kindberg, T. et al.: People, Places, Things:Web Presence for the RealWorld.http://www.cooltown.com/dev/wpapers/webpres/WebPresence.asp, 2001, Abruf am2003-04-22.
[Lang01] Langheinrich, M.: Privacy by Design –Principles of Privacy-Aware Ubiquitous Sys-tems. In: Proceedings of Ubicomp 2001, Septem-ber 30–October 2, 2001, Atlanta, USA.
[LyYo02] Lyytinen, K.; Yoo, Y.: Issues and Chal-lenges in Ubiquitous Computing. In: Communi-cations of the ACM 45 (2002) 12, S. 83–87.
[MaCr94] Malone, T.; Crowston, K.: The Interdis-ciplinary Study of Coordination. In: ACMComputing Surveys 26 (1994) 1, S. 87–119.
[Matt03] Mattern, F. (Hrsg.): Total vernetzt. Sprin-ger, Berlin etc. 2003.
[Midk03] Midkiff, S. F.: The First Summer Schoolon Ubiquitous and Pervasive Computing. inIEEE Pervasive Computing 2 (2003) 1, S. 84–88.
[NeSL00]Negus, K. J.; Stephans, A. P.; Lansford, J.:HomeRF: wireless networking for the connectedhome. In: IEEE Personal Communications 7(2000) 1, S. 20–27.
[Norm98] Norman, D. A.: The Invisible Compu-ter. MIT Press, Cambridge, USA 1998.
[Papa99] Papazoglou, M. P.: The Role of AgentTechnology in Business Electronic Commerce.In: Lecture Notes in Computer Science (1999)1652, S. 245–264.
[Pier01] Pierre, S.: Mobile computing and ubiqui-tous networking: concepts, technologies andchallenges. In: Telematics and Informatics 18(2001) 2–3, S. 109–131.
[RFID03] RFID Journal: Diverse Fallstudien.http://www.rfidjournal.com/article/archive/4/,Abruf am 2003-04-22.
[Saty01] Satyanarayanan, M.: (2001) Pervasivecomputing: vision and challenges. In: IEEE Per-sonal Communications 8 (2001) 4, S. 10–17.
[Shar01] Sharp, K. R.: Technology Edge RFIDGoes Mainstream. In: ID Systems 21 (2001) 1, S.58–59.
[StAn02] Stajano, F.; Anderson, R.: The Resurrect-ing Duckling: Security Issues for Ubiquitous
Computing. In: Computer 35 (2002) 4, Supp., S.22–26.
[Utte94] Utterback, J.: Mastering the Dynamics ofInnovation. Harvard Business School Press,Boston, Massachusetts 1994.
[Wald02] Waldo, J.: Virtual Organizations, Perva-sive Computing, and an Infrastructure for Net-working at the Edge. In: Information SystemsFrontiers 4 (2002) 1, S. 9–18.
[WaBJ67] Watzlawick, P.; Beavin, J. H.; Jackson,D. D.: Menschliche Kommunikation. Formen,Storungen, Paradoxien. Hans Huber, Bern 1967.
[Weis91] Weiser, M.: The computer for the 21stcentury. In: Scientific American 256 (1991) 3, S.94–104.
[Wolf01] Wolff, J. A.: RFID tags – an intelligentbar code replacement. ftp://service.boulder.ibm.com/software/pervasive/info/tech/gsoee200.pdf,2001, Abruf am 2003-04-22.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 45 (2003) 6, S. 611–620
Abstract
Ubiquitous computing: A business perspective
This paper identifies and analyses potential business benefits of ubiquitous computing (ubi-comp). Its aim is to challenge whether the growing visibility of topics such as ubiquitous orpervasive computing, automatic identification (Auto-ID) and radio frequency identification(RFID) can be justified from a business perspective. To do so it analyses the business contri-bution of existing ubicomp applications, reconstructs their development phases, introducesthe business relevant base-functionalities and discusses implications on the design of pro-ducts, processes and services using ubicomp applications.The creation of an alternative and rather cost efficient machine-machine-relation betweenalready established information systems and the real world things they try to manage hasbeen identified as the main source of business benefit. However, before businesses can sys-tematically leverage all potential benefits, some technical and political questions, such ascreating robust solutions and solving privacy issues, have to be answered.
Keywords: ubiquitous computing, pervasive computing, applications, integration
Die Forschungsarbeiten zu diesem Aufsatz wurden von den Forschungsprojekten Mobile and UbiquitousComputing Lab (www.m-lab.ch) sowie dem Auto-ID Center (www.autoidcenter.org) unterstutzt.
620 Elgar Fleisch, Markus Dierkes




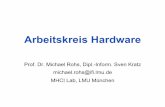










![Friedemann Mattern, Christian Flörkemeier ETH Zürich · 2010-01-27 · der 1990er-Jahre von Mark Weiser mit „Ubiquitous Computing“ [33] bezeichnete Vorstellung einer umfassenden](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5c6648d609d3f252168c2374/friedemann-mattern-christian-floerkemeier-eth-zuerich-2010-01-27-der-1990er-jahre.jpg)



