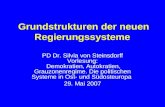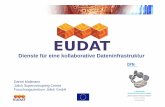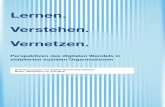Verfassungsänderungen in etablierten Demokratien: Motivlagen und Aushandlungsmuster
-
Upload
astrid-lorenz -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
Transcript of Verfassungsänderungen in etablierten Demokratien: Motivlagen und Aushandlungsmuster
-
Astrid Lorenz
Verfassungsnderungen in etablierten Demokratien
-
Astrid Lorenz
Verfassungsnderungen in etablierten DemokratienMotivlagen und Aushandlungsmuster
-
1. Auflage 2008
Alle Rechte vorbehalten VS Verlag fr Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008
Lektorat: Katrin Emmerich
Der VS Verlag fr Sozialwissenschaften ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.www.vs-verlag.de
Das Werk einschlielich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschtzt. JedeVerwertung auerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohneZustimmung des Verlags unzulssig und strafbar. Das gilt insbesondere frVervielfltigungen, bersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherungund Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werkberechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen imSinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wren und dahervon jedermann benutzt werden drften.
Umschlaggestaltung: KnkelLopka Medienentwicklung, HeidelbergSatz: Anke Vogel, Ober-OlmDruck und buchbinderische Verarbeitung:Gedruckt auf surefreiem und chlorfrei gebleichtem PapierPrinted in Germany
ISBN 978-3-531-15667-5
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet ber abrufbar.
Strauss GmbH, Moerlenbach
-
Inhalt Einleitung ............................................................................................................................... 7 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang .................................................... 13 1.1 Verfassungen, Verfassungsdemokratien, Verfassungsnderungen........................ 13 1.2 Verfassungsnderungen im empirischen berblick............................................... 19 1.3 Erklrungsanstze fr Verfassungsnderungen im berblick ............................... 28 1.4 Zwischenbilanz....................................................................................................... 36 2 Akteure und Interaktionen Erklrungsansatz und Fallauswahl.................. 39 2.1 Rationalistische Annahmen, Erweiterungen und Gegenannahmen ....................... 39 2.2 Untersuchungsdesign.............................................................................................. 59 2.3 Institutionen und Kontext als Handlungsrahmen ................................................... 66 2.4 Auswahl der zu untersuchenden Flle.................................................................... 84 2.5 Zwischenbilanz....................................................................................................... 90 3 Der Start der individualistischen Phase:
Dominanz normalpolitischer Eigeninteressen und nderungsminimalismus in komplexen Strukturen ......................................... 93
3.1 Kanadisches Fallbeispiel (1979) ............................................................................ 93 3.2 Griechisches Fallbeispiel (1995) .......................................................................... 104 3.3 Irisches Fallbeispiel (2001) .................................................................................. 114 3.4 Deutsches Fallbeispiel (1995) .............................................................................. 124 3.5 Zwischenbilanz..................................................................................................... 136 4 Die Fortsetzung der individualistischen Phase:
Abwehr, Positionsformierung und Bemhung des Initiators um Kooperationsbereitschaft des (nchst-) wichtigsten Akteurs .................. 147
4.1 Kanadisches Fallbeispiel (1979-1992) ................................................................. 147 4.2 Griechisches Fallbeispiel (1995-1998)................................................................. 161 4.3 Irisches Fallbeispiel (2001) .................................................................................. 178 4.4 Deutsches Fallbeispiel (1995-1996)..................................................................... 190 4.5 Zwischenbilanz..................................................................................................... 202 5 Die kooperative Phase: Vernderte Entscheidungsperzeption,
soziales Handeln und Selbstluferprozesse...................................................... 217 5.1 Kanadisches Fallbeispiel (1992-1998) ................................................................. 217 5.2 Griechisches Fallbeispiel (2000) .......................................................................... 228 5.3 Irisches Fallbeispiel (2001-2002)......................................................................... 241 5.4 Deutsches Fallbeispiel (1996-1997)..................................................................... 258 5.5 Zwischenbilanz..................................................................................................... 269
-
6 Inhalt
6 Die kompetitive Phase: Fehlerkorrektur durch die Kollektivakteure, Kontextsensitivitt und Verschiebung von substanziellen zu nichtsubstanziellen Nutzenkalklen ................................................................. 281
6.1 Kanadisches Fallbeispiel (1998) .......................................................................... 281 6.2 Griechisches Fallbeispiel (2001) .......................................................................... 290 6.3 Irisches Fallbeispiel (2002) .................................................................................. 297 6.4 Deutsches Fallbeispiel (1997) .............................................................................. 306 6.5 Zwischenbilanz..................................................................................................... 314 7 Verfassungsnderungen als Ergebnisse rational-sozialen Handelns
Erkenntnisse, Modell und Test.......................................................................... 321 7.1 Beteiligte und aushandlungsrelevante Akteure .................................................... 321 7.2 Die Rationalitt des Handelns und der Umgang mit unklaren Prferenzen......... 327 7.3 Die Erklrung der Entscheidungserzielung ber ein interaktionsorientiertes
Phasenmodell........................................................................................................ 334 7.4 Test anhand nicht verabschiedeter Verfassungsnderungen................................ 345 7.5 Verfassungspolitik als normale Politik? ........................................................... 354 7.6 Zwischenbilanz..................................................................................................... 359 8 Resmee und Ausblick ....................................................................................... 361 Anhang ............................................................................................................................... 377 Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................... 405 Tabellenverzeichnis ........................................................................................................... 407 Literatur- und Quellenverzeichnis .................................................................................. 411
-
Einleitung
Verfassungen sind Macht-Ordnungen. Sie befugen und bndigen, verleihen Rechte und setzen Grenzen den Brgern ebenso wie dem Staat. Ihre Kombination mit dem demokra-tischen Prinzip regelmiger Wahlen gilt als intelligenteste Methode, das menschliche Zusammenleben zum Vorteil aller langfristig zu organisieren und heterogene Interessen in einer Gemeinschaft zu integrieren. So einleuchtend die Relevanz von Verfassungen, so wenig wissen wir doch ber ihr Schicksal nach der Verabschiedung. Die Politikwissen-schaft fiel offensichtlich auf ihre eigenen Deutungen herein: Es war ja sie selbst, die seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts nach berstandenen Weltkriegen und der Anomie des Neuanfangs die Systeme des Westens als besonders fest gefgt bewertete und im Eindruck der Blockkonfrontation den hohen Respekt vor den Verfassungen als wesensbestimmend fr die Demokratie. Als die Akteure lngst flgge geworden waren und die Verfassungen bereits viel hufiger nderten, als angenommen, banden dann der weltumspannende forma-le Triumph des Konstitutionalismus (Kay 2001: 16; Herrmann/Schaal/Vorlnder 2003) und die Debatte um eine europische Verfassung die Aufmerksamkeit und lenkten von klassisch-nationalen Verfassungsentwicklungen ab.
Solche klassisch-nationalen Verfassungsnderungen knnen als grere Reformen f-fentliche Aufmerksamkeit erregen, wie die deutsche Fderalismusreform im Jahr 2006. Sie knnen sich sogar in der Einfhrung einer neuen Verfassung manifestieren, sofern diese die Identitt bzw. Legitimationsgrundlage des politischen Systems nicht vllig abschafft (denn dann wre von einer Revolution zu sprechen). Sie knnen aber auch marginal erscheinen und trotzdem als steter Tropfen den Stein hhlen, also in ihrer Summe unbemerkt Inhalt und Funktionsweise einer Verfassung erheblich verndern. Sie sind aber nicht nur in nor-mativer und funktionaler Hinsicht bedeutungsvoll. Weil etablierte Demokratien durch das Vorhandensein fest gefgter, eben etablierter, Strukturen definiert und Verfassungen theo-retisch durch erhhte Mehrheitserfordernisse vor Eingriffen geschtzt sind, stellt sich die rationalistisch interessante Frage, warum nderungen der politischen Kerninstitutionen dann trotzdem regelmig auf der Tagesordnung stehen. Welche Motive stehen hinter ih-nen, warum stimmen groe Mehrheiten Eingriffen in die Macht-Ordnung zu?
Die vorliegende Analyse1 will diese Fragen beantworten und konzentriert sich dabei gezielt nicht auf das besonders Augenfllige, auf groe Reformen, symbolisch hochaufge-ladene, problematische Verfassungsnderungen, konstitutionelle Schpfungsmomente oder die politisch einflussreichsten Staaten. Im Fokus steht vielmehr die Aushandlung von Verfassungsnderungen in ihrer Breite in Demokratien in ihrer Breite mit anderen Wor-ten: die normale Verfassungspolitik in etablierten Demokratien. Damit unterscheidet sich die Untersuchung vom grten Teil der politikwissenschaftlichen Arbeiten zur Verfas-sungspolitik. Deren Konzentration auf besondere Ereignisse, wichtige Staaten und neue
1 Ich danke der Deutschen Forschungsgemeinschaft fr die grozgige Untersttzung des diesem Buch
zugrunde liegenden Forschungsprojekts.
-
8 Einleitung
Herausforderungen ist typisch fr die Politikwissenschaft insgesamt, die berproportional Krisen, Kriege und Konflikte untersucht. Eine solche Ausrichtung der Forschung ist sehr ntzlich, um ihre Funktion als Anregerin fr praktische Problemlsung zu erfllen, doch kann die Summe individuell ntzlicher und berzeugend angelegter Einzelstudien die Rea-litt in etablierten Demokratien durchaus verzerrt abbilden. Es bedarf auch der systemati-schen Beobachtung des verfassungspolitischen Alltags, um ein Verstndnis fr den Stel-lenwert der Befunde solcher Analysen zu erlangen. Und es bedarf ihrer, um eine mgliche Problematik des scheinbar Unproblematischen berhaupt erkennen zu knnen.
Da die empirisch-vergleichende Erforschung von Verfassungsnderungsprozessen in etablierten Demokratien noch in den Kinderschuhen steckt, ist die Studie teilexplorativ angelegt. Sie will ausgehend von Erkenntnissen der Verfassungsforschung im engeren und der politikwissenschaftlichen Forschung im weiteren Sinne schrittweise etwas Neues ent-wickeln: Aussagen mittlerer bis grerer Reichweite generieren und ein Erklrungsmodell entwerfen. Leitend sind dabei drei Interessen: Erstens sollen Muster der Initiierung und Aushandlung von Verfassungsnderungen in etablierten Demokratien aufgedeckt werden, die das verfassungspolitische Ergebnis beeinflussen, zweitens werden Aussagen zur Ratio-nalitt des Handelns angestrebt. Drittens will die Studie, nachgeordnet, prfen, ob die Ver-fassungspolitik in etablierten Demokratien dem Idealtypus deliberativ-demokratischer Ver-fassungspolitik oder dem Typus der normalen Politik entspricht.
Das erste Interesse bezieht sich auf die empirischen Prozesse der Aushandlung von Verfassungsnderungen und kann auf konkrete Einzelfragen heruntergebrochen werden: Was motiviert Akteure in etablierten Demokratien dazu, verfassungspolitisch aktiv zu wer-den? Wie reagieren die anderen Akteure? Warum und wie werden die Aushandlungspro-zesse trotz unterschiedlicher Positionen der Beteiligten in Gang gehalten? Wer sind dabei die Schlsselakteure? Wie komplex und tiefgrndig sind ihre Argumentationen? Bestim-men letztlich typische Interessen, Wahrnehmungs- und Verlaufsmuster das Zustandekom-men und die inhaltliche Ausgestaltung von Verfassungsnderungen?
Dem zweiten Interesse, die Rationalitt des verfassungspolitischen Handelns genauer zu qualifizieren, kommt die Untersuchung dadurch nach, dass sie zentrale Annahmen des Rationalwahlansatzes, insbesondere das Vorhandensein stabiler und klarer Prferenzen, ber die Aushandlungsprozessse hinweg prft. Sie geht dabei von einem Idealtypus des strikten Rationalismus aus, der auf einen konkreten Aushandlungsgegenstand und kurze Entscheidungswege fokussiert, stellt diesem konkurrierende Aussagen der sozialpsycholo-gischen Forschung zum Verhalten von Akteuren gegenber und testet auch deren empiri-sche Bedeutung. Darber hinaus wird erfasst, ob die Aushandlungsbeteiligten dauerhaft nur fr sie ertragreiche Verfassungsnderungsvorhaben untersttzten, inwieweit nicht auf das konkrete Vorhaben gerichtete (also nichtsubstanzielle) Kalkle eine Rolle spielen und ob die Delegation der Aushandlungen an Vertreter der Kollektivakteure zu Prferenzverschie-bungen beitrgt.
Mit Blick auf das dritte Kerninteresse hinterfragt die Studie, ob sich die Verfassungs-nderungspolitik von der normalen Politik unterscheidet. Sie schaut dabei u.a. auf die Ziele der Akteure, die Aushandlungsarena und den Aushandlungsmechanismus. Reflektie-ren die Akteure die verfassungspolitische Bedeutung ihres Tuns? Dominieren auf das Ge-meinwohl gerichtete Erwgungen und deliberative Konsensfindung, wie beim Idealtypus des demokratischen Konstitutionalismus, oder Eigeninteressen und Tauschhandel, wie beim Idealtypus der normalen Politik?
-
Einleitung 9
Die Studie basiert auf einem akteur- und interaktionsorientierten Erklrungsansatz, der andere Variablen weitgehend ausblendet, ohne ihre potenzielle Bedeutung grundstzlich zu bestreiten. Seine Wahl ist dadurch begrndet, dass die politischen Akteure in einem politi-schen System unter hnlichen historischen, gesellschaftlichen, kulturellen, konomischen und internationalen Bedingungen unterschiedliche Interessen verfolgen, dass sie mit ihrem Handeln die Formulierung von Verfassungsnderungsentwrfen und deren Durchsetzung ganz konkret beeinflussen, dass sie den institutionellen Rahmen ihres Handelns verndern und Institutionen innerhalb bestimmter Grenzen so benutzen knnen, wie es ihnen passt.
So wurde in der Bundesrepublik gem den Vereinbarungen im Einigungsvertrag eine Gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Vorbereitung von Grundge-setznderungen eingesetzt, deren personelle Besetzung und Funktionsweise nicht legiti-miert war (Hennis 1993), hnliches galt fr die 2003 von Bundestag und Bundesrat einge-setzte Fderalismuskommission (Benz 2005a).2 Die franzsische Verfassungsgeschichte liefert bis in die Gegenwart hinein zahlreiche Beispiele dafr, wie sich die Akteure Verfas-sungsinstitutionen designten bei irrtmlichen Wirkungsannahmen und politischer Konfu-sion (Elster 2003). Die Macht des US-Kongresses bei der Regulierung des Auen- und Binnenhandels berschreitet deutlich den Verfassungstext und die Ursprungsintention (Henkin 1994: 45). In Polen sollte die nachsozialistische Verfassung 1997, obwohl nicht obligatorisch, durch ein Referendum legitimiert werden, aber als bei einer niedrigen Refe-rendumsbeteiligung weniger als 20 Prozent der Brger fr ihre neue Verfassung stimmten, bewerteten die politischen Akteure den Vorsprung vor den Nein-Stimmen als ausreichende Legitimation, weil das Ergebnis ihren Interessen entsprach.3 Im Zuge der Ratifizierung der europischen Vertrge bis hin zur europischen Verfassung sprachen sich Politiker in den EU-Staaten aufgrund eigener Erwgungen und in Beobachtung der Ereignisse im Ausland unabhngig von den jeweiligen nationalen Regelungen mal fr, mal gegen entsprechende Referenden aus (u.a. Ritzenhofen 2005); die institutionellen Vorgaben wurden dabei klar als vernder- oder auslegbar betrachtet.
Was hier nur anekdotisch belegt wurde, soll in der Studie systematisch empirisch ge-prft und differenziert werden. Ihre Kerninteressen und der akteur- und interaktionsorien-tierte Ansatz machen beim derzeitigen Forschungsstand eine qualitativ-vergleichende und teilinduktive Analyse erforderlich. Sie ist annahmen- und kriterienbasiert angelegt, verzich-tet aber in Teilen auf spezifische Hypothesen und ist hier offen fr unvorhergesehene Wirkungszusammenhnge. Dies legt aus forschungspraktischen Grnden einen Vergleich nur weniger Flle nahe. Da die Untersuchung generelle Aussagen zu Verfassungsnderun-gen in etablierten Demokratien anstrebt, reprsentieren die ausgewhlten Flle die Vielzahl der Themen und die inhaltliche Reichweite von Verfassungsnderungen in etablierten De-mokratien und sind entsprechend der Konkordanzmethode unter sehr unterschiedlichen institutionellen und Kontextbedingungen abgelaufen. Die trotz dieser Institutionen- und
2 Beide bereiteten, ergnzt durch exklusive informelle Runden, umfangreiche Verfassungsnderungen vor, die
von Bundestag und Bundesrat im Wesentlichen so angenommen wurden (Kapitel 2.3.). 3 Die gltig gebliebenen Teile der Verfassung von 1952 sahen parlamentarisch beschlossene Verfassungsn-
derungen vor, Art. 19 der provisorischen Kleinen Verfassung von 1992 erlaubte aber Referenden bei ei-nem besonderen staatlichen Interesse. Das Ergebnis war nur dann bindend, wenn eine Mehrheit der Wahlbe-rechtigten vorliegt. Nur in diesem Falle wollte Prsident Kwaniewski die Verfassung unterzeichnen. Im Re-ferendum am 25.05.1997 stimmten 52,7 Prozent der Whler der Einfhrung der Verfassung zu, aber die Wahlbeteiligung lag bei nur 42,9 Prozent. Trotzdem setzte Kwaniewski sie in Kraft.
-
10 Einleitung
Umfeldvarianzen auftretenden Gemeinsamkeiten im verfassungspolitischen Verhalten der Akteure begnstigen offensichtlich Verfassungsnderungen in Demokratien.
Die in die Vergleichsmethodik eingebundenen Einzelfallstudien sind in zweifacher Hinsicht wichtig: Zum einen haben sie einen systematisch-konzeptionellen Stellenwert, weil sie inhaltlich zur Erarbeitung der Befunde und eines Modells von Verfassungsnde-rungsprozessen hinfhren und dem Leser Transparenz auf dem schrittweisen Weg dorthin gewhrleisten. Zum anderen bieten sie fr sich genommen Erkenntnisse zur Aushandlung konkreter Verfassungsnderungen, ber die es in dieser Form noch keine politikwissen-schaftlichen Verffentlichungen gibt, und bilden die Komplexitt und Eigenheit der Pro-zesse wenigstens im Ansatz ab. Sie erhalten daher in der Darstellung ihren eigenen Raum und knnen jeweils auch losgelst von der bergeordneten Fragestellung als Fallstudien zu einem bestimmten politischen Problemkomplex gelesen werden.
Das erste Buchkapitel fhrt in die Thematik von Verfassungsnderungen ein. Es skiz-ziert, warum sich Verfassungen verbreiteten, wie sich die normativen Ansprche an Verfas-sungspolitik wandelten und worin sie heute bestehen. Es prsentiert systematisches empiri-sches Vergleichswissen zu Verfassungsnderungen in allen 39 etablierten Demokratien mit mehr als 1 Million Einwohnern und ohne bewaffnete Konflikte im Zehnjahreszeitraum 1993 bis 2002, gibt einen kritischen berblick ber theoretische Anstze zur Erklrung von Verfassungsnderungen und verortet den fr die Studie gewhlten akteur- und interaktions-orientierten Untersuchungsansatz in einem der Wahlforschung entlehnten verfassungstheo-retischen Kausalittstrichter.
Das zweite Kapitel beschreibt die Vorannahmen und das Forschungsdesign. Die Un-tersuchungskriterien der Fallstudien orientieren sich an der rationalistischen Forschung, ergnzt um berlegungen im Hinblick auf funktionale Differenzierung, die Rckfallpositi-on nicht-kollektiver Entscheidungsfindung und mgliche Effekte sozialen Handelns. Die Anwendung des selten genutzten qualitativen Vergleichs weniger sehr unterschiedlicher Flle wird dann begrndet und durch explorative Untersuchungen zum Einfluss institutio-neller und Kontextvariablen auf die Hufigkeit und inhaltliche Reichweite von Verfas-sungsnderungen vorbereitet. In konventionellen quantitativen Verfahren werden Daten zu den 39 etablierten Demokratien fr den Untersuchungszeitraum 1993 bis 2002 ausgewertet. Auf Basis der Befunde wird eine zweidimensionale Matrix politischer Systeme entwickelt, die der Auswahl von Fllen fr die eigentliche Tiefenanalyse verfassungspolitischer Aus-handlungsprozesse dient. Wichtigstes Selektionskriterium fr die Lnderauswahl ist die Nhe zum Mittelwert der Verfassungsnderungen des jeweiligen Quadranten; bei mehreren infrage kommenden Staaten wird auerdem eine mglichst groe Varianz bei weiteren Variablen gesichert, die als potenziell einflussreich fr die Verfassungsnderungspolitik infrage kommen. Aus allen Verfassungsnderungen, die in diesen Staaten stattfanden, wer-den dann vier gewhlt, die bezglich Thema und inhaltlicher Reichweite variieren und die gleichzeitig als einigermaen reprsentativ fr die jeweiligen nationalen verfassungspoliti-schen Langzeitentwicklungen gelten knnen.
Die Kapitel 3 bis 6 widmen sich jeweils verschiedenen Phasen der Aushandlungspro-zesse, die sich hinsichtlich der Interaktionsorientierung der Akteure und des Aushandlungs-status deutlich voneinander unterscheiden. Kapitel 3 beleuchtet die Initiierung verfas-sungspolitischer Prozesse als Ausgangspunkt der individualistischen Phase. Sie geht nicht zwangslufig mit der formalen Einbringung einer nderungsvorlage im Parlament einher. Im Zusammenhang mit der Initiative werden auch die politischen und institutionellen Prob-
-
Einleitung 11
lemhorizonte der verfassungspolitischen Aktivitten skizziert, wie sie sich den Akteuren darstellten. Die nachfolgenden Kapitel 4 bis 6 richten sich auf den weiteren Verlauf der individualistischen Phase, auf die anschlieende kooperative sowie auf die kompetitive Aushandlungsphase. Der abschlieende Abschnitt jedes Kapitels fasst jeweils die Gemein-samkeiten der Befunde zusammen, wobei all diese Zwischenbilanzen einer hnlichen Grundstruktur folgen.
Kapitel 7 fhrt die empirischen Befunde der Studie zusammen und bewertet sie mit Blick auf deren Kerninteressen. Es resmiert zunchst die an den Aushandlungsprozessen beteiligten Akteure sowie die Strke und Art ihrer Einflussnahme. Danach diskutiert es die Rationalitt des Handelns der Akteure. Den Prozesscharakter verfassungspolitischer Aus-handlungen, die nur bedingt formal-institutionellen Vorgaben folgen und die sich nicht ohne Weiteres durch strikt-rationalistische vorhabenbezogene Annahmen erklren lassen, gibt das nachfolgende Prozessmodell wieder, das die in den Phasenkapiteln herausgearbei-teten Merkmale aufnimmt. Der anschlieende Abschnitt prft die empirisch gewonnenen Aussagen zur berwindung der Schwellen von einer zur anderen Interaktionsorientierung anhand verfassungspolitischer Prozesse, die nicht in Verfassungsnderungen mndeten. Schlielich wird bewertet, inwiefern der verfassungspolitische Alltag in etablierten Demo-kratien dem Idealtypus demokratischer Verfassungspolitik entspricht.
Das Schlussresmee ist darauf gerichtet, die Befunde der Studie in einen greren wissenschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Es fasst noch einmal jene Ergebnisse zu-sammen, die verbreitete verfassungs- und institutionentheoretische Auffassungen zu Ver-fassungen und zur Verfassungspolitik infrage stellen, und diskutiert ihre gemeinsame Be-deutung fr die Konzeptionalisierung von Verfassungsnderungspolitik in etablierten De-mokratien. Darauf aufbauend, entwickelt es Vorschlge fr eine systematisch und interdis-ziplinr angelegte weitere Forschung zum Verfassungswandel in Demokratien.
-
1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang Dieses Kapitel bereitet die Hauptanalyse des Buches vor, indem es deren spezifischen Zu-gang zur Problematik begrndet: Es umreit zunchst aus politikwissenschaftlicher Sicht Sinn und Funktionen von Verfassungen, ihr normativ-konzeptionelles Verhltnis zur De-mokratie, den Wandel der inhaltlichen Ansprche an Verfassungen und Verfassungspolitik sowie den Begriff der Verfassungsnderung. Es gibt dann einen berblick ber die Hufig-keit, inhaltliche Reichweite, thematische Ausrichtung, regionale und temporale Verteilung von Verfassungsnderungen in etablierten Demokratien. Beide Abschnitte unterstreichen die Relevanz der Forschung zur Verfassungsnderungspolitik. Der nachfolgende Teil sys-tematisiert die Anstze zur Erklrung von Verfassungsnderungen und bewertet ihren Nutzwert hinsichtlich der die Studie anleitenden Kerninteressen. 1.1 Verfassungen, Verfassungsdemokratien, Verfassungsnderungen Verfassungen sind die normativ-institutionellen Kerne etablierter Demokratien. Sie enthal-ten die wichtigsten Regeln, Verfahren und Prinzipien, die die Einrichtung, Organisation und Ausbung der Staatsgewalt sowie das Verhltnis zwischen Staat, Gesellschaft und Individuum bestimmen. Zwar gab es Verfassungen im allgemeinen Verstndnis der Ord-nung des Politischen (Preu 1994: 9) bereits zuvor, aber als normativ-regulierende Instru-mente zur Absicherung eines angenommenen Gemeinwohls gegenber Partikularinteressen und Machtmissbrauch die aber trotzdem keine konkrete Politik vorschreiben verbreiten sie sich erst infolge der brgerlichen Revolutionen des spten 18. Jahrhunderts (Bckenfr-de 1991: 32, Grimm 1994: 11f.; Glaener/Reutter 2001: 15).
Der politikwissenschaftliche Zugang zu Verfassungen ist im Vergleich zum rechtswis-senschaftlichen dadurch gekennzeichnet, dass er sie v.a. als Resultate von politischen Aus-einandersetzungen und Prozessen und in ihrer Bedeutung fr die politische, soziale und konomische Gestaltung von Gemeinwesen betrachtet und weniger als gesetzte, gewisser-maen von oben gegebene Normenschreine. In dieser Perspektive war die Triebkraft fr die Verbreitung von Verfassungen das Misstrauen gegenber den Machtinhabern und einer widrigen, unkontrollierbaren Umwelt. Vernderte politische und konomische Krftever-hltnisse, gesellschaftliche Emanzipationsprozesse sowie der rationalistische Wunsch nach der Standardisierung interpersoneller Beziehungsmuster im sozialen, konomischen, politi-schen, kulturellen Raum schufen die Voraussetzung dafr, dass sich Verfassungen als In-strumente der Konfliktprvention und -kanalisierung durchsetzten. Um zu verhindern, dass Menschen die ihnen anvertraute Macht missbrauchen, wurden in ihnen restriktive, sankti-onsbewehrte Spielregeln festgelegt, an die sich alle Brger halten mussten, wofr sie im Gegenzug bestimmte verbriefte Rechte erhielten. Konstitutionalistische Leitprinzipien waren und sind Machtbeschrnkung, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsschutz (Castiglio-ne 1996; Preu 1996; Murphy 1993; Hberle 1996: 66; Venizelos 2003: 690; Bckenfrde 1991: 29-52; Hart 2001).
-
14 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
Auch wenn diese Prinzipien heute leicht mit Demokratie assoziiert werden, so waren und sind doch andere konstitutionelle Regimetypen denk- und beobachtbar (Walker 1997; Arato 1994: 168). Demokratie wurde zunchst mit unregulierter Mehrheitsherrschaft bzw. Selbstregierung durch das Volk in kleinen Gemeinwesen gleichgesetzt (z.B. Federalist pa-pers 10, 14, 51). So verstanden, bedurfte sie im Idealfall konstitutioneller Schutzmechanis-men gar nicht, weil einerseits Brger keine Tyrannen in politische mter whlen, sie im Falle einer Tyrannei abwhlen bzw. absetzen und weil andererseits die politische Mehrheit auf Repression von sich aus verzichtet, da sie die Rache ihrer Gegner frchtet, sollten diese knftig die Mehrheit erlangen (Murphy 1993; Rosenfeld 1994b). Aufgrund ihrer Skepsis gegenber dieser Argumentation pldierten etwa Alexander Hamilton, Thomas Madison und James Jay in ihren Artikeln zur Verteidigung des Entwurfs der US-Verfassung, den Federa-list Papers, fr eine Verfassungsrepublik anstelle einer Demokratie (Levinson 2006).
Dass sich in der Praxis das Misstrauen als angebracht erwies, frderte die Verbreitung des Machteinhegungs- und Befriedungsinstruments Verfassung, die strker vonstatten ging als der Export des Befriedungsinstruments Demokratie. Seit Verabschiedung der ersten Staatsverfassungen in den USA am 17.09.1787, in Polen am 03.05.1791 und in Frankreich am 03.09.1791 verbreitete sich der Trend zur derartigen formellen Fixierung allgemein verbindlicher Regeln weltweit (Fenske 2001; Reinhard 1999). Inzwischen verfgen alle souvernen Staaten ber Verfassungen, Verfassungsgesetze oder bergangsverfassungen. Davon ist nur die des Vereinigten Knigreichs von Grobritannien und Nordirland nicht vollstndig schriftlich kodifiziert (AA o.J.; CIA 2007; Tschentscher o.J.).3 Obwohl in vie-len Staaten noch nicht einmal die Grundprinzipien des Konstitutionalismus voll respektiert werden, zhlt die Installation einer Verfassung doch heute zum typischen Instrumentarium einer Selbstdefinition als Staat bzw. politisches Gemeinwesen. Von einem Teil der (zumal deutschen) Verfassungslehre wurde Staatlichkeit umgekehrt als Grundvoraussetzung fr die Verabschiedung einer Verfassung erachtet (Bckenfrde 1991: 29; Isensee 1995; Kirchhof 1995; Schmitt 1970: 3), bis die verfassungstheoretische Auseinandersetzung mit der Idee einer EU-Verfassung zu neueren berlegungen fhrte.
Im Laufe der Zeit wandelten sich die Rahmenbedingungen des Konstitutionalismus und die normativen Ansprche an Verfassungen und an die Verfassungspolitik erheblich. Nach den Vertragstheorien des 17. Jahrunderts gingen der Liberalismus des 18., die demo-kratischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, das Konzept des Wohlfahrtsstaates und die qualitative Verengung des Verstndnisses einer echten, modernen, reifen Demokratie im 20. Jahrhundert deutlich in die Konzeption von Konstitutionalismus ein (Chambers 2001: 63). Schon der liberale Konstitutionalismus, der sich besonders auf den Schutz des einzel-nen Brgers vor der Volkssouvernitt richtete (Preuss 2003: 1), hatte sich dafr strker dem Konzept der Gewaltenteilung geffnet. Er spezifizierte also das zunchst neutrale Prinzip der Machtbegrenzung.4 Fr Carl J. Friedrich (1937) beispielsweise war Gewalten-teilung neben der Rechtsstaatlichkeit bereits das zweite Hauptmerkmal von Konstitutiona-lismus. Konzeptionell weiterentwickelt (z.B. Loewenstein 1959; Hermens 1964) und ver-fassungsrechtlich umgesetzt (Johnson 1993) wurde dieser Gedanke in gezielter Abwendung
3 Das Gleiche gilt fr Guernsey, Jersey und die Isle of Man, die aber als Besitztmer der englischen Krone
einen verfassungsrechtlichen Sonderstatus aufweisen. 4 Im weiteren Sinne wurzelte Gewaltenteilung schon in der Antike (Vile 1967: 2), Bellamy (1996: 24) sieht sie
als Doktrin sptestens seit der franzsischen Revolution verbreitet. Hier wird aber ein engeres Begriffsver-stndnis genutzt.
-
1.1 Verfassungen, Verfassungsdemokratien, Verfassungsnderungen 15
von den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Dass smtliche etablierte Demokratien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Vorteile beider Freiheitskonzepte zu verbinden suchen, deutete auf einen mglichen Wirkungszusammenhang zwischen Demokratie und Konstitu-tionalismus hin, den seither die meisten Demokratietheorien zu untermauern suchen. Ihre grundstzliche Argumentation lautet: Demokratien bedrfen zwingend einer Verfassung, die das politische Handeln beschrnkt, aber durch Setzung objektiver, verbindlicher Spiel-regeln berhaupt erst einen fairen politischen Wettstreit ermglicht (Elster 1993b: 2f., 9 ff.; Holmes 1993a: 21, 1993b: 196 ff.; Schultze 1997: 509; Bellamy 2006: xi).
Hinzu kamen immer weitere Erwartungen auch an die Verfassungspolitik. So definier-te der deutsche Verfassungsrechtler Hberle gute Verfassungspolitik als Resultante aus dem Gegen- und Miteinander von Mglichkeits-, Wirklichkeits- und Notwendigkeitsden-ken (1996: 18). Die konstitutionelle Regierungsform, so der britische Politikwissenschaft-ler und Verfassungstheoretiker Bellamy, fhre die verschiedenen Gruppen und Interessen innerhalb einer Gesellschaft in einen Dialog miteinander und gewhrleiste, dass die Rechtssetzung die jeweiligen Belange des anderen und den Respekt freinander ebenso wiederspiegele wie den Wunsch nach Frderung des Gemeinwohls (1996: 44). Weitere bliche Leistungserwartungen sind heute Transparenz und Verstndlichkeit als Implikatio-nen von Legitimitt und Verfahrenssicherheit, faire Reprsentation, Konsensbildung, Effi-zienz, insbesondere Entscheidungseffizienz im politisch-administrativen System, Regie-rungseffektivitt sowie ein adquates Verhltnis aus Stabilitt und Anpassungsfhigkeit gegenber vernderten Rahmenbedingungen (Schultze 1997: 511; Dahl 1996: 179f.). Da parallel zu dieser Entwicklung auch die Ansprche an die Demokratie stiegen,5 die die Verfassung schtzen soll, umfassen gegenwrtige Konzepte des demokratischen oder modernen Konstitutionalismus oft die demokratische Deliberation neben Individualrech-ten und Rechtsstaatlichkeit als drittes Hauptmerkmal und berlappen sich stark mit moder-nen Demokratiekonzepten, und zwar bis hinein in das Verstndnis der konstitutiven Ein-zelmerkmale (z.B. Nino 1994; Henkin 1994: 41f.; Arato 1994).
Die Theoriediskussionen zur Demokratie und zum Konstitutionalismus berschneiden sich auch hinsichtlich der Wirtschaft, sozialen Rechte und Wohlfahrt. So werden Verfassun-gen teils als vertragliche Basis dafr verstanden, dass der Staat konkrete Leistungen bzw. ffentliche Gter bereitstellt, von denen der einzelne profitiert (Buchanan/Tullock 1962), also nicht nur als institutionelle Schutzschilde gegen Anarchie oder Mehrheitstyrannei, teils wird argumentiert, die modernen Verfassungen htten sich gerade aufgrund der Trennung von Gesellschaft und (dem nunmehr durch sie eingerichteten) Staat ber dessen Preisgabe der Wohlfahrtsfunktion herausgebildet, weshalb sie in den heutigen Sozialstaaten Schw-chen in der Regulierung der vernderten Staatsttigkeit zeigten (Grimm 1994: 404f., 399). Auch manche Konzepte von Demokratie betrachten fr diese die Gewhrleistung einer Marktwirtschaft neben anderem als wesensbestimmend (z.B. Linz/Stepan 1996), wh-rend andere die konomie weitgehend unbercksichtigt lassen (z.B. Dahl 1971, 1989; Mer-kel 2003). Ein weiteres demokratietheoretisch wie konstitutionalistisch kontrovers diskutier-tes Thema sind Status, Gehalt und Wirkungsweise von Verfassungen und Demokratie in globalisierten, entgrenzten Rumen (z.B. Lietzmann 2002; Tully 2002; Scheuerman 1999; Weiler 2003; Bellamy 2003; Landfried 2001, 2006; van Ooyen 2006: 235 ff.).
5 Siehe u.a. Merkel 2003; Merkel u.a. 2003 und die Ausfhrungen zur deliberativen Verfassungspolitik in
Kapitel 2.1.
-
16 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
Neben den instrumentellen Verfassungsfunktionen der (generationenbergreifenden) Regulierung und der Stabilisierung des verfassungsrechtlichen Grundkonsenses, der Entlas-tung der Herrschaftstrger und ihrer Kontrolle6 wurde in der Literatur die symbolische Bedeutung, geistig-normativ regulierende und orientierende Funktion von Verfassungen als verfestigte Sinngebilde hervorgehoben und seit einiger Zeit von der Politikwissenschaft neu entdeckt (Ghler 1997; Rehberg 1997). Sie spiegeln im Idealfall die in einer Gesellschaft verankerten Werte wider, knnen Konflikte vermeiden und als Konsensquelle die Brger zu einer Verfassungsgemeinschaft integrieren, beispielsweise durch die Neuerschaffung gebrochener historischer, kultureller oder nationaler Identitten (Vorlnder 2002b; Schaal 2001). Obgleich aufgrund sprlicher empirischer Informationen ber die tatschliche Re-zeption der Verfassung durch den einzelnen Brger wenig Gewissheit in diesem Punkt herrscht, so zhlen die geistige Orientierung, Sinn- und Identittsstiftung doch zum Set der hohen Erwartungen an Verfassungen in modernen Demokratien und gehen damit ebenfalls weit ber das hinaus, was als theoretisches Konstrukt des sich selbst eine Verfassung verleihenden Volkes in frheren Verfassungstheorien eine Rolle spielte. Aktuelle theore-tische berlegungen kreisen hier darum, wie die Verfassungspolitik ethnische, religise, kulturelle, sexuelle usw. Vielfalt (Diversitt) umfassend absichern kann (z.B. Rosenfeld 1994b), und inwiefern Konstitutionalismus auch die Achtung der ethnischen Selbstbestim-mung beinhaltet, also des Rechts der Vlker darauf, ihre politische Zugehrigkeit selbst zu whlen und zu ndern (Henkin 1994: 42).
Unterhalb dieser generellen Trends der Theorieentwicklung beinhalten verfassungs-theoretische Beitrge jeweils Wahrnehmungsschwerpunkte und Interpretationsneigungen, die vom spezifischen Wissen, den Erfahrungen und kulturellen Prgungen ihrer Autoren beeinflusst sind. Dies zeigt sich an den Konzepten des US-amerikanischen constitutiona-lism, des angelschsischen rule of law, des deutschen Rechtsstaats und des zwar wrtlich bernommen, aber doch anders angelegten franzsischen tat de droit sowie an unter-schiedlichen Vorstellungen davon, wie viel formalisierte Rechtsstaatlichkeit Demokratie berhaupt bentigt, um funktionieren zu knnen (Rosenfeld 2001; Lauth 2001: 26 ff.). An zwei Staaten sei dies veranschaulicht: In Deutschland wurde die Verfassung v.a. als gesetz-te Rechtsordnung des als zentral betrachteten Staates verstanden und die eingangs erwhnte Dualitt von Freiheit und Rechtsbindung besonders im Hinblick auf das Verhltnis Staat Gesellschaft diskutiert (z.B. Schmitt 1970).7 Erst seit den 1960er Jahren fungierte infolge einer strkeren Rezeption von Rudolf Smend die Verfassung selbst mehr als Ausgangs-punkt rechtstheoretischer berlegungen. Dennoch ist die traditionelle Sicht oft weiter er-kennbar (z.B. Grimm 1994: 406, 431; Hberle 1996: 226f.) und steht die Beschrnkung (anstelle einer Begrndung) von Herrschaft durch mglichst genau kodifiziertes Recht weiter latent im Vordergrund (Lepsius 2004: 4; Gnther 2004; Hennis 2002; Lietzmann 6 Verfassungen stabilisieren, so Grimm, das Verhltnis von Kontinuitt und Wechsel, indem sie auf der
Ebene der Prinzipien und Verfahren hhere Kontinuitt institutionalisieren als auf der Ebene der Ausfh-rung und Konkretisierung von Politik. Sie entlasten auerdem die Akteure von der permanenten Reflexion ber die geeigneten Entscheidungsgrundlagen, weil ihre Regelungen nicht mehr Thema, sondern Prmisse von Politik sind, erleichtern es den Unterlegenen, die Entscheidungen der Mehrheit zu akzeptieren, und dmmen so das Konfliktpotenzial ein (Grimm 1994: 430, 429).
7 Hennis (2002) schildert zu Recht und plastisch, dass es in Deutschland unterschiedliche verfassungsrechtli-che Schulen gab und gibt. Vergleicht man indes ihre Argumente und Diskussionsfoki mit Arbeiten von Autoren anderer Staaten, dann ergeben sich zwischen ihnen teils mehr hnlichkeiten als mit letzteren. Zum Wandel des deutschen Rechtsstaatsverstndnisses siehe Lauth 2001: 30 ff.; Bckenfrde 1976: 65 ff.; Vor-lnder 1999a.
-
1.1 Verfassungen, Verfassungsdemokratien, Verfassungsnderungen 17
2002: 294 ff.). In den USA ist hingegen bei aller beobachtbaren Kontroverse um die Wei-terentwicklung der Verfassung der Gedanke Thomas Jeffersons verbreiteter, dass jeder Generation das Recht garantiert sein msse, die Regierungsform frei zu whlen, von der sie glaubt, dass sie die beste sei. In diesem Verstndnis soll die Verfassung lediglich ein Safe von eher sparsamen prozeduralen Vorgaben und (allerdings erst spter hinzugefgten) Grundrechten sein (Jefferson 1979; Barak 1994; Levinson 2006: ix).
In der praktischen Politik verengten sich die normativen Selbstbeschreibungen und Selbstverpflichtungen hnlich wie in der Theorieentwicklung, etwa im Rahmen der Europ-ischen Menschenrechtskonvention des Europarates, des Vertragswerks der Europischen Gemeinschaft/Europischen Union und in der materiellen EU-Politik (so in den Kopenha-gener Kriterien). Aber selbst die konomisch ausgerichteten Organisationen OECD und Weltbank fixierten in ihrem Konzept des guten Regierens (good governance) erhhte normative Ansprche an Institutionen. Die EU griff dieses Konzept inzwischen auf und erweiterte es. Seine Prinzipien sind Rechtsstaatlichkeit, Offenheit, Transparenz und Ver-antwortlichkeit demokratischer Institutionen, Gerechtigkeit und Gleichheit im Umgang mit den Brgern inklusive Konsultation und Partizipation, Effektivitt und Effizienz, klare, transparente und anwendbare Gesetze, Konsistenz und Kohrenz in der Politikformulierung und hohe Standards fr ethisches Verhalten. Der Staat soll nach diesem Ansatz die Zivilge-sellschaft in die Gesamtsteuerung der gesellschaftlichen Entwicklung einbeziehen und aktivieren (OECD 1995; Kommission der Europischen Gemeinschaften 2001).
Die Verfassungs(nderungs)politik in etablierten Demokratien soll heute also sowohl gem theoretischen Vorstellungen als auch gem politischen Vereinbarungen weitaus mehr leisten, als es das ursprngliche Konzept des Konstitutionalismus beinhaltete. Sie soll freie und faire Wahlen als Mittel der Machtbegrenzung, den Schutz brgerlicher Rechte und Freiheiten, Minderheitenschutz, Interorgankontrolle, verantwortliches Regieren, Lega-litt (Ausschluss rckwrtiger Normensetzung), Rechtsstaatlichkeit (Gesetzeshoheit und -stabilitt), Legitimation und Effizienz sichern (vgl. Elster 1993b: 2; Goodin 1996: 1-53; Boldt 1995: 817 f.; Schwegmann 2002: 533), sie soll deliberativ zustande kommen und wie andere Politiken gem den eben erwhnten Prozessprinzipien von good governance: transparent, effizient und partizipativ. Gleichzeitig wird mehr oder weniger explizit erwar-tet, dass Verfassungen wegen ihres Charakters als Akte bergeordeter Rechtsetzung auch inhaltlich ber den tagespolitischen Irrungen und Wirrungen stehen und mglichst wenig verndert werden.
Diese Prinzipien lassen sich dennoch weiter mit einer erheblichen Bandbreite poli-tisch-institutioneller Ausprgungen vereinbaren (Lietzmann 2002: 292; Bellamy 2006: xi) ob nun in Form des Prsidentialismus oder Parlamentarismus, Einheits- oder Fderalstaa-tes, mit Mehrheits- oder Verhltniswahl, flexibler oder rigider Verfassung. Auch bei den Grundrechten besteht zwar angesichts verbreiteter Erfahrungen politischen Unrechts und einer Internationalisierung des Grund- und Menschenrechtsschutzes (Sommermann 2004: 16) ein Konsens darber, dass sie festgeschrieben werden sollten,8 umstritten ist aber, wel-che Rechte (etwa auch materielle), in welcher Form und mit welchen Konsequenzen.9 Nicht 8 Abweichend Sartori (1994: 198), Ely (1978) oder Alexander Hamilton, der im Federalist-Artikel 84 argumen-
tiert, es sei absurd, Rechte in der Verfassung festzuschreiben, zu deren Beschrnkung ohnehin niemand ver-fassungsmig befugt sei (Hamilton 1788). Ein weiterer Einwand gegen kodifizierte Grundrechtechartas be-steht darin, sie implizierten den Nichtschutz dort ungenannter Rechte (Levinson 1995a: 27 ff.).
9 Die geltende Verfassung der V. Franzsischen Republik etwa verweist lediglich in ihrer Prambel auf die Verbundenheit des franzsischen Volkes mit den Menschenrechten, wie sie in der Erklrung der Menschen-
-
18 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
nur zwischen, auch innerhalb von Staaten variieren hier die Einstellungen und spiegeln wohl noch am deutlichsten die ansonsten bisweilen recht eingeebneten ideologischen Fron-ten wider. Dennoch kommt es auch in diesem sensiblen Bereich regelmig zu Mehrheiten, die ausreichen, um sich auf Grundrechtserweiterungen ebenso wie auf beschrnkungen zu einigen (fr Deutschland Lorenz 2007).
Die Politik in den etablierten Verfassungsdemokratien steht heute nicht nur unter ei-nem normativen Erwartungsdruck. Regieren, zumal wenn es in einem teilintegrierten Mehrebenensystem wie dem der Europischen Union stattfindet, bedeutet weniger als fr-her Gestaltung nach eigenen Wnschen, sondern ist ein komplexes Interdependenzmana-gement unterschiedlichster Akteure in Rumen, in denen der Nationalstaat und seine ge-whlten Entscheidungstrger in der Politik weder nach innen noch nach auen ber ein unhinterfragtes Herrschaftsmonopol verfgen. Stattdessen vervielfltigten sich gesellschaft-liche, konomische und politische Institutionen und Akteure und orientieren sich nicht mehr allein an den Grenzen geordneter Staaten (u.a. Benz 2004, 2005b; Schuppert 2006). konomischer, gesellschaftlicher und kultureller Wandel und seine negativen wie positiven Effekte, etwa die Zunahme der Erwartungshaltungen, neue Konfliktpotenziale, schwieriger zu erreichende und auf Dauer abzusichernde Lsungen sowie Kommunikationsdruck, set-zen die gewhlten Entscheidungstrger unter erheblichen Stress.10 Inwieweit sich dies sys-tematisch (also nicht nur in bestimmten Fllen) auf die nationalen Verfassungspolitiken auswirkt, ist allerdings weitgehend unbekannt.
Aufgrund des Normenwandels und der praktischen Anreize fr politisch-institutionel- len Wandel muss die Politikwissenschaft sich trotz ihrer Vorliebe fr die Revolutions- romantik der Verfassungsgebung und fr groe Reformen auch der Beobachtung der Verfas-sungspolitik im Alltag etablierter Demokratien ffnen. Seit der Annahme der kanadischen Verfassungsurkunde von 1982 enthalten alle demokratischen Verfassungen Regeln fr ihre eigene nderung und stellen damit Instrumente zur Verfgung, auf vernderte Rahmenbe-dingungen oder Interessen verfassungspolitisch zu reagieren (Murphy 1995: 168). Tatsch-lich ist die Art und Weise, wie Verfassungswandel organisiert und durchgefhrt wird, fr die Stabilitt einer politischen Ordnung von ebenso elementarer Bedeutung wie die Verfas-sungsgebung (Glaener/Reutter 2001). Diesem Gedanken verpflichtet waren die aufschluss-reichen neueren Studien zum impliziten konstitutionellen Wandel, so per Verfassungsausle-gung durch Gerichte, gewandelte Konventionen oder Praktiken (Landfried 1988, 1996; Sto-ne Sweet 2000; Kneip 2006a, 2006b; Hnnige 2006). Die vorliegende Analyse nimmt nun zugunsten einer ausgewogenen Gesamtwahrnehmung das Zustandekommen auch der kon-
und Brgerrechte vom 26.08.1789 festgeschrieben sind, und schreibt in Art. 1 die Gleichheit aller Brger vor dem Gesetz ohne Unterschied der Herkunft, Rasse oder Religion sowie die Achtung jeden Glaubens fest. Die staatsbrgerlichen Rechte sind nur einfachgesetzlich geregelt. In Grobritannien war die Ratifizie-rung der Europischen Menschenrechtskonvention lange sehr umstritten nicht vordergrndig aufgrund ih-rer Inhalte, sondern aufgrund der Kollision mit dem Prinzip der Parlamentssouvernitt. In Deutschland wiederum sind die Grundrechte fest konstitutionell verankert. Zur verfassungs- und demokratietheoretischen Debatte ber die Konstitutionalisierung von Grundrechten siehe Becker 2001.
10 Als gesamtgesellschaftliche Trends, die selbstverstndlich so nicht dauerhaft anhalten mssen, lassen sich nennen: Individualisierung, auch der Interessenlagen, Abnahme traditionaler Bindungen und wahrgenom-mener Verbindlichkeiten (damit auch von Planungssicherheit), Beschleunigung, Mobilittserhhung, (issue-basierte, oft kurzfristige) Vernetzung, Enthierarchisierung, konomisierung bei mehr Angebotskonkurrenz, hhere Kommunikationsdichte, Verschiebung von der real erfahrenen zur medial vermittelten Wirklich-keitswahrnehmung. Trotz des Wandels und der Kritik an politischer Steuerung sind die Leistungsansprche gegenber Staat und Politik relativ unverndert hoch geblieben.
-
1.2 Verfassungsnderungen im empirischen berblick 19
kreten Modifikationen am Verfassungstext in den Blick, rechtswissenschaftlich gesprochen, der nderungen am Verfassungsrecht im formellen (und nicht materiellen) Sinne.
Solche expliziten Verfassungsnderungen11 bewirken ebenfalls oft direkt oder indirekt eine Umverteilung von Macht, lsen daher potenziell politische Konflikte und Legitimati-onsprobleme aus oder verschrfen sie (Krockow 1976: 18, Powell/DiMaggio 1991: 28). Im Unterschied zum impliziten Wandel bedrfen sie der eindeutigen Zustimmung verschiede-ner Akteure gem dem vorgegebenen Verfahren fr Verfassungsnderungen. Die Literatur hat gerade in der vergangenen Dekade unter dem Einfluss der Vetospielertheorie berzeu-gende Argumente vorgebracht, warum derartiger institutioneller Wandel in etablierten Demokratien unwahrscheinlich ist (Kapitel 1.3; 2.3). Rationale Akteure, so eine zentrale Annahme, werden geneigt sein, dem unsicheren Ausgang den Status quo vorzuziehen, es sei denn, ihnen wrden gute Grnde fr dessen Vernderung prsentiert. Fr jeden ber-zeugende Grnde bzw. ertragreiche Lsungen sind aber ceteris paribus umso schwieriger zu erreichen, je mehr Akteure an ihrer Aushandlung und Verabschiedung beteiligt sind, da jeder seine eigenen Interessen verfolgt (u.a. Schultze 1997: 516; Vorlnder 2003: 8). Das provoziert die Frage: Wie schaffen es Initiatoren von Verfassungsnderungen, ohne Staats-krisen groe Mehrheiten fr ihre Vorhaben zu mobilisieren? 1.2 Verfassungsnderungen im empirischen berblick Dass die Untersuchung von Verfassungsnderungspolitik nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch relevant ist, erschloss sich bislang eher exemplarisch, denn an empirischen Vergleichsdaten in grerem Mastab fehlte es.12 Trgt man die Informationen zur Verfas-sungsnderungspolitik in den demokratischen Staaten seit 1945 zusammen, so belegen diese, dass die Hufigkeit von Verfassungsnderungen trotz deutlicher Varianz der lnder-bezogenen Zahlen seither tendenziell berall zugenommen hat (Lorenz/Seemann 2007).
Soll diese Aussage verfeinert werden, dann bedarf es umfassenderer Daten und ange-sichts der drftigen Informationslage aus praktischen Grnden eines krzeren Untersu-chungszeitraums. Die folgenden Befunde beziehen sich auf alle Verfassungsnderungen in jenen Demokratien, die Freedom House im Untersuchungszeitraum von 1993 bis 2002 gem dem Index Political Rights, Civil Liberties, Status als frei einstufte,13 deren Bevlkerungszahl die 1-Millionen-Marke bersteigt (um ein Mindestma an politisch-institutioneller Komplexitt zu gewhrleisten) und deren Verfassungspolitik nicht durch gewaltttige Konflikte beeinflusst wird.14
11 Im deutschen Sprachgebrauch dominiert die von Georg Jellinek (1996) geprgte Unterscheidung von (for-
meller) Verfassungsnderung und (informellem) Verfassungswandel, wobei der zweite Begriff fr die Inter-pretation durch Gerichte u.. teils stark kritisiert wird (Vokuhle 2004). Die eher politikwissenschaftliche, technisch-pragmatische Unterscheidung von explizitem und implizitem Verfassungswandel (constitutional change) findet sich u.a. bei Levinson 1999: 25; Voigt 1999; Giovannoni 2001; Rasch 2003: 113.
12 Robert Maddex (1996) lieferte zwar Informationen zu den Verfassungen der achtzig grten Staaten welt-weit, beschrnkte sich jedoch weder auf Demokratien noch auf stabile Regimes. Donald S. Lutz arbeitete zu nderungen in Verfassungssystemen (1994: 356f.), bezog sich aber fr verschieden lange Zeitperioden, die alle vor dem hier betrachteten Untersuchungsabschnitt lagen.
13 Die Methodik von Freedom House ist zu Recht nicht unumstritten (u.a. Merkel 2003: 43f.), doch fr den Zweck dieser Teilanalyse ausreichend.
14 Die Lnge von zehn Jahren wurde gewhlt, um die Wahrscheinlichkeit vorbergehender Verzerrungen zu vermeiden, gleichzeitig aber zu gewhrleisten, dass der Aufwand fr Datenerhebung und auswertung in ei-
-
20 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
Wie Abb. 1 zeigt, fanden trotz der rationalen, institutionellen und soziokulturellen Hemmschwellen fr Verfassungsnderungen in 32 aller 39 bercksichtigten voll etablierten Demokratien in diesen zehn Jahren solche nderungen statt. In beinahe der Hlfte von ih-nen, 18 Lndern, sogar fnf oder mehr Mal, also durchschnittlich mindestens alle zwei Jahre. Abbildung 1: Hufigkeit von Verfassungsnderungen in etablierten Demokratien,
1993-2002
Quelldaten: GLIN o.J., Tschentscher o.J., T.C. Williams SoL o.J., Maddex 1996, Georgetown University 1998; Flanz u.a. 2007; eigene Recherchen. Die acht Nullreformierer15, die der Anschaulichkeit halber separat erfasst sind, bilden angesichts von 31 Staaten mit Verfassungsnderungen eher eine verfassungspolitische Minderheit. Zudem stehen auch bei ihnen Vernderungen der Verfassungstexte auf der politischen Agenda, wie eine Stichprobe schnell zeigt. In Australien beispielsweise hlt eine Verfassungsdebatte ber elementare Charakteristika des politischen Systems an.16 1999 fanden zwei Verfassungsreferenden statt, die aber scheiterten. In Dnemark entwi-ckelte sich seit 1999 eine Debatte ber Verfassungsnderungen, die 2000 zur Einsetzung einer entsprechenden Parlamentskommission und seither zu zahlreichen nderungsvor-schlgen von verschiedensten Akteuren fhrte; manche nderungen spiegelt zudem der Text des grundlovs allein nicht wider.17 Die japanische Regierungspartei LDP initiierte im Jahr 2000 eine Verfassungsnderung zur Abschaffung des Pazifismusgebots; die nachfol-gend eingerichtete parlamentarische Arbeitsgruppe befrwortete 2002 auch weitergehende konstitutionelle nderungen18 (Gefter 2000; Grobe 2005; Foreign Press Center Japan 2007). In den USA fand die letzte Verfassungsnderung 1992 statt. Dasselbe galt in Spa-
nem angemessenen Verhltnis zum eigentlichen Zweck der Studie steht. Da die Erhebung in der ersten Pha-se des 2002 begonnen Forschungsprojekts erfolgte, endet der Untersuchungszeitraum 2002.
15 Australien, Benin, Bulgarien, Dnemark, Japan, Spanien, Sdkorea, USA. 16 Themen sind die Umwandlung in eine Republik, die Einfhrung des Prsidentialismus, der Wahlmodus des
Staatsoberhaupts und die Anerkennung der indigenen Bevlkerung. 17 Per Gesetz vom 29.04.1992 ergnzte das Parlament die Verfassungsnormen um die Europische Menschen-
rechtskonvention. Eine solche bernahme suprationaler und internationaler Vereinbarungen wird durch die Verfassung gedeckt. Initiativen zu deren nderung berhrten u.a. das Kompetenzverhltnis zwischen Par-lament und Regierung, ethnische, religise und Sprachdifferenzen, die Brgerrechte, die Staatsverwaltung und die Monarchie (Folketinget 2001; Folketinget o.J.).
18 Die japanische Regierung hatte seit 1950 das Pazifismusgebot, das innenpolitisch immer umstritten war, zunehmend berdehnt. Der Bericht des Parlamentsausschusses befrwortete auch Staatsziel- und Grund-rechtsnderungen hinsichtlich Umwelt und Privatsphre.
02468
101214
0 1 bis 5 6 bis 10 11 bis 15 16 bis 20 ber 21
Anzahl der Verfassungsnderungen
Anz
ahl d
er S
taat
en
-
1.2 Verfassungsnderungen im empirischen berblick 21
nien, wo seit der damals ersten nderung nach der Verabschiedung der Verfassung 1978 deren Reform immer konkreter und umfassender diskutiert wurde und nur aufgrund einer fehlenden Einigung aussteht.19
Verfassungsnderungen sind also ein praktisches und nicht nur akademisches Thema auch in den Staaten, in denen im Untersuchungszeitraum keine nderungen durchgefhrt wurden. Wie hufig sie in den anderen Demokratien stattfanden, zeigt Tab. 1. Sie erfasst alle formalen Beschlsse ber eine oder mehrere substanzielle (also inhaltliche) nderungen der Verfassungen20 und enthlt auerdem Angaben zur kumulierten inhaltliche Reichweite der jeweils verabschiedeten Verfassungsnderungen. Dieses Ma erbringt eine zustzliche Aus-sage, wenn man annimmt, dass eine signifikante Verfassungsnderung ebenso bedeutungs-voll sein kann wie mehrere einfache Modifikationen und dass die Einfhrung einer neuen Verfassung nochmals bedeutungsvoller ist.21 Eingriffe in den Verfassungstext wurden grundstzlich als einfache nderungen eingestuft (1 Punkt) und nur dann mit groer Zurckhaltung als signifikant (3 Punkte), wenn sie entweder den Charakter des politi-schen Systems inhaltlich deutlich reformierten und/oder wenn sie sehr groe Textbereiche novellierten (Tab. A 5). Die Einfhrung einer neuen Verfassung wird als Maximalnderung der vorangegangen Verfassung erfasst (5 Punkte).22 Nur Grobritannien wurden wegen der ungeschriebenen Verfassung keine Zahlenwerte zugewiesen, obwohl etliche Neuerungen faktisch Verfassungsnderungen waren, so der Human Rights Act, die Reform des House of Lords, die Freedom of Information legislation. Mindestens die Devolution, die das traditio-nelle Verfassungsprinzip des Unitarismus berhrte, entsprach dabei dem Charakter einer signifikanten Verfassungsnderung (Kaiser 2002: 143; Hazell/Sinclair 1999).
Hinsichtlich der Gesamtreichweite ihrer nderungsaktivitten sind sterreich, Bel-gien, Finnland und die Schweiz Spitzenreiter. Chile, Costa Rica, Papua-Neuguinea und Neuseeland auf weiteren Pltzen zeugen aber davon, dass die Neuerungsbereitschaft kein europisches, etwa einseitig dem EU-Integrationsprozess seit Maastricht geschuldetes Ph-nomen ist.23 Der Durchschnitt betrgt 5,9 Verfassungsnderungen in zehn Jahren.
19 Initiativen der Fraktion Vereinte Rechte/Initiative fr Katalonien 1995 richteten sich auf das aktive und
passive Wahlrecht (Congreso de los Diputados 2002). Seit 1996 befasste sich der Senat aktiv mit einer Ver-fassungsreform ihn betreffend (Propuesta reforma 2005: 15). Die sozialistische Regierung schlug 2005 nderungen zur Thronfolge, zum Verhltnis zwischen Spanien und der EU, die namentliche Erwhnung der Autonomen Regionen und Autonomen Stdte und eine Senatsreform vor (Consejo de Estado 2006).
20 Rein orthografische nderungen, wie die am 26.03.2001 per Bekanntmachung des polnischen Ministerpr-sidenten erfolgte Korrektur zweier sprachliche Fehler, sind also nicht erfasst.
21 So beinhaltete die Grundgesetznderung vom 27.10.1994 umfangreiche Modifikationen am Verfahren der nderung des Gebietsbestandes der Bundeslnder, zu Gesetzgebungskompetenzen, zur finanziellen Eigen-verantwortung der Gemeinden u.v.m.
22 Die Einstufung als neue Verfassung in Abgrenzung von total revidierten oder nachgefhrten Verfassun-gen weicht in der Literatur teilweise ab (z.B. Ismayr 1999: 10; Filos 2002; Biaggini 1999). Die Einstufung richtet sich hier nach dem gewhlten nderungsverfahren und der Selbstdarstellung der Staaten.
23 Zu den jeweiligen verfassungspolitischen Vorausssetzungen und Implikationen der Kompetenzabgabe an europische Institutionen durch die EU-Staaten siehe Masclet/Maus 1993.
-
22 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
Tabelle 1: Verfassungsnderungen in 38 Demokratien, 1993-2002 Staat Verfassung in Kraft seit Anzahl der nderungen Kumulierte Reichweite Australien 1901, 86 0 0 Belgien 1831 19 21 Benin 1990 0 0 Bolivien 1967 1 3 Botsuana 1966 2 2 Bulgarien 1991 0 0 Chile 1981 11 11 Costa Rica 1949 15 15 Dnemark 1953 0 0 Deutschland 1949 13 15 Finnland 1919 16 2000 0
20
Frankreich 1958 9 9 Griechenland 1975 1 3 Irland 1937 9 9 Italien 1948 7 11 Jamaika 1962 3 3 Japan 1946 0 0 Kanada 1867 7 7 Litauen 1992 3 3 Mauritius 1968 6 6 Mongolei 1992 1 1 Namibia 1990 1 1 Neuseeland 1840 13 13 Niederlande 1815 6 6 Norwegen 1815 2 2 sterreich 1920 21 21 Papua-Neuguinea 1975 9 13 Polen 1992 4 1997 0
8
Portugal 1976 2 6 Schweden 1975 11 11 Schweiz 1848 14 18 2000 5 5 Slowenien 1991 2 2 Spanien 1978 0 0 Sdkorea 1948 0 0 Tschechien 1993 5 5 Ungarn 1949 10 10 Uruguay 1967 2 4 USA 1789 0 0 Quelldaten: GLIN o.J., Tschentscher o.J., T.C. Williams SoL o.J., Maddex 1996, Georgetown University 1998; eigene Recherchen.
-
1.2 Verfassungsnderungen im empirischen berblick 23
Der Mittelwert der kumulierten nderungsreichweite liegt mit 6,6 wenig hher als der Mittelwert der nderungszahl. Die Differenz geht vor allem auf das Konto der drei neuen Verfassungen bzw. Totalrevisionen in Polen, Finnland und der Schweiz.24 Sowohl in Finn-land als auch in der Schweiz diente die Einfhrung der neuen Verfassung der Konsolidie-rung und Neustrukturierung der bisherigen konstitutionellen Bestimmungen, umfasst je-doch auch politisch bedeutsame modifizierte oder neue Inhalte, in der Schweiz beispiels-weise die zuvor nicht verfassungsrechtlich festgeschriebenen Grundrechte (Biaggini 1999). In Polen lste nach jahrelangen zhen Verhandlungen 1997 ein vollwertiges Grundgesetz die postsozialistische Kleine Verfassung von 1992 ab, die nur rudimentr das Regie-rungssystem geregelt hatte (Bos 2004: 172 ff.; Ziemer/Matthes 2004: 192f.). Jeweils signi-fikant beeinflussten von den insgesamt 223 Verfassungsnderungen mit sieben nur gut drei Prozent das Gesamtgefge des politischen Systems.
Verfassungsnderungen finden nicht nur hufig statt, sondern verteilen sich dabei auch ber die gesamte Zeit zwischen den fr Demokratien so relevanten Parlaments- bzw. Un-terhauswahlen. Abb. 2 verdeutlicht dies. Sie zeigt an, wie viel Verfassungsnderungen jeweils in den Dreimonatsabschnitten stattfanden.25 Abbildung 2: Zeitpunkte von Verfassungsnderungen nach Parlamentswahlen,
1993-2002
Quelldaten: eigene Recherchen. Die Hufung nach Parlamentswahlen erklrt sich oft durch das Zusammentreffen der pro-zeduralen Vorgabe einer dem Verabschiedungsprozess zwischengeschalteten Parlaments-wahl mit einem Grundkonsens hinsichtlich der Verfassungsnderung oder aber mit stabilen Mehrheitsverhltnissen trotz Wahl. Dies trifft beispielsweise auf die elf schwedischen Ver-fassungsnderungen im Untersuchungszeitraum zu. Die Hufung konstitutioneller Modifi-kationen 40 bis 48 Monate nach Wahlen kann bei rein parlamentarischen Prozessen da-durch erklrt werden, dass Verfahren noch in der laufenden Legislaturperiode abgeschlos-sen werden, um ihre Ergebnisse zu fixieren, oder dass Akteure versuchen, die institutionel-len Machtverhltnisse abzusichern oder fr den Fall vorteilhaft zu gestalten, dass die Wah- 24 Die tschechische Verfassung, die am ersten Tag des Untersuchungszeitraumes in Kraft trat, wurde nicht als
neu erfasst, da sie ja von Anbeginn Basis potenziellen konstitutionellen Wandels war. 25 Angegeben ist auf der X-Achse aus Grnden der Lesbarkeit jeweils der letzte Monat der Zeitintervalle (3
steht fr 0-3 Monate nach der letzten Wahl, 6 fr 4-6 Monate etc.).
0
5
10
15
20
25
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
Anzahl der Monate nach der letzten Parlaments-/Unterhauswahl
Anz
ahl d
er
Ver
fass
ungs
nde
rung
e n
-
24 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
len das Gefge der politischen Krfte verwirbeln. Letzteres betrifft etwa die verfassungs-rechtliche Ermglichung zustzlicher Amtszeiten fr Prsidenten in lateinamerikanischen Staaten.26 Wichtiger als diese Hufungen ist die empirische Beobachtung, dass Verfas-sungsnderungen praktisch permanent stattfinden.
Es lassen sich also (nicht nur) vom Westminster-Modell ber die napoleonischen Staats- und Verfassungstraditionen bis hin zur Verfassungsentwicklung Deutschlands nachhaltige Wandlungsprozesse aufzeigen (Hesse 1999: 16). Dieses Ausma verfassungs-politischer Aktivitten in etablierten Demokratien blieb in der Politikwissenschaft bislang noch relativ unbemerkt. Konstanz gilt oft weiterhin unterschwellig als Gtekriterium von Verfassungen, whrend ein instrumentell-voluntaristischer Umgang mit ihnen wie in Frank-reich als wahrgenommene Ausnahme der hufigen Zitation wert ist. Bercksichtigt man zugleich den Befund, dass ein starker impliziter Verfassungswandel stattfindet und dass insbesondere die Auslegung von Verfassungen durch die Gerichte eine neue Qualitt er-reicht hat (z.B. Stone Sweet 2000; Lhotta 2001), dann ist insgesamt von einer groen kon-stitutionellen Dynamik in etablierten Demokratien zu sprechen. Sie manifestiert sich in hufigen Verfassungsnderungen mit individuell nichtreformerischem Charakter.
Dennoch ist kein eindeutiger Trend im Verhalten aller beobachteten Flle festzustel-len. Darauf verweisen die Spannbreite der nderungsfreudigkeit (von 0 bis 21 Modifikati-onen in zehn Jahren) und die ber dem Mittelwert liegende Standardabweichung (Tab. 2). Es gibt noch nicht einmal klare regionale Trends der Hufigkeit von Verfassungsnderun-gen, wie die mit dem Mittelwert der Verfassungsnderungen pro Region zunehmende Stan-dardabweichung indiziert. Beispielsweise variierten die nationalen verfassungspolitischen Aktivitten innerhalb Europas stark trotz der EU-Integration. Regionale Verwandtschaf-ten mgen vielleicht die Inhalte von Verfassungsnderungen anregen ber die Orientie-rung aneinander, die Bereitschaft zum policy-learning von den Nachbarn, die Kooperation und institutionelle Verflechtungen, die ihrerseits Lerneffekte und familienspezifische hnlichkeiten politischen Verhaltens bzw. politischer Entscheidungen frdern knnen (Castles 1993: xiii); die Hufigkeit und inhaltliche Reichweite von Verfassungsnderungen determinieren sie aber nicht. Die unterschiedlichen Mittelwerte der nderungen pro Region sind daher keine verlsslichen Gren. Tabelle 2: Verfassungsnderungen nach Regionen, 1993-2002
Region Beobachtete Staaten
Mittelwert der nderungen
Standardab- weichung
Minimal- wert
Maximal- wert
Nordamerika 2 3,5 5,0 0 7 Mittelamerika 2 9,0 8,5 3 15 Sdamerika 3 4,7 5,5 1 11 Nordafrika 1 - - 0 0 Sdafrika 3 3,0 2,7 1 6 Nordeuropa 4 7,3 7,9 0 15 Westeuropa 11 9,0 7,2 0 21 Osteuropa 6 3,8 3,4 0 10 Ostasien 3 0,3 0,6 0 1 Australien/Ozeanien 3 7,3 6,7 0 13 Gesamt 38 5,8 6,0 0 21
Quelldaten: Tab. 1.
26 Danach sinken die Zahlen, weil die Legislaturperioden in den meisten Staaten krzer waren als 60 Monate.
-
1.2 Verfassungsnderungen im empirischen berblick 25
Die bisher genannten Zahlenwerte verraten noch nichts ber die jeweiligen verfassungspo-litischen Inhalte. Wichtig ist es aber, auch ein Grundverstndnis dafr zu erlangen, womit sich Verfassungsnderungen in etablierten Demokratien berhaupt befassen, allein schon, um die vorliegenden wissenschaftlichen Einzelstudien und Diskussionen zu bestimmten Materien bzw. einzelnen nderungen in ihrer empirischen Relevanz einordnen zu knnen. Zu diesem Zweck systematisiert Tab. 3, wieviele Verfassungsnderungen jeweils bestimm-te Kernbereiche antasteten. Ein als Einfhrung und berblick gedachter Vergleich dieser Grenordnung muss sich auf die Prfung bestimmter, hier thematisch-funktioneller27 Kernbereiche beschrnken. Von den wichtigsten gesamtsystemisch relevanten Regelungs-bereichen von Verfassungen bercksichtigt die bersicht in Tab. 3: das Regierungssystem, d.h. Kompetenzen, Verpflichtungen, Ttigkeitsregelungen (ex-
klusive Abstimmungsregeln) betreffend die zentralen politischen Organe, die Regelungen zur Personalrekrutierung, zu Wahlen und Abstimmungen (Referenden,
Abwahl, Quoren) und zur Mitsprache von Parteien auf nationaler Ebene28 sowie das Verhltnis zwischen Zentralstaat und territorialen Einheiten einschlielich Rege-
lungen betreffend die territorialen Einheiten (Grenzen, Regionalwahlen).29 Die Grundrechtsproblematik wird aufgrund der bereits erwhnten unterschiedlichen verfas-sungsrechtlichen Rahmenbedingungen und des erheblichen, aber schwer berschaubaren Einflusses impliziten Verfassungswandels, darunter einfachgesetzlicher und internationaler Regelungen, ausgeklammert. Da Verfassungsnderungen gleichzeitig mehrere Themenbe-reiche berhren knnen, ergibt die Summe der in Tab. 3 thematisch differenzierten Modifi-kationen nicht automatisch die Anzahl der Verfassungsnderungen in einem Staat.
Immer wieder wird in der Literatur postuliert, dass aufgrund des hohen Beharrungs-vermgens etablierter Regierungssysteme deren nderung wenig wahrscheinlich ist (u.a. Bryde 1982: 136-8). Tab. 3 sttzt diese Annahme nicht: Die deutliche Mehrzahl der erfass-ten Verfassungsnderungen berhrte den machtsensiblen Bereich des Regierungssystems. Nur drei der 31 Staaten, die innerhalb der beobachteten zehn Jahre ihre Verfassungen n-derten, lieen das Regierungssystem dabei auen vor Jamaika, Kanada und Namibia. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Verfassungen neben dem politisch-institutionellen Gefge und den wesentlichen Strukturprinzipien hufig mehr Belange re-geln, was sich auch an ihrem Umfang zeigt (Kapitel 2.2). Dass nun der berwiegende Teil der Verfassungsnderungen den Kern vom Kern antastete, verdeutlicht die Notwendig-keit intensiverer politikwissenschaftlicher Forschung, selbst wenn fast nie Fundamentalre-formen durchgefhrt wurden, sondern die meisten Verfassungsnderungen sich auf die Modifikation einzelner Regelungen richten.
27 Je nach Zielrichtung der Systematik sind andere Unterteilungen mglich, etwa nach Arten von Normen:
Verfassungsprinzipien, Staatszielbestimmungen und Staatsaufgaben; Verfassungsauftrge; Grundrechtsge-whrleistungen und Organisationsnormen (Glaener 1999: 136) oder Verfassungsnderungen, die auf Effi-zienzprobleme des politisch-institutionellen Systems reagieren bzw. die auf die Steigerung der Regierungs-effektivitt zielen oder solche, die Inklusionsprobleme zu lsen suchen (Schultze 1997: 515).
28 Im Folgenden pragmatisch-kurz als Reprsentation bezeichnet. 29 Trifft der Staat politische Regelungen fr die Regionen und formuliert damit zentral deren Kompetenzen
und Abhngigkeiten, so berhrt dies grundstzlich das Verhltnis zwischen nationaler Ebene und diesen Gebieten.
-
26 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
Tabelle 3: Hufigkeit der nderung von Verfassungskernbereichen, 1993-2002 Hufigkeit der thematischen Betroffenheit
Staat Anzahl der Verfas-sungsnderungen Regierungs- system
Reprsen-tation
Verhltnis nationale Ebene territoriale Einheiten
Australien 0 0 0 0 Belgien 19 11 4 6 Benin 0 0 0 0 Bolivien 1 1 1 1 Botsuana 2 1 2 0 Bulgarien 0 0 0 0 Chile 11 5 4 2 Costa Rica 15 4 5 2 Dnemark 0 0 0 0 Deutschland 13 9 2 8 Finnland (1919) 16 12 7 2 Finnland (2000) 0 0 0 0 Frankreich 9 5 3 1 Griechenland 1 1 1 1 Grobritannien Ja ja ja Ja Irland 9 5 0 1 Italien 7 4 5 2 Jamaika 3 0 2 0 Japan 0 0 0 0 Kanada 7 0 1 7 Litauen 3 1 0 3 Mauritius 6 3 3 0 Mongolei 1 1 1 0 Namibia 1 0 1 0 Neuseeland 13 3 11 0 Niederlande 6 6 1 1 Norwegen 2 1 1 0 sterreich 21 20 5 10 Polen (1992) 4 4 3 1 Polen (1997) 0 0 0 0 Portugal 2 2 2 2 Schweden 11 9 4 0 Schweiz (1848) 14 3 2 5 Schweiz (2000) 5 5 1 3 Slowenien 2 1 2 0 Spanien 0 0 0 0 Sdkorea 0 0 0 0 Tschechien 5 4 3 1 Ungarn 10 8 7 2 Uruguay 2 1 1 1 USA 0 0 0 0 Alle 39 Staaten 226 130* 85* 62* * Ohne Angaben zu Grobritannien und Papua-Neuguinea. Quelldaten: GLIN o.J., Tschentscher o.J., T.C. Williams SoL o.J.; eigene Recherchen.
-
1.2 Verfassungsnderungen im empirischen berblick 27
Am zweithufigsten von den drei geprften Kernbereichen wurden Reprsentations-, Per-sonalrekrutierungs- und Abstimmungsmodalitten auf nationaler Ebene gendert durch mehr als 35 Prozent der von 1993 bis 2002 in Kraft getretenen Verfassungsnderungen. Am aktivsten zeigten sich Neuseeland, wo sich nahezu alle der 13 konstitutionellen Modifikati-onen auf Wahlen und Referenden bezogen, sowie Finnland und Ungarn. Zwar variierte die Zahl der Eingriffe in diesen Bereich stark, doch nur drei Demokratien mit Verfassungsn-derungen innerhalb der zehn Jahre tasteten ihn nicht an. Offenbar unterliegen Reprsentati-onsbelange einem erhhten Neuregelungsdruck oder ihre nderung ist fr die politischen Akteure besonders interessant. Die teils beobachtete Neigung zu mehr Proportionalitt zwischen Stimmen und Mandaten in Legislativwahlen und zur Einfhrung der Direktwahl der Exekutivchefs (Colomer 2001: 235, 243; Lijphart 1994: 53, 1999) lsst sich dabei in Bezug auf Verfassungsnderungen nicht eindeutig besttigen, denn die inhaltliche Spann-breite der nderungen war sehr gro. Nicht selten ging es um Abstimmungsquoren, spezi-fische Mehrheitsvoten in bestimmten Entscheidungssituationen, um Fristen, die Zulassung oder Nichtzulassung von Mandatsberschneidungen oder zumeist im Vorfeld von Prsi-dentschaftswahlen und oft umstritten weiterer Amtszeiten fr eine Person.
In etablierten Demokratien wird darber hinaus das Verhltnis zwischen nationaler Ebene und territorialen Einheiten durchaus hufig neu reguliert: Mehr als jede vierte beo-bachtete Verfassungsnderung im Untersuchungszeitraum tangierte diesen Komplex. Al-lerdings zeigt sich die Besonderheit, dass dieses Verhltnis in einigen Staaten mehrfach institutionell gendert wurde, whrend in immerhin 17 Staaten und damit mehr als der Hlfte der Flle keinerlei Modifikationen stattfanden. sterreich, Deutschland, Schweiz und Kanada sind die Spitzenreiter, was kaum verwundert, da es sich um fderale Staaten handelt, in denen ein Eingriff in das Regierungssystem oft automatisch das Verhltnis zwi-schen Zentrum und Territorialeinheiten berhrt. Allerdings waren die kanadischen Verfas-sungsnderungen, die zwischen 1993 und 2002 smtlichst mehr Autonomierechte fr be-stimmte Gebiete bzw. Provinzen bewirkten, nicht durch diesen Automatismus zu erklren, sondern wurden spezifisch initiiert.
Ein genereller Trend zur Dezentralisierung, wie er bisweilen unterstellt wird, lsst sich aus den Verfassungsnderungen zwischen 1993 und 2002 nicht ablesen. Flle wie Italien, wo eine politisch signifikante Verfassungsnderung den Regionen mehr Entscheidungs-mglichkeiten innerhalb eines vorgegebenen Rahmens liefert, oder die britische Devoluti-on, die (formal rckholbare) bertragung von Kompetenzen auf neu geschaffene staatliche Institutionen in Schottland, Wales, Nordirland, London und den englischen Regionen, fal-len zwar ebenso ins Auge wie die Fderalisierung Belgiens, doch bei nherer Betrachtung unterscheidet sich der Umgang mit den territorialen Einheiten erheblich, nicht zuletzt auf-grund unterschiedlicher Zielvorstellungen und Argumentationen der Beteiligten in den einzelnen Lndern (vgl. De Vries 2000; Mller/Wright 1994: 8). Viele Verfassungsnde-rungen zum Verhltnis zwischen Zentrum und Territorialeinheiten sind inhaltlich unspek-takulr, und in beinahe der Hlfte der Demokratien gab es keine expliziten Verfassungsn-derungen in diesen Fragen.
-
28 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
1.3 Erklrungsanstze fr Verfassungsnderungen im berblick Die Anzahl und Reichweite von Verfassungsnderungen in etablierten Demokratien sowie ihre thematische Ausrichtung belegen ganz deutlich, dass die Ewigkeit oder Konstanz von Verfassungen (Goodin 1996: 1-53; Finn 1991: 4; Saj 1994: 336) allenfalls ein ideal-typisches, in der Realitt aber kaum beobachtbares konstitutionalistisches Prinzip ist. Die Beharrungskraft von Institutionen wird allgemein oft berschtzt (Seibel 2003: 224f.; Co-lomer 2001: 236), die von Verfassungen offensichtlich besonders. Das ist den Verfassungs-theorien anzumerken und zeigt sich in der sprlichen vergleichenden politikwissenschaftli-chen Forschung zu Verfassungsnderungen (Busch 1999; Benz 1993; Schultze 1997; Grimm 1978, 1994; Bellamy/Castiglione 1996), die ihrerseits zur Fortexistenz berkom-mener Verfassungsvorstellungen beitrgt.30
Wer eine theoretisch angeleitete empirische Forschung anstrebt, ist mit dem Problem konfrontiert, dass die im engeren Sinne verfassungstheoretische Forschung hinsichtlich expliziter Verfassungsnderungen eine derartige Abstraktionshhe und Empirieferne auf-weist, dass sie kaum forschungsleitend genutzt werden kann. Hinzu kommt, dass viele Arbeiten trotz des Anspruchs auf Allgemeingltigkeit stark in bestimmten Fllen und ihrem jeweiligen (politischen, kulturellen, historischen) Kontext verwurzelt sind (bspw. Levinson 1995a). Die Verfassungstheorie gibt es in Bezug auf Verfassungsnderungen in etablier-ten Demokratien daher nicht, sondern nur ein Puzzle oft vager Annahmen, Reflexionen ber bestimmte Verfassungsfragen vor dem Hintergrund spezifischer historischer bzw. nationaler Entwicklungen oder Behauptungen, die dem empirischen Vergleichstest entwe-der nicht standhalten oder sich einem solchen Test aufgrund der erwhnten Abstraktions-hhe entziehen. Einheitliche Ordnungsbegriffe, Typologien, Leitgedanken oder Theoriege-bude zum Verfassungswandel brachte bislang weder die Politik- noch die Rechtswissen-schaft hervor (Grimm 1994: 316; Vokuhle 2004: 458).
Die durchaus zahlreichen empirischen Arbeiten stehen ihrerseits oft noch unverbunden nebeneinander. Viele Untersuchungen sind rechtswissenschaftlicher Natur und beschrnken sich auf die Textinterpretation, bestimmte Problemflle oder die formale Rechtsentwick-lung. Dies verstrkte den Eindruck von Verfassungspolitik als statisch, trocken und lega-listisch, wohingegen die Politikwissenschaft sich eher fr den allgemeinen soziokonomi-schen Rahmen von Verfassungen selbst interessierte (Bogdanor 1988a: 1). Die Zahl ber-regional und systematisch vergleichender politikwissenschaftlicher Analysen ist unabhn-gig von der verfolgten Fragestellung sehr berschaubar (u.a. Kaiser 2002; Lutz 1995). In jngerer Zeit wurden die Effekte der in Verfassungen festgeschriebenen Institutionenmo-delle (Sartori 1994; Lane/Mland 2000; Congleton/Swedenborg 2006), die symbolisch-kulturelle Wirkung von Verfassungen (Vorlnder 2002b, Ghler 1997), die Geltung und Wirksamkeit des Rechts auf globaler Ebene (HUB o.J.), die Verfassungsgebung in Um-bruchsituationen und die EU-Verfassungsdiskussion thematisiert, doch richten sich diese Forschungsarbeiten nicht auf die bergreifende Erklrung von Verfassungsnderungen in etablierten Demokratien auf nationaler Ebene (vgl. Kaiser 2002; Busch 1999).
Insofern finden sich Erklrungen fr Verfassungswandel oft nur am Rande von Arbei-ten oder sind indirekt aus den Anstzen ableitbar. Im Folgenden werden die in der politik-wissenschaftlichen Literatur gngigen Erklrungsvarianten systematisiert und auf ihre Er- 30 Fr einen berblick ber die Literatur zum Konstitutionalismus und zur Verfassungspolitik siehe u.a. Bu-
facchi 1995; CEPC 2003.
-
1.3 Erklrungsanstze fr Verfassungsnderungen im berblick 29
giebigkeit in bezug auf die in der Studie verfolgten Interessen abgetastet, um auf diese Weise die Auswahl des konkreten Untersuchungsansatzes vorzubereiten. Dabei lassen sich die Anstze wie die Beitrge zum politisch-institutionellen Wandel insgesamt in institutio-nalistische, kulturalistische, historisch-soziologische sowie konomische Anstze untertei-len (Tab. 4). Tabelle 4: Anstze zur Erklrung von Verfassungsnderungen im Vergleich
Institutionalismus Kulturalistische Anstze Historisch-soziologische Anstze
konomische, Rational-choice-Anstze*
Verfassungsverstndnis Dokument, das als Verfassung angese-hen wird
Basis der gemeinschaftli-chen Identitt und Selbstver-stndigung
Grund- und Rechtsord-nung des Staates
Spielregeln als Risiko-versicherung und Pla-nungsbasis
Art der Verfassungsnderung inkremental bis revolutionr, impli-zit und explizit
inkremental, implizit und explizit
inkremental, explizit tendenziell inkremental, explizit
Erklrende Variablen fr Verfassungsnderungen Merkmale der Verfassung selbst (nderungshrde, Umfang, Alter u..)
Verfassungsdefizite, auf-kommende Konkurrenz-interpretationen, Kulturwan-del der Verfassungsgemein-schaft; Schutz vor ber-fremdung
historischer Wandel, Funktions-, Legitimati-onsdefizite der Verfas-sung, normgeleitete Eli-ten, gesellschaftliche Konflikte/Krisen
Handeln interessenge-leiteter, nutzenmaximie-render Akteure
Zeithorizont der Erklrung kurz- bis langfristig Langfristig langfristig kurzfristig
Empirische Testbarkeit gut Beschrnkt beschrnkt beschrnkt bis gut
Besondere Erklrungsstrke in bezug auf Effekte von Verfas-sungsregeln
Verfassungsunterschiede zwischen Staaten, Kontinui-tt bestimmter Verfassungs-elemente
Besonderheiten einzel-ner verfassungspoliti-scher Prozesse, Einbet-tung in Kontext
Sinn der Selbstbeschrn-kung von Akteuren
Beispiele Sartori 1994; Lutz 1995
Vorlnder 2002a; Gebhardt 2001; Brodocz 2003
Grimm 1994; Schultze 1997c; Banting/Simeon 1985
Buchanan/Tullock 1962; Elster 1993b; Voigt 2001; Congleton/Swedenborg 2006
* teils berschneidung mit dem institutionalistischen Ansatz Der traditionelle Institutionalismus erklrt Verfassungsnderungen vor allem mittels tech-nischer Eigenheiten der Verfassungen selbst, so mithilfe der nderungshrde, des Um-fangs, ihres Alters (Lutz 1995; Bryde 1982) oder mithilfe der Gte oder Passfhigkeit der in ihnen verankerten Problemlsungsmechanismen (Sartori 1994). Er neigt daher zur Ent-personalisierung und Entkontextualisierung von Verfassungspolitik. Zeitpunkte, Inhalte und Grnde konstitutionellen Wandels bleiben weitgehend im Dunkeln. Eine Spielart die-ses Ansatzes, das constitutional engineering, unterstellt zumindest implizit, es gbe beste institutionelle Lsungen. Seine Vertreter bewerten Verfassungsnderungen tendenziell als durch bestimmte Defizite ausgelste, stabilittsgefhrdende Flickschusterei (z.B. Sartori 1994: 199) oder im Idealfall als berwindung technischer oder normativer Defizite. Der Institutionalismus bringt gerade in Kombination mit dem Ansatz des rationalen Akteurs relativ klare Hypothesen zum Verfassungsnderungsverhalten hervor, die allerdings selten
-
30 1 Verfassungsnderungen ein erster Zugang
systematisch geprft wurden. Falls ja, dann sind enttuschende Befunde nicht auszuschlie-en (Kapitel 2.2; Lorenz 2005; Lorenz/Seemann 2007). Teils wie bei der Qualitt von Verfassungsnderungen entziehen sich die Hypothesen aufgrund eines noch weitgehend fehlenden methodischen Instrumentariums einem monochronen oder polychronen Ver-gleich vieler Flle. Hier besteht ein ausgeprgter Forschungsbedarf.
Whrend der traditionelle Institutionalismus sowohl mit der Annahme verknpft wurde, dass die Prferenzen von Akteuren durch die Institutionen geprgt sind, als auch damit, dass sie unabhngig von diesen bestehen und lediglich ihre Vermittlung untereinander den Zwn-gen institutioneller Settings unterliegt, stellen kulturalistische Anstze ganz klar die Prge-kraft der Verfassung heraus. Sie beeinflusse in Form einer historisch verwurzelten Traditi-on von Theorie und Praxis, einer sich entwickelnden Sprache der Politik die individuelle Prferenzbildung, und ber sie erlange die Verfassungsgemeinschaft eine nationale Identitt (Ackerman 1989: 477). Formen vermittelter Reprsentanz und direkter Vergegenwrti-gung oder prsenzkulturelle Formen, so das Erleben von Konstitutionsfesten und die Verkrperung der Verfassung durch die Richter der Verfassungsgerichte heben, so Vorln-der (2002: 21), die Historizitt der Verfassung, die Differenz von Vergangenheit und Ge-genwart, in Kontinuittskonstruktionen auf. Die Gesellschaft verhandle und interpretiere flieend und tendenziell unabgeschlossen normative Ordnungsvorstellungen in den hermeneutischen Kontexten der jeweiligen politischen Kultur, den Deutungskulturen von Medien, Eliten und ffentlichkeiten wie in den Kulturen der sozialen Lebenswelten (ebd.: 22). Anlsse fr Verfassungswandel und konkret Verfassungsnderungen sind gem dieser Forschungsrichtung die inhaltliche Unbestimmtheit oder Interpretationsspannungen der Texte selbst, aufkommende Konkurrenzinterpretationen bzw. Kulturwandel aufgrund gen-derter historischer, gesellschaftlicher und konomischer Rahmenbedingungen, aber auch der wahrgenommene Bedarf an Bewahrung von Kulturtraditionen angesichts solcher Kontext-vernderungen (Vorlnder 2002a: 22f.; Sommermann 2006).
Allerdings bleibt angesichts eines als permanent anzunehmenden Wandels der Um-stnde offen, wann er eine nderungsinduzierende Qualitt erreicht oder wie dies dann in eine tatschliche, konkrete Verfassungsformulierung bersetzt wird, leiten sich doch aus allgemeinen kulturellen Affinitten oder traditionellen Deutungsmustern nicht konkrete Formulierungen oder Kompromisse ab. Unterschiede zwischen ideengeschichtlichen Tradi-tionen, beispielsweise zwischen der rousseaugeprgten und der US-amerikanischen Kon-zeption von Souvernitit (Offe/Preu 1991), fallen zwar ins Auge, doch besteht stets die Mglichkeit ihres Abbruchs oder ihrer Vernderung. Letztlich bleibt die Verfassungspolitik (relativ) autonom in der Fortschreibung konstitutioneller Traditionen und der Neustruktu-rierung der Handlungsstrukturen (Lietzmann 2002: 292).31 Das zentrale Problem der kultu-ralistischen Anstze besteht aber darin, dass sie verfassungspolitische Verhaltens- und Pr-ferenzunterschiede von Akteuren innerhalb einer Verfassungsgemeinschaft nur unzurei-
31 So fhrt die personelle Nicht-Reprsentation bestimmter gesellschaftlicher Gruppen heute nationenbergrei-
fend selten zur systematischen Exklusion ihrer Interessen aus der Politik (Hoffmann-Lange 1992: 178 ff., Kielhorn 2002: 18), was nicht nur als Verbreitung einer Norm gelten, sondern auch zweckrational erklrbar sein kann: Eine verstrkte Inklusion gesellschaftlicher Gruppen zwar die internen Kosten, andererseits pro-duziert auch ihre Exklusion Risiken, insbesondere wenn sie von einer Entscheidung direkt betroffen sind (Sartori 1992). Verfassungstraditionen knnen auch nur zu Nuancenunterschieden der Politik fhren, wenn beispielsweise eine Konsenskultur dazu beitrgt, dass ein strkerer Akteur entgegen der rationalistischen Vermutung eine Ausdehnung der Mitspracherechte initiiert oder befrwortet, aber nur unter der Vorausset-zung, dass sein Machtvorsprung weiterhin deutlich abgebildet erscheint (Brzel/Risse 2000).
-
1.3 Erklrungsanstze fr Verfassungsnderungen im berblick 31
chend erklren oder sichtbar machen. Insgesamt bestehen ihr Anspruch und ihre Strke besonders darin, konstitutionelle Stabilitt und Traditionslinien trotz konfligierender Inte-ressen und sich wandelnder Rahmenbedingungen sowie nationale Charakteristika der ver-fassungspolitischen Inhalte oder der Einstellung zur Verfassung zu erklren (z.B. Gebhardt 1999). Sie tragen aber nicht so sehr zur Beantwortung der konkreten Leitfragen der vorlie-genden Studie bei.
Die am strksten verbreiteten historisch-soziologischen Anstze verstehen die Verfas-sung allgemein als Grund- und Rechtsordnung des Staates. Sie betonen die Spezifika des jeweiligen Falles und insbesondere der Entstehungssituation der Verfassung, bleiben oft lnderverhaftet und bewerten nderungen entweder als Nachholprozesse, Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel, Ausdruck politischer oder gesellschaftlicher Konflikte, Ausfl-lung von Verfassungslcken (Banting/Simeon 1985; Levinson 1995b; Loewenstein 1961: 21; Bryde 1982: 120; Grimm 1994: 376) oder als Abbau der ursprnglich intendierten Ver-fassungsordnung aufgrund von politischen Krisen bzw. durch gezieltes Einwirken politischer Krfte (Finn 1991; fr Deutschland Seifert 1977: 30 ff.; Abendroth 1974: 143; Stuby 1974: 20). Diese Erklrungen neigen im Falle der historischen Anstze zu einer elitenorientierten Herangehensweise, im Falle der soziologischen Anstze zu einem nahezu entpersonalisierten Schluss von strukturellen Rahmenbedingungen auf den Wandel des Verfassungsdokumen-tes. berlappungen der kulturalistischen und der historisch-soziologischen Herangehenswei-se finden sich v.a. in den neueren Arbeiten zur europischen Verfassungsdebatte unter dem Stichwort (Sozial-)Konstruktivismus, der zu erfassen sucht, dass normorientierte und sinnsuchende Akteure zu gemeinsamen neuen Deutungen und Normen gelangen, diese konstruieren, gleichzeitig aber auch durch die einmal konstruierten Normen beeinflusst sind (Wagner 1999).
Im Gegensatz zu den institutionalistischen Anstzen sind historisch-soziologische Ar-beiten auf Multivariabilitt angelegt. Die Verfassung, andere Institutionen und Rahmenbe-dingungen beeinflussen hier die Entstehung kollektiver Akteure und die Herausbildung von Prferenzen, aber die Akteure sind selbst dazu fhig, ihre Umwelt zu verndern. hnlich den kulturalistischen Anstzen kommen historisch-soziologische oft zu plausibel scheinen-den, aber so allgemeinen Aussagen