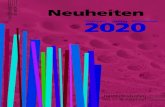Verum 07
-
Upload
jochen-dersch -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Verum 07
\�\
verumNr. 7 Oktober 2013
Magazin für Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft
MutDie Ritter von heute sind Whistleblower und BürgerrechtlerDie Ritter von heute sind Whistleblower und Bürgerrechtler
\�\
In den Nachkriegstrümmern Hamburgs florieren Schwarzmarkt und Korruption. Babette will leben, endlich wieder. Doch im Sommer 1951 begegnet sie dem Mörder ihres Mannes, der sich als Held des Wirtschaftswunders feiern lässt. Seine schwarze Uniform hat er im KZ Bergen-Belsen an den Nagel gehängt. Das geraubte Vermögen, Hamburgs Richter und das Schweigen der Mitläufer schützen ihn. Mit Witz und Chuzpe beginnt Babette, ihren Todfeind einzukreisen. Als rassisch Verfemte ist aus der behüteten Bankierstochter eine starke Frau geworden.
Wolf LevienDie Passion der Babette308 Seiten mit zahlreichen AbbildungenBoD 2013ISBN 978 3848 227 129Paperback EUR 19,90als eBook EUR 9,99
\�\
In den Nachkriegstrümmern Hamburgs florieren Schwarzmarkt und Korruption. Babette will leben, endlich wieder. Doch im Sommer 1951 begegnet sie dem Mörder ihres Mannes, der sich als Held des Wirtschaftswunders feiern lässt. Seine schwarze Uniform hat er im KZ Bergen-Belsen an den Nagel gehängt. Das geraubte Vermögen, Hamburgs Richter und das Schweigen der Mitläufer schützen ihn. Mit Witz und Chuzpe beginnt Babette, ihren Todfeind einzukreisen. Als rassisch Verfemte ist aus der behüteten Bankierstochter eine starke Frau geworden.
Wolf LevienDie Passion der Babette308 Seiten mit zahlreichen AbbildungenBoD 2013ISBN 978 3848 227 129Paperback EUR 19,90als eBook EUR 9,99
Titel: Seid mutig!Wer steht heute noch für seine Sache ein?
Facebook macht unglücklichDie Schattenseiten der „social networks“ im Internet
Post: Besuchen Sie DüppelOffener Brief der Redaktion an Bundespräsident Joachim Gauck
Waren es die Wikinger?Linguisten glauben, das Englische habe sich aus dem Norwegischen entwickelt
„Packt eure Sachen!“Die Pariser Gerontokraten bekommen die Krise in Frank-reich nicht in den Griff
Kritik unerwünschtUnion und SPD werden die Steuern erhöhen
Kunst: Aus dem Schleppnetz der WeltDer Düsseldorfer Maler Julien Deiss
verum erscheint am jeweils ersten Donnerstag eines Monats. Wir freuen uns über Leserbriefe, am liebsten per eMail an: [email protected]. Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernehmen wir keine Haftung.
verum-magazin verlagPlanckstraße 13D-22765 HamburgTel. +49.40.28492860Fax +49.3212.5337724V.i.S.d.P.: Jochen Dersch,Dr. Franz WauschkuhnLayout: Monika van der Meulen
Unsere Anzeigenpreisliste erhalten Sie gern auf Anfrage; bitte kurze eMail an: [email protected]
Impressum
I
NHALT
Seite 30
Seite 4
Seite 10
Seite 12
Seite 18
Seite 26
Seite 36
„Zwischen Hochmut und Demut steht ein drittes,dem das Leben gehört, und das ist der Mut.“
Theodor Fontane (1819 - 1898)
ZItat
\�\
Ohne herrscht Langeweile...
...und mit werden wir unglücklich
Tragen Facebook, Twitter und Instagram die Bezeichnung „social networks“ wirklich zu Recht? Neuesten Studen zufolge nicht. Denn auch wenn die meisten User dieser Netzwerke sie gerade deshalb nutzen, um Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, also aktiv am sozialen Leben teilzunehmen, tritt der gegenteilige Effekt ein: Sie werden einsam und unglücklich.
Selbst fest gefügte Beziehungen können durch social net-works gestört werden. Foto: photaki/wavebush
\�\
jed - Fünf Nachrichten über Fa-cebook schickte der Psychologe Ethan Kross (University of Michi-gan, Ann Arbor, USA) täglich an 82 zufällig ausgewählte Personen aller Altersgruppen. Er fragte sie nach ihrem allgemeinen Befinden, ob sie sich einsam fühlten, ob sie Sorgen hätten, worüber sie sich freuten und wie oft sie in (virtuellen) Kon-takt zu anderen träten. Nach zwei Wochen schon zog er die Reißlei-ne: Je häufiger die Teilnehmer mit anderen Facebook-„Freunden“ zwischen zwei Mails von Kross in-teragierten, desto unzufriedener wurden sie, und am Ende fühlte sich die große Mehrheit der Probanden bereits nach dieser kurzen Zeit einsamer und unglücklicher als vor der Testreihe.
Kross‘ Ergebnisse bestätigen, was eine der ersten Untersuchungen er-geben hatte: Schon 1998 veröffent-liche Robert Kraut von der Carne-gie Mellon University in Pittsburgh
(USA) seine Studie; seine Ergeb-nisse bezogen sich aufs Internet all-gemein und er kam zu dem Schluss: Je häufiger sie das Web nutzen, de-sto einsamer und depressiver füh-len sich die Menschen.
Die Gründe für dieses erstaun-liche Phänomen sind noch nicht gänzlich erforscht. Immerhin steht inzwischen fest, dass die Nutzer dieser „social networks“ ein ziem-lich genaues Abbild der ganzen Ge-sellschaft eines Landes darstellen: Sie sind weder einsamer noch un-glücklicher als ihre Mitmenschen - allerdings nur am Anfang ihrer neu-en Art der Freizeitbeschäftigung. Eine 2010 veröffentlichte Metastu-die, die 40 Einzel-Untersuchungen auswertete, beschreibt einen fa-talen Trend: Fleißige Internetnutzer, besonders Mitglieder jener „social networks“, leiden zunehmend un-ter Entfremdung. Sie kommen im-mer weniger mit dem realen Leben klar. Besonders beunruhigend ist
das schier unglaubliche Ergebnis eines Experiments: Probanden, die sich in einem Zustand der Traurig-keit befanden, suchten immer häu-figer Trost bei Fotos auf Facebook und Co. Zunächst bei den Bildern und Profilen ihrer Partner, dann bei denen all ihrer „Freunde“. Das half ihnen mehr als die Anwesenheit und das Händchenhalten mit dem realen Partner!
Das mag mit der aufkommenden Eifersucht zu tun haben, die den jeweils Facebook verweigernden Part einer Beziehung ergreift. Bei besonders eifrigen Facebook-Fans
Als Haustier-Sitter ist das Internet ohnehin ungeeignet. Foto: Lizenz GNU
\�\
kann das sogar zu einer echten Bezeihungskrise führen, ergab eine drei Jahre alte Untersuchung. So-gar beim FB-Nutzer selbst kommt häufig Neid auf. Hanna Krasnova, Wirtschaftsinformatikerin an der Humboldt-Universität Berlin, hat
in Studien festgestellt: Je mehr Zeit ein Facebook-Mitglied auf der Seite dieses Netzwerks verbringt, desto neidischer wird es auf viele andere, die es dort trifft. Ursache: Man ver-gleicht seinen eigenen Lebenslauf und Aktivitäten mit denen der ande-
ren und fühlt sich ihnen gegenüber minderwertig, obwohl niemand die dortigen Angaben überprüfen kann. Es geht vielen Nutzern, wie im rich-tigen Leben auch, oftmals mehr um den schönen Schein denn um das wahre Sein. So kehrt sich nach Er-
International ja, verbindend nein: Fa-cebook schürt Neid.
Foto: Lizenz GNU
\�\
kenntnissen der Psychologin Beth Anderson, University of London, der Effekt, den wir uns beim Eintritt in die Facebook-Gemeinschaft er-hoffen, nämlich mehr über andere zu erfahren uns sie über uns wissen zu lassen, um in Neid, Eifersucht und Ablehnung.
Die Erkenntnisse von „social network“-Forschern wie Sebastian Valenzuela (Katholische Unversität in Santiago de Chile) und Matthew Lieberman (University of Califor-nia, Los Angeles, USA) klingen da wie Hohn: Sie glauben, Facebook mache glücklich. Ihren Umfragen zu-folge stieg sogar das Vertrauen der User in die allgemeine Gesellschaft; letztlich – so bestätigten ihnen die Befragten – wuchs durch die Inter-aktion mit anderen FB-Fans ihr In-teresse an der Politik.
Damit sind sie aber auch die Ein-zigen mit dieser Meinung. Interes-santer - und glaubwürdiger - klingt da Liebermans These, soziale Netz-werke im Internet hätten bei eifrigen Nutzern bereits die Wahrnehmung der Realität stark verändert: Schon bevor wir etwas auf Facebook & Co. mit anderen teilen, reklektieren wir, welchen Effekt das auf die mehr oder weniger zahlreichen Anderen („Freunde“) hat. Umgekehrt sei es genauso: Noch beim Lesen der Po-stings unserer Facebook-Partner denken wir darüber nach, ob wir es weitergeben sollen oder nicht und welchen Stellenwert uns das in der „Community“ bescheren könnte.
Warum ernst zu nehmende Stu-dien zu solch unterschiedlichen Er-
gebnissen kommen, versucht der Sozialpsychologe Samuel Gosling zu erklären: Es hänge schlicht davon ab, ob und wie aktiv ein Nutzer der „social networks“ sei: Reine Konsu-menten der Postings von anderen würden immer unglücklicher, aktiv Mitteilende erlebten die positiven Seiten des Netzwerks, sie fühlen sich als Teil einer sozialen Gemein-schaft. In einem (nicht auf die All-gemeinheit übertragbaren, weil mit nur einer sehr geringen Anzahl von
Studnten durchgeführten) Experi-ment an der Universität von Mis-souri bestätigt dies. Je vier Elek-troden über und unter den Augen der Probanden angebracht zeigten freudige Gesichtszüge bei aktiven Nutzern, eher traurige bei reinen Konsumenten. Diese Art der „Ge-sichtselektromyographie“ gilt den-noch als recht zuverlässig bei der Beurteilung des Gemütszustands einer Testperson.
Sollen wir also uns alle bei einem
Längst sind Netzwerke auch mobil verfügbar - durchaus ein Vorteil Foto: photaki/SVLuma
\�\
„social network“ anmelden und täglich stundenlang in die Tasten fliegen, damit wir uns - besonders als Teil einer Gemeinschaft - wohl-fühlen? Besser nicht! Schon heute haben sich Millionen Menschen, darunter die meisten Jugendlichen und junge Erwachsene, daran ge-wöhnt, stets und ständig online mit anderen verbunden zu sein. Dazu braucht man sich nur beim Einkau-fen oder der Fahrt in der U-Bahn umzusehen: Im Gehen, Sitzen, Lie-
gen sieht man die Gesichter seiner Mitmenschen über die Mini-Bild-schirme ihrer Smartphones ge-beugt, tippend, lesend, antwortend. In einer zurzeit noch laufenden Studie hat der Psychologe Timothy Dalton (Universität von Virginia in Charlottesville) bei seinen eigenen Studente festgestellt, dass sie „cra-zy“ werden, sobald sie länger als eine halbe Stunde auf ihr iPhone oder Tablet verzichten sollen. Sein Fazit: „Es ist Langeweile, die sich
dann breitmacht. So gesehen ist Fa-cebook nicht das Problem, sondern das Symptom.“
Längst sind Netzwerke auch mobil verfügbar - durchaus ein Vorteil Foto: photaki/SVLuma
\�0\
Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
mit großer Bewunderung und innerer Freude haben wir Ihren Staatsbesuch in Frankreich beobachtet. Mit Ihrem menschlichem Einfühlungsvermögen, ihren Gesten, Klugheit und Charme haben Sie selbst Menschen gewonnen, die der französisch-deutschen Freundschaft bislang noch mit größter Skepsis bege-gnet waren. Wir kennen viele davon. Sogar die Kommentatoren der Zeitung „Le Monde“, deren liebstes Steckenpferd es war, die Schattenseiten Deutschlands hervorzuheben, zeigten sich nach Ihrem Besuch wie verwandelt.
So respektvoll und mitfühlend wie Sie sich im Angesicht des Kriegsverbrechens in Oradour-sur-Glane verhalten haben, haben Sie dem Miteinander beider Länder mehr gedient als alle Ihre Amtsvorgänger. Poli-tik kann sich nicht im Machiavellismus unserer Tage erschöpfen – auch wenn es die Nomenklatura in Ber-lin und Brüssel so sieht. Wollen wir wirklich die letzten Ressentiments ausräumen und die Gesellschaft links und rechts des Rheins zusammenschmieden, so brauchen wir auch Gesten und politische Symbolik – auf die sich Konrad Adenauer und Charles de Gaulle ohne Inszenierung ganz natürlich verstanden. Dies hat uns der amtierende, französische Ministerpräsident Jean-Marc Ayrault bestätigt.
Herr Bundespräsident, am 14. April kommenden Jahres jährt sich zum 150. Mal der Tag, an dem die Düp-peler Schanzen in Nordschleswig zur Schlachtbank Tausender Soldaten und zum Trauma Dänemarks und aller Bewohner des alten Herzogtums Schleswig wurden. Wir haben erfahren, Ihnen sei von Mitarbeitern Ihres Präsidialamts empfohlen worden, nicht an der Gedenkfeier in Düppel und Sonderborg teilzuneh-men.
Unseres Erachtens wäre dies ein schrecklicher Fehler. Denn die Menschen in Dänemark und ganz Skandi-
P\ O\ S\ T\
Unsere dänischen Nachbarn würden sich über den Besuch des Bundespräsidenten freuen - und über die Lösung des Fehmarn-Belt-Problems. Fotos: Lizenz GNU
\��\
navien werden gespannt beobachten, wie sich das wiedervereinte Deutschland verhalten wird. Gerade in Dänemark wächst die Skepsis gegenüber der neuen Führungsmacht in der EU enorm, denn in ihrer tägli-chen Praxis scheinen sich die Bundesministerien keinen Deut um die dänischen Belange zu kümmern.
Das ist keine Panikmache. Wer dänische Medien wahrnimmt, dem wird klar, dass sich erneut Groll an-häuft. Aber die Ministerialen in Berlin bemerken es nicht, weil Schleswig-Holstein völlig außerhalb ihres Blickfelds liegt. „Wir haben keine Lobby in Berlin“, titelte vor einer Woche die Flensburger Zeitung des marktbeherrschenden SHZ-Verlags. „Richtig“, sagten die Menschen zwischen Nord- und Ostsee.
Bundesverkehrsminister Ramsauer mag nicht einsehen, welch immenser, politischer Flurschaden in Däne-mark durch die bewusste Vernachlässigung der Infrastruktur des deutschen Landesteils Schleswig ange-richtet worden ist. Die Sperrung der Rader Hochbrücke für den Lkw-Verkehr von und nach Jütland trifft nicht nur die dänische, sondern auch die schwedische Exportindustrie bis ins Mark. Der Rendsburger Straßentunnel, der der Verwaltung des Nord-Ostsee-Kanals untersteht, ist total marode und die museale Eisenbahnbrücke kann moderne Containerzüge nicht tragen. Dass die dänische Regierung den Nordsee-hafen Esbjerg modernisiert und ausgebaut, kann niemanden verwundern.
Wenn Sie, Herr Bundespräsident, mit skandinavischen Manager(inne)n sprechen, wird sofort die jahr-zehntelange Vernachlässigung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) durch das Bundesverkehrsministerium das Thema sein. Denn der NOK ist für die skandinavische und baltische Wirtschaft der schnellste Weg zu den Weltmärkten. Allein, mit mehr als hundert Jahre alten, hölzernen Schleusentoren kann Container-schiffsverkehr, können Dutzende Feederdienste nicht gewährleistet werden. Seit 50 Jahren wird seitens der Bundesregierung die baldige Modernisierung und Verbreiterung des NOK besprochen. Doch es sind stets hohle Worte und Gesten geblieben, ebenso wie der fernsehgerechte Spatenstich Ramsauers für eine neue Schleusenkammer in Brunsbüttel.
„Was tut die Bundesregierung für die Straßen- und Schienenanbindung des geplanten Tunnels unter dem Fehmarn-Belt?“ fragen die Zeitungen in Kopenhagen, Oslo und Stockholm. Aus Berlin hören die Skandi-navier nur eine Kakophonie und Bundesminister Ramsauer schiebt die Schuld, dass es mit dem Schienen-ausbau nicht voran kommt, auf die Gemeinde „Timmendorf oder wie das da heißt“ (Interview-O-Ton). Das Echo auf diese zu Markt getragene Ignoranz war in der Holsteiner Bevölkerung verheerend. Offen-sichtlich begreifen auch die deutschen Naturschützer, die seit Jahren lauthals gegen die feste Verbindung von Fehmarn nach Lolland agitieren, in ihrer eindimensionalen Scheuklappensicht nicht, dass die Skandi-navier dies als gezielte Torpedierung ihrer Lebensinteressen deuten.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, wir alle wünschen uns, in einem geeinten, starken Europa zu leben. Dann aber ist es Pflicht aller Deutschen, auf ihre Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Die große Befürchtung vieler Menschen im Norden ist, dass das Bundesverwaltungsgericht die längst überfällige Vertiefung des Elbfahrwassers untersagen wird. Es wäre nicht nur der Tiefschlag gegen die norddeutsche Wirtschaft und Hunderttausende von Arbeitsplätzen, sondern auch eine Katastrophe für Skandinavien, weil Hamburg der Umschlagplatz für den Ostseeraum ist.
Die Rücksichtslosigkeit Deutschlands ist der beste Dünger für die Renaissance des Nationalismus in den Nachbarländern. Ansätze gibt es inzwischen leider viele in Skandinavien.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, reisen Sie bitte im kommenden Jahr nach Düppel. Die Europäer werden es Ihnen danken.
Mit freundlichem Gruß
Jochen Dersch und Dr. Franz Wauschkuhn
\��\
S\ P\ R\ A\ C\ H\ E\
Waren es die Wikinger?
Nicht aus dem Deutschen, aus dem Norwegischen soll
das Englischeentstanden sein
Zwei Linguisten rütteln an den Säulen der Anglistik: Nicht aus dem West-, sondern aus dem Nordgermanischen sei die heutige Inselsprache entstanden - man könnte auch sagen: nicht aus dem (Nieder-)Deutschen, sondern aus dem Norwegischen. Doch erstens ist diese These noch nicht bewiesen, und zweitens ist sie längst nicht so revolutionär, wie die beiden sie sehen.
\��\
Die wilden Nordmänner kommen: Ein unbekannter englischer Künstler hat die Ankunft der Wikinger um 900 gemalt
\��\
Die Geschichte einer Sprache ist natürlich eng verknüpft mit der Ge-schichte der sie sprechenden Völker. Daher ist die bis heute gül-tige Annahme, Angeln und Sachsen hätten bei ihrer Besiedelung der
Nordsee-Insel(n), die heute die britischen heißen, ihre westgermanischen Sprachen mitgebracht, nur folgerichtig. Die Invasoren kamen zwischen dem vierten und sechsten Jahrhundert und formten aus ihren westgermanischen Sprachen (und einigen keltischen Einsprengseln) das Altenglische. Soweit stimmen Jan Terje Faarlund und sein tschechischer Kollege Joseph Emmonds der überlieferten Version zu. Doch dann scheiden sich die Geister. Die Philologie teilt die Geschichte der englischen Sprahe in vier zeitliche Abschnitte:
o Das Altenglische (Old English) – ca. 450 bis 1100o Das Mittelenglische (Middle english) – ca. 1100 bis 1500o Das Frühneuenglische (Early Modern English) – ca. 1500 bis 1750o Das Moderne Englisch (Modern English) – von ca. 1750 bis heute
Nach traditioneller Linguisten-Meinung entstand das (Alt-)Englische also aus der niederfränkischen (niederlandischen) und der niederdeutschen (nieder-sächsischen) Sprache. Beim Übergang vom Alt- ins Mittelenglische spielte die normannische Eroberung unter William the Conquerer 1066 eine große Rol-le. Viele Begriffe, besonders Standesbezeichnungen und Ausdrücke des Glau-bens/Klerus wurden übernommen, das Englische genoss kaum noch Ansehen und blieb den niederen Schichten vorbehalten.Das sehen Faarlund/Emmonds ganz anders: Man habe die ständigen Einfälle der Wikinger vergessen. Die kamen zwischen 800 und 1100 und besiedel-ten zeitweilig ganz England und Irland. Durch sie sei das Altenglische einfach ausgestorben – so wie das Gotische im Deutschen keine Rolle mehr gepielt habe. „Warum wohl lernen wir Norweger so leicht Englisch?“ fragt Faarlund. Nun, wir könnten sagen: Weil fast sämtliche englischsprachigen Spielfilme im norwegischen Fernsehennin der Originalsprache gesendet und mit Unter-titeln versehen werden, weil sich die Synchronisation für gerade einmal 4,5 Millionen Bergbewohner als nicht lohnend erwies. Doch die beiden Forscher führen andere Argumente ins Feld. Das Altenglische, das Anglelsächsische, also eine westgermanische Sprache, sei durchaus mit Angeln und Sachsen aus Norddeutschland und Jütland einge-führt worden; doch „...das Alt- und das moderne Englisch sind zwei sehr ver-
Die Angeln und die Sachsen besiedelten die Insel zwischen 400 und 450
\��\
schiedene Sprachen! Während das Altenglische schlicht ausstarb, überlebte das Skandinavische, wenn auch stark beeinflusst vom Altenglischen.“Der etablierten Theorie machen sie zum Vorwurf, dass sie sich vornehmlich au f den Wortschatz beider Sprachen berufe, bedeutsamer sei allerdings die Ähnlichkeit der grammatischen Strukturen; die sei zwar beim Altenglischen sehr „deutsch“ gewesen, im modernen Englisch aber spüre man förmlich das Norwegische. Und selbst das Standardwerk „Oxford Dictionary of English“, das den Wortschatz und die Sprachentwicklung des letzten Jahrtausends um-fasst, gebe zahlreiche etymologische Hinweise auf das „Old Norse“.Faarland behauptet, es habe eine ganze Zeit lang Kämpfe um die politische Macht zwischen den „Briten“ und den Skandinaviern, den Wikingern, gegeben, und zwar in einer Gegend namens Danelagen (!), das Gebiete im heutigen Nordosten Englands und Teile Schottlands umfasste. Der Däne Guthrum hat-te die Gebiete Ende des neunten Jahrhunderts erobert und herrschte - nach seiner Taufe - als christlicher Herrscher über sie. Dort, so Faarlund, habe man auch später noch ähnlich gesprochen wie in Teilen der heutigen Eastern Mid-
Seite aus der Örvar-Oddr-Saga (13. Jh. - oben). Mitte: Bug eines Drachenbbots der Wikinger Fotos: Lizenz GNU
\��\
lands (um Nottingham herum), wo man ebenfalls erst sehr spät das moderne Englisch angenommen habe.Als sichersten Beweis allerdings führen Faarlund und Emmonds drei gram-matische Topoi an:
o Im Englischen (wie im Skandinavischen) kann ein Satz mit einer Prä-position enden, im Gegensatz zum Deutschen, Niederländischen oder Friesischen - und Altenglischen; Beispiel: That‘s we have talked about (dt: Das ist es, worüber wir gesprochen haben).
o Im Englischen steht immer das Objekt am Satzende, im Deutschen das Verb; Beispiel: I’ve read a book (dt: Ich habe ein Buch gelesen).
o Im Englischen gibt es den so genannten Gruppengenitiv; Beispiel: The Queen of England‘s hat (dt: ,Der Hut der Königin von England; oder um es klarer zu machen ,Der Königin von England Hut‘).
Doch sowohl der „gesplittete“ Infinitiv (to do), der ebenfalls als Unterschied zum Deutschen aufgeführt wird, als auch die Satzendung mit einer Präposi-tion gehörten ursprünglich zur Grammatik des Modernen Englisch - auch wenn beides über die Umgangssprache inzwischen in die Lehrbücher Einzug gehalten hat. Umgekehrt ist die Genitivbildung mit „s“ bei Begriffen, die Men-gen oder Massen bezeichnen, im Deutschen ursprünglich nicht zulässig ge-wesen. Augenfällig wird das beispielsweise bei Ländernamen. Laut Duden darf es heißen „Deutschlands beste Schwimmerinnen“, aber es ist auch erlaubt „die beiden Staaten des geteilten Deutschlands“ zu sagen und zu schreiben, und da scheiden sich die Geister. Das Genitiv-s ist grundsätzlich zwar richtig, wird aber (besser: wurde) nur in Redewendungen benutzt, die keine Ehrbe-zeichnung beinhalten, siehe das Schwimmerinnen-Beispiel. Sobald ein Länder-name nun als Staat mit seinen Menschen (und gedachten Hoheitsabzeichen) gemeint ist, gebietet die Hochachtung, kein s zuverwenden: „...des geteilten Deutschland“. Doch aufgrund von Unkenntnis und zunehmender Flapsigkeit beziehungsweise Taktlosigkeit werden beide Versionen verwendet, vermutlich allzu oft einfach unüberlegt.Der Genitiv ist aber auch gutes Argument gegen Faarlungs und Emmonds These. Im Altenglischen gab es eine Form des ,genitivus possesivus‘, der auch im Deutschen - dort allerdings nur in manchen Dialekten - noch heute üb-lich ist. Im Englischen nennt man ihn den his-Genitiv. Beispiel: „the father his house“ (dem Vater sein Haus). Diese Form starb mit dem Altenglischen aus, kehrte aber mit dem Modern English wieder - in abgekürzter Form als apo-strophiertes „s“: „the father’s house“.
Eines der berühmt-berüchtigten Drak-ker-Boot der Nordmänner
\��\
Sprachen sind nun einmal Systeme, die sich ändern, wenn sie nicht ausster-ben. Sie entwickeln sich, es kommen neue Wörter hinzu, alte bleiben auf der Strecke, Grammatik und Orthographie schleifen sich im umgangsprachlichen Gebrauch normalerweise ab, bis die simplifizierten Formen schließlich in den offiziellen Wörterbüchern und Sprachlehren manifestiert werden. Das mag man gut heißen oder nicht, es ist eine Tatsache. Leider ist die Arbeit der beiden Linguisten von der Osloer Universität noch immer nicht veröffentlicht, Faarlund hat bisher nur in einer Tageszeitung darü-ber berichtet. Bis dahin scheint es wahrscheinlich, dass einige Zeit (vielleicht sogar jahrhundertelang) das Englische und Norwegische zugleich gesprochen wurden; daher wird das Modern English aus beiden Quellen geschöpft ha-ben.
jed
Stolze raue Kerle - so stellte sich auch Wiktor M. Wasnezow die Wikinger vor. Fotos: Lizenz GNU
\�0\
Allzu oft wird in Frankreich auf die dramatischen, kul-turellen und ökonomischen
Veränderungen, die sich gegenwär-tig global vollziehen, mit spießbür-gerlicher, belangloser Debatte geantwortet. Das Niveau dieser Debatte ist symptomatisch für den insularen, intellektuellen Seifenkäfig, in dem sich das Land viel zu lange selbst gefangen hält“, schrieb Felix Marquardt jüngst in der „Inter-national Herald Tribune“. In einer gemeinsamen Kolumne der Zei-tung „La Libération“ hatten er, der algerischstämmige Journalist Mou-louf Archour und die Rapper der Gruppe „Mokless“ die französische Jugend aufgerufen: „Packt eure Sa-chen und sucht euer Glück irgend-wo anders auf der Welt. Frankreich ist überzentralisiert und wird von altersschwachen Greisen beher-rscht.“
Die derbe Provokation zeigte
Wirkung: Gerade, weil der Beitrag in der linksliberalen, von Jean Paul Sartre gegründeten „Libération“ erschien, fühlten sich der sozia-listische Präsident Francois Hol-lande und die Pariser Regierung schmerzhaft auf den Fuß getrampelt. Doch durchschlagende Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeits-losigkeit von jetzt über 25 Prozent blieben seither aus. Im Fernsehen konfrontiert mit dem Schicksal ei-ner erstklassigen Absolventin des Pariser (Elite-)„Institut d’Études Politique“ („Science Po“), die nach Australien auswandert, weil sie in Frankreich keinen Job findet, ant-wortete Hollande in seiner höl-zern, präsidialen Attitüde: „Meine Pflicht ist es, dieser jungen Frau zu sagen: Frankreich ist der Platz, wo Sie Karriere machen sollten.“ Den Zuschauern war nicht zum Lachen zumute.
Kein Hoffnungsstreifam Horizont
Kein Wunder, dass in den Pa-riser Vorstädten seit Jahren ein explosives Klima herrscht. Übe-rall Arbeitslosigkeit und kein Hof-fnungsstreif am Horizont. Wollen Polizisten das 2011 beschlossene Burka-Verbot durchsetzen oder jugendliche Rauschgiftdealer ver-haften, antworten die Anwohner, deren Eltern oder Großeltern meist aus Nordafrika stammen, mit einem Hagel von Steinwürfen und Krawallen wie in Clichy-sous-Bois oder jüngst in Trappes, wo eine auf-gebrachte Menge Jugendlicher eine Nacht lang das Polizeirevier regel-recht belagerte. Ohne Aussicht auf geregelte Arbeit werden die ansäs-sigen Jugendlichen permanent ag-gressiver, rebellischer. Absehbar ist, dass die Konfrontationen mit der Polizei 2014 massiv eskalieren wer-
Unruhen in den vor allem von Menschen, die aus Nordafrika zugewandert sind,...
\��\
den. Deshalb will die Regierung der Banlieue-Krise nun mit Finanzhilfen für die ärmsten (Pariser) Vorstädte und mit Hilfe steuerlich subventio-nierter Arbeitsplätze für gering und schulisch unqualifizierte Jugendliche zu Leibe rücken.
Aber am starren Kündigungs-schutz, der Rente mit 62 Jahren oder dem staatlich dekretierten (und nicht durch Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-nehmern vereinbarten) Mindest-lohn wird nicht gerüttelt. Diese Einstiegsbarrieren für Berufsanfän-ger bleiben heilige Kühe, obwohl sich der Anteil der Industrie am BIP seit 1980 auf zwölf Prozent halbiert hat und im abgelaufenen Jahrzehnt 700.000 Arbeitsplätze verloren gin-gen.
Propagandafutter fürMarine Le Pen
Innenminister Manuell Valls thront permanent zwischen zwei Stühlen. Denn während seine eige-ne Partei und die Grünen gegenü-ber den Hunderttausenden arbeits-loser, nordafrikanischer Migranten-kinder mehr Nachsicht seitens der Polizei und der Gerichte fordern, spricht die bürgerliche UMP-Op-
position vom Klima der Straflosig-keit in den Banlieues. So hat Ma-rine Le Pen von der rechtsradikalen „Front National“ (FN) alle naslang Anlass, das gesellschaftliche Chaos an die Wand zu malen. Das tradi-tionell linksliberale Intellektuellen-milieu von Paris erregt sich derweil über das „von Vorurteilen gesteu-erte Handeln“ der Polizei, wirft einzelnen Polizisten Rassismus vor, worauf diese sich vehement weh-ren, als islamfeindlich, ja faschistisch stigmatisiert zu werden. Das Ganze
wird in den Medien von immer den gleichen Zeitzeugen und Redak-teuren ritualisiert. Folgerichtig mag seit Jahren kein Polizist mehr frei-willig in den Vorstädten Dienst tun, was wiederum eine Verschlechte-rung der dortigen Verhältnisse zur Folge hat. Viele Polizisten betreiben ihre Versetzung aus den Banlieues oder weigern sich mit allen Mitteln des Beamtenrechts und ihrer Ge-werkschaft dorthin kommandiert zu werden. So wird die von den Sozialisten im Wahlkampf propa-gierte „Bürgerpolizei“ vermutlich ein Traum bleiben.
...Metropolen Frankreichs. Eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Alle Fotos: bpb/ddp/AP
...erschüttern seit Jahren die Banlieues in den Vorstädten der...
\��\
Albtraum der Sozialisten wie der Bürgerlichen ist die drohende isla-mistische Rebellion mit Dauerkra-wallen in den Vorstädten. Pariser Zeitungen prognostizieren, dass sie nicht so schnell wie die in Lon-don abebben dürften. Einen Zip-fel Hoffnung gibt es: Hollande und Bildungsminister Vincent Peillon setzen auf strikte Neutralität in Sa-chen Religion und Geschlecht vom Kindergarten bis zur Universität. Das geht inzwischen so weit, dass vor oder in öffentlichen Gebäuden keine Weihnachts-/Christbäume mehr aufgestellt werden. Mit 15 Paragraphen der „Charta der Lai-zität“ hofft Peillon, eine „säkulare Moral“ in Frankreich zu etablieren, die unter anderem das Tragen re-ligiöser Kleidungsstücke wie Kippa oder Burka verbietet und keinen Vorwand muslimischer oder jüdi-scher Schüler(inne)n mehr gelten lässt, Biologie-, Geschichts- oder Religionsunterricht zu schwänzen.
Flankiert wird dies durch „ge-schlechtsneutralen Unterricht“.
Schneller Zug nach Norden
Problem Nummer 1 des fran-zösischen Innenministers ist die Tatsache, dass sich die mafiösen Berufskriminellen wie in Marseille zunehmend als strenge Islamisten tarnen. Was die FN nutzt, um die Moscheen als rechtsfreie Räume zu denunzieren. Die Raubkrimina-lität und die Hilflosigkeit des Staats, ihrer Herr zu werden, führt inzwi-schen dazu, dass die Côte d’Azur mehr und mehr in Verruf gerät. Sie gilt heute wie die Insel Korsika, wo selbst der Mord des Präfekten - nach immerhin zehn Jahren - ange-blich nicht geklärt werden konnte, als überteuert und kriminell.
„Das ist meiner Frau und den Kindern nicht mehr zuzumuten“,
sagen Väter, die ihre Ferienbleibe am Mittelmeer – häufig mit erhebli-chem Verlust – verkauft haben, um sie gegen eine ländliche Immobilie in der Bretagne oder Normandie zu tauschen. Infolgedessen ziehen die Preise trotz der Wirtschaftsflaute in Frankreich unvermindert weiter an. Sylter Immobilienpreise sind in La Baule an der Tagesordnung. Ansäs-sige Makler sprechen mit Kunden offen von der innerfranzösischen Wanderung nach Norden.
Da die Bürgermeister der Schic-keria umschwärmten Mittelmeer-kommunen von Monat zu Monat mehr Druck aus ihrer einheimi-schen Bevölkerung bekommen, die um ihren Tourismus bangt, bekla-gen sie immer lauter „polizeiliche Untätigkeit“. Marine Le Pen, der weibliche Kopf der FN, hat die im Süden um sich greifende Krimina-lität zum Politkampfthema Num-mer eins erhoben und treibt damit nicht nur die sozialistischen Lokal-
Die klassischen Jet-Set-Orte im Süden überlässt man den Russen...
\��\
und Regionalpolitiker vor sich her, sondern auch die UMP. Im Süden fallen ihr Dorf um Dorf, Stadt um Stadt zu. So geraten Petitessen wie die Räumung illegaler Roma-Sied-lungen seit geraumer Zeit zu Strei-tereien nationaler Bedeutung. Wie gereizt das innenpolitische Klima ist, lässt sich daran erkennen, dass sozialistische Spitzenpolitiker sich immer öfter hinreißen lassen, Bun-deskanzlerin Angela Merkel und deutsche Unternehmen für Miss-stände in Frankreich verantwort-lich zu machen. Wie in den zwan-ziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts macht in der Pariser Linken Germanophobie die Runde. Heute wirft Verbraucherminister Benoît Hamon der Bundesrepublik
Lohn-Dumping vor, morgen kippen französische Hennenhalter zehn-tausende Hühnereier vor örtliche Lidl-Märkte, weil die deutschen Grünen maßgeblich zur rechtli-chen Verschärfung der Standards in der Geflügelhaltung beigetragen und die Kosten der französischen Bauern so hoch getrieben hätten, dass sie in der EU nicht mehr kon-kurrenzfähig seien.
Selbst Präsident Hollande scheut sich nicht populistisch zu argu-mentieren: Da französische Frauen mehr Kindern das Leben schenkten als deutsche, drängten jetzt mehr junge Menschen auf den franzö-sischen Arbeitsmarkt als auf den
deutschen – sei die Arbeitslosigkeit also in Frankreich höher als in der Bundesrepublik. Dass es sich um eine Milchmädchenrechnung han-delt, die nicht das Geringste mit Erkenntnissen der Arbeitsmarkt-forschung zu tun hat, scheint nicht zu stören.
Colbert bleibt en vogue
Die Regierung meidet politische Debatten über zentralistischen Di-rigismus und wirtschaftlichen Inter-ventionismus. Nichtsdestotrotz ist die merkantilistische Denkschule selbst 300 Jahre nach dem Tod von Finanz- und Wirtschaftsminister Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) so quicklebendig wie je zuvor. Dass
...und zieht lieber in den weniger lieblichen, dafür aber noch „französischen“ Norden (P. Gauguin, Bretonische Schäferin.
F
otos
: Liz
enz
GN
U
\��\
die französische Staatsquote in Höhe von 57% des Bruttoinlands-produkts und damit 10% höher als die deutsche ist, wird nicht von Hol-landes Sozialisten und ihren UMP-Gegnern, sondern fast ausschließ-lich vom Arbeitgeberverband Me-def und dessen Vorsitzenden Pierre Gattaz kritisiert. Der Medef nennt Frankreich schlicht die „Steuer-hölle“. Im kommenden Jahr wird die Schuldenquote Frankreichs auf über 95% des BIP klettern, weil die Regierung in Paris trotz vielfacher Sparversprechungen weder die Löcher im Staatshaushalt zu stop-fen noch die Sozialversicherung – jeder Rentner erhält 75% seines letzten Monatslohns – ernsthaft zu reformieren wagt. Von der Renten-reform werden ohnehin alle Bürger über 56 ausgenommen. Ähnlich ist es mit den Privilegien der Beam-tenschaft. Die unzeit-gemäßen, ja die übrigen Landsleute geradezu diskriminierenden Pri-vilegien wenigstens ein wenig zu stutzen, wird als selbstmörderisch bezeichnet. Der Maas-tricht-Vertrag interes-siert in Paris inzwischen genauso wenig wie im Berliner Kanzleramt.
Die Defizite der französischen Sozialversicherung werden durch kurzfristige Schuld-titel finanziert, was nach Meinung des Pariser Rechnungshofs im Hin-blick auf das absehbare Ende der Nullzinspolitik der Federal Reserve Bank und der EZB riskant ist. Ange-sichts französischer Staatsschulden von 1,95 Billionen Euro bringt die Inflationspolitik der Zentralbanken in Washington und Frankfurt aller-dings Zinserleichterungen in Mil-liardenhöhe mit sich. Mario Draghi kann sich also der heimlichen Un-terstützung Moscovicis vorerst sicher sein. Paris will keine Zins-wende.
Manche der „beispiellosen“ Haushaltseinsparungen, die Finanz-minister Pierre Moscovici Anfang September angekündigt hat, ent-puppen sich bei näherem Hinsehen als kreative Buchführung. Es drohen sogar die Erhöhung der Körper-schafts- und der Mehrwertsteuer, zusätzliche Sozialabgaben und neuartige Steuern (Finanztransakti-onssteuer). Das veranlasste Unter-nehmerchef Gattaz anlässlich eines Frühstückstreffens, Moscovici zu bitten, nicht auch noch die Crois-sants höher zu besteuern. In Vorbe-reitung befindet sich die Lkw-Maut. Bislang ohne Kommentar wurde in Berlin Moscovicis jüngste Idee aufgenommen, eine gemeinsame Arbeitslosenunterstützung aller Länder des Euro-Raumes zu schaf-
fen. Im gleichen Atemzug plädierte er für einen supranationalen EU-Haushalt, um Konjunkturdellen zu vermeiden.
Untragbare Besteuerung
Strikt im Sinne Colberts ist die Sonderförderung von 34 ausgewä-hlten Entwicklungsprojekten der französischen Industrie mit Förder-geldern in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. Das Geld fließt in die ohnehin von Staatsunternehmen dominier-ten Sektoren: Auto, Bahn, Luft- und Raumfahrt. Ob damit aber in den nächsten zehn Jahren 480.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen werden, bezweifeln die Privatunternehmer. „Das Niveau der Besteuerung ist untragbar“, sagte jüngst Patrick Kron, der Vorstandsvorsitzende des Siemens Konkurrenten und Elek-troanlagenbauers (Umsatz € 20 Milliarden) Alstom. Die Staatsaus-gaben müssten substantiell gekürzt werden.
Die Franzosen wählten Nicolas Sarkozy 2012 ab, weil sie den Selbst-darsteller nicht mehr ertragen kon-nten. Im weniger sprunghaften, be-häbigen und im kleinen Kreis sehr amüsanten Hollande wähnten sie einen der Ihren zu erkennen. Desto bitterer ist heute die Enttäuschung. Die Schlagzeilen der Zeitungen lassen ahnen, wie tief sie sitzt. Es scheint, dass für die wiedergewählte
Kanzlerin Merkel nicht so sehr Griechenland oder die europäische Staats-schuldenkrise als vielmehr Frankreichs Präsident Hollande ihr größtes Pro-blem werden könnte.
Felix Marquardt von der „International Herald Tri-bune“ zögert nicht, seine französischen Berufskolle-gen ob ihrer immer noch zurückhaltenden Kritik an Hollande hart ins Gebet zu nehmen. Zum Kampf gegen die Herrschaft der
Gerontokraten hat er ein proba-tes Rezept: „Mehr junge Franzosen müssen ins Ausland, dort arbeiten, reisen und sehen, wie die Dinge in anderen Kulturen und Ländern gehandhabt werden – und dann heimkehren nach Frankreich, um all ihre im Ausland gesammelte Ener-gie und ihren Enthusiasmus wieder einzubringen. Das kann helfen, die breitere Öffentlichkeit endlich mit den globalen Realitäten vertraut zu machen, die ihr bislang vorent-halten wurden.“ Kommt es nicht so, dürfte bald eine Präsidentin aus dem Élysée-Palast grüßen: Marine Le Pen.
Marine Le Pen Francois Hollande
\��\
Die Koalition ist längst nicht vertraglich zementiert. Doch
in einem sind sich die Spitzen von Union und SPD heute schon völlig einig: Die wissenschaftlichen Bei-räte des Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministeriums kriegen den Maulkorb. „Über Neubeset-zungen im BMWi-Beirat wird bald eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung entscheiden“, er-klärte Michael Roth, der europapo-litische Sprecher der SPD, kurz vor der Bundestagswahl. „Dass Herr Vaubel diesem Gremium dann noch angehört, können wir jetzt schon ausschließen.“
Das heimliche Consilium Abe-undi aus SPD und CDU hat über drei höchst anerkannte Wissen-schaftler ihr Urteil gefällt. Nicht nur VWL-Professor Roland Vaubel von der Universität Mannheim, sondern auch Professor Kai Kon-rad, Direktor am Max-Planck-Insti-tut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen in Berlin, und Professor Charles B. Blankart von der Uni-versität Luzern, den weltweit an-erkannten Finanzwissenschaftler, werden ihre Sitze in den Beiräten räumen müssen. SPD- und Unions-politiker halten alle drei Profes-soren des Vergehens für schuldig, die bisherige Euro-Rettungspolitik beider Parteien nicht bejubelt, son-dern wissenschaftlichem Zweifel unterzogen und sogar öffentlich kritisiert zu haben.
Wer den Aufschrei der Empörung seitens der Wissenschaft erwar-tet hatte, sah sich Anfang Oktober bitter enttäuscht: Die deutschen Professoren der Volks- und Fi-nanzwissenschaft schweigen. Nicht einmal der renommierte „Verein für Socialpolitik“ hielt es für nötig, vehement gegen diesen Angriff auf die freie Meinungsäußerung und ge-gen die Freiheit von Forschung und Lehre zu protestieren. „Wir wollen doch nicht mit der Alternative für Deutschland (AfD) in einen Topf geworfen werden“, erklärte man an
der FU-Berlin und der Universität Hamburg gegenüber verum-ma-gazin. Was wiederum die ätzende Einschätzung namhafter US-Öko-nomen bestätigt, den meisten deut-schen Wirtschaftsprofessoren fehle jeder Mumm, sich gegen die herr-schenden Finanzpolitiker, geschwei-ge denn gegen die Inflationspolitik der EZB zu positionieren. Deutsche Charakterköpfe wie die „Göttinger Sieben“ seien eben Historie.
Es zeichnet sich ab, dass zukünf-tige finanz- und steuerpolitische Be-schlüsse der Regierung Merkel/Ga-briel als „ex cathedra“ und „alter-nativlos“ geschluckt werden. Kritik an diesen Berliner Koalitionsdog-men wird wahrscheinlich nur noch von Professor Hans-Werner Sinn, dem Präsidenten des ifo-Instituts in München, zu hören sein.
Profiteure des Negativzins
Gegner des faktischen Nega-tivzinses der EZB sind seit dem Rauswurf der FDP aus dem Bun-destag nicht mehr vorhanden. So erfährt auch nur ein Bruchteil der deutschen Bevölkerung zum Bei-spiel davon, dass der anhaltende Niederstzins alle deutschen Privat-haushalte 5,8 Milliarden € pro Jahr oder 71 € pro Kopf kostet, weil die Spareinlagen angesichts einer Geldentwertung von mehr als zwei Prozent und einem durchschnitt-lichen Einlagezins von 1,5 Prozent schrumpfen. Jeder Spanier aber gewinnt aufgrund geringer Schuld-zinsen 250 €, jeder Italiener 213 € und jeder Franzose 92 €. Dies zeigt der jüngste Weltvermögensbericht des Allianz-Konzerns.
Unions- und SPD-Politiker be-zeichneten die Bundesrepublik im Bundestagswahlkampf schönfärbe-risch als „reiches Land“. Diesen Ball nahmen – allen voran Jean Clau-de Juncker, der Regierungschef von Luxemburg, dem reichsten Land der Euro-Gruppe – und die Mini-sterpräsidenten Spaniens, Italiens,
Portugals sofort dankbar auf. Umso leichter, so lautet das politische Kalkül, sei die bisherige Ablehnung von Euro-Bonds seitens der Bun-desregierung und damit die Verge-meinschaftung sämtlicher Schul-denberge zu brechen. Die SPD hat-te dem Euro-Bond-Ansinnen und der Haushaltssubventionierung der Euro-Südstaaten durch EZB-Prä-sident Mario Draghi ohnehin mit ihrer Wahlkampfparole „Der euro-päische Wirtschaftsraum braucht eine vereinte Stimme. Wir sehen die Lösung in einer gemeinsamen Wirtschaftsregierung“ längst statt-gegeben. Martin Schulz, der SPD-Abgeordnete und Präsident des Eu-
ropa-Parlaments, hatte ein solches Versprechen bei einem seiner zahl-reichen Audienzen bei Frankreichs Staatspräsident Hollande persön-lich abgelegt. Demzufolge dürfte dem „guten“ Deutschen Schulz zumindest die Unterstützung Hol-landes bei der Personalbesetzung der EU-Wirtschaftsregierung win-ken. „Schlechte“ Deutsche sind für die französischen Sozialisten in er-ster Linie Gegner der Euro-Bonds und Liberale.
Spiel über die Bande
Wie zwischen Paris und Christi-ne Lagarde, der Chefin des Inter-nationalen Währungsfonds (IWF)
\��\
über die Bande gespielt wird, be-leuchtet ein IWF-Papier zur Reform der Euro-Zone, das passend am Montag nach der Bundestagswahl in New York veröffentlicht wur-de. Es ist mit seinen Forderungen nach einer EU-Wirtschaftsregie-rung und der Vergemeinschaftung der Staatsschulden in so genannten Eurobonds fast identisch mit den EU-Reformvorschlägen von Hol-lande/SPD/Schulz. Selbst die fran-zösischen Forderungen nach Schaf-fung einer gemeinsamen Arbeitslo-senversicherung in der Euro-Zone sowie eines Infrastrukturbudgets finden sich beinahe wortwörtlich im IWF-Papier wieder.
Aber Deutschland zählt faktisch keineswegs zu den reichsten Indus-trieländern. Es liegt eher im Mittel-feld. Denn das Nettogeldvermögen pro Kopf beträgt in Deutschland lediglich knapp € 42.000 und liegt damit hinter Frankreich (€ 44.310), Italien (€ 45.770), Niederlande (€ 68.760), Belgien (€ 73.520). Wohl-weislich verschwiegen wird, dass vier von zehn Deutschen nicht ein-mal 4.900 € ihr eigen nennen kön-nen und damit statistisch gleichauf mit einem Chinesen liegen.
Zur Refinanzierung, sprich Sa-nierung aller maroder, Konkurs be-drohter Banken der Euro-Südlän-der sind nach derzeitiger Schätzung 732 Milliarden Euro nötig. Diese
gigantische Summe übertrifft die Jahressteuereinnahmen des Bundes (2013) noch um 100 Milliarden Euro. - Ob es allerdings bei die-ser Summe bleiben wird, ist mehr als fraglich, weil diese Banken ihre wahren Abschreibungsverluste erst mit Inkrafttreten der Euro-Banken-union offen legen müssen. - Die 732 Milliarden Euro fließen aus dem so genannten Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), für die jeder deutsche Steuerzahler mit € 100.000, beziehungsweise mehr als dem Doppelten seines privaten Nettogeldvermögens, garantiert. Was nach Professor Sinn auf eine „massive Vermögensumverteilung in Europa“ hinausläuft.
Schaukampf bis Neujahr
Doch damit nicht genug: Union und SPD dürften – wie es sich jetzt durch viele Äußerungen aus bei-den Parteilagern schon abzeichnet - nach Schaukampf um die Koaliti-onsmodalitäten, der bis Jahresen-de andauern wird, ähnlich wie in Frankreich die Erbschaftssteuer, die Einkommenssteuer und die Mehr-wertsteuer kräftig anheben und dies mit der Senkung der Progres-sion für niedrige Einkommen zu bemänteln suchen. Vorläufig erklärt Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), er schließe höhere Steuern nicht „kategorisch“ aus. Aus sei-nem Ministerium heißt es zynisch, die Steuersysteme der beiden zen-tralen Euro-Staaten würden har-monisiert. Da die Bundeskanzlerin den CDU-Wirtschaftsrat („Mut zu einem starken Wirtschaftsstandort Deutschland“) und die CDU-Mit-telstandsvereinigung eher als fol-kloristisches Anhängsel betrachtet, werden die Mahnungen beider Or-ganisationen vor Steuererhöhungen - wie gehabt - im Raum verhallen. Auf Seiten der SPD drängen am stärksten die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf Steuerer-höhung, weil sie sich durch Spar-
maßnahmen und Schnitte in der Verwaltung keinesfalls mit ihrem Beamten- und Verdi-Klientel anle-gen möchten. Darüber, dass der To-talzusammenbruch der Kommunal-finanzen vor der Tür steht, herrscht beredtes Schweigen.
Kassandra warnt nicht mehr
Gerade vor dem bequemen, aber zunehmend abschüssigeren Pfad ins Höchststeuerelend hatte Hermann Otto Solms (FDP), der erfahrenste deutsche Finanz- und Haushalts-politiker, unter nicht müde wer-dendem Hinweis auf die katastro-phalen Konsequenzen für das Wirt-schaftswachstum 33 Jahre lang im Bundestag gewarnt. Frankreich und Italien seien Beweis genug, dass die Erhöhung der Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte, welche von SPD und Grünen als „Reichensteuer“ tituliert wird, gewerbliche Investi-tionen fast zum Erliegen bringen kann. Weil Solms als unabhängig und unbequem gilt, hatte die dama-lige FDP-Führung unter Guido We-sterwelle ihn 2009 bei seiner Kan-didatur für den Posten des Bundes-finanzministers ohne Nachdruck unterstützt. Fußend auf die seit 2010 kräftig sprudelnden Steuer-einnahmen hatte Solms unermüd-lich und nachdrücklich sichtbaren Schuldenabbau des Bundes gefor-dert. Er wollte, dass ein Zeichen auf den internationalen Finanzmär-kten gesetzt würde. Solms hält es mit dem Wirtschaftsjournalisten Richard Lewihnson: „Ausgeglichene Staatshaushalte in den Euro- Mit-gliedsländern sind zweifellos die effektivsten Brandmauern gegen Vertrauensverlust in den Euro und drohende Geldentwertung.“ Zum gesunden Haushalten gehört zwin-gend das Sparen. Doch vom Sparen ist in Berlin nicht die Rede, nur vom Gegenteil. Die Koalitionäre wollen von Kassandra nichts wissen.wau.
\��\ Fl
eißi
ger B
arde
, der
Mut
und
Min
ne b
esan
g (S
eite
aus
der
Man
essi
sche
n Li
eder
hand
schr
ift, u
m 1
300)
. Fot
o: U
nive
rsitä
t Hei
delb
erg
\��\
Eine der ältesten Tugenden der Menschheit ist aus dem Alltagsleben verschwunden, aus der Mode gekommen sozusagen: Mut. Sie hat Phänomenen wie „(Adrenalin-)Kick“, Abenteuer-Urlaub oder „Handys
abziehen in der U-Bahn“ Platz gemacht; das ethische Moment scheint gänzlich verschwunden. Doch langsam erwacht Mut in vielen Menschen wieder, entfacht durch die Wut, Knechte zu sein in einem totalitären politischen System.
Selbst die ritterlichen Tugenden, die seit dem Mittelalter den Idealtyp abendländischer Mannhaftigkeit (von Emanzipation war damals auch in dieser Hinsicht noch keine Rede) auswiesen, beinhalteten neben dem Überwinden von Angst vor physischen Beschädigungen auch die Wahrung ethischer Werte wie Stolz, Treue und Loyalität. Doch derlei Interpretationen des Begriffs Mut sind heute verpönt. Immerhin geistert das Wort Courage seit einigen Jahren wieder durch die Medien, meist versehen mit dem Affix Zivil und angestoßen durch schreckliche Vorfälle wie dem Mobben, Berauben und/oder Zusammenschlagen Wehrloser in U-Bahnen, etc.; in diesem Kontext hat Mut – nämlich die Bereitschaft, dem Opfer zu helfen und sich dabei selbst in Gefahr zu begeben – durchaus alte Qualitäten. Wie schwierig es ist, Zivilcourage an den Tag zu legen und andere ebenfalls dazu anzuhalten, beweist die Tatsache, dass sich die Zahl solcher Übergriffe nicht abnimmt. Bundesweite Bestürzung hatte der gewaltsame Tod des 50 Jahre alten Dominik Brunner ausgelöst, der am 12. September 2009 in einer Münchener S-Bahn vier Schüler vor einem Raubüberfall schützen wollte, woraufhin er von zwei Jugendlichen, gerade 17 und 18 Jahre alt, durch mehr als 20 Tritte und Faustschläge getötet wurde.Niemand brauche den „Helden spielen“, sagte der Polizeisprecher seinerzeit. Statt dessen solle man „laut rufen, um Öffentlichkeit herzustellen“ und die 110 anrufen. Und dann? Dann kommt die Polizei, und alle Bösewichte sind längst verschwunden. Aber so ist das: Objektive Sicherheit für jeden – sei er Bürger eines Staates und Mitglied einer Gruppe oder Einzelgänger – gibt es selbstverständlich nicht; es geht den Sicherheitsorganen heute längst nur noch darum, jedem Einzelnen das subjektive Gefühl, er werde beschützt, zu vermitteln. Das ist auch verständlich, denn schließlich kann es sich kein Staat leisten, fünf Millionen Polizisten zu beschäftigen. Und selbst die uniformierten Ordnungshüter werden immer häufiger Ziel von Attacken brutaler Schläger. Polizisten sollten mutig sein. Sie müssen sich häufig ganz konkreten physischen Gefahren aussetzen. Das haben sie mit Soldaten gemein, auch deutschen heutzutage, seit die Bundeswehr verstärkt Auslandseinsätze wahrnimmt.Für alle anderen – kriminelle Banden einmal ausgenommen – soll gelten, was in einem philosophischen Wörterbuch steht: Den frei gewordenen Platz des Begriffs Mut hat heute „Optimismus“ eingenommen. Das ist schon ein sehr zweifelhafter Ersatz. Das altertümliche „Beherztheit“ gehört wohl noch weniger zum aktiven Sprachschatz eines Durchschnittsdeutschen, beschreibt aber recht gut, was ursprünglich mit Mut gemeint war: Ausgehend vom germanischen „muod“ (Zustand der Erregung, manchmal auch Zorn) entwickelte sich der Begriff im Mittelhochdeutschen von der allgemeinen Bezeichnung „Mut = Gemüt“ zu „hoher Mut“ (nicht Hochmut im Sinne von Hoffart), was nichts anderes heißt als „noble Gesinnung“, und dazu gehörte auch, dass man im
Mutiger Demonstrant am Rande des Gezi-Parks in Istanbul
\��\
Kampf – gleich welcher Art – seinen Mann stand. Es ist die Unerschrockenheit angesichts einer Gefahr, die Überwindung der Angst, zugleich aber auch die Gewissheit der eigenen Stärke und Souveränität. Delorges, der Edle in Schillers „Handschuh“, war so einer : In offensichtlicher Todesverachtung stieg er in die von „greulichen“ Raubtieren bevölkerte Arena und holte Fräulein Kunigundes Handschuh „mit keckem Finger“ - um ihn ihr ins Gesicht zu werfen. Es ging ihm um seine Ehre, die zu verteidigen er sich aufgefordert fühlte.Nun sahen sich die Ritter des Mittelalters noch immer in einer Reihe der Krieger, die seit den Germanen dem Leben zwar nicht abgeneigt waren, den Tod im Kampf, in der Schlacht aber als den ehrenhaftesten ansahen. Wer heute mutig ist, beweist das normalerweise nicht im (körperlichen) Kampf, jugendlicher Übermut vor der Schule ausgenommen. Dafür gilt es, den Mut zu haben, seinem Vorgesetzten im Job gegenüber die eigene Sache zu vertreten, wenn man denn
von ihr überzeugt ist. Einen Fehler zuzugeben, bedarf auch einigen Mutes, gleich ab dem Partner oder Kollegen gegenüber. Es ist, was man mit „Bürgermut“ bezeichnen könnte, angelehnt an den französischen Begriff Zivilcourage. Warum wir Deutsche dafür kein eigenen Wort haben, bleibt ein Rätsel. Vielleicht hat Bert Brechts Anna Fierling ihren Anteil daran, auch wenn diese „Mutter Courage“ in diesem kriegs- und kapitalismuskritischen Stück von 1939 im Dreißigjährigen Krieg ihre Kinder verlor. Es scheint überhaupt, dass Frauen diesen Begriff gepachtet haben. „Courage“ hieß eine feministische Zeitschrift in den 70-ern und 80-ern des vergangenen Jahrhunderts, und so heißt heute noch ein Modelabel. Jugendclubs, ein Theater und eine Einrichtung für psychologisch-pädagogische Jugendhilfe schmückt sich ebenfalls mit diesem Namen. Doch auch Reichskanzler Otto von Bismarck soll sich des ursprünglich französischen Begriffs Zivilcourage befleißigt haben. 1898 soll er einem Verwandten, der ihn in einer Parlamentsdebatte nicht unterstützt hatte, vorgeworfen haben: „Mut auf dem Schlachtfeld ist bei uns Gemeingut, aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt.“Ob Mut dazu gehört, mit einem Mountainbike steile Schotterpisten hinunter zu rasen oder sich an einem dicken Gummiseil von Brücken in die Tiefe zu stürzen, müssen Psychologen beantworten. Zwar geht es auch dabei darum, Angst zu überwinden, Anhänger solcher Freizeitbeschäftigungen im Freundeskreis preisen aber eher den „Kick“, den Adrenalinstoß, der sie ereilt und für kurze Zeit in eine euphorische Stimmung versetzt.Apropos Adrenalin: Dieses im Nebennierenmark gebildete Hormon soll uns seit Urzeiten befähigen, im Kampf mit einem
Gegner (und sei es ein wildes Tier) entweder hellwach und reaktionsschnell den Angriff abwehren – oder aber Fersengeld geben zu können. Adrenalin stellt blitzartig eine Extraportion Energie zur Verfügung (indem es Fett abbaut), erhöht den Blutdruck und die Atemfrequenz, stoppt für den Moment unnötige Energieverschwender wie die Verdauung, weitet die Pupillen, steigert die Schweißproduktion und kontrahiert die glatte Muskulatur. Äußeres Zeichen für diesen Stress – und den rufen gefährliche Situationen hervor – ist übrigens die so genannte Gänsehaut. Nun nutzen die Menschen solche Adrenalinschübe nicht immer in derselben Art. Es gibt eben Mutigere und weniger Mutige. Umso höher ist die Beherztheit jener einzuschätzen, die – allein oder in der Gruppe – gegen vermeintlich übermächtige Gegner ihre Courage beweisen. Der Tübinger Politikwissenschaftler Gerd
Mutiger Demonstrant am Rande des Gezi-Parks in Istanbul
\��\
Mayer beschreibt die Situationen, in denen sich solche Menschen behaupten, wie folgt: • Es gibt einen latenten oder manifesten Konflikt zwischen denen, die diese Werte und Normen verletzen und denen, die sich für ihre Bewahrung einsetzen. • Es gibt nicht immer leicht bestimmbare Risiken, das heißt der Erfolg zivilcouragierten Handelns ist meist unsicher, und der Handelnde ist bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. • Zivilcouragiertes Handeln ist öffentlich, d. h. in der Regel sind mehr als zwei Personen anwesend. • Es gibt ein reales oder subjektiv wahrgenommenes Machtungleichgewicht zuungunsten dessen, der mutig handeln will, etwa weil er sich in einer Minderheits-/Mehrheitssituation in Gruppen oder in einem Verhältnis der Über-/Unterordnung bzw. einer Abhängigkeit befindet (die oft mit Anpassungsdruck verbunden sind).Der Wissenschaftler unterscheidet drei Arten des Handelns mit Zivilcourage: • Eingreifen zugunsten anderer, meist in unvorhergesehenen Situationen, in denen man schnell entscheiden muss, was man tut. • Sich-Einsetzen – meist ohne akuten Handlungsdruck – für allgemeine Werte, für das Recht oder die legitimen Interessen anderer, vor allem in organisierten Kontexten und Institutionen, wie z.B. in der Schule oder am Arbeitsplatz. • Sich-Wehren z.B. gegen körperliche Angriffe, Mobbing oder Ungerechtigkeit; zu sich und seinen Überzeugungen stehen, standhalten, sich behaupten; widerstehen, nein sagen, ‚aus guten Gründen‘ den Gehorsam verweigern. Dies erfordert Mut, da derjenige, der Zivilcourage zeigt, möglicherweise mit Sanktionen durch Autoritäten, Vertreter der herrschenden Meinung oder sein soziales Umfeld (z.B. einer Gruppenmehrheit) zu rechnen hat. Als zivilcouragiert gelten auch Whistleblower, die illegale Handlungen oder sozialethisches Fehlverhalten zum Schaden der Allgemeinheit innerhalb von Institutionen, insbesondere Unternehmen und Verwaltungen, aufdecken.Ob die Menschen, die zunächst in Tunesien, später dann in vielen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens den Mut bewiesen haben (und noch beweisen), sich gegen die Diktatoren, die ihre Heimat regieren, zu stellen? jed
Mut oder „nur“ die Sucht nach dem Adrenalin-Kick? Mountainbiker in England
Foto: privat
\��\
K\ U\ N\ S\ T\
„Wenn Farbschicht auf Farbschicht folgt und Neues Altes übermalt, kann ich durch das ,Arbeiten an sich‘ einen Zustand erreichen, an dem ich wie von einem Fischkutter aus ein Schleppnetz in den Schlick des Unbewussten werfen. Was sich verfängt, wird gemalt. Auf diese Weise entstehen Seelen, Erinnerungs- und Traummo-tive, in denen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusam-menkommen. Lassen sich die einzelnen Szenen noch jede für sich beschreiben, so entziehen sie sich im Ganzen oft jeglicher Deu-tung.“
Geboren 1983 in Düsseldorf2004 Studium der Kunstgeschichte und Französisch in Aachen2006 Studium der freien Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf2007 Klasse LüpertzAb 2008 Klasse Braun2009 Stipendium des deutsch-französischen Jugendwerkes2009/10 Auslandssemester an der école supérieure d‘arts de BrestZahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland
Noch bis 18. Oktober: Die Welt von oben - Spuren, Relikte, Tro-phäen der Jagd, Zwischenebene der U-Bahnstation Schauspiel-haus, Hattinger Straße 1, 44789 Bochum (24 Stunden geöffnet)Kontakt: [email protected]
JulienDeiss
\��\
Das nächste verum erscheint am 7. Nov. 2013
Friedrich von Schiller (1797)
Der Handschuh
Vor seinem Löwengarten, Das Kampfspiel zu erwarten, Saß König Franz, Und um ihn die Großen der Krone, Und rings auf hohem Balkone Die Damen in schönem Kranz.
Und wie er winkt mit dem Finger, Auftut sich der weite Zwinger, Und hinein mit bedächtigem Schritt Ein Löwe tritt Und sieht sich stumm Ringsum Mit langem Gähnen Und schüttelt die Mähnen Und streckt die Glieder Und legt sich nieder.
Und der König winkt wieder, Da öffnet sich behend Ein zweites Tor, Daraus rennt Mit wildem Sprunge Ein Tiger hervor.Wie der den Löwen erschaut, Brüllt er laut,
Schlägt mit dem Schweif Einen furchtbaren Reif Und recket die Zunge, Und im Kreise scheu Umgeht er den Leu, Grimmig schnurrend, Drauf streckt er sich murrend Zur Seite nieder.Und der König winkt wieder, Da speit das doppelt geöffnete Haus Zwei Leoparden auf einmal aus, Die stürzen mit mutiger Kampfbegier Auf das Tigertier; Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen, Und der Leu mit Gebrüll Richtet sich auf, da wirds still; Und herum im Kreis, Von Mordsucht heiß, Lagern sich die greulichen Katzen.
Da fällt von des Altans Rand Ein Handschuh von schöner Hand Zwischen den Tiger und den Leun Mitten hinein.
Und zu Ritter Delorges, spottenderweis, Wendet sich Fräulein Kunigund: “Herr Ritter, ist Eure Lieb so heiß,
Wie Ihr mirs schwört zu jeder Stund, Ei, so hebt mir den Handschuh auf!”
Und der Ritter, in schnellem Lauf, Steigt hinab in den furchtbaren Zwinger Mit festem Schritte, Und aus der Ungeheuer Mitte Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.Und mit Erstaunen und mit Grauen Sehns die Ritter und Edelfrauen, Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, Aber mit zärtlichem Liebesblick – Er verheißt ihm sein nahes Glück – Empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht: “Den Dank, Dame, begehr ich nicht!” Und verläßt sie zur selben Stunde.