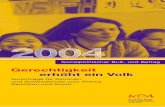Vom Ideal zur Wertelüge – soziale Gerechtigkeit im armutspolitischen Stresstest
-
Upload
ulrich-schneider -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of Vom Ideal zur Wertelüge – soziale Gerechtigkeit im armutspolitischen Stresstest
Im BlIckpunkt
Zusammenfassung: Gerechtigkeit ist eine der zentralen organisatorischen Ideen unserer Gesell-schaft und unseres Staates. Dabei ist Gerechtigkeit als Begriff ein schwer fassbares konstrukt, das sich meist nur durch die Abwesenheit von ungerechtigkeit in Beziehungen und Verhältnissen darstellen lässt. Im Beitrag wird das Ideal der sozialen Gerechtigkeit innerhalb unserer Gesell-schaft mit armutspolitischen phänomenen diskutiert und das entstandene Dilemma der heutigen leistungsgesellschaft offengelegt. Es zeigt sich, dass sich das Gerechtigkeitsideal zu einer Wer-telüge entwickelt hat, da weite teile der Gesellschaft aus der heutigen leistungsgerechtigkeit herausfallen.
Schlüsselwörter: Soziale Gerechtigkeit · leistungsgerechtigkeit · leistungsgesellschaft · ungleichheit · Armut
From an ideal to a lie—social justice tested by poverty politics—a comment
Abstract: Justice is one of the central organizational ideas of our society and constitution. mean-while the term is a hard to catch construction, which can be only defined by the absence of in-justice in relationships and interactions. this comment discusses the ideal of social justice in the society with poverty phenomenons and proclaims the dilemma of todays meritocracy. the ideal of social justice has developed into a lie about our society’s values.
Keywords: Social justice · meritocracy · Inequality · poverty
Soz passagen (2011) 3:175–180DOI 10.1007/s12592-011-0085-8
Vom Ideal zur Wertelüge – soziale Gerechtigkeit im armutspolitischen Stresstest Ein Kommentar
Ulrich Schneider
© VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011
Dr. u. Schneider ()Der paritätische Gesamtverband, Oranienburger Str. 13–14, 10178 Berlin, DeutschlandE-mail: [email protected]
176 u. Schneider
Gerechtigkeit wird zugleich unterschätzt und deutlich überbewertet. unterschätzt wird die Bedeutung dieser normativen kategorie für das Funktionieren dieser Gesellschaft, für ihren Zusammenhalt, als bindende leitnorm. Es klingt paradox: Aber erst das ge- sellschaftliche Ideal sozialer Gerechtigkeit vermag diese Gesellschaft in den Stand zu versetzen, schreiende ungerechtigkeiten, wie sie in der sich immer weiter öffnenden Schere zwischen Arm und Reich zum Ausdruck kommen, überhaupt auszuhalten. Zur lösung sozialer probleme oder gar zur Schaffung sozialen Ausgleichs taugt diese leit-norm jedoch nicht – ganz im Gegenteil.
Soziale Gerechtigkeit ist weit mehr als eine ethische Zielkategorie oder ein morali-scher Anspruch. Soziale Gerechtigkeit als individuell erlebtes leitprinzip sorgte in der Vergangenheit überhaupt erst für das friedfertige Zusammenleben der menschen in die-ser Arbeits- und leistungsgesellschaft. Es ist die zentrale Idee, um die herum sich Staat und Gesellschaft ideologisch organisieren – auch wenn die Armut in diesem lande eine andere Sprache zu sprechen scheint.
mit der Gerechtigkeit verhält es sich eigentümlich. Sie ist eigentlich kein Wert aus sich heraus, sondern sie wird vollzogen. Dieser Vollzug kann sich aus sehr unterschied-lichen moralischen Quellen speisen, aus unbarmherzigkeit und Vergeltung gemäß dem alttestamentarischen „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ oder auch aus Barmherzigkeit und Großmut. Was der eine als gerecht empfindet, kann der andere als zutiefst ungerecht ver-urteilen. Auch in einem anderen wichtigen Aspekt unterscheidet sich die Gerechtigkeit von anderen Werten: Wertbegriffe und tugenden sind in aller Regel mit positiven emo-tionalen Assoziationen verknüpft. Für ihre psychische und soziale Vermittlung und für ihr Funktionieren als gesellschaftliche leitplanken ist das sehr wichtig – wesentlich wich-tiger als ihre intellektuelle Durchdringung. Worte wie mut, Stolz, Weisheit, Fleiß oder Güte lösen durchweg positive Gefühle aus. Häufig verknüpfen wir mit Wertbegriffen auch spontane Bildassoziationen aus der kindheit: der mutige Ritter, der stolze Indianer-häuptling, der weise Alte mit den weißen Haaren und so weiter. nur mit der Gerechtigkeit will das nicht so recht gelingen. Das Gefühl, das wir noch am ehesten mit ihr in Ver-bindung bringen, ist die Empörung. nicht umsonst sprechen wir vom „gerechten Zorn“. Gerechtigkeit definiert sich vor allem ex negativo, aus seinem Gegenteil heraus.
Was damit gemeint ist und weshalb das so ist, wird klar, wenn wir kinder dabei beob-achten, wie sie sich diesen Wert aneignen. ungerechtigkeit ist bei kindern ein General-verdacht, ein Vorwurf, der fast immer erhoben wird, sobald ein anderer im Vorteil zu sein scheint. Ob ein Stück kuchen minimal größer ist oder ob der ältere Bruder abends etwas länger aufbleiben darf – jeder unterschied ist grundsätzlich verdächtig, eine „him-melschreiende ungerechtigkeit“ in sich zu bergen, wenn er dem anderen ein privileg zu bescheren scheint. Der Ruf „Das ist aber ungerecht“ ist bei kindern geradezu ein kampfruf, der dafür sorgen soll, dass sofort Gerechtigkeit hergestellt wird. Alles andere wird nicht geduldet. Ruhe kehrt erst wieder ein, wenn dem kind entweder der gleiche Vorteil gewährt wird oder wenn der Vorteil des anderen gut begründet wird: „Du hattest doch heute morgen schon zwei kugeln Eis und deine Schwester noch gar keine.“ Oder: „Dein Bruder ist drei Jahre älter als du. Wenn du so alt bist wie er, darfst du auch etwas länger aufbleiben.“ Im Grunde sind solcherlei Erklärungen eigentlich nichts anderes als die Rechtfertigung von Vorteilen anderer. Wie weit dies gelingt, hängt sehr von der Güte der Erklärung, aber auch von der Einsichtigkeit, Gelassenheit oder auch Großzügigkeit
177Vom Ideal zur Wertelüge …
des Beschwerdeführers ab. Gerechtigkeit ist ein Wert, der sich erst in der Interaktion, im miteinander einstellt. Ganz praktisch gilt daher: Gerechtigkeit ist hergestellt, wenn Ruhe herrscht. Gerechtigkeit ist nicht mehr als die Abwesenheit von ungerechtigkeit, die Abwesenheit von nicht gerechtfertigten Vorteilen Einzelner oder ganzer Gruppen.
In einer Gesellschaft, die durch äußerst ungleiche Verteilungs- und Wohlstandsposi-tionen geprägt ist, wird daher auch entsprechend sehr viel mühe darauf verwand, privi-legien zu begründen und ungleichheiten duldbar zu machen. Weite teile der kindlichen Sozialisation bestehen daraus, vom kind spontan als ungerecht Empfundenes als den-noch gerecht zu erklären.
und man hat den Eindruck, dass auch ein Großteil des staatlichen und politischen Bemühens genau darauf abzielt. Bei den letzten Bundestagswahlen tauchten in den pro-grammen der im parlament vertretenen parteien die Worte „Gerechtigkeit“ und „gerecht“ in unterschiedlichsten Ausprägungen zusammen über 330-mal auf. und da Gerechtigkeit offenbar nicht gleich Gerechtigkeit ist, finden wir in den Wahlprogrammen so interes-sante Varianten wie Steuergerechtigkeit, Beitragsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtig-keit, teilhabegerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, chancengerechtigkeit und vieles mehr. nur ein teil dieser Wortzusätze dient allerdings dazu, auf Felder hinzuweisen, wo es besonders ungerecht zugeht – wie in der Bildung oder unter den Geschlechtern. Andere Beifügungen verfolgen genau das gegenteilige Ziel: Durch die Spezifizierung soll schon sprachlich legitimiert werden, dass privilegien gut und gerecht sind.
Von herausragender, zentraler und geradezu staatstragender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Begriff der leistungsgerechtigkeit. Er prägt wesentliche Bereiche unserer Gesellschaft, von den lohnstrukturen über das Steuerrecht und das Bildungssys-tem bis hin zu den sozialen Sicherungssystemen – und dient ausschließlich der legitima-tion von ungleichem. Er vollbringt dazu das kuriosum, leistung zur moralischen Größe zu erheben: Wer etwas leistet, verdient eine Belohnung. Die Solidargemeinschaft ist eine Gemeinschaft von leistungserbringern. Wer hingegen nichts leistet, schließt sich aus. unverhohlen wertend sprechen wir von „leistungswilligen“, „leistungsträgern“ oder „leistungsverweigerern“. Wer guten (leistungs-)Willens ist, bekommt sogar sozialen Schutz; jeder nach seiner leistung, jeder nach seinen (Versicherungs-)Beiträgen.
In einer Schrift aus dem Jahr 1990 bringt der damalige Arbeitsminister norbert Blüm diese Ideologie sehr schön auf den punkt, wenn er erklärt: „In unserem sozialen Siche-rungssystem hat Gerechtigkeit, wo immer möglich, Vorfahrt. man soll ein problem nicht mit Barmherzigkeit lösen, wenn es mit Gerechtigkeit gelöst werden kann. Das ist eine leitformel der Sozialpolitik im Rahmen der sozialen marktwirtschaft. Daran orientiert sich z. B. unser Rentensystem: Rente ist Alterslohn für lebens-Beitrags-leistung, die wir aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit gegenüber Frauen ergänzt haben um die schritt-weise Anerkennung auch der Familienleistung. Rente ist kein Gnadenbrot, das staatlich nach Belieben gewährt oder genommen wird. Rente ist ein selbst erarbeiteter, eigentums-ähnlich geschützter und damit kalkulierbarer Anspruch, der dynamisch den Arbeitsver-diensten folgt.“ (Blüm 1990)
mit einem hat Blüm zweifelsfrei recht: Ein sozialer Gerechtigkeitsbegriff, der sich aus einem leistungsgerechtigkeitsideal speist, ist in der tat unbarmherzig, kalt, grenzt syste-matisch aus. lebensstandardsicherung und Äquivalenzprinzip sind seine Fortsetzung in der logik unserer sozialen Sicherungssysteme.
178 u. Schneider
Die wesentlichen Säulen unseres Sozialstaates – Arbeitslosen-, Renten- und krankenver-sicherung – sollten nie vor Armut schützen, sondern einen lebensstandard absichern. Ziel dieser „Sozialversicherungen“ ist es, die menschen gegen die großen sozialen Risiken der Erwerbsgesellschaft – Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und altersbedingter Austritt aus dem Erwerbsleben – so abzusichern, dass der individuelle lebensstandard so weit wie möglich gehalten werden kann. Je näher die unterstützungsleistung an das niveau des vormals erzielten Erwerbseinkommens heranreicht, umso zielgenauer und erfolgrei-cher ist nach solcher logik der Sozialstaat. lebensstandardsicherung ist Ziel und prinzip, an dem unser ganzer Sozialstaat ausgerichtet ist. Das sogenannte Äquivalenzprinzip, das Arbeitslosen- und Rentenversicherung zugrunde liegt und wonach im Risikofall ein jeder leistungen gemäß seinen vormals eingezahlten Beiträgen erhält, ist die sachgerechte und folgerichtige umsetzung dieser sozialpolitischen Richtschnur.
und dieses lebensstandardsicherungsprinzip ist zugleich auch der kern unseres sozial-staatlichen Dilemmas. prinzipientreu wird gezahlt, prinzipientreu wird aber auch sozialer Schutz verweigert, wenn kein Äquivalent vorhanden ist. Arbeitslosen- und Rentenver-sicherung kennen keine mindestbedarfe, die es zu decken gilt, und somit auch keine mindestsicherung. Das Äquivalenzprinzip ist blind für soziale not: Gesichert wird der sehr auskömmliche lebensstandard ebenso wie der lebensstandard am unteren Ende der Wohlstandsskala, selbst wenn es sich dabei bereits um Armut handelt. Schutz genießt, wer so lange gearbeitet und eingezahlt hat, dass er überhaupt einen Anspruch auf Arbeits-losengeld geltend machen kann, wer so gut verdient hat, dass er auch bei 60 % lohner-satzleistung noch gut zurecht kommt, und wer nur für eine relativ kurze Zeit – bevor er nämlich in Hartz IV absteigt – aus dem Arbeitsprozess herausfällt und schnellstmöglich sein Einkommen und seine Rentenansprüche wieder über eigene Erwerbstätigkeit sichert. nur diese menschen sind in der lage, die notwendigen Beitragszahlungen zu leisten. nur bei ihnen greift daher auch das Versicherungsprinzip und nur sie erwerben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Gar nicht oder nur schlecht geschützt hingegen ist, wer auf dem Arbeitsmarkt noch gar nicht Fuß fassen konnte oder wer seine Erwerbstätigkeit wegen kindererziehung oder Pflege eines Angehörigen längere Zeit unterbrechen muss. Und wer so wenig verdient, dass ihn 60 % seines nettoeinkommens auch nicht über die Hartz-IV-Schwelle heben, hat sowieso verloren – trotz Anwartschaftszeiten und trotz Beitragszahlungen wird er Hartz IV beantragen müssen. Jugendliche, ungelernte Arbeiter mit niedrigem Einkom-men, personen in prekären Beschäftigungsverhältnissen oder mit gesundheitlichen Ein-schränkungen: All diese menschen müssen, wenn sie ihre erste Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt bereits hinter sich haben, im Sozialversicherungssystem ihre zweite erleben und feststellen: Sie sind es anscheinend nicht, die der Sozialstaat schützen will. kommt das Alter, werden sie feststellen, dass es in der Rentenzeit auch nicht besser wird. Ganz im Gegenteil: Die Rente ist lediglich die verschärfte Weiterführung von privilegien bezie-hungsweise Benachteiligungen im Erwerbsleben. Wer es bis dahin mit seinem Erwerbs-einkommen vielleicht gerade noch so geschafft hatte der Armut zu entkommen, der wird nach den knallharten Spielregeln unseres Rentensystems spätestens im Alter endgültig in die Armut abrutschen. Entweder hat er nicht lange genug eingezahlt, da er zu oft arbeits-los war, oder aber die Rente ist so klein, dass er trotzdem den Gang zum Sozialamt antre-ten muss. So funktioniert es nun einmal: unser leistungsgerechtigkeitsprinzip.
179Vom Ideal zur Wertelüge …
Fatalerweise kommt hinzu, dass wir uns mit dem leistungsbegriff gleich doppelt belügen. Denn sagen wir leistung, meinen wir eigentlich Erfolg. und sagen wir Erfolg, meinen wir in Wirklichkeit Geld. mit dieser Verwechslung wird der ohnehin schon kuriose Wert der leistungsgerechtigkeit endgültig zur Ideologie im schlechten Sinne, zur Werte-lüge im Interesse von Vorteilsnehmern. Wie soll sich sonst erklären lassen, weshalb mancher manager in nur einem Jahr mit einem Einkommen nach Hause geht, für das andere ihr ganzes Berufsleben schuften müssen und es selbst dann nicht erreichen? Oder wie sollen sich mit einem leistungsprinzip Abschiedszahlungen in millionenhöhe legitimieren las-sen, die selbst dann gezahlt werden, wenn unternehmen kurz vor der pleite stehen oder sogar schon insolvent sind? Gerade in jüngerer Zeit, als unsere vermeintlichen Superleis-tungsträger mit ihrer Zockerei Banken in die pleiten und ganze Volkswirtschaften an den Abgrund führten, offenbarten sie den ideologischen charakter unseres leistungsprinzips in geradezu schon grotesker Weise.
Doch in der Bundesrepublik scheinen sich an diese merkwürdige und ungerechte „leistungsgerechtigkeit“ selbst diejenigen gewöhnt zu haben, die sich ganz unten auf der Leistungs-, Erfolgs- oder Einkommenstreppe befinden. Bescheidenheit war schon immer ihre tugend, das motto „Geld allein macht nicht glücklich“ ihr trost, die Ziehung der lottozahlen ihre Hoffnung. Die Empörung über die Einkommensungerechtigkeiten hat sich viele Jahre allenfalls im Stammtisch-Geschimpfe über „die da oben“ luft gemacht, womit „die da oben“ im Zweifel ganz gut leben konnten.
Insgesamt funktionierte das ideelle System jedoch. Solange Bilder wie das des flei-ßigen Häuslebauers, des hart und verantwortlich arbeitenden mittelständischen unter-nehmers oder des innerbetrieblichen Aufsteigers unser leistungsprinzip genährt haben, konnte ein solches leitbild trotz seines ideologischen charakters und trotz der Verwech-selung von leistung und Geld gesamtgesellschaftlich durchaus tragen. Einige Superrei-che, die in sehr öffentlicher (oder auch schon schamloser) Form den Zusammenhang von leistung und Wohlstand widerlegten, dienten der unterhaltung in magazinen, konnten jedoch der tragfähigkeit der leistungsnorm und des Ideals der leistungsgerechtigkeit keinen Abbruch tun.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Das Bild derer, die sich leistungsträger nen-nen, wird heute nicht mehr vom verantwortungsvollen mittelständischen unternehmer geprägt, sondern mehr und mehr von managern und Aktionären, die auf den schnellen Euro aus sind. Den fleißigen Häuslebauer gibt es nur noch mit beträchtlichem Startka-pital, und dass es möglich sein soll, karriere allein mit talent und Fleiß zu begründen, glauben heute am wenigsten die karrieristen selbst. leistungsträger sind vor allem die-jenigen, die über die gesellschaftliche position und die macht verfügen, sich selbst als solche zu definieren und zu deklarieren: Besserverdienende halt.
Vor dem Hintergrund eines solchen Wandels ist das leistungsideal als integrierende leitnorm ohnehin bereits ziemlich strapaziert, schließlich kann ihr ideologischer Gehalt immer weniger kaschiert werden. Das leistungsprinzip fußt auf einem vagen Verspre-chen: Jeder, der guten Willens ist und sich anstrengt, hat auch eine perspektive. Es war ausschließlich dieses Versprechen, das die offensichtlichen ungleichheiten und unge-rechtigkeiten für viele noch subjektiv erträglich machte und dafür sorgte, dass dieses leistungsprinzip trotz seiner faktischen Verlogenheit diese Gesellschaft so lange zusam-menhalten konnte. Spätestens dann jedoch, wenn menschen in großer Zahl zwar leistung
180 u. Schneider
erbringen wollen, aber nicht die chance dazu erhalten, verliert ein soziales Gerechtig-keitsideal, das sich aus dem leistungsprinzip speist, seine legitimation, seine Akzeptanz und damit letztlich seine Fähigkeit, gesellschaftlichen konsens zu erzeugen. Wenn mil-lionen von menschen keine befriedigenden perspektiven mehr sehen und wenn millionen von kindern nicht mehr lernen, an perspektiven glauben zu können – in diesem moment verliert das leistungsideal seine integrierende kraft.
kein mensch hält es aus, dauerhaft erfolglos zu sein. und doch trifft dieses Schicksal heutzutage nicht mehr nur Einzelne, sondern gleich ganze Gruppen. Die Herausbildung von Subkulturen mit eigenen Wertmustern ist zwangsläufig die Folge. Wenn wir jun-gen menschen nicht mehr das Gefühl vermitteln können, dazuzugehören, dann sind sie geradezu dazu gezwungen, eigene Gemeinschaften zu bilden. und sie werden in diesen Gemeinschaften auch ihre eigenen Erfolgskriterien definieren müssen, damit sie wieder erfolgreich sein können.
Aber auch für diejenigen, die durchaus noch einen platz in unserem System haben, verliert das leistungsideal angesichts wachsender Armut an ideeller Bindungskraft. Aus Glaube, Überzeugung oder Gewissheit werden Verunsicherung, Orientierungslosigkeit und sogar Angst. Je weiter sich Armut und Ausgrenzung auf die mitte dieser Gesell-schaft ausweiten, umso tiefer unterhöhlen sie damit das psychosoziale Fundament die-ser leistungs- und Arbeitsgesellschaft – mit heute noch gar nicht absehbaren Folgen und Dynamiken. Soll soziale Gerechtigkeit weiterhin als integrative leitnorm in dieser Gesellschaft dienen, so sind wir an einem punkt angelangt, wo uns wahrscheinlich nichts mehr anderes bleibt, als uns ehrlich zu machen und eine Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu betreiben, die soziale Gerechtigkeit wieder von der verlogenen Ideologie zum lauteren Ideal macht.
Literatur
Blüm, n. (1990). Übersicht über die soziale Sicherung. Bundesministerium für Arbeit und Sozial-ordnung (Hrsg.). Bonn: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
Schneider, u. (2010). Armes Deutschland. Neue Perspektiven für einen anderen Wohlstand. Frank-furt a. m.: Westend-Verlag.