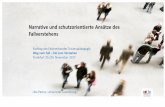Weg vom Bettgitter
Transcript of Weg vom Bettgitter
56 Heilberufe / Das P� egemagazin 2014; 66 (6)
PflegeAlltag Recht
Freiheitsentziehende Maßnahmen
Weg vom Bettgitter In der pflegefachlichen Diskussion ist bereits seit längerem eine zu-nehmend kritische Einstellung zu freiheitsentziehenden Maßnahmen, zu denen auch das Hochziehen eines Bettgitters gehört, zu verzeich-nen. Auch in der Rechtsprechung ist nun ein Paradigmenwechsel fest-zustellen. Die Tendenz geht eindeutig contra Bettgitter.
Im Rahmen der erforderlichen betreu-ungsgerichtlichen Genehmigung für das Hochziehen von Bettgittern hat den
Betreuungsgerichten in der Vergangen-heit häufig ein ärztliches Attest genügt. Mittlerweile wird deutlich stärker abge-wogen, bevor die Genehmigung für ein Bettgitter ausgesprochen wird. Viele Betreuungsgerichte wenden dabei den „Werdenfelser Weg“ an, der darauf ab-zielt, die Entscheidungsprozesse bezüg-lich der Frage, ob eine freiheitsentziehen-de Maßnahme notwendig ist, zu verbes-sern und damit im Ergebnis die Anwen-dung von freiheitsentziehenden Maßnah-men zu reduzieren. Hierfür werden gezielt ausgebildete Verfahrenspfleger einge-setzt, die sowohl über rechtliche als auch pflegerische Fachkenntnisse verfügen. Vornehmlich handelt es sich dabei um Personen, die einen Pflegeberuf erlernt haben und über eine entsprechende Be-rufserfahrung verfügen. Sie verschaffen sich regelmäßig vor Ort einen Eindruck vom Einzelfall und legen gemeinsam mit der Einrichtung ein besonderes Augen-merk auf mögliche alternative und weni-ger einschneidende Maßnahmen.
Freiheit vor SicherheitInsgesamt ist die Zahl von genehmigten Bettgittern deutlich zurückgegangen. Die gerichtliche Spruchpraxis zeigt, dass das Recht auf Freiheit und Menschenwürde eine immer stärkere Gewichtung gegen-über dem Aspekt der Sicherheit erhält. So hat die 29. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt mit einer Entscheidung vom 09.04.2013 (AZ: 2-29 T 377/12) festgehal-ten, dass das Anbringen von Bettseiten-teilen eine freiheitsentziehende Maßnah-me ist, die unverhältnismäßig sei, wenn als mildere Maßnahme die Verwendung eines geteilten Bettgitters ausreicht. Bei der Verwendung eines geteilten Bettgitters handele es sich grundsätzlich nicht um eine freiheitsentziehende Maßnahme. Etwas anders gilt allerdings, wenn das konkrete zweigeteilte Bettgitter im Ergeb-nis einem hochgezogenen Bettgitter gleichkommt, weil die betroffene Person das Bett ebenso wenig verlassen kann wie bei einem komplett hochgezogenen Bett-seitenteil. Grundsätzlich ist das Hochzie-hen eines Bettgitters hiernach als unver-hältnismäßig – und damit als nicht ge-nehmigungsfähig – anzusehen, wenn im
konkreten Einzelfall stattdessen ein zwei-geteiltes Bettgitter ebenso in Betracht kommt. Gegebenenfalls ist hier die Kom-bination mit einer polsternden Matratze vor dem Bett in Betracht zu ziehen.
Mit einer Entscheidung vom 29.11.2012 (AZ: 49 XVII HOF 3023/11) hatte das Amtsgericht Frankfurt bereits exempla-risch betont, dass der Einsatz von Bettgit-tern streng am Erforderlichkeitsgrundsatz zu messen sei und eine Genehmigung nur dann erteilt werden dürfe, wenn keine milderen Mittel zur Verfügung stünden. Finanzielle Erwägungen dürften im Rah-men der Prüfung von milderen Maßnah-men keine Rolle spielen.
Verhinderung einer Sturzgefahr ist pflegerischer StandardPflegepolitisch bedeutsam ist dabei die ausgesprochene Betonung des Gerichts, dass die Verhinderung einer Sturzgefahr ohne freiheitsentziehende Maßnahmen zu den pflegerischen Standards in Deutschland gehöre. Auch auf die sich anschließende Frage, wer denn für die damit verbundenen Anschaffungskosten verantwortlich ist und wie es sich verhält, wenn die alternativen Hilfsmittel nicht zur Verfügung stehen, hat das Amtsge-richt Frankfurt in dieser Entscheidung eine Antwort gegeben. Die Anschaffung alternativer Mittel, beispielsweise ein ab-senkbares Pflegebett, müsse von der Pfle-geeinrichtung oder durch die sozialrecht-lichen Kostenträger zur Verfügung gestellt werden.
Wendet die Einrichtung diesen pflege-rischen Standard nicht an, ist im Extrem-fall ein Umzug in eine andere Einrichtung vor einer Freiheitsentziehung mittels Bettgittern vorzuziehen. Es handelt sich dabei um eine betreuungsrechtliche Ent-scheidung. Die Konsequenz ist hiernach, dass ein Bettgitter in solchen Fällen keine betreuungsgerichtliche Genehmigung erfahren soll. Konsequenzen hat dies gleichwohl auch in haftungsrechtlicher Hinsicht. Wird nämlich das Hochziehen des Bettgitters mangels (theoretisch) zur D
OI:
10.1
007/
s000
58-0
14-0
682-
yRolf Höfert
ist Geschäftsführer des Deutschen Pflegeverbandes (DPV) und Experte für Pflegerecht. Gern greift er Ihre Fragen auf und beantwortet sie in unserer Rubrik Pflegerecht, die Sie in jeder Ausgabe finden.
HAB E N SI E N O CH FR AG E N?
57Heilberufe / Das P� egemagazin 2014; 66 (6)
Jede freiheitsentziehende Maßnahme stellt einen Eingriff in die Menschenwürde, das Recht auf persönliche Freiheit und das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung dar.
Verfügung stehender Alternativen nicht genehmigt, so darf es auch nicht hochge-zogen werden. Wird nun aber die kon-krete weniger einschneidende Alternative nicht angewandt, weil sie nicht zur Ver-fügung steht, so droht im Schadensfall eine haftungsrechtliche Verantwortlich-keit.
Die neuere Spruchpraxis der Betreu-ungs- und Zivilgerichte zeigt zudem deut-lich auf, dass das Hochziehen von Bett-gittern häufig kontraindiziert ist. Ist das Hochziehen des Bettgitters kontraindi-ziert, darf es nicht vorgenommen werden. So bei nachgewiesenem Bewegungsdrang und mangelnder Einsicht im Hinblick auf die Krankheitsbilder. Ebenso bei subjek-tiver Ablehnung des Bettgitters durch den Betroffenen. Denn in diesen Fällen ist
damit zu rechnen, dass der Betroffene das Bettgitter ablehnt und versuchen wird, das Bettgitter zu überwinden. Dies schützt dann nicht nur vor einem befürchteten Sturz, sondern bringt vielmehr sogar ein sehr viel höheres Verletzungsrisiko mit sich. Das Amtsgericht Paderborn geht in seiner Entscheidung mit Urteil vom 26.04.2011 (AZ: 57 C 680/08) sogar noch einen Schritt weiter und vertritt die Auf-fassung, dass ein bis auf 25 cm hochgezo-genes Bettgitter nur bei Bewohnern indi-ziert sei, die keinen Bewegungsdrang zeigen oder ihre Bewegungen nicht mehr willkürlich steuern können.
Sozialhilfeträger in der PflichtAußerordentlich bemerkenswert ist auch eine sozialrechtliche Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 19.03.2012 (AZ: L 2 SO 72/12 ER-B). Mit dieser Entscheidung hatte der 2. Senat des LSG eine zuvor ergangene sozialge-richtliche Entscheidung des Amtsgerichts Freiburg bestätigt, wonach der Sozialhil-feträger die Kosten für eine nächtliche 1:1 Überwachung eines Pflegeheimbewoh-ners zu übernehmen hat, wenn hierdurch eine Fixierung vermieden wird. Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt
zugrunde: Die in einer Pflegeeinrichtung lebende Bewohnerin litt unter multiplen psychiatrischen, neurologischen und in-ternistischen Erkrankungen. Aufgrund ihrer psychischen Erkrankung traten bei ihr folgende Verhaltensauffälligkeiten auf: unkontrolliertes Urinieren/Verkoten des ganzen Zimmers und des eigenen Kör-pers. Dadurch lagen sowohl eine Rutsch-, Sturz und Verletzungsgefahr, verbunden mit einem erhöhten Infektionsrisiko vor. Tagsüber konnte die Bewohnerin durch das Personal gut gelenkt und das Problem einigermaßen aufgefangen werden. Nachts allerdings konnte sie nur zur Ruhe kommen – und damit eine Fixierung ver-mieden werden –, wenn eine Person ne-ben ihrem Bett anwesend war. Die Pfle-geeinrichtung konnte dies mit dem zur
Verfügung stehenden Pflegepersonal je-doch nicht leisten.
Zur Not: Rechtschutzantrag stellenDer Betreuer der Bewohnerin stellte des-halb einen Antrag beim zuständigen So-zialhilfeträger auf Übernahme der Kosten einer nächtlichen 1:1 Überwachung. Er-wartungsgemäß lehnte der Sozialhilfeträ-ger dies ab. Um dem erheblichen Sturz-, Verletzungs- und Infektionsrisiko zu be-gegnen wurde zwischenzeitlich eine Fi-xierung vom Betreuungsgericht geneh-migt und auch durchgeführt. Der Betreu-er nahm die ablehnende Entscheidung des Sozialhilfeträgers jedoch nicht hin und stellte einen einstweiligen Rechtschutzan-trag beim Sozialgericht – mit Erfolg! Die Fixierung stelle einen Eingriff in die durch das Grundgesetz garantierte Menschen-würde und die Freiheitsrechte dar. Durch eine nächtliche 1:1 Überwachung könnten im vorliegenden Fall diese Eingriffe ver-mieden werden. Deshalb habe der Sozi-alhilfeträger die Kosten hierfür zu tragen. Dieser sozialrechtliche Anspruch er-wachse aus dem Anspruch auf Hilfe zur Pflege für so genannte „sonstige Verrich-tungen“ (§ 61 Absatz 1 Satz 2 SGB XII).
Zu diesen Verrichtungen zähle insbeson-dere die Erforderlichkeit einer Nachtwa-che zur Verhinderung selbstgefährdenden Verhaltens.
Diese Entscheidung setzt ein deutliches Zeichen. Jede freiheitsentziehende Maß-nahme stellt einen Eingriff in die Men-schenwürde (Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz), das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz) und das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) dar. Sie verbietet sich per se und kann nur ausnahmsweise un-ter strenger Berücksichtigung des Verhält-nismäßigkeitsgrundsatzes rechtmäßig sein. Stehen weniger einschneidende al-ternative Maßnahmen zur Verfügung, verbietet sie sich grundsätzlich.
Alexandra Zimmermann Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizin-und StrafrechtGünther-Wagner-Allee 5 30177 Hannoverinfo@zimmermann-heim-
recht.de