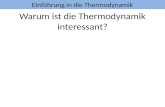„Wo man im Judentum hinschaut, ist es interessant!“
Transcript of „Wo man im Judentum hinschaut, ist es interessant!“

Beiträge zurdeutsch-jüdischenGeschichte aus demSalomon LudwigSteinheim-Institutan der UniversitätDuisburg-Essen
24. Jahrgang 2021Heft 3–4
Seite 5Fragen unbequem
Seite 8Lehren mit Musik
Seite 13Führen unterm Schirm
Seite 15Forschen in der Stadt
„Wo man im Judentum hinschaut, ist es interessant!“Alte und neue Leitung des Steinheim-Instituts im Gespräch
Frau Raspe, Sie haben vor wenigen Monaten in der Nachfolge von Michael Brocke die Leitung des Steinheim-Instituts übernommen. Was war Ihre Motivation, diese Position anzustreben?
Lucia Raspe: Unter den verschiedenen Instituten in der Bundesrepublik, die zur deutsch-jüdischen Ge-schichte forschen, zeichnet sich das Steinheim-Ins-titut ja dadurch aus, dass seine Arbeit nicht erst mit der Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert einsetzt, sondern die vormodernen Grundlagen deutsch-jüdischer Kultur ausdrücklich einschließt. Das kommt meinen eigenen Interessen sehr entge-gen, und dem hat auch die Ausschreibung insofern Rechnung getragen, als sie die dazu erforderliche judaistisch-hebraistische Kernkompetenz beson-ders hervorgehoben hat. Ich verstehe dies als einen Auftrag, die erfolgreiche Arbeit weiterzuführen, die das Institut unter Ihrer Leitung, Herr Brocke, in Forschung und Vermittlung geleistet hat.
Michael Brocke: Ich habe das Steinheim-Institut nun fünfundzwanzig Jahre lang geleitet, auch über meine Emeritierung hinaus. Das war ein schöner, aber auch sehr verantwortungsvoller Job. Mein Lehrstuhl war ja zunächst von Duisburg nach Düs-seldorf verlegt und dann, nach meinem Ausschei-den, nicht wieder besetzt worden, so dass es eine sozusagen „natürliche“ Nachfolge nicht gab. Ich freue mich deshalb sehr und bin ebenso dankbar wie erleichtert, dass das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen unserer Johannes-Rau-Forschungsge-meinschaft jetzt eine eine neue Professur an der Universität Duisburg-Essen geschaffen hat, zu de-
ren Aufgaben es gehört, das Institut hauptamtlich zu leiten. Das ist ein großer Fortschritt und eine nachhaltige Aufwertung unserer Arbeit.
Frau Raspe, Sie sind zwar erst kurz im Amt, aber das STI und Sie, das ist doch schon eine längere Be-kanntschaft?
LR: Aus meiner Perspektive – ich hatte ja in Berlin bei Ihnen, Herr Brocke, studiert – ist das Stein-heim-Institut in dem Moment auf der Landkarte erschienen, als Sie von der Freien Universität nach Duisburg zurückkehrten. Danach hat es sich sehr nachhaltig positioniert. Es gab damals das erste Kolloquium, zu dem ich als Doktorandin eingela-

2
den war und das dann unter dem Titel „Neuer An-bruch“ als Buch erschienen ist ...
MB: Ich war 1996 am Steinheim-Institut interes-siert, weil es die Chance bot, ein tatsächlich deutsch-jüdisches Institut zu verwirklichen – eines, das nicht erst in der Haskala anfängt oder bei der Emanzipation oder das vorrangig Antisemitismus-forschung macht. Ich war schon damals der Mei-nung, dass es nicht angeht, über die Schoa, über den Holocaust Zugang zum Judentum zu gewin-nen, sei es rückwärts, sei es vorwärts, sei es in die Gegenwart. Wir haben damals noch nicht über das Mittelalter geredet – da war Ihre Arbeit eine Aus-nahme –, aber der Akzent lag natürlich schon wei-ter zurück. Wir wollten das Innerjüdische, die Reli-gion, die Kultur erforschen – das sollte in den Vor-dergrund treten. Und die Hebräischkenntnisse.
LR: Sie haben dann – gemeinsam mit Ihren Mitar-beiter:innen – eine Reihe neuer Schwerpunkte ge-setzt. „Zwischen Sprachen“ war so ein Thema; die Beschäftigung mit Memorialkultur auf unterschied-liche Weisen; das Frauenthema. Das hat auch die Forschungslandschaft verändert. Denken Sie an das „Forum Jüdische Geschichte und Kultur in der Frü-hen Neuzeit“, das damals im Umfeld des Instituts gegründet wurde und das in den über zwanzig Jah-ren seines Bestehens eine feste Größe geworden ist.
MB: Sie haben recht. Bevor ich kam, war das Stein-heim-Institut eins von mehreren, die alle – mit ver-schiedenen Schwerpunkten – im 18., 19., 20. Jahr-hundert ansetzen. Das habe ich geändert. Ich brachte ja auch Erfahrungen aus meiner früheren
Zeit in Duisburg mit. Und ich muss Ihnen ja nicht sagen: Wo man im Judentum hinschaut, ist es inter-essant! Dass das Friedhofsthema so prominent ge-worden ist, verdankt sich der zunehmenden Wahr-nehmung, dass das eine völlig unerschlossene Quel-le jüdischer Kultur war – nicht auf die großen Ge-lehrten fokussiert, aber so interessant in Hinsicht auf die große Vielfalt des Judentums. Das zeigen die Friedhöfe: ein dauerndes Spiel von Formel und Freiheit. Wie etwa – unter den großen Gemeinden im Mittelalter – Würzburg anders ist als Worms und Regensburg wieder anders als Würzburg. Und die Friedhöfe sind eine solch reiche Quelle für die Kultur der Frauen. Es gibt immer ein paar mehr Männergrabsteine als solche von Frauen, aber es ist ausgewogen. Wo haben Sie das sonst? Und dann der schlichte Charme dieser Landfriedhöfe! Also das macht doch viel Vergnügen.
Können Sie sich vorstellen, Herr Brocke, dass Sie das, was Sie am Steinheim-Institut aufgebaut haben – die epigraphische Datenbank epidat, die digitale Methodik, das, was man heute Forschungsdateninf-rastruktur nennt – als Uni-Professor ohne das Insti-tut so hätten aufbauen können? Mit Leuten, die in-haltlich arbeiten, die promovieren wollen, die eine Forschungsfrage haben im Bereich der Judaistik?
MB: Nein, ich glaube, das wäre sehr viel schwieri-ger gewesen. Nicht nur wegen der Befristungen, die dem Aufbau von Infrastruktur grundsätzlich im Wege stehen, sondern auch, weil hier sehr viel ad-ministrative Flexibilität erforderlich ist, um sich mit Kommunen, mit Privatleuten, mit Lokalhistori-kern, mit Geschichtsvereinen, nicht zuletzt mit den jüdischen Gemeinden und Verbänden auseinander-zusetzen und mit ihnen Verträge über die Doku-mentation des jeweiligen Friedhofs zu schließen. Ich hatte natürlich schon in Berlin den Wunsch, da etwas aufzubauen. Aber ich hätte das nicht so ver-stetigen können, wie ich das hier, an einem außer-universitären Forschungsinstitut innerhalb der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, konnte.
Welche Schwerpunkte, Frau Raspe, sehen Sie für die zukünftige Forschung des Instituts?
LR: Die Grabsteinepigraphik wird natürlich ein Thema bleiben – eins, das sich in verschiedene Richtungen ausbauen, an neue Forschungsfragen andocken lässt. Damit meine ich nicht allein die In-tegration unserer Arbeit in umfassendere Angebote

3
wie das PEACE-Portal*. Nehmen Sie den Antrag für das Langzeitvorhaben, den wir eben neu einge-reicht haben. Die Erforschung der frühneuzeitli-chen Friedhöfe hat enormes Potential für die histo-rische Forschung, beispielsweise in Bezug auf die Raumorganisation nach den Vertreibungen aus den alten urbanen Zentren am Ende des Mittelalters. Wir wissen noch nicht sehr viel darüber, wie sich das Friedhofsnetz zum Siedlungsnetz, zu den Rab-binatsbezirken, zu den territorial zersplitterten Herrschaftsräumen verhält. Da sind die Friedhöfe und ihre Inschriften selbst eine wichtige Quelle. Oder nehmen Sie die Memorbücher, in denen die Namen der Verstorbenen der jeweiligen Gemeinde für die synagogale Verlesung verzeichnet wurden. Auch da hat das Steinheim-Institut bereits erste Editionen vorgelegt. Das bietet sich insofern an, als das Institut schon seit einigen Jahren auf dem Ge-biet der digitalen Prosopographie unterwegs ist. Zugleich ist der kulturhistorische Stellenwert dieses Genres, das auf die Märtyrerlisten des Mittelalters zurückgeht, noch nicht wirklich geklärt. Oder den-ken Sie an die sozialen Aspekte der Begräbniskultur – die Beerdigungsvereine, die wohltätigen chewrot.
Am Steinheim-Institut ist ja seit einigen Jahren der Arbeitskreis Jüdische Wohlfahrt beheimatet. Erst kürzlich war er in Berlin an dem Festakt der Zen-tralwohlfahrtsstelle zum 70. Jahrestag ihrer Wieder-gründung 1951 beteiligt.
MB: Wichtig war mir bei diesem Thema der Über-gang von der gemeindlichen, rein innerjüdischen Zedaka, der Übergang von diesen ganzen kleinen chewrot hin zu einer organisierten, sozialwissen-schaftlich fundierten Wohlfahrt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der aus dem Innerjüdischen her-auskommt und sich in die große Welt hineingear-beitet hat.
LR: Dieser Übergang vom traditionellen Vereinswe-sen in die moderne Wohlfahrtspflege ist in der Tat bislang noch kaum erforscht. Das ist ein Thema, das dem Steinheim-Institut sicherlich gut anstehen wür-de. Wir sprachen vorhin davon: Was kann ein außer-universitäres Forschungsinstitut leisten, das man an der Uni nicht kann? Dazu gehört die Grundlagen-forschung, die Erschließung neuer Quellenbestän-de. Da sind beispielsweise die frühneuzeitlichen jü-dischen Briefe, teils in jiddischer, teils in hebräischer Sprache, die aus unterschiedlichen Anlässen be-
schlagnahmt wurden und seither in öffentlichen Ar-chiven liegen, oder die seit den 1980er Jahren ge-borgenen Funde aus den genisot frühneuzeitlicher Landsynagogen – eine reiche Quelle für die zeitge-nössische jüdische Buchkultur abseits der urbanen Zentren. Ich selbst beschäftige mich seit einigen Jah-ren mit den sogenannten minhagim-Büchern, litur-gischen Brauchsammlungen, die seit dem Mittelal-ter in hebräischer Sprache überliefert sind, seit Ende des 15. Jahrhunderts dann in die Volkssprache über-setzt werden. Die sind in vielfacher Hinsicht inter-essant für die Art und Weise, wie die Traditionen des mittelalterlichen Aschkenas in die frühe Neuzeit kommen. Von Haus aus ist der liturgische Ritus ge-rade in Aschkenas ja eine eminent lokale Angelegen-heit; jede Gemeinde, jede Region hatte ihre eigenen Gepflogenheiten. Wenn dann am Ende des Mittelal-ters die Juden beinahe flächendeckend vertrieben werden, gerät die liturgische Landkarte damit not-wendigerweise in Bewegung. Zugleich bringt das neue Medium des Buchdrucks eine gewisse Verein-heitlichung mit sich. Und schließlich wird die religi-öse Tradition durch die Übersetzung in die Volks-sprache – wie in den nichtjüdischen Umgebungsge-sellschaften auch – breiteren Schichten zugänglich als je zuvor. Die jiddische Druckausgabe der minha-gim, die zuerst 1589 in Venedig erschien, war unter den Juden Mitteleuropas bis ins 19. Jahrhundert weit verbreitet, ist jedoch bis heute weder wissen-schaftlich ediert noch übersetzt. Mir scheint, dass gerade hier – in der Erschließung solcher Quellen, die das religiöse Leben der aschkenasischen Jüdin-nen und Juden beyond the elite in den Fokus bringen – eine Aufgabe für die deutsche Judaistik liegt.
* https://peace.sites.uu.nl/

4
Sie meinen im internationalen Kontext? Sie publi-zieren ja, wenn ich richtig sehe, schon seit einigen Jahren vorwiegend auf Englisch.
LR: Ich hatte das Glück, schon früh mit der inter-nationalen Forschungslandschaft in Berührung zu kommen – erst durch das Studium in Jerusalem, dann durch eine Reihe von Auslandsaufenthalten seit der Promotion. Insofern sehe ich unsere Arbeit selbstverständlich im internationalen Zusammen-hang. Die grundsätzliche Mehrsprachigkeit der westaschkenasischen Judenheit, die hebräische und die jiddische Seite der Überlieferung samt allen Mischformen, wie sie gerade für die Quellen der frühen Neuzeit charakteristisch sind – all das er-schließt sich uns vielleicht doch ein bisschen leich-ter als anderen. Dabei bleiben die judaistischen Kernkompetenzen natürlich unabdingbar für das Verständnis solcher Ausdrucksformen einer religiö-sen Alltagskultur. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten, und da sehe ich mich hier am Steinheim-Institut definitiv am richtigen Ort. Zugleich gibt mir die neue Professur für deutsch-jüdische Ge-schichte, mit der die Leitung des Instituts verbun-den ist, die Möglichkeit, auch ein bisschen in die Breite zu wirken und jüdische Geschichte wieder als eine feste Größe im Lehrangebot der Universität Duisburg-Essen zu verankern.
MB: Das ist der Spagat des Instituts: dass man ver-mitteln möchte. Das ist ja auch dem Kalonymos ein großes Anliegen. Und das macht auch einen nicht geringen Teil unserer Arbeit in der Grabsteinepigra-phik aus. Weil ich meine, dass das ganz wichtig ist: dass man mit den Leuten, die sich um einen Friedhof in einem kleinen Ort in Franken oder in Hessen oder im Saarland kümmern, in Kontakt bleibt; dass man versucht, über den Friedhof hinaus bei der Ju-gend und bei anderen Interessierten Verständnis zu wecken für das Judentum. Ich kann mich noch erin-nern, wie ich in Krefeld auf dem Friedhof Führun-gen gemacht habe für Schulkinder. Die quicken tür-kischen Mädchen und Jungen! Da war ein zwölf-, dreizehnjähriger Junge, der dann – nachdem ich er-klärt hatte, hier gibt es tolle moderne Grabsteine von Leopold Fleischhacker** – auf dem Friedhof umhersprang und rief: „Das! Das ist auch von Fleischhacker. Das sieht genauso aus!“
Frau Raspe, Herr Brocke sprach vorhin das Thema Antisemitismus an. Das ist ein Thema, das immer
wieder – und gerade jetzt, aus leider zunehmend ge-gebenem Anlass – an das Institut herangetragen wird. Wie werden Sie damit umgehen?
LR: Grundsätzlich – da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Brocke – ist es nicht unsere Aufgabe, den An-tisemitismus zu erforschen. Es gehört aber sehr wohl zu den Zielen unseres Instituts, Präventions-arbeit zu leisten. Deshalb gefällt mir das neue Pro-jekt Net Olam so gut, das wir in der Förderlinie „Aktuelle Dynamiken und Herausforderungen des Antisemitismus“ des Bundesministeriums für Bil-dung und Forschung* durchführen. In Zusammen-arbeit mit der Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdi-sche Architektur in Europa in Braunschweig und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege er-forschen wir da Ausdrucksformen des Antisemitis-mus, wie sie den Kolleg:innen in der Epigraphik seit Jahren und Jahrzehnten in Form von Friedhofs-schändungen begegnen. Ich habe im Sommer auf einer gemeinsamen Exkursion zu einer Reihe von Friedhöfen in Franken einen Eindruck davon be-kommen. Das Ausmaß und die Hintergründe sind praktisch noch nicht erforscht. Da können wir also zum einen unsere spezifische wissenschaftliche Ex-pertise einbringen. Zum anderen zielen wir darauf ab, mit all unseren vielfältigen Kontakten, die sich aus der jahrzehntelangen Erfahrung in Forschung und Vermittlung ergeben, ein Netzwerk zur Prä-vention aufzubauen – auch jenseits der Großstädte. Im Grunde besteht da kein Widerspruch. Unsere primäre Aufgabe ist es, Wissen unters Volk zu brin-gen. Das ist Antisemitismusprävention. Und die Er-fahrung lehrt, dass die Beschäftigung mit dem jüdi-schen Kulturerbe vor Ort ein ganz wichtiger Ein-stieg ist – eine Möglichkeit, Interesse zu wecken, Identifikation zu ermöglichen in dem Sinne, dass die jüdische Geschichte des eigenen Ortes Teil un-serer eigenen Geschichte ist.
MB: Und dass jüdische Werte und jüdische Ideale und jüdische Lebenskraft – dass das Werte sind, die relevant sind, die positiv sind. Das Positive daran: die Fähigkeit, Buchstaben und Geist immer wieder in die Balance zu bringen; die Überlebensfähigkeit; die Fähigkeit zu transformieren, zu transponieren und aus den alten Texten immer wieder neue Fun-ken zu schlagen, Licht!
Das Gespräch führte Harald Lordick.
** Barbara Kaufhold: Das Werk
Leopold Fleischhackers: Virtu-
ell ausgestellt, Kalonymos 16
(2013), 3, S. 9–11
* https://www.geistes-und-so-
zialwissenschaften-bmbf.de/
de/Aktuelle-Dynamiken-und-
Herausforderungen-des-Anti-
semitismus-2292.html
Lucia Raspe studierte Judaistik und Nordamerikanistik in Tübin-
gen, Chapel Hill (North Carolina), Berlin und Jerusalem und
schloss ihr Studium 1994 an der Freien Universität ab. Seit 1998
war sie zunächst Wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann Wissen-
schaftliche Assistentin am Seminar für Judaistik der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main, wo sie 2003
promovierte und sich 2011 habilitierte. Schwerpunkte ihrer For-
schung liegen auf dem Gebiet des aschkenasischen Judentums in
Mittelalter und früher Neuzeit. Nach Lehrstuhlvertretungen in
Bochum, Potsdam und München und Forschungsaufenthalten in
Philadelphia, Jerusalem, Paris und Oxford war sie von 2015 bis
2019 Kuratorin im Team der neuen Dauerausstellung am Jüdi-
schen Museum Berlin. Seit Juni 2021 ist sie Professorin für
deutsch-jüdische Geschichte und Direktorin des Steinheim-Insti-
tuts an der Universität Duisburg-Essen.

5
Eine unbequeme FrageJakob J. Petuchowski
iniges hat sich doch seit dem Mittelalter geän- dert. Man setzt sich heutzutage zum „christlich-
jüdischen Gespräch“ hin, ohne dabei in erster Linie an „Mission“ zu denken. Es steht nicht auf dem Programm, dass der christliche Gesprächspartner zum Judentum oder der jüdische Gesprächspartner zum Christentum „bekehrt“ werden soll. Dennoch kommen Konversionen gelegentlich vor. Das braucht noch nicht einmal als Konsequenz eines „Dialogs“ geschehen – wie das von vielen orthodo-xen Juden gefürchtet wird, die deshalb auch in ih-rer Mehrheit das theologische „christlich-jüdische Gespräch“ meiden. (Nicht-theologische Gespräche, bei denen es sich um die Verbesserung der Welt handelt, sind nicht Gegenstand dieser Furcht.) Aber die meisten heutigen Konvertiten vom Judentum zum Christentum oder vom Christentum zum Ju-dentum waren gewiss nie Teilnehmer an „christ-lich-jüdischen Gesprächen“. Die Konversionen fin-den eher statt als Nebenprodukt von Mischehen, aus innerer Unzufriedenheit mit der angestammten Religion, durch plötzliche Erfahrungen „auf dem Weg nach Damaskus“ und dergleichen mehr. Im-merhin, und darum geht es, sie kommen vor.
Wie sich die „verlassenen“ Religionen zu den Konvertiten, die zur „anderen“ Religion übergetre-ten sind, verhalten, mag als Maßstab dafür gelten, ob wir tatsächlich das intolerante Mittelalter hinter uns gelassen haben. So behauptet Johann Maier mit Recht: „Aber solange das Judentum sich eine Sen-dung für die Welt zuschreibt und das Christentum sei-nen im NT verankerten Anspruch nicht preisgibt, wird es Konversionen geben, und beide Seiten müs-sen sich u.a. daran messen lassen, ob sie das Grund-recht auf persönliche freie Entscheidung gelten lassen und auch im menschlichen Umgang respektieren.“1
Dem Schreiber dieser Zeilen sei es erlaubt, sich hier als Illustration einer persönlichen Erfahrung zu bedienen. In einer größeren Stadt im amerikani-schen Bundesstaat Texas hielt er jüngst ein Referat im Rahmen eines „christlich-jüdischen Gesprächs“. Bei der nachfolgenden Diskussion wurde die Frage gestellt, wie sich denn der Referent zu den soge-nannten „Juden für Jesus“ verhält, d.h. es wurde zu der oben erwähnten Aussage Johann Maiers die Pro-be aufs Exempel gestellt. Der Referent antwortete, dass er sich diesbezüglich noch nicht ganz im Klaren sei, weil, seiner Meinung nach, das heutige Juden-tum dieses Problem noch nicht genügend durch-dacht hat. Er meinte aber, dass man im 20. Jahrhun-
dert die mittelalterliche Einstellung nicht ganz so einfach übernehmen könne, da sich inzwischen so manches geändert hätte – nicht zuletzt die Tatsache, dass, während im Mittelalter viele jüdische Konver-titen zum Christentum sich entweder einer Zwangstaufe unterzogen oder bewusst mit der vä-terlichen Religion brechen wollten, viele der heuti-gen jüdischen Konvertiten zum Christentum ganz aufrichtig und bewusst weiterhin Juden bleiben wol-len. Verleumdungen der Juden und des Judentums, Anklagen, die zu Zwangsdisputationen, Bücherver-brennungen und Scheiterhaufen führen, gehen von den heutigen Judenchristen nicht aus. Man müsse daher im heutigen Judentum andere Kategorien als im Mittelalter finden, um diese Menschen richtig einzustufen. Aber wie diese Kategorien aussehen werden, weiß der Referent noch nicht. Man befasse sich ja mit einem ganz neuen Phänomen.
Der wütende Brief, der ein paar Tage später von dem orthodoxen Ortsrabbiner einlief, war keine Überraschung. Der orthodoxe Kollege wollte klar-machen, dass der Referent ganz und gar nicht im Namen der „jüdischen Mehrheit“ gesprochen hatte – was allerdings der Referent nie von sich selbst be-hauptet hatte. Im Gegenteil, er hatte am Anfang seines Referats die Frage aufgeworfen: „Welches Ju-dentum steht welchem Christentum gegenüber?“, und er hatte angegeben, bei diesem Gespräch nur seine persönliche Meinung zu vertreten. Das aber war offensichtlich eine Meinung, die von seinem orthodoxen Kollegen nicht geteilt wurde. Falsch war es allerdings, dem Referenten zu unterstellen, dass er tatsächlich schon zu dem Entschluss gekom-men sei, die „Juden für Jesus“ als jüdische Glau-bensbrüder anzuerkennen. Dieser Entschluss steht nämlich bei dem Referenten immer noch aus, denn das Problem ist ein höchst kompliziertes.
Aber was Schreiber dieser Zeilen seinem ortho-doxen Kollegen geantwortet hat, mag von allge-meinem Interesse sein. Er schrieb ihm, dass bei der jüdischen Beurteilung von jüdischen Konvertiten zum Christentum drei verschiedene Stadien streng getrennt werden müssen: die Zeit des Urchristen-tums, das Mittelalter und die Moderne. Über das Mittelalter können wir uns einig sein. Die Taufe, wie oben schon angedeutet, wurde bewusst als Ab-sage an das Judentum gewählt, so weit es sich nicht um Zwangstaufen handelte, und viele jüdische Konvertiten zum Christentum haben ihren ehema-ligen jüdischen Glaubensgenossen viel Leid und
E

6
JUDENCHRISTEN
Schmerz zugefügt. Dass die jüdische Beurteilung dieser Konvertiten absolut negativ ausfallen muss-te, ist selbstverständlich und unumstritten.
Weniger selbstverständlich und unumstritten ist dagegen die Beurteilung der Judenchristen im klas-sischen rabbinischen Zeitalter. Zu einem Bruch zwischen Judentum und Christentum ist es natür-lich gekommen, obwohl dieser Bruch vielleicht ur-sprünglich eher „politisch“ als „theologisch“ war.2 Dennoch hat sich dieser Bruch gewiss nicht plötz-lich und in einem Schlag vollzogen. Die Kirchenvä-ter der ersten paar christlichen Jahrhunderte wissen noch von Judenchristen zu berichten, die sich abso-lut als Juden fühlten. Sie fanden es auch notwen-dig, Heidenchristen davor zu warnen, sich jüdische Gebräuche und Feiertage anzueignen.
Auch auf rabbinischer Seite scheint man eine ganze Weile noch die Judenchristen als irgendwie noch zur jüdischen Gemeinschaft zugehörig be-trachtet zu haben. In der zweiten Hälfte des 3. Jahr-hunderts lehrte Rabbi Simeon ben Laqisch, dass das Höllenfeuer den „Sündern Israels“ (poscheʻé jisrael) nichts anhaben kann, da diese Sünder so voll von re-ligiösen Handlungen (mizwoth) sind wie ein Gra-natapfel von Kernen (bḤagigah 27a; bErubhin 19a). Sein Zeitgenosse Rabbi Simeon Ḥasida lehrte, dass kein Fasttag als richtiger Fasttag angesehen werden kann, wenn die „Sünder Israels“ nicht an ihm teil-nehmen (bKerithoth 6b). Nun hat der jüdische Ge-lehrte Arthur Marmorstein (1882–1946) in einer längeren Studie behauptet, dass es sich bei diesen „Sündern Israels“ um Judenchristen handelt, die deshalb „Sünder Israels“ genannt wurden, weil sie in einigen Dingen von der jüdischen Gesamtheit abge-wichen sind, in anderen aber noch ganz der jüdi-schen Gemeinschaft zugerechnet wurden – ja sogar wegen ihres Eifers in der Gesetzeserfüllung von Rabbi Simeon ben Laqisch gelobt wurden.3
Das ist eine Hypothese, die von der heutigen Wissenschaft nicht allgemein und unbedingt akzep-tiert wird. Aber in der Replik an den orthodoxen Rabbiner in Texas wurde diese Hypothese dennoch ins Feld geführt, weil Arthur Marmorstein ein streng orthodoxer Rabbiner war, der als Professor am Jews’ College, dem orthodoxen Rabbinersemi-nar in London, lehrte. Sein Sohn Emile schrieb in einer Würdigung seines Vaters, die den Aufsätzen Arthur Marmorsteins vorangeht: „Das Leben und die Lehre meines Vaters wurden hauptsächlich von seiner Überzeugung von der Wahrheit des Juden-tums beeinflusst. Er übernahm ohne Vorbehalt die
Lehre von der göttlichen Offenbarung des ‚Ge-schriebenen‘ und des ‚Mündlichen Gesetzes‘ am Berge Sinai. Es war ihm daher einfach und logisch, das Judentum als Lebensweg zu praktizieren.“ 4
Ob nun die Hypothese Marmorsteins wissen-schaftlich haltbar ist oder nicht, mag hier dahinge-stellt bleiben. Fest steht auf jeden Fall, dass sich ein orthodoxer Rabbiner und Lehrer von orthodoxen Rabbinern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlauben konnte, damit zu rechnen, dass noch im 3. Jahrhundert die Judenchristen in Palästina als Juden galten und sogar von einer Autorität wie Simeon ben Laqisch gewissermaßen gelobt werden konnten – wenn man auch von ihren Abweichungen vom Wege der Gesamtheit wusste. Warum also muss sich ein orthodoxer Rabbiner am Ende des 20. Jahrhunderts zu der Behauptung versteigen, dass die mittelalterli-che jüdische Beurteilung von jüdischen Konvertiten zum Christentum schon seit eh und je bestand und dass sie immer einheitlich war? Dazu verpflichtet ihn gewiss nicht seine Orthodoxie, sondern nur ein Mangel an geschichtlichem Verständnis.
Wenn es aber möglich ist, zwischen der jüdi-schen Beurteilung von Judenchristen im klassischen rabbinischen Zeitalter und der jüdischen Beurtei-lung von „Apostaten“ im Mittelalter zu unterschei-den, dann sollte es nicht weniger möglich sein, zwi-schen der mittelalterlichen Beurteilung und der Be-urteilung von heutigen jüdischen Konvertiten zum Christentum zu unterscheiden. Leicht wird eine derartige Unterscheidung allerdings nicht sein. Das heutige Christentum, um welche Richtung in ihm es sich auch handeln mag, ist ja schließlich nicht mit dem Christentum der ersten drei Jahrhunderte identisch. Wenn es auch klar ist, dass die meisten heutigen Konvertiten zum Christentum durch ihre Konversion ihr Judentum nicht verleugnen wollen, so bleibt doch das Judentum aller Richtungen den Tendenzen gegenüber empfindlich, die als „Auflö-sungsprozess“ des Judentums und als „Untergra-bung“ seiner Struktur verdächtigt werden können. Auch das Bewusstsein, „gefährdete Minorität“ in einer nichtjüdischen Welt zu sein, spielt dabei im-mer noch eine erhebliche Rolle. Dazu kommt, dass das heutige Judentum noch ganz am Anfang steht mit einem Vermögen, etwa zwischen den verschie-denen Möglichkeiten des Messiasglaubens und zwi-schen einer theologischen Trinitätslehre und einem Glauben an drei Götter zu unterscheiden.
Kompliziert wird das Problem auch dadurch, dass es sich bei der amerikanischen „Juden für Je-
Anmerkungen
1. Johann Maier: „GeschichtlicheEinführung“ zum Teil „Judentumund Christentum“, in: ChristlicherGlaube in moderner Gesellschaft
(Freiburg i. Br.: Herder, 1980),S. 135.
2. Siehe Jakob J. Petuchowski:„Der Ketzersegen“, in: Michael
Brocke, Jakob J. Petuchowski(Hrsg.), Das Vaterunser (Freiburg i.
Br.: Herder, 1974), S. 90–101.
3. Arthur Marmorstein: Studies inJewish Theology (London: Oxford
University Press, 1950),S. 179–224.
4. Ebd., S. xxiii.
5. Siehe z.B. Cornelia und IrvingSüssman in: John M. Oesterrei-
cher (Hrsg.), The Bridge, Bd. 1(New York: Pantheon Books,
1955), S. 96–117.
Foto Seite 7: privat

7
CHRISTENJUDEN
sus“-Bewegung durchwegs um buchstabengläubige, biblische Fundamentalisten handelt, wobei doch selbst die jüdische Orthodoxie durch ihren Glau-ben an die „mündliche Lehre“, ohne die man die „schriftliche“ Torah gar nicht verstehen kann, ei-nen konsequenten biblizistischen Fundamentalis-mus nicht nachvollziehen kann. Es sei wieder auf ein persönliches Erlebnis hingewiesen:
Schreiber dieser Zeilen verbrachte einmal eine Woche in einem Nonnenkloster, um die Schwestern in talmudicis zu unterrichten. Beim Festmahl am Ende der Woche saß er zwischen einem Prälaten und einem Benediktinermönch. Über die jüdische Her-kunft des Prälaten wusste er Bescheid. Aber auch der Mönch erzählte von der jüdischen Erziehung, die er als Kind genossen hatte. So saßen dann drei gebür-tige Juden zusammen, der Rabbiner zwischen dem Prälaten und dem Mönch. Bei der guten Mahlzeit unterhielt man sich großartig – und ganz ökume-nisch. Nach einer Weile gesellten sich zwei Gäste zu uns, „Juden für Jesus“ aus der Nachbarschaft. Da hörte auf einmal die Unterhaltung auf. Man saß still-schweigend am Tisch. Schließlich nahmen die „Ju-den für Jesus“ ihren Abschied. Da sprach der Mönch zu dem Prälaten und dem Rabbiner: „Es ist doch ko-misch. Wir drei können uns großartig unterhalten, denn wir haben eine gemeinsame Sprache. Aber die-se gemeinsame Sprache fehlt uns mit den ‚Juden für Jesus‘.“ Gemeint damit war natürlich nicht die ge-meinsame jüdische Herkunft, sondern die wissen-schaftliche Ausbildung und das nicht-buchstaben-gläubige Verständnis der Heiligen Schrift, die den „Juden für Jesus“ total abging. Und das ist es auch, was die „Juden für Jesus“ für das heutige Judentum so besonders problematisch macht. Den Buchsta-benglauben hat das historische Judentum den Sek-ten der Sadduzäer im Altertum und der Karäer im Mittelalter überlassen. Es wird ihn wohl heute kaum aufnehmen, nur um dadurch mit den „Juden für Je-sus“ besser ins Gespräch zu kommen.
Damit ist natürlich die unbequeme Frage noch keineswegs beantwortet. Es gibt ja schließlich auch Juden, die zu anderen Formen des Christentums übergetreten sind und mit denen ein Gespräch auf nicht-fundamentalistischer Basis möglich wäre. (Franz Rosenzweig hat sich ja so mit seinen christlich getauften Verwandten und Freunden unterhalten – und wäre selber ein derartiger „Christ aus dem Ju-dentum“ geworden, hätte ihn nicht sein religiöses Er-lebnis am Versöhnungstag 1913 davon abgehalten.)
Aber mit dieser unbequemen Frage müssen sich
die heutigen Juden erst noch beschäftigen. Aus dem Wege können sie ihr auf die Dauer nicht gehen. Und auch die Christen müssen erst noch ins Klare kommen über die parallele Frage: wie denn die heutige Kirche zu einem bewussten Judenchristen-tum stehen würde, d.h. mit christusgläubigen jüdi-schen Menschen, die sich an die Vorschriften der Torah halten. Dass Paulus den Weg der Torah für Heidenchristen verwirft und tadelt, ist ausgemacht. Die Neutestamentler sind sich aber noch gar nicht darüber einig, wo Paulus diesbezüglich den Juden-christen gegenüber steht, ja auch darüber, wie er es mit sich selbst gehalten hat.
„Jesu Jude-Sein als Zugang zum Judentum“ ist der vielsagende Titel eines von Willehad Paul Eckert und Hans Hermann Henrix herausgegebe-nen, 1980 in zweiter Auflage erschienenen Buches. Marc Chagalls Gemälde „Kreuzigung in gelb“ (1943), wo Jesus am Kreuz mit den tephillin (Ge-betsriemen) an der Stirn und auf dem Arm darge-stellt wird, fand positive Beurteilung von christli-cher Seite.5 Aber das Verständnis von Jesu Judesein und die Beschäftigung mit dem ursprünglichen Ju-denchristentum sind ja sozusagen historische For-schung, die zwar das gegenseitige Verständnis er-heblich fördert, die aber dennoch für die heutige christliche Einstufung von bewussten und nach jü-dischem Religionsgesetz lebenden heutigen Juden-christen so wenig aussagt wie, von jüdischer Seite aus, Marmorsteins Behandlung der talmudischen Einstellung zu den ursprünglichen Judenchristen.
Um die Frage noch unbequemer zu machen, müs-sen wir auch auf die heutige konkrete Situation hin-weisen. Es geht doch in der Mehrzahl der Fälle gar nicht um jüdische Konvertiten zum Christentum, die entweder vor oder nach ihrer Taufe das jüdische Re-ligionsgesetz beobachten. Und es geht auch nicht um Juden gewordene Christen, die ihren Ruf als Chris-ten aufrecht erhalten wollen. Es geht vielmehr um Konvertiten (in beide Richtungen) und um die Stel-lungnahme zu ihnen seitens der „verlassenen“ Reli-gionen. Die Antwort wird wahrscheinlich davon mitbeeinflusst werden, ob man sich an die Annahme von „einem Bund“ oder an die Annahme von „zwei Bünden“ hält. Im letzteren Fall wird es fraglich sein, ob man nach Belieben von dem einen Bund in den anderen umschalten kann. Rosenzweig hatte das für unzulässig gehalten. Andere mögen darüber anders urteilen. Jedenfalls steht die Antwort noch aus. Die Suche nach ihr darf aber im christlich-jüdischen Ge-spräch nicht vernachlässigt werden.
Jakob J. Petuchowski (30. Juli 1925 Berlin – 12. No-vember 1991 Cincinnati) war Professor für jüdisch-christliche Studien am Hebrew Union College, Cin-cinnati, Ohio, U.S.A., und Rabbiner am B’nai Israel Tempel in Laredo, Texas, U.S.A. Er entstammte einer orthodoxen Familie, Groß-vater war Rabbiner Dr. Markus Petuchowski (1866–1926). Im Mai 1939 gelang-te er durch einen „Kinder-transport“ nach Schottland. Er lernte in Jeschiwas in Glasgow, London und den USA. 1968 veröffentlichte er das Pionierwerk „Prayer-book Reform in Europe“. Besonders lesenswert sind seine unpolemischen Erin-nerungen an seinen Weg von der Orthodoxie hin zum Reform Judaism: „Mein Ju-desein. Wege und Erfahrun-gen eines deutschen Rabbi-ners“ (Freiburg 1992). Petu-chowski ist ein unvergesse-ner Dialogpartner in der jüdisch-christlichen Annähe-rung in Deutschland seit den 70er Jahren. Ein großzügi-ger, herzlicher, in sich ruhen-der „mentsh“, eine Figur des „großen Judentums“ – nicht der „kleinen Judentümer“ (Leo Baeck). mb

8
JUDENCHRISTEN
Die musikalische Ausbildung an den jüdischen Lehrerseminaren in Düsseldorf und Köln 1867–1933Klaus Wolfgang Niemöller
n dem eben erschienenen Tagungsband Jüdische Musik im süddeutschen Raum hat Geoffrey Gold-
berg (Jerusalem) im Rahmen seiner Darstellung der Aufgaben eines Chasans auch auf deren Ausbildung in Deutschland im 19. Jahrhundert hingewiesen. Unter den Orten, in denen ein jüdisches Lehrerse-minar gegründet wurde, werden neben Würzburg und Hannover auch Düsseldorf und Köln genannt, finden aber keine nähere Erläuterung. Doch führen die im Quellenverzeichnis von Goldberg genannten „Berichte“ der Lehrerseminare in Düsseldorf 1869 sowie in Köln 1908 weiter. Sie ergänzen die 1985 als Staatsexamensarbeit an der Universität zu Köln verfassten „Beiträge zu einer Geschichte des jüdi-schen Lehrerseminars in Köln“ von Tatjana Leh-mann, die sich u.a. auf zahlreiche Beiträge in der zeitgenössischen Wochenzeitung „Der Israelit“ stützt; ein Exemplar befindet sich in der Bibliothek Germania Judaica in Köln. In den Lehrplänen wer-den als Unterrichtsfächer auch Gesang und Musik aufgeführt. Der historischen Musikforschung fällt die Aufgabe zu, diese musikalische Ausbildung der Seminaristen näher zu untersuchen und in ihren musikkulturellen Zusammenhang zu stellen.
Die Gründung des jüdischen Lehrerseminars in Düsseldorf 1867Im November 1866 kamen in den Räumen der Köl-ner Gesellschaft „Harmonie“ Vertreter von mehr als 60 Gemeinden der preußischen Provinzen Westfalen und Rheinland zusammen, um über das Vorhaben der Rabbiner Dr. Israel Schwarz (Köln) und Dr. Wolf Feilchenfeld (Düsseldorf) hinsichtlich der Gründung eines neuen jüdischen Lehrerseminars in Köln zu beraten. Die meisten Vertreter nahmen ge-gen diesen Plan Stellung, da sie befürchteten, dass dadurch die beiden Provinzen in dem bisher gemein-sam unterhaltenen Institut in Münster auseinander gerissen würden. Gäbe es nun ein weiteres Seminar, das auf exklusive Orthodoxie Anspruch machte, „so würde der Hader mitten in den Schoß der Gemein-den getragen werden“. Schwarz und Feilchenfeld warfen dem reformorientierten Seminar der Marks-Haindorf-Stiftung in Münster aber gerade vor, nicht fest auf dem Boden der jüdischen Gesetze zu stehen. 1866 hatten sie bereits viele Spenden gesammelt, mit denen ein neues Seminar für fünf Jahre unterhalten werden konnte und die von einem eigens gegründe-ten Verein verwaltet wurden. Allein aus Köln wur-den im Bericht von 1869 die Namen von 35 Spen-
dern genannt. Seinen Sitz fand das neue Lehrersemi-nar jedoch zunächst in Düsseldorf. Für die Gründe dafür fehlen ebenso Informationen wie für die ge-nauen Räumlichkeiten. Der Seminarbetrieb begann mit sieben Schülern, 1871 waren es fünfzehn. Die Seminaristen wohnten im Seminargebäude, das zu-gleich als Internat diente. Als Direktor wurde der Rabbiner Dr. Hirsch Plato berufen, der bereits in Karlsruhe ein Lehrerseminar geleitet hatte. Als „Hauptlehrer“ unterrichte er Deutsch, Französisch, Geschichte, naturwissenschaftliche Fächer und ein-zelne Disziplinen der Religionswissenschaft, Kantor (Moritz?) Eichberg lehrte die hebräische Schrift.
Die musikalische Ausbildung der Seminaristen in Düsseldorf 1867–1874Im neu gegründeten Seminar wurde auch eine mu-sikalische Ausbildung vermittelt, und zwar durch speziell dafür verpflichtete Fachkräfte. Ein Real-schullehrer Erk unterrichtete das Fach Gesang. Be-nutzt wurde dazu das Schulliederbuch des Berliner Musiklehrers Ludwig Erk, das 1859 in Essen er-schienen war. Möglicherweise bestand ein Ver-wandtschaftsverhältnis zwischen den Namensvet-tern. In dem Liederbuch, das 155 ein- und zwei-stimmige Gesänge bot, fanden sicherlich die Erfah-rungen einen Niederschlag, die Erk als Musiklehrer im Lehrerseminar in Moers gesammelt hatte. Unter dem Direktor Adolph Diesterweg war dieses zu ei-ner Musteranstalt geworden. Den Musikunterricht einschließlich des Violinspiels erteilten den Semina-risten zwei Musiker, die beide im Düsseldorfer Mu-sikleben situiert werden können. Leopold Alexan-der wird im Programmheft des dreitägigen Nieder-rheinischen Musikfestes, das zu Pfingsten 1872 mit 812 Mitwirkenden in der großen Tonhalle statt-fand, unter den Violinspielern genannt. Er stammte aus der Musikerfamilie des Duisburger Synago-genkantors Abraham Alexander, deren bekanntes-tes Mitglied Joseph Alexander war, der erste Cello-lehrer von Jacob (Jacques) Offenbach. Klarinettist Johann Kochner wiederum, der Kollege Leopold Alexanders am Seminar, war als Militärkapellmeis-ter von der preußischen Regierung in Berlin vielsei-tig ausgebildet worden. Musikgeschichtlich ist sein Name mit den Aufführung der „Märchenbilder“ op. 132 für Klarinette, Viola und Klavier im Jahr 1853 im Hause des damaligen Düsseldorfer Musik-direktors Robert Schumann verbunden, bei der Clara Schumann am Flügel saß.
I

9
STREITORGEL
Genaueren Einblick in den Lehrplan der musi-kalischen Fächer gewähren zwei historische Doku-mente: ein „Erster Bericht über die Bildungs-An-stalt für israelitische Lehrer in Düsseldorf und über den Verein zur Unterhaltung derselben“ (Düssel-dorf 1869) sowie ein entsprechender „Zweiter Be-richt“ von 1871, beide laut Stempel ehemals im Be-sitz der Jüdischen Gemeinde Berlin und heute in der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Für das Fach Gesang, das wöchentlich eine Stunde erteilt wurde, wurden die Unterrichtsinhalte sogar innerhalb der drei Semester, die das Studium um-fasste, differenziert. Im ersten Semester ging es um „Elementarlehre“ sowie um „Einige Lieder aus Erk’s Liederkranz I“, der bereits genannten Ausga-be. Im zweiten Semester folgten „Die Tonleitern. Die diatonischen, chromatischen und enharmoni-schen Töne. Der Quintenzirkel“, im dritten Semes-ter „Von der Dynamik der Töne und den Zeitma-ßen. Das Wichtigste über die Akkorde und ihre Bre-chungen“. Das Fach Violinspiel wurde wöchentlich in vier Stunden nach der „Henningschen Violin-schule“ unterrichtet. Im Bericht von 1871 wurde
zwischen einer Vorklasse und einer Seminarklasse unterschieden. Im Fach Musik waren unter „a) Vio-linspiel“ für die Vorklasse Duette von Ignaz Pleyel und Jacque Féréal Mazzas und Etüden von Hein-rich Ernst Kayser angesetzt. Es folgte „b) Pianoforte nach der Schule von Cramer“. Die „Große prakti-sche Pianoforte-Schule“ von Johann Baptist Cramer war seit 1815 immer wieder neu aufgelegt worden. In der Seminarklasse wurde im Fach Gesang nach der „Accordenlehre“ auch eine „Einfach-harmoni-sche Begleitung zu einer gegebenen Stimme“ einge-übt, etwa zu den Liedern des Erkschen Liederkran-zes. Auch wenn die Fächer Gesang und Musik erst nach den von den Hauptlehrern unterrichteten all-gemeinbildenden Fächern aufgelistet sind und nur von externen Lehrkräften erteilt wurden, die mit Ausnahme Alexanders einer der beiden christlichen Konfessionen angehörten, zeigt sich, dass man durchaus bestrebt war, die Seminaristen zur Ertei-lung eines guten Gesangsunterrichts in den Elemen-tarschulen zu befähigen. Das Singen der Schüler sollte durch Mitspielen der Melodien auf der Vio-line oder eine einfache Begleitung auf dem Klavier unterstützt werden. Ein derartiger Nachweis für ei-ne in allen Elementarschulen geübte Praxis ist von großem historischem Wert.
Das jüdische Lehrerseminar in Köln 1874–19141874 siedelte das Lehrerseminar mit dem Direktor Dr. Hirsch Plato von Düsseldorf nach Köln über. Aus der Schenkung der reichen Familie Julius Harff waren dem Seminar zwei Häuser in Köln-Ehrenfeld zugewiesen worden. Bereits 1876 wurde das Semi-nar wieder verlegt, nun in die Innenstadt in ein Haus an der Cäcilienstraße, wo sich auch der Betsaal der 1863 gegründeten orthodoxen Kultus-gemeinschaft Adass Jeschurun befand, die mit Dr. Plato nun auch einen Rabbiner erhielt. Seit 1888 amtierte dort Elias Gut als Kantor. Da die Zahl der Seminaristen weiter zunahm – 1882 wa-ren es 27 –, zog man noch ein drittes Mal um, und zwar in ein Haus in der Thieboldsgasse nahe dem Neumarkt. In der 1861 eingeweihten prächtigen Synagoge, die der Bankier Abraham Oppenheim neben seinem Haus in der Glockengasse auf eigene Kosten hatte errichten lassen, amtierte seit 1876 Dr. Abraham Salomon Frank als Rabbiner. Lehrer und Schüler des Seminars erlebten dann 1899 die Einweihung der großen Synagoge mit 1.400 Plät-zen in der Kaiserstraße der Kölner Neustadt, der

10
ORGELSTREIT
heutigen Roonstraße. Als die reformorientierte Ge-meinde nach vier Jahren kontroverser Diskussio-nen 1906 eine große Orgel in der Synagoge ein-weihte, trennten sich die Gegner endgültig ab. Im selben Jahr wurde Adass Jeschurun von den preußi-schen Behörden als eigenständige Gemeinde aner-kannt. Der Kölner Orgelstreit war geradezu para-digmatisch für die Unterscheidung zwischen kon-servativen und liberalen Synagogengemeinden.
Als am 16. Januar 1884 in Anwesenheit vieler Gäste in der Aula das „neuerbaute Haus der israeli-tischen Lehrer“ in der St.-Apern-Straße eingeweiht wurde, begannen die Feierlichkeiten nach dem Be-richt in „Der Israelit“ mit einem hebräischen Ge-sang, der von den Seminaristen vorgetragen wurde. Danach waren „das Gebäude und die Zöglinge die greifbaren Beweise von der Kraft des alten überlie-ferten Judenthums“. Das gegenüber der Synagoge errichtete Seminargebäude umfasste einschließlich Keller- und Dachgeschoss für Wirtschaftsräume fünf Stockwerke. Im Erdgeschoss lagen die Lehrer-wohnungen, „die Lehrerzimmer, die Übungsschule, die Bibliothek und das sogenannte Physikzimmer
im 1. Stock“, die Arbeitszimmer im 2. Stock, die Schlafzimmer im 3. Stock. An Werktagen übernah-men Seminaristen in der Synagoge die Funktion des Vorbeters.
Im Jahr 1901 erfolgte aufgrund eines Erlasses des preußischen Ministeriums eine Reorganisation des Unterrichts. Sie war mit einem Wechsel in der Direktion verbunden. Dr. Hirsch Plato ging in den Ruhestand, neuer Direktor wurde Rabbiner Dr. Emanuel Carlebach. Angesichts sinkender Schü-lerzahlen kämpfte dieser um die weitere Existenz des Seminars. Hinzu kam die Kritik des Provinzial-schulrates Dr. Flügel. Dieser behauptete, dass die Kölner Anstalt das Hauptgewicht auf die Ausbil-dung von Religionslehrern und Kantoren lege, die allgemeinbildenden Fächer dagegen vernachlässigt würden. Das Ministerium forderte nun einen ge-trennten Unterricht der drei Klassen. Klassenkom-binationen sollten nur in „technischen Fächern“ stattfinden, zu den auch das Singen gehörte. In ei-nem Brief des Minsteriums vom 16. August 1907 werden auch die angestellten „Hilfslehrer“ für Erd-kunde, Turnen, Zeichnen und Musik genannt. Mu-sik- und Gesangsunterricht wurde ab 1906 von dem Protestanten Wilhelm Bredack erteilt.
Ähnlich wie in Düsseldorf 1869 erschien 1908 in Köln noch einmal ein aufschlussreiches Doku-ment, der „Bericht über das jüdische Lehrersemi-nar die Zeit vom 1. Oktober 1904 bis 1. Oktober 1907 umfassend, erstattet vom Seminardirektor“; ein Exemplar befindet sich in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Leibniz-Ins-tituts für Bildungsforschung und Bildungsinforma-tion (DIPF) in Berlin. Die 20 Mitglieder des Kura-toriums des Vereins von 1867, dem auch die Direk-toren Plato und Carlebach angehörten, hatten ih-ren Wohnsitz in Bonn, Fulda, Frankfurt, Gelsenkirchen, Karlsruhe und Breslau. Stellvertre-ter des Vorsitzenden Isidor Dülken, der in Porz ein Sägewerk besaß, war Gereon Rothschild in Köln. Aus den biographischen Angaben über die vier Se-minarlehrer geht die enge Verbindung mit der Syn-agoge hervor. Direktor Carlebach war Rabbiner der israelitischen Religionsgesellschaft Adass Je-schurun. Elias Gut, seit 1888 deren Kantor und selbst von 1885 bis 1888 Seminarist in Köln, war seit 1901 Mitglied des Lehrerkollegiums, Dr. phil. Moses Auerbach seit 1907. Dazu kamen drei nicht-jüdische Hilfslehrer, für Zeichnen Hubert Kempen vom Apostel-Gymnasium, für Musik Paul Bonn
AboserviceHat sich Ihre Postadresse geändert? Sie wollen das gedruckte Heft neu abonnieren, nicht weiter beziehen oder stattdessen online lesen? Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit!
Bestellungen · AbbestellungenDatenschutzTel +49 (0)201-20164434Mail [email protected]/abo
ImpressumHerausgeberSalomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen
ISSN 1436–1213
RedaktionProf. Dr. Michael BrockeDipl.-Soz.-Wiss. Harald LordickDr. Beata MacheProf. Dr. Lucia RaspeAnnette Sommer
Satz und LayoutHarald Lordick · Beata Mache
Postanschrift der RedaktionEdmund-Körner-Platz 245127 Essen
Telefon+49(0)201-82162900
Fax+49(0)201-82162916
E-Mai [email protected]
Internetwww.steinheim-institut.de
DruckBrendow Printmedien, 47443 Moers
VersandZAD Lettershop Factory GmbH44149 DortmundVierteljährlich im Postzeitungsdienst
Kalonymos ist für unsere Leserinnen und Leser kostenlos. Wir sind gerade deshalb dringend auf Ihre Zuwendun-gen angewiesen ! (steuerabzugsfähig)
SpendenkontoIBAN DE42 3505 0000 0238 000343BIC DUISDE33XXXStadtsparkasse Duisburg
Synagoge derAdass Jeschurun, 1884

11
STREITORGEL
von der Vorschule des Gymnasiums in Ehrenfeld und Wilhelm Bredack von der Städtischen Volks-schule. Unterrichtserfahrene Musikpädagogen, nicht Berufsmusiker wie 1869 in Düsseldorf, berei-teten also die 37 namentlich aufgelisteten Semina-risten auf ihre zukünftigen Aufgaben vor.
Der Bericht von 1908 enthält auch einen höchst beeindruckenden Katalog der umfangreichen Bib-liothek des Lehrerseminars, alphabetisch geordnet nach Fachgebieten. Zur Musik umfasste der Kata-log elf Titel. Angesichts der ermittelten Erschei-nungsjahre hing die Anschaffung offensichtlich auch mit der Reform des Lehrerseminars zusam-men. Das trifft gleich für den ersten Titel von Au-gust Bode zu, „Der Sängerin Lustgarten“, einer Ge-sangschule auch für Lehrerinnenseminare, deren Folgen 1898 und 1905 im Kölner Kinderbuch-Ver-lag von Friedrich & Hermann Schaffstein erschie-nen waren. Nach einer musiktheoretischen Einfüh-rung enthält das Buch 127 Lieder, chronologisch nach Komponisten geordnet. Es war in drei Exem-plaren vorhanden. Sogar zwanzig Exemplare gab es von den „Stimmbildungsübungen für die oberen Gesangklassen höherer Lehranstalten“ von Schu-bert. An Noten gab es nicht nur Sammlungen von Sologesängen wie „Gesänge der Andacht“ des jüdi-schen Kantors und Lehrers Heinrich Fabisch, son-dern auch solche für Männerchor wie „Volksperlen. Sammlung von 120 Volksliedern“ (Frankfurt 1906) von Richard Müller. Volkslieder enthielt auch Christian Heinrich Hohmanns „Praktische Violin-schule, neu um 65 Volks- und vaterländische Ge-sänge vermehrte Auflage von Ernst Heim“, die 1891 im Kölner Musikverlag Tonger erschienen war. Eine zweite Violinschule, Friedrich Zimmers „Praktische Violinschule in drei gesonderten Stufen für Präparanden-Anstalten und Lehrerbildungs-Anstalten“ (Berlin um 1890), war speziell für das Lehrerseminar eingerichtet.
Wesentlicher für ein jüdisches Lehrerseminar waren die synagogalen Gesänge. Von der mehrbän-digen Ausgabe Isaak Lachmanns „Awaudas Jisroeil. Der israelitische Gottesdienst – Traditionelle Syna-gogengesänge des süddeutschen und osteuropäi-schen Ritus“ war Teil I vorhanden. Eine Einfüh-rung auch zu mehrstimmigen Synagogengesängen fanden die Seminaristen im Buch des Berliner Hauptkantors Aron Friedmann, „Der synagogale Gesang. Eine Studie. Zum 100. Geburtstag Salo-mon Sulzer’s und 10. Todestag von Louis Le-
wandowski (1904)“, das 1908 erschienen war. Ori-entierung zum Schulfach vermittelte Karl Küffners „Die Musik und ihre Stellung an den bayerischen Mittelschulen“ (Nürnberg 1902). Duch das bis in die Gegenwart immer wieder neu aufgelegten Mo-zart-Buch von Oskar Fleischer, dem Leiter der Mu-sikinstrumentensammlung und Professor an der Universität Berlin, wurden die Seminaristen bei-spielhaft auf die zahlreichen jüdischer Autoren im damaligen Musikschrifttum aufmerksam gemacht. In einmaliger Weise spiegelt die Musikbibliothek des Kölner Lehrerseminars die in der Ausbildung zur Verfügung stehenden Lehrmittel wieder, die zu-gleich – wie bei der Begleitung von Volksliedern durch Violinspiel – eine Vorstellung von den kon-kreten Anforderungen an den Musikunterricht in den Elementarschulen vermitteln.
1911 wurde erstmals eine staatliche Lehrerprü-fung der Seminaristen durchgeführt, die alle be-standen. Im Kriegsjahr 1915 waren es noch elf. Die Glückwunschadresse „Die Synagogengemeinde Adass Jeschurun ihrem Lehrer und Kantor Elias Gut zum 25jährigen Amtsjubiläum 1888–1913“ unterschrieb als Vorstandsmitglied auch der Papier-großhändler Bernhard Salomon Lewertoff, der Va-ter von Salomon (Shlomo) Bernhard Lewertoff (1901–1965), der als Kaufmann 1925 dem Vor-stand der Kölner Gesellschaft für Neue Musik an-gehörte. Nach seiner Eheschließung mit der Vorsit-zenden dieser Gesellschaft, der Musikwissenschaft-lerin Dr. Else Thalheimer, emigrierte das Paar 1935 nach Tel Aviv.
Lehrerseminar und Musikunterricht in der Weimarer RepublikNach Ende des Ersten Weltkriegs wurden die Tradi-tionen des Lehrerseminars unter neuen politischen Rahmenbedingungen fortgeführt. Bereits 1919 konnte in der Aula des Lehrerseminars die Eröff-nung der jüdischen weiterführenden Schule Jawne gefeiert werden. Das staatlich anerkannte Reform-realgymnasium stand ebenfalls unter der Leitung von Emanuel Carlebach und war im Gebäude des Lehrerseminars untergebracht. Nach dem Tod von Elias Gut wurde 1925 Siegfried Soffe Kantor der Synagoge Adass Jeschurun. Er unterrichtete auch in der Jawne. Der Musikunterricht wurde weiterhin von Nichtjuden erteilt. Als der langjährige Direktor Carlebach im Dezember 1927 starb, sprachen bei der Trauerfeier in der überfüllten Synagoge auch
Am historischen Ort des Leh-
rerseminars und des jüdischen
Gymnasiums Jawne in der Köl-
ner Innenstadt befindet sich
heute der „Lern- und Geden-
kort Jawne”, der mit Ausstel-
lungen, Veranstaltungen und
pädagogischen Angeboten an
die Geschichte dieses zentralen
Ortes jüdischen Lebens und
Lernens in Köln erinnert:
www.jawne.de
„Jawne“, JüdischesReformrealgymnasium, 1937

12
ORGELSTREIT
führende Repräsentanten von Regierung und Stadt, darunter der Beigeordnete Dr. Linnartz. Erzbischof Karl Joseph Kardinal Schulte sandte ein Kondo-lenzschreiben.
Zwischen 1928 und 1931 erhielten jeweils 20 bis 31 Kandidaten das Lehrerdiplom. Selbst 1933, als das Seminar im April geschlossen wurde, waren es noch zwölf. Von dem Seminaristen Adalbert Klein, der seit 1925 am Seminar studierte, sind zwei Zeugnisse über seine Abschlussprüfung 1927 erhalten. Für die Religionslehrerprüfung wurden auch die Fächer Synagogale Liturgik und Kantorat benotet. Dem Zeugnis über die Entlassungsprüfung zufolge gab es sogar eine schriftliche Prüfung in Harmonielehre. Die Note „sehr gut“ erreichte Klein im Singen (Fertigkeit und Methodik) sowie im Violin- und Klavierspiel. Da es für die Semina-risten wegen der Aufnahme der höheren Schule Jawne in das Gebäude des Lehrerseminars kein Internat mehr gab, fanden sie meist in jüdischen Familien Unterkunft. Mitteilungen von Ehemaligen an Tatjana Lehmann bezeugen, dass sie am Kultur-leben der Großstadt Köln, an Theater und Oper teilnahmen. So drangen sicherlich 1933 auch die Nachrichten darüber zu ihnen, dass der Direktor der Hochschule für Musik, der Komponist Walter Braunfels, von den Nazi-Machthabern ebenso ent-lassen wurde wie der Generalmusikdirektor der Oper Eugen Szenkar. Vielleicht erlebten einige am 15. Oktober 1933 in der Synagoge in der Roonstraße auch die Eröffnungsveranstaltung des
Jüdischen Kulturbundes Rhein-Ruhr, deren Leitung Lewertoff und Thalheimer innehatten. Der Cellist Emanuel Feuermann (Berlin) und der Pianist und Dirigent Wilhelm Heinrich Steinberg (Frankfurt) spielten Werke von Bach, Beethoven und Mendels-sohn, an der Orgel saß der Kapellmeister am Schauspielhaus Kurt Heinemann. Die Mitteilungen des Kulturbundes informierten dann auch über die regelmäßigen Kantorenkonzerte in der Synagoge, die der Oberkantor Hermann Joseph Fleischmann leitete.
Als Lewertoff und Thalheimer 1963 auf Einla-dung der Stadt Köln zur Eröffnung der Ausstellung „2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein“ im Kölnischen Stadtmuseum wieder nach Köln zurückkamen, dürften viele Erinnerungen wieder lebendig geworden sein. Sicherlich besuchte das Ehepaar die 1959 wieder errichtete Synagoge in der Roonstraße, in deren Nähe (in der Jülicher Straße) Else Thalheimer einst gewohnt hatte. Viel-leicht schlossen sie auch das jüdische Lehrersemi-nar mit ein.
Klaus Wolfgang Niemöller, em. Univ.-Prof. des Mu-sikwissenschaftlichen Instituts der Universität zu Köln und Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Düs-seldorf, ist Verfasser einer Reihe von Studien zur Ge-schichte jüdischer Musikpersönlichkeiten im Rhein-land zwischen 1820 und 1933.
BuchgestöberDavid Schnur (Hg.): Jüdisches Leben in der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd vom 13. bis ins 17. Jahrhundert. Schwäbisch Gmünd: einhorn, 2021. 139 S., Abb. 18 Euro, ISBN 978-3-95747-114-7
Während die Geschichte der Stadt Schwäbisch-Gmünd gut erforscht ist, kann dies von der Geschichte der dort einst lebenden Juden nicht behauptet werden. Hier soll die vorliegende Veröffentlichung – erschienen 500 Jahre, nachdem Kaiser Karl V. „ein auf Ewige Zeiten verlängertes Niederlassungsverbot für Angehörige der jüdischen Minderheit in der Reichsstadt“ ausgespro-chen hatte – Abhilfe schaffen. Sie beinhaltet einen anhand der Quellen erstellten allgemeinen Überblick zur mittelalterlichen Geschichte der Gmünder Juden sowie eine Zusammenfassung der Erkenntnisse über die vor wenigen Jahren wiederentdeckte mittelalterli-
che Synagoge („domus judaeorum“) des Ortes. Ein dritter Beitrag widmet sich den ländlichen Judensied-lungen im Umfeld der Reichsstadt im 16. und 17. Jahr-hundert. Die übersichtliche und ansprechende Publika-tion ist mit zahlreichen Farbfotos versehen.
Joseph Klausner: Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre. Mit einem Nachwort von Christian Wiese, Berlin: Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 2021. 718 S. 38 Euro, ISBN 978-3-633-54310-6
Fragt man nach dem Autor des hier angezeigten Buches über Jesus von Nazareth, so wird man vermutlich über-rascht sein, dass dieser ein Onkel des vor drei Jahren verstorbenen israelischen Schriftstellers Amos Oz war, der ihm in seinem letzten großen Roman „Judas“ ein

13
STREITORGEL
bleibendes Denkmal gesetzt hat. Der aus Russland stammende Philosoph Joseph Klausner beschreibt Jesus in seinem 1930 erschienenen Werk als „Träumer, Reformator und Weltverbesserer, dessen Augenmerk sich nicht auf die politischen Kämpfe der Zeit richtete, sondern auf das Schicksal des Einzelnen im Lichte des kommenden Reiches Gottes.“ Die acht Kapitel des Buches behandeln die Quellen, die Epoche, die Jugend-geschichte Jesu und Johannes den Täufer, den Beginn von Jesu Wirksamkeit, seine Offenbarung als Messias, seine Zeit in Jerusalem, Verurteilung und Kreuzigung sowie die Lehre Jesu. Auch wenn der Theologe und Judaist Christian Wiese in seinem Nachwort eingesteht, dass Klausners Verständnis Jesu und des Christentums heute kaum mehr den Maßstäben eines interreligiösen Dialogs entspricht, so kommt er doch zu dem Ergebnis, dass das Werk die „spannende und spannungsreiche Neubegegnung beider Traditionen“, der christlichen wie der jüdischen, ermögliche, eine Neubegegnung, die ihren Ausgangspunkt in der Moderne habe, von Ausch-witz überschattet sei und dennoch (oder vielleicht gerade deswegen) „Perspektiven für ein echtes, bedeut-sames Gespräch“ in sich berge. Möge dieses beachtens-werte Werk jüdisch-christlicher Zeitgeschichte den Weg zu einem solchen Gespräch stets neu anregen!
Johannes Czakai: Nochems neue Namen. Die Juden Galiziens und der Bukowina und die Einführung deutscher Vor- und Familiennamen 1772–1820, Göttingen: Wallstein, 2021 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 55). 560 S. 58 Euro, ISBN 978-3-8353-5017-5
„Für die Juden hat der Name deshalb keinen Wert, weil er gar nicht ihr Name ist. Juden, Ostjuden, haben kei-nen Namen. Sie tragen aufgezwungene Pseudonyme.“ Dieses Zitat des Schriftstellers Joseph Roth spielt dar-auf an, dass – im Gegensatz zum Großteil der christli-chen Bevölkerung – aschkenasische Juden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zumeist keine festen Famili-ennamen führten. Unter dem Einfluss der französischen
Revolution und der Frage nach dem Bürgerrecht für Juden erlangten Namen eine ganz neue Bedeutung. Die meisten europäischen Staaten verfügten in ihren nun erarbeiteten umfassenden Toleranzgesetzen für ihre jüdischen Einwohner die Registrierung fester Vor- und Familiennamen, was letztendlich aber vor allem der Ausbildung staatlicher Kontrollmechanismen diente. Mit seiner Publikation legt der Autor eine erste wissen-schaftliche Studie zu dem Thema vor. Anhand des Umstands, dass Ende des 18. Jahrhunderts unzähligen Juden in den österreichischen Provinzen Galizien und Bukowina neugeschaffene deutsche Familiennamen aufoktroyiert wurden, zeigt der Autor, wie nachhaltig diese Zwangsmaßnahme, die die „Empfänger“ durch-aus auch für sich zu nutzen wussten, die jüdische Welt Ost- und Mitteleuropas beeinflusst hat. Erhellend sind nicht nur die zum Teil erstaunlichen Geschichten hinter den neu kreierten Namen, sondern auch die jüdisch-staatlichen Interaktionen, die sich in der Habsburger-monarchie zu jener Zeit beobachten lassen.
Markus Roth: Holocaust. Die 101 wichtigsten Fragen, München: C.H. Beck, 2021. 144 S. 12 Euro, ISBN 978-3-406 77737 0
In 101 Fragen erschließt der Autor, Mitarbeiter am Fritz Bauer Institut (Frankfurt), das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Allerdings lässt sich das Thema in einem solchen Fragenkatalog nicht annähernd umfassend abhandeln, da mit dem Holocaust auch sol-che Fragen verbunden sind, auf die es nur schwerlich eine Antwort gibt, so etwa die nach dem “Warum”. Absicht des Buches ist es, einen Einstieg in die große Bandbreite von Aspekten der Vorgeschichte, Geschichte und Nachgeschichte des Holocaust zu ermöglichen. Denn die Ermordung von sechs Millio-nen Juden ist ein Menschheitsverbrechen, das uns bis heute nicht loslässt. Die Erinnerung daran wachzuhal-ten, gehört zu den wichtigsten Aufgaben der politi-schen Bildung in Deutschland. Dazu leistet das kleine Bändchen einen wertvollen Beitrag.
MitteilungenJRF vor Ort: Jüdisches Köln – rechtsrheinischAm 29. August konnte das Steinheim-Institut auf dem jüdischen Friedhof in Köln-Deutz eine ertrag-reiche Veranstaltung unter freiem Himmel durch-führen. Im bewährten Format „JRF vor Ort“ – ein Institut lädt die anderen in der Johannes-Rau-For-schungsgemeinschaft zusammengeschlossenen Insti-tute und eine interessierte Öffentlichkeit zu einem Ortstermin ein – fanden sich trotz leichtem Regen an
einem Sonntagmorgen 30 Interessierte ein, darunter auch der Rektor der UDE, Prof. Dr. Ulrich Radtke.
Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Dieter Bathen, Vorstandvorsitzender der JRF, und Prof. Dr. Lucia Raspe, die neue Direktorin des Stein-heim-Instituts, führte Dr. Ursula Reuter, Geschäfts-führerin der „Germania Judaica. Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen Judentums“, in die jüdische Geschichte Kölns und die Bedeutung des
Wir wünschen allenunseren Leserinnen und Lesern
und denen, die unser Institut in Treue fördern,frohe, erholsame Festzeiten
und ein glückliches, gesundes Jahr 2022

14
ORGELSTREIT
Deutzer Friedhofs für die Stadtgeschichte ein. Dr. Cordula Lissner stellte anschließend das Projekt „Jüdisches Köln – rechtsrheinisch“ vor.
Im Zentrum der Veranstaltung standen drei Friedhofsführungen mit unterschiedlichen Schwer-punkten. Nach jeweils 20 Minuten konnte die Grup-pe gewechselt werden, so dass die Gäste die Mög-lichkeit hatten, alle drei Themen kennenzulernen.
Anna Martin führte zu besonderen Grabsteinen auf dem weitläufigen Areal, erklärte unterschiedli-che Zeitphasen, Gestaltungselemente und Symbole. Nathanja Hüttenmeister analysierte die lange In-schrift eines der ältesten erhaltenen Grabsteine und entschlüsselte die Fülle der gelehrten Zitate. Diese Führungen durch Wissenschaftlerinnen des Stein-heim-Instituts ergänzte ein dritter Rundgang mit Prof. Dr. Hans Leisen, emeritierter Professor für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft an der TH Köln und ein ausgewiesener Experte für Gesteinsarten und die Erhaltung steinerner Kultur-denkmäler – ein Thema, das auch für den Friedhof Köln-Deutz von hoher Aktualität ist.
Paula Wendel/Cordula Lissner
Ausführlicher Bericht: JRF-Webseite
https://jrf.nrw/veranstaltung/1700-jahre/
Festakt zum Jubiläum des Wohlfahrtsverbandes ZWST unter Mitwirkung der Arbeitskreises Jüdische WohlfahrtMit einem Festakt im Centrum Judaicum würdigten Politik und Gesellschaft am 31. Oktober 2021 in Berlin die Arbeit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST). Anlass war der 70. Jahrestag ihrer Wiedergründung im Jahr 1951. Die Sprecher:innen des Arbeitskreises Jüdische Wohl-fahrt am Steinheim-Institut, Sabine Hering (Pots-dam), Beate Lehmann (TU Braunschweig), Harald Lordick (Steinheim-Institut) und Gerd Stecklina (Hochschule München), gestalteten den Festakt mit.
Abraham Lehrer, Präsident der ZWST, gab in seiner Begrüßungsrede einen Abriss der Geschichte der ursprünglich 1917 gegründeten und 1939 zwangsaufgelösten ZWST. Er verwies auf die gelun-gene Integrationsarbeit, nachdem nach der Öffnung Osteuropas rund 200.000 Juden und Jüdinnen aus den ehemaligen GUS-Staaten nach Deutschland ein-wanderten und die jüdischen Gemeinden und die ZWST vor neue Herausforderungen stellten.
Die Festrede hielt Hubertus Heil, Bundesminis-ter für Arbeit und Soziales. Er betonte, dass das
Prinzip der Zedaka auf das Selbstverständnis des modernen Sozialstaates großen Einfluss hatte. Mit Blick auf die zahlreichen von Altersarmut bedroh-ten Migranten der 1990er Jahre stellte Heil Abhilfe in Aussicht: Mit dem seitens der ZWST seit langem geforderten Nothilfefonds werde es unter der neu-en Bundesregierung bald eine Lösung für dieses Problem geben. Heil stellte zudem fest, dass die Leistungen, die die Wohlfahrtverbände in der Pan-demiezeit erbracht hätten, nicht hoch genug ge-würdigt werden könnten.
Einen Einblick in die Forschungen des Arbeits-kreises zur Geschichte der jüdischen Wohlfahrt seit nunmehr zwei Jahrzehnten gaben Harald Lordick und Beate Lehmann. Sie stellten die Vielfalt der sei-tens des Arbeitskreises mit Tagungen und Konfe-renzen, wissenschaftlicher Buchreihe, digitaler Plattform und zahlreichen weiteren Aktivitäten aufgegriffenen Themen vor – Pionierarbeit ange-sichts der lange Zeit ,verschollenen‘ Geschichte jü-discher Wohlfahrt. Dabei hoben sie die Zusammen-arbeit mit der ZWST besonders hervor. Sie umfasst u.a. die Mitwirkung des Arbeitskreises an der Ze-daka-Kampagne der ZWST im Jubiläumsjahr #2021JLID und insbesondere die Erforschung der Geschichte der ZWST selbst. In diesem Sinne hatte Abraham Lehrer den Arbeitskreis zuvor als „das Gedächtnis der ZWST“ gewürdigt. Zu seinen zu-künftigen Aufgaben wird der Ausbau der digitalen Angebote und insbesondere die weitere Nach-wuchsförderung gehören. Auf großes Interesse stieß die von Sabine Hering konzipierte Wander-ausstellung, die die Geschichte der ZWST durch die sie prägenden Persönlichkeiten zeigt.
Grußworte sprachen Ulrich Lilie (Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-pflege), Juliane Seifert (Staatssekretärin im Bundes-ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-gend) sowie Elke Breitenbach (Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales). Lebhaften Beifall fanden schließlich auch der Film „70 Jahre Wiedergründung der ZWST“ und die musikalische Umrahmung durch das Nitsan Bernstein Trio. red
Unseren Blogbeitrag mit Fotos, dem Link
zum Film „70 Jahre Wiedergründung der
ZWST“ und weiteren Materialien erreichen
Sie auf der Webseite des Arbeitskreises
https://akjw.hypotheses.org/1219
Vorstellung des Arbeitskreises
Jüdische Wohlfahrt auf dem
Festakt zum 70. Jahrestag der
Wiedergründung der ZWST

15
Jüdisches Köln – rechtsrheinischEin Projekt zum Jubiläumsjahr
Paula Wendel
it dem Projekt „Jüdisches Köln – rechtsrhei- nisch“ beteiligt sich das Steinheim-Institut am
Festjahr „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutsch-land“. Es beinhaltet neben der Dokumentation aus-gewählter Grabsteine des jüdischen Friedhofs Köln-Deutz die Projektarbeit mit Schülerinnen und Schülern in Form eines Stadtrundgangs mit einer Handy-App sowie die Erarbeitung eines allgemein verfügbaren Fahrradführers für die rechtsrheini-schen Stadtteile von Köln. Indem es die oft weit zu-rückreichenden Familiengeschichten der Deutzer jüdischen Bevölkerung beleuchtet, wird auch die jüdische Geschichte von Köln und seiner Umge-bung vor der Schoa betrachtet. Eine solche umfas-sende Sicht ist für das Verständnis der gesellschaft-lichen Voraussetzungen, die unter anderem zur Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland führten, von besonderer Bedeutung.
Ein Ziel des Projekts ist es, die epigraphische Forschung und Friedhofs-Dokumentation in den gesellschaftlichen Kontext außerhalb der Wissen-schaft einzubringen, um sie so einer breiteren Öf-fentlichkeit zugänglich zu machen. Für Schüler und Schülerinnen ist dabei eine Annäherung an Ge-schichte über die Erforschung von Biographien auch deshalb besonders sinnvoll, weil man zwi-schen der eigenen Lebenssituation und der der his-torischen Persönlichkeiten Verbindungen herzustel-len vermag. Hierfür eignet sich wiederum der städ-tische Raum in besonderer Weise, da Geschichte immer Spuren im Stadtbild hinterlässt, die zu auf-schlussreichen Erkenntnissen führen. Im Rahmen des Stadtrundgangs werden die Schüler sowohl auf offizielle und gekennzeichnete Orte jüdischer Ge-schichte wie Stolpersteine, eine Gedenkplatte am Deutzer Bahnhof oder auch die ehemalige Synago-ge des Stadtteils aufmerksam gemacht. Andererseits
aber gibt es auch alltägliche Orte, die nur dank Re-cherche und Rekonstruktion als ehemals jüdisch er-kannt und eingeordnet werden können.
Orte unterschiedlichen Erinnerns in Köln-DeutzAuch in Deutz gibt es also, wie oben bereits ange-deutet, intendierte öffentliche Orte des Erinnerns, wie sie heute in jeder deutschen Stadt anzutreffen sind. Demgegenüber begegnet man aber auch hier „alltäglichen“ oder „privaten Gedenkorten“, zu de-nen z.B. Wohnhäuser, Straßen und Gebäude wie et-wa das Schaurte-Gymnasium zählen. Diese sind zwar ebenfalls öffentlich, weisen aber keinerlei ent-sprechende Erinnerungskultur auf.
Um diese unterschiedlichen Arten von Gedenk-orten und die damit zusammenhängende Erinne-rungskultur im städtischen Raum geht es unter an-derem in unserem Projekt. Der jüdische Friedhof von Köln-Deutz, der dabei im Zentrum der Be-trachtung steht, kann hier allerdings nicht einer einzelnen Kategorie von Gedenkorten zugeordnet werden. Ihm kommt insofern, als er unterschiedli-che Kriterien in sich vereint, eher „ein Platz in der Mitte“ zu, Zum einen kann er als öffentlicher Ort betrachtet werden, der der Erinnerung an jüdische Persönlichkeiten und an jüdische Kultur dient. Zum anderen ist es ein sehr privater Ort, der zahl-reiche persönliche und intime Geschichten in sich birgt und daher auch für verschiedene Menschen von unterschiedlicher Bedeutung ist.
Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt wer-den, dass der jüdische Friedhof in Köln-Deutz im
M
Abbrucharbeiten am Rhein-
ufer, Ecke Deutzer Freiheit.
Links das Barockgebäude der
Synagoge von 1786.
Aquarell W. Scheiner 1884
(Gidal-Bildarchiv im STI).
Blick in das Innere der Deutzer
Synagoge während des
Gottesdienstes, um 1910.
Vor dem Thoraschrein
Rabbiner Dr. Julius Simons
(Gidal-Bildarchiv im STI).

16
Allgemeinen nicht frei zugänglich ist, sondern nur nach Anmeldung sowie bei offiziellen Veranstaltun-gen oder Führungen besucht und besichtigt werden kann. Das hat seinen Grund in der allgegenwärti-gen Bedrohung durch antisemitische Gräberschän-dung und antisemitische Gewalt, deren Zunahme in den letzten Jahren immer offensichtlicher ge-worden ist. Hier zeigt sich das Ineinandergreifen von Vergangenheit und Gegenwart an diesem his-torischen Ort des Andenkens, das einerseits das Er-innern durch den begrenzten Zugang verwehrt, an-dererseits aber gerade die Notwendigkeit von Ge-denken umso dringlicher macht.
Jüdische Geschichte in Deutschland zeigt sich zumeist in Form von Lücken, Verlust oder Zerstö-rung. Die jüdisch-christlichen Beziehungen vor dem Nationalsozialismus sind häufig unsichtbar und zum Teil nur schwer rekonstruierbar. Auch hier spielt der Friedhof im städtischen Raum eine zentrale Rolle, da man mit seiner Hilfe Spuren nachgehen kann und Lücken geschlossen werden können.
Durch das Projekt und die Handy-App werden „öffentliche Orte der Erinnerung“ wieder ins Ge-dächtnis gerufen und „private Orte der Erinne-rung“ teilweise erstmalig sichtbar gemacht. Auf die-se Weise können verlorene oder vergessene Stadt-geschichte durch Familiengeschichten und Biogra-phien (wieder)entdeckt werden. Die Stadt Köln ist ein idealer Ort, um sich mit jüdischer Geschichte in Deutschland auseinanderzusetzen, da die Spuren einzelner Gemeinden hier so weit zurückverfolgt werden können wie in keiner anderen deutschen Stadt. So existiert mit dem Dekret Kaiser Konstan-tins vom 11. Dezember 321 der älteste erhaltene schriftliche Nachweis für jüdisches Leben in Köln. Erste Niederlassungen von Juden im Rheinland
werden jedoch schon zwischen dem 1. und 3. Jahr-hundert nach Christus vermutet.
Die jüdische Geschichte Kölns ist insgesamt wechselhaft. Sie zeugt einerseits von friedlichen Zeiten für die jüdische Bevölkerung beispielsweise im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Re-publik. Doch auch vor der Schoa gab es durch Mord und Vertreibung gekennzeichnete Phasen. Hier sind die Pogrome von 1096 und 1349 zu nennen sowie das Ansiedlungsverbot für Juden zwischen 1424 und 1789, das erst durch die französische Besat-zungsmacht ein Ende fand. Während des 375 Jahre andauernden Verbots konnten sich Juden nur auf der rechten Seite des Rheins niederlassen, vornehm-lich in den damals eigenständigen Städten Deutz und Mülheim. Aus diesem Grund findet das Projekt rechtsrheinisch, hauptsächlich in Köln-Deutz, statt.
Einer der Schwerpunkte des Projekts liegt auf der Beschäftigung mit der Lebensrealität und den Familiengeschichten jüdischer Personen vor der Schoa. Dabei wird erkennbar, wie der ständige Wechsel von Ausgrenzung und Annäherung zwi-schen jüdischer und christlicher Bevölkerung die Wohn- und Lebensgewohnheiten der Juden und Jüdinnen in Köln-Deutz beeinflusst und somit auch das Stadtbild geprägt hat. Auch davon weiß der Friedhof manches zu erzählen.
Paula Wendel studiert „Urbane Gesellschaft, Kultur und Raum“ an der Universität Duisburg-Essen und ist Wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt „Jüdisches Köln – rechtsrheinisch“ des Steinheim-Instituts. Der Beitrag basiert auf ihrem im Rahmen des Studiums entstandenen Bericht über das Projekt in Köln-Deutz aus kultur- und stadthistorischer Perspektive.
Verkehrskreisel an der Deutzer
Brücke. Standort der ersten
Synagoge von Deutz, die 1784
dem Eishochwasser zum Opfer
fiel, sowie der zweiten Synago-
ge des Stadtteils, 1786 einge-
weiht, 1913 für den Bau der
Brücke abgerissen.
Foto: Axel Joerss
Auf dem Jüdischen Friedhof
Köln-Deutz, Juni 2021.
Foto: Anna Martin