Xenohormone aus Verpackungen
Transcript of Xenohormone aus Verpackungen

b Xenohormone (Pseudohormone) sind Substanzen, die wie Hormone wirken und das tierische oder menschliche Hormonsystem beein-flussen. Viele dieser Xenohormone wirken als Östrogene oder Antiöstro-gene, einige Substanzgruppen beein-flussen die Schilddrüse oder andere Hormonachsen. Der Nachweis der Hormonaktivität sagt allerdings noch nichts darüber aus, wie sich die Sub-stanz auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirkt. Wesentlich ist die Unterscheidung zwischen Xenohor-monen und endokrinen Disruptoren.
Nach der Definition1) sind endo-krine Disruptoren (EDC) solche „Xe-nohormone, die in einem intakten Organismus oder seinen Nachkom-men wirken und nachteilige Gesund-heitseffekte, die durch die Hormon-effekte bedingt sind, hervorrufen“.
Substanzen beeinflussen Hor -mon achsen auf verschiedenen Ebe-
nen (hier sind nur die wichtigsten angeführt):2)
• Bindung an Hormonrezeptoren (als Agonisten oder Antagonis-ten),
• Bindung an weitere Rezeptoren, die Hormonwirkungen indirekt beeinflussen (z. B. an den Pero-xisom-Proliferation-aktivierten Rezeptor �, PPAR-�, der an der Regelung des Glukosestoffwech-sels beteiligt ist),
• Beeinflussung der Hormonkon-zentration durch Erhöhung der Hormonbiosynthese, des Hor-monabbaus oder der Ausschei-derate,
• gewebespezifische Veränderung der Konzentration an Hormon-rezeptoren.
So sind neben natürlich vorkom-menden Phytoöstrogenen und Arz-neimitteln viele andere Substanzen endokrin wirksam, darunter Metal-le (z. B. Cd), anorganische Salze (Perchlorat), Dioxine, phenolische Verbindungen (Bisphenol A, Nonyl -phenol), Organozinnverbindungen (Tributylzinn) und Benzophenone. Diese Substanzen sind entweder in der Natur weit verbreitet (Phytoös-trogene) oder als Umweltchemika-lien ubiquitär. Xenohormone fin-den sich in Pflanzenschutzmitteln, Detergenzien, Körperpflegemitteln, Benzin, Kunststoffen, Papier, La-cken, Medizinprodukten, Lederwa-ren, Druckfarben, Kleidung und vielen anderen Produkten.
EDC in der Umwelt verursachen umfangreiche und schwere Störun-gen an Wildtieren. So sind die Ver-männlichung mariner Arten, etwa von Meeresschnecken, die Ver-weiblichung von Fischen und Rep-tilien sowie Reproduktionsstörun-gen bei Vögeln zahlreich und gut dokumentiert.3)
Lebensmittel als Quelle von Xenohormonen
b Für den Menschen sind Lebens-mittel die wichtigste Aufnahme-quelle von Xenohormonen. Sie lie-gen entweder bereits als natürliche Inhaltsstoffe im Lebensmittel vor (z. B. Phytoöstrogene aus Sojapro-dukten) oder sind Kontaminatio-nen wie Dioxine, Pestizide, Schwer-metalle und Konservierungsmittel wie Parabene. Dazu kommt die Mi-gration von hormonwirksamen Substanzen aus Verpackungen.
Xenohormone in Kunststoffen für Verpackungen sind entweder:• in der EU für den Lebensmittel-
kontakt zugelassen (Tabelle) oder • Verunreinigungen (non inten-
tionally added substances, NIAS): geringe Konzentrationen, die durch kontaminierte Aus-gangsmaterialien oder Nebenre-aktionen der Polymerisation eingeschleppt werden oder durch Abbauprozesse entstehen.
In Papier gelangen Xenohormone vor allem beim Recyclingprozess
Johannes Bergmair, Manfred Tacker, Michael Washüttl
Hormonell aktive Inhaltsstoffe in Verpackungsmaterial können in Lebensmittel übergehen und werden
wegen ihrer möglichen gesundheitlichen Auswirkungen diskutiert. Mit einer Kombination von In-vitro-
Tests und chromatographischen Verfahren lassen sich Werkstoffe im Lebensmittelkontakt analysieren
und bewerten.
Xenohormone aus Verpackungen
BAnalytikV
VV Verpackungen aus Papier, Kunststoff oder la-
ckierten Metallen können hormonaktive Sub-
stanzen (Xenohormone) enthalten, die ins Le-
bensmittel wandern.
VV Die Kombination von In-vitro-Verfahren wie
Yeast Estrogen Screen (YES) sowie Yeast An-
drogen Screen (YAS) und Chromatographie iden-
tifiziert Xenohormone in Migraten.
VV Screeningtests liefern nur Hinweise darauf, dass
endokrine Disruptoren vorliegen. Sie können den
Tierversuch nicht ersetzen.
b QUERGELESEN
Nachrichten aus der Chemie| 60 | September 2012 | www.gdch.de/nachrichten
898

durch Kontamination mit Druck-farben und Klebstoffen. Obwohl Recyclingkarton hauptsächlich als Umverpackung dient und der Großteil der darin verpackten Le-bensmittel noch in einem Innen-beutel stecken, können Xenohor-mone aus dem Karton ausdampfen, durch den Innenbeutel migrieren und so Lebensmittel wie Müsli, Ze-realien und Kindernahrung konta-minieren. So wurden etwa in Back-waren oder Mehl bis zu 2 mg·kg–1 Di-n-Butylphthalat nachgewiesen4)
oder in Säuglingsnahrung bis zu 1,8 mg·kg–1 DIBP (Di-i-Butylphtha-lat) festgestellt.5)
Besonders gut untersucht ist der hormonelle Effekt von Bisphenol A (BPA). In Lebensmittelverpackun-gen kommt BPA vor allem in Poly-carbonatbehältnissen sowie in epoxybeschichteten Metalldosen vor (Getränke- und Konservendo-sen). Während die US-Institutio-nen National Institute of Health (NIH) und Endocrine Society die Bisphenol-A-Belastung der Bevöl-kerung, vor allem von Säuglingen und Kleinkindern, als Anlass zur Sorge sehen,6) hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Efsa den zulässigen Grenzwert von 600 µg·kg–1 Lebensmittel bestätigt.
Der Efsa-Grenzwert wird allerdings derzeit wieder evaluiert.
Die Europäische Kommission hat trotz der Beibehaltung des Grenzwerts durch die Efsa aus Vor-sichtsgründen verboten, Babytrink-flaschen aus Polycarbonat in Ver-kehr zu bringen. Europäische Län-der wie Frankreich, Belgien und Schweden haben nationale Rege-lungen beschlossen, die BPA in Le-bensmittelkontaktmaterialien für Kindernahrung verbieten.
Relativ häufig kommen Phthala-te in Lebensmittelverpackungen vor, etwa in Twist-off-Verschlüssen sowie in Druckfarben und Kleb-stoffen. Fetthaltige Lebensmittel, die mit Twist-off-Verschlüssen ver-schlossen sind, enthalten bis zu 270 mg·kg–1 DiNP (Diisononyl -phthalat) sowie 825 mg·kg–1 DEHP (Diethylhexylphthalat). Diese Wer-te liegen weit über den geltenden EU-Grenzwerten.7)
Auch in Mineralwässern wurden hohe Konzentrationen von mehr als 10 ng·L–1 Xenohormonen entdeckt. Wässer lassen sich aufgrund der einfachen Matrix gut mit In-vitro-Tests untersuchen. Eine Studie in Deutschland fand bis zu 75 ng·L–1 17-ß-Östradioläquivalente im hefe-basierten Rezeptorgenassay YES (Ye-
Yeast Estrogen Screen (YES): Vergleich der EC-50-Kurven von 17-ß-Östradiol und den Xeno-
hormonen BPA (Bisphenol A), Benzophenon, BBP (Butyl-Benzyphthalat), NP (Nonylphenol)
und DBP (Dibutylphthalat). Das natürliche Hormon wirkt bei deutlich geringeren Konzen-
trationen als Xenohormone.
Nachrichten aus der Chemie| 60 | September 2012 | www.gdch.de/nachrichten
899Analytik BBlickpunktV

ast Estrogen Screen).8) Eine kürzlich publizierte nordirische Studie fand bis zu 34 ng·L–1 17-ß-Östradioläqui-valente mit einem auf einer huma-nen Zelllinie basierenden Rezeptor-genassay. Zusätzlich wurden hier hohe Konzentrationen an Andro-genagonisten und -antagonisten so-wie Progestagen- und Glucocorti-coidagonisten festgestellt.9) Welche Xenohormone diese Aktivitäten her-vorrufen, ist nicht bekannt.
Analytik
b Für das Screening von Migraten aus Lebensmittelkontaktmateria-lien auf Xenohormone eignen sich hefebasierte Rezeptorgenassays wie YES, Yeast Androgen Screen (YAS), Rezeptorgenassays auf Basis von humanen Zelllinien (z. B. ER-CA-LUX) oder Zellproliferationsassays wie E-Screen.
Allen Rezeptorgenassays ist ge-meinsam, dass ein künstlich in die Zellen eingebrachter Rezeptor (et-wa der humane Östrogenrezept-or-�) durch die Bindung eines Xe-nohormons ein Signal hervorruft (z. B. Farbentwicklung oder Luci-feraseexpression).
In diesen Assays wirken Xeno-hormone weit schwächer als natür-liche Hormone. So benötigt Bisphe-nol A im YES etwa die 5000-fache Konzentration wie 17-ß-Östradiol, um die gleiche Wirkung hervorzu-rufen (Abbildung S. 899).
In-vitro-Tests bilden allerdings nur einen eingeschränkten Bereich der Hormonwirkung ab. Bei Rezep-torgenassays ist das hauptsächlich die Fähigkeit, am Rezeptor anzudo-cken. Diese Assays erfassen andere hormonelle Effekte nicht, etwa den Einfluss auf die Hormonbiosynthe-se, auf die Aufnahme durch den Or-ganismus oder auf den Hormonab-bau. Es ist deshalb nicht möglich, alleine aus dem Ergebnis eines In-vitro-Tests auf gesundheitliche Auswirkungen zu schließen.
Die chemische Analytik von Xe-nohormonen ist schwierig, da diese in ihrer chemischen Struktur oft nicht bekannt sind und in einer komplexen Matrix vorliegen, im Lebensmittel selbst oder im Le-bensmittelkontaktmaterial.
Das Österreichische Forschungs-institut für Chemie und Technik entwickelt im Rahmen eines von der Österreichischen Forschungsförde-rungsgesellschaft (FFG) geförderten Projekts die Grundlagen für die Analytik von Migraten aus Lebens-mittelkontaktmaterialien. Unterneh-men der Lebensmittelwirtschaft, Verpackungs- und Rohstoffhersteller sowie Unternehmen des Lebensmit-telhandels unterstützen das Projekt.
Basis für das In-vitro-Screening sind validierte Verfahren zur Proben-vorbereitung (Konzentrierung durch Festphasenextraktion um den Faktor 10 000). Die Konzentrate können dann direkt in Rezeptorgenassays für verschiedene Hormonachsen einge-bracht werden, die ihre Xenohor-monaktivität bestimmen.
Parallel dazu wurden GC-MS- und LC-MS-Multimethoden entwi-ckelt, die sowohl die 30 häufigsten in Kunststoffen vorkommenden Xe-nohormone quantifizieren als auch unbekannte Substanzen mit einem Gehalt von mehr als 10 ppb im Mi-grat semiquantitativ erfassen. Mit diesen Methoden werden derzeit
Lebensmittelverpackungen unter-sucht und die Hormonaktivität von Migraten aus verschiedenen Werk-stoffen festgestellt. Diese Ergebnisse sollen zur Bewertung von Lebens-mittelkontaktmaterialien beitragen und die Grundlage für weitere Opti-mierungen liefern.
Johannes Bergmair studierte Lebensmittel-
und Biotechnologie an der Universität für Bo-
denkultur in Wien und schloss mit einer Di-
plomarbeit am Institut für Lebensmitteltech-
nologie ab. Am Österreichischen Forschungsin-
stitut für Chemie und Technik (ofi) promovierte
er in Zusammenarbeit mit der TU Wien über
Qualitätsmanagement bei Lebensmittelverpa-
ckungen. Seit dem Jahr 2002 leitet er das Ver-
packungsinstitut im ofi und betreut seit 2004
dort auch den Fachbereich Life Science.
Manfred Tacker studierte Biochemie an der
Universität Wien und habilitierte in Lebensmit-
teltechnologie mit Spezialgebiet Lebensmittel-
verpackung an der TU Wien. Nach Tätigkeiten
in der pharmazeutischen Industrie wurde er In-
stitutsleiter des Verpackungsinstitutes und
war bis zum Jahr 2011 Geschäftsführer des ofi.
Seit 2011 ist er selbstständiger Berater.
Michael Washüttl studierte Lebensmittel- und
Biochemie an der Technischen Universität
Wien. Seit er seine Diplomarbeit am Institut
für Lebensmittelchemie und -technologie ab-
geschlossen hat, ist er am ofi tätig. Dort been-
dete er im Herbst 2001 seine Dissertation über
modifizierte atmosphärische Verpackungen.
Seine Fachgebiete sind Lebensmittelrecht so-
wie aktive und intelligente Verpackungen.
Literatur
1) Weybridge 1996: European Workshop
on the impact of endocrine disruptors
in human health and wildlife, Report of
the proceedings 1.-4. Dezember 1996,
Report EUR 175497.
2) J. Lintelmann, A. Katayama, N. Kurihara,
L. Shore, A. Wenzel, Pure Appl. Chem.
2003, 60, 631.
3) A. K. Hotchkiss, Toxicol. Sci. 2008, 105, 235.
4) M. F. Pocas, J. C. Oliveira, J. R. Perreira, T.
Hogg, Food Addit. Contam. Part A 2010,
27, 1451.
5) F. Grün, B. Blimberg, Mol. Cell. Endocri-
nol. 2009, 304, 19.
6) E. Diamanti-Kandarakis, J. P. Bourgignon,
L. P. Giudice et.al., Endocrinol. Rev. 2009,
30, 293.
7) J. H. Petersen, L. K. Jensen, Food Addit.
Contam. Part A 2010, 27, 1608.
8) M. Wagner, J. Oehlmann, J. Steroid Bio-
chem. Mol. Biol. 2009, 16, 278.
9) M. Plotan, F. Frizzell, V. Robinson, C. T. El-
liott, L. Conolly, Food Chem. 2012, im
Druck, DOI: 10.1016/j.foodchem.
2012.01.115
10) J. Muncke, Sci. Total Environ. 2009, 407,
4549.
In der EU für den Lebensmittelkontakt zugelassene Substanzen, die
als potenzielle endokrine Disruptoren gelten (adaptiert aus: Lit.10))
Substanz CAS Bisphenol A 80-05-7 Dibutylphthalat (DBP) 84-74-2 Butylbenzylphthalat (BBP) 85-68-7 4-tert-Butylphenylsalicylat 87-18-3 2,2’-Methylenbis(4-ethyl-6-t-butylphenol) 88-24-4 4,4’ Biphenol 92-88-6 Propylparaben 94-13-3 4,4’-Thiobis(6-t-butyl-3-methylphenol) 96-69-5 Methylparaben 99-76-3 p-Hydroxybenzoesäure 99-96-7 Diethylhexyladipat 103-23-1 p-Kresol 106-44-5 1,4-Dichlorbenzol 106-46-7 Resorcinol 1,3-dihydroxybenzol 108-46-3 Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 117-81-7 2,2’-Methylenbis(4-methyl-6-t-butylphenol) 119-47-1 Benzophenon 119-61-9 Ethylparaben 120-47-8 Propylgallat 121-79-9 Isophtalsäure 121-91-5 2,20-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon 131-53-3 2,4-Dihydroxybenzophenon 131-56-6 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon 131-57-7 9-Octodecenamid 301-02-0 p-Cumylphenol 599-64-4 4,4’-Dihydroxybenzophenon 611-99-4 t-Butylhydroxyanisol (BHA) 25013-16-5 Diisodecylphthalat (DiDP) 26761-40-0
Nachrichten aus der Chemie| 60 | September 2012 | www.gdch.de/nachrichten
900 BBlickpunktV Analytik
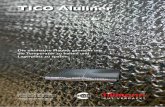

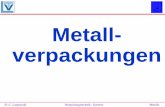







![Der Wellpappendirektdruck Kr [Kompatibilitätsmodus] · • Nr. 1 im Bogenoffset-Großformat ... für Drucken, Lackieren, Trocknen und Logistik von Blechtafeln (Verpackungen aus Aluminium,](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f1e5937215d0033b35c6185/der-wellpappendirektdruck-kr-kompatibilittsmodus-a-nr-1-im-bogenoffset-groformat.jpg)








